
Franz Oppenheimer, Der Staat (1926)
 |
 |
| Franz Oppenheimer (1864-1943) |
[Created: 15 October, 2022]
[Updated: April 30, 2023 ] |
The Guillaumin Collection
 |
This title is part of “The Guillaumin Collection” within “The Digital Library of Liberty and Power”. It has been more richly coded and has some features which other titles in the library do not have, such as the original page numbers, formatting which makes it look as much like the original text as possible, and a citation tool which makes it possible for scholars to link to an individual paragraph which is of interest to them. These titles are also available in a variety of eBook formats for reading on portable devices. |
Source
, System der soziologie. Zweiter Band: Der Staat (Jena: G. Fischer, 1926).http://davidmhart.com/liberty/GermanClassicalLiberals/Oppenheimer/1926-DerStaat/index.html
This title is also available in a facsimile PDF [139 MB] of the original and various eBook formats - HTML, PDF, and ePub.
Part of: Franz Oppenheimer, System der soziologie (Jena: G. Fischer, 1922-35)
- 1 bd. Allgemeine Soziologie. 1. halbbd. Grundlegung. 2. halbbd. Der soziale Prozess (1922-23)
- 2. bd. Der Staat (1926)
- 3. bd. Theorie der reinen und politischen ökonomie. 5., völlig neu bearb. aufl. (6-8. tausend) 1. halbbd. Grundlegung. 2. halbbd. Die Gesellschafts-wirtschaft (1923-24)
- 4.bd. Abriss einer sozial- und wirtschaftsgeschichte Europas von der Völkerwanderung bis zur Gegenwart. 1. abt. Rom und die Germanen (1929). 2 abt. Adel und Bauernschaft: das Mittelalter (1933). 3 abt. Stadt und Bürgerschaft (1935).
This book is part of a collection of works by Franz Oppenheimer (1864-1943).
Editor's Note
Due to the length of the book and the large number of footnotes I have kept formatting to a minimum. The footnotes are not linked, “pages” are retained and the “footnotes” are located beneath the page separated by a horizontal line.
Inhaltsverzeichnis [short]
[iii-vi]
Vorwort (S. vii-x)
Erster Abschnitt: Begriff und Methode. (S. 1-23)
Zweiter Abschnitt: Die Klassenordnung. (S. 24-307)
Dritter Abschnitt: Der primitive Eroberungsstaat. (S. 308-366)
Vierter Abschnitt: Der Seestaat. (S. 367-505)
- I. Die Bedingungen des Seestaates (Handel und Schiffahrt) 367
- II. Die Entstehung des Seestaates 375.
- III. Die Entwicklung des Seestaates 385
- IV. Der Untergang des Seestaates (Die kapitalistische Sklavenwirtschaft) 416
Fünfter Abschnitt: Der Landstaat. (S. 506-644)
- I. Der Feudalstaat 506
- II. Die weiter entwickelnden Kräfte 546
- III. Der Ständestaat 560
- IV. Der absolute Staat 590
Sechster Abschnitt: Der moderne Verfassungsstaat. (S. 645-725)
- I. Begriff 645
- II. Die Statik (Der Klassenstaat) 648
- III. Die Kinetik (Der Gruppenkampf) 651
- IV. Der kapitalistische Dissensus 675
Siebenter Abschnitt: Die klassenlose Gesellschaft. (S. 726-811)
Literatur 813
[vii]
Vorwort.
Mit diesem Bande liegt die theoretische Soziologie fertig vor. Der erste Band, die „Allgemeine Soziologie“, (1922/3) gibt Begriff und Methode, die psychologische Grundlegung und durch sie die Einsicht in die Ziele der Gruppenhandlung; und soviel von allgemeiner Historik, wie erforderlich ist, um die treibenden Kräfte und die Stufen der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft im groben zu verstehen. Der zweite und dritte Band stellen die Mittel dar, deren sich die entfalteten Gesellschaften bedienen, um jene Ziele zu erreichen: dieser zweite Band das entfaltete politische Mittel, den Staat, und der dritte, schon vorliegende (1923/4) das entfaltete ökonomische Mittel, die Gesellschaftswirtschaft.
Was jetzt zu folgen hat, um das System zu vollenden, ist die Anwendung der gewonnenen Prinzipien und Einsichten auf die noch übrigen Gesellschaftswissenschaften. Von diesen muß ich die Soziologie der Sprache endgültig anderen Kräften überlassen: ich habe keine Aussicht mehr, mich der dazu erforderlichen ungeheuren Kenntnisse zu bemächtigen ; außerdem stellen sich mir Aufgaben, deren Bewältigung mir viel dringlicher erscheint:
Vor allem sind meine Ergebnisse an den Tatsachen der Geschichte noch viel genauer zu prüfen, als es in den vorliegenden Bänden geschehen konnte. Und zwar scheint mir die dringlichste Aufgabe eine politische Geschichte der kapitalistischen Staatsgesellschaften der Neuzeit. Der hier vorliegende Band zeigt an der Geschichte des antiken Stadtstaates, wie ich mir die Lösung der Aufgabe denke, und enthält bereits eine Skizze der Entwicklung des modernen Staates, die nun aber mit ungleich größerer Genauigkeit und mit viel tiefer greifender Analyse womöglich aller erfaßbaren Einzelformen ausgestaltet und eben dadurch der schärfsten Prüfung auf ihren Wahrheitsgehalt unterzogen werden soll.
Ich habe mich dabei der Mitarbeit eines bewährten und anerkannten Historikers, meines verehrten Kollegen Fedor Schneider, versichert, der sich von der Fruchtbarkeit der soziologischen Grundlegung als eines mächtigen Prinzips für die Auffindung und Ordnung des [viii] geschichtlichen Urstoffs überzeugt hat. Diese Kooperation wird mich vor der naheliegenden Gefahr schützen, trotz allen guten Willens meine Ideen in die Geschichte hineinzusehen. Unser Ausgangspunkt wird die jetzt völlig gesicherte Überzeugung sein, daß das „Gesetz der ursprünglichen Akkumulation“ in seinen beiden Gestalten ein Pseudo- gesetz ist: sowohl als Lehre von der Entstehung der Klassen und daher des Klassenstaates wie als Malthussches Bevölkerungsgesetz. Wir werden, nach Justus Mosers methodischem Rat, überall versuchen, die Verteilung des Grundeigentums und die damit eng zusammenhängende Gestaltung der Standesverhältnisse als die Grundlage aller weiteren Untersuchung mit möglichster Genauigkeit festzustellen und daraus die einzelne Entwicklung zu verstehen, soweit es ohne Zwang geschehen kann. Das heißt: wir sind entschlossen, ohne jede Rücksicht auf die vorläufigen Ergebnisse der schon vorliegenden Bände nur die Tatsachen sprechen zu lassen und jede, unserer eingebrachten Grundanschauung etwa widersprechende, Einzelheit ins hellste Licht zu rücken und selbstverständlich, wenn es nötig sein sollte, jene Anschauung klar zu widerrufen. Wir werden, um bis an die Wurzeln der uns interessierenden Erscheinungen zu kommen, mit der Übergangszeit von der Antike zum frühen Mittelalter zu beginnen haben.
Welchen Umfang diese Untersuchung gewinnt, und wie lange sie uns beschäftigen wird, können wir auch nicht im entferntesten ermessen. Es kann wohl sein, daß sie den Rest der mir beschiedenen Arbeitszeit in Anspruch nehmen wird.
Sollte mir Zeit und Kraft bleiben, und ich einen zuverlässigen Mitarbeiter finden, so könnte ich vielleicht noch wenigstens eine Aufgabe lösen, die mir am Herzen liegt: die Soziologie des Rechts. Wenn mir das gelingen sollte, so wird damit eine andere Teilaufgabe in der Hauptsache mitgelöst sein, der ich früher einen eigenen Band zu widmen gedachte: der Soziologie der Ideologien. Es hat sich während der Arbeit herausgestellt, daß es unumgänglich war, sie zum großen Teile in die ersten Bände mit hineinzuarbeiten, schon aus dem zwingenden Bedürfnis der kritischen und antikritischen Sicherung der eigenen Ergebnisse. Die drei vorliegenden Bände enthalten in den Hauptzügen bereits eine soziologisch orientierte Dogmengeschichte der allgemeinen Soziologie, der Staatslehre, der Ökonomik und des Sozialismus und Ansätze zu einer solchen der Historik, die übrigens mein Schüler, Gottfried Salomon, in seiner Skizze „Geschichte als Ideologie“ bereits weiter ausgestaltet hat. Ich bin in diesen dogmengeschichtlichen Erörterungen sogar etwas weiter gegangen, als vom Gesichtspunkt der bloßen Sicherung erforderlich gewesen wäre: meine Absicht war überall, dadurch, daß ich alle Autoren von Rang ausführlich zu Wort kommen ließ, wo sie Eigenes zu sagen hatten, dem nicht fachlich [ix] interessierten Leser den Rückgriff auf die ältere Literatur zu ersparen und dem werdenden Soziologen den Zugang zu ihr nach Möglichkeit zu erschließen. Wenn ich das gleiche Verfahren noch in der Soziologie des Rechtes durchführen könnte, wäre damit auch die Soziologie der Ideologien soweit gefördert, daß wenigstens ich auf eine Zusammenfassung und Vertiefung wohl guten Gewissens verzichten dürfte: ars longa, vita brevis!
Das sind die beiden großen Aufgaben, die ich noch die Hoffnung haben darf, wenn nicht zu vollenden, so doch zu fördern. Aber ganz ferne am Horizont winken und locken noch andere : zunächst der zweite Hauptteil der praktischen Soziologie: die Sozialpädagogik. Ihr erster, die Politik, ist in ausführlicher Skizze in diesem Bande, im siebenten Abschnitt, als meine „Utopie“ enthalten.
Vor allem aber gehört zu dem System der Soziologie, als der Lehre von den objektiven Werten: Staat, Wirtschaft und Recht, als seine Ergänzung ein System der Sozialphilosophie, als die Lehre von den absoluten Werten: Philosophie, Kunst, Religion. Diese Aufgabe aber wird mit höchster Wahrscheinlichkeit einem anderen zufallen müssen. Ich wäre froh, wenn sie noch zu meinen Lebzeiten gelöst würde. Ich derelinquiere den großen Gegenstand.
Vor sechzehn Jahren erschien meine kleine Skizze der „Staat“. Sie hat ihren Weg erfreulich gemacht, ist mehrfach neu aufgelegt und in viele Sprachen übersetzt worden und hat sich in aller Welt zahlreiche Freunde erworben. Ich habe sie fast zur Gänze in diesen Band hineingearbeitet. Irgend Wichtiges habe ich nicht zu ändern gefunden, konnte auch die Disposition in der Hauptsache beibehalten. Ich habe eine ausführliche Darstellung der soziologischen Staatstheorien vorausgeschickt, wobei ich die juristischen Lehren nur soweit miterfaßte, wie es mir unerläßlich schien ; und habe die kurzen Hinweise auf geschichtliche Tatsachen, die sich bereits in der Skizze fanden, zu größerer Ausführlichkeit ausgestaltet. Der Leser findet hier neu die Geschichte des antiken Stadtstaates und der Übergänge vom Feudalstaat zum Verfassungsstaat : Ständestaat und absoluter Staat. Er findet ferner eine viel ausführlichere Darstellung des modernen Verfassungsstaates und der klassenlosen Gesellschaft, an deren baldiger Verwirklichung ich nicht zweifle; jene soeben erwähnte „Utopie“. Was darüber grundsätzlich zu bemerken ist, ist im Text gesagt. Ich weiß, daß ich mich wieder eines schlimmen Verbrechens schuldig gemacht habe, und, horribile dictu!, ich empfinde keinerlei Reue. Ich werde im Gegenteil mit Vergnügen bei meinen Kritikern lesen, „wie jammerschade es ist, daß ein sonst leidlicher Gelehrter sich durch Träume und Phantasmen vom [x] Wege der echten und allein seligmachenden Wissenschaft abdrängen läßt“ — jener sozialen Wissenschaft, die uns doch zu so herrlichen Menschheitshöhen emporgeführt hat ! Man wird mir wieder oberlehrerhaft Zensuren ausstellen, anstatt nach Gelehrtenart meine Gründe zu diskutieren: man wird mir keine Behauptung nachweisen können, für die ich mich nicht bemüht hätte, Beweise zu erbringen. Es scheint eine verschollene Sage zu sein, daß der Kritiker ein begründetes richterliches Urteil schuldet: Akzeptieren oder Widerlegen, befiehlt das Staatsrecht unserer Gelehrtenrepublik: die Logik!
Meinem Assistenten, Herrn Dr. Julius Kraft, bin ich für seine Hilfe an dem Register und den Korrekturen zu Dank verpflichtet.
Das bibliographische Material findet sich auch hier am Schlüsse des Bandes hinter dem Text. Die Noten zum Text enthalten im allgemeinen nur den Namen des Autors, die Seitenzahl und, wo nötig, ein kurzes, das Buch bezeichnendes Stichwort. S. S. bedeutet mein „System der Soziologie“.
Frankfurt a. M., am 22. Juli 1925.
Franz Oppenheimer.
[1]
Erster Abschnitt.
Begriff und Methode. ↩
I. Grenzbestimmung. ↩
Wir stellen auch hier wieder, wie in den schon vorliegenden Teilen dieses Systems [1], eine Nominaldefinition voraus, die „den Umfang des Begriffes umgrenzt“ und erst durch die gesamte Darstellung zur Realdefinition erhoben werden kann, die „den Inhalt des Begriffes klarlegt“ [2]:
Die soziologische Staatslehre ist die theoretische Wissenschaft von dem historischen Staat.
Indem wir den verborgenen Inhalt dieser Definition analytisch, „explikativ“, entfalten, werden wir nicht nur den äußeren Umfang unserer eigenen Disziplin bestimmen, sondern auch feststellen, welche anderen Sozialwissenschaften an sie grenzen: Nachbarwissenschaften, die uns für unsere Betrachtung als Hilfswissenschaften dienen werden, wie unsere Disziplin ihnen in ihren besonderen Aufgaben.
Wir nehmen zunächst ein rein äußerliche Abgrenzung des durch den Ausdruck „historischer Staat“ im allgemeinen bezeichneten „Erfahrungsobjekts“ [3] vor. Diese Abgrenzung kann nur zeitlich sein. Wir haben weder mit dem vor-, noch mit dem nachhistorischen Staate zu schaffen. Unter dem ersten Ausdruck fassen wir zusammen den subhistorischen „Staat“ der Tiergesellschaften und den prähistorischen „Staat“ der primitiven Menschengruppen. Der erste ist ein Gegenstand der Zoologie und Tierpsychologie, der letzte ein Gegenstand der Ethnographie, Ethnologie und Völkerkunde. Unter dem nachhistorischen Staate verstehen wir erstens den „unhistorischen Staat“ der religiösen und sozialistischen Utopisten und zweitens den „posthistorischen Staat“, den die wissenschaftliche Politik, namentlich der wissenschaftliche Sozialismus, aus der Tendenz der gesellschaftlichen Entwicklung abzuleiten versucht. Der erste ist überhaupt kein Gegenstand der Wissenschaft, sondern nichts als ein Gedankenspiel, das wir gar nicht erwähnt hätten, wenn es nicht zu-
[1] System der Soziologie (in Zukunft bezeichnet als S. S.) I, S. 68 und III, S. 3.
[2] Radbruch, Grundlagen der Rechtsphilosophie, S. 32/33.
[3] S. S. I, S. 146ff. — III, S. 195ff., S. 713L Oppenheimer, System der Soziologie. Band II. I
[2]
weilen, und zwar nicht von Vulgärsozialisten, sondern sogar von Männern wie Heinrich Dietzel [1] und Anton Menger [2], zum Gegenstande einer ernsthaften Untersuchung gemacht worden wäre. Ebensogut könnte man an Goethes Homunkulus Anatomie und Physiologie studieren wollen [3]. Was den „posthistorischen Staat“ anlangt, so wird er uns in einem gewissen Umfang zu beschäftigten haben, aber nicht in der eigentlichen Untersuchung, sondern erst nach ihrem Abschluß, wenn wir unser Recht ausüben werden, aus der sich ergebenden Tendenz der Entwicklung des historischen Staates vorsichtige Schlüsse auf die Veränderungen zu ziehen, die er in übersehbarer Zukunft erleiden dürfte.
Danach bleibt als roher Stoff übrig der Inbegriff der historischen Staaten, von denen uns die Weltgeschichte Kunde gibt. Hier ist eine sachliche Grenzbestimmung zu vollziehen.
Über diese „geschichtlich-gesellschaftliche Wirklichkeit“ haben nach Wilhelm Dilthey [4] die von ihm so genannten „Geisteswissenschaften“ drei verschiedene Aussagen zu machen: historische, indem sie ein Wirkliches aussprechen, das in der Wahrnehmung gegeben ist; — theoretische: durch Abstraktion ausgesonderte Teilinhalte dieser Wirklichkeit; — und praktische, die Werturteile ausdrücken und Regeln vorschreiben.
Da wir unserer Definition zufolge die „theoretische“ Wissenschaft von dem Staate zu treiben haben, fallen sowohl die „historischen“ wie auch die „praktischen“ Aussagen über unseren Stoff außerhalb unseres Gebietes.
Die ersten unterliegen der Bearbeitung durch die politische Geschichte. Sie hat nicht mit „dem“ Staate, sondern mit „den“ Staaten [5], als mit „historischen Individuen“ zu tun, von denen ein jeder ein Einziges, nie Wiederholbares von eigenem Werte ist. Damit ist zugleich alles gesagt, was wir über die Methode unserer Arbeit hier zu sagen haben: sie ist nicht wie die der Historik, „idiographisch“, sondern „nomothetisch“ [6].
[1] Theoretische Sozialökonomik.
[2] Neue Staatslehre.
[3] Konstruktionen wie Platons „Bester Staat“ oder Morus' „Utopia“ gehören in die Geschichte der Staatslehre, aber nicht in die Staatslehre selbst. So urteilte bereits im Altertum Polybius: „So wäre dies gerade, als ob Einer ein Standbild hinstellen und es mit lebenden Menschen vergleichen wollte“. (Nach Gumplowicz, Gesch. der Staatstheorien, S. 38.)
[4] S. S. I, S. 157.
[5] Vgl. Gumplowicz, Allgemeines Staatsrecht, S. 436: „Wir verstehen unter Staatsphilosophie die Wissenschaft vom Staate, aber nicht vom einzelnen Staate, sondern vom Staate als Gattungsbegriff.“
[6] S. S. I, S. 155.
[3]
Ebenso scheiden die praktischen Aussagen aus unserer Betrachtung aus. Sie gehören der Politik an.
Darunter verstand man früher die ganze Lehre vom Staate. So braucht Aristoteles das Wort. „Was sie zusammenfassend behandelt, fällt nach verschiedenen Gesichtspunkten in die Gebiete der Nationalökonomie und des Staatsrechts“ [1]. Die Trennung geschah zuerst faktisch durch Lipsius, der „die Politik unabhängig vom Staatsrechte abhandelte“, und dann vollzog der Holländer Ulrich Huber die Trennung auch terminologisch, indem er die „nova disciplina juris publici universalis“ streng von der Politik unterschied [2]. Dann hat die neueste Zeit den Begriff der Politik noch weiter eingeengt: auf die „Lehre von der Erreichung bestimmter staatlicher Erscheinungen unter bestimmten teleologischen Gesichtspunkten, die zugleich den kritischen Maßstab der staatlichen Zustände und Verhältnisse liefern. Enthält die soziale Staatslehre wesentlich Erkenntnisurteile, so hat die Politik Werturteile zum Inhalt . . . Sie ist zugleich eine Kunstlehre“ [3].
Wir brauchen den Ausdruck in seinem neuen Sinne, als Inbegriff der praktischen Wissenschaften vom Staate.
Hier haben wir noch eine wichtige Unterscheidung zu machen, entsprechend der Doppelbedeutung, die das Wort „praktisch“ hat. Die Politik im Sinne der „praktischen Staatskunst“, die eine Reihe von Klugheitsregeln enthält, aussagend, wie bereits gesetzte Zwecke am besten erreicht werden können, nennen wir mit einem neuerdings in einigen Verruf geratenen, aber kaum zu ersetzenden Worte die „Realpolitik“ [4]. Hier handelt es sich um „hypothetische Imperative“, die nicht unbedingt, sondern nur in Hinsicht auf einen vorgesetzten Zweck Geltung haben [5].
Von dieser Kunstlehre hat schon Grotius die zweite „praktische“ Staatslehre getrennt: „An einigen Orten habe ich zwar das Zweckmäßige auch erwähnt, aber nur flüchtig und im Bestreben, es von der Rechts-
[1] Treitschke, Politik I, S. 2.
[2] Jellinek, Allg. Staatslehre, S. 59. Vgl. Stintzing-Landsberg, Gesch. der deutschen Rechtswissenschaft, 2. Abt., S. 14/15.
[3] Jellinek, a. a. O. S. 13/14.
[4] Der Ausdruck entstammt dem Titel eines von A. L. Rochau verfaßten Buches, „Grundsätze der Realpolitik“ (1853). Vgl. Meinecke, Idee der Staatsräson, S.493. Nach Gumplowicz, Gesch. d. Staatstheorie, S. 376 wäre im gleichen Jahre anonym ein Buch gleichen Titels erschienen, das den sonst unbekannten August Diezel zum Verfasser gehabt habe. Es scheint sich hier um einen Irrtum G.s zu handeln.
[5] Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, ed. Reklam, S. 47. Und zwar würde unsere Realpolitik für ihn umfassen: erstens „Regeln der Geschicklichkeit“ („technische Imperative“) und „Ratschläge der Klugheit“ („pragmatische Imperative“); zusammen ungefähr das, was er als „praktische Anthropologie“ bezeichnet; — aber nicht die „Gebote der Sittlichkeit“ („moralische Imperative“), vgl. a. a. O. S. 48/9.
[4]
frage zu trennen“ [1]. Was er hier unter „Recht“ versteht, ist die Staatslehre im Sinne der „praktischen Philosophie“. Sie ist keine Klugheits- sondern eine Prinzipienlehre; sie enthält nicht hypothetische, sondern kategorische Imperative, und diese beziehen sich nicht nur auf Mittel zu bestimmten Zwecken, sondern vor allem auf die Setzung der Zwecke selbst [2]. Es ist bedauerlich, daß wir keinen passenden Ausdruck für diese Wissenschaft haben; der Terminus „Rechtspolitik“ ist für die Regeln mit Beschlag belegt, denen die Staaten in ihrer gesetzgeberischen Praxis folgen [3]; der Terminus „Staatsphilosophie“ bedeutet herkömmlicherweise den Inbegriff aller nichtjuristischen Wissenschaften von „dem“ Staate [4]; der Terminus „Politik“ schlechthin, den Leonard Nelson [5] für das Gebiet gebraucht, bezieht sich sprachüblich auf die beiden praktischen Disziplinen. Um keinen Zweifel aufkommen zu lassen, was gemeint ist, wollen wir den Ausdruck „philosophische Politik“ wählen, um so mehr, als Nelson selbst, freilich nur im Titel seines großen Werkes, den gleichen Namen braucht, und ferner, weil auch Jellinek den Gegenstand nicht der Lehre vom Staat, sondern der Philosophie zuweist [6]. Das scheint denn auch die heute herrschende Ansicht zu sein: auch Hobhouse lehnt die „Staatsphilosophie als eine unabhängige Disziplin ab“ [7] und verweist sie in die Ethik [8].
Somit scheiden wir auch diese Lehre vom sozusagen „überhistorischen“ Staat aus unserem Arbeitsgebiet aus. Das entspricht der allgemeinen Stellung, die wir in der Grundlegung der Allgemeinen Soziologie (S. 63) eingenommen haben: die Soziologie, als eine rein rationalistische, rein kausal erklärende Seinswissenschaft von der Sozialphilosophie, als einer an Werten orientierten Sollwissenschaft, scharf zu trennen.
Wie wenig — leider! — die Wissenschaft vom überhistorischen Ideal- oder „Rechtsstaate“ mit dem wirklichen Staate, der uns beschäftigt, zu schaffen hat, dafür seien nur zwei, allerdings sehr bezeichnende Zeugnisse angeführt. Fichte beklagt, daß sich so oft unter einer scheinbar rechtmäßigen Staatsform eine Vergewaltigung des Volkes
[1] De jure belli ac pacis, Amstelodami 1701. (Prolegomena 57) S. XXXIII. Vgl. Meinecke, Staatsräson, S. 261.
[2] S. S. I, s. 352.
[3] v. Calker (Rechtspolitik: Hdb. d. Pol. (1. Aufl., S. 12/3) braucht den Ausdruck für die philosophische Politik und nennt das andere „Gesetzgebungspolitik“. Fries (Politik S. 218) sagt „Justizpolitik“.
[4] Vgl. die soeben angeführte Stelle aus Gumplowicz, Allg. Staatsrecht, S. 436. Ich selbst habe früher den Terminus in diesem Sinne gebraucht. Vgl. mein „Staat“ S. 5.
[5] Vorlesungen über die Grundlagen der Ethik, Dritter Band. System der philosophischen Rechtslehre und Politik, Leipzig 1924.
[6] Allg. Staatsl. S. 63.
[7] Die metaphysische Staatsidee S. 75.
[8] Ib., S. 2. Ebenso Lord, Principles of Politics, S. 186.
[5]
„durch die Grundbesitzer und Gemeingenießer“ versteckt: aber „ein solcher Klassenstaat geht den Erleuchteten gar nichts an“ [1]. Er folgt hier seinem Meister Kant, der schreibt: „Nichts kann Schädlicheres und eines Philosophen Unwürdigeres sein als die pöbelhafte Berufung auf vorgeblich widerstreitende Erfahrung, die doch gar nicht existieren würde, wenn jene Anstalten (der Staat) zur rechten Zeit nach den Ideen getroffen würden, und an deren Statt nicht rohe Begriffe, eben darum, weil sie aus der Erfahrung geschöpft werden, alle gute Absicht vereitelt hätten“ [2].
Was jetzt von dem gewaltigen Stoff, der „gesellschaftlich-geschichtlichen Wirklichkeit“ der Staaten, noch übrig bleibt, ist das gemeinsame Erfahrungsobjekt zweier theoretischer Wissenschaften, aus denen sie sich, durch Auswahl der sie je interessierenden Kennzeichen, je ihr besonderes Erkenntnisobjekt bilden (S. S. HI S. 969).
Die erste ist die der Jurisprudenz angehörige Staatsrechtslehre, insofern sie nicht Norm Wissenschaft, sondern eben theoretische Wissenschaft ist, also dasjenige, was Jellinek als „Allgemeines Staatsrecht“ bezeichnet, das „keine Lehre von einem geltenden Rechte, sondern gleich dem nichtjuristischen Teil der Staatslehre eine Theorie ist, die nicht Normen, sondern wissenschaftliche Sätze enthält“ [3]. Sie interessiert sich ausschließlich für die rechtliche Form des Staates [4]: „Der Jurist kann mit seiner Methode am Staate nur erfassen, was rechtlicher Natur ist [5]“. „Die juristische Erkenntnis des Staates will daher nicht
[1] Zit. nach Metzger, Gesellschaft, Recht und Staat, S. 181.
[2] Krit. d. reinen Vernunft, Zweiter Teil, II. Abt., Buch I. Vgl. Carl Schmitt, Der Sinn des Staates, S. 49: „Für jede prinzipielle, nicht politische Untersuchung, der es auf die philosophische Erkenntnis, nicht auf Parteiziele und -zwecke ankommt, gibt es keinen anderen als den in seiner Idee erfaßten Staat, der sich zu dem, was in der Welt der Tatsachen mit dem Namen „Staat“ belegt wird, nicht als Abstraktion, sondern als sein Sinn verhält, ohne den der konkrete Staat nur eine gewalttätige Macht sein würde, unberechtigt und irrational, von der sich nur sagen ließe, daß sie ein „Wille“ sei, ein Terrorismus, an den wir uns gewöhnt haben, und von dem einige zu profitieren wissen, ein magnum latrocinium mit dem idealen Ziel, sich zur Versicherungsgemeinschaft emporzuentwickeln.“
[3] Allgemeine Staatslehre S. 63.
[4] Hier kann man wirklich einmal in unzweideutiger Klarheit von dem Gegensatz zwischen rechtlicher Form und geschichtlichem Inhalt sprechen. Vgl. über Simmeis und seiner Nachfolger (v. Wiese, Vierkandt) unglücklichen Begriff der „Form“, S. S. I, S. 112.
[5] Jellinek, a. a. O. S. 74. Ebenso v. Mayr, Begriff und Gliederung der Staatswissenschaften, S. 22: „Die juristische Betrachtung des Staates erstrebt die Erkenntnis der formalen Rechtssekretionen. . .“ Ganz analog auch v. Below (Deutscher Staat des Mittelalters, S. 191). Schelling schreibt in seinen „Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums (1803): „Was allein von der Jurisprudenz einer universellhistorischen Ansicht fähig sein möchte, ist die Form des öffentlichen Lebens“, Aufl. von 1813, S. 228). Eine Parallelstelle aus Schelling bringt Quarch, Zur Gesch. und Entw. d. organischen Methode der Soziologie (Berner Dissertation 1901), S. 29.
[6]
sein reales Wesen erfassen, sondern den Staat juristisch denkbar machen, d. h. einen Begriff auffinden, in dem alle rechtlichen Eigenschaften des Staates widerspruchslos zu denken sind“ [1].
Da diese Disziplin zwar von dem historischen Staate ausgeht, aber nur, um alles im eigentlichen Sinne Historische, Geschehene, abzustreifen, und lediglich das Zeitlose, nämlich die Rechtsform, zum Objekt ihrer Untersuchungen zu machen, könnte man sie als die Lehre von dem „nicht-historischen“ Staat bezeichnen.
Was nun noch übrig bleibt, „die Erfassung des realen Wesens des Staates“, ist der Gegenstand der soziologischen Staatslehre, ist der „historische“ Staat, betrachtet gerade in bezug auf das, was an ihm geschichtlich ist: seine Entstehung, sein Wachstum, die Stufen seiner Entwicklung, und, soweit Wissenschaft Voraussagen wagen darf, seine Zukunft.
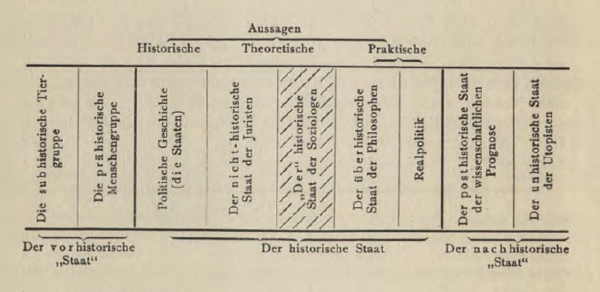
[Der vorhistorische „Staat“ | Der historische Staat | Der nach historische „Staat“]
Diese Grenzbestimmung steht in fast allen Punkten mit der herrschenden wissenschaftlichen Meinung in voller Übereinstimmung. Wir wollen das zuerst an der sachlichen, dann an der zeitlichen Grenzbestimmung nachweisen.
Die erste betrifft die Grenzen gegen den überhistorischen Philosophen-, den nicht-historischen Juristenstaat und gegen die „Realpolitik“.
Schon Robert v. Mohl hat vier Teile der Staatslehre unterschieden : Allgemeine Staatslehre, Staatsrecht, Staatssittenlehre, und Staatskunst. Konstantin Frantz wirft dieser Teilung „sehr erhebliche“ logische und materielle Mängel vor [2]. Materiell, weil Mohl keine ge-
[1] Jellinek, a. a. O. S. 163.
[2] Die Naturlehre des Staates S. 2/3.
[7]
nügende Erklärung gebe, was seine „allgemeine Staatslehre“ bedeute; und logisch sei es unerlaubt, das Allgemeine dem Besonderen, und die praktische Kunstlehre der Theorie zu koordinieren.
Er selbst scheidet streng zwischen der Kunstlehre und der Theorie und fordert für diese die Dreiteilung in die „Naturlehre“, Rechtsund Sittenlehre, wobei die Naturlehre die Grundlage der beiden anderen sein müsse, „so gewiß als das physische Individuum doch das eigentliche Substrat des Rechtssubjektes und Staatsbürgers ist, für welche die Rechtslehre und die Sittenlehre bestimmt sind“ (S. 8).
Um ebenso streng gegen ihn zu sein, wie er gegen v. Mohl war, so wäre zu sagen, daß es logisch nicht korrekt ist, die praktische Sittenlehre den beiden anderen theoretischen Disziplinen zu koordinieren. Aber das ist hier, wie eine sofort anzuführende Stelle zeigt, nur ein Lapsus; Frantz unterscheidet sehr wohl zwischen dem Sein und dem Sollen.
Was uns vor allem interessiert, ist, daß Frantz' „Naturlehre“ ungefähr und grundsätzlich unserer Soziologie des Staates entspricht. Das Wort wird freilich vermieden, obwohl Frantz unzweifelhaft stark von Comte beeinflußt ist, den er auch gelegentlich (z. B. S. 455) zitiert. Wie dieser geht er auf den vergesellschafteten Menschen mit seinen Trieben zurück und sieht, daß diese Triebe echte Kräfte sind. Wie dieser ist er in der Geschichtsauffassung Antiheroist und Kollektivist; wie dieser ist er ein Verächter der idealistischen Philosophie, namentlich Hegels, aber auch der anderen, sogar Kants, und ein Schwärmer für die naturwissenschaftliche Methode. Ganz Comteisch ist auch seine vermittelnde, halb aristokratische, halb liberale Stellung gegenüber dem Feudalismus und bürgerlichen Liberalismus. Ferner hat er die Lehren vom Primat des Intellekts über die Ökonomie und vom Consensus. Und schließlich ist auch sein Ausgangspunkt die europäische Krise (der Ausdruck findet sich z. B. S. 236) und die Sehnsucht nach der „Begründung einer neuen Ordnung, die Dauer verspräche“ (S. III).
Die Naturlehre „sieht den Staat für ein physisches Wesen an“ (12/3) ; er entsteht durch natürliche Kräfte und ist nach seiner Grundlage ein Naturprodukt (15). Das ist ganz im Geiste der „Physique Sociale“ Comtes gedacht [1]. Wobei, um Mißverständnisse zu verhüten, daran erinnert sei, daß schon Comte selbst (und um wievielmehr sein deutscher Schüler) nicht etwa ausschließlich mit physikalischen, sondern fast durchaus mit sozialpsychologischen Kräften rechnet. Dementsprechend sagt denn auch Frantz — und hier tritt der romantische Einschlag aller Soziologie klar zutage —: „Durch seine Geschichte ist jeder Staat geworden, was er ist, und alle Veränderungen, die er
[1] Vgl. S. S. I, S. 8ff. besonders S. 11.
[8]
in Zukunft noch erfahren mag, sind dadurch bedingt. Er kann nicht jede beliebige Gestalt annehmen, sondern seine angemessene Gestalt kann immer nur aus ihm selbst hervorgehen. Denn überhaupt existieren die Staaten nur als Individuen, und ihr individueller Charakter gehört zu ihrem Wesen“ (49)[1].
So kommt Frantz zu seiner klaren Dreiteilung, die auch den oben gerügten kleinen Mangel vermeidet: „Der Staat ist daher nach seiner physischen Seite ein Produkt zu nennen, nach seiner rechtlichen Seite eine Anstalt, nach seiner moralischen eine Aufgabe, weil das Moralische immer ein Sollen bleibt“ (54). Oder, anders ausgedrückt: Man kann die Naturlehre als den realen Teil des Systems bezeichnen, und eben darum muß sie den Ausgangspunkt bilden; die Sittenlehre hingegen ist der ideale Teil, der das Ziel der Entwicklung enthält, während die Rechtslehre als der formale Teil dazwischen liegt. Denn durch die Form wird das Reale dem Idealen zugeführt, oder das Ideale in das Reale hineingebildet (24) [2].
Georg Jellinek ist auf dem von Frantz beschrittenen Wege weitergegangen. Er leugnet, wie gesagt, die Existenz einer gesonderten philosophischen Staatslehre; das Spekulative gehöre der Philosophie an (63). Ferner scheidet er die Kunstlehre der Politik aus (56). Was übrig bleibt, nennt er die Staatslehre, die in die soziale Staats- und die Staatsrechtslehre zerfällt (11). Wie er die letztgenannte bestimmt und von der Nachbarin abgrenzt, haben wir oben schon mitgeteilt. Die erstere hat „das gegenständliche, historische, wie auch wohl nicht ganz zutreffend gesagt wurde“, (das geht wahrscheinlich gegen Frantz) „das natürliche Sein des Staates zum Inhalte“ (20). Was darunter zu verstehen ist, erfahren wir im Fortgang der Untersuchung: die soziale Staatslehre hat „zum Gegenstande den Staat als soziale Erscheinung. Sie wendet sich den realen, subjektiven und objektiven Vorgängen zu, aus denen das konkrete Leben der Staaten besteht. Man pflegt diese Betrachtungsweise die historisch-politische zu nennen. Sie liegt zugrunde der Staatengeschichte, der Lehre von der Entstehung, Umbildung und dem Vergehen der Staaten, der Erforschung der gesellschaftlichen Voraussetzungen und Wirkungen des Staates sowie seiner einzelnen Elemente und ihres Zusammenhanges. Das Sein und Wirken des Staates in der äußeren und inneren Welt wollen diese hierhergehörigen Disziplinen erfassen“ (S. 137/8).
[1] Ebenso Gumplowicz, Gesch. d. Staatsth., S. 226. Das ist die Auffassung der gesamten neueren Historik, der wir uns in historischem Betracht völlig anschließen. Vgl. Meinecke, Staatsräson, passim, Small, Gen. Sociology, S. 249.
[2] Die letzten Worte klingen allerdings nicht im mindesten Comteisch. Sie könnten eher von Schelling stammen: „Geschichte als Wissenschaft besitzen nur solche Wesen, die eine Aufgabe, ein Ideal zu verwirklichen haben“ (Quarch, a. a. O., S. 38).
[9]
In diesen Sätzen ist einigermaßen zutreffend der Umfang des Gebiets beschrieben, das wir als Soziologie des Staates bezeichnen. Nur einigermaßen zutreffend ! Jellinek, der wie seine ganze Generation [1] die eigentümliche Stellung der Soziologie als „Erkenntnistheorie“ und zugleich Synthese der Sozialwissenschaften nicht erkennt oder nicht anerkennen will, kann nicht klar zwischen der zugrundeliegenden und den auf ihr fußenden Wissenschaften, vor allem der Staatengeschichte unterscheiden. Der aufmerksame Leser erkennt das an dem Schwanken des Ausdrucks: bald ist von „dem“ Staate, und bald von „den“ Staaten die Rede.
Die Existenz dieser sozialen Staatslehre wird mit großer Energie gegen den Anspruch vieler juristischer Staatslehrer verfochten, die die ganze Staatstheorie für ihre Wissenschaft beanspruchen, wie auf der anderen Seite jede gleichgerichtete Einseitigkeit von „historischer, soziologischer, politischer“ Seite ebenso kräftig abgelehnt wird [2].
Die „rein formal-juristische Betrachtung des Staates kann niemals zur Erkenntnis materieller Schranken der Staatstätigkeit gelangen, sie kann keine anderen Schranken anerkennen, als die, welche der Staat sich selber setzt, ist aber außer stände, den Inhalt dieser schrankensetzenden Tätigkeit irgendwie zu bestimmen. Die Existenz solcher Schranken ist erst durch die fortschreitende Erkenntnis der Gebundenheit des Staates durch seine Zwecke nachgewiesen worden“ (239). Insbesondere kann die Theorie des Staates als des Inhabers des „Rechtszwanges“ nicht erkennen, „daß es außer dem Staate noch andere soziale Mächte gibt, die wesentliche Garantien der Erfüllung der Rechtsnormen darbieten. Der nichtorganisierte Druck, den die allgemeine soziale Sitte, die besonderen Anstandsregeln bestimmter Gesellschaftsklassen und Berufe, die kirchlichen Verbände, Presse und Literatur auf das Individuum und die Gesamtheit ausüben, ist viel stärker als aller bewußte vom Staate geübte Zwang. So gewiß einerseits die nichtstaatlichen Garantien allein ohne den staatlichen Zwang die Rechtsordnung nicht aufrechtzuerhalten vermögen, so fiele doch andererseits, wenn der Druck jener sozialen Mächte aufhörte, die Rechtsordnung selbst zusammen, denn der Rechtszwang ist nur ein zur unentbehrlichen Verstärkung der außerstaatlichen Garantien dienendes Element“ [3]. An anderer Stelle wird festgestellt, daß der Staat selbst von der öffentlichen
[1] Z. B. v. Mayr (Begriff und Gliederung) passim.
[2] Allg. Staatslehre, S. 433. Der Hauptführer der ausschließlich juristischen Staatslehre ist zur Zeit Hans Kelsen. Wir werden uns mit seinen überaus scharfsinnigen Darlegungen auseinanderzusetzen haben; indes kann das erst mit Aussicht auf Erfolg geschehen, wenn wir die Erörterung weit genug geführt haben, um nicht mehr nur eine Nominaldefinition, sondern eine Realdefinition des Staates zu besitzen.
[3] A. a. O., S. 335/6.
[10]
Meinung (103, 125), der Sitte und dem Herkommen (789), von dem Druck der internationalen Beziehungen (336/7, 387, 479), und schließlich von den Konstanten des Rechts (375) sehr stark abhängig ist, was die rein juristische Betrachtungsweise niemals erkennen kann. Und darum stellt sich die „soziale Betrachtungsweise. . . als notwendiges Korrektiv der juristischen dar“ (125).
Wir möchten diesen Sätzen, die wir vollkommen annehmen, da sie bestes soziologisches Gedankengut enthalten, Gedanken, die namentlich von Ross in seiner „social control“ und Eugen Ehrlich in seiner „Soziologie des Rechts“ ausgeführt worden sind, noch hinzufügen, daß ein ebenso notwendiges Korrektiv der juristischen die philosophische Staatsbetrachtung ist. Nur sie kann das von Jellinek nicht erörterte Rätsel lösen, woher die „Konstanten des Rechts“ stammen: „nam universalis effectus universalem requirit causam“ [1] ; nur sie kann zeigen, wie die gelegentlich erwähnten (S. 20) „metaphysischen Zwecke“ in das Bewußtsein des Menschen gelangen; nur sie kann die Frage beantworten, wie das vorstaatliche Recht entsteht [2] : ein Problem, das nicht nur, wie Jellinek angibt, diejenige juristische Staatslehre nicht lösen kann, die den Staat als ein „Rechtsverhältnis“ anschaut, sondern überhaupt keine rein juristische Staatslehre.
Wir halten es auch hier mit Kant: „Man kann alle Philosophie, sofern sie sich auf Gründe der Erfahrung fußt, empirische, die aber, so lediglich aus Prinzipien a priori ihre Lehren vorträgt, reine Philosophie nennen. Die letztere, wenn sie bloß formal ist, heißt Logik ; ist sie aber auf bestimmte Gegenstände des Verstandes eingeschränkt, so heißt sie Metaphysik. Auf solche Weise entspringt die Idee einer zwiefachen Metaphysik, einer Metaphysik der Natur und einer Metaphysik der Sitten. Die Physik wird also ihren empirischen, aber auch einen rationalen Teil haben; die Ethik gleichfalls, wiewohl hier der empirische Teil besonders praktische Anthropologie, der rationale aber eigentlich Moral heißen könnte [3].“
Was wir „Realpolitik“ nannten, nennt Kant also „praktische Anthropologie“. Wir glauben den Terminus nicht verwerten zu können; das Wort Anthropologie hat seit Kants Zeit seine Bedeutung so völlig auf die Naturwissenschaft vom Menschen als einer zoologischen Spezies eingeschränkt, daß es immer mißverstanden werden würde, wollte man es jetzt in seiner älteren Bedeutung gebrauchen, wo es alles Menschlich-Sinnliche umfaßte, so daß nur das Rationale a priori nicht von dem Begriff erfaßt wurde.
Wir sind mit Kant der Überzeugung, daß „die Natur der Wissen-
[1] Grotius, 1. c. I cap. I § 12 (S. 14).
[2] A. a. O., S. 168/9. [3] Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. S. 14.
[11]
schaft es erfordert, den empirischen von dem rationalen Teil jederzeit sorgfältig abzusondern und vor der eigentlichen (empirischen) Physik eine Metaphysik der Natur, vor der praktischen Anthropologie aber eine Metaphysik der Sitten voranzuschicken; . . . daß jede andere Vorschrift, die sich auf Prinzipien der bloßen Erfahrung gründet, . . . zwar eine praktische Regel, niemals aber ein moralisches Gesetz heißen kann . . ., daß es ohne diese Metaphysik der Sitten überall keine Moralphilosophie geben kann“ (S. 16/7). Und schließlich, daß der „Begriff der Verbindlichkeit“, den sich jede nicht derart orientierte Moralphilosophie macht, „freilich nichts weniger als moralisch, aber doch so beschaffen ist, als es in einer Philosophie, die über den Ursprung aller möglichen praktischen Begriffe, ob sie auch a priori oder bloß a posteriori stattfinden, gar nicht urteilt, nur verlangt werden kann“ (18).
Wir sind, soweit wir das vermochten, dieser klaren Forderung gefolgt, indem wir in der Grundlegung unserer allgemeinen Soziologie (S. 349ff., 394ff·) den Hauptinhalt der „Metaphysik der Sitten“ als einer rein rationalen Wissenschaft a priori in der ihr von dem vorgeschrittensten Nachfolger Kants, Leonard Nelson, gegebenen Form dargelegt haben. Auf diese Weise hoffen wir dem in dem letzten Kantzitat implicite enthaltenen Vorwurf, eine „Rechtswissenschaft ohne Recht“ (Nelson) zu lehren, nicht ausgesetzt zu sein.
Wir haben diese Dinge ins Gedächtnis des Lesers zurückrufen müssen, weil es sich hier um die Grenzbestimmung gegen die philosophische Staatslehre handelt. Im eigenen Betriebe unserer soziologischen Staatslehre werden wir sie nicht mehr brauchen; hier kommen wir mit dem aposterioristischen, psychologisch-empirischen Gerechtigkeitsbegriff der „Reziprozität“ aus [1].
Aber wir werden gelegentlich unser Recht ausüben, sozusagen aus dem Ring zu treten, die rein rationalistische, rein kausal vorgehende Methode der Seinswissenschaft Soziologie für einen Moment zu verlassen und auf Grund von eingebrachten Vorurteilen die Erscheinungen des Staates und seines Rechtes zu werten. Wir werden diesen Wechsel des Standpunktes jedesmal ausdrücklich kundgeben, um den Leser, den wir zu überzeugen wünschen, nicht unversehens nur zu überreden. Dann mag er sich erinnern, daß die Vorurteile, die wir in unsere Arbeit einbrachten, nicht uneingestandene Velleitäten, nicht Ausdruck unserer „persönlichen Gleichung“ [2], unserer Erziehung und Klassenlage, oder gar unserer „Rasse“ sind, sondern Vor-Urteile in dem Sinne, daß sie, als a priori begründet, jeder Theorie zugrunde zu liegen haben, und daß sie jede Praxis zu bewerten nicht nur das
[1] Vgl. s. s. I, s. 396.
[2] S. S. I, S. 203.
[12]
Recht, sondern die heilige Pflicht haben, „weil eine andere Moralphilosophie durch diese Vermengung sogar der Reinigkeit der Sitten selbst Abbruch tut und ihrem eigenen Zwecke zuwider verfährt“ [1]. Es gibt keinen anderen Ausweg aus den Wirren und Nöten unserer schweren Zeit, als daß der unselige Relativismus der Ethik wieder, wie zu Kants Zeit und durch Kants Verdienst, durch den Absolutismus des Pflichtgebots des Sittengesetzes, der Gerechtigkeit, vernichtet wird: „Ohne reine Philosophie ist es sogar im bloß gemeinen und praktischen Gebrauche, vornehmlich der moralischen Unterweisung, unmöglich, . . . reine moralische Gesinnungen zu bewirken und zum höchsten Weltbesten den Gemütern einzupfropfen [2].“
Um nach dieser notgedrungenen Abschweifung wieder zu unserem Gegenstande zurückzukehren, so unterscheidet auch Kistiakowski in seiner wohlbekannten tiefgründigen Untersuchung [3] ganz wie Jellinek zwischen der juristischen und der soziologischen Staatslehre: „Die Erkenntnis der rechtlichen Bedeutung und der gesellschaftlichen Natur des Staates bilden zwei vollständig unvereinbare Wissenszweige.“ Und Ludwig Gumplowicz hat zwar einmal in hitziger Kämpferstimmung behauptet, die Staatslehre sei, „die Juristen mögen darüber zetern wie sie wollen, keine juristische Disziplin, sondern eine reine Naturwissenschaft“ [4]. Aber bei ruhiger Überlegung sagt doch auch er: „Es können
[1] Kant, a. a. O. S. 17.
[2] Grundlegung zur Metaphysik der Sitten S. 44. Vgl. a. S. 42/3. Nelson stellt seinem,, System der philosophischen Rechtslehre und Politik“ die folgenden Sätze aus den Gesprächen Kung-Futses als Motto voraus: „Dsi Lu sprach: „Der Fürst von We wartet auf den Meister, um die Regierung auszuüben. Was würde der Meister zuerst in Angriff nehmen?“ Der Meister sprach: „Sicherlich die Richtigstellung der Begriffe.“ Dsi Lu sprach: „Darum sollte es sich handeln? Da hat der Meister weit gefehlt, warum denn deren Richtigstellung?“ Der Meister sprach: „Wie roh du bist, Yu! Der Edle läßt das, was er nicht versteht, sozusagen beiseite. Wenn die Begriffe nicht richtig sind, so stimmen die Worte nicht ; stimmen die Worte nicht, so kommen die Werke nicht zustande ; kommen die Werke nicht zustande, so gedeiht Moral und Kunst nicht; gedeiht Moral und Kunst nicht, so treffen die Strafen nicht; treffen die Strafen nicht, so weiß das Volk nicht, wohin Hand und Fuß setzen.“
Eine Parallelstelle aus dem viel verrufenen Hobbes: „Wenn man heilsame Lehren zur Geltung bringen will, muß man bei den Universitäten beginnen. . . Sind doch heutzutage Urteile im Umlauf, die bloß durch das häufige Anhören dazu gelangt sind, obgleich sie falsch und so wenig verständlich sind, als wenn man eine Anzahl von Ausdrücken durch das Los aus der Urne gezogen hätte; wievielmehr werden daher aus denselben Ursachen wahre Lehren angenommen werden, die der menschlichen Einsicht und der Natur der Dinge entsprechen. Daher halte ich es für die Pflicht der Herrscher, daß sie Handbücher über die wahren Grundlehren des Staatsrechts anfertigen lassen, über die auf allen Universitäten des Staates gelesen werden muß“ (Vom Menschen und vom Bürger, S. 217/8). Das nimmt ihm Harrington (Oceana, S. 13) sehr übel.
[3] Gesellschaft und Einzelwesen, S. 130. Ebenso v. Mayr, a. a. O. S. 2off.
[4] Sozialphilosophie im Umriß S. 35.
[13]
einerseits jene wirkenden Kräfte, welche den Zusammenschluß und Zusammenhalt der ... sozialen Gruppen hervorbringen, mitsamt ihren Folgen, andererseits jenes System von, durch diesen Zusammenschluß und Zusammenhalt erzeugten gegenseitigen Verhältnissen zum Gegenstand der Forschung gemacht werden. Mit ersteren beschäftigt sich die Soziologie, als deren Bestandteil die Staatswissenschaft erscheint, mit letzterem die Jurisprudenz“ [1].
Wir werden uns mit dem Altmeister noch darüber auseinanderzusetzen haben, ob die soziologische Staatslehre in der Tat eine „Naturwissenschaft“ in seinem Sinne ist. Hier interessiert uns nur, daß auch er sie von der juristischen scheidet. Wenn er die Sonderexistenz einer juristischen Staatslehre leugnet, so mag er das mit seinen Kollegen ausmachen: es ist eine völlig belanglose Frage der Rangordnung.
Damit haben wir gezeigt, daß unsere sachliche Abgrenzung dem heutigen Stande der Wissenschaft entspricht, und können uns zu unserer zeitlichen Abgrenzung wenden.
Dasjenige, was wir als den „nachhistorischen“ Staat bezeichnet haben, nämlich der „unhistorische“ Staat der Utopisten und der „posthistorische“ der wissenschaftlichen Prognose, wird in den besseren Abhandlungen über den Staat nicht oder kaum erwähnt, offenbar aus dem Grunde, weil gar kein Zweifel daran bestehen kann, daß sie nicht in die Lehre hineingehören. Wir haben dem oben Gesagten denn auch nichts hinzuzufügen.
Was nun unseren „vorhistorischen“ Staat anlangt, so scheint auch darüber fast vollkommene Einigkeit zu bestehen [2], daß der „sub-historische“, der Tierstaat, aus der Betrachtung auszuscheiden ist. Das hat schon Hobbes getan: „Indes sind ihre Vereinigungen keine Staaten, ... ; denn ihre Regierung beruht nur auf der Vereinigung vieler auf einen Gegenstand gerichteter Willen, aber es herrscht bei ihnen nicht (wie es im Staate nötig ist) ein Wille. Es ist richtig, daß bei diesen in bloßen sinnlichen Empfindungen und Begehrungen lebenden Geschöpfen die Übereinstimmung der Neigungen so beständig ist, daß sie nichts weiter als ihr rein natürliches Begehren brauchen, um diese Übereinstimmung und damit den Frieden sich zu erhalten“ [3].
Ebenso denkt Burckhardt: „Etwas wesentlich anderes sind ferner
[1] Die soziologische Staatsidee S. 27/8.
[2] Eine Ausnahme bildet z. B. Eduard Meyer (Elemente der Anthropologie S. 1 [1]. Er betrachtet „den staatlichen Verband nicht nur begrifflich, sondern auch geschichtlich als die primäre Form der menschlichen Gemeinschaft, eben als denjenigen sozialen Verband, welcher der tierischen Horde entspricht und seinem Ursprung nach älter ist als das Menschengeschlecht“. Rachfahl schließt sich ihm an (Staat, Gesellschaft, Kultur und Geschichte, S. 32/3). Ihm nahe steht Grotius, a. a. O. S. 5 (prolegomena 7). Wir kommen noch darauf zurück.
[3] Lehre vom Menschen und vom Bürger S. 131.
[14]
die Tierstaaten, bei weitem vollkommener als die Menschenstaaten, aber unfrei. Die einzelne Ameise funktioniert nur als Teil des Ameisenstaates, welcher als ein Leib aufzufassen ist. Das ganze, was da vorgeht, ist dem einzelnen Individuum ganz unverhältnismäßig überlegen, ein Leben in vielen Atomen; schon die höheren Tierklassen aber leben bloß als Familie, höchstens als Rudel. Nur der Menschenstaat ist eine Gesellschaft, d. h. eine irgendwie freie, auf bewußter Gegenseitigkeit beruhende Vereinigung“ [1].
Sehr hübsch sagt Frantz: „Zum Wesen des Menschen gehört Entwicklung und daher die Geschichte, ohne welche weder der Mensch noch der Staat gedacht werden darf. Für reine Geister gäbe es kein Recht, so wenig wie für Tiere, weil die einen wie die anderen schon sind, was sie werden sollen, und kein Streben besitzen, etwas zu werden, was sie noch nicht sind“ [2].
Was zweitens den prähistorischen „Staat“ anlangt, so besteht hier keine Übereinstimmung. Treitschke z. B. sagt: „Es fehlt uns jede historische Kenntnis von staatlosen Völkern. Überall, wo Europäer hingekommen sind, haben sie eine, wenn auch noch so rohe Form staatlicher Ordnung gefunden“ [3]. Dagegen sagt Wundt kurz und knapp : „Die Stammesorganisation der totemistischen Zeit ist nicht im geringsten eine unvollkommene, noch unausgebildete Staatsordnung, sondern ganz etwas anderes“ [4].
Offenbar zwei einander kontradiktorisch widersprechende Behauptungen ! An und für sich wiegt die Meinung des großen Ethnologen schwerer als die des Historikers, der ja mit seinen Mitteln nicht bis zu den staatlosen, d. h. geschichtslosen Völkern „hinauflangen kann“ [5], wie Kant einmal sagte [6]. Es wiegt noch schwerer, daß Wundt zuerst auf Treitschkes Standpunkt stand. In seinen „Vorlesungen über Tier- und Menschenseele“ (1863) und noch in der dritten Auflage seiner „Ethik“ läßt er den Staat allmählich aus dem Stammesverbande, wie das Recht aus der Sitte entstehen[7].
Wir werden zeigen, daß Wundt aus zwingenden Gründen seine erste Meinung aufgegeben hat. In der Tat unterscheidet sich der prähistorische „Staat“ essentiell von dem historischen.
Damit ist unsere Grenzbegehung beendet, und wir können zur eigentlichen Begriffsbestimmung übergehen.
[1] Weltgeschichtliche Betrachtungen S. 27ff.
[2] Naturlehre des Staates S. 56.
[3] Politik, I, S. 13/4.
[4] Elemente der Völkerpsychologie, S. 301. Vgl. S. S. I, S. 1043.
[5] Vgl. S. S. I, S. XI.
[6] Metaphys. Anfangsgründe d. Rechtslehre II.
[7] Nach Gumplowicz, Gesch. d. Staatsth., S. 443/4.
[15.]
II. Der soziologische Staatsbegriff. ↩
1. Der Klassenstaat. ↩
Wir suchen den soziologischen Begriff „des“ Staates. Das ist das, was Lacombe im Gegensatz zur geschichtlichen Wirklichkeit eine geschichtliche Wahrheit genannt hat [1] : „Eine geschichtliche Wahrheit besteht erstens aus einer Wirklichkeit, die zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten auftritt, und zweitens aus dem Nachweis der Ursachen, aus denen sie entsteht“. Eine solche, zu den verschiedensten Zeiten und an den verschiedensten Orten auftretende geschichtliche Wirklichkeit ist „der“ Staat. Was wir zu finden haben, ist die Essenz des Staates, das, was allen Staaten gemeinsam ist, so daß der von uns aufzufindende Staatsbegriff der Oberbegriff, die Klasse ist, der alle einzelnen Staatstypen als Arten untergeordnet sind, wie diesen die einzelnen historischen Staaten als Exemplare. Wir treiben sozusagen vergleichende Anatomie, Physiologie und Pathologie des Staates, in der Absicht, dadurch eine Anschauung von dem natürlichen Stammbaum der Staaten und daraus wieder eine Anschauung von der Entwicklung des Staates, als eines universalhistorischen Objektes, zu gewinnen.
Was ist denn nun „der“ Staat? Wie ist dieser Oberbegriff beschaffen, unter den alle Staaten der Weltgeschichte ohne Ausnahme lallen: primitive und hoch zivilisierte, in allen fünf Erdteilen, mit Untertanen aller Farben und Rassen, Monarchien, Republiken, Theo-, Aristo-, Demo-, und Ochlokratien, gut und schlecht verwaltete, freie und despotische, zugrundegegangene und überdauernde, große und kleine, kriegerische und тдиб friedliche?
Wir würden nur unsere Zeit verlieren, wenn wir versuchen wollten, den gesuchten Begriff aus der Literatur der Staatswissenschaften zu entnehmen. Sie befindet sich in einem kläglichen Zustande. Jellinek, der selbst sehr viel dazu geleistet hat, das Chaos zu ordnen, sagt von ihr: „Auf ihrem Gebiete konnte bis in die Gegenwart hinein jeder haltlose Einfall, sofern er nur mit Sicherheit vorgetragen wurde, wissenschaftliches Ansehen gewinnen und ernstlich diskutiert werden. Behauptung wurde für Tatsache, Überzeugung für Beweis genommen, Unklarheit galt für Tiefsinn, willkürliche Spekulation für höhere Erkenntnisart“ [2]. Die Zahl der Definitionen ist Legion, aber die meisten sind nicht einmal als Material verwendbar, und ganz befriedigen kann keine einzige; außerdem widersprechen sie einander auf das krasseste. Die meisten haben
[1] De l'Histoire considérée comme science, Paris 1894, S. IX·
[2] Allg. Staatslehre S. 26/7.
[16]
nur einen einzigen Staat oder nur eine Art von Staaten im Auge, oder erfassen nur einen Teilinhalt seines Wesens, oder versuchen umgekehrt, für die verschiedenen Erkenntnisobjekte eine einzige Definition aufzufinden. Andere glauben, den Begriff des Staates zu ergreifen, wenn sie seinen „Zweck“ oder seine „Aufgabe“ bezeichnen, wobei in der Regel der „persönliche Gleichung“ [1] des Autors in bald erheiternder, bald erbitternder Naivetät zutage tritt. Wieder Andere glauben, etwas erschöpfendes zu sagen, wenn sie den Staat als eine natürlichen oder gar „ethischen“ Organismus [2] oder als eine Vorrichtung zur Erzielung des größten „Güteverhältnisses“ der sozialen Kooperation erklären [3]. Und was dergleichen Entgleisungen mehr sind [4].
Wenn wir uns also nicht in dem Bemühen sollen untergehen sehen, zu den zahlreichen kritischen Geschichten der Staatslehre oder auch nur des Staatsbegriffs eine neue zu schreiben und darüber den eigentlichen Zweck unserer Arbeit zu versäumen, so bleibt uns unter diesen Umständen nichts anderes übrig, als uns nach Schopenhauers gutem Rat auf die lebendige Anschauung zu besinnen und uns darüber klar zu werden, worin alle Staaten der Geschichte bei ihren sonstigen Verschiedenheiten übereinstimmen, d. h. jenes Minimum von Prädikaten aufzufinden, das ein Oberbegriff haben muß.
Den ersten Schritt können wir mit der Gewißheit allgemeiner Zustimmung tun. Von jeher ist, auch von denjenigen Schriftstellern,
[1] S. S. I, S. 139, S. 203/4.
[2] Waitz, zit. nach J. G. Weiß, Gesellschaft und Staat als Organismus (Pol. Anthropol. Revue, 1906). Die Vorstellung erinnert an Fouillées „kontraktuellen Organismus“. Vgl. S. S. I, S. 63.
[3] Z. B. Ostwald („Energet. Grundl. d. Kulturwiss.“ S. 160): „Wir müssen die staatlichen Organisationen . . . als hochwichtige Faktoren . . . ansehen, insofern sie die erste wirksame Zusammenfassung menschlicher Energie für gemeinsame Zwecke darstellen. Dies ist der Sinn und Wert eines jeden Staates“. Ähnlich Menzels „energetische Staatsauffassung: „Darnach erscheint der Staat als die Gesamtheit der Einrichtungen, welche dazu dienen, die Kollektivkraft eines Volkes zu bilden und über sie zu verfügen“ (Hdb. d. Pol. I, S. 43). Jellinek führt die Stelle als Beispiel für solche Autoren an, die es „sich an Schlagworten genügen lassen .... und selbst, wenn man sich auf ihren Standpunkt stellt, die Ursache des Staates mit diesem selbst vermengen“ (Allg. Staatsl. S. 141/2).
[4] Eine kleine Probe. Matzat schreibt in seiner preisgekrönten Abhandlung: „Philosophie der Anpassung“: „Ein Staat ist eine Gesamtheit von Menschen in Rechtsverhältnissen, welche (wenigstens teilweise) durch einen fremden Willen nicht geändert werden können, und durch welche ein solcher Teil des äußeren Verhaltens aller Mitglieder nach dem Willen eines Mitgliedes, und ein solcher Teil des äußeren Verhaltens dieses einen Mitgliedes nach dem Willen der anderen Mitglieder bestimmt ist, daß kein Mitglied befugt ist, wider den Willen dieses einen Mitgliedes gegen irgend jemand Gewalt zu gebrauchen“. Gumplowicz (Gesch. d. Staatsth. S. 557) „kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß der Herr Verfasser sich einen Jux machen wollte.“
[17]
die den Staat auf das strikte Minimum der durchaus unerläßlichen Funktionen beschränken wollen, den sog. Manchestermännern [1], als das Mindestmaß der Kennzeichen eines Staates angegeben worden, daß er eine Anstalt besitzt, der der Grenzschutz nach außen und der Rechtsschutz nach innen obliegt, und der zu diesem Zwecke eine gewisse Machtgewalt zur Verfügung steht. Wir sagen ausdrücklich nicht: eine genügende Machtgewalt. Denn wenn auch ein Staat, der keine genügende Macht des Grenzschutzes besitzt, als selbständige Macht unter den bisher bestehenden Umständen schnell als solcher zugrundegehen, d. h. seine Souveränetät verlieren muß, so hat es doch sehr viel Staaten gegeben, die für den inneren Rechtsschutz keine genügende Machtgewalt besaßen und dennoch „Staaten“ blieben.
Daß Grenz- und Rechtsschutz das strikte Minimum der Kennzeichen eines Staates sind, sagt Treitschke, der sich das Problem stellt, ausdrücklich: „Er ist, . . . Macht nach außen und Rechtsordnung im Innern, seine Grundfunktionen müssen also sein das Heerwesen und die Rechtspflege.“ Dazu gehört „ein Staatshaushalt wenn auch in den primitivsten Formen“ [2] : kurz, das, was wir eine „Anstalt“ nannten.
Waitz sagt: „In den germanischen Staaten von jeher und immer die Grundlage aller Ordnung und zugleich die eine Hauptseite der Befugnis und der Pflicht dessen, der an der Spitze des Gemeinwesens steht, ist die Sorge für Recht und Frieden“ [3].
Nach v. Below ist die Aufgabe des deutschen Königs die Rechtsordnung, die Förderung der kirchlich-religiösen Angelegenheiten, das Heerführeramt [4].
Von diesen drei Funktionen gehört die Fürsorge für das Seelenheil der Untertanen offenbar nicht zu den essentiellen Kennzeichen „des“ Staates; denn mit fast einziger Ausnahme der christlichen Staaten, und auch dieser nur in gewissen Perioden ihrer Geschichte, haben die historischen Staaten diese Funktion nicht ausgeübt. Es bleibt also auch hier nur der Grenz- und Rechtsschutz übrig.
Das ist auch die Ansicht derjenigen Richtungen, die dem Staate am unfreundlichsten gegenüberstehen, des Anarchismus, der nicht den Staat, sondern den Klassenstaat „abschaffen“ will, und des sogenannten Manchestertums, das, in Lassalles Ausdruck, den Staat auf die Aufgaben eines „Nachtwächters“ einengen möchte. Herbert Spencer z. B. schreibt in einer sehr bekannten Stelle: „Die Aufgabe
[1] Hobhouse (Social Evolution S. 182/83) macht die feine Bemerkung, daß die von Bentham kritisierte Staatsform „gar zu sehr einer engen und korrupten Korporation ähnelte“. Diesem Staat konnte man in der Tat kein Vertrauen entgegenbringen.
[2] Politik I, S. 70.
[3] Zit. nach v. Below, Der deutsche Staat des Mittelalters, S. 199.
[4] A. a. O. S. 203. Oppenheimer, System der Soziologie. Band II. 2
[18 ]
des Staates ist lediglich, zu verhindern, daß jemand durch den Gebrauch seiner Freiheit anderen Unrecht zufüge; geht der Staat über diese Aufgabe hinaus, so tut er Unrecht.“
Wir bitten, wohl zu unterscheiden: wir behaupten nicht etwa, daß der Staat geschaffen worden sei, um den Grenz- und Rechtsschutz zu übernehmen, so daß, wie Burckhardt einmal sagt, „die Gesellschaft das Prius und der Staat zu ihrem Schutze entstanden wäre, als ihre negative, abwehrende, verteidigende Seite, so daß er und das Straf recht identischen Ursprung hätten“: wir lehnen diese Vorstellung ebenso entschieden ab, wie Burckhardt selbst. Wir behaupten nur, daß jeder Staat, er sei entstanden aus welchen Ursachen oder Gründen immer, diese beiden Aufgaben übernommen hat [1].
Wir können also vorläufig aussagen, daß der Staat eine „Rahmengruppe“ ist, die eine mit Machtmitteln versehene Anstalt für den Grenz- und Rechtsschutz besitzt. Unter dem Ausdruck „Rahmengruppe“ verstanden wir, um es ins Gedächtnis zurückzurufen, jene, „namentlich politisch nach außen, gegen andere Gesellschaften, abgegrenzten menschlichen Verbände, die gleichzeitig Wirtschaftsgesellschaften und in der Regel auch Rechts-, Sprach-, und Religionsgesellschaften darstellen“ [2] In dieser vorläufigen Bestimmung des Staatsbegriffs ist die Souveränetät, die für die Meisten notwendig dazu gehört, enthalten.
Auch den nächsten Schritt können wir noch mit der Gewißheit fast allgemeiner Zustimmung tun. Es gibt kaum Staatslehrer, die nicht die Herrschaft über ein bestimmtes Gebiet für eines der Kennzeichen hielten [3], das im Begriffe des Staates nicht fehlen darf. Wo in dieser Beziehung Bedenken bestehen, liegt die häufige Verwirrung von Staat und Gesellschaft zugrunde: „Die Herrschaft über ein Landgebiet gehört zum Begriff des Staates, nicht aber das Landgebiet zum Bau der Staatsgesellschaft. Herrschaft ist immer ein Verhältnis von Mensch zu Mensch oder von Gruppe zu Gruppe, hier der Grenznachbarn, denen das Staatsgebiet nicht gehört“ [4]. Ein wenig von dieser Verwirrung spielt wohl auch in die Auffassung Jellineks hinein, der zwar die Herrschaft über ein Staatsgebiet ausdrücklich in seine Definition aufnimmt, sie aber doch mehr für ein Accidens als ein Essentiale zu halten scheint. „Allerdings besitzt der Staat auch ein Gebiet. Geht man
[1] Grotius steht dieser Auffassung mindestens sehr nahe: „Der Staat ist eine vollkommene Verbindung freier Menschen, welche sich des Rechtsschutzes und des Nutzens wegen zusammengetan haben“ (übersetzt von Hasbach, Phil. Grundl. S. 36). [2] S. S. I S. 465.
[3] Das scheint Ratzel sogar für das Primäre zu halten: „Nehmen wir eine große oder kleine Gesellschaft : sie will in erster Linie den Boden festhalten, auf dem sie lebt, und von dem sie lebt. Organisiert sich die Gesellschaft für diese Aufgabe, so wird sie zum Staat (Anthropogeographie I, S. 44, vgl. 45/6).
[4] S. S. I, S. 464 Anm.
[19]
aber der Sache auf den Grund, so gelangt man zu der Erkenntnis, daß auch das Gebiet ein den Menschen anklebendes Element ist. . . Von menschlichen Subjekten ganz losgelöst gibt es kein Gebiet, sondern nur Teile der Erdoberfläche“ [1]. „Die Herrschaft über ein Gebiet ist nicht dominium, sondern Imperium.“ „Das Gebiet ist kein selbständiges Objekt der Staatsgewalt“ [2]. Wir brauchen uns bei diesen dialektischen Finessen nicht aufzuhalten, die für uns von sehr geringem Interesse sind. Uns genügt es, daß die Herrschaft über ein bestimmtes Landgebiet zum Begriff jeder Rahmengruppe, also auch das Staates, gehört. Das ist ja im Grunde auch Jellineks Anschauung. Um noch andere Autoren von Bedeutung anzuführen, so schreibt Stammler: „Der Staat ist eine auf einem abgegrenzten Teil der Erdoberfläche seßhafte, mit einer herrschenden Gewalt versehene und durch sie zu einer Einheit zusammengefaßte Vielheit von Menschen“ [3]. Schurtz sagt [4]: „Der Staat muß gleichzeitig als gesellschaftliches Gebilde und geographischer Begriff betrachtet werden.“ Und er zitiert einen anderen Ausspruch von Ratzel: „Wenn wir von einem Staate reden, meinen wir, gerade wie bei einer Stadt oder einem Weg, immer ein Stück Menschheit und ein menschliches Werk und zugleich ein Stück Erde.“
Wir nehmen also die Herrschaft über ein Landgebiet ausdrücklich in unsere Begriffsbestimmung auf, wobei wir aber weniger das Verhältnis zu den eigenen Staatsuntertanen als das zu den Fremden jenseits der Grenze im Auge haben, die eben diese Herrschaft der Regel nach nicht in das Gebiet zuläßt, es sei denn mit ausdrücklicher Zustimmung des Staates. Den Wortlaut unserer Definition brauchen wir deshalb nicht zu ändern: es genügt, wenn wir das Wort „Grenzschutz“, das in unserer
[1] a. a. O. S. 176.
[2] a. a. O. S. 398/400. Eduard Meyer (El. d. Anthrop. S. 1 [1] sagt, der „Besitz eines fest umgrenzten Gebietes bildet keineswegs einen integrierenden Bestandteil des Staatsbegriffs“. Das ist eine rein terminologische Entscheidung, da er jede gewachsene Gruppe, auch schon die Tierherde, als „Staat“ bezeichnet. Kelsen (Soziol. und jurist. Staatsbegriff, S. 38ff. Anm.) polemisiert ausführlich und, wie es uns scheint, mit Glück gegen Ratzeis halb geographisch-soziale, halb psychologische Meinung, das Land sei der Körper des Staates. S. 85 faßt er sich, in Übereinstimmung mit uns, folgendermaßen zusammen: „Der Herrschaftsbereich des Staates ist doch offenbar nicht der Raum, innerhalb dessen Herrschaftsakte des Staates faktisch möglich sind, sondern er ist der Geltungsbereich der staatlichen Ordnung“. S. 144/5 polemisiert er gegen Stammlers Lehre, der Staat sei „ein Staatsvolk auf seinem Staatsgebiet unter einer staatlichen Gewalt“. —· Das ganze Problem hat nur staatsrechtliche, aber nicht staatssoziologische Bedeutung.
[3] Wirtschaft und Recht § 87ff. Zit. nach Hacker: „Die ererbten Anlagen und die Bemessung ihres Wertes für das politische Leben“, Jena 1907, S. 64.
[4] H. Schurtz, Völkerkunde, Leipzig-Wien, 1903, S. 30. Vgl. a. Bruno Schmidt, „Der Staat“, Lpz. 1896, S. 142/3. Vgl. a. Kjelléns bekanntes Buch „Der Staat als Lebensform“. Darüber S. S. I, S. 844ff. Vgl. ferner Treitschke, Politik I, S. 202, 204 in gleichem Sinne.
[20]
ersten Formulierung nichts als die Abwehr jedes von außen kommenden Eingriffs bedeutete, in seiner eigentlichen Bedeutung als Schutz bestimmt gezogener Grenzen verstehen. Im übrigen gibt es kaum menschliche Gruppen, die nicht den Begriff des Gruppeneigentums an bestimmten Lokalitäten, Jagd- oder Fisch- oder Weidegründen, besäßen [1].
Die meisten Staatstheoretiker sind der Meinung, daß wir mit dieser Formel die gesuchte Definition des Staates bereits besitzen. Machen wir die Probe: konvertieren wir sie! Dann erhalten wir den Satz: jede Rahmengruppe, die eine mit Machtmitteln versehene Anstalt für den Grenz- und Rechtsschutz besitzt, ist ein Staat. Ist das wahr?
Man könnte einzuwenden versuchen, daß dann jede Räuberbande, etwa Flibustier oder Bukanier, die eine Insel besetzt halten und nach außen hin gegen Angriffe verteidigen, während sie nach innen hin eine gewisse Rechtsordnung unter sich aufrechterhalten, ein Staat wäre. Das aber wäre verkehrt: denn zum Begriff einer „Rahmengruppe“ gehört der Bestand im Geschlechterwechsel. Und es kann gar keinem Zweifel unterliegen, daß eine solche Piratengesellschaft, wenn sie auf die Dauer seßhaft wird, einen echten Staat bildet. Sehr viele Staaten sind auf diese Weise entstanden, gegründet durch phönizische, karische, hellenische, skandinavische, malaiische und andere „Wikinge“ [2].
Bedenklicher ist, daß eine Anzahl subhistorischer Rahmengruppen unter die konvertierte Definition fallen würden. Auch höhere Tiergesellschaften haben ihre bestimmten Jagd- oder Weidegründe, von denen sie die Ungenossen, auch der eigenen Art, abwehren; auch sie halten im Innern eine gewisse Ordnung, den Keim eines Rechtszustandes, aufrecht [3].
[1] Holsti sagt von den primitiven Jägern, sie hätten „wohlbegrenzte Jagdgründe“ (The relation of war to the origin of the state, S. 272).
[2] Bodin entscheidet anders (Six livres etc. S. 2/3 der Lyoner Ausgabe von 1580): „Obgleich die Piraten in Freundschaft und Gesellschaft zu leben scheinen, weil sie, wie von Bargule und Viriat berichtet wird, die Beute gleichmäßig teilen, darf man das doch weder Freundschaft noch Gesellschaft noch rechtmäßige Teilung nennen, denn die Hauptsache fehlt, das wahre Kennzeichen der Freundschaft, nämlich die gerechte Regierung nach den Naturgesetzen“. Vgl. dazu Piaton, der Staat (Ausg. Horneffer) S. 33.
[3] Vgl. Jellinek a. a. O. S. 542; ferner Wundt, Völkerpsychologie VII, S. 15. Von Hühnern berichtet das gleiche Schjelderup-Ebbe.
Alverdes berichtet (Tiersoziologie S. 73 ff.) über den „geschlossenen Verband als eine Gemeinschaft, die sich nach außen gegen Nichtmitglieder abschließt. Im Innern der Gesellschaft wird häufig eine Rangordnung hergestellt; bei Vögeln und Säugetieren geschieht dies wohl stets, bei Insekten dagegen wahrscheinlich nie“. Ameisen und Bienen lassen nur solche Artgenossen zu, die den spezifischen Nestgeruch besitzen, die „Geruchsuniform“ tragen. Strauße beißen und töten fremde Jungen. Die halbwilden Pariahunde des Orients haben ihre ganz bestimmten Quartiere, in die sie keinen anderen zulassen. Ganz ähnlich verhalten sich in der Fortpflanzungszeit die Pinguine; sogar in den zoologischen Gärten fallen die Insassen eines Gesellschaftskäfigs, Affen und Raubtiere, aber auch Präriemurmeltiere, Papageien usw. über jeden Neuankömmling her (76). „Vielleicht handelt es sich bei solchen Kämpfen immer um die Herstellung einer Rangordnung. Nach Pfungst hat jeder Affe innerhalb der Horde ein bestimmtes Ranggefühl.“ Auch von freilebenden Tieren gilt das: „Im allgemeinen hat jede Affenhorde ihr abgegrenztes, je nach der Spezies mehr oder minder ausgedehntes Wohngebiet inne. Beim Zusammentreffen zweier Horden können sich heftige Kämpfe entspinnen; das Gleiche gilt vom Känguruh, vom Gabelbock, von allen Ameisenstaaten“ (109/110).
[21]
Aber darüber könnte man sich wegsetzen. Entscheidend jedoch ist, daß auch die prähistorischen Rahmengruppen unter die Definition fallen würden, und die sind ja, wie uns Wundt sagte, „nicht im mindesten unentfaltete, unvollkommene Staaten, sondern ganz etwas anderes“.
Wie aber unterscheiden sich die prähistorischen „Stammesorganisationen“ von den historischen Staaten? Diese sind hierarchisch in erbliche einander über- und untergeordnete Dauergruppen gegliedert, jene aber nicht!
Solcher erblicher Dauergruppen gibt es in historischer Betrachtung drei Arten: die Kasten, Stände und Klassen.
Sie unterscheiden sich vielfach, vor allem durch die Schwierigkeit, die das Ausscheiden aus der Gruppe mit sich bringt. Es ist bei der Kaste ganz oder nahezu unmöglich, bei dem Stande schwierig und in der Regel mit formellen Rechtsveränderungen verbunden, bei der Klasse am leichtesten, ohne Rechtsveränderung, rein faktisch, möglich. Diese Unterschiede sind juristisch sehr erheblich, aber soziologisch weniger bedeutsam. Für uns ist wichtig, was die drei Arten Gemeinsames haben: daß man durch die Geburt in sie gelangt und in der Regel bis zum Tode in ihnen verbleibt, kurz, daß es dauernde erbliche Verhältnisse der Individuen sind; daß es, vom Ganzen her gesehen, erbliche Gruppen oder Schichten sind, deren Personenbestand in der Regel und im Großen durch den Zufall der Geburt bestimmt ist und bleibt. Wir werden diese Schichten im folgenden als „Klassen“ (im weiteren Sinne) bezeichnen.
Wir kommen somit auf folgende Definition des historischen Staates : Der Staat ist eine in Klassen gegliederte Rahmengruppe, die eine mit Machtmitteln versehene Anstalt für den Grenz- und Rechtsschutz besitzt.
Wir glauben, auch hierin der allgemeinen Zustimmung sicher zu sein, daß diese hierarchische Klassenordnung zu den essentiellen Kennzeichen des Staates gehört. Dennoch findet sie sich, mit Ausnahme einiger — nicht einmal aller — bereits soziologisch orientierter Autoren, in keiner Definition des Staates. Dieser Mangel ist es, der uns zwang, auch die besten unter ihnen als unzureichend zu bewerten.
Wie ist dieses sehr seltsame Übersehen oder doch Nichtbeachten
[22 ]
eines anerkanntermaßen allgemeinen Kennzeichens aller historischen Staaten, also „des“ Staates, zu erklären?
Das ist sehr einfach: es gilt als „selbstverständlich“. Alle bürgerlichen und sehr viele sozialistische Staatstheoretiker sind der Überzeugung, daß solche Klassengliederung aus „natürlichen“ Gründen, η atur not wendig, in jeder irgend höher entwickelten menschlichen Gesellschaft bestehen muß. Und so hat man versäumt, dieses Kennzeichen in die Definitionen aufzunehmen, obgleich es der einzige Weg ist, um die prähistorischen Gruppen, die ja doch die Meisten als vom Staate sehr verschieden empfinden, von ihm begrifflich zu unterscheiden. Übrigens wäre es auch ohne das logisch geboten gewesen, ein allgemeines Kennzeichen in die Definition aufzunehmen.
Was hier spricht, ist das Axiom aller bürgerlichen und leider auch des größten Teiles der marxistischen Soziologie [1], ist die „Wurzel aller soziologischen Übel“: das „Gesetz der ursprünglichen Akkumulation“.
Nun, alle eigentliche Wissenschaft beginnt bekanntlich mit dem Augenblick, wo nicht mehr die auffälligen, seltenen, sondern gerade die alltäglichen, der Gewohnheit „selbstverständlichen“ Erscheinungen untersucht werden. Die neue Naturwissenschaft begann, als Galilei fragte, warum ein Apfel zur Erde fällt. Und so begann — wir haben es gezeigt [2] — alle soziologische Wissenschaft erst in dem Augenblicke, wo die Frage aufgeworfen wurde, warum denn alle Staaten Klassenstaaten seien; und all ihr Fortschritt in Vergangenheit und Zukunft, theoretisch und praktisch, kann nur aus einer immer genaueren und umfassenderen Antwort auf diese Frage erwartet werden.
Wir haben mehrfach und ausführlich bewiesen [3], daß dieses angebliche Gesetz in Wirklichkeit nicht existiert, daß es in der Tat eine „Kinderfibel“ ist, wie Marx es nannte. Aber, falsch oder wahr, es hat die Geister beherrscht und beherrscht sie auch heute noch fast unbedingt. Daher die Vorstellung, daß jeder Staat „selbstverständlich“ ein Klassenstaat sein muß, daher die Lücke in den Definitionen.
Wir haben in einer geistesgeschichtlichen Skizze [4] gezeigt, wie allgemein dieser verheerende Irrtum ist. Wir haben bezeichnende Stellen angeführt aus Ricardo, Lorenz v. Stein („so ergibt sich, daß das Dasein der bloßen Klassen eine . . . unvermeidlich gegebene Tatsache ist“), Inama-Sternegg, Eduard Meyer, Giddings, Brooks-Adams, Gustav Schmoller und Friedrich Engels, dem Kampfgenossen des
[1] S. S. Ill, S. I94ff.
[2] S. S. I, S. 47, S. 987.
[3] S. S. I, S. 987ft., III, S. 206ff.
[4] S. S. I, S. 98711.
[23]
großen Denkers, der die Lehre als Kinderfibel verspottete! Hier sei noch ein Autor von besonders großem Einfluß genannt: Treitschke. Er schreibt [1] : „Mit dem Wesen der Gesellschaft ist ein für alle Male gegeben die Verschiedenheit der Lebenslage und Lebensbedingungen. Um es kurz zu sagen: alle bürgerliche Gesellschaft ist Klassenordnung.“ Und an anderer Stelle: „Man kann sagen, Gesellschaft ist Gliederung. Wie der Staat nicht bestehen kann ohne die Teilung in Regierende und Regierte, so die Gesellschaft nicht ohne die Gliederung in verschiedene Klassen“ [2]. Worauf beruht diese so allgemeine, so festgewurzelte Lehrmeinung ?
[1] Politik I, S. 50.
[2] A. a. O. S. 298. Ähnlich Izoulet (la cité moderne S. XXV.): „La science biosociale établit irrésistiblement ceci à savoir : que la cité est un organisme et que tout organisme supérieur est essentiellement une solidarité certes, mais aussi et surtout une hiérarchie“.
[24]
Zweiter Abschnitt.
Die Klassenordnung.
I. Die Theorien. ↩
Die Aufgabe dieses Abschnitts wird es sein, festzustellen, wie sich dieses Dogma, nein, dieses als keines Beweises bedürftig betrachtete Axiom, des weitaus überwiegenden Teiles der heutigen Sozialwissenschaft entwickelt hat, und es zu widerlegen. Zu dem Zwecke werden wir zuerst die Theorien darstellen und sie dann mit den Tatsachen konfrontieren.
1. Darstellung.↩
Nach dem, was wir in der Begriffsbestimmung als den einzigen Gegenstand unserer Untersuchung bezeichnet haben, kann es nicht unsere Absicht sein, eine Geschichte der Staatstheorien zu geben. Sondern uns interessiert nur, was sie über unser Thema, den historischen Klassenstaat, und namentlich über seine Entstehung zu sagen haben. Ihr übriger Inhalt, insofern er sich mit dem überhistorischen Philosophenstaat wie auch mit dem nicht-historischen Juristenstaat befaßt, wird uns nur insoweit zu beschäftigen haben, wie er mit unserem Gegenstande zusammenhängt.
a) Altertum.
Die Wurzeln des uns beschäftigenden axiomatischen Lehrsatzes lassen sich bis in das hellenische Altertum zurück verfolgen. Und zwar kommen hier vor allem in Betracht die Staatslehre des Aristoteles, die der Stoa und die des Epikuräismus. Und zwar waren es sämtlich philosophische Lehren vom Staat, geschaffen, um die Konstruktion des philosophischen, „überhistorischen“ Staates zu unterbauen. Um die Entwicklung vordeutend mit einem kurzen Worte zu bezeichnen, so wurden diese drei, unter sich sehr verschiedenen Theorien erstens einer Synthese unterworfen und zweitens in ihrer Richtung aus einer, rein der Erkenntnis und dem Weltverständnis dienenden, philosophischen Theorie umgebogen in Lehren des Parteien- und Klassenkampfes
[25]
zuerst in eine staatsrechtliche, und zuletzt in eine ökonomische Klassentheorie. In dieser ihrer letzten Form interessiert sie uns vor allem. Aber unsere Absicht, sie ein für alle Male zu widerlegen und aus den Grundlagen der Soziologie auszuroden, wird sich am besten dadurch ausführen lassen, daß wir in Kürze ihre proteushaften Wandlungen durch die Jahrhunderte verfolgen.
Wir beginnen mit der Anschauung des Stagiriten, obwohl sie zeitlich später vorgetragen wurde, als die entscheidenden Gedanken, die dann in den beiden anderen Systemen voll ausgestaltet wurden. Aber Aristoteles (384—322) bedeutet ja überhaupt gegenüber der Zeit vor ihm eine Art von Reaktion [1] gegen die Schrankenlosigkeit des Denkens, die die Generation vor ihm, Platon nicht minder als die Sophisten, ausgezeichnet hatte; er ist im Guten wie im Schlimmen „bürgerlicher“, und so hat er auch hier eine ältere Gemeinauffassung vom Ursprung des Staates vorgetragen, nämlich daß er durch allmähliche Entwicklung aus der Familie entstanden sei. Diese Vorstellung mußte einer Zeit naheliegen, die sich noch sehr deutlich der erst durch Kleisthenes vollzogenen Auflösung des alten Stammesstaates, der Geschlechterverfassung der Phylen, erinnerte. Offenbar war der athenische Staat aus der Vereinigung der Geschlechter, der Familien, entstanden: wie in die alten Phylen die schon in ihnen vorhandene Gliederung der Klassen in „Fürsten der Stammhäuser“ und Edelinge, Freie und Sklaven hineingekommen war, darüber zerbrach Aristoteles sich den Kopf so wenig wie zwei Jahrtausende später Filmer, Albrecht v. Haller und sein neuester Anhänger, Funck-Brentano, von denen bald die Rede sein wird.
Diese Lehre war „universalistisch“, ging, wie Aristoteles' Methode es überall forderte, vom Ganzen zu den Teilen, hier von der lebendigen Gruppe zum Individuum, nicht vom isoliert gesehenen, verabsolutierten Individuum, dem Teile aus, zum Ganzen[2].
Die Auffassung bedeutet, von diesem Manne vorgetragen, bereits eine sozusagen „romantische“ Reaktion gegenüber dem Individualismus und Rationalismus seiner Zeit, gegenüber der „Aufklärung“, die in Hellas gerade so aus der Auflösung aller alten gewachsenen Bindungen entstand, wie Jahrtausende später in Westeuropa. Ihre ersten Vertreter waren die Sophisten[3]. Die Zeit vorher hatte, wie jede nicht heillos kranke Gesellschaft, deren „Consensus“[4] noch einigermaßen besteht, die Ordnung der
[1] Kaerst, Gesch. d. Hellenismus, S. 106.
[2] S. S. I, S. 5, S. 31, S. 94ff.
[3] Kaerst, a. a. O. I. Bd. Zweites Kapitel. Das folgende vorwiegend nach ihm dargestellt. Die eingeklammerten Seitenzahlen beziehen sich auf dieses Buch.
[4] S. S. I, S. 454ff., S. 47off.
[26]
staatlichen Gesellschaft als heilig verehrt. Sie galt als eine Schöpfung der vom göttlichen Ratschluß gelenkten Natur.
Dieser „Gemeinschaftsidee“ tritt nun eine ganz andere entgegen, die „vom einzelnen Individuum ausgeht und dessen Gesichtspunkte und Interessen zum entscheidenden Maßstabe der Weltauffassung und Lebensgestaltung macht“ (55). „Der Mensch ist das Maß aller Dinge“ heißt das Meisterwort des Protagoras (485—415). In seinem Sensualismus, Relativismus und Empirismus löst sich alles Absolute auf, auch das Sittengesetz: es besteht nicht mehr „von Natur wegen“ (φύσει), sondern durch menschliche Satzung (νόμω). Diese Auffassung wird zuerst dem jonischen Naturphilosophen Archelaos in den Mund gelegt: „Das Gerechte und Häßliche besteht nicht von Natur, sondern durch die menschliche Satzung“ (59/60). Mit anderen Worten: Recht, Sittlichkeit und Staat-Gesellschaft sind nichts Gewordenes, sondern ein Gemachtes, entstammen, um mit Toennies zu reden, nicht dem Wesen-, sondern dem Kürwillen. Das ist der große Gegensatz, der später die stoische von der epikuräischen Lehre trennt.
Protagoras selbst versucht noch eine Synthese zwischen den beiden schon zu seiner Zeit kämpfenden Anschauungen: eine Synthese mit religiösen Mitteln, wie sie ähnlich viel später die neuzeitliche Staatslehre vornahm. Platon hat sie uns in dem Dialog dargestellt, der den Namen des großen Sophisten trägt: „Prometheus und Epimetheus haben von den Göttern den Auftrag erhalten, die sterblichen Wesen mit den notwendigen Fertigkeiten und Mitteln zum Leben auszustatten. Nachdem Epimetheus für die übrigen Geschöpfe die Verteilung durchgeführt hat, bleibt allein der Mensch ungerüstet für den Kampf ums Dasein [1]. Da entwendet Prometheus dem Hephaestos und der Athene das Feuer und die Kunst des gewerblichen Lebens; es fehlt aber den Menschen die staatliche Kunst, die Zeus bewahrt. Dieser Mangel macht sich zum Verderben des menschlichen Geschlechts geltend. Die Menschen verehren die Götter, bilden eine Sprache aus, gewinnen die Mittel, für ihre Nahrung und Wohnung zu sorgen, aber sie leben zerstreut, sind auf sich selbst angewiesen und haben keine Städte. Deshalb können sie sich vor wilden Tieren nicht schützen. Sie suchen sich infolgedessen zu vereinigen, aber da sie die staatliche Kunst nicht haben, tun sie einander unrecht, zerstreuen sich wieder und gehen so zugrunde. Da sendet Zeus ... Hermes zu den Menschen, der ihnen die δίκη und αιδώς, das Rechts- und Schamgefühl bringt, damit geordnete Staaten und freundschaftliche Bande ... möglich seien... . Hermes verteilt ... die δίκη und αίδώς gleichmäßig unter die Menschen“ (63)[2].
[1] „Für den Menschen bleibt nichts übrig, keine harte Sohle, kein Pelz, kein Huf.“ Vgl. a. Barth, Die Philosophie der Geschichte als Soziologie, S. 268.
[2] Beloch II, 1, S. 123 nennt diese Auffassung „die erste theoretische Rechtfertigung der Demokratie“.
[27]
In diesem Mythus sind die beiden unvereinbaren Elemente, die später auseinandertreten, durch einen „deus ex machina“ im wahrsten Sinne des Wortes rein äußerlich vereinigt: der Vertrag und dennoch das heilige Sollen, das Rechtsgebot, das niemals aus einer reinen Tatsache, einem Sein, abgeleitet werden kann. Aber das, was der Stoa und dem Epikuräismus gemeinsam ist, tritt doch schon deutlich heraus: der Ausgangspunkt von der Schwäche und Bedürftigkeit der Menschen, der Individualismus und Demokratismus der Gesamtauffassung. Hier spricht bereits deutlich die neu zum Siege gelangte Bourgeoisie (70,74). War der Staat zur Wahrung ihrer Interessen da, so lag der Gedanke nahe, daß er auch zum Zwecke ihrer Interessen geschaffen sei. Von hier aus kam es dann leicht zur Leugnung jedes absoluten Rechts und zur Idee des reinen Machtstaates, wie ihn der sonst unbekannte Sophist Kallikles in Platons „Gorgias“, und wie ihn Thrasymachus [1] in der „Politeia“ vertreten. Der „Herrenmensch“ tritt auf den Plan, wie in unserer Zeit bei Nietzsche, Treitschke und Burckhardt. „Der Nomos verlor jede verpflichtende Kraft“ (80); die ihn heiligende Religion erschien hier (wie in unserer Aufklärung etwa bei Voltaire) als eine schlaue menschliche Erfindung (78/9).
Mit dem Fortschreiten der sozialen Zersetzung, dem Verlust der politischen Unabhängigkeit und dem Eintritt in den „weiten Raum“[2] der hellenistischen Großmachtkultur treten die bei Protagoras noch künstlich vereinigten Elemente scharf und klar auseinander. Hasbach schildert die Philosophie der Stoa im Anschluß namentlich an Zeller (Phil. d. Griechen) folgendermaßen: „Die Achse der stoischen Ethik ist die feurige Vernunft, Weltvernunft, Weltseele, welche den gesamten Stoff durchdringt. Die Gottheit ist ebenso als der Urstoff wie als die Urkraft zu bezeichnen, das Urfeuer, welches Gott und die Materie als seine Elemente in sich trägt ... Diese Grundgedanken enthalten erstens die Lehre von einer strengen Gesetzmäßigkeit im Weltganzen ... Aus ihnen folgt zweitens, daß Naturgesetz und Sittengesetz ihrem Wesen und Ursprung nach identisch sind. Dieser nomos ist Gesetz alles Seienden ... und Gesetz ebensowohl des Physikon und des Logikon wie des Ethikon. So wohnt das ethische Gesetz der Natur inne als einzige und absolute Norm, welche, erhaben über Raum und Zeit, gleichmäßig allen Menschen die Regel des Guten und Bösen ist... Sie umschließen drittens den Satz ..., daß das Gesetz auch objektiv außerhalb des Menschen existiert. Sofern nun das Gute in der allgemeinen Weltordnung begründet ist, tritt es dem Menschen als Gesetz gegenüber... Indem dieses göttliche Gesetz von Menschen erkannt und anerkannt wird, entsteht das menschliche... Damit ist die Anerkennung einer
[1] S. S. I, S. 384; Platon-Horneffer 1. c. S. 13.
[2] S. S. I, 688.
[28]
unlöslichen Gemeinschaft aller Vernunftwesen gegeben. Ja, die Stoiker nehmen einen Trieb nach Gemeinschaft zwischen den einzelnen Vernunftwesen an... Sie sind füreinander da, ihre Gemeinschaft ist daher das unmittelbarste Gebot der Natur. Die Stoiker leiten also die Gemeinschaft aus dem Naturgesetze her, nicht das Naturgesetz aus der Gemeinschaft. Das ist zur Charakterisierung der stoischen „Oikeiosis“ wichtig. Und daraus folgt schließlich eine bedeutsame praktische Anwendung: „Insoweit das Naturrecht und das positive Recht sich widerstreiten, muß letzteres aller verbindlichen Kraft ermangeln“ [1].
So ist also der Staat oder die Gemeinschaft — die Begriffe werde noch nicht unterschieden — von Natur wegen (physei) da. Von diesem Standpunkt geht in der Neuzeit Grotius aus (er nennt die „Oikeiosis“, Proleg. 6. S. V.), wie er denn auch, ganz stoisch, ein Recht a priori statuiert: „Actus de quibus tale exstat dictatum, debiti sunt aut illiciti per se“ (Lib.I. cap.I. § 10, 2). „Nicht einmal Gott kann dieses Naturrecht ändern (ib. § 10, 5), so wenig wie er machen kann, daß zweimal zwei nicht vier ist.“
Entgegengesetzt der Stoa ist der Epikuräismus „das umfassendste System des physischen und ethischen Materialismus, welches das Altertum hervorgebracht hat... Dasselbe System, welches das Universum aus dem Fall unbelebter Atome entstehen ließ, erklärte die Gesellschaft aus dem Zusammentreten selbstsüchtiger, von dem Gebote keines inneren oder äußeren Gebotes beherrschter Individuen; Moral und Recht leitet es aus den Nützlichkeitserwägungen der um Frieden und Leben besorgten Menschen ab“. Die Gesellschaft entsteht durch einen Staatsvertrag[2]; vor ihm gab es kein Recht überhaupt, folglich ist alles Recht im Staate positives Recht; es gibt kein anderes. „Das Naturrecht, sagt Epikur konsequent, ist ein Vertrag über das, was geschehen muß, damit wir andere nicht verletzen noch von ihnen verletzt werden“[3].
Also ist nach dem Epikuräismus der Mensch von Natur wegen ungesellig; der Naturzustand ist der „Krieg Aller gegen Alle“; um ihm ein Ende zu machen, treten die Menschen zusammen und schaffen durch einen „Vertrag“ den Staat, der also „durch Satzung“ besteht.
Wenn wir die beiden Theoreme wertend vergleichen dürfen, so steht die stoische Lehre philosophisch und logisch unzweifelhaft viel höher. Sie vermeidet den lächerlichen Fehler, anzunehmen, daß zwischen isolierten Individuen ein Vertrag zustande kommen kann: das setzt ja nicht nur den Besitz einer gemeinsamen Sprache voraus — die doch
[1] Die allgemeinen phil. Grundl. usw. S. 3ff. Vgl. S. S. I, S. 987ff.
[2] Von einem derartigen Vertrage ist schon in Platons „Staat“ (S. 39) die Rede.
[3] Hasbach a. a. O. S. 78. Über den Zusammenhang des Epikuräismus mit Demokrits Atomenlehre vgl. Beloch II, 1, S. 258, namentlich Anm. daselbst.
[29]
nur in der schon bestehenden Gemeinschaft entstehen kann, sondern auch und vor allem ein gemeinsames Recht [1]. Jeder Vertrag setzt ja das Recht voraus, kann es also unmöglich schaffen[2]. Anstatt dessen nimmt die Stoa — allerdings auf Grund einer dogmatisch-metaphysischen Annahme (die in ihrer Wurzel von Heraklit stammt[3])— als Urzustand die gewachsene Gemeinschaft mit ihrer Sittlichkeit und ihrem Rechte an, als natürlicher Auswirkung der allgemeinen Weltvernunft: „Niemals im ganzen Altertum sind das vernünftige Denken und Wollen, die Herrschaft der Natur und des Gesetzes, die wesentliche Harmonie von Natur und Vernunft so hoch emporgehoben, mit solchem Nachdruck behauptet worden wie von den Stoikern. Erst im 18. Jahrhundert begegnen wir einer ähnlichen Verherrlichung von Natur und Vernunft“[4].
Auf der anderen Seite muß zugegeben werden, daß die epikuräische Lehre in ihrer zugrundeliegenden Psychologie prima facie glaubhafter ist als die Gegnerin. Bis auf unseren Schopenhauer hinauf[5] hat sie immer wieder deshalb Freunde gefunden, weil sie den Menschen als eine nur durch die Not und die Furcht gebändigte Bestie darstellte.
Damit hängt ein anderer gegensätzlicher Zug der beiden Lehren zusammen, der gleichfalls geeignet war, dem Epikuräismus Freunde zu werben. Die Stoa ist in ihrem Ausgangspunkte so sehr optimistisch, daß sie in ihrem Fortgang notwendigerweise schwer pessimistisch werden muß. Sie muß, um den Zustand der geschichtlichen Wirklichkeit zu erklären, die allmähliche Verderbnis oder einen plötzlichen „Sünden- fall“ der Menschen annehmen. Sie knüpft an die alte Sage vom Goldenen Zeitalter an. „Während jener glücklichen Urzeit ... herrschte das Naturgesetz ausschließlich; die Verderbnis, die später hereinbrach, hatte das positive Gesetz im Gefolge“[6]. So kommt sie zu einem Dualismus ihrer Rechtsauffassung, der später als der Gegensatz von Naturrecht und positivem Recht sehr einflußreich werden sollte.
Dieser Dualismus bleibt dem Epikuräismus, der nur ein positives Recht zuläßt[7], erspart. Außerdem ist er in seinem Ausgangspunkt so sehr pessimistisch, daß er im Fortgang notwendigerweise optimistisch sein muß[8]. Die Kurve der Entwicklung zeigt hier ebenso steil aufwärts, wie bei der Stoa abwärts. Man versteht, wie leicht eine spätere Periode
[1] S. S. I, S. 474.
[2] S. S. I, S. 357. Vgl. Carl Schmitt: Der Wert des Staates, S. 46.
[3] „Alle menschlichen Gesetze nähren sich aus dem einen göttlichen.“
[4] Hasbach, a. a. O. S. 5.
[5] Grundlage der Moral S. 575.
[6] Hasbach, a. a. O. S. 7.
[7] Vgl. Oncken, Gesch. d. Nat.ök., S. 54.
[8] „Die Geschichte ist nach Lucretius die Geschichte einer allmählichen, stufenweisen Entwicklung zur materiellen, sittlichen und intellektuellen Kultur. Stets muß der Naturalismus die Idee des Fortschritts vertreten“ (Hasbach, a. a. O. S. 9/10).
[30]
zu Versuchen getrieben werden konnte, den optimistischen Anfang der Stoa mit dem optimistischen Fortgang der gegnerischen Lehre zu vereinen.
Wie stark die beiden Lehren in ihrer mittelalterlichen und neuzeitlichen Ausgestaltung auf die Ausbildung der Ökonomik als einer eigenen Wissenschaft gewirkt haben [1], haben die meisterhaften Untersuchungen Wilhelms Hasbachs gelehrt. Uns interessiert hier zunächst nur ihre Fortbildung nach der juristisch-staatsrechtlichen Seite hin.
Ob die Lehre des Aristoteles auch nebenher ein wenig historisch gemeint war, wollen wir dahingestellt sein lassen. Die Antike hatte schon an sich wenig geschichtliches Interesse, und ihre Aufklärungszeit — alle Aufklärung ist un-, fast antihistorisch — noch viel weniger[2]. Aber daß die beiden Grundkonstruktionen der Aufklärungsphilosophie durchaus nicht als Darstellung eines geschichtlichen Verlaufs gedacht waren, kann keinem Zweifel unterliegen. Sie waren, wie wir schon sagten, lediglich philosophisch gemeint, wollten Recht und Staat im idealen Sinne, d. h. den überhistorischen „Rechtsstaat“, widerspruchsfrei ableiten und wählten zu diesem Zwecke eine Konstruktion oder vielleicht sogar „Fiktion“, die alles Geschichtliche, im philosophischen Sinne also Zufällige, absichtlich ausschloß[3]. Dennoch sind alle drei Theorien der Gefahr nicht entgangen, die ihnen von der unausrottbaren Neigung des ungeschulten Geistes drohte, alles „linear“[4] zu sehen: sie sind vielfach als Darstellungen eines geschichtlichen Verlaufs betrachtet und als historische Autoritäten behandelt worden.
Ihre weitere Geschichte beruht darauf, daß sie alle drei, so verschieden sie auch in der philosophischen Grundlage und Grundstimmung waren, doch in einem Punkte übereinstimmten: sie lassen sämtlich von ihrem Ausgangspunkt aus, rein aus inneren Kräften, ohne Eingriff irgendeiner äußeren Gewalt, den historischen Staat entstehen. Dieses Moment kam zusammen mit der Überzeugung von
[1] „Der Stoizismus hat nachweislich Bausteine zur Naturrechtslehre des 17. und 18. Jahrhunderts geliefert, auf Grund deren sich das physiokratische System aufgebaut hat. Der Epikuräismus andernteils vertritt die gleichen philosophischen Ideen, wie sie dem modernen Manchestertum und, wiewohl nach der historischen Seite hin ergänzt und aufs Proletariat übertragen, auch dem Marxismus zugrunde liegen. Man weiß, daß Marx als Student eine Doktordissertation über Epikur ausgearbeitet hat“ (Oncken, a. a. O. S. 47/8).
[2] Vgl. über die unhistorische Tendenz der Aufklärung S. S. I, S. 5 und Anm. 2 daselbst. Zur antiken Historik, S. S. I, S. 753ff.
[3] Genau so muß auch die Ökonomik vorgehen und ist sie in allen ihren guten Vertretern wirklich vorgegangen. Vgl. S. S. III, S. I99ff. : „Zur Geschichte der rein-ökonomischen Methode.“ «) S. S. I, S. 37, S. 56.
[31]
der geschichtlichen Wahrheit der Konstruktionen zur Geltung in dem Augenblicke, wo zuerst ein Konflikt zwischen Staat und Gesellschaft ausbrach.
Das war in der Antike unmöglich [1]. Staat und „Gesellschaft“ wurden nicht nur nicht unterschieden: sie konnten nicht unterschieden werden, weil sie in Wahrheit eines waren[2]. Es gab keine mächtige, außerhalb des Staates ansässige Kirche, die sich als Vertreterin gesellschaftlicher Interessen und eines dem positiven Rechte fremden und überlegenen Rechtes hätte gegen den Staat stellen können; — und es gab keinen tief eingewurzelten allmächtigen Staat veralteten Rechts, der sich auf die Dauer mit Erfolg dem Aufstieg der „Gesellschaft“, d. h. auch hier der Bourgeoisie, hätte widersetzen können. Sie hatte schon unter Solon (593), dann entscheidend unter Kleisthenes, ihren Sieg über den Feudal- und Geschlechterstaat gefeiert (509). Ein starker Gegensatz zwischen drittem und viertem Stande konnte nicht aufkommen, weil der vierte Stand, soweit er aus Sklaven bestand — und das war der größte Teil — weder zum Staate noch zur Gesellschaft gehörte[3] ; die freien Proletarier aber waren durch stärkste Interessen ökonomisch an dem Fortbestand der Sklaverei interessiert, und politisch hatten sie ja alle Rechte. (Wir werden diese Zusammenhänge bei der Darstellung der kapitalistischen Sklavenwirtschaft sehr genau analysieren.) Unter diesen Umständen konnte wohl leicht eine Regierung, aber nicht „der Staat“ als solcher in Konflikte geraten; und deshalb fehlt im Altertum die Auswertung der philosophischen Doktrinen vom Staate für den politischen Kampf so lange, bis auch hier die Grundlage der ganzen Ordnung in Frage gestellt wird: die Sklaverei selbst. Das geschieht erst im weiten Räume des Hellenismus, greift aber nicht auf die Kritik des Staates als solchen weiter.
b) Mittelalter.
Der Mensch der Neuzeit hat es nicht leicht, sich von dem Staate des Mittelalters einen zureichenden Begriff zu machen. Er ist sowohl von der antiken Polis, wie auch von dem modernen Staate völlig verschieden. Nicht wie die antiken „Seestaaten“ um eine Stadt entstanden,
[1] Vgl. Treitschke, Politik I, S. 191.
[2] „Höchster Lebenswert war in der Blütezeit des Stadtstaates der Staat. Ethik und Staatsethik fielen dabei zusammen, deshalb gab es keinen Konflikt zwischen Politik und Moral. Es gab ja auch keine universale Religion, die mit ihren Geboten das freie Walten der staatlichen Kräfte einzuengen versuchte“ (Meinecke, a. a.O. S. 32/3). Vgl. a. bei Kistiakowski, a. a. O. S. 7, Anm. eine Stelle aus K. Hildebrandt, wonach keinem griechischen Denker der Unterschied von Staat und Gesellschaft zum Bewußtsein gekommen war.
[3] Das deutet auch Treitschke an. Politik I, S. 260.
[32]
nicht früh geldwirtschaftlich durchorganisiert und zentralisiert, ist der mittelalterliche Staat seinem Ursprung nach „Flächenstaat“ und bleibt als solcher lange Zeit naturalwirtschaftlich rückständig und äußerst locker organisiert. Er ist mehr ein Bündel von sehr selbständigen Land- und Landsmannschaften als das, was wir heute einen „Staat“ nennen [1]. Und er steht von Anfang an wenigstens moralisch unter einer Gewalt, die das Altertum nicht kannte, dem Christentum in seiner Zusammenfassung durch Rom: „Die neue universale Religion stellte zugleich ein universales Moralgebot auf, dem auch der Staat gehorchen sollte, verwies den einzelnen Menschen auf jenseitige Werte... Vereint mit der christlichen Ethik hielt dann im Mittelalter der germanische Rechtsgedanke den Staat nieder. Wohl gab es einen Staat ..., aber er galt nicht als souverän. Das Recht war ihm übergeordnet, er war Mittel zur Verwirklichung des Rechts“[2].
Theoretisch herrschte hier sehr lange die Staatslehre des Aristoteles, der ja nahezu wie ein Kirchenvater verehrt wurde[3]. Sie entsprach auch in ihrer universalistischen Prägung und konservativ-agrarischen Haltung sehr wohl dem Geiste der Zeit, in der ja lange ein wirklicher „Consensus“ bestand. „Nicht nur Thomas von Aquino, auch der kühne Marsilius von Padua stehen ganz auf dem Boden der theologischaristotelischen Lehre.“ So konnte hier die Theorie des staatsbildenden Gesellschaftsvertrages keinen Boden gewinnen: sondern „die kirchliche Anschauung erblickt den Grund des Staates in einem durch die Erbsünde bedingten übermenschlichen Willensakte, vermag daher den menschlichen Willen nicht als einzige Basis des Staates anzuerkennen“. Freilich gibt es auch hier eine Vertragslehre, aber sie darf nicht mit der des Epikur verwechselt werden. „Die Vertragslehre des Mittelalters ist nicht die Lehre von der primären Schöpfung des Staates- sondern von der Einsetzung des Herrschers im Staate. Nicht der populus, sondern der rex entsteht durch den Vertrag. Die mittelalterliche Lehre ist daher überwiegend Lehre vom Subjektionsvertrag, der die Verfassung des Staates, aber nicht den Staat selber schafft. Wenn sich daher auch hier und da Spuren eines Gesellschaftsver-
[1] Gierke tadelt es, „daß viele Rechtshistoriker ... in die flüssige Staats- und Rechtsordnung der germanischen Vorzeit die scharf formulierten Kategorien des modernen juristischen Dogmas hineinlegen“ (zit. nach v. Below, Der Deutsche Staat des Mittelalters, S. 57).
[2] Meinecke, Idee der Staatsräson, S. 33.
[3] Daneben wurde auch die stoische Tradition gepflegt, die, wie Hasbach (a. a. O. S. 16) zeigt, dem Christentum sehr nahe verwandt war: „Für den Nous, den Logos tou Pantos trafen sie den Theos oder Logos; das christliche Universalreich war mit dem Weltstaate der antiken Philosophen verwandt; der angenommene Naturzustand der griechisch-römischen Denker erhielt durch die christliche Lehre vom Paradiese die kräftigste Bestätigung“. Auch glauben beide an Verderbnis und Sündenfall.
[33]
träges nachweisen lassen, der nicht die Gewalt im vorhandenen Staate ableiten, sondern den Staat selbst konstituieren will, so kommt es dennoch nirgends zu einer klaren Darstellung dieses Vertrages“ [1].
Die Verschiebung des Gesichtspunktes ist klar und ist wichtig. Sie beruht darauf, daß „der Staat“ als solcher zum ersten Male in der europäischen Geschichte mit einer anderen Macht in offenen Konflikt geraten war: der römischen Kirche[2]. Die päpstliche Weltpolitik streitet gegen die nationalen Mächte[3].
Den Höhepunkt des Kampfes und der publizistischen Bewegung bildet das II. Jahrhundert, insbesondere die Zeit Papst Gregors VII. und Kaiser Heinrichs IV. : der Investiturstreit. Gregor schreibt (1081) an Hermann, Bischof von Metz: „Wer weiß es nicht, daß die Fürsten ihre Herrschaft über die Menschen den Feinden Gottes verdanken, die durch Hochmut, Raub, Verrat, Meuchelmord und alle anderen Verbrechen, geleitet vom Satan, herrschen wollen über ihresgleichen, d. i. über Menschen“[4]. Hier gewinnen Gedanken politische Gestalt und Gewalt, die siebenhundert Jahre zuvor der Heilige Augustin in seiner religiösen Phantasie „De civitate dei“ ausgesprochen hatte[5]: der weltliche Staat, als die civitas terrena sive diaboli steht der civitas coelestis sive dei, dem Gottesreiche, der „Idee“ eines Staates (im platonischen Sinne der Idee) gegenüber. Jetzt wird aus der Philosophie europäische Politik[6]: über Jahrhunderte und durch alle Länder des katholischen Glaubens geht der Kampf zwischen weltlicher und geistlicher Gewalt, und hier zum ersten Male wird „der Staat“, nicht eine einzelne Regierung, sondern eben „der“ Staat, Problem und als solcher Gegenstand leidenschaftlichster Angriffe und ebenso leidenschaftlicher Verteidigung; hier zum ersten Male wird sein positives Recht an einem anderen, göttlichen, weil von Gott selbst in die Menschennatur gepflanzten, von ihm offenbarten und der Kirche als seinem Wächter anvertrauten, „natürlichen“ Rechte gemessen — und oft als zu leicht befunden. Hier liegt die Wurzel der gewaltigsten politischen Um-
[1] Jellinek, a. a. O. S. 204/5.
[2] Vgl. Gothein, Art. „Gesellschaft“ Hdw. d. Stw. IV, S.694. Ferner Mitscherlich, „Der Nationalismus Westeuropas“, S. 103.
[3] Vgl. Salomon, Geschichte als Ideologie, Festschr. für Fr. Oppenheimer, S. 453.
[4] Mirbt, Die Publizistik im Zeitalter Gregors VII, S. 23 zit. n. Gumplowicz, Gesch. d. Staatsth. S. 93.
[5] Vgl. Jellinek, a.a.O. S. 187: „Die civitas terrena ist zwar nicht mit dem historischen Staate identisch, trägt aber unverkennbar dessen Züge; er erscheint als ein Werk des Bösen.“
[6] Über die Weltherrschaftspläne Innozenz III. und den Widerstand des Hl. Bernhard dagegen vgl. Röscher, Politik, S. 108. Hier taucht das Bild von den „beiden Lichtern“ (luminaria) auf; das größere, die Sonne, ist der Papst, der Kaiser nur der Mond. Später erklärt sich namens der christlichen Armut Marsilius v. Padua gegen das Fürstentum des Papstes (Bluntschli, a. a. O. S. 11).
[34]
wälzungen, die unserem Europa zuletzt seine Geistesfreiheit und weiterhin auch seine politische Emanzipation bescherten, weil der Kampf der beiden Mächte den Bann der Geisterfurcht löste, der vorher die Völker gefangen hielt ; und hier liegen die Wurzeln der einflußreichsten Gedanken, die später die Wissenschaft befruchten sollten. Wie zum ersten Male, im Gegensatz zur Antike, die Vorstellung dämmerte, daß der Staat nicht mit der Gesellschaft eines sei, so wurzelt hier auch die Staatsverachtung des Manchestertums, die im Anarchismus ihren Gipfel erreicht: denn schon damals erschien der Staat oft als „das böse Tier“ : schon am 30. Dezember 1367 bekannte Johannes Spinner in Erfurt vor dem Inquisitor Kerling [1] das Credo Stirners vom „Einzigen und seinem Eigentum“: „Der freie Mensch schuldet niemandem Gehorsam; er ist Herr über alle Dinge, von denen er nehmen darf, was er braucht. Jeder, der sich seinen Plänen entgegensetzt, darf von ihm getötet werden: selbst über das Leben des Imperators darf er mit Recht verfügen, wenn dieser ihm hinderlich ist[2].“ Und ebenso wurzelt hier die Lehre von der Volkssouveränetät, die Jahrhunderte später, in Rousseaus Formel, so viel dazu beitrug, den Feudalstaat zu Boden zu werfen.
Auf der Seite des Papstes stehen in diesem Kampfe als erste Theoretiker Hugo von St. Victor, ferner Thomas Becket, der Erzbischof von Canterbury, der 1170 an seinem Altar von königlichen Söldnern erschlagen wurde, und dessen Freund und Sekretär, „der größte kirchliche Theoretiker des Monarchenhasses[3]“: Johann von Salisbury; auf der weltlichen Seite eröffnet den Reigen, „zweihundert Jahre vor Marsilius und Wyklif“, unter Wilhelm II. von England „der Anonymus von York, der die Freiheit des Staates von der Kirche proklamiert“[4]. Auch in Frankreich unter Philipp dem Schönen „rafft der Staat sich zusammen und spricht aus, der Papst habe nichts zu sagen in diesem Königreich[5]“.
„Das französische Königtum gibt der antipapistischen Propaganda den Anstoß, in seinem Auftrage schreiben Ägidius und Johann von Paris, von denen Marsilius und Occam ausgehen. Die Franziskaner setzen der Begründung der päpstlichen Obergewalt und Weltherrschaft durch Christus als ersten Papst die Gegenerklärung der evangelischen Nachfolge und im Widerstreit gegen die Verweltlichung den Gedanken der armen Kirche entgegen. Occam, der Johann XXII. der Ketzerei überführt, begibt sich in kaiserlichen Schutz“[6].
[1] Offenbar identisch mit dem Dr. theol. Walter Kerlinger, der um die Mitte des XIV. Jahrh. das officium inquisitionis haereticae bekleidete (Stintzing I, S. 9).
[2] Treumann, Die Monarchomachen, S. 46.
[3] Gumplowicz, Gesch. d. Staatsth., S. 98; vgl. Wolzendorff, Staatsr. u. Naturr., S. 8.
[4] Brodnitz, EngL Wirtsch.-Gesch. I, S. 89.
[5] Treitschke, Politik I, S. 333.
[6] Salomon, a. a. O. S. 452.
[35]
Die Kirche bietet Angriffspunkte genug. „Die kirchliche Welt bereitete durch ... die fortschreitende Durchdringung des Papsttums mit weltlich-politischen Interessen, durch die vielfach schon sehr utilitaristische Gedankenbewegung der Konzilszeit und durch die rationale Ausbildung des päpstlichen Finanzsystems den Geist einer neuen Staatskunst vor. Das stärkste Motiv für eine solche aber lag doch in der beginnenden nationalen Staatenbildung ... Die universalen Ideen des mittelalterlichen Corpus christianum brachen sich an den neuen nationalen und partikularen Willenszentren“ [1].
Der Hauptkampf geht zwischen Papst und Kaiser. Der römische Kaiser deutscher Nation behauptet, durch die „translatio imperii“ der rechtmäßige Nachfolger der römischen Imperatoren zu sein. Gegen ihn rufen die Päpste das „absolute Naturrecht“ ins Feld. „Es kann dazu dienen, die weltlichen Mächte zu entheiligen durch die Erklärung der naturrechtlichen Volkssouveränetät. Hier ist die Wurzel aller Widerstandsrechte[2]. Hat jede Obrigkeit ihr Amt von Gott, ohne doch, wie das Kaisertum, durch das Wahlrecht von dem Willen des „Volkes“ losgelöst zu sein, so ging der Streit nur um die Absetzbarkeit, denn die Einsetzung wurde von Gregorianern und Antigregorianern ... angenommen. Indem Gregor durch die Unterscheidung von Herrscher und Tyrann das Widerstandsrecht des Volkes erklärte und billigte, gibt er die vorbildliche juristische Rechtfertigung, die dann später von den Ständen gegen das Königtum und in der Konzilszeit gegen die Kirche selbst gebraucht wird“[3].
Auf seiten des deutschen Kaisers steht kein geringerer als der große Dante (1265—1321) mit seiner Schrift „De Monarchia“, in der er um des Friedens halber eine Weltmonarchie unter der Kaiserkrone
[1] Meinecke, Staatsräson, S. 34. Vgl. Frantz, Naturlehre des Staates, S. 402ff. Er macht mit Recht darauf aufmerksam, daß die hohen Kleriker selbst Feudalherren waren. Auch auf die Verdrängung des Latein durch die Nationalsprachen weist er hin. Über die Entstehung nationaler Rechtsschulen vgl. Stintzing II, Kap. 16, S. iff. besonders für Deutschland S. 10/11.
[2] Das ist nicht ganz richtig. Wolzendorff hat gezeigt, daß das Widerstandsrecht der Stände im positiven Rechte wurzelt, dieses im Lehnsrechte, und dieses wieder in einem allgemeinen „germanischen Rechtsgedanken“ (z. B. S. 146), der schon in der Zeit des Urkönigtums stark ist. Und dieses wurzelt wieder im Naturrecht, freilich nicht im „Natur- recht im technischen Sinne“, sondern in seinem Sinne als Volksrecht, womit ein allgemeiner psychologischer Tatbestand der Volksseele bezeichnet werden soll. Das ist auch unsere grundsätzliche Auffassung.
[3] Salomon, a. a. O. S. 448· Vgl. Wolzendorff, a. a.O. S. 13; „Hier lehrt die sogenannte konziliare Theorie die naturrechtliche und unzerstörbare Souveränität zunächst der Gesamtheit in der Kirche, dann nur der aktiven im Klerus verkörperten Mitgliedschaft der Kirche. Ganz entsprechend der staatlichen Lehre wir4 auch von dieser kirchlichen Lehre aus der Souveränität des Konzils für dieses das Recht abgeleitet, den Papst zu entsetzen.“
[36]
fordert: eine ghibellinische Antwort auf die Bulle „Unam sanctam“ (1302), in der Bonifacius VIII. die Unterordnung des weltlichen Schwertes unter das geistliche beansprucht hatte [1]. Und nur wenig später tritt Dantes Zeitgenosse, Marsilius von Padua (1270—1340), der kühnste und konsequenteste aller ghibellinischen Publizisten, der Leibarzt Kaiser Ludwigs des Bayern, mit seinem „Defensor Pacis“ auf den Plan (1324). Seine Lehre klingt wie eine Vorwegnahme der wichtigsten Sätze Rousseaus: „Die gesetzgebende Gewalt kann nur dem Volke, d. h. der Gesamtheit der Bürger, oder dessen Mehrheit zustehen, wenn es seinen Willen in einer allgemeinen Versammlung dartut. Die Exekutive befiehlt kraft der Autorität, die ihr vom Gesetzgeber eingeräumt ist... Die anderen Konsequenzen der Volkssouveränetät sind, daß der Fürst den Gesetzen unterworfen ist, und daß er dem Volke für seine Taten einstehen muß, welches ihn eventuell richten kann. Die Eigenschaft, Bürger zu sein, ist von der Konfession vollständig unabhängig“[2].
Uns will scheinen, als ob hier schon ein neuer Ton ankündigt, daß eine neue Klasse ihre Ansprüche anmeldet. In Nordwesteuropa beginnt die „Neuzeit“ gegen das Ende des 14. Jahrhunderts, in Italien aber, dessen Stadt- und geldwirtschaftliche Gestaltung niemals vollkommen unterbrochen worden war, wesentlich früher. Die lombardischen Bankiers waren neben denen von Cahors (Kawerziner, Cawerschen) die zeitlich ersten der neuen Zeit, wie die Italiener ja denn auch charakteristischerweise, freilich erst zwei Jahrhunderte später, aber doch vor allen anderen Nationen, mit Untersuchungen über das Geldwesen die ersten Grundlagen einer ökonomischen Theorie legten : Scaruffi, Davanzati und Serra an der Spitze[3].
Auch Marsilius selbst war Bürgerlicher und hatte sich in mancherlei Berufen versucht, ehe er Weltgeistlicher wurde[4]. Aus seinem Munde erklingt, wenn wir uns nicht täuschen, zum ersten Male die Stimme des dritten Standes.
c) Neuzeit.
Für unsere Auffassung, die wir an anderer Stelle[5] ausführlich begründet haben, beginnt, wie soeben gesagt, die Neuzeit in Nordwesteuropa im letzten Drittel des 14. Jahrh. mit der Zersetzung der im wesentlichen „konsensuellen“ mittelalterlichen Gesellschaft, aus der
[1] Oncken, Gesch. d. Nat.-Ök. S. 139/40. Viel später fordert Pietro da Bosco die französische Weltmonarchie, und dann Campanella zuerst die spanische und dreißig Jahre später doch auch wieder die französische. Wir kommen noch auf ihn zurück.
[2] Treumann, a. a. O. S. 23ff. Vgl. Gumplowicz, Gesch. d. Staatsth. S. iigfi., Treitschke, a. a. O. S. 333.
[3] Oncken, a a. O. S. 237/8.
[4] Gumplowicz, a. a. O. S. 119. Vgl. dazu Salomon, a. a. O. S. 452.
[5] Großgrundeigentum und soziale Frage, zweiter, geschichtlicher Teil.
[37]
der moderne Kapitalismus erwächst. Damit setzt die europäische Krise ein, in der wir noch heute stehen [1].
Von jetzt an wird die Stimme der neuen Klasse, des dritten Standes der aufkommenden Kapitalisten, in einem der europäischen Länder nach dem anderen immer lauter vernehmlich, bis sie zuletzt die das Diapason beherrschende Melodie übernimmt. Und damit ändert sich das mittelalterliche Weltbild, und ändern sich die das Staatsleben beherrschenden Kräfte und Ideologien vollkommen: es berührt uns heute fast archaistisch, daß Rankes „Geschichte der Päpste“, die jene Zeit und noch dazu vor allem in Italien behandelt, kaum eine Ahnung von dieser grundstürzenden Umwälzung erkennen läßt.
„Die Florentiner Bankiers, die ihre diplomatischen Intrigen ohne Rücksicht auf geistliche oder kirchliche Interessen durchzuführen pflegten, waren wenig geneigt, dem Himmel einen Einfluß auf die Politik zuzuschreiben“[2]. Die neue Klasse „sieht den Aufstieg und fühlt sich auf der Höhe des bis zu ihr reichenden Fortschritts“[3]. Daher der Optimismus ihrer Weltanschauung, der Aufklärung, die sich dem mittelalterlich-katholischen Pessimismus schroff entgegenstellt. „Das goldene Zeitalter liegt nicht zurück, sondern vorwärts. Wenn das Ideal nicht in der Geschichte, vielmehr in der Vorgeschichte gesehen wird, steht Vernunft der Geschichte gegenüber und entgegen.“ Jetzt wird das Verhältnis umgekehrt: „Der Menschheit, nicht der Gottheit, ist Vollkommenheit zugesprochen, zu der sie im Fortschritt gelangt“[4].
So tritt an die Stelle der Autorität die freie individuelle Vernunft, an die Stelle der Legitimität das Naturrecht. „Die Vertreter des wohlhabenden Bürgertums bestimmen als Aufgabe des Staates die Hebung der ideellen und materiellen Prosperität... Die bürgerliche Gesellschaft braucht eine kritische, politisierende und moralisierende Geschichtsschreibung zur Rechtfertigung ihrer Ansprüche gegenüber den geschichtlich begründeten Mächten: Adel und Klerus. Damit ist schon der antihistorische Rationalismus gegeben... Gegenreformation und Gegenrenaissance, in denen Kirche und Adel wieder zur Geltung kamen, treten zurück. Die staatsbürgerliche und volkswirtschaftliche Gesellschaft erobert sich ihre Freiheit und gibt sich ihre Gesetze; sie findet ihren reinen Ausdruck in der Aufklärung, die den Rationalismus der Renaissance und den Individualismus der Reformation radikal weiterführt“[5].
Schon die Renaissance ist wesentlich der Ausdruck der wirtschaft-
[1] Vgl. S. S. III, S. 154.
[2] Fueter, Gesch. d. Historiographie, S. 13.
[3] Salomon, S. 431.
[4] Salomon S. 432/3.
[5] Salomon, a. a. O. S. 435/6.
[38]
liehen Umwälzung. Aber wie überall dem eigentlichen, soliden Unternehmer der „merchant-adventurer“ vorausgeht, noch eine Kreuzung von Edelmann-Krieger und -Unternehmer, eine Art von Mittelding zwischen Land- oder Seeräuber und Kaufmann, so auch hier: „Renaissance bedeutet die Wiedererhebung italienischen Bürgergeistes. Eine geldwirtschaftlich bedingte Schicht von Emporkömmlingen braucht Prestige und begönnert die Kunst [1]... Der Exodus des Geistes aus der Kirche wird ermöglicht durch die Verweltlichung des Papsttums, das wie ein Landesfürstentum wirkt, und durch die Begünstigung, die von Handelskontoren und politischen Kanzleien ausgeht“[2]. Aber diese Bewegung ist „nur der Vorsprung kleiner Kreise“, während die Aufklärung „getragen wird von einer verbreiterten Besitz- und Bildungsschicht“[3].
Diese Umschichtung der Klassen und die mit ihr verbundene Umwälzung des Geistes geht allmählich über ganz Europa : von Italien, wo sie am frühesten entstehen konnte, weil, wie gesagt, die Geldwirtschaft und, wie wir hinzufügen wollen, der aus dem Altertum übernommene und durch die germanische Eroberung noch gestärkte Großgrundbesitz ohne wesentliche Unterbrechung und Erschütterung fortbestanden; — von Italien, dessen Entwicklung andererseits durch die unglücklichen Verhältnisse der politischen Zersplitterung und der Fremdherrschaft aufgehalten und in eine andere geistige Richtung gedrängt wurde[4] (statt zur Staatstheorie zur Staatskunst: davon später) — von Italien ging der Weg über die beiden großen Seemächte der Zeit, Holland und England mit ihrer schnell wachsenden mächtigen Bourgeoisie, später nach dem durch seinen Feudalismus schwer gefesselten Frankreich
[1] Auch die griechische Kunst wächst an den Höfen von Tyrannen und ehemaligen Condottieri empor. Athen war unter den Pisistratiden der Mittelpunkt aller künstlerischen Bestrebungen; die ersten Dichter und Tonkünstler der Nation, Simonides, Ana- kreon, Lasos wurden berufen (Beloch, Griechische Geschichte Ι, 1 S. 390/91 und S. 416). Mit ihm wetteiferte Hieron von Syrakus. Kein geringerer als Aischylos, der seine „Perser“ hier zum zweiten Male aufführen ließ, schrieb ein eigenes Stück für die syrakusische Bühne, die „Aetnaeerinnen“ (Beloch, a.a. O. II, I, S. 73 und 224). Der makedonische Hof folgte, schon unter Perdikkas, vor allem unter Archelaos: „Makedonien wurde unter seiner Regierung zu einem Mittelpunkt des geistigen Lebens der Nation“ (Beloch, a.a.O. III, 1, S. 23). Ganz wie im Italien der Renaissance beteiligten sich auch die kleineren Höfe, z. B. Klearchos von Herakleia, „ein hochgebildeter Mann, der bei Isokrates und Platon studiert hatte“, er war der erste Fürst, der eine Bibliothek anlegte (ib. 138/39). Die Fürstenhöfe von Pella und Pherae, von Halikarnassos und Syrakus suchten in der Pflege der Kunst ihren Ruhm; „überall entstanden Theater“ (ib. 263).
[2] Salomon, a. a. O. S. 443.
[3] Salomon, a. a. O. S. 432.
[4] Vgl. Meinecke, a. a. O. S. 97/8: „Der revolutionäre Geist ging von der ständischen, durch den Calvinismus befruchteten Idee in Frankreich und den Niederlanden aus. Italien, in dessen fürstlichen Staaten die ständische Idee tot war, bot keinen Boden dafür.“
[39]
und, in geringerem Maße, nach dem noch stärker gefesselten Spanien, und erst zuletzt nach Deutschland : denn überall vollzieht sich der Aufstieg der Klasse und die Umformung der Ideen in den Nationalstaaten im Bunde mit dem Absolutismus. Deutschland aber war kein Nationalstaat, sondern ein „geographischer Begriff“.
Man versteht weder das Naturrecht noch die in ihm sich äußernde soziale Bewegung, wenn man das Verhältnis des dritten Standes zur absoluten Monarchie mit den Augen des ausgehenden 18. oder gar des 19. Jahrhunderts anschaut. Sie sind ursprünglich natürliche Verbündete, wie sie ja auch Kinder der gleichen Zeit und des gleichen Geistes, sozusagen Zwillinge aus der Ehe der Gewalt mit dem Kapitalismus sind. Der gemeinsame Feind ist der Feudalismus, den der Monarch niederwerfen muß, um den Staat zu der finanziell und militärisch mächtigen Maschine machen zu können, deren die Dynastie bedarf: derselbe Feudalismus, der den Kaufmann und Unternehmer besteuert, wohl auch unmittelbar ausraubt, und ihm, was viel empfindlicher ist — denn über dem Wirtschaf fliehen steht das „Prestige“ [1] — die gesellschaftliche Ehre versagt, das Connubium und Commercium weigert. Beide, Monarch und dritter Stand, müssen sich gegen die „Libertäten“, die historischen Rechte des Adels und der Kirche, auf das natürliche Recht und die „necessità“ einer neuen Zeit berufen, sind also von vornherein anti- traditionalistisch-rationalistisch gestimmt, wozu der Städter an sich neigt[2], wie denn auch die Rationalisierung des Staates, namentlich des Heerwesens (das bekanntlich die erste Art der großen Unternehmung darstellt), früher und großartiger erfolgt ist als die der Fabrikation und sogar des Bankgewerbes. Der absolute Staat ist ferner aus politischen Machtgründen gezwungen, dem Kommerz, der, da Adel und Klerus praktisch steuerfrei sind, allein ihm das Geld für das stehende Heer und den steigenden Luxus der Hofhaltungen liefern kann, durch Privilegien, Subsidien usw. das Verdienen zu erleichtern; das ist das Geheimnis des Merkantilismus, der sich überall als das Bündnis der Höfe und ihrer Fisci mit dem großen Kommerz darstellt[3]. Auch darin sind
[1] S. S. I, S. 896/7
[2] S. S. I, S. 666/7.
[3] Vgl. S. S. III, S. 162. „Was Luther an Beschwerden über die Monopolia vorbringt, tritt sachlich in engsten Zusammenhang mit dem, was in Gutachten, sonderlich im „Ratschlag des kleinen Ausschusses über die Monopolien“ dem Reichstag vorgelegen hatte. Dem mangelhaften Erfolg der Bemühungen entsprach die gegensätzliche Stellung des Kaisers Karl, dessen Interessen sich von vornherein mit dem Großhandel verbunden hatten.“ Es erging ein kaiserliches Mandat, „in welchem er sich zu der Anti-Monopolbewegung des Reichstags in direkten Gegensatz stellt. Zum erstenmal ist hier öffentlich von seiten der höchsten staatlichen Gewalt der Grundsatz durchbrochen, der die mittelalterliche Wirtschaftspolitik beherrscht hatte: die Forderung des gerechten Preises ... ist vom Kaiser ... fallen gelassen worden. Den Monopolinhabern und Bergwerkbesitzern wird ausdrücklich das Recht zugestanden, ihre Erze und Metalle zu dem höchsten Preise zu verkaufen, den sie erhalten können“ (v. Schuberth, Wirtschaftl. Entscheidungen Luthers, Kauf und Darlehn, S. 63/4). Luther selbst sieht sich gezwungen, den Zins bei Produktivdarlehen als gerecht zuzulassen, während er ihn bei Konsumtivdarlehn verwirft (ib. S. 76).
[40]
die beiden Gebilde einander ähnlich, daß sie von Haus aus „nationalistisch“ sind: der absolute Monarch muß den Nationalismus pflegen [1], um aus der künstlich aufgebauten Maschine seines Staates erst einmal einen belebten Körper zu machen, eine von einem Geiste beseelte „hochorganisierte Gruppe“ im Sinne Mac Dougalls[2]; dazu muß er die Landessprache pflegen, die, wie wir aus schlimmer Erfahrung wissen, leicht zu einer Art von Kampfpanier gemacht werden kann, namentlich, wenn eine zu bekämpfende fremde Macht sich einer anderen Sprache bedient, wie die katholische Kirche des Latein; das hat vor allem in den protestantischen Staaten[3] zur Pflege der eigenen Sprache getrieben; aber es gibt auch noch weniger imposante Gründe dafür: man braucht im Absolutismus dringend aus Prestigegründen Nationalgeschichten zur Propaganda im Auslande und im Inlande, Bücher, die nicht nur die des Latein Kundigen, sondern auch der neue Bildungsstand lesen sollen und wollen; und man will z. B. in Frankreich damit der von Italien herkommenden Konkurrenz ein Paroli biegen[4].
[1] Meinecke, Weltbürgertum und Nationalstaat, S. 19/20) zeigt sehr schön, daß die gemeine Ansicht, die „Weltbürgertum und Nationalgef ülil wie zwei sich ausschließende, sich lediglich nur bekämpfende und einander ablösende Denkweisen gegenüberstellt“, allzu primitiv ist. Die beiden Einstellungen sind miteinander sehr gut verträglich, und die Überzeugung der besten Männer, daß „das beste deutsche Nationalgefühl auch das weltbürgerliche Ideal einer übernationalen Humanität mit einschließe, daß es undeutsch sei, bloß deutsch zu sein“, kommt der Wahrheit schon viel näher. „Bei Novalis war dieser Universalismus angeknüpft an den mittelalterlichen theokratischen Universalismus, bei Friedrich Schlegel an die weltbürgerlichen Ideen der Revolution“ (81). Fichte entwickelt die Meinung, „daß es gar keinen Kosmopolitismus überhaupt geben könne, sondern, daß in der Wirklichkeit der Kosmopolitismus notwendig Patriotismus werden müsse“ (98). „Es war nicht so, wie man sich oft und bequem die Sache vorstellt, daß der Kosmopolitismus fade und abgelebt am Boden lag, und der junge nationale Gedanke nun leicht und siegreich emporstieg, sondern Kosmopolitismus und Nationalität standen noch geraume Zeit in einer engen Bluts- und Lebensgemeinschaft“ (126). Das ist ja auch kein Wunder: beide Gedankenrichtungen und Arten der Einstellung zur Welt stammen aus dem Rationalismus, das Weltbürgertum und der moderne Staat, also auch die diesem Staate zugewendeten Ideen. Friedrich der Große hatte ja seinen adligen Offizieren „gleichviel aus welcher Provinz sie stammten, einen preußischen Gemeingeist, einen esprit de corps et de nation einblasen wollen“ (35). Das ist überall und muß überall sein das Bestreben des absoluten Staates, und ist fast überall geglückt, auch wo es sich um zusammengefegte disparate Elemente handelt: bei den Janitscharen, geraubten Christenkindern, bei den durch „Pressung“ zusammengebrachten Truppen Friedrichs, Tschakas und Sebituanas.
[2] Vgl. S. S. I, S. 575.
[3] Vgl. S. S. I, S. 644. Ferner Frantz, Naturlehre, S. 402.
[4] Salomon, a.a.O. S. 471. Über die Rebellion der nationalfranzösischen Juristen gegen das römisch-italische Recht vgl. Stintzing, a. a. O. II, S. 20/1. Hasbach a. a. O. 46.
[41]
Der Nationalismus, wie wir ihn heute kennen, beginnt erst im 15. Jahrhundert, also etwa zugleich mit dem Kapitalismus [1]. Röscher bemerkt sehr fein[2], daß in aristokratischen Staaten „Vaterlandsliebe, Nationalgefühl usw.“ nicht aufkommen können, sondern nur in Demokratie und Monarchie. Diese „Drittenstandsbewegung“, mit der sicherlich auch die Reformation eng zusammenhängt[3], diente dazu, die Entwicklung zum absoluten Staat kräftig zu befördern[4]. Das Bürgertum suchte geradezu in der absoluten Monarchie die stärkste Stütze seiner Stellung: „Die absolute, auf die Autorität des Corpus juris gestützte Gewalt des Königtums war die Lieblingsidee nicht nur des französischen Hofes, sondern vorzüglich auch des dritten Standes und seiner Juristen, weil sie von dieser Kraft aus die Beseitigung der feudalen Schranken, die Unterordnung der kleinen Herren, die Bändigung der konfessionellen Parteien, die Einigung der ganzen Nation, eine gleiches französisches Recht und eine energische französische Politik erwarteten“[5].
Schließlich ist der Staat als der einzige Inhaber der Militärgewalt im reifen absoluten Staat, d. h. nach Entwaffnung des frondierenden Adels, auch der einzige Schutz des Reichtums gegen die eben so tief verachtete wie gefürchtete „populace“. Man weiß, daß das einer der Gründe ist, die sogar den kriegerischen Adel in den Hofdienst trieben: um wie viel mehr muß das bei dem friedlichen Bürger gewirkt haben!
Deshalb steht das Großbürgertum überall so lange in festem Bunde mit dem Monarchen, bis dieser, seiner feudalen Feinde ledig, zu keinen Rücksichten gegen den alten Alliierten mehr gezwungen, sich wieder seinen Stammverwandten, dem jetzt ungefährlich gewordenen Adel zuwendet, den Bürger durch seine dynastische Gloriapolitik mit Steuern überlastet, und ihm dennoch in dem starren Rahmen seines Staatengebildes nicht den zum Ersatz nötigen freien Spielraum gewähren kann. Erst dann wird der dritte Stand Gegner des Absolutismus[6].
Das Bündnis spiegelt sich in der gesamten Literatur der Zeit und des Landes, vor allem in der Staatslehre und der Politik in ihrer Bedeu-
[1] Röscher, Politik, S. 82.
[2] Derselbe S. 185.
[3] Lord, a. a. O. S. 23: „Diese Bewegung war die Zusammenfassung und Konzentration aller der in den vorgeschrittenen Völkern entwickelten Elemente des nationalen Patriotismus, so daß das Heilige römische Reich als eine Altertümlichkeit und seine Kirche als ein Aberglaube erschien.“
[4] Röscher, a. a. O. S. 193, Lord, a. a. O. S. 25: „Namentlich in England und Frankreich erhöhte man die Autorität des Königs, um die Ansprüche des Papstes zurückweisen zu können.“
[5] Bluntschli, a.a.O. S. 35. Vgl. Gooch a.a.O. S. 20: „Die Krone zu stärken hieß den Staat stärken, hieß starke Empfindungswerte um den König herum anhäufen, in seiner Eigenschaft als Mittelpunkt und Symbol eines organischen nationalen Lebens.“
[6] Vgl. S. S. IH, S. 163.
[42]
tung als Kunstlehre. In England ist noch Hobbes Vertreter des Absolutismus, und erst mit dem Siege der Wirtschaftsstaates wird Locke Verfechter der konstitutionellen Monarchie. In Frankreich sind noch Voltaire und die Physiokraten unmittelbar am Vorabend der großen Revolution Absolutisten, Gläubige des „aufgeklärten Despoten“ [1], und in Deutschland, das, wie gesagt, am spätesten kommt, vertritt noch am Vorabend der deutschen Revolution Hegel den gleichen Standpunkt.
Die einzige scheinbare Ausnahme bilden in den Zeiten der Reformation und Gegenreformation die Monarch omachen. Aber hier spricht auch nicht das Interesse des dritten Standes, sondern ganz oder vorwiegend das der mittelalterlichen Mächte, des Papsttums und der Stände. Von katholischer Seite richtet sich der Kampf gegen die evangelischen Landesfürsten: eine ähnliche Situation wie im Investiturstreit ; die Verfechter der päpstlichen Weltherrschaft berufen sich gegen den jungen absoluten Nationalstaat auf das Naturrecht. So vor allem der spanische Jesuit Juan de Mariana (1536—1623); in seiner berühmten Streitschrift „De rege“ stellt er sich „als ein Vorläufer von Hobbes dar, der wie er den Naturzustand schildert und die bürgerliche Gesellschaft auf die Mangelhaftigkeit des Menschenwesens zurückführt“[2]. Auf der evangelischen Seite aber stehen die calvinistischen Schriftsteller dieser Richtung, die ihre Pfeile gegen den katholischen Staat als Staat richten, geführt von Hotmann[3], dem Verfasser der „Franco- Gallia“ (1573), und Duplessis de Mornay, mit seinen noch berühmteren „Vindiciae contra Tyrannos“ (1577) [4]
Aber aus diesen Schriften spricht nicht ausschließlich das Interesse des dritten Standes, sondern auch das der mit ihm verbundenen feudalen Stände. „Man darf nicht vergessen, daß die hugenottische Bewegung schon frühe zu Beginn der 60er Jahre (des 16. Jahrh.) in eine
[1] Vgl. Salomon, a. a. O. S. 478/9.
[2] Gooch, a. a. O. S. 50.
[3] Vgl. Stintzing I, S. 373, 378ff. Die Familie hieß ursprünglich Autmann und stammte aus Schlesien.
[4] Gumplowicz (Gesch. d. Staatsth. S. 202/3) nennt noch Hubert Languet als den Verfasser. Diese ältere Anschauung ist beute aufgegeben; es steht fest, daß Duplessis de Mornay der Verfasser der „Vindiciae“ ist. Vgl. Wolzendorff, a. a. O. S. 105, 281, 373, ferner Lord, a. a. O. S. 48. Er war, wie Wolzendorff mitteilt, Mitverfasser der Unabhängigkeitserklärung der Niederlande. Stintzing (II, S. 40) berichtet, daß der unter calvinistischem Einfluß stehende Hortleder, der Erzieher der weimarischen Prinzen, es „für unbedenklich hielt, auch die Vindiciae zu verwenden, um seinen Zöglingen die Lehre von der Beschränkung der kaiserlichen Rechte durch reichsständische Freiheiten einzuflößen“. Die Lutheraner waren „im Gegensatz zum Calvinismus, durch die stärkere Betonung des Amtsbegriffs, zu einer mehr ausgesprochen monarchischen Gesinnung geneigt“. Vgl. a. a. O. S. 191 über Reinking. Vgl. Gooch, a. a. O. S. 20.
[43]
Allianz mit den ständisch-aristokratischen Interessen getreten war“ [1]. Die hugenottischen Granden wollten gern werden, was ihre Standesgenossen in Deutschland geworden waren: Landesfürsten; und das von der Gegenreformation bedrängte hugenottische Bürgertum nahm seine Bundesgenossen, wo es sie finden konnte.
Wenn wir von dieser einen wichtigen Ausnahme absehen, so ist also das erste Kennzeichen der früh-neuzeitlichen Staatslehre überall dort, wo das Großbürgertum allein spricht, die Hinneigung zum Absolutismus. Das zweite Kennzeichen ist ihre sich immer mehr verstärkende Tendenz, die wirtschaftlichen Interessen in den Vordergrund zu rücken. Das ist schon bei Bodin[2] spürbar, dessen Ziele nicht rückwärts lagen, wie die der hugenottischen Monarchomachen und ihres Gesinnungsgenossen Gentillet[3], sondern vorwärts in der Richtung des modernen Staates[4]. Man merkt es deutlicher bei Spinoza, dem der fromme, noch ganz katholisch orientierte Vico nicht ohne Recht vorwarf, er spräche vom Staate, „come d'una società che fusse di mercadanti“[5]. Man merkt es sehr deutlich bei Hobbes, dem Meinecke mit Recht bescheinigt, daß „seine Vorliebe für den monarchischen Absolutismus utilitarisch, nicht innerlich-gemütlich bestimmt und darum auch von propagandistischem Eifer frei war... Unter der Decke des schroffsten Absolutismus lebt hier bereits das Neue, was wir auch bei Grotius schon keimen sahen; der westeuropäische Individualismus und Utilitarismus, der den Staat den Bedürfnissen der bürgerlichen Klasse anzupassen suchte und ihn dabei je nachdem möglichst stark oder möglichst schwach sich wünschen konnte“ (S. 268/9). Von Grotius heißt es, daß „die alten Überlieferungen des corpus christianum in ihm schon übergingen in moderne, bürgerlich-liberal und sentimental angehauchte Lebensideale, wie sie die holländische Kaufmannsaristokratie jetzt entwickeln konnte“ (261). Und ganz die gleiche Einstellung finden wir auch bei den Bearbeitern des Staates von der anderen Seite her, bei den Lehrern der Staatsraison, von denen wir noch zu handeln haben werden: überall das Grauen vor dem Pöbel, geweckt durch die Ausschreitungen der Bauernkriege und
[1] Meinecke, Staatsräson, S. 69, vgl. Salomon, a. a. O. S. 472.
[2] Vgl. Bluntschli, a. a. O. S. 37, 43, 46.
[3] Meinecke, a. a. O. S. 61 ff.
[4] Meinecke, a. a .O. S. 71. Man merkt den tief wurzelnden Absolutismus Bodins auch daran, daß er, der Schöpfer des Begriffs der Souveränetät, noch die des Staates mit der des Monarchen verwirrte, und dadurch zu „falschen und unhaltbaren Schlußfolgerungen“ Anlaß gab (Meinecke, S. 72/4).
[5] Neue Wissenschaft S. 127/8. Vgl. Gustav Mayer, Die Geschichte bei Vico und Montesquieu, Festschrift für Franz Oppenheimer, S. 420. Das gilt am meisten für Spinozas letztes Werk, den Fragment gebliebenen „Politischen Traktat“.
[44]
der Wiedertäufer, so bei Settala, Boccalini und Canonhiero [1] bei Naudé (S. 252) ; und sehr oft die starke Berücksichtigung der wirtschaftlichen Interessen des Großbürgertums, so bei Rousset, der „einen bezeichnenden propagandistischen Eifer nur für Toleranz und Handelsfreiheit entwickelt“ (332). Er war hugenottischer Réfugié und lebte in Holland als Publizist.
Endlich trat die gleiche Entwicklung langsam auch in Deutschland ein, namentlich in dem armen Preußen, dessen Herrscher in wohlverstandenem Eigennutz mit allen Maßnahmen der Immigrations- und Wirtschaftspolitik einen Unternehmerstand schufen. Schon 1712 las Nikolaus Hieronymus Gundling in Halle „über den jetzigen Zustand von Europa“; aus dem Kolleghefte „erkennt man, daß seit Pufendorf der Sinn für den Zusammenhang der politischen und wirtschaftlichen Interessen sehr lebendig emporgewachsen war“. Er lehrte z. B„ „daß ohne Erkenntnis der holländischen und englischen Kommerzien und Manufakturen niemand die Welt noch die ganze Konnexion von Europa verstehen könne“ (328). Und Meinecke faßt die Entwicklung zusammen: „Das große Ereignis des 18. Jahrhunderts war, daß unter der Decke des herrschenden Absolutismus der Mittelstand geistig und sozial erstarkte und für sein nun allmählich auch politisch sich färbendes Standesinteresse den Schatz des Vernunft- und Naturrechts auszubeuten begann“ (431)[2]. Der letzte große Exponent dieser Richtung ist Hegel, in dem, wie wir sofort zu zeigen haben werden, die beiden Ströme der Staatslehre, die vom überhistorischen Staate, und die von der Räson der wirklichen historischen Staaten, in ein Bett zusammenflössen: auch er ein Vertreter des Absolutismus.
A. Das Naturrecht.
Wir haben weit vorgreifen müssen, um die Lagerung der Klassen zu zeichnen, aus der die Staatslehren der Neuzeit hervorgingen, und
[1] Meinecke, Staatsräson S. 155—158. Auch die folgenden Zitate in ( ) nach ihm. Vgl. zu dem Obigen Salomon, a. a. O. S. 461 : „Der Humanismus sieht überhaupt das Volk als ungebildete Masse, als zu gestaltendes Material.“ Wilh. v. Humboldt schreibt an Jakobi: „In Deutschland vergißt man gern die Masse, um bei einigen Individuen stehen zu bleiben“ (Meinecke, W. u. N. S. 55). Diese Verachtung betrifft zuerst, wie man bei Spinoza noch sehr deutlich erkennt, nicht den Pöbel als solchen, sondern den Ungebildeten überhaupt, und den Pöbel nur insofern, wie er eben ungebildet ist (Ethik S. 189, Theol. Pol. Tr. S. 147, 217, besonders deutlich Pol. Trakt. VII, § 27).
[2] Sehr charakteristisch in dieser Beziehung ist Christian Thomasius, ein durch und durch moderner Mann, der als erster in Deutschland mit Tatkraft gegen Tortur und Hexenprozesse und Ketzereiverfolgungen aufgetreten ist. Seine „Kurzen Lehrsätze vom Rechte eines christlichen Fürsten in Religionssachen“ von 1724 atmen in jeder Zeile den Geist des im besten Sinne aufgeklärten Bürgertums, auch ökonomisch. So lautet z. B. Satz 10: „Das Tun und Lassen der Untertanen, das den gemeinen Frieden nicht verhindern noch befördern kann, ist den Rechten eines Fürsten nicht unterworfen.“
[45]
die Wandlungen der Klassenlagerung, mit denen die Abwandlungen der Theorien einhergehen. Wir kehren jetzt zu unserem Ausgangspunkt zurück, um die Theorien selbst in unser Gesichtsfeld einzustellen.
Die bürgerliche Staatslehre stützt sich anstatt auf Aristoteles weit mehr auf die Stoa und Epikur. Dafür sind mehrere Gründe maßgebend. Erstens ist sie der Exponent einer Zeit der sozialen Zersetzung, die der der Antike sehr ähnlich ist. Auch hier sind alle gewachsenen Bindungen in der Auflösung [1]. Das Individuum, herausgeworfen aus seiner festen Einordnung in eine im wesentlichen konsensuelle Gesellschaft , die ihm sittlich, politisch und ökonomisch die Existenz sicherstellte und ihm ewig scheinende Maßstäbe gab, sieht sich auch hier in den Ozean geschleudert und als auf die einzige Macht der Hilfe auf den eigenen Verstand angewiesen. „Es ist der alles transzendenten Himmelslichtes beraubte, mit den dämonischen Naturgewalten allein auf dem Kampfplatze gelassene Mensch, der nun auch als dämonische Naturkraft sich empfindend Gleiches mit Gleichem vergilt“, sagt Meinecke sehr schön[2]. Daraus folgte „die grandiose Einseitigkeit, mit der nun ... alle verschiedenen Lebensgebiete nach und nach ihre Autonomie und Ellbogenfreiheit sich eroberten, zu ungeahnter Leistung dadurch gediehen, zugleich aber einen Kampf der Lebensgebiete untereinander entzündeten, der das Ganze der Lebensgemeinschaft bedrohte und zum Problem der modernen Menschheit wurde“[3]. Es war, möchten wir wiederholen, der Beginn der europäischen Krise, unter der wir heute noch leiden, und an der wir vielleicht zugrunde gehen werden. So sahen St. Simon und Comte die Dinge, und nach ihnen viele andere[4].
[1] Diese Zersetzung schildert Montesquieu (De l'esprit des lois, Livre III Kapitel 3.) sehr beredt : „Die griechischen Politiker in der Volksregierung anerkannten keine andere Macht als die Tugend, um sie aufrecht zu erhalten. Die von heute sprechen uns nur von Fabriken, Handel, Finanzen, Reichtum und gar von Luxus. Wenn die Tugend verschwindet, zieht der Ehrgeiz in diejenigen Herzen ein, die seiner fähig sind, und der Geiz in alle. Die Begierden wechseln den Gegenstand : man liebt nicht mehr, was man liebte; man war frei im Rahmen der Gesetze, jetzt will man frei gegen sie sein; jeder Bürger ist wie ein dem Haushalt seines Herrn entlaufener Sklave; was früher Grundsatz war, heißt jetzt Rigorismus; was Regel war, nennt man jetzt Hemmung; was Ehrfurcht war, heißt jetzt Furcht. Jetzt heißt einfache Lebensführung, aber nicht die Habsucht Geiz. Früher bildete das Vermögen der Einzelnen den öffentlichen Schatz; jetzt aber wird der eigentliche Schatz das Vermögen der Einzelbürger. Die Republik ist eine wehrlose Beute, und ihre Kraft ist nur noch die Macht einiger Bürger und die Zügellosigkeit aller.“
[2] Staatsräson S. 46.
[3] Staatsräson S. 127.
[4] Z. B. Bonald, die Urgesetzgebung, S. 72: „Die Revolution wurde freilich zu jener Zeit geboren, allein sie war schon lange vorher im Schöße der Gesellschaft empfangen.“ Ferner Frantz, „Naturlehre des Staates“, S. S. 402ff. sehr ausführlich in Polemik gegen die von katholischer Seite viel gehegte Meinung, daß es die Reformation war, die den „Consensus“ der mittelalterlichen Gesellschaft zerstört habe, eine Meinung, die übrigens Chatterton Hill (Individuum und Staat, Tübingen 1913, S. I45ff.) wieder vorträgt. Frantz schildert die Ursachen der Zersetzung ganz, wie wir es soeben im Abschnitt über das Mittelalter getan haben.
[46]
Einem solchen Geisteszustände mußte die Philosophie der antiken Aufklärung sympathischer sein als die der aristotelischen Gegenrevolution. Dazu kam verstärkend, daß Aristoteles die große Autorität der Kirche war; mit dieser aber mußte die moderne Aufklärung in noch viel schwerere Konflikte geraten als die antike Aufklärung mit ihrer schwachen Priesterschaft, die doch immerhin stark genug gewesen war, Sokrates zum Tode verurteilen zu lassen. Denn die katholische Kirche war und blieb, trotz aller inneren Gegensätze und gelegentlichen Machtkämpfe, die Verbündete des Feudalstaates; und sie fühlte sich stark genug, um dem Fortschritt der Naturwissenschaften in den Weg zu treten, der stärksten Waffe der Aufklärung: das hatte im Altertum (außer vielleicht in Ägypten) die schwache Kirche nie auch nur versucht, kam auch nicht dazu in Versuchung, weil es ja keine als offenbart und darum als unfehlbar betrachtete Bibel gab.
So baut denn die westeuropäische-neuzeitliche Aufklärung ihre Rechts- und Staatslehre mehr auf stoischer und epikuräischer als auf aristotelischer Grundlage auf. Sie verbindet damit einen ihr aus Roms Jurisprudenz übermittelten, aber auch bereits aus Hellas stammenden [1] Bestandteil: das „jus gentium“[2].
Wir haben am Beispiele des Protagoras gezeigt, wie wenig zufrieden die besseren Köpfe der Sophisten mit dem bis aufs äußerste gesteigerten Relativismus ihrer Rechtslehre waren. Sie suchen den Weg von ihrem unmöglichen Ausgangspunkt, dem Rationalismus und Individualismus, zu einer überpersönlichen Ordnung, die unmöglich fehlen darf, soll Gesellschaft zusammenhalten, ja, soll man die sittliche Verbindlichkeit irgendeines Rechtsgebotes auch nur von ferne behaupten dürfen. In dieser Lage macht, wie es scheint, zuerst der Sophist Hippias von Elis (um 400) den Versuch, in einem psychologischen Sachverhalt das Allgemeine aufzufinden, das über der Willkür der Individuen steht und ihnen als Maß zu dienen hat. Und er findet es in denjenigen Rechtsanschauungen, die bei allen Völkern in Geltung sind. Dann hat die römische Jurisprudenz geradezu die Gleichsetzung dieses allgemeinen mit dem idealen Rechte vorgenommen. Hier hat bereits Cicero[3] den
[1] Kaerst, a. a. O. S. 81.
[2] „Der Humanismus hat erstens die naturrechtlichen Bestandteile des römischen Rechts und zweitens die philosophischen Systeme des Stoizismus und Epikuräismus wieder erweckt“ (Hasbach, a. a. O. S. 27).
[3] Vgl. S. S. I, S. 395. Cicero vollzieht die erste „Synthese“ der antiken Anschauungen durch einen kritiklosen Eklektizismus, den Mase-Dari mit Recht widerspruchsvoll nennt. (Gumplowicz, Gesch. d. Staatsth., S. 77 Anm.). Über die verschiedenen Arten des Naturrechts bei den Römern und die Verschmelzung des jus gentium, „quo omnes gentes utuntur“, vgl. Hasbach a. a. O. S. I2ff. Grotius (Prolegomena 40, S. XXII) unterscheidet Naturrecht und Völkerrecht; jenes muß aus den Prinzipien der Natur erschlossen werden, dieses ergibt sich aus einer gewissen allgemeinen Übereinstimmung. Was nicht deduziert werden kann und doch allgemein gilt, muß aus der Willkür abgeleitet werden. Vgl. Lib. I cap. I § 13ff. über das willkürliche Recht.
[47]
größten Teil des Weges zurückgelegt, wenn er von „dem obersten Gesetz“ spricht, „das entstanden war in all den Zeitaltern, bevor ein Gesetz niedergeschrieben oder ein Staat gebildet war“, das „in demselben Momente ins Dasein trat, wie der Geist Gottes“. Gajus hat dann die beiden Rechte ausdrücklich gleichgesetzt: „Was auch immer die natürliche Vernunft unter den Menschen angeordnet hat, wird von allen Völkern in Ehren gehalten und heißt das jus gentium [1].“ Nach den Institutionen des Corpus juris ist das Naturrecht das Recht, „das die Natur alle Geschöpfe lehrte. Denn dieses Recht ist nicht nur dem Menschengeschlechte, sondern allen Geschöpfen eigen, die in der Luft, auf der Erde und im Meer zur Welt kommen“[2].
„Das natürliche Recht in diesem Verstände überwand das bürgerliche Recht der Römer und aller politischen Gemeinden der antiken Kultur[3].“
Diese Gleichsetzung des „natürlichen Rechtes“ mit dem allgemeinen Rechte hat ihren guten Sinn, wenn man davon ausgeht, daß das Rechtsgesetz als dunkles Interesse a priori jedem Menschen vor aller Erfahrung innewohnt. Man versteht aber, daß von jener Gleichsetzung schwere Verwirrungen ausgehen mußten, wenn man erst einmal die Natur, die der Antike und dem mittelalterlichen Denken als „göttlich“ galt[4], entgötterte: dann konnte es leicht geschehen, daß man den Ursprung allen Rechts in das sinnliche Triebleben verlegte und derart zu in sich widerspruchsvollen und praktisch überaus gefährlichen Folgerungen
[1] Giddings, Prinzipien der Soziologie, Dtsch. Ausgabe v. Seeliger, S. 297.
[2] Gysin, a. a. O., S. 97. Corpus Juris I, 1, 2 pr. Melanchthon erkannte das Naturrecht nur insofern an, wie es den Menschen, nicht wie es den Tieren gegeben war. Es ist dann zum zweiten Mal im Dekalog offenbart worden (Stintzing I, S. 286).
[3] Toennies, Gemeinschaft und Gesellschaft, S. 249. „In der Kaiserzeit wurden altrömische Rechtssätze verkehrswirtschaftlich ausgestaltet und mit fremdem Recht verschmolzen ... Die Kodifikation dieses Gemenges aus römischen und unrömischen Einrichtungen im oströmischen Reiche stellte dann für die späteren Völker den Inbegriff des römischen Rechts dar.“ (Neurath, Antike Wirt- schaftsgesch. S. 71.)
[4] So noch Grotius. In seiner Einleitung zum „mare liberum“ (1609) schreibt er noch: „Es gibt einen Gott, den Schöpfer und Lenker der Welt, vor allem aber den Vater der Natur des Menschen.“ In den sechzehn Jahre später erschienenen „libri très de jure belli ac pacis“ fehlt diese religiöse Begründung: hier ist alles rein stoisch gesehen, auf den „Appetitus societatis“ abgestellt (Gysin, a. a. O. S. 48). Wie Grotius in seiner Frühzeit sah es noch der fromme Vico, der Gegner der Aufklärung (vgl. Gust. Mayer, Die Gesch. bei Vico und Montesquieu, S. 421).
[48]
gelangte. Dieser Gefahr ist Spinoza nicht ganz entgangen, und Hobbes ist ihr unterlegen [1].
Das aber ist das erste Charakteristikum des modernen Naturrechts, daß es, „von theologischer Basis losgelöst, nicht kraft göttlichen Gebotes, sondern kraft innerer Notwendigkeit seine Selbständigkeit behauptet“[2]. Diese Loslösung vollzog sich nicht auf einmal, sondern sehr langsam[3]. „Der beginnende Bruch ... setzt mit Baco ein, der statt der causae finales, die im göttlichen Willen beruhen, die causae efficientes, die im wirklichen Leben das Geschehen direkt herbeiführenden Ursachen, zunächst in Physik und Anthropologie suchen wollte; das gleiche erstrebte dann Hobbes in der Staatslehre, Locke in der Psychologie. Damit war man auf dem Wege zu Naturgesetzen, in die Gott nicht direkt eingreife. Newton suchte diesen Weg der christlichen Auffassung durch die Erklärung annehmbar zu machen, daß er die Vollkommenheit der ursprünglichen göttlichen Schöpfung auseinandersetzte, welche die Welt dann sich selbst und ihren Naturgesetzen habe überlassen können“[4]
[1] Hobbes ist interessant als der erste positivistische Soziologe, der auf Grund rein naturwissenschaftlicher Methode, ausgehend von den „menschlichen Leidenschaften, die außer der Vernunft zu seiner „Natur“ gehören“ (Meinecke, Staatsräson, S. 263), lange vor Comte und Spencer, aber diesem näher verwandt (beide sind typische Engländer, beide Großbürger) ein ganzes System zu schaffen versuchte. Zuerst kommt die Lehre vom Körper, dann vom Menschen, zuletzt vom „Staat“, der hier noch ganz der „Gesellschaft“ gleich gesetzt ist. Er gibt das große Programm selbst an (Lehre vom Menschen und vom Bürger, S. 75). Vgl. Meinecke, a. a. O. S. 265.
Spinoza versucht die Synthese von Stoa und Epikuräismus (wie er, davon später, die Synthese von Staatsphilosophie und Staatsräson versucht). Er folgt Hobbes fast in allem, was den Naturzustand und den Gesellschaftsvertrag anlangt (z. B. Ethik, 179, Theol. pol. Traktat, 213, 348), und hat dennoch die echt stoische Vorstellung, daß „der menschliche Geist ein Teil des unendlichen göttlichen Verstandes ist“ (Ethik, S.49). Das Bindeglied stellt sein Pantheismus dar, der auch die Natur vergöttlicht; sie erscheint nur als ein anderes Attribut der „Substantia sive Deus“. „Wenn wir sagen, alles erfolge nach den Gesetzen der Natur, oder alles werde durch den Ratschluß und die Leitung Gottes angeordnet, so sagen wir dasselbe“ (Th. pol. Tr., S. 183). Von hier aus war ein starker Quietismus kaum vermeidlich. Meinecke (Staatsräson) sagt mehrfach mit Recht, Spinoza präludiere Hegel.
[2] Jellinek, a. a. O. S. 58. Vgl. Hasbach, a. a. O. S. 24. Die Quelle ist die „vernünftige menschliche Natur“. Nicht einmal Gott kann das Naturrecht ändern; es ist mathematisch sicher, sagte uns soeben Grotius. Von ihm ist das auf Gottes Willen beruhende, durch die Offenbarung kundgegebene Recht streng zu unterscheiden (vgl. Proleg. 48ff.; ferner I, I, § 10, 2 (S. 10), 5 (S. 11), § I3ff. (S. 16).
[3] „Als die Frage zuerst aufgeworfen wurde, wo das Naturgesetz gefunden werden könne, finden es die ersten protestantischen Schriftsteller im Dekalog, und die katholischen im kanonischen Gesetz. Nur allmählich gelangte das Naturgesetz dazu, auf seinen eigenen Füßen zu stehen, und zwar als die Verkörperung der Vernunft und nicht mehr der Autorität (Lord, a. a. O. S. 31).
[4] Schmoller, Art. „Volkswirtschaft“ im Hdw. d. Staatsw., Vili, S. 483. Gumplowicz (Gesch. d. Staatsth., S. 218) hält Spinoza für den „Wendepunkt“ von der theologischen zur rein naturrechtlichen Staatslehre, Bluntschli (a. a. O., S. 88) Grotius.
[49]
Das ist die Lehre des Deismus, der, ein Übergang von der theologischen zur naturwissenschaftlich-positivistischen Auffassung, die Welt als ein von Gott geschaffenes vollkommenes Kunstwerk betrachtete. Die Auffassung hat namentlich in der Ökonomik sehr lange nachgewirkt [1]. Hier wird das Wort „natürlich“ in zwei nahe verwandten, aber doch deutlich verschiedenen Bedeutungen gebraucht: es ist das eine Mal von „Natur“ im engeren Sinne abgeleitet, von der „äußeren Natur“, dem Inbegriff aller räumlich-geographischen Verhältnisse des Landes, des Klimas usw. ; und zweitens steht es im Sinne der Naturlehre und des Naturrechts, als das, was aus der „Natur“ der menschlichen Gesellschaft selbst folgt, im Gegensatz zu Eingriffen der Gewalt oder des Rechtes“[2]. Das aber „bedeutet immer: zugleich naturnotwendige und gerechte Institutionen“[3].
Diese Doppelbedeutung hat Simmel feinsinnig erfaßt: „Die Natur ist nicht nur das, was eigentlich allein ist, das Substantielle in allem Flackern und Wirbeln der Geschichte, sondern sie ist zugleich das Seinsollende, das Ideal, um dessen wachsende Verwirklichung es sich erst handelt“[4].
Nur von hier aus läßt sich die Theorie des wirtschaftlichen Liberalismus verstehen, die in der physiokratischen Gegenüberstellung des „ordre naturel“ als der Harmonie, und des „ordre positif“ als des verderbten Wirtschaftsstaates gipfelte und dann von Adam Smith in vollkommenerer Gestalt weitergeführt wurde[5]. Hier lebt die alte Augustinsche Gegenüberstellung von der civitas caelestis und terrena wieder auf.
α) Der Rechtsstaat.
Das zweite Charakteristikum des modernen Naturrecnts ist, wie schon vordeutend bemerkt, daß sich die antike, philosophisch gemeinte Natur lehr e in ein juristisch gemeintes Natur recht umwandelt:
[1] Vgl. über den Deismus Hasbach, a. a. O. S. 143. Er zeigt nach Windelband, wie der ursprünglich rein verstandesmäßig-kühle Charakter des Deismus allmählich zur schwärmerischen Verehrung wurde, und zwar durch seine Verkuppelung mit dem Optimismus, der mit diesem Naturalismus immer verbunden ist. Giordano Bruno hatte die Welt als das Werk eines göttlichen Künstlers angeschaut, ihrer harmonischen Schönheit halber. Ihm folgte noch sogar der skeptische Hobbes; er sagt in den ersten Sätzen des „Leviathan“: „Natura, id est illa, qua Mundum Deus condidit, Divina ars“. Seit Newton die Himmelsmechanik entdeckt hatte, gilt die Natur als eine vollkommene Maschine, und Gott als ihr Erfinder und Konstrukteur.
[2] S. S. III, S. 353.
[3] S. S. III, S. 201.
[4] Grundfragen der Soziologie, S. 87.
[5] S. S. III, S. 202ff. In dieser Bedeutung faßte z. B. noch der junge Hegel den Gegensatz: das „Positive“ ist das Sinn- und Vernunftwidrige (Metzger, a. a. O. S. 321). Man möge dort nachlesen, wie sich ihm der Begriff allmählich wandelte: es ist nicht mehr das „Zufällige“, das von einer allgemeinen Vernunft Abweichende, — denn das wird es, als individuelles Faktum stets tun —, sondern es ist das mit dem „Geist“ seines Volkes und seiner Zeit nicht Übereinstimmende, das als „fremdes Erbstück vergangener Zeiten“ in eine gewandelte Welt hineinragt.
[50]
eine Metamorphose, die freilich schon in der späteren mittelalterlichen Ausgestaltung weit gediehen war, wie wir soeben zeigten. Jellinek schreibt darüber: „Die antike Lehre betrachtet den Staat als ein Produkt natürlicher menschlicher Anlagen, nicht als Erzeugnis des Rechtes. Selbst diejenigen Theorien, welche die soziale Ordnung auf den Nomos zurückführen, verstehen unter der Satzung keineswegs die rechtliche. Vielmehr soll dadurch nur die menschliche Willkür im Gegensatz zu der, menschlichem Willen entrückten, Naturordnung bezeichnet werden. Von dem Gedanken aber, daß staatsbildende Tatsachen Rechtstatsachen seien, findet sich in der hellenistischen Literatur [1] keine Spur. Nicht minder war den Römern die Vorstellung einer rechtlichen Entstehung ihres Gemeinwesens fremd ... Der dem modernen Naturrecht zugrunde liegende Satz: pacta sunt servanda, ist den Epikuräern schlechthin unbekannt. Ihr Vertrag ist daher ein auf den zusammenfallenden Einzelinteressen beruhender Modus vivendi“[2].
An Stelle dieser Naturlehre tritt also jetzt das Naturrecht: „Es ist in seinem Anfange hauptsächlich dem öffentlichen Rechte zugewendet. Der Staat, seine Entstehung, sein Wesen, seine Funktionen werden aus ihm abgeleitet [3]“. Und zwar bemüht man sich wohl, diese neue Lehre rein wissenschaftlich von der Politik zu trennen, aber, trotz des Grotius großer Autorität, mit geringem Erfolge, „da die hervorragendsten und einflußreichsten Schriftsteller an der Gestaltung der politischen Verhältnisse lebhaft interessiert sind, und ihre Untersuchungen in erster Linie theoretische Fundierung der praktischen Ziele bezwecken. Bei Hobbes und Locke, bei Spinoza und Pufendorf, wie später bei Rousseau und Kant tritt dies Bestreben, den Normalstaat zu zeichnen, als Zweck der theoretischen Untersuchung, jedem Leser deutlich hervor. Überall erscheint der Staat als eine durch das Recht begründete und fortwährend auf einem Rechtsgrunde — dem Staatsvertrage — ruhende Institution“[4].
[1] Vgl. Beloch, Griech. Gesch. I, S. 350 über die Auffassung der Hellenen (wie der Indogermanen überhaupt), daß das Recht göttliche Satzung {friftte) ist.
[2] Jellinek, a. a. O. S. 269/70 und Anm. daselbst. Vgl. ferner S. 329. Wenn die hier vorgetragene Anschauung buchstäblich richtig ist, aann würde der eine Vorwurf, den wir dem Epikuräismus oben gemacht haben, daß er durch einen Vertrag, der das Recht voraussetzt, das Recht habe entstehen lassen, stark abgeschwächt. Er gilt aber unvermindert gegen alle die Neueren, die gerade diesen Denkfehler begingen.
[3] Jellinek, a. a. O. S. 58/9.
[4] Jellinek, a. a. O. S. 58/9. Im Orig. nichts gesperrt. Das erste selbständige Naturrecht schrieb der Hamburger Oldendorp 1539. (Hasbach, a. a. O. S. 26/7; Gumplowicz, Gesch. d. Staatsth., S. 157). Es war in lateinischer Sprache abgefaßt; das erste in deutscher Sprache abgefaßte Naturrecht ist, wie Gumplowicz (a. a.O. S. 161ff.) mitteilt, von Andreas Fricius Modrevius verfaßt, einem aus Schlesien nach Polen eingewanderten Gelehrten, der sich nach seinem Heimatsorte Modrzewski nannte. Zuerst lateinisch unter dem Titel „De emendanda republica“ 1551 erschienen, kam es 1557 in deutscher Sprache unter dem Titel „Die Verbesserunge des Gemeinen Nutz“ heraus. G. nennt Fricius einen Vorläufer des Hugo Grotius, den Niemand kenne. Stintzing, a. a. O. I, S. 203 macht darauf aufmerksam, daß Hase-Lagus im gleichen Jahre mit Oldendorp in seiner „Metho- dica juris utriusque traditio“ in den ersten Kapiteln gleichfalls die Grundzüge des Naturrechts entwickelt hat. Oldendorp seinerseits gab nur Melanchthons Lehre wieder (ib. S. 327), dessen Freund er war (Bluntschli, a. a. O. S. 72).
[51]
Die letzten Worte geben den Extrakt des dritten Charakteristikum des modernen Naturrechts. Die ursprünglich einander polar entgegengesetzten philosophischen Lehren der Stoa und ihres Gegners sind wenigstens insofern in einer Synthese verschmolzen worden, als jetzt alle Naturrechtler, mögen sie von dem stoischen oder dem epi- kuräischen Urzustände ausgehen, mögen sie von der angeborenen Güte oder Schlechtigkeit der Menschennatur überzeugt sein, dennoch den Staat in einem ausdrücklichen oder stillschweigenden „Vertrage“ seinen Ursprung nehmen lassen: eine Vorstellung, die, wie wir wissen, der Stoa ganz fremd war [1].
Diese Wandlung ist leicht zu verstehen. Die soeben angedeuteten Probleme haben philosophisches, weltanschauungsmäßiges Interesse. Aber die neue Lehre hat keine philosophischen, sondern praktische, politische Interessen. So treten ihr die alten Gegensätze zurück, ohne deshalb ganz aus dem Gesichtsfelde zu verschwinden, weil man ja doch nicht nur Politiker, sondern auch immer noch, sozusagen im Nebenamt, Philosoph ist.
Nun sind die politischen Kämpfe, denen die neue Lehre zu dienen hat, damals reine Verfassungskämpfe. Es handelt sich darum, wer die politische Macht haben soll: der alte Staat des mit der Kirche und später mit dem Absolutismus verbündeten Feudaladels, oder der Schöpfer und Besitzer des neuen Reichtums, der Träger der neuen Zeit : die Bourgeoisie? Der Staat beruft sich auf ein Recht: das gewordene, durch die Kirche legitimierte Recht des beatus possidens. So muß ihm der Gegner ein anderes, höheres Recht entgegenhalten, das zwar nicht von der Kirche, wohl aber von Gott unmittelbar, oder doch von der durch Gott in uns eingepflanzten Vernunft noch besser legitimiert ist. Daher die uns heute so sonderbar berührende juristische Aufmachung
[1] Grotius, obgleich durchaus stoisch orientiert, spricht von dem Übergang von der communio primaeva zum Einzeleigentum, der nicht durch den bloßen Willen, sondern durch eine Art Vertrag geschah, teils ausdrücklich wie bei der Teilung, teils stillschweigend wie bei der Besitzergreifung (vgl. Metzger, a. a. O. S. 33, Anm.). Vgl. auch Proleg. 15, wo auch der Subjektionsvertrag auf diese Weise erschlichen wird.
[52]
des ganzen Konflikts, die Behandlung der Frage, als sei es ein vor einem obersten Gerichtshofe geführter Prozeß [1].
Wie aber hätte diese neue Schicht ihr Recht anders begründen können als eben auf einen Vertrag? Erstens ist sie ja „Gesellschaft“ in Toennies' Sinne: der zweiseitige Vertrag ist ihr Lebenselement, das do ut des, die Leistung für Gegenleistung, ist die einzige Ordnung menschlichen Verkehrs, die sie kennt oder wenigstens anerkennt. Wenn aber, zweitens, diese psychologische Einstellung nicht bestanden hätte: welche andere Rechtsform hätte der Anwalt einer zum Kampfe gegen den historischen Feudalstaat antretenden neuen Klasse denn als Basis wählen können als eben den Vertrag? Alle anderen Rechtstitel: Ersitzung, formelles Recht, religiöse Sanktion, sind ja bei den Angegriffenen !
Und so vollzog sich die Synthese der beiden philosophisch unvereinbaren Lehren auf dem Boden des Gesellschaftsvertrages. Sie „bleibt seit Hobbes die unverlierbare Grundlage der naturrechtlichen Staatslehre“[2].
Vorbereitet war diese Synthese bereits im christlichen Mittelalter durch die kanonische Philosophie, als einer der vielen Versuche, den optimistischen Anfang der Stoa mit der optimistischen Entwicklungstendenz der Epikuräer zu verbinden, von denen ja einer, freilich schon vor der Spaltung gemacht, der des Protagoras-Mythus ist. Ähnliches unternahm also aus dem gleichen psychologischen Zwang heraus das Mittelalter. Hasbach berichtet darüber: „Nach der Stoa war ja auf das goldene Zeitalter eine Periode der Verderbnis gefolgt, die das positive Recht zur Folge hatte. Wenn man sich nun diese Zeit in der Weise der Epikuräer dachte, so konnte man sehr wohl die Lehre vom Staatsvertrage an diejenige vom ewigen natürlichen Vernunftrecht reihen. Ins Christliche übersetzt, hieß dies: die von Gott nach seinem Ebenbilde geschaffenen Menschen lebten ursprünglich im Paradiese; während dieses Zustandes völliger Unschuld standen sie allein unter dem direkt ausgesprochenen Gesetze Gottes. Infolge der Sünde wurden sie aus dem Paradiese verstoßen: Habsucht und Mord entzweiten sie; sie zerstreuten sich über die Erde und lebten ein unsicheres und erbärmliches Leben. Um ihr Dasein zu schützen, gründeten sie endlich den Staat durch einen Vertrag. Obwohl ihre Fähigkeiten geschwächt waren, gestattet ihnen die Tatsache, daß sie nach dem Ebenbilde Gottes geschaffen waren, mit Hilfe ihrer Vernunft das Naturrecht zu finden“[3].
[1] Das Naturrecht liegt „in dem Banne eines Traumes, in welchen die geweihten Töne alter Überlieferung und die bestrickende Gewalt fremdländischer Überlieferung sie gewiegt hatten“, wie Stintzing von der deutschen Rechtswissenschaft der gleichen Zeit (16. Jahrhundert) sagt.
[2] Jellinek, a. a. O. S. 210.
[3] Hasbach, a. a. O. S. 17. Auch die dem Turmbau zu Babel folgende Zerstreuung der Menschen in verschiedene Völker mit verschiedener Sprache spielt in dieser Auffassung gelegentlich eine Rolle. Über eine andere Synthese, die viel später von Kant versucht wurde, vgl. S. S. I, S. 1060ff.: „Das Problem der Soziabilität“. Wir kommen weiter unten darauf zurück.
[53]
Vollendet wurde diese theologische Synthese durch die Reformatoren. Hasbach „glaubt, daß die christlichen Ideen in der Gestalt, welche ihnen die Reformatoren gaben, das Bindeglied zwischen den stoischen und epikuräischen Lehren bildeten, weil sie sowohl den Unschuldszustand des Menschen in inniger Gemeinschaft mit Gott wie die nachfolgende Verderbnis der menschlichen Natur, die in einem unbegrenzten Egoismus besteht, umfassen. Die christlich-reformatorischen Lehren verleihen dem Naturgesetze die unbedingte Hoheit, welche es bei den Stoikern besitzt, anerkennen die natürliche Schlechtigkeit des Menschen, den Staatsvertrag, und Frieden und Sicherheit als alleinigen Zweck des Staates“ [1].
In diese Gedanken ging, die Theorie vom Staatsvertrage unterstützend, auch die biblische Erinnerung an den zwischen Gott Jahve und dem Volke Israel geschlossenen Vertrag mit ein[2]. Dadurch und durch Übertragung der Calvinschen Lehre von der kirchlichen Gemeinde „entsteht unter den independenten Puritanern die Anschauung, daß, wie die christliche Gemeinde, so auch der Staat auf einem Covenant, einem Gesellschaftsvertrage, ruhe, der von allen Gliedern des Gemeinwesens einstimmig abgeschlossen werden müsse“[3]. Und zwar ist die Vorstellung die, daß die ursprünglich souveränen Individuen in dem Akt des Vertragsschlusses durch freien Willen ein göttliches Gebot erfüllen. Der erste Theoretiker dieser Richtung in England ist Richard Hooker[4], Lockes große Autorität, der „Arch-Philosopher“[5].
Dazu kam schließlich, wie Wolzendorff[6] (a. a. O.) nachgewiesen hat, der damals noch reiche Bestand des positiven Rechtes an wirklichen Verträgen und vertragsähnlichen Formalitäten, die bei der Wahl eines Wahlfürsten oder auch der Einsetzung eines legitimen Erben in Brauch waren, wie z. B. in der „Joyeuse Entrée“ der flandrischen Stände oder
[1] A. a. O., S. 29/30.
[2] Vgl. Treumann, a. a. O. S. 57 über Junius Brutus' „Vindiciae contra tyrannos“ (1577); ferner Jellinek, a. a. O. S. 291, und Gumplowicz, Gesch. d. Staatsth., S. 202. Vgl. ferner Grotius Lib. I, Kap. I, § 15/16 und die aus Gassendi stammende Stelle bei Hasbach, a. a. O. S. 37, Anm. 2. Vgl. a. Spinoza, Theol. Pol. Traktat, S. 368, 388. Bluntschli, a. a. O. S. 33/4.
[3] Vgl. Jellinek, a. a. O. S. 509/10.
[4] Jellinek, a. a. O. S. 205.
[5] Two treatises of government II, § 74 Anm. Vgl. a. § 5 und passim. Bei Hooker findet sich noch keine Spur der später von den Theologen Jakobs I. verkündeten unbedingten gottbefohlenen Gehorsamspflicht der Untertanen (Gooch, a. a. O. S. 16).
[6] Ebenso Lord, a. a. O. S. 48.
[54]
in den eindrucksvollen Feierlichkeiten, die die Königskrönung in Aragonien durch den „Justitia“ begleiteten. Die sogenannten „Wahlkapitulationen“, die die Kurfürsten mit dem Kaiser, und in allen geistlichen Stiftern die Domherren mit dem künftigen Abt oder Bischof abschlössen, waren echte Verträge in jedem rechtlichen Sinne [1]. Hier wurzeln alle Widerstandsrechte, die gegen den Absolutismus geltend gemacht werden[2].
Derart wirkten religiöse und weltliche Auflehnung[3] gegen die alte Ordnung des Staates und der Kirche zusammen, um aus der gegensätzlichen Philosophie der Antike die einheitliche Staatslehre der neuen Aufklärung zu schaffen. Durch Aufnahme des der Antike fremden Satzes „Pacta sunt servanda“ oder „praestanda“, den Hobbes, echt „gesellschaftlich“, zum Eckstein seines Gedankengebäudes machte[4], wurde, je nachdem man den .Vertrag' aufzog, als „Unterwerfungs“- oder „Verwaltungs“- oder „Einigungsvertrag“, jeder denkbaren politischen Richtung die „Rechtsbasis“ geliefert. Durch Hereinnahme eines zweiten, ebenso harmlos klingenden Rechtssatzes: „Volenti non
[1] In Sparta mußten die Könige gar alle Monate vor den Ephoren schwören, nach den Gesetzen des Staates zu regieren, worauf ihnen diese als Vertreter der Gemeinde gelobten, die Macht des Königs unversehrt zu erhalten, so lange er den Eid hielte (Pohlenz, Staatsgedanke und Staatslehre d. Griechen, S. 18).
[2] Über Luthers (positive) Stellung zum Widerstandsrechte vgl. Bluntschli, a. a. O. S. 71. Treitschke, Politik I, S. 192 ff.
[3] Es ist selbstverständlich im letzten Kerne nur eine, einheitliche, Bewegung. Aber der Zusammenhang ist doch wohl nicht der von Max Weber mit so großem Nachdruck betonte, sondern der umgekehrte. Uns will scheinen, daß Brodnitz beweisendes Material für seine Meinung beigebracht hat: „Der Calvinismus ist nicht der Ausgangspunkt der ganzen Geistesbewegung, die dem Kapitalismus Schwungkraft verleiht, sondern nur einer ihrer markanten Höhepunkte“. (Engl. Wirtsch.-G. I, S. 283.)
[4] Es ist der zweite Grundsatz im Leviathan; der erste gebietet um des Friedens willen den Verzicht Aller auf ihr Naturrecht auf alles; man soll sich vertragsmäßig über das Eigentum usw. einigen. Dann folgt jener zweite Satz: „denn ohnedem wäre das Recht auf alles vergebens niedergelegt, und es bliebe der Krieg aller gegen alle“ (Lev. c. 15). „Und auf diesem Gesetz beruht die Natur der Gerechtigkeit. Denn wo kein Vertrag vorausging, da ist kein Recht übertragen worden, sondern alles gehört noch allen. Nichts ist also ungerecht ... Gerecht aber ist, was nicht ungerecht ist“. Unser Wilhelm Busch hat diese grandiose Rechtsphilosophie des Bürgers, vulgo Philisters, in die unsterblichen Verse gegossen: „Das Gute, dieser Satz steht fest, ist stets das Böse, was man läßt.“ Auch Grotius hat jene Rechtssätze in sein System aufgenommen: „Cum jure natura sit, stare pactis“ (a. a. O., Proleg. 15). Und Lib. I, Kap. III, § 7, 1 : „Licet homini cuique se in servitudinem privatam cui velit, addicere“. Aber er lehnt jenen Satz von Hobbes, daß dasjenige Recht sei, was nicht gegen die Gesetze sei (injustum), ausdrücklich ab: „Das aber ist ungerecht, was der Gemeinschaft vernunftbegabter Wesen widerspricht“. (Lib. I, Kap. I, § 3, 1). Spinoza verwirft den Satz „pacta sunt servanda“, für den Naturzustand, (Theol. Pol. Traktat, S. 351/2), läßt ihn im Staate gelten (ib. 412), aber wie Hobbes nicht im zwischenstaatlichen Verkehr, wo der Naturzustand weiterbesteht. Hier wirkt die Lehre von der Staatsräson (Pol Trakt. III, § 17).
[55]
fit injuria“ wurde schließlich den Verteidigern des Absolutismus, ja, Despotismus das nötige Werkzeug gereicht: denn danach gibt es keine unveräußerlichen Rechte, und man kann z.B. die Sklaverei rechtfertigen.
Wir möchten übrigens ausdrücklich noch einmal hervorheben, daß unsere Aussage über die Synthese der beiden antiken Philosopheme mit einem starken Korne Salz aufzufassen ist. Vollkommen eines wurden sie selbstverständlich nur in der Meinung der politischen Klopffechter der verschiedenen Parteien, an denen es damals so wenig wie heute gefehlt hat. Wissenschaftlich wirklich von Allen angenommen wurde aber nur der (der Stoa ursprünglich fremde) Staatsvertrag. Aber in den übrigen Beziehungen blieben die alten Gegensätze bestehen, wenn sie auch keine so große Rolle mehr spielten. Schmitt-Dorotic hat in seiner vortrefflichen Studie über die „Diktatur“ darauf aufmerksam gemacht, daß eine Spaltung existiert, „die das ganze, gewöhnlich als einheitlichen Komplex behandelte Natur recht des 17. Jahrhunderts in zwei völlig verschiedene Systeme trennt. Man kann den Gegensatz als den von Gerechtigkeits- und wissenschaftlichem (d. h. naturwissenschaftlich-exaktem) Naturrecht bezeichnen. Das Gerechtigkeitsnaturrecht, wie es bei den Monarchomachen [1] auftritt, ist von Grotius weitergeführt worden; es geht davon aus, daß ein Recht mit bestimmtem Inhalt als vorstaatliches Recht besteht, während dem wissenschaftlichen System von Hobbes mit größter Klarheit der Satz zugrunde liegt, daß es vor dem Staate und außerhalb des Staates kein Recht gibt, und der Wert des Staates gerade darin liegt, daß er das Recht schafft, indem er den Streit um das Recht entscheidet... Der Unterschied ... wird am besten dahin formuliert, daß das eine System von dem Interesse an gewissen Gerechtigkeitsvorstellungen und infolgedessen an einem Inhalt der Entscheidung ausgeht, während bei dem anderen ein Interesse nur daran besteht, daß überhaupt eine Entscheidung getroffen wird“[2].
Hier spricht wieder das philosophische Interesse, das klar erkennt, daß trotz der Einigung in Formal-Juristischen die alten Gegensätze der beiden Schulen lebendig geblieben sind. Denn selbstverständlich
[1] Wolzendorff will in seinem ausgezeichneten „Staatsrecht und Naturrecht“ die Monarchomachen viel mehr als Vertreter bestehender positiver Rechte der Stände denn als Naturrechtler angesehen wissen. Das hängt zum Teil damit zusammen, daß er hierbei nur das von ihm sog. Naturrecht im technischen Sinne im Auge hat; ferner scheint er uns doch nicht genug zu beachten, daß die Monarchomachen offenbar die bestehenden positiven Rechte (de lege lata) nur aus dem Grunde so stark betonen, weil sie die Einführung des Widerstandsrechtes (de lege ferenda) überall, auch dort fordern, wo das positive Recht des Staates es nicht enthält. Das aber ist ein ausgesprochen naturrechtlicher Zug: denn von positivem Rechte kann ja nur in einem bestimmten Staate die Rede sein.
[2] Die Diktatur, S. 21/2.
[56]
repräsentiert der Typ Grotius den von der Stoa, der Typ Hobbes den von Epikur vorwiegend beeinflußten Denker. Und der hier aufgedeckte Gegensatz ist der uralte des Rechtsphilosophen und des Juristen: für den Einen ist das Kantsche „Rechtsgesetz“, für den anderen das Gesetzesrecht maßgebend; für jenen ist das Recht das höchste aller Gebote, für diesen nichts als „Gemeinschaftsregelung“ [1].
Es würde uns weit aus der von uns beabsichtigten Bahn führen, wollten wir hier die verschiedenen Naturrechtslehren darstellen. Sie können nur Objekte, nicht aber Subjekte der soziologischen Betrachtung sein : denn sie sind ohne Ausnahme Exponenten der sozial-ökonomischen Lagerung, in der sich die Gruppe ihres Verfassers zurzeit befand, sind sämtlich Ausdruck seiner „persönlichen Gleichung“, kraft des „sozialpsychologischen Determinismus“[2]. Mehr noch! Viele dieser Parteigänger waren offen besoldete Vertreter der Interessen, die sie mit allen Mitteln der wissenschaftlichen Dialektik verteidigten: „Lockes Schrift (Two Treatises) ist also eine Gegenschrift gegen Hobbes; jener verdammt die Revolution, rechtfertigt den Absolutismus und verteidigt die Stuarts; Locke rechtfertigt die Revolution, stützt sich auf das Recht des Volkes, verteidigt die konstitutionelle, auf dem Volkswillen beruhende Monarchie. Nur in einem Punkte gleichen sich diese zwei sich bekämpfenden Philosophen : daß jeder von ihnen seinen Brotherrn verteidigt. Hobbes war ein Pensionär der Stuarts, Locke der Pensionär Wilhelms von Oranien“[3]. Die Tatsachen sind richtig, sehen aber bösartiger aus, als sie im Grunde sind. Es war in der damaligen Zeit allgemeine Sitte, daß die hervorragenden Gelehrten und Publizisten von den Höfen besoldet wurden. Auch Conring bezog ganz offen eine französische Pension[4]. Hobbes hatte im Exil dem damaligen Kronprinzen, dem späteren Könige Karl II. mathematischen Unterricht erteilt und blieb der Sache der Stuarts während seines ganzen Lebens treu : die Gerechtigkeit verlangt, auch mitzuteilen, daß er alle Aufforderungen Cromwells, in seine Dienste zu treten, beharrlich zurückwies[5].
Immerhin ist es verständlich, wenn die Gegner dieser Staatslehrer immer wieder auf derartige materielle Abhängigkeitsverhältnisse hinweisen. So schreibt z. B. Rousseau[6] : „Jedermann kann in den Kapiteln
[1] Vgl. S. S. I, 394ff.: „Natürliches und positives Recht“.
[2] Vgl. S. S. III, S. 160.
[3] Gumplowicz, Gesch. d. Staatsth., S. 226/7.
[4] Stintzing, a. a. O. II, S. 171.
[5] Trotzdem wurde ihm die Drucklegung seines Buches in England erlaubt, „weil es jeder Form des Despotismus dienen konnte“ (Laski, Authority in the modern states S. 23.
[6] Contrat social, II, 2. — Helvetius (cit. nach Kapp, Gesch. d. Sklaverei, S. 22) sagt: „Hätte die Pest Orden und Pensionen zu vergeben, so würden sich Juristen genug finden, die so niedrig wären zu behaupten, daß die Herrschaft der Pest von Gott und Rechtswegen bestehe, und daß sich ihr zu entziehen, ja, ihren bloßen Einflüssen zu entziehen, Hochverrat sei.“
[57]
drei und vier des ersten Bandes von Grotius sehen, wie dieser Gelehrte und sein Übersetzer Barbeyrac sich in ihren Sophismen herumquälen und verwickeln, aus Furcht, nicht genug oder zu viel zu sagen und die Interessen zu verletzen, die sie zu versöhnen hatten. Grotius, der als mit seiner Heimat unzufriedener Flüchtling in Frankreich lebte, will sich bei Ludwig XIII., dem sein Buch gewidmet ist, lieb Kind machen und tut sein möglichstes, um die Völker aller ihrer Rechte zu berauben und den König damit zu bekleiden. Das wäre auch nach dem Geschmack Barbeyracs gewesen, der seine Übersetzung dem englischen Könige Georg I. widmete. Aber leider zwang ihn die Vertreibung Jakobs IL, die er Abdankung nennt, sich vorsichtig auszudrücken, Ausflüchte zu machen und sich zu drehen und zu wenden. Wenn diese beiden Schriftsteller die richtigen Prinzipien angenommen hätten, so wären alle Schwierigkeiten behoben gewesen : aber dann hätten sie traurigerweise die Wahrheit gesagt und sich nur bei dem Volke lieb Kind gemacht. Freilich, die Wahrheit bringt keine Schätze, und das Volk hat weder Gesandtschaften noch Lehrstühle noch Pensionen zu vergeben“.
Mag immerhin hier der Ausdruck wie die Stimmung von dem persönlichen Ressentiment des Enterbten beeinflußt sein, so bleibt doch wahr, daß derartige Bindungen nicht gerade geeignet sein konnten, die wissenschaftliche Objektivität zu erhöhen. Kelsen hat zweifellos recht, wenn er ganz allgemein sagt : „Man manipuliert neben der Rechtsordnung noch mit einer zweiten, die sogenannte Staatsräson darstellenden Ordnung, die hauptsächlich auf die Bedürfnisse gewisser oberster Organe abgestellt ist“ [1].
Aus solcher Geistesverfassung heraus sahen wir soeben Grotius die Sklaverei „naturrechtlich“ rechtfertigen, und erschlich Hobbes den Unterwerfungsvertrag, der den Absolutismus für ewig begründen soll[2].
Wir, die wir die Wurzeln dieser ganzen Naturrechtslehre aufgedeckt haben, verstehen leicht, daß sie unschwer dazu mißbraucht werden konnte, den Interessen aller möglichen Gruppen zu dienen. Entsprungen aus zwei einander schnurstracks widersprechenden Philosophemen, die noch dazu beide dogmatisch-metaphysisch begründet waren, notdürftig mit eingestandenen oder verhohlenen theologischen Mitteln zusammengeleimt, durch einige juristische Sätze ergänzt, die hier, um milde zu sein, keine unbedingte Geltung haben, konnte man mit ihr alles beweisen, angreifen und verteidigen. Und so finden wir denn ihre Vertreter in allen Lagern? „Welchen Bestrebungen hat das Naturrecht allein in der neueren Zeit dienen müssen : den Bedürfnissen einer handel-
[1] A. a. O. S. 137·
[2] Hasbach, a. a. O. S. 38.
[58]
treibenden Republik, des absoluten und aufgeklärten Fürstentums, der Mittelklassen und endlich des vierten Standes! Staatsabsolutismus und Volkssouveränetät, Rechtsstaat und Wohlfahrtsstaat, unveräußerliche Menschenrechte und alles verschlingende Staatsomnipotenz, Freiheit und Knechtschaft, Freiheit mit Zentralisation und Freiheit mit Assoziation — sie haben alle im Naturrecht Platz gefunden“ [1].
Je nachdem man den Staatsvertrag aufzog: als Unterwerfungsvertrag (Hobbes) oder als Verwaltungsvertrag (Althusius), d. h. als „translatio“ oder „concessio imperii“[2], oder als Einigungsvertrag (Rousseau), oder zwischen beiden ein unmögliches Kompromiß herzustellen versuchte, wie Pufendorf[3], konnte man, wie gesagt, streng juristisch deduzieren, was doch schon vorher als „thema probandum“ feststand oder — vorgeschrieben war. Nur eines konnte man juristisch eben nicht deduzieren: das Recht selbst und den Staat als Schöpfer und Hüter des Rechts: „Dem Naturrecht ist die Frage nach der Entstehung des Staates eine Rechtsfrage“. Sie ist aber keine: „Unserer Zeit ist die Unhaltbarkeit aller Versuche klar geworden, die Entstehung des Staates juristisch zu konstruieren“[4].
Wir können diese Dinge, als für unsere Fragestellung ohne größere Bedeutung, beiseite lassen: wir haben hier nur der Entwicklung zu folgen, durch die sich das Axiom von der „ursprünglichen Akkumulation“ herausbildet. Das geschieht, wie vordeutend schon bemerkt, dadurch, daß die „rationale“, juristische Konstruktion allmählich in eine historische umgewandelt wird, und zwar, weil die Naturrechtslehre nicht mehr dem politischen Verfassungskampf, sondern dem ökonomischen Klassenkampf zu dienen hat. Es ist kein Zufall, daß es gerade Locke (1632—1704) ist, der im Gegensatz zu Hobbes[5] (1588—1679) diesen Wechsel des Gesichtspunktes vornimmt; er „steht deshalb nicht tief unter Hobbes“, wie Jellinek ihn tadelt[6], sondern es war die veränderte Lagerung seiner Gruppe, die diese Umbiegung ins Historische jetzt erst forderte.
ß) Der Wirtschaftsstaat.
1.1. Die großbürgerliche Staatsidee. (Von Locke bis Adam Smith.)
Locke ist der erste Vertreter des bereits siegreichen Großbürgertums, des englischen. Die Bürger der Städte, die kleineren Guts-
[1] Hasbach, a. a. O. S. 55.
[2] Hasbach, a. a. O. S. 17.
[3] Vgl. Schmitt-Dorotic, a. a. O. S. 118. Vgl. ferner Hasbach, S. 38, und Gumplowicz, der Pufendorf als Eklektiker, zwischen Grotius und Hobbes mitten innestehend, kennzeichnet (a. a. O. S. 223.).
[4] Jellinek, Allg. Staatsl., S. 270/1. Vgl. Wolzendorff, a. a. O. S. 463.
[5] „Hobbes hat keinesfalls mit seiner Lehre von der Staatengründung den historischen Werdegang des Staates zeichnen wollen“ (Jellinek, a. a. O. S. 209/10).
[6] Jellinek, a. a. O. S.210.
[59]
eigentümer, die Pächter des Landes waren als neue politische Macht gegen das absolute Königtum und einen großen Teil der feudalen Aristokratie in Waffen getreten und hatten beide im ersten Anlaufe zu Boden geworfen [1].
Der bedeutendste Theoretiker und Agitator dieser englischen Mittelklasse war John Milton (1608—74) gewesen, der berühmte Dichter des „Verlorenen Paradieses“, selbst ein echtes Bürgerkind der stolzen Stadt London. Bei ihm war das Selbstgefühl des dritten Standes zuerst zu klarem Ausdruck gelangt. Er unterscheidet ihn scharf von dem Pöbel: „Unter ihnen sind sehr viele verständige und der Geschäfte kundige Männer. Die Übrigen hat aber bald der Luxus und der Überfluß, bald der Mangel und die Not von der männlichen Tugend und dem Studium des bürgerlichen Rechtes abgehalten“, so schreibt er in seiner „Verteidigung des englischen Volkes“ gegen den berühmten Philologen Salmasius, der im Auftrage der flüchtigen Stuarts „Eine Verteidigung des Königs Karl I.“ geschrieben hatte, in der die Engländer des frevelhaften Königsmordes beschuldigt wurden[2].
Locke „nimmt in allen Beziehungen die Lehren von Althusius und Milton wieder auf. Der erste Vertrag begründete eine Gesellschaft, der zweite setzt eine Regierung ein. Der erste ist der Sozialvertrag, der zweite ist das Grundgesetz des Staates“[3].
Die berühmte Schrift, in der diese Gedanken vorgetragen wurden, die „Two Treatises on government“, erschien 1689, also nach der vollen und endgültigen Niederlage des absoluten Königtums in der „glorious revolution“, die den Oranier als den ersten konstitutionellen Monarchen im modernen Sinne auf den englischen Thron brachte, — im Jahre des Friedensschlusses zwischen der agrarischen und der kommerziellindustriellen Bourgeoisie, den das Korngesetz Williams besiegelte[4]. Jetzt hatte die Klasse von oben her keine Gefahren mehr zu befürchten, da der Verfassungskampf gegen den Feudalismus und Absolutismus endgültig entschieden war.
Dafür aber trat immer dringender das Bedürfnis auf, die errungene ökonomische Machtstellung nach unten hin, gegen den allmählich, durch die „Einhegungen des Gemeindelandes“[5] und durch das Bauernlegen, entstandenen vierten Stand zu sichern.
Schon die Lollhardenbewegung (1381) hatte die Besitzenden erschreckt und wirkte lange nach; dann machte die kommunistische
[1] Bluntschli, a. a. O. S. 104.
[2] Bluntschli, a. a. O. S. 112/3.
[3] Lord, a. a. O. S. 54.
[4] Oncken, a. a. O. S. 202.
[5] Vgl. S. S. I, S. 524.
[60]
Bewegung der Mitte des 16. Jahrhunderts, namentlich in Gestalt der Errichtung der Wiedertäufer-Republik in Münster, einen ungeheuren Eindruck auf die Zeitgenossen [1], ganz wie später die englische Revolution mit der Hinrichtung Karls II.[2] und die französische mit der Ludwigs XVI.[3], und wie die sowjetistische Revolution und der Tod Nikolaus' auf unsere Generation. Schon Bodin ist Antikommunist, und zwar nicht nur aus den bekannten wirtschaftlichen Gründen, sondern unter ausdrücklichem Hinweis auf Münster, auf die Heiligkeit der Familie[4]. Von da an geht die antikommunistische Einstellung wie ein Leitmotiv durch die naturrechtlichen Systeme. Locke aber hatte erneuten Grund, den Kommunismus zu fürchten: er hatte die Bewegung der „True Levellers“ unter Cromwell erlebt[5]. „Was uns aus dem alten Naturrecht herausgeführt hat, ist keine Begriffsentwicklung, sondern ... das Streben der besitzenden, vorzugsweise der Mittelklassen Englands nach Schutz ihrer Freiheit und ihres Eigentums“[6].
Dieser neuen Gefahr gegenüber mußte das Bürgertum notwendigerweise, wie jede herrschende Klasse, dazu gelangen, irgendwie „legitimistisch“, d. h. durch Berufung auf geschichtliche Leistungen und Verdienste, ihre neuerrungene Machtstellung im Staate zu rechtfertigen. Aus diesen Gründen wurde die alte, im Kampfe gegen den Feudalstaat erprobte politisch-rechtliche Kampflehre jetzt, zum ökonomischen Klassenkampf nach unten hin, ins gleichzeitig Historische und ökonomische umgebogen[7].
Diese Deutung scheint uns bewiesen durch die Tatsache, daß die ältere, rationale, juristische Gestalt der Theorie auch in den anderen Ländern so lange herrschte, wie die Bourgeoisie den Verfassungskampf
[1] Man weiß, wie sehr die Ausschreitungen der Bauernkriege auf Luthers ganze Stellung eingewirkt haben. Das Jahr 1525 bedeutet für ihn geradezu eine Gesinnungswende. Vgl. Hans Mühlestein, „Rußland und die Psychomachie Europas“, das leidenschaftliche Buch eines Schweizers, der ganz von dem revolutionären Pathos Zwingiis beseelt ist. Laski (a. a. O. S. 41) spricht von Luthers „Verrat an den Bauern“ („desertion of the peasants“).
[2] Vgl. Stintzing, a. a. O. II, S. 203, über den Eindruck dieser Geschehnisse auf Reinking. Er polemisiert gegen Hippolithus de Lapide (Chemnitz): „Wenn er den Kaiser zum Diener des Reiches mache und für des ,Reichsrats Direktor' erkläre, so seien das dieselben Argumente, deren sich jüngst die Engländer bedient hätten, um die Hinrichtung ihres Königs Karl zu rechtfertigen“.
[3] S. S. I, S. 3.
[4] A. a. O. S. 11.
[5] Vgl. Gooch, a. a. O. S. 122ff.
[6] Hasbach, a. a. O. S. 54.
[7] „Und nun zeigt sich eine eigentümliche Erscheinung : der auf die Spitze getriebene Rationalismus schlägt in Historismus um. Der Gedanke tritt nicht selten auf, daß das wahre Gesetz und die wahre Natur in einer fabelhaften Urzeit gegolten hätten“ (Hasbach, a. a. O. S. 124).
[61]
um die Herrschaft im Staate zu führen hatte. Zunächst in Frankreich. Es unterliegt keinem Zweifel, „daß Rousseau in seinem welterschütternden Werke nicht den bestehenden Staat erklären, sondern den dem Wesen des Menschen entsprechenden Staat aufzeigen und rechtfertigen wollte“ [1]. Und ebenso in Deutschland. Es ist wahrscheinlich nicht nur die vorwiegend philosophische Einstellung Kants, sondern auch die politische Lage des Bürgertums, dessen Wortführer der Denker war, die ihn trotz Locke und im Gefolge Rousseaus an der älteren Form festhalten, den Sozialvertrag als unhistorische Konstruktion auffassen ließ : „Der Akt, wodurch sich das Volk selbst zu einem Staate konstituiert, eigentlich aber nur die Idee desselben, nach der die Rechtmäßigkeit desselben allein gedacht werden kann, ist der ursprüngliche Kontrakt, nach welchem alle (omnes et singuli) im Volk ihre äußere Freiheit aufgeben, um sie als Glieder eines gemeinen Wesens d. h. des Volkes als Staat betrachtet (universi), sofort wieder aufzunehmen“[2]. Hier haben wir die rein juristische, entschieden nicht historisch gemeinte Konstruktion in voller Klarheit[3]. Im übrigen wird sich zeigen, daß Kant denn doch von der neuen Wendung ins ökonomische nicht ganz unberührt geblieben ist[4]: die Gedanken wirken eben über die nationalen Grenzen und färben, wenn auch leicht, die Vorstellungen der Führer der einzelnen nationalen Gruppen der gleichen internationalen Schicht mit Elementen, für die die Zeit in ihrem Lande noch nicht ganz gekommen ist. Für unsere Auffassung erscheint uns ferner als starke Stütze, daß Schopenhauer, der schon im Zeitalter des Aufstiegs des deutschen dritten Standes und des beginnenden ökonomischen Klassenkampfes lebt, durch eine Art von Kompromiß doch wenigstens eine Halbwendung vom Rationalen ins Historische macht: „In der Tat ist jener Ursprung (aus einem Vertrage) der wesentlich einzige und durch die Natur der Sache gesetzte. Auch kann der Staat, in keinem Lande, je einen anderen gehabt haben, weil eben erst diese Entstehungsart, dieser Zweck, ihn zum Staate macht; wobei es aber gleichviel ist, ob der ... vorhergegangene Zustand der eines Haufens
[1] Jellinek, a. a. O. S. 211.
[2] Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, II. Teil. Weiter unten heißt es ausdrücklich: „Der Geschichtsurkunde dieses Mechanismus nachzuspüren ist vergeblich, d. i. man kann zum Zeitpunkt des Anfangs der bürgerlichen Gesellschaft nicht hinauflangen. Denn die Wilden errichten kein Instrument ihrer Unterwerfung unter das Gesetz, und es ist auch schon aus der Natur roher Menschen abzunehmen, daß sie es mit der Gewalt angefangen haben werden.“
[3] Vgl. Kelsen, a. a. O. S. 142.
[4] Bluntschli schreibt von Kant, er bleibe in der Bekämpfung des Erbadels nicht hinter Sieyès zurück. „Im Grunde heißt es immer die Menschheit degradieren, gewisse Menschen durch die Geburt als eine besondere Spezies ohne Rücksicht auf Glücksgüter unter andere zu setzen.“ (Bluntschli, a. a. O. S. 380.)
[62]
voneinander unabhängiger Wilden (Anarchie) oder eines Haufens Sklaven war, die der Stärkere nach Willkür beherrschte (Despotie). In beiden Fällen war noch kein Staat da: erst durch jene gemeinsame Übereinkunft entsteht er, und, je nachdem diese Übereinkunft mehr oder weniger unvermischt ist mit Anarchie oder Despotie, ist auch der Staat vollkommener oder unvollkommener“ [1].
Man sieht die Mischung des Rationalen mit dem Historischen sehr deutlich, die nur dadurch verschleiert wird, daß die Entscheidung ins Terminologische abgeschoben wird[2]: was nicht auf (formellem oder stillschweigendem) Vertrage beruht, ist zwar geschichtlich, aber nicht philosophisch ein „Staat“, oder ist nur insofern ein Staat, wie er auf einem Vertrage beruht.
Um nun zu den Anfängen dieser Umdeutung ins Historischökonomische zurückzukehren, so kann natürlich keine Rede davon sein, daß die wirtschaftlichen Verschiedenheiten des Einkommens und Besitzes den ersten Theoretikern des Gesellschaftsvertrages ganz unbemerkt geblieben seien. Sondern es handelt sich nur um eine immer stärkere Verlegung des Akzents[3].
Der Ausgangspunkt ist immer der „Naturzustand“, der ursprünglich nicht anders als negativ charakterisiert werden kann: er ist vorhanden, ehe der Staat entsteht. Und wie verschieden auch immer die einzelnen Schulen ihn darstellen, als Krieg Aller gegen Alle oder als goldenes Zeitalter der paradiesischen Unschuld und Eintracht: in einem sind sie Alle einig: es ist ein Zustand der Gleichheit und Freiheit. Aus dieser Voraussetzung wird nun versucht, die hier geltende „natürliche Rechtsordnung“ abzuleiten.
Und zwar ist die Gleichheit zunächst nichts anderes als die logische Konsequenz der Freiheit[4]. Frei ist hier, rein juristisch-politisch gesehen, jeder Mensch, weil ihm niemand von Rechts wegen etwas zu befehlen hat. Aber hier konnte man nicht stehen bleiben. „Der Gedanke einer .natürlich' bestimmten Rechtsordnung schließt notwendig die Konsequenz einer naturrechtlichen Bestimmung des Besitzes in sich“[5]. Denn ohne die Einbeziehung der Interessen bleibt der Grund-
[1] Welt als Wille und Vorstellung, I, S. 405.
[2] Ähnlich hilft sich Hegel. Wir kommen unten darauf zurück.
[3] Bodin sagt schon: „Denn die Erhaltung des Vermögens (des biens) eines jeden im besonderen ist die Erhaltung des öffentlichen Wohles (du bien public; hier ist wohl, nicht ohne Absicht beide Male das Wort „bien“ gewählt) a. a. O., S. 12. Vgl. S. 194: „Le monarque royal est celuy qui se rend aussi obéissant aux loix de la nature, comme il désire les subjects estre envers luy, laissant la liberté naturelle et la propriété des biens à chacun“. Vgl. Gumplowicz, Gesch. d. Staatsth., S. 148.
[4] „Est civitas coetus perfectus liberorum hominum, juris fruendi et communis societatis causa sociatus“ (Grotius, a. a. O., I. I, § 14).
[5] Gysin, a. a. O. S. 109.
[63]
satz der Gleichheit des Rechts leer. Er sagt dann nur aus, daß Jeder so viel Recht hat wie jeder Andere, schweigt aber darüber, auf was beider Recht sich erstreckt. Und hier interessiert, da das Recht auf Leben und Freiheit nicht nur selbstverständlich, sondern der Ausgangspunkt der ganzen Konstruktion ist, nur noch eins: das Interesse am Besitz, das Eigentum [1].
So kam man von dem Grundsatz der rechtlich-politischen Gleichheit notwendigerweise zur Gleichheit des Eigentums als Kennzeichen des Naturzustandes, d. h. zur Konstruktion der „Communio primaeva“, des Kommunismus[2], die noch heute in dieser rein dogmatischen, zuerst durchaus nicht geschichtlich gemeinten Konstruktion eine wie es scheint unzerstörbare Wurzel hat[3]: den Glauben an die geschichtliche Wirklichkeit dieses Anfangs. Inwieweit bei den ersten Naturrechtlern hier die Vorstellungen von dem angeblichen Urkommunismus der ersten Christen und der „dulcissima rerum possessio“ einiger Kirchenväter mitgewirkt haben, soll hier nicht untersucht werden.
Diese Gleichheit ist bei Hobbes und Spinoza rein negativ bestimmt als das Recht Aller auf Alles, aus dem eben der Kriegszustand mit Notwendigkeit hervorgeht; ihm kann nur das positive Recht, d. h. der Staat, ein Ende machen. Bei Grotius aber und seinen Nachfolgern wird, in bewußtem Gegensatz zu Hobbes, das „Recht“ der Besitzergreifung als schon in der Rechtsordnung des Naturzustandes gültig erklärt. Und zwar wird bei Thomasius (1655—1728) schon klar zwischen dem Recht der Okkupation verbrauchlicher Sachen unterschieden, das als absolut gilt, während das Recht der Okkupation an „fruchttragenden Sachen“, d. h. an Produktionsmitteln, nur für die Dauer des wirklichen Gebrauchs gelten soll.
Nun erscheint schon bei Grotius die Vorstellung, daß ein solcher Kommunismus nur unter der Bedingung geringer Dichte der Be-
[1] Daire (a. a. O., I, S. XV.) stellt Quesnays Meinung über diesen Gegenstand wie folgt dar: „Offenbar konnte die Idee der Freiheit im Geiste des Menschen nicht auftauchen, ohne daß sich ihr die des Eigentums gesellte, ohne die die erste keinen Sinn gehabt, nur ein eingebildetes Recht ohne Gegenstand dargestellt hätte ... Die derart aufgefaßte Freiheit ist nichts anderes als das Eigentum (devient la propriété)“.
[2] Grotius, Lib. I, Kap. I, § 11, 7 „sunt et quaedam juris naturalis non simpli- citer, sed pro certo rerum statu; sic communis rerum usus naturalis fuit, quamdiu dominia introducta non erant“. Gassendi nennt als erste Wirkung des Gesellschaftsvertrages die Möglichkeit, Eigentum zu haben“ (Hasbach, S. 37).
[3] Max Adler spricht allerdings jetzt von einem „legendarischen Urkommunismus“ (Die Staatsauffassung des Marxismus, S. 52/3).
Aber man lese, wie geradezu fanatisch Rosa Luxemburg in ihrem nachgelassenen Buche „Einführung in die Nationalökonomie“, herausgegeben von Paul Levi, die alte These noch gegen die „bürgerlichen Soziologen“ verteidigt (S. 102ff.).
[64]
völkerung und großer Primitivität der Lebensführung möglich sei [1]. Dieser Gedanke hat weit gewirkt. Er ist nicht bloß in die späteren naturrechtlichen Theorien übergegangen, sondern er hat auch vor allem, wahrscheinlich durch Vermittlung des auch in Westeuropa viel gelesenen Pufendorf, in die altliberale Theorie der Ökonomik Eingang gefunden.
Ferner tauchen schon hier die bekannten und zweifellos treffenden Bedenken gegenüber dem Kommunismus auf, „daß weder bei der Arbeit noch bei der Konsumtion die geschuldete Gleichheit beobachtet wird[2]“.
Aus solchen Erwägungen heraus nähern sich diese vorwiegend stoisch eingestellten Köpfe doch wieder dem Epikuräismus und seinem Erneuerer Hobbes. Denn bei wachsender Dichte der Bevölkerung und höheren Ansprüchen der Einzelnen müssen ja danach Konflikte entstehen, und dann wandelt sich der ursprünglich friedliche Naturzustand dieser Richtung dennoch in den Krieg Aller gegen Alle um. Hobbes hatte gefragt, „weshalb jemand eine Sache eher die seine als die eines anderen nennt. Da sich ergab, daß dies nicht auf der Natur, sondern auf dem Übereinkommen beruht (denn das, was die Natur für alle hervorgebracht hat, ist erst durch die Menschen verteilt worden), so führte mich dies auf die weitere Frage, zu welchem Zweck und infolge welcher Nötigung die Menschen gewollt haben, daß, da eigentlich alles allen gehörte, jeder ein besonderes Eigentum haben sollte. Ich sah nun, daß aus diesem gemeinsamen Besitz der Dinge der Krieg und damit alle Arten von Elend für die Menschen, die sich um deren Genuß mit Gewalt stritten, notwendig hervorgehen müsse[3]“. Diese Ansicht wird allgemein. Schon Grotius hatte gemeint, daß um des Friedens willen die Aufhebung der communio primaeva dringend „angeraten“ oder sogar durch das Naturrecht geboten sei[4].
Dieser Übergang vom Kommunismus zum Privateigentum wird nun von der älteren Richtung, die noch alles juristisch konstruiert, wieder als durch einen Vertrag geschehend dargestellt: eine in der Tat überaus naive Vorstellung, die Marx in einer berühmten Stelle geißelt, wo er sagt, daß die Volksmasse sich freiwillig in majorem gloriam des Kapitals selbst expropriiert haben soll[5], und die klarer als alles
[1] Lib. II, Kap. II, § 2. Die zweite Bedingung ist das Bestehen einer engen religiösen oder persönlichen Verbindung zwischen den Vergesellschafteten. Auch diese Vorstellung kehrt immer wieder.
[2] Ib. § 4.
[3] Lehre vom Menschen und vom Bürger, S. 66.
[4] Gysin, a. a. O., S. 115. Der Unterschied gegen Hobbes reduziert sich jetzt also darauf, daß ihm der Naturzustand — ohne communio — bereits den Krieg bedeutet, während die Stoiker der Neuzeit erst “die communio und daraus den Krieg entstehen lassen: als „Verderbnis“, als „Sündenfall“, stoisch ganz konsequent.
[5] Kapital, I, S. 732. Vgl. S. S. I, S. 989.
[65]
andere zeigt, wie hilflos die rein juristische Staatslehre allen Erscheinungen gegenübersteht, die die Entstehung des Rechts und der Rechte betreffen. Die kindische Fiktion war zuerst für die Entstehung einer politischen Tatsache, der sozialen Rangklassen, angewendet worden: „Die Aristokratie ... nimmt ihren Ursprung von einer Demokratie, die ihre Rechte auf jene Vornehmsten überträgt ... Ist das geschehen, so erhellt, daß das Volk als einheitliche Person infolge der auf jene übertragenen höchsten Gewalt nicht mehr besteht“ [1]. Fortan kann „diese Ungleichheit, durch welche der, dem wir freiwillig mehr zugestanden haben, auch mehr besitzt, nicht mehr für ein Unrecht gelten“[2]. Das ist vorwiegend politisch, auf die Rangordnung, gemünzt, klingt aber bereits deutlich ins ökonomische hinüber. Und noch deutlicher klingt die spätere liberale Eigentumslehre an, wenn Hobbes die Erstgeburt und die erste Besitznahme für „natürlich“ erklärt[3] und wenn er (S. 206) sagt: „Obgleich nun jedermann weiß, daß man durch Fleiß und Geschick sich Vermögen erwerben und durch Sparsamkeit erhalten kann, so pflegt doch der Arme die Schuld nicht in seiner Trägheit oder Verschwendung zu suchen, sondern er gibt der schlechten Staatsregierung die Schuld“. Hier taucht u. W. zum ersten Male in der Literatur das Problem auf, das noch heute Sozialismus und Bürgertum spaltet, ob die Armut auf dem Gebote der Natur oder auf „schlechter Regierung“ beruht. Das war namentlich die große Frage, über die sich Malthus mit Condorcet und Godwin auseinanderzusetzen hatte[4].
Man sieht, es waren hier schon fast mehr als nur „Ansätze“ zu einer naturrechtlichen Theorie des Eigentums gegeben, wie Gysin (S. 114) sagt.
Ähnlich läßt also, wie gesagt, auch Grotius, trotz seines ganz anderen „Naturzustandes“, das Privateigentum aus der kommunistischen Gemeinschaft durch Vertrag um des Friedens willen entstehen: „Es geschah nicht durch den bloßen Willen; denn dann hätten die Anderen nicht wissen können, was Jeder für sich haben wollte; auch hätten dann Mehrere dieselben Sachen wollen können; vielmehr geschah es durch eine Art Vertrag, teils ausdrücklich, wie bei der Teilung, teils stillschweigend wie bei der Besitznahme. Denn als die Gemeinschaft nicht mehr gefiel, und doch keine ausdrückliche Teilung
[1] Hobbes, a. a. O., S. 158. Ebenso Grotius, Proleg 15 (S. X) ferner I, Kap. I, § 4.
[2] Hobbes, a.a.O., S. 183. Gegen diese Konstruktion wendet sich bereits Milton; „Kein Volk hat freiwillig die wahnsinnige Tat begangen, alle seine Macht völlig an einen Menschen zu veräußern“, zit. bei Bluntschli, a. a. O. S. 116.
[3] Hobbes, a. a. O., S. III.
[4] Vgl. S. S. III, S. io34ff.
[66]
geschah, so mußte man annehmen, daß Alle übereingekommen sind. Jeder solle das zu eigen haben, was er in Besitz nehmen werde“ [1].
Spinoza (1632—1677) hat diese Ansätze weiter entwickelt[2], dann „waren es Locke und Wolff, die in der Konsequenz dieser Richtung eine vollständige Naturrechtstheorie des Eigentums entfalteten, unter deren Einfluß noch Kant steht“[3]. Locke ist es vor allem, der den Übergang von der nicht-historisch-juristischen zu der historisch-ökonomischen Konstruktion vollzog.
Er ist im Gegensatz zu seinem Antipoden Hobbes durchaus stoisch orientiert. (Er nennt ihn kaum; einmal wird „der große Leviathan“ erwähnt.) Sein „Naturzustand“ ist bereits eine Gesellschaft, in der es schon Eigentum gibt (II § 6)[4]. Es gibt auch schon das Natur recht auf das Erzeugnis der eigenen Arbeit (§ 27), und auf Leib und Leben, aber es gibt gegen Verletzungen kein Gesetz, keinen Richter und keine Vollstreckungsbehörde, bei der Klagen angebracht werden könnten. Jeder ist sein eigener Richter und Rächer, der auch die ihm nach Natur- recht zustehende Entschädigung selbst einzuziehen hat (§ 10, 12). „Um den hieraus entstehenden Kämpfen (Kriegszustand) zu entgehen, treten die Menschen durch einen Einigungsvertrag zusammen, setzen sich Richterund ausführende Gewalten, eine „Regierung“ (government), und verwandeln so die „Gesellschaft“ schlechthin in die „bürgerliche“ oder „politische Gesellschaft“ (§ 14/15, § 21, 28, 50, 74, 87, 89, 95).
Der einzige Zweck der Vereinigung ist, wie immer wiederholt wird: die Sicherung des Eigentums: „the chief end whereof is the preservation of property“ (85) ; darunter versteht er allerdings nicht nur das sachliche Eigentum, sondern „his life, liberty and estate“ (123, 87) ; „Der Gedanke des Privateigentums beherrscht so sehr die Lockesche Theorie, daß er die Begriffe „lives, liberties, estates“ mit dem Worte „property“ zusammenfaßte“[5]. In diesem Sinne muß man es verstehen, wenn die
[1] Vgl. Metzger, a. a. O. S. 33 Anm.
[2] Vgl. Meinecke, Staatsräson, S. 278. Bei Spinoza spielt das ökonomische im allgemeinen eine sehr geringe Rolle. Er ist eben ein Zwischenklassenmensch, aus großbürgerlicher Kommerzfamilie, aber ausgestoßen und seiner Arbeit und Lebenshaltung nach mehr Proletarier. So vertritt er auch keine Klasse, und seine bürgerliche Herkunft kommt mehr in dem allgemeinen Pazifismus seiner Gesamthaltung zum Ausdruck, (z. B. Pol. Trakt. VII, § 28), ferner in der Einschätzung ökonomischer Motive (ib. VII, § 8).
[3] Gysin, a. a. O. S. 116.
[4] Alle Zitate beziehen sich in Zukunft auf das zweite Buch der Two Treatises. Das erste ist nichts als eine Polemik gegen den „Patriarcha“ Filmers, eines Vorläufers unseres v. Haller, die für uns kaum noch lesbar ist. Das Buch war erst 1680 publiziert worden (Lord, a. a. O. S. 28). Auch Algernon Sidney (1683 unter Jakob II. enthauptet) würdigte das törichte Pamphlet einer Gegenschrift (Gooch, S. 160).
[5] Hasbach, a. a. O. S. 51. Vgl. Jellinek, a.a.O. S. 247. In ähnlicher geschichtlicher Situation schrieb Cicero (De officiis, II, 21, 73): „Hanc enim ob causam maxime, ut sua tenerent, res publicae civitatesque constitutae sunt“.
[67]
Behauptung unermüdlich wiederholt wird: „Whereas government has no other end but the preservation of property“ (§ 94). „The great end of men's entering into society being the enjoyment of their properties in peace and safety“ (134). „The supreme power cannot take from any man part of his property without his own consent, for the preservation of property being the end of government and that for which man enter in society“ (§ 138). Sogar der siegreiche Eroberer darf wohl das Leben des mit den Waffen in der Hand gefangenen Feindes nehmen, aber nicht sein Eigentum, es sei denn als Schadenersatz (§ 182), und ganz und gar nicht das Eigentum der Frau und der Kinder (§ 183). So ist denn auch das Erbrecht von Natur wegen: jeder Mann wird mit einem doppelten Recht geboren; erstens der Freiheit, und zweitens „to inherit with his brethren his father's goods“ (190).
Wie ist nun das Eigentum entstanden ? Im Naturzustande waren selbstverständlich alle gleich (§ 4). Und diese Gleichheit war zuerst nicht gefährdet. „Das gleiche Gesetz der Natur, das uns durch dieses Mittel (die Arbeit) Eigentum gibt, begrenzt es auch ... So viel Einer irgendwie zu seines Lebens Vorteil brauchen kann, bevor es verdirbt, so viel darf er durch seine Arbeit zu seinem Eigentum machen: was darüber ist, ist mehr als sein Teil und gehört den anderen. Und da es wenig Menschen und viel Naturerzeugnisse gab, so konnte es lange Zeit in der Welt nicht zu Streitigkeiten über das Eigentum kommen“ (§31).
Das wichtigste Eigentum aber, das an der Erde selbst, nicht nur an ihren Früchten, kann auch nur durch Arbeit gewonnen werden. „So viel Land, wie ein Mann pflügt, pflanzt, verbessert, bebaut, so viel Land, und nicht mehr, als das Erzeugnis trägt, das er gebraucht, ist sein Eigentum (32) ... Indem er es aussonderte, beeinträchtigte er niemanden: denn es blieb noch genug ebensoguten Landes übrig; ebensowenig beeinträchtigt ein tiefer Trunk aus einem starken Bache den Späterkommenden (33). Die Natur hat das Maß des Eigentums gut bestimmt durch die Größe der Arbeitskraft und der Bedürfnisse des Menschen: keines Mannes Arbeit könnte alles Land urbaren und sich aneignen, auch könnte sein Genuß nur einen kleinen Teil verzehren. Und so war es für jedermann auf diese Weise unmöglich, das Recht des anderen zu beeinträchtigen oder zum Schaden seines Nachbarn Eigentum zu erwerben, der immer noch ein ebenso gutes und großes Stück haben kann, nachdem der erste sich versorgt hat. Dieses Maß beschränkte in den ersten Weltaltern jedes Mannes Eigentum auf ein sehr bescheidenes Maß ... Und das gleiche Maß könnte, so voll die Welt auch erscheinen mag, jedermann ohne Nachteil für einen anderen zugemessen werden... Ich behaupte kühn, daß die gleiche Regel des Eigentums, daß nämlich jedermann so viel Land haben könnte, wie er gebrauchen könnte, immer noch in der Welt ohne
[68]
Beengung irgend jemandes gelten könnte, da genug Land in der Welt vorhanden ist, um die doppelte Zahl der Erdbewohner zu versorgen“ (36).
Wie ist denn nun trotz dieser Fülle des Ackerbodens die landlose Klasse der reinen „freien“ Arbeiter entstanden? Mit der Erklärung treten wir in die volle ökonomische Theorie ein: es ist die Erfindung des Geldes, die das zuwege brachte! Sie und das stillschweigende Einverständnis der Menschen, ihm einen Wert beizumessen, führten (ebenfalls durch Übereinstimmung, consent) größeres Grundeigen und ein Recht darauf ein (§ 36).
Locke erreicht sein Beweisziel, die gegenwärtige Eigentumsordnung Englands zu rechtfertigen, durch eine höchst seltsame Konstruktion, die trotz der Größe seines Namens u. W. in keine spätere Ökonomik übergegangen ist, ja, nicht einmal irgendwo erwähnt wird, auch nicht von den Physiokraten, denen sich die gleiche apologetische Aufgabe für Frankreich stellte. Locke hat seinen Beweis außerordentlich geschickt vorbereitet, indem er uns sagte, daß jeder von den freien Gaben der Natur rechtmäßig so viel nehmen dürfe, wie er brauche, aber er dürfe nichts verderben lassen. Wenn nun jemand z. B. „Pflaumen, die in einer Woche verfault wären, gegen Nüsse austauschte, die sich ein ganzes Jahr eßbar erhalten, so beging er kein Unrecht, da er den gemeinsamen Vorrat nicht verwüstete; — und wenn er dann, gereizt durch die Farbe, seine Nüsse für ein Stück Metall, oder seine Schafe für Muschelschalen, oder Wolle für einen blinkenden Kiesel oder Diamanten vertauscht, und diese Dinge sein ganzes Leben behält, so begeht er wieder kein Unrecht, mag er auch noch so viel davon aufhäufen, da die Ausschreitung nicht in der Größe seines Besitzes, sondern in der nutzlosen Verwüstung eines Dinges liegt“ (§46). „Und so kam das Geld in Gebrauch, ein dauerhaftes Ding, das man ohne Verderb aufbewahren konnte, und das auf Grund gegenseitiger Vereinbarung die Menschen in Tausch für die wahrhaft nützlichen aber verderblichen Lebensmittel annehmen; (47) und da verschiedene Grade des Fleißes (industry) dahin wirkten, den Menschen Besitz in verschiedenen Verhältnissen zu geben, so gab ihnen die Erfindung des Geldes die Möglichkeit, ihn zu verewigen und zu erweitern: denn man unterstelle eine Insel, abgeschnitten von allem Verkehr mit dem Rest der Welt, mit nur hundert Familien als Einwohnern, aber mit Schafen, Pferden und Kühen und anderen nützlichen Tieren, mit bekömmlichen Pflanzen und Kornland genug für hunderttausendmal so viele, aber mit nichts auf dem Eiland, was, sei es durch seine Un verderblichkeit, sei es durch seine Seltenheit, die Stelle eines Geldes vertreten könnte : welchen Grund könnte jemand haben, seinen Grundbesitz über den Bedarf seiner Familie und ihre reichliche Versorgung mit solchen Gütern auszudehnen, die sie entweder
[69]
selbst erzeugen oder gegen gleich verderbliche nützliche Güter austauschen könnten ? Wo ein solches, gleichzeitig dauerhaftes und seltenes Gut nicht existiert, das wertvoll genug ist, um aufgeschatzt zu werden, da werden die Menschen nicht in der Lage sein, ihren Besitz an Land, und wäre es noch so reich und noch so frei zugänglich, zu vergrößern. Denn ich frage : was würden einem Manne zehn-, ja hunderttausend Acres des besten Landes, fertig bestellt und sogar mit Vieh versorgt, im Innern Amerikas nützen, wo er keine Aussicht auf Verkehr mit der übrigen Welt hat, um durch den Verkauf seines Erzeugnisses Geld zu erzielen ? Es würde nicht die Kosten der Einzäunung wert sein, und er müßte es bald wieder den wilden Schatze der Natur zurückgeben, außer der kleinen Fläche, die für ihn und seine Familie ausreicht“ (§ 48).
Nun war aber im Anfang die ganze Welt Amerika, und war noch mehr als nur Amerika. Denn etwas dem Gelde Ähnliches war nirgend bekannt. Finde etwas heraus, was unter seinen Nachbarn den Gebrauch und Wert des Geldes hat, und du wirst sehen, daß derselbe Mann sofort beginnen wird, sein Grundeigentum zu vergrößern (§ 49).
„Da aber Gold und Silber, das ja im Verhältnis zu Nahrung, Kleidung und Fahrzeugen kaum Nutzen hat, seinen Wert, dessen Maß sonst noch weithin die Arbeit ist, nur durch die Übereinstimmung der Menschen hat, so ist es klar, daß die Menschen sich auf eine unverhältnismäßige und ungleiche Verteilung des Landeigentums geeinigt haben, indem sie, durch eine stillschweigende und freiwillige Vereinbarung, einen Weg fanden, wie ein Mann auf gerechte Weise (fairly) mehr Land besitzen kann, als dem Erzeugnis entspricht, das er verbrauchen kann, indem er für den Überschuß Gold und Silber empfängt, das er, ohne jemandem Unrecht zu tun, aufschatzen kann, da diese Metalle in der Hand des Besitzers nicht verderben“ (§ 50)· Vor der Erfindung des Geldes aber und dem stillschweigenden Vertrage, der auf Gold und Silber einen Wert setzte, kam niemand in Versuchung, mehr zu arbeiten als seinen Bedürfnissen entsprach; so blieb kein Raum für Streit um Besitzrechte und für Beeinträchtigung der Rechte anderer; der Teil, den sich jemand herausschnitt, war leicht erkennbar, und es war ebenso unehrenhaft wie nutzlos, sich zu viel herauszuschneiden oder über Bedarf zu nehmen (§ 51).
Wir sagten, wir seien hier in voller ökonomischer Theorie, und zum Teil in recht guter. Die Vorstellung der „isolierten Insel“ ist in viele spätere Lehrbücher übergegangen, die Erkenntnis, daß Boden als „freies Gut“ gleich dem Wasser des starken Baches unter den hier vorgestellten Verhältnissen keinen Wert haben kann; daß das Eigentum gleich sein muß, daß es nicht nur gegen das Recht der Gemeinschaft, sondern auch nutzlos ist, größeres Grundeigen
[70]
zu nehmen, sind noch heute leider weit davon entfernt, das Gemeineigentum der Ökonomisten zu sein, obgleich es sich um apodiktisch wahre und entscheidend wichtige Sätze handelt; außerdem findet sich in diesen Paragraphen eine Auslassung, die beweist, daß Locke schon damals das „Gesetz der Kapazität“ besaß, das erst mehr als hundert Jahre später von List und Carey neu entdeckt werden mußte; wir kommen in anderem Zusammenhange darauf zurück [1].
Um so erstaunlicher ist die eigentliche Ableitung. Sie ist von äußerster Schwäche; vielleicht ist sie aus diesem Grunde nie wieder aufgenommen worden; uns erscheint allerdings wahrscheinlicher, daß sie eher deshalb sekretiert worden ist, weil in der Begründung Dinge ausgesprochen sind, die dem apologetischen Zweck des Ganzen außerordentlich gefährlich sind, da von eben diesen Grundlagen aus die Berechtigung des Großgrundeigentums und der Klassenscheidung sich sehr leicht angreifen ließ. Die bürgerliche Theorie hat Torheiten weitergegeben, die nicht geringer waren, so z. B. die Ricardosche Ableitung des Kapitalprofits und das Malthussche Bevölkerungsgesetz, von neueren Ungeheuerlichkeiten zu schweigen.
Wenn wir uns selbst auf den Standpunkt Lockes stellen wollen, daß das Geld seinen Wert nur „durch Meinung“ hat, so bleibt dennoch die ganze Ableitung vollkommen unmöglich. Wer kultiviert denn die zehn- oder hunderttausend Acres in diesem vorausgesetzten Gesellschaftszustande ? Der eine Mann mit seiner Familie ? Nur ein Städter kann solchen Unsinn denken! (Wir werden später sehen, daß auch Fichte ungefähr so gedacht hat.) Der Einzelbauer ohne Gesinde kann nicht viel mehr als etwa dreißig Morgen bestellen, auch in der Neuzeit mit den besseren Werkzeugen nicht. Es muß eine Arbeiterklasse gegeben sein, ehe Großbesitz wirtschaftlich möglich ist, nicht bloß, wie der handelsgewöhnte englische Städter annimmt, Absatzmöglichkeit. Solange es aber noch freies Land gibt, kann es keine Arbeiter geben, also auch keinen Großbesitz, also auch keine maßlose Anhäufung von Schätzen, also keine groben, klassenbildenden Verschiedenheiten des Einkommens und Vermögens. Auch nicht nach der „Erfindung“ des Geldes. Locke hat hier versucht, die alte Überzeugung des Platon und der kanonischen Wirtschaftsphilosophie auf ökonomische Weise zu erhärten; und seine Zeit wird ihm willig gefolgt sein, da sie das „verfluchte Gold“ von jeher als die Wurzel aller Übel ansah: aber für einen
[1] Im Keime besaß bereits Morus das Gesetz, er schreibt (Utopia S. 54/55): „Mit denen, die wollen, verbinden sie sich zu gleicher Lebensweise und gleichen Sitten und verschmelzen dann leicht mit ihnen, und das dient zu beider Völker Bestem: erreichen sie doch dank ihrer Einrichtungen, daß dieselbe Bodenfläche für beide reichlich Raum bietet, die vorher dem einen knapp und unzureichend erschien.“
[71]
wirklich ökonomisch denkenden Modernen ist die ganze Darlegung keiner Gegenworte wert.
Was hier spricht, ist der Klassenvertreter der englischen Bourgeoisie im Jahre des Friedensschlusses zwischen dem „moneyed“ und dem „landed interest“, den kommerziellen und agrarischen Kommerzien- räten, um mit Wichard von Möllendorff zu sprechen, im Jahre des Korngesetzes Williams. Er hat die apologetische Aufgabe zu lösen, die Verteilung der Vermögen in Stadt und Land — „reime dich oder ich fresse dich“ — naturrechtlich zu rechtfertigen, und löst diese seine Aufgabe so gut er kann: wie wir annehmen, gutgläubig [1].
Er hat auch noch andere Zeichen seiner großbürgerlichen Gesinnung gegeben: er bekommt es fertig, das unglaubliche System der englischen Parlamentswahlen mit seinen „rotten boroughs“[2] zu rechtfertigen und doch so weit für reformbedürftig und -fähig zu erklären, wie das der Großbürgerklasse erwünscht sein möchte (§158: „in proportion to the assistance which it affords to the public“).
Er entwarf „die Grundlagen einer freiheitlichen Wirtschaftsordnung“, sagt Hasbach von ihm[3]; von hier „war es nur noch ein Schritt zum Smithschen Wirtschaftsstaat“[4].
Bevor wir diesen Schritt machen, muß noch einmal betont werden, daß mit diesem Ökonomismus notwendig auch ein ausgesprochener Historismus verbunden war. Der Naturzustand wird als geschichtlicher Ausgangspunkt genommen; man braucht nur das achte Kapitel „über den Beginn der politischen Gesellschaften“ zu lesen, namentlich von § 100 an, um das klar zu erkennen. Wenn sich Locke hier wieder außer auf römische Quellen vorwiegend auf die Bibel stützt, so ist es nicht mehr, wie noch bei Grotius, die heilige, sondern die geschichtliche Überlieferung, auf die er seine Schlüsse baut.
Der einzige Zug, der diese ganze Konzeption grundsätzlich von der der Quesnay und Adam Smith unterscheidet, ist der echt stoische
[1] „Und so entpuppt sich das nüchterne Vernunftwesen Lockes unversehens als englischer Gentleman, der dem Ideal der respectability huldigt“ (Rohden, Weltanschauliche Grundlagen, S. 24).
[2] Unter den 203 englischen cities und boroughs, welche die Masse der Unterhausmitglieder sandten, (zusammen 415), waren vor der Reform von 1832: 60 sogenannte rotten boroughs von weniger als 2000 Menschen bewohnt, 48 von 2—4000, während die neuaufgeblühten Großstädte, Manchester, Birmingham, Leeds, Sheffield gar keine Vertretung hatten. Man nahm an, daß tatsächlich 84 Personen, großenteils Peers, die Wähler von 157 Mitgliedern waren, daß ferner 180 andere Stellen durch den Einfluß von 70 Individuen besetzt wurden, so daß von den insgesamt 658 Mitgliedern des Unterhauses die Mehrheit, nämlich 337, von etwa 159 Privatleuten ernannt wurden. (Röscher, Politik, S. 344.)
[3] Hasbach, a. a. O. S. 168.
[4] Derselbe, S. 154.
[72]
Pessimismus der Auffassung: die Lehre vom Sündenfall: „Nach dem Gesetz der Natur, das allen gemeinsam ist, bilden alle Menschen eine Gemeinschaft, formen eine Gesellschaft, im Gegensatz zu allen anderen Geschöpfen. Und wäre nicht die Verderbnis und Tücke der entarteten Menschen, so brauchte man keine andere; die Menschen brauchten sich nicht von dieser großen und natürlichen Gemeinschaft zu trennen und durch positive Verträge kleinere und gesonderte Verbände zu begründen“ (§ 128).
Aber mit dieser einzigen Ausnahme haben wir hier das ganze Credo der ersten Generation der klassischen Ökonomik : die Klassenordnung ist ohne Verletzung des Naturrechts rein aus innerstammlichen Beziehungen der verbundenen Menschen ohne jedes Eingreifen außerökonomischer Gewalt entstanden.
Den Umschwung zu einer optimistischen Auffassung brachte erst die Lehre Bernard de Mandevilles (1705) von der durch den Egoismus herbeigeführten Harmonie der Interessen: „private vice public virtue“, und ihre Ausgestaltung durch Quesnay und Adam Smith [1]. Damit war der christlich-stoischen Lehre von der „Sündhaftigkeit“ der Menschen die Grundlage entzogen, solange jene Theorie galt. Als sie aufgegeben wurde, trat der Pessimismus wieder in seine herrschende Stellung ein, und so gleicht denn die Ökonomik der zweiten Generation der englischen Klassiker, der Ricardo und Malthus, grundsätzlich vollkommen wieder der Lockes. Sie wird, wie Carlyle sagte, zur „trüben Wissenschaft“ (dismal science).
Aber diese moralphilosophischen Anschauungen und ihr Wandel berühren nicht die historisch-ökonomischen Grundlagen der großbürgerlichen Theorie von der Entstehung des Staates und der Klassen, wie wir sie in ihrer vollendeten Gestalt spätestens bei Turgot[2] finden. Der englische Calvinismus hat, wie Max Weber gezeigt hat[3], an ihrer Ausgestaltung mitgewirkt. Geschäftlicher Erfolg ist den Gläubigen
[1] Vgl. unsere „Wege zur Gemeinschaft“, S. 27ff. : „Physiologie und Pathologie des sozialen Körpers“. Ferner über Mandeville und Smith' Stellung zu ihm Hasbach, a. a. O. S. 107. Gide und Rist, Gesch. d. volksw. Lehrmein. (3. Deutsche Ausgabe, S. 77/8). Die „Bienenfabel“ erschien nach Gide (S. 60) zuerst 1704, nach Robertson, (Pioneer Humanists, S. 232) nicht vor 1705, dann in erweiterter Gestalt 1714. M. hat also unzweifelhaft die Priorität vor Vico, dessen Scienza Nuova erst 1725 erschien. Ob Vico Mandeville gekannt hat, wissen wir nicht zu sagen; jedenfalls hat er die Vorstellung von der „List der Idee“ in der ihm eigentümlichen stark religiös gefärbten Fassung: „Man wird erkennen, daß jene öffentliche Tugend nichts war als der gute Gebrauch, den die Vorsehung von schweren häßlichen und wilden privaten Lastern machte, damit die Gemeinwesen sich erhielten .. .“ (S. 69). Vgl. ferner S. 77, 134/5. 424 und anderwärts. Die Übereinstimmung im Wortlaut ist auffällig.
[2] Vgl. S. S. I, S. 988, III, S. 221.
[3] Vgl. Meinecke, Staatsräson, S. 237.
[73]
der schrecklichen Prädestinationslehre ein Zeichen dafür, daß Gott sie für das Paradies auserlesen hat. Daher die außerordentliche positive Wertbetonung der „wirtschaftlichen Tugenden“: Fleiß, Sparsamkeit, Nüchternheit, Vertragstreue, Um- und Vorsicht ! Kraft dieser Tugenden kommt der Bürger empor: ihnen dankt er seine soziale Stellung — und sie müssen nun diese Stellung als gerecht, als „natürlich“ legitimieren. Des Kaufmanns Ehre besteht, wie v. Ihering [1] in seinem „Kampf ums Recht“ feinsinnig gezeigt hat, in seinem unbezweifelten Kredit; er dankt diesen Kredit und somit seine Standesehre jenen Tugenden, die ihn „vor Gott und den Menschen wohlgefällig machen“. So ausgezeichneten Männern sendet Gott als Zeichen seiner Gnadenwahl auch Glück im Geschäft : und damit ist die Lehre von der Klassenentstehung vollendet, wie Turgot sie vorträgt:
Wenn der „Naturzustand“ vorbei ist, weil jene kritische Dichte der Bevölkerung erreicht, das ganze Land „voll besetzt“ ist, beginnt die Differenzierung der Einkommen und Vermögen. Die Tugendhaften werden reich und gelangen in den Besitz des Landes und des Kapitals, der Frucht ihrer „Enthaltsamkeit“; die weniger Tugendhaften werden oder bleiben arm und müssen den Günstlingen Gottes dienen.
In dieser Gestalt ist die Lehre das Gemeineigentum der ganzen physiokratischen Schule: „Aber der zunehmende Reichtum der Gesellschaft führt notwendig die zunehmende Verschiedenheit des Vermögens mit sich : eine natürliche Ungleichheit, die sich sogar im primitiven Zustand bereits als Folge der Verschiedenheiten der individuellen Fähigkeiten findet; sie wird durch die Aneignung des Bodens vergrößert, und zwar aus dem gleichen Grunde, und vergrößert sich noch mehr durch das natürliche und rechtmäßige Erbrecht, demzufolge der väterliche Besitz einer Familie unter zahlreiche Erben aufgeteilt wird, während in anderen Fällen ein einziger Erbe den Reichtum mehrerer Familien in seiner Hand vereinigt“[2]. In ganz der gleichen Gestalt nimmt dann Adam Smith die Theorie wieder von den Physiokraten an und gibt sie seinen Nachfolgern weiter, unter denen sie ihren Charakter, eine gegen den Kommunismus gerichtete Kampftheorie zu sein, erst völlig klar enthüllt. Malthus wendet sie, die bisher nur auf die Vergangenheit bezogen wurde, zum ersten Male auch auf die Zukunft an; er unterstellt gegen Godwin, Condorcet und die übrigen Sozialisten
[1] S. S. I, S. 596.
[2] Daire, Physiocrates, I, S. 28/9. Mercier de la Rivière führt das Grunaeigentumsrecht auf die Arbeit der Urbarung zurück. Daher gehöre es zum Bestände der natürlichen Ordnung: „Wenn nun auch durch die Einführung der Privateigentums an der Erdoberfläche Viele vom Privateigentum ausgeschlossen werden, so erhalten sie doch ein Recht auf den Mitgenuß der Ernte, wenn sie sich nützlich machen“ (zit. n. Hasbach, a.a.O., S. 63). Vgl. ed. Daire, II, S. 617. Ganz ebenso Baudeau (ib. S. 759).
[74]
seiner Zeit, daß der Zustand der Gleichheit durch irgend einen Eingriff wiederhergestellt sei, und beweist triumphierend, daß binnen kürzester Zeit die alte Klassenordnung sich wiederherstellen müßte, kraft der Verschiedenheit der wirtschaftlichen Begabung. Mithin sei jeder Sozialismus wider die Natur und ein Frevel an der Gesellschaft.
All das steht, wenn auch nicht verbis expressis, aber doch völlig klar und präzis, schon bei Hobbes, Grotius und Locke und ist, mit wenigen Ausnahmen, in alle spätere Theorie übergegangen, und zwar nicht nur in die groß- und kleinbürgerliche, sondern auch in die bedeutsamste sozialistische, das Marxsche System: es ist die einzige logische Grundlage für seinen Kommunismus, wie wir gezeigt haben [1].
Gysin hat unseres Erachtens unbedingt Recht, wenn er angesichts dieser Lehre annimmt, Locke habe die ganze Konstruktion des Urkommunismus nur aus dem Grunde gemacht, um „der naturrechtlichen Ableitung des Eigentums einen idealen Hintergrund zu bieten“ (117). Auf soldher Grundlage steht die „geschichtliche“ Theorie des Eigentums, der z. B. Treitschke in dem Lakonismus Ausdruck gibt: „Im großen gesehen, erscheint die Geschichte des Eigentums als eine Entwicklung aus dem Kommunismus zu freiem Einzeleigentum“[2].
Wir haben jetzt die Elemente beisammen, die die Grundlage der naturrechtlichen Lehre von der ursprünglichen Akkumulation ausmachen: die Differenzierung der Vermögen und Einkommen durch die, auf Grund der Geldwirtschaft und des dadurch ermöglichten Handels heraufbeschworene Konkurrenz, und das Recht der ersten Okkupation, durch das ein von nun an unangreifbares Recht entstehen soll. Schopenhauer konnte sich nur ausKants „Altersschwäche“ „seine ganze Rechts- lehre, als eine sonderbare Verflechtung einander herbeiziehender Irrtümer, und auch dieses erklären, daß er das Eigentumsrecht auf erste Besitzergreifung begründen will“. Er führt demgegenüber „das älteste Gesetzbuch der Welt, das des Manu“, an, das sage: „daß ein bebautes Feld dessen Eigentum ist, welcher das Holz ausrottete, es reinigte und pflügte, wie eine Antilope dem ersten Jäger gehört, welcher sie tödlich verwundete“. Und dann widerlegt er diese Lehre von der Okkupation mit Gründen, denen so leicht niemand widersprechen wird. „Wie sollte doch die bloße Erklärung meines Willens, Andere vom Gebrauch einer Sache auszuschließen, sofort auch selbst ein Recht dazu geben ? Offenbar bedarf sie selbst erst eines Rechtsgrundes, statt daß Kant annimmt, sie sei einer“[3].
[1] S. S. III, S. 194/5, 210, 223, S. S. I, 990/1.
[2] Politik, I, S. 267.
[3] Welt als Wille und Vorstellung I, S. 396/7 vgl. Metzger, a.a. O. S. 98:
„Gerade in diesen Zusammenhängen tritt nun wieder der naturrechtliche Materialismus der Kantischen Eigentumslehre, welcher das Recht eben doch auf die Macht gründet, unverkennbar an den Tag. Es ist die Frage: „Wieweit erstreckt sich die Befugnis der Besitznehmung eines Bodens? Soweit als das Vermögen, ihn in seiner Gewalt zu haben, das ist als der, so ihn sich zueignen will, ihn verteidigen kann; gleich als ob der Boden spräche: wenn ihr mich nicht beschützen könnt, so könnt ihr mir auch nicht gebieten.“ Die entgegenstehende kulturrechtliche Theorie Lockes, welche das Sondereigen nicht in der bloßen Inhabung, sondern in der Bearbeitung der Dinge gründen läßt, hat Kant hier ausdrücklich abgelehnt.“
[75]
Es zeugt von der ungeheuren Kraft des „Zeitgeistes“, daß sogar ein Kopf wie Kant in einen so krassen Irrtum verfallen konnte.
2.2. Die kleinbürgerliche Staatslehre. (Jean Jacques Rousseau.)
Während die Bourgeoisie ihre feudalen Gegner allmählich besiegte, schuf sie sich selbst in den nicht nur relativ, im Vergleich mit den Ansprüchen und Lebensmöglichkeiten des neuen Reichtums, verarmten, sondern auch vielfach unmittelbar ausgepowerten, absolut verarmten Gliedern des ehemals einheitlichen dritten Standes neue Gegner: in den durch die Manufakturen „expropriierten“ Handwerkern, in den, durch eine nur der Industrie dienende Getreidepolitik ; durch den Import neuer konkurrierender Stoffe (Indigo für Waid) ; durch die von ihr mit verschuldete und jedenfalls zu verantwortende imperialistische Politik: Militärdienst und Steuerdruck; und schließlich, wie in England, durch unmittelbare „Legung“ zugrundegerichteten Bauern; in den halb und ganz gebildeten Geistesproletariern, denen nicht mehr wie einst der Schirm der arm gewordenen Kirche, im äußersten Falle das Kloster, offen stand: aus dem „clericus“ ist jetzt der „clerk“ [1] geworden, der Geistesarbeiter. Zu ihnen gesellen sich Malkontente, die in diesem Staate der Mächtigen und Reichen keine Möglichkeit des Aufstiegs sehen, geführt von den beiden Elementen, die noch Comte so grimmig haßte, den Advokaten und Journalisten, die durch Opposition zu Macht und Einkommen zu gelangen hoffen. Noch schweigt die Stimme des industriellen Proletariats; nur die Handwerksgesellen, vom Monopol der Zünfte fast jeder Aussicht auf Selbständigkeit beraubt, intonieren schwach das später so mächtige Lied der darbenden Arbeit. Kurz, die ganze Bewegung ist vorerst noch kleinbürgerlich. Sie ist gefährlich besonders durch die ihr in jedem Augenblick zur Verfügung stehende Bundesgenossenschaft des Lumpenproletariats, das in Zeiten so arger Korruption von oben her, die die schlimmste Prostitution und den immer mit ihr verbundenen Kriminalismus nach unten hin verbreitet, ungeheuer zahlreich und gefährlich ist: Gelegenheitsarbeiter, Zuhälter,
[1] Englisch für Schreiber und „Commis“.
[76]
Verbrecher jeder Art. Unter der reichen, üppigen Gesellschaft des Ancien Régime gärt eine Hölle [1]!
Die Bewegung, das Kampfbündnis der zur Verzweiflung getriebenen Bauern mit den Enterbten des jungen Kapitalismus, hatte schon mehrfach zu Ausbrüchen geführt, deren Wirkung auf das Großbürgertum wir soeben dargestellt haben. Die Lollhardenbewegung in England und die spätere agrarkommunistische Rebellion der True Levellers zu Cromwells Zeit beruhigte sich in dem Maße, wie die englische Volkswirtschaft sich ihr Weltmonopol eroberte und ausweitete, das ja auch den unteren Schichten gewisse Anteile abwarf. Die gleiche Bewegung in Deutschland zur Zeit der Bauernkriege und der Wiedertäufer hatte lange keine Nachwirkung, weil mit dem Siege der Fürsten über sie auch gleichzeitig der junge aber starke Kapitalismus der Fuggerzeit erwürgt und das Land dann durch den dreißigjährigen Krieg nahezu bis zur Naturalwirtschaft zurückgeworfen wurde.
Frankreich war dazu bestimmt, der Schauplatz der gewaltigsten aller bisher beobachteten revolutionären Bewegungen dieser kleinbürgerlichen Kampfgenossenschaft zu werden. Nirgends war der Druck auf die ländliche und städtische Unterklasse wirtschaftlich, politisch und vor allem moralisch so über alle Massen unerträglich, letzteres, weil nirgends die Schamlosigkeit des Genusses einer vollkommen verderbten, aus jeder sozialen Bindung gelösten, nur faulenzenden und genießenden „leisure class“ sich so offen ins Tageslicht stellte. In den unterirdischen Gängen des Vulkans spannten sich die Gase: die Explosion mußte erfolgen.
Der Wortführer dieser Bewegung ist Jean Jacques Rousseau[2]. „Bei ihm gibt das in seiner Würde gekränkte Ehrgefühl der Untertanen, der pathologisch gesteigerte Zorn über die Herrschaft moralisch verkommener Menschen, das Mitleid mit den Opfern der Ungerechtigkeit den Ausschlag“[3]. Er „gibt eine Moral für den Umsturz“ [4]. „Der Bußprediger des fin du siècle entwirft aus Sehnsucht und Reue ein Gegenbild seiner selbst und der Gesellschaft. Wie aus Minderwertigkeitsgefühl und Selbstverneinung die .Bekenntnisse' stammen, so aus Zurücksetzung und Nichtbeteiligung die Predigt gegen die Ungleichheit“[5].
[1] Die Ähnlichkeit mit der schlimmsten Zeit der Antike in Rom ist auffällig groß. Das verheerende Klubwesen besteht in der Revolutionszeit in demselben Umfang und mit derselben vernichtenden Wirkung, und auch die billige Brotverteilung mußte eingeführt werden unter schwerer Belastung des ganzen übrigen Frankreich. Anfang 1796 verschlang dieser Posten über zwei Drittel sämtlicher Ausgaben des Ministeriums des Innern. Röscher, a. a. O. S. 350.
[2] Vgl. S. S. I, S. 757.
[3] Fueter, a. a. O. S. 398.
[4] Salomon, a. a. O. S. 482.
[5] Ib. S. 483.
[77]
In dieser „Predigt“, dem „Discours sur les origines de l'inégalité parmi les hommes“ von 1754 ist die kleinbürgerliche Fassung des Gesetzes der ursprünglichen Akkumulation in ebenso großer Vollständigkeit enthalten wie die großbürgerliche Variante in Turgots „Réflexions“. Wir geben deshalb einen ausführlichen Auszug:
Das Problem ist, den natürlichen Menschen darzustellen, wie er war, ehe er durch die Einflüsse der Gesellschaft und der Zivilisation verändert wurde. Nur aus der Natur des Menschen können wir das Gesetz der Natur ableiten: nicht das sog. „Naturrecht“ der Juristen, sondern das aus der Natur des Menschen folgende Gesetz. Das eine können wir erkennen, daß es nur unter zwei Bedingungen das gesuchte Gesetz sein kann: es muß so beschaffen sein, daß der Wille des Verpflichteten sich ihm bewußt unterwirft, und daß es „unmittelbar durch die Stimme der Natur zu ihm spricht“ (37). Es gibt nun nur zwei Grundtriebe, aus denen es entstehen kann, den Trieb der Selbsterhaltung und den des Mitleidens gegenüber unseres Gleichen.
Es gibt heute zwei Arten der Ungleichheit, eine natürliche, die im Unterschied des Alters, der Gesundheit, der geistigen und körperlichen Kräfte begründet ist, und eine andere, die man als politische und moralische bezeichnen könnte, da sie auf einer Art von Konvention beruht. Sie besteht in den verschiedenen Vorrechten des Reichtums, des Ranges, der Macht. Wie hängen diese mit der ersten Art zusammen ? Das kann uns keine noch so schöne Theorie sagen, sondern wir müssen den Naturzustand durch das reine Denken rekonstruieren.
Der Anfang ist wie bei Vico [1] die „stumpfsinnige, blöde und schreckliche Bestie“ das menschliche Tier, durch harte Auslese zu einem Wunder an Kraft und Geschicklichkeit emporgezüchtet, also „Tarzan of the Apes“, um modern zu sprechen[2]. Es ist seiner Umgebung vollkommen angepaßt, Krankheiten befallen es nicht, die gibt es erst in der Gesellschaft: die Zivilisation und vor allem das Denken, dieser „état contre la nature“, der aus dem Menschen ein „animal dépravé“ macht, tragen die Schuld. Nur domestizierte Tiere und Menschen erkranken. Der Tiermensch aber ist eine vollkommene Maschine, den Tieren trotz seiner geringeren natürlichen Ausstattung überlegen, weil er ein „libre agent“ ist, der nicht, wie das Tier, aus purem Instinkt, sondern durch einen Akt der Freiheit handelt. Mit dieser Eigenschaft
[1] Neue Wissenschaft, S. 151.
[2] Eine von Edgar Rice Burroughs erfundene, heute überaus populäre Romangestalt: eine jämmerlich schlechte Nachahmung des Mowgli aus Kiplings „Djungle Books“, hineingestellt in ebenso jämmerliche Kopien von Rider Haggards phantastischen Abenteurer-Romanen. Ein britischer Karl May, ebenso roh, ebenso erfindungsarm, ebenso illiterat! Es ist soziologisch sehr interessant, daß derartige Produktionen heute den Büchermarkt geradezu beherrschen können.
[78]
ist ihm die „Perfektibilität“ gegeben; wachsende Bedürfnisse können ihn über die Tierheit heben, können seine Vernunft wecken.
Aber : woher sollen ihm neue Bedürfnisse kommen ? Das setzt ja die Kultur schon voraus; und der Urmensch lebt völlig isoliert, ohne Sprache; es gibt nicht einmal das, was wir heute die Kleinfamilie nennen; die Beziehungen zwischen den Geschlechtern beschränken sich auf den gelegentlichen, sozial folgelosen Akt der Paarung, und selbst die Kinder verlassen die Mutter, sobald sie selbständiger Ernährung fähig sind. Die Konstruktion ist epikuraeisch. Sie findet sich ausführlich bei Lucretius [1], von dem sie auch Vico erhalten haben wird. (Hier beruft sich Rousseau ausgesucht auf Affen und Wölfe, zwei fast immer in Rudeln und Herden lebende hochgesellschaftliche Arten.)
In diesem Zustande gibt es weder Gut noch Böse, weder Laster noch Tugenden. Jedenfalls ähnelt er durchaus nicht dem von Hobbes angenommenen Naturzustande des Kampfes Aller gegen Alle. Erstens gibt es nur wenig Gründe zum Konflikt, da die Hab- und Ehrsucht noch nicht wirken, und die Nahrungsquellen für alle reichlich sprudeln[2], und von den heftigen Leidenschaften, die sich beim Zivilisierten mit der Liebe verbinden, noch keine Rede ist; andererseits mildert das „Mitleid“ etwaige Konflikte, jener Urtrieb, aus dem alle sozialen Tugenden stammen; sie steht im Urzustände an des Gesetzes Stelle.
In diesem Zustande kann die natürliche Ungleichheit offenbar keine Folgen haben. Unterdrückung des Schwächeren durch einen Stärkeren kann es nicht geben, nur allenfalls Raub und Gewalttat: der Unterwerfung aber kann man sich immer leicht durch die Flucht entziehen[3]. Nur wo Besitz ist, kann Abhängigkeit sein.
Wie kann sich von diesem Ausgangspunkt aus die heutige Gesellschaftsordnung entwickelt haben?
Rousseau nimmt die Antwort vorweg mit dem viel zitierten Satze: „Der erste, der ein Grundstück eingezäunt hatte und es sich einfallen ließ, zu sagen : Das ist mein, undDummköpfe fand, die es ihm glaubten, war der wahre Gründer der bürgerlichen Gesellschaft“.
Wie kam es dazu? Die Dichtigkeit der Bevölkerung wächst, die Nahrung muß mit mehr Arbeit beschafft werden, aus dem Sammler wird der Fischer und Jäger, der zugleich Krieger ist. Mit der größeren Erfahrung entstehen Begriffe, das Feuer wird gezähmt, die Überlegenheit über die wilden Tiere wächst, der Mensch wird, um mit Kipling zu sprechen, der „Meister des Dschungel“. Das weckt ihm die alles beherrschende Leidenschaft, den Stolz. Gleichzeitig erkennt er
[1] Oncken, a. a. O. S. 52/3, Hasbach, a. a. O. S. 10.
[2] Das ist Lockes Lehre.
[3] Auch das ist Locke (§ 115).
[79]
in den anderen isolierten Menschen, denen er gelegentlich begegnet, seines Gleichen — es kommt zu Konflikten, aber auch zur Kooperation. So gewöhnt man sich an eine zunächst zu nichts verpflichtende gegenseitige Hilfe und verwächst zu einer lockeren Genossenschaft rein faktischen Gepräges. Dazu gehört nicht mehr an Sprache, als der Affe und die Krähe haben. (Auch die Krähe ist ein eminent soziales Tier!)
Von hier aus kommt es, zuerst unendlich langsam, zu Fortschritten, die dann immer schneller einander folgen. Die erste „Industrie“ entsteht; die Steinaxt wird zum Werkzeug, sie baut die erste Hütte: und damit ist der Keim der dauernden Familiengemeinschaft und des Eigentums gegeben. Die bisher undifferenzierten Geschlechter teilen sich in die Arbeit : das Haus der Frau, die Jagd dem Manne. Verweichlichung setzt ein, die als Notdurft erscheinen läßt, was früher reiner Luxus war: das Haus, die gekochte Nahrung. Jetzt entfaltet sich die Sprache, in der relativen Seßhaftigkeit bilden sich Nationen von gleicher Sitte und Art, und jetzt erst entsteht, befördert durch die Geschlechtsliebe, die Soziabilität. Tanz und Gesang vereinen, der Ehrgeiz erwacht, Eitelkeit und Stolz, Scham und Neid werden mächtig. Jetzt erst wird der Mensch empfindlich und in der Verteidigung seiner Ehre und der Rache wild und blutdürstig, so wie wir jetzt die meisten Wildvölker finden. Es war eine notwendige und heilsame Veränderung, so unschön sie ausschaut. „Diese Periode der Entwicklung der menschlichen Fähigkeiten, die zwischen der Indolenz des Naturzustandes und der stachelnden Aktivität unserer modernen Selbstliebe die rechte Mitte hielt, mußte die glücklichste und dauerhafteste Epoche sein“ (73), die „wahre Jugend der Welt“, und jeder Schritt seither war nicht ein Fort-, sondern ein Rückschritt.
Denn jetzt entfaltet sich die Arbeitsteilung [1], die Kapitalbildung
[1] Diesen Zug hat er vielleicht von Hutcheson: „In dem Naturzustande, den er darstellt, finden wir die durch Arbeitsteilung verbundene, in Familien geschiedene natürliche Gesellschaft“ (Hasbach, a. a. O. S. 57). Über Hutchesons Abhängigkeit von Pufendorf ib. S. 46. „Die Schifflein schießen herüber, hinüber.“
Es könnte auch sein, daß Rousseau diesen Zug aus Spinoza übernommen hat, der mehrfach die Vorteile der Kooperation darstellt, und zwar nicht bloß wie Aristoteles in bezug auf die Verbesserung, sondern sehr deutlich schon in bezug auf die Vermehrung des gesellschaftlichen Produkts. Diese Quelle der berühmten Lehre ist uns in der Geschichte der Ökonomik niemals begegnet. (Ethik, S. 176, 209, vor allem aber Theol. pol. Tr. S. 213): „Kräfte und Zeit würden einem jeden fehlen, wenn er allein pflügen, säen, ernten, mahlen, kochen, weben, nähen und noch sehr viele andere zur Erhaltung des Lebens nötige Dinge verrichten müßte; um noch ganz von den Künsten und Wissenschaften zu schweigen ... Denn wir sehen, daß diejenigen, welche wild ohne Staatsverband leben, ein elendes und beinahe viehisches Leben führen“. Lord, a. a. O. S. 130, meint allerdings, Rousseau sei gestorben, bevor das Interesse an Spinozas Werken neu erweckt wurde. Bluntschli, a. a. O. S. 252, deutet an, daß Rousseau von Christian Wolff angeregt sein könnte.
[80]
(„sobald man bemerkte, daß es nützlich sei, wenn Einer für Zwei Vorräte besaß“), Metallbearbeitung und Ackerbau entstehen, — und mit ihnen das Eigentum und — die Sklaverei. Nicht Silber und Gold, sondern Eisen und Korn haben den Menschen zivilisiert und die Menschheit verderbt, und zwar muß beides zusammen gegeben sein: das hat Europa den Vorsprung gegeben.
Der Ackerbau bringt die Verteilung des Bodens mit sich; da das auf Arbeit beruhende Eigentum des Schutzes bedarf, werden die Gesetze, das positive Recht nötig. So ward Ceres, wie Grotius erinnert, die Gesetzgeberin [1], die Geberin eines vom natürlichen Rechte verschiedenen Gesetzes.
„Jetzt hätte der Besitz gleich bleiben können, wenn die Gaben (talents) gleich geblieben wäre; ... aber das durch nichts gestützte Gleichgewicht ging bald verloren; der Stärkere leistete mehr Arbeit, der Geschicktere wußte die seine besser auszunützen, der Erfindungsreichere fand Mittel, um die Arbeit abzukürzen; bald brauchte der Schmied das Korn, bald der Bauer das Eisen dringlicher, und so gewann der eine, bei gleicher Arbeit, viel, während der andere kaum seinen Lebensunterhalt erwarb[2]. So entfaltet sich die natürliche Ungleichheit unmerklich mit der Kooperation in dem Maße, wie die Verschiedenheiten der Menschen, durch die Umstände entwickelt, sich mehr und mehr bemerklich machen, wie sie in ihren Auswirkungen immer dauerhafter werden und das Schicksal der Einzelnen in gleichem Maße zu bestimmen beginnen“ (76).
Von hier aus ist alles weitere ohne Schwierigkeit abzuleiten. Das Sein und der Schein trennen sich, List und Sünde sind die Folge. Der Besitz besteht hauptsächlich aus Land und Vieh. „Wenn nun die Hufen (héritages) an Zahl und Größe so gewachsen sind, daß sie, indem sie sich sämtlich berühren, den ganzen Boden bedecken, kann man sich nur noch auf Kosten der Anderen vergrößern; und die Überzähligen, die aus Schwäche oder Trägheit nichts angeeignet hatten, jetzt arm geworden, ohne doch eigentlich etwa verloren zu haben, weil sie allein in dem Wandel aller Dinge sich nicht gewandelt hatten, sahen sich nun gezwungen, ihren Unterhalt von den Reichen zu empfangen
[1] Wir haben in Schillers „Eleusisches Fest“ den ganzen Rousseau, aber ins Optimistische gewandelt. „Scheu in des Gebirges Klüften barg der Troglodyte sich, der Nomade ließ die Triften wüste liegen, wo er strich“. Aber Ceres „hat uns die süße Heimat gegeben, hat den Menschen zum Menschen gesellt“.
[2] Wir möchten fast annehmen, daß die unglaublich verfehlte Ableitung des Kapitalprofits durch Ricardo, die wir S. S. I, S. 989/90 und III, S. 571 dargestellt haben, mittelbar oder unmittelbar hierher stammt. Vgl. dazu Contrat social, II, 11: „Gerade aus dem Grunde, weil alle Kräfte immer dahin drängen, die Gleichheit zu zerstören, muß die Kraft der Gesetzgebung immer dahin drängen, sie aufrecht zu erhalten“ : das Stichwort alles ökonomischen Interventionismus.
[81]
oder zu rauben. So entstand, je nach dem Charakter der Beteiligten, auf der einen Seite Herrschaft und Knechtschaft, auf der anderen Gewalttat und Raub“ (77).
Die Reichen bedienen sich jetzt ihrer Sklavenscharen, um immer mehr Land und Sklaven zu erobern : furchtbare Unordnung, ein immerwährender Kriegszustand stellt sich ein. Ihn zu beenden, haben die Reichen ein größeres Interesse als die Armen, die nichts zu verlieren haben, während die Reichen sich darüber klar sein müssen, daß ihr durch Gewalt erworbener Besitz keinen eigentlichen Rechtstitel darstellt und durch andere Gewalt ihnen jederzeit wieder entrissen werden kann. „Und so entwarf der Reiche endlich den schlauesten Plan, den jemals ein menschliches Gehirn ausgeheckt hat: die ihn bedrohenden Kräfte in seinen Dienst zu ziehen, aus seinen Gegnern seine Verteidiger zu machen, ihnen andere Grundsätze einzuprägen und andere Institutionen zu schaffen, die ihm ebenso günstig, wie das Naturrecht jetzt ungünstig, wären“ (79). „Vereinen wir uns, sagen sie ihren Nachbarn, um die Schwachen vor Unterdrückung zu schützen, die Ehrgeizigen im Zaum zu halten, und jedem seinen Besitz zu sichern; wir wollen eine Ordnung (des règles) der Gerechtigkeit und des Friedens einführen, denen alle zu gehorchen verpflichtet sind“ (79).
Auf diesen Vorschlag ging alles ein: die große Masse, weil sie wohl die Vorteile, aber nicht die verborgenen Nachteile einer solchen Ordnung erkannte ; und sogar die Weisen konnten nicht widersprechen ; sie gaben seufzend einen Teil ihrer Freiheit auf, um den anderen zu bewahren, wie man sich wohl einen Arm amputieren läßt, um das Leben zu retten.
Das war oder muß gewesen sein der Ursprung der Gesellschaft und des positiven Rechts (des lois), die beide dem Schwachen neue Fesseln auferlegten und dem Reichen neue Kräfte gaben, die natürliche Freiheit auf immer zerstörten, auf immer das Gesetz des Eigentums und der Ungleichheit errichteten, aus einer geschickten Usurpation ein unwiderrufliches Recht machten, und für alle Zukunft das ganze Menschengeschlecht im Dienste von ein paar Ehrgeizlingen der Arbeit, der Knechtschaft und dem Elend auslieferten“ (79/80).
Die Begründung der ersten Gesellschaft zieht notwendig, durch den Zwang des politischen Gleichgewichts, andere nach sich; überall ist das Naturrecht tot, das bürgerliche Recht hat seinen Thron bestiegen; nur zwischen den Gesellschaften besteht noch der alte Naturzustand, gemildert durch das sog. Völkerrecht. Das einst so mächtige Mitleiden lebt nur noch in einigen großen Seelen, die „über die imaginären Grenzen der Völker fort, nach dem Beispiel ihres Schöpfers das ganze Menschengeschlecht mit ihrem Wohlwollen umfassen“ (80).
Zwischen den so entstandenen „politischen Körpern“ brechen Kriege über Kriege aus, der Blutdurst wird zur Bürgertugend.
[82]
So also entstand der „politische Körper“; noch meidet Rousseau das Wort „Staat“, weil er es für die nächste Stufe aufheben muß. Jede andere Ableitung lehnt er ab. Davon interessiert uns am meisten die Ableitung des Staates aus der Eroberung, die „soziologische Staatsidee“.
Die von ihm dagegen geltend gemachten Gründe sind die folgenden : „Da das „Recht“ der Eroberung kein Recht ist, so kann es auch kein Recht begründen; der Eroberer und die Unterworfenen werden daher immer im Kriegszustande bleiben, es sei denn, daß die in ihre Freiheit wiedereingesetzte Nation ihren Besieger freiwillig zu ihrem Oberhaupte ernennt ; bis dahin kann es weder eine wirkliche Gesellschaft noch einen politischen Körper, noch ein anderes Recht als das des Stärkeren geben, da auch etwa abgeschlossene „Kapitulationen“ (der Ausdruck „Vertrag“ wird sorgfältig vermieden) nur auf Gewalt begründet und dadurch ohne weiteres null und nichtig sind“ (81). Wir werden diese Auffassung in der Kritik sehr genau zu untersuchen haben. Auch sie stammt von Locke (Kap. XVI. On conquest, § 176, namentlich 184).
Der politische Zustand (état politique) war sehr unvollkommen, da weder die Erfahrung noch die Philosophie daran mitgewirkt hatten. „Die Gesellschaft bestand zuerst nur aus einigen allgemeinen Conven- tionen, die alle Individuen einzuhalten sich verpflichteten, und für die die Allgemeinheit die Gewähr übernahm. Das reichte bei weitem nicht hin; Miß brauche häuften sich, der Arm des Gesetzes war zu schwach, und so mußte man sich entschließen, „Einzelnen das gefährliche Gut der öffentlichen Autorität anzuvertrauen“; man stellte Beamte an; denn es ist eine keiner Widerlegung würdige Ansicht, daß ohne vorhergegangenen Einigungsvertrag ein Unterwerfungsvertrag möglich wäre.
Selbstverständlich waren die Beamten zuerst nur die Schützer der Freiheit. Der Gedanke eines Grotius und Hobbes, daß freiheitsliebende Menschen sich sofort unwiderruflich in die absolute Gewalt eines Herrschers gegeben haben sollten; ist abwegig [1]. Ebensowenig kann die Herrschaft aus dem Patriarchat stammen : dessen Herrschaft ist viel zu sanft. Gegen Pufendorf wird bemerkt, daß es unveräußerliche Menschenrechte gibt : sollte man selbst für die eigene Person auf Freiheit und Leben verzichten dürfen, so ist es doch undenkbar, daß man einen solchen Verzicht auch für alle Nachgeborenen sollte rechtskräftig und für alle Zeit bindend aussprechen können.
Der Grundvertrag jeder Regierung kann also nur ein wahrer Ver-
[1] „This is to think, that men are so foolish, that they take care to avoid what mischiefs may be done them by polecats and foxes; but are content, nay think it safety to be devoured by lions“ (Locke, § 93) „No rational creature can be supposed to change his condition with an intention to be worse“ (§ 131). Vgl. auch § 163.
[83]
trag zwischen dem Volke und den von ihm gewählten Oberen sein. „Da das Volk, soweit die gesellschaftlichen Beziehungen in Frage kamen, seine sämtlichen Willen in einen Willen vereint hat, so werden alle Artikel, über die dieser Wille sich ausläßt, ebenso viele Grundgesetze, die alle Mitglieder des jetzt erst vollendeten Staates (de l'Etat [1], hier findet sich der Ausdruck zum ersten Male) ohne Ausnahme verpflichten. Jeder Bruch hebt das Amt und sein Recht auf.
Zuerst entscheiden, wo nicht schon der Reichtum sich durchsetzt, das Alter und das Verdienst. Da aber die Wahl der alten Leute sehr häufige Neuwahlen bedang, bildete sich die Erblichkeit der Ämter heraus; das Amt wird Besitz, der „Staat“ wird zum Privateigentum.
Derart ist die Ungleichheit in drei Stufen entstanden: die erste ist die Einrichtung des Gesetzes und des Eigentumsrechtes, die zweite die der Beamtenschaft, die dritte die Verwandlung der gesetzlichen in willkürliche Gewalt. Die erste schuf den Gegensatz von Reich und Arm, die zweite den von Mächtig und Schwach, die dritte den von Herrn und Sklaven. Diese Entwicklung ist eine bittere Notwendigkeit: wären die Menschen ohne Laster, so brauchte man keinen Staat.
Jetzt entstehen neue Ungleichheiten aus der politischen Kräfteverteilung. Der Herrscher schafft sich Kreaturen, die er mit Rang und Reichtum ausstattet. (Hier bricht das Ressentiment des armseligen Intelligenz-Proletariers gegen den Adel und die „leisure class“ seiner Zeit, die vielleicht noch niederträchtiger war als die unsere, mit aller Kraft hervor[2].) Zuletzt wird zur einzigen Ursache der Ungleichheit, deren erste Wurzel die Begabung war (les qualités personelles), der Reichtum, und das ist das Ende vom Ende, Die Ungleichheit ersteigt ihren höchsten Grad in der Tyrannei; der Kreis ist geschlossen, wieder sind Alle gleich, der Naturzustand ist wiedergekehrt, aber nicht mehr im Stande der Unschuld, sondern der Verderbnis.
Nachdem er den „Kanadier, der Europens übertünchte Höflichkeit nicht kannte“, wie sein Schüler Seume später dichtete[3], dem verweichlichten und verderbten Menschen von heute gegenübergestellt hat, schließt er: „Es folgt daraus, daß die moralische Ungleichheit, die einzig und allein in dem positiven Gesetze begründet ist, immer dann dem Naturrecht zuwiderläuft, wenn sie nicht in gleichem Verhältnis
[1] Man beachte, hier spricht Rousseau nicht wie im „Contrat social“ als Philosoph, sondern als „Historiker“. Und hier meint er den vollendeten historischen Staat, die civitas diaboli.
[2] Vgl. Contrat social III 6, III 8, III 9.
[3] Mercier de la Rivière hat ihn auch schon; vgl. ed. Daire II, S. 526. Alle Zeiten des Verfalls haben solche Ideale in den Naturvölkern gefunden. Hellas in den Persern der Kyroupaedie und den edlen Skythen des Ephoros (v. Poehlmann I S. H3ff.), Rom in Tacitus' Germanen.
[84]
der persönlichen Ungleichheit entspricht; eine Unterscheidung, die zur Genüge die Art der Ungleichheit beleuchtet, die wir überall bei den zivilisierten Völkern finden: daß ein Kind einem Greise befiehlt, ein Dummkopf über Weise herrscht, und eine Handvoll Menschen im Luxus erstickt, während die hungernde Menge der Notdurft ermangelt.“
---
Wir haben hier, was die ökonomische Deduktion anlangt, das volle Credo des aufklärerisch-bürgerlichen Gesetzes der ursprünglichen Akkumulation: den Ausgang vom isolierten Individuum, die Gleichheit bis zu dem kritischen Punkte, wo die wachsende Dichtigkeit der Bevölkerung Arbeitsteilung und Eigentum, namentlich Grundeigentum erzwingt; die Bildung von „Kapital“, die Verschiedenheit der wirtschaftlichen Begabung mit ihren differenzierenden Folgen, den Fluch des Handels (Tausches), die Vollbesetzung des Bodens, die nirgends so klar und logisch wie hier geschildert ist als der Augenblick, wo „die Hufen, sich berührend, das ganze Land bedeckten“, also ausgesprochen die „ökonomische“ Besetzung durch Bauern, nicht etwa die „politische“ durch Usurpatoren [1], ganz wie bei Hobbes und Locke.
Nur der Wertakzent ist ein völlig entgegengesetzter. Rousseau kann zwar von den Voraussetzungen des Naturrechts, auch von den ökonomischen, noch nicht los: aber er ist nicht im mindesten geneigt, die faktischen Vorrechte der Bourgeoisie gleich ihr als das Ergebnis von lauter lauterer Tugend zu preisen; nur der erste Keim der Ungleichheit stammt aus den Unterschieden des „Talents“: aber diese „natürliche“ Ungleichheit hat ihre Schichten bildende Rolle längst ausgespielt und ist heute ganz und gar ersetzt durch die „moralische“ oder „politische“ Ungleichheit, die durchaus nicht aus Tugenden, sondern dem genauen Gegenteil erwachsen ist.
Es kommt also auch diese kleinbürgerliche Variante des Gesetzes der ursprünglichen Akkumulation auf die gleichen Vorstellungen, denen unsere Kritik gewidmet sein wird: aus einem Anfangszustande der Gleichheit und Freiheit hat sich, rein durch innere Kräfte ohne Einwirkung äußerer Gewalt, die Klassenscheidung mit allen ihren Folgen entwickelt.
Wir haben hiermit das eine Wurzelgeflecht des bürgerlichen Grundaxioms, das naturrechtliche, vollkommen aufgedeckt. Der gesamte Inhalt des „Gesetzes der ursprünglichen Akkumulation“ ist ausgebildet: der Ausgangspunkt von einer Gesellschaft der Freien und Gleichen, der Urkommunismus, der bei einer gewissen Höhe der Kultur und einer gewissen Dichte der Bevölkerung nicht mehr zu halten ist und durch das Privateigentum ersetzt werden muß, und die Differenzierung der
[1] S. S. I, S. 999.
[85]
Klassen aus diesem Anfangszustande durch rein wirtschaftliche Kräfte; Handel, Konkurrenz, verschiedene wirtschaftliche Begabung, ohne Eingriff irgend einer äußeren nicht-wirtschaftlichen Macht.
Damit ist aber unsere Aufgabe noch nicht gelöst. Es muß noch gezeigt werden, wie es kam, daß auch die Gegner der „Aufklärung“, die Träger der „geistigen Gegenrevolution“, wie wir sie nennen [1], zu dem gleichen Axiom gelangten.
Bevor wir diesen zweiten Teil unserer geistesgeschichtlichen Analyse in Angriff nehmen, sei es uns jedoch gestattet, zusammenfassend diese naturrechtliche Abart der „Kinderfibel“ zu charakterisieren:
Sie ist, um es zu wiederholen, entsprungen aus zwei einander schnurstracks widersprechenden antiken Philosophemen, die noch dazu beide dogmatisch-metaphysisch begründet waren, die man notdürftig mit eingestandenen oder verhohlenen theologischen Mitteln zusammengeleimt hatte, ergänzt durch einige Rechtssätze, die, milde gesagt, hier keine unbestrittene Geltung hatten; — dann, fügen wir jetzt hinzu, aus einer schematisch-juristischen, ausgesprochen nichthistorischen Konstruktion oder Rechtsfiktion umgebogen in die Behauptung einer historischen Wirklichkeit oder sogar „Wahrheit“ im Sinne Lacombes.
Betrachten wir jetzt, ob die Gegnerin die gleiche Grundthese besser zu begründen gewußt hat.
B. Diegeistige Gegenrevolution.
Die Gegner der Aufklärung, eine bunt zusammengesetzte Masse der verschiedensten geistigen Richtungen: Altgläubige, Junker, Schwärmer für das kunstgewerbliche Mittelalter, durch die Revolution erschreckte Ideologen, auch Männer von echt historischem Blick wie Justus Moser, usw. waren in nichts anderem einig als in der Ablehnung der aufklärerischen Philosophie und Politik. Was man ihr zum schwersten Vorwurf machte — mit Recht — war die (theoretische wie praktische[2]) „Atomisierung der Menschen“, in der Staatsgesellschaft nur einen Haufen atomer Individuen zu sehen, die erst durch die Staatsverfassung
[1] S. S. 1, S. 4.
[2] Die französische Konstitution verbot bekanntlich jegliche Koalition der Arbeiter als „ein Verbrechen gegen die Menschenrechte“. Sieyès orakelte: „Die gesellschaftliche Ordnung verlangt schlechterdings, daß keine Innungen, Genossenschaften, Körperschaften irgendeiner Art sich bilden und politisch wirksam werden. Denn sie würden ihr Interesse geltend machen wollen; wo alle einzeln, isoliert stehen, wird dagegen der Wunsch der Mehrheit immer dem allgemeinen Besten angemessen sein“ (Zit. nach Raumer, Geschichtl. Entw. d. Begr. Recht, Staat, Politik, S. 116). Hier spricht klar Rousseau, dessen „volonté générale“ bekanntlich allwissend und allgütig ist. Vgl. Schmitt-Dorotic, Die Diktatur S. 120.
[86]
in Zusammenhang kommen sollten [1]... Das war eben der ungeheure Irrtum des fälschlich sogenannten Naturrechts, daß man den wirklichen Menschen in das Abstraktum eines reinen Rechtsubjektes verwandelte (S. 8)... Kein Vaterland, keine Nation, keine Religion, sondern nur ein Haufe von Staatsbürgern, durch eine vertragsmäßige Zwangsgewalt zusammengehalten, so war der reine Rechtsstaat... Und solche Lehre, die den Staat naturlos machte, hieß noch obenein Naturrecht, gerade wie lucus a non lucendo“ (S. 99).
Ganz besonders war selbstverständlich für jeden halbwegs geschichtlich denkenden Menschen der „Naturzustand“ das Stichblatt der Angriffe. Wir bringen einige erheiternde Proben: „Den Naturzustand malt Rousseau so ins Schöne wie Hobbes ins Häßliche, was freilich bei dieser Erfindung gleich erlaubt ist. Aber trotz dieser Verklärung erscheint sein, von allem Positiven entkleideter Naturmensch noch kahler und jämmerlicher als des Diogenes gerupfter Hahn, und obgleich in ihm (laut des Emil) gar keine Wurzel des Bösen ist, geht es ihm doch so schlecht und ungerecht, daß er in den Jammer des bürgerlichen Lebens eintreten muß“[2]. Derselbe geistreiche Autor sagt von Hobbes: „Sein Naturzustand läßt sich weder geschichtlich, noch philosophisch, noch religiös erweisen, er ist bestialisch und des Teufels“ (S. 42). Und Arthur Schopenhauer schreibt grimmig: „Und nun bitte ich den Leser zu bedenken, daß die Maxime der Ungerechtigkeit, das Herrschen der Gewalt anstatt des Rechts, welches demnach als Naturgesetz auch nur zu denken unmöglich sein soll, eigentlich das wirklich und faktisch in der Natur herrschende Gesetz ist nicht etwa nur in der Tierwelt, sondern auch in der Menschenwelt“[3].
Um auch noch einen sozialistischen Romantiker anzuführen, so schreibt Marx: „Den Propheten des 18. Jahrhunderts ... schwebt dieses Individuum des 18. Jahrhunderts — das Produkt einerseits der Auflösung der feudalen Gesellschaftsformen, andererseits der seit dem 16. Jahrhundert neu entwickelten Produktionskräfte —, als Ideal vor, dessen Existenz eine vergangene sei. Nicht als ein historisches Resultat, sondern als Ausgangspunkt der Geschichte“[4].
[1] Frantz, Naturlehre des Staates, S. 160.
[2] Raumer, a. a. O. S. 103/4. Schelling (Vorles. üb. d. Meth., S. 234) sagt von den Kantischen Juristen, die „diese Philosophie als Magd ihrer Szienz zu brauchen fleißig angefangen, und zu diesem Behuf auch richtig immer das Naturrecht reformiert. Diese Art des Philosophierens äußert sich als ein Schnappen nach Begriffen ...“.
[3] Grundlage der Moral, S. 540. Vgl. Ferner Treitschke, Politik, I, S. 4. Bonald, die Urgesetzgebung, S. 106. Hasbach, a. a. O S. 31, der dem Liberalismus vorwirft, die „doktrinäre, unhistorische Grundlage des stoischen Naturrechts in die Köpfe ... der großen Masse“ eingeprägt und zur Klassentheorie gewandelt zu haben.
[4] Zur Kritik der politischen Ökonomie, S. XIII/XIV. Vgl. dazu Jellinek, a. a. O. S. 89.
[87]
Aus dieser Negation ergibt sich ohne weiteres der positive Inhalt der sämtlichen gegenrevolutionären Theoreme: den Anfangszustand bildet nicht der isolierte, verabsolutierte Mensch, den es selbstverständlich nicht gibt und nicht geben kann [1]; und daher ist der Staat nicht durch einen Vertrag solcher „Atome“ entstanden, sondern er stammt von einer gewachsenen, nicht von einer gemachten Verbindung ab, ist von vornherein, um mit Toennies[2] zu sprechen, Gemeinschaft und nicht Gesellschaft, entstammt nicht dem „Kürwillen“, sondern dem „Wesenwillen“; oder, um mit Schelling zu sprechen, dessen Auffassung der von Toennies aufs nächste verwandt ist: nicht das Individuum ist der Ausgangspunkt, sondern die Gemeinschaft, (Familie, Gesellschaft, Volk und Staat), deren Wille, das „Absolute“, nicht aus der Freiheit, sondern aus der Notwendigkeit entspringt[3].
Die gegebene theoretische Autorität für diese Auffassung war der Gegner der antiken Aufklärung, Aristoteles.
a) Die legitimistische Staatsidee. (Die „Familie“.)
Aristoteles ist der große Vertreter des „Universalismus“, der logisch wie entwicklungsgeschichtlich unzweifelhaft richtigen Anschauung[4], daß, wie überhaupt das Ganze vor den Teilen ist, so auch die Gemeinschaft vor dem Einzelnen besteht. Leider weiß er so wenig wie seine ganze Zeit zwischen Staat und Gesellschaft oder Gemeinschaft zu unterscheiden und kommt so zu dem gefährlichen Satze : „Von Natur aber früher ist der Staat als die Familie und jeder Einzelne von uns“. Der Satz ist logisch sicherlich, und entwicklungsgeschichtlich vielleicht richtig, wenn man unter dem Begriffe „Staat“ hier die menschliche Gemeinschaft versteht: denn nur in der und durch die Gemeinschaft wird der Anthropoide zum homo sapiens; und es ist wohl möglich, daß die besondere Entwicklung des Menschen eher mit der Horde als mit der „Ehefamilie“ im Sinne Westermarcks begonnen hat — wenn wir auch, noch weiter zurückblickend, annehmen müssen, daß die Horde ihrerseits aus der Ehefamilie entstanden ist[5]. Aber der Satz wird geradezu falsch, wenn man unter „Staat“ den historischen Klassenstaat versteht.
Um das vorläufig beiseite zu lassen, so ist also die weit verbreitete
[1] S. S. I, s. 83ff.
[2] S. S. I, S. 340ff.
[3] Neue Deduktion des Naturrechts, (1800) zit. nach Gumplowicz, Gesch. d. Staatsth. 290.
[4] S. S. I, S. 15/6, S. 31/2, S. 940.
[5] S. S. I, S. 1063.
[88]
Ansicht irrig, daß Aristoteles den „Staat“ aus der Familie entstehen läßt. Er ist ihm vielmehr ein „Gebilde der Natur“, und zwar, weil es in der „Natur“ des Menschen, als eines „gesellschaftlichen Tieres“ (ζώον πολιτικον) liegt, in Gesellschaft zu leben.
Wohl aber läßt er den Staat sich von der „Familie“ aus entwickeln; sie ist der Urbestandteil, aus dessen allmählicher Ausdehnung und Auszweigung der Staat entstanden ist. Das aber ist etwas ganz anderes als die neuere Lehre, die sich auf Aristoteles berufen zu können glaubt: denn er hat einen ganz anderen als den modernen, er hat noch den antiken Begriff von der Familie.
„Familia“ bedeutet im Lateinischen zuerst die Sklavenschaft [1], denn famulus ist der unfreie Diener. Erst allmählich, mit der unserem Rechtsgefühl fast unbegreiflichen Ausweitung und Erhöhung der patriarchalischen Gewalt über die Frau und die Kinder, werden auch diese als die „liberi“ (famuli) in den Begriff hineingezogen. Uns aber ist seit dem Verschwinden der Sklaverei und der daraus folgenden Milderung der patriarchalischen Gewalt der erste und ursprüngliche Bestandteil ganz aus dem Begriff verschwunden, und es sind nur noch die Frau und die Kinder darin verblieben.
Bei Aristoteles hat der Begriff aber noch seinen vollen antiken Inhalt. Sein Ausgangspunkt ist nicht, wie bei den meisten seiner vermeintlichen neueren Anhänger, die Gleichheit, sondern die Ungleichheit der Menschen an Begabung und daher an Recht und Rechten. Freilich ist es nicht die Ungleichheit der Begabung, die zwischen den Gliedern desselben Volkes besteht, von der er ausgeht, wie der Pseudo- liberalismus der Gegenwart, sondern die Ungleichheit der angeborenen Rasse. Wie jedes junge Volk hält sich auch das Hellenentum jener Zeit für „auserwählt“, allen anderen weit überlegen, und von der Natur selbst zu Herren der „Barbaroi“, der Menschen mit der unverständlichen Sprache bestimmt. Dieser Suggestion seines Zeit- und Gruppengeistes kann sich auch ein Denker solchen Ranges nicht entziehen; es ist seine persönliche Gleichung: und so erscheinen ihm die Barbaren als „Sklaven von Natur wegen“, und das heißt auch hier: aus natürlichem Recht! Er steht hier, seine Auffassung von der Rassensverschiedenheit einmal zugegeben, auf dem Rechtsstandpunkt seines Meisters Platon: „Gleichheit ist es, den Ungleichen Ungleiches zuzumessen, den Besseren Besseres, den Geringeren Geringeres; diese Gleichheit ist von allen denkbaren die abgestufteste und beste“[2]. Und dieser Satz ist in der
[1] Grotius, a. a. O. S. 83 (Lib. I, Kap. III, § 7, 2: „Quomodo sunt servi membra familiae“. Er läßt denn auch den Staat nicht aus Einzelnen, sondern stoisch aus „familiae segreges“ entstehen, „adversus violentiam“ (a. a. O. S. 140, Lib. I, Kap. IV, § 7, 4).
[2] Prodi Philosoph! Platonis Opera, ed. Cousin, Paris 1820, Tom. II, S. 6/7:(In Platonis Alcibiadem primum) : „') τοίς άνισοι? τα ävwa διανέμονσα Ιαότης, xaì rois μεν μείζονσιν τα μείζω, τοϊς δε έλάττονοι τα ελάττα, παθών δε μονσιχωτάτη και αρίστη.'* Vgl. Nomoi, 757 A: i»TO*s ΐ^ρ άνΐυοις τα Ισα άνισα γιγνοΐντ αν, εΐ μή τνγχάνον δε μ,έτρον“. Und G or già s: „Ή ίσότης ή γεωμετρική χαϊ εν &εοΐί χα'ι εν άν&ρώποιε μέγα δνναταί“.
Aristoteles unterscheidet die „arithmetische“ und die „geometrische“ Gerechtigkeit, jene ist die einfach proportionelle, diese aber die im mathematischen Sinne proportionale Verteilung. Grotius, a. a. O. S. 7 (I, Kap. I, § 8, 2) vgl. auch Hobbes, Leviathan, Kap. 15 (a. a. O. S. 75).
[89]
Tat, an sich genommen, der Ausdruck des Rechtsgesetzes, denn: „Gerechtigkeit bedeutet nichts anderes als die persönliche Gleichheit, d. h. die Ausschließung jedes durch die numerische Bestimmtheit der einzelnen Person bedingten Vorzugs... Hiermit ist keineswegs jede Bevorzugung einer Person ausgeschlossen, sondern nur jede nicht durch einen qualitativen Unterschied der Lage des einen und anderen bedingte Bevorzugung“ [1]. Zur Lage gehört aber auch die „individuelle Eigenart der Personen“[2]. Wenn man also ganze Rassen, ja, alle mit Ausnahme des eigenen Volkes, als Wesen geringerer Art betrachtet, so folgt, daß sie auch geringeres Recht haben müssen. Nur eben, daß wir dem Aristoteles diese, noch ganz dem „engen Räume“ entstammende „ethno- zentrische“ Auffassung nicht zugeben können; selbst unsere größten Rassenfanatiker von heute würden hier mit uns gehen, denn der Stagirit hat ja auch unzweifelhaft „arische“ Völker, sogar die den Hellenen aufs nächste stammverwandten Thraker[3] usw., als „Sklaven von Natur“ bezeichnet. Diese Köpfe müssen den Begriff der „Rasse“ auf das lächerlichste ausweiten und verbiegen, indem sie ihn mit Sprachgemeinschaften verwirren[4], um Schlüsse ziehen zu können, die ihrer persönlichen Gleichung genügen[5].
Um nun zu Aristoteles' Auffassung zurückzukehren, so besteht ihm zufolge jede Familie (jedes „vollständige Haus“) aus Sklaven und
[1] Nelson, System der phil. Rechtslehre und Politik, S. 85.
[2] Nelson, System der phil. Rechtslehre und Politik, S. 331/2.
[3] Beloch, Griech. Gesch. I, S. 77.
[4] S. S. I, S. 624—642.
[5] Dazu gehört leider auch Beloch. Er spricht von „Wir Arier“ (S. 66, vgl. auch S. 67 Anm.). Aber Max Müller hat das berühmte Wort gesprochen, daß es gerade eine solche Todsünde sei, von einer indogermanischen Rasse zu sprechen, wie von einer dolichokephalen Grammatik.
Beloch „leidet an dem geschichtlichen Irrtum, daß die Nation immer in erster Linie auf Blutsverwandtschaft beruhe und daß Einheit der Sprache nur durch gemeinsame Abstammung zu erklären sei“, wie Meinecke (W. u. N.) von Fr. Schlegel sagt. Max Schmidt (Ethn. Volksw. S. 98) schreibt: „Die Bildung der Sprachen ist unabhängig von der Bildung und Begrenzung der Rassen ... und die Sprachverwandtschaft verschiedener Völkerschaften darf somit nicht gleichgesetzt werden mit der Frage des Ursprungs eines gewissen Sprachstammes“. Vgl. ib. S. 36/7. Kein Wunder, daß die Historiker die Soziologie hassen ; sie nimmt ihnen die teuersten Vorurteile.
[90]
Freien. Das sei nicht naturwidrig, denn der Sklave ist notwendiges Werkzeug der Wirtschaft. Wer sollte denn anders als er die Arbeit machen?! Ja, „wenn die Weberschiffe selbst webten, und die Zitherschlägel selber die Zither schlügen, dann freilich bedürfte es für den Meister nicht der Gehilfen und für den Herrn nicht der Sklaven“.
Wir erkennen also mit voller Klarheit, daß diese Staatslehre die Klassenverschiedenheit in ihrer krassesten Gestalt als Sklaverei voraussetzt; und weiter: daß diese Verschiedenheit gesetzt gedacht ist als die Auswirkung äußerer erobernder Gewalt: denn der Sklave ist hier wie ursprünglich überall der Kriegsgefangene, der „Heilot“, das „Man- zipium“, der „Slave“: immer ein fremder, der eigenen Gruppe nicht angehöriger und daher rechtloser „Ungenosse“. Und so ist denn auch des Aristoteles „bester Staat“ durchaus nicht auf dem Grundsatz der Gleichheit aller Bürger errichtet: Vollbürger ist nur der Krieger und Staatsbeamte, aber Niemand, der das Leben eines Handwerkers oder Kaufmanns führt: „Denn ein solches ist unedel und der Tugend und Tüchtigkeit zuwider.“ Auch den Acker dürfen die Bürger nicht bauen, „denn es bedarf voller Muße zur Ausbildung der Tugend und zur Besorgung der Staatsgeschäfte“. Die Ackerbauern „müssen Leibeigene oder Hintersassen von ungriechischer Abstammung sein“. Und nur aus dem Stande der Vollbürger dürfen die Priester genommen werden; die Greise übernehmen die Priesterschaft. Dieses Staatsideal ist mithin, darüber kann gar kein Zweifel bestehen, der idealisierte Eroberungsund'Adelsstaat Sparta [1], das Sparta der „Lykurgfabel“[2].
Diese aristotelische Lehre ist zu einer der Grundlagen der modernen gegenrevolutionären Staatstheorien geworden durch eine groteske Quaternio terminorum, einfach dadurch, daß man für den antiken den modernen Begriff der Familie einsetzte und dadurch den Ausgangspunkt gewann, um den Staat als aus friedlicher Differenzierung, ohne Eingriff äußerer Gewalt entstanden, abzuleiten und auf diese Weise den klaffenden Gegensatz von Staat und Gesellschaft zu verkleistern[3].
Einen Übergang von der alten zu der neuen Lehre bildet die „patri-
[1] Vgl. Gumplowicz, Gesch. d. Staatstheorien, S. 64. Beloch III, 1, S. 393; vgl. ferner Neurath a. a. O. S. 46.
[2] Vgl. Busolt, a. a. O. S. 95, v. Poehlmann a. a. O, S. I, S. 118H.
[3] Vico läßt den Staat aus einem Zusammenschluß der Großfamilien entstehen. „Dieser erfolgt, weil die Familienoberhäupter das Bedürfnis empfinden, gemeinsam vorzugehen, wenn sie sich ... mit den wachsenden Ansprüchen ihrer Gefolgsleute und Schutzbefohlenen auseinandersetzen“ (Gust. Mayer, a. a. O. S. 423). Das ist echt aristotelisch: es sind „Fürsten der Stammhäuser“, die sich vereinen. Mayer findet es auffällig, daß Karl Marx, der Vico kannte, auf dessen Theorie von der Entstehung des Staates aus den frühesten Klassengegensätzen nirgends Bezug nimmt. — Wir werden diese Frage sofort beantworten können.
[91]
moniale Staatstheorie“ Karl Ludwig v. Haller's. Sein Standpunkt ist fast genau derjenige des richtig verstandenen Aristoteles. Die Menschen sind ungleich: aus diesem Naturgesetz ist der Staat entstanden, und zwar überall und zu allen Zeiten als ein „Verhältnis von Herrschenden und Untergebenen“ [1]. Das ist der „Naturzustand“; er hat niemals aufgehört und kann, eben weil er aus einem Naturgesetz entspringt, niemals aufhören[2]. Wie es drei Arten der Ungleichheit gibt: die Überlegenheit des Reichtums, der Tapferkeit oder Geschicklichkeit und des Geistes oder der Wissenschaft, so gibt es auch drei Arten von Staaten: die patriarchalischen oder haus- und grundherrlichen (die Haller „patri, monial“ nennt), die militärischen und die geistlichen (Hierarchien, Theokratien). Von diesen drei Arten gilt ihm die erste „durchaus als der normale Verband“. Die Geschichte beweise, daß „die meisten Fürstentümer ursprünglich auf dem Haus- oder grundherrlichen Verband oder dem sog. Patriarchat beruhen, alle anderen aber sich in der Folge nur durch dieses Verhältnis befestigen konnten“[3].
Worüber sich diese Lehre ausschweigt, ist das eigentlich entscheidende Problem, wie denn der „große Grundherr“ zu seinem großen Eigentum und seiner überwiegenden Macht gekommen ist, die es ihm gestatten, „eine so zahlreiche Menschenmasse durch „Dienstverträge“ von sich abhängig zu machen“[4]. Denn um solche handelt es sich bei diesem „herrschaftlichen Dienstverband“; „Woher er stammt, namentlich aber woher diese jenes eigene Recht des Eigentümers schaffende Rechtsordnung stamme, das sagt Haller uns nicht[5]“. Wir erfahren nur, daß es sich nicht um einen Gewalt- und Kriegszustand handelt, wo der Starke den Schwachen rücksichtslos unterdrücken könnte oder dürfte : denn das verbietet das göttliche, in allen Herzen lebende „Pflichtgesetz“. Allein „es bleibt auch nicht bei bloßem gegenseitigen Leben
[1] Handbuch der allgemeinen Staatenkunde, einleitende Sätze.
[2] Jellinek, allg. Staatsl., S. 193.
[3] Restauration der Staatswissenschaften, zit. nach v. Below, der deutsche Staat des Mittelalters, S. 1. Ähnlich sah es Herder und ihm folgend der junge Hegel (vgl. Rosenzweig, Hegel und der Staat, I, S. 28). Haller hat offenbar von Grotius (I. Kap., § 8, 3ff.) seinen Ausgang genommen. Danach entsteht die Herrschaft (subjectio) aus Kriegsnot, aus Nahrungsmangel und Bewucherung durch den Reichen (offenbar eine Erinnerung an die Josephssage), und wegen Bodensperre, weil „paterfamilias latifundia possidens neminem alia lege suas terras habitantem recipere velit“ usw. Die Josephslegende spielt bei der Erörterung der Monopole in dieser bibelkundigen Zeit überhaupt eine große Rolle: auch Luther zieht sie an (v. Schubert, a. a. O S. 64).
[4] Metzger, a. a. O. S. 276. Vgl. Treitschke Pol. I, S. 83, v. Below a. a. O. S. 312.
[5] Jellinek, a. a. O. S. 200/1. Das ist nicht ganz wörtlich zu nehmen. Sowohl Militärstaaten wie die geistlichen Hierarchien müssen nach H. alsbald die Verbindung mit dem Grundeigentum und der Grundherrschaft finden, wenn sie Bestand haben sollen, Ohne diese Vereinigung hat der Militärstaat den Charakter einer Horde (vgl. von Below, der Deutsche Staat d. Mittelalters, S. 2).
[92]
und Lebenlassen, sondern kraft des natürlich-sittlichen Grundgesetzes hat der Starke das Recht, über den Schwachen zu herrschen, und der Schwache hinwieder die Pflicht, dem Starken zu dienen“ [1].
Daß diese Lehre mit ihren eigenen Voraussetzungen in Widerspruch steht, haben schon die Zeitgenossen in scharfen Kritiken festgestellt, v. Raumer sagt: „Nie kommt man auf diesem Wege aus dem Privatrecht heraus, zu echtem Königtum, zu Staat und Souveränetät“[2]. Auch Jellinek sagt mit ebensoviel Recht, daß die Rechtsordnung, kraft deren der große Herr sein Eigentum besitzt, „da sie nicht in der Staatsordnung begründet ist, nur vorstaatlich sein kann, und damit befindet sich der erbitterte Gegner des Naturrechts ganz auf dem Boden dieser von ihm sonst so gründlich bekämpften Lehre. Darin liegt aber auch die schärfste Kritik der ganzen Patrimonialtheorie. Sie steht und fällt mit Annahme einer vorstaatlichen Rechtsordnung“[3].
Der Fehler, der hier begangen worden ist, ist genau der gleiche, der regelmäßig bei dem Versuch begangen wird, die Entstehung des Kapitalismus und der Kapitalisten durch den Hinweis auf besonders tüchtige und erfolgreiche Männer zu erklären, die sich von kleinsten Anfängen aus zu großer Stellung emporgeschwungen haben. Wir haben zeigen können, daß dieser Versuch, den Kapitalismus zu erklären, ihn voraussetzt[4]. Geradeso setzt Haller die Klassenordnung voraus, die er erklären will.
Hier spielt natürlich die dem vornehmen Patrizier selbstverständ-
[1] Metzger, a. a. O. S. 274. „Macht und Herrschaft sei ein natürliches Recht und göttliches Recht zugleich“: das ist der Kern seiner Lehre (Meinecke, Weltbürgertum, S. 225).
[2] Geschichtl. Entwicklung der Begriffe usw., S. 205. v. Below (a. a. O. S. 173/4) wirft ν. Haller vor, er teile die individualistische Auffassung mit der Naturlehre, in ihm stecke viel Rationalismus. Das hat ihm schon Savigny vorgeworfen: „Krasser Aufklärer in Geschichte und Politik“ (Meinecke, Weltb. S. 226). Auch Savigny ist dem Vorwurf nicht entgangen, „er sei, noch stärker als ihm bewußt, mit Naturrecht behaftet gewesen“ (Landsberg, Gesch. d. Dtsch. Rechtswissenschaft, 3. Abt., 2 Halbb., S. 195, Noten dazu S. 100/1). Landsberg schreibt diesem Vorwurf eine „berechtigte Seite“ zu. Übrigens ist Savigny kaum als Romantiker anzusprechen; er stand ihnen nur sachlich, als historisch interessiert und als Gegner des Naturrechts, und persönlich als Gatte einer Brentano, nahe (ib. 246.) Rohden schreibt sehr fein (Deutscher Staat und deutsche Parteien, S. 33): „Von Geburt konservativ gestimmte Naturen haben von je her ein tiefes Mißtrauen gegen den theoretischen Konservatismus empfunden. Selbst ein de Maistre galt in den Augen mancher seiner Standesgenossen als Jakobiner. Denn der gebürtige Konservative fühlt instinktiv, daß jede Staatsdoktrin, auch die organische, eben als Doktrin den rationalistischen „Sündenfall“ mitmacht, selbst wenn sie dessen inhaltliche Konsequenzen verneint.“ Ein charakteristisches Beispiel dafür ist, daß sogar der nüchternverständige Justus Moser „sich des Rousseauschen Gesellschaftsvertrages nicht erwehren kann“, wie Bluntschli (a. a. O. S. 468) ihm spöttisch ins Stammbuch schreibt.
[3] A. a. O. S. 200/1. Ähnlich urteilt Ewald, Die Probleme der Romantik usw. S. 44.
[4] S. S. I, S. 996.
[93]
liche Voraussetzung uneingestanden ihre entscheidende Rolle, daß der Adel sich zu seiner Stellung durch überragende Tüchtigkeit aufgeschwungen habe, wobei ununtersucht bleibt, worin diese Tugend bestanden habe. Daß entschieden nicht an die wirkliche geschichtliche Wahrheit gedacht wird, die uns zeigt, daß wenigstens der größte Teil des Ur- und Schwertadels Europas durch Waffengewalt zu seiner Stellung gelangt ist, beweist die Tatsache, daß einmal Adam als der erste Souverän erwähnt wird [1]. Wie hoch steht über dieser Geschichtsklitterung der alte Bodin, der ebenfalls die von ihm so genannte „monarchie seigneurale“ von der idealen, durch den Unterwerfungsvertrag entstandenen unterscheidet, als „diejenige, wo der Fürst durch Waffengewalt sich zum Herrn der Güter und Personen seiner Untertanen machte, die er nun beherrscht wie der Hausherr seine Sklaven“. Und zwar ist diese geschichtlich die älteste und soll durch die vollkommene abgelöst werden, in der „die Untertanen den Gesetzen des Königs, und dieser den Gesetzen der Natur folgt, so daß die eigentliche Herrschaft das Gesetz übt“ (B. II, c. 3). Man sieht, daß diese Naturrechtler geschichtlich denken konnten, wenn ihnen daran lag.
Jedenfalls zeigt uns die Erwähnung Adams als des ersten „Souveräns“ bei Haller die Linie, die zu der von uns aufgedeckten lächerlichen Äquivokation mit dem Worte „Familie“ führt. Denn Adam hatte noch keine Sklaven oder Leibeigenen. Es geht dann auch alsbald auf dieser Linie weiter. Dahlmann behauptet, die Urfamilie sei der Urstaat, jede Familie, unabhängig dargestellt, sei Staat. Ähnlich Br. Schmidt. Und weil Ratzel von Familien als politischen Einheiten bei Melanesiern und Mikronesiern erzählt, gründet Rehm darauf die Lehre von „Familienstaaten“. Jellinek, dem wir diese Hinweise verdanken[2], lehnt die Auffassung als „zu weit getriebene Induktion“ mit den Gründen ab, die wir oben bei der Abgrenzung des prähistorischen Staates mitgeteilt haben: aber er hat nicht gesehen, daß diese primitiven Formen unmöglich als Staaten im historischen Sinne aufgefaßt werden dürfen aus dem einzigen Grunde, weil sie noch keine Andeutung einer Klassenspaltung zeigen.
Haller hat noch vor kurzer Zeit einen Nachfolger gefunden, den Franzosen Funck-Brentano[3]. Wir wollen einen kurzen Auszug des
[1] Die Vorstellung stammt spätestens von Filmer („Patriarcha“ 1680). Locke widmet ihrer Widerlegung das ganze erste Buch der „Treatises“, im ganzen von § 5 bis 169, und noch drei §§ im zweiten Buch. Noch Rousseau macht sich über den Gedanken lustig (Contr. soc. I, Kap. 2). Haller könnte von Filmer angeregt sein, vielleicht auch von Fénelon, der etwas später (Télémaque) die gleichen Gedanken vortrug (Bluntschli, a. a. O. S. 198).
[2] A. a. O. S. 83 Anm.
[3] L'Ancienne-France, Paris 1912. Der letzte Anhänger v. Hallers war in Deutschland Romeo Maurenbrecher; in seinem Buche „Die deutschen regierenden Fürsten und die Souveränität“ (1839), hat er wieder versucht, wie früher den Fürsten an die Stelle zu setzen, die — ein gewaltiger Fortschritt des Staatsrechts — schon seit einiger Zeit der unpersönliche Staat einnahm. Von Haller angeregt, nennt er seine Auffassung geradezu die „patrimoniale“ (Landsberg, a. a. O. S. 400/1).
[94]
Gedankenganges geben, weil es unübertrefflich das Doppelspiel mit dem Worte „Familie“ zeigt.
Funck sieht keine Möglichkeit, mit den Mitteln der Völkerkunde festzustellen, wie sich aus der Familie der Staat entwickelt hat, glaubt aber, daß uns die Geschichte diese Möglichkeit gibt, und zwar durch das Studium solcher Zeiten, in denen sich der Staat unter der Wirkung dauernder innerer Fehden und äußerer Einfälle „aufgelöst“ hatte. Das war nach seiner Meinung im Frankreich des 8. und 9. Jahrhundert der Fall; wie in der Zeit der primitiven Wildheit herrschte die vollkommenste Anarchie. Die einzige organisierte Macht, die unberührt geblieben war, war die Familie. Sie kräftigte sich, gewann größere Kraft des Zusammenhalts. Gezwungen, alle ihre Bedürfnisse aus eigener Kraft zu befriedigen, schuf sie sich die dazu erforderlichen Organe ... Der Staat besteht nicht mehr, die Familie tritt an seine Stelle. Sie wird ein Staat im kleinen, der eifersüchtig seine Grenzen schützt. Der Patriarch besitzt die unumschränkte Autorität der alten Zeiten, er organisiert die Verteidigung und die Arbeit.
Aus der Familie entfaltet sich die „Mesnie“ (Grundherrschaft), die die Familie im engeren Sinne, die Diener („Serviteurs“, offenbar die Sklaven oder Leibeigenen), die Verbündeten und die Adoptivverwandten umfaßt. An ihrer Spitze steht der Seigneur mit väterlicher, patronaler Gewalt... Aus der Mesnie wird durch Aufnahme fremder Elemente das Lehen („fief“). Jene steht in Frankreich zwischen Familie und Lehensbesitz wie in Griechenland die Phratrie zwischen der Familie und dem Stamme, und wie in Rom die Gens zwischen Familie und Kurie. In den Dokumenten der Zeit wird das gleiche Wort „Familie“ für die engere Familie in unserem modernen Sinne, für die untertane Bevölkerung und schließlich für das unter dem Lehensherrn stehende Land gebraucht. Womit der Beweis geführt ist, daß normalerweise der Staat aus der „Familie“ entsteht.
Wir wollen noch nicht darauf bestehen, daß hier der „Staat“ in der Tat nicht verschwunden war : wir haben erst noch zu zeigen, daß Rechts- und Grenzschutz, aus deren Mangel Funck die Auflösung des Staats erschließt, sekundäre Kennzeichen des Staates sind, die aus seiner primären Eigenschaft, Klassenherrschaft zum Zweck der wirtschaftlichen Ausbeutung zu sein, entstanden sind. Nach diesem Kennzeichen aber war Frankreich in jener schlimmen Zeit der innerpolitischen Zersetzung und der Einbrüche der Normannen zwar ein sehr schlechter Staat, aber doch immer noch ein Staat. Aber selbst wenn wir davon
[95]
noch ganz absehen wollen: alle Einwände, die gegen Haller durchschlagen, treffen auch seinen späten Nachfolger. Wer war denn der „Patriarch“, dem sich die Gehetzten anvertrauten? Ein mächtiger Grundbesitzer, der es sich leisten konnte, ein großes Gefolge von Bewaffneten zu unterhalten! Oder ein Kondottiere, ein fremder oder einheimischer, der sich zum Haupt einer bewaffneten Bande aufgeschwungen hatte und nun den Schutz der Bedrängten unter der Bedingung der Herrschaft übernahm! In diesem Falle kam es wenigstens zu einem ausdrücklichen „Subjektionsvertrag“: aber auch hier kann keine Rede von dem „bürgerlichen Idyll“ sein, das uns Haller und Funck vortragen. Denn nicht aus der Mitte der Gemeinde erhob sich ein „Par inter Pares“ als ihr erwählter Richter und Heerführer, der nun allmählich zu ihrem Herrn wurde, sondern hier wie bei der blutigen Unterwerfung ist es die organisierte militärische Gewalt, die sich mit oder ohne Einwilligung der Unterworfenen zur Herrschaft aufschwingt. Nicht aus der Führung wird die Herrschaft, sondern aus der Herrschaft die Führung.
Wir kommen auf diese Fragen bei der Kritik zurück. Hier interessiert uns vor allem, daß von seiten der Gegenrevolution zuerst bei v. Haller die Entwicklung einsetzt, die das aristotelische Wort „Familie“ in unsere moderne „Kleinfamilie“ übersetzt. Auf der Gegenseite finde ich die Quelle möglicher Mißverständnisse zuerst bei Rousseau. Ihm ist, ganz richtig, „die älteste Gesellschaft die Familie“. Kein Zweifel, daß er die moderne Kleinfamilie im Auge hatte. Denn er sagt : „Der Herrscher ist das Bild des Vaters, das Volk das Bild der Kinder, und alle, gleich und frei geboren, entäußern sich ihrer Freiheit nur um ihres Nutzens willen“ (Contrat social I Kap. 2). Aber es konnte nicht ausbleiben, daß dieser moderne Begriff der Familie, als des engsten Geschlechtsverbandes, von unvorsichtigen Menschen gleichgesetzt wurde dem antiken Begriff, als dem Inbegriff der einem Patriarchen unterworfenen Menschen. Und da zweifellos alle „Gesellschaft“ aus der Familie im ersten Sinne abgeleitet werden muß [1], so lag für Leute, die nicht zwischen Staat und Gesellschaft zu unterscheiden wußten, die Versuchung allzu nahe, auch den Staat aus ihr abzuleiten, unter Berufung auf Aristoteles, der den anderen Begriff im Auge, und mit der Ableitung des Staates aus der „Familie“ in diesem anderen Sinne ungefähr Recht gehabt hatte.
Es hat übrigens nicht der Autorität Rousseaus bedurft, um die Irrung hervorzurufen. Schon bei Sir William Temple finde ich, fast hundert Jahre vor dem Genfer, kurz und knapp ausgesprochen: „Der Staat hat sich aus der Familie entwickelt. Die erste Autorität
[1] S. S. I, S. 1063ff. Vico hat Aristoteles völlig richtig verstanden (Neue Wissenschaft S. 106, 232).
[96]
war die des Familienhauptes, die sich allmählich ausdehnte, indem sie einen immer weiteren Kreis umfaßte“ [1].
In unserer Zeit ist es vor allem der sehr einflußreiche Sir Henry Maine, dessen Formel Anhänger gefunden hat, daß „die Vereinigung der Familien das Geschlecht, das Haus, die Vereinigung der Häuser den Stamm, die der Stämme das Gemeinwesen oder den Staat bilden“[2]. Noch ganz neuerdings hat Albrecht Wirth die Ansicht, der Staat sei „einfach eine fächerförmige Erweiterung der Sippenverbände“, für „durchaus denkbar“ erklärt, sagt aber dazu, „in keinem einzigen Falle, den wir nachprüfen können, ist ein Staat von Belang wirklich so entstanden“[3].
ß) Die romantische Staatsidee. (Der „Organismus“.)
Diese sich auf den mißverstandenen Aristoteles berufenden Vorstellungen gehen nun, als nahe verwandt, in die sog. „Romantik“ ein. Daß der Staat nicht die willkürliche Schöpfung zweckbewußter Individuen, sondern ein Gebild der Natur ist, wie Aristoteles verkündet hatte, nichts Gemachtes, sondern ein Gewordenes: das paßte vortrefflich in den Gedankengang der Romantiker, die auch diese gesellschaftliche Erscheinung geradeso durch ein „pflanzenhaftes“ Wachstum[4] entstehen ließen wie die Sprache, die Religion und das Recht. Dazu kam ein bedeutungsvoller Zug, der, dem Altertum fremd, aus der mittelalterlich-katholischen Geschichtsphilosophie in das Gedankengeflecht dieser Richtung einging. Die Kirche hatte, im Gegensatz zu der antiken Anschauung vom ewig gleichen Kreislauf der Dinge[5] immer die Lehre vorgetragen, daß die Weltgeschichte die „Theophanie“ sei, die Selbst-
[1] La recherche de l'origine et de la nature du Gouvernement, 1672.
[2] Vgl. Gumplowicz, a. a. O., S. 412.
[3] Geschichtsphilosophisches, Pol. anthropol. Revue, 1908.
[4] S. S. I, S. 5. Treitschke, (Polit. I, S. 20) warnt vor der Übertreibung dieses Vergleichs der Staats- mit der Sprachbildung. Bei der ersteren habe der bewußte Wille ganz anders mitgewirkt. Hier hat ihn sein „Machtstaaf'-Instinkt einmal richtig geleitet: aber die Vertreter jener Anschauung meinten Gemeinschaft, wenn sie „Staat“ sagten, während er wirklich den historischen Staat meint.
„Daß die Gleichordnung von Sprach- und Rechtsentwicklung ebenso wie die Vorliebe für volkstümliche Urzustände, wie das Verständnis für Volkstümliches überhaupt auf Herder zurückgeht, genau so wie die Gesamtromantik an diesen als an ihren geistigen Ahnherrn anknüpft, darf wohl heute als allgemein bekannt angenommen werden; daß dabei Wilh. v. Humboldt für Savigny der Vermittler gewesen ist, hat bereits 1856 Kuntze nachgewiesen“ (Landsberg, a. a. O. S. 213). Eine sehr große Rolle bei dieser Gleichsetzung hat auch Jakob Grimm gespielt, der von Hause aus Jurist war und erst von hier aus zu seinen Sprachstudien kam (vgl. Landsberg S. 277ff.).
[5] S. S. I, 755. Nach Gumplowicz (Gesch. d. Staatsth. S. 73) hat Polybius zuerst die Lehre vorgetragen.
[97]
offenbarung Gottes [1]: er enthüllt sich der Menschheit, indem er seinen Heilsplan, den vollkommenen Sieg des Guten über das Böse, die Vollendung des die ganze Welt umspannenden christlichen Gottesreiches, verwirklicht. Auf diese Weise erschien jedes einzelne geschichtliche Gebilde als Stufe dieses großen Prozesses oder vielleicht besser: als ein Zug in diesem ungeheuren Schachspiel Gottes mit der Gewalt des Bösen, und darum erhielt alles geschichtlich Gewordene etwas Heiliges, was es in der Antike nie gehabt hatte, noch haben konnte.
Im Lichte dieser Auffassung mußte auch, und vor allem, der Staat, als der eigentliche Hauptträger der geschichtlichen Entwicklung, schon an sich seinen besonderen Wertakzent erhalten. Und das wurde noch verstärkt durch den Nationalismus, der, wie wir wissen[2], zu den kennzeichnenden Zügen der bürgerlichen Psychologie gehört. Der eigene Staat — und in Konsequenz davon „der“ Staat überhaupt, erschien als die Manifestation Gottes oder, bei den Protestanten, die aus der Theophanie eine „Ideophanie“[3] gemacht hatten, als die Manifestation der „Natur“, auf die alle Attribute des allmächtigen und allweisen Gottes übertragen worden waren, Comtes „Entität der Enti- täten“.
Von hier aus versteht man den „Staatsenthusiasmus“, in dem befangen Schelling und Adam Müller[4] „die Totalität der Kultur im Staate verwirklicht finden wollten“[5] : eine Stimmung, die zuletzt bei Hegel sich geradezu bis zum Staatsgötzentum steigerte.
[1] „Jeder besondere Moment der Zeit ist Offenbarung einer besonderen Seite Gottes, in deren jeder er absolut ist ... Natur und Geschichte verhalten sich überhaupt als die reale und ideale Einheit; aber ebenso verhält sich die Religion der griechischen Welt zu der christlichen, in welcher das Göttliche aufgehört hat, sich in der Natur zu offenbaren und nur in der Geschichte erkennbar wird“ (Schelling, a. a. O. S. 172/3).
[2] S. S. I, S. 645ff.
[3] Salomon, a.a.O. S. 428; vgl. S. S. I, S. 39. Ähnlich unterschied schon Frantz, Naturlehre, S. 197) zwischen Theo- und Ideokratie. Auch das ist im Kerne Comteisch.
[4] Über Adam Müllers Staatsauffassung, die stark von Burke beeinflußt war, vgl. Meinecke (Weltb.) S. 139/40. S. 145 wird ein Brief an Gentz zitiert, in dem Müller sich mit Fichtes Rationalismus und Individualismus auseinandersetzt: „Wer den Glauben des Gehorsams hat, wer an die Gesetze Gottes glaubt und an seine positiven Weltordnungen, nicht weil sie vernünftig sind, sondern weil ihm alle Jahrhunderte sagen, daß sie von Gott herrühren, ... der ist orthodox, der ist ein Christ“. Von diesem Standpunkt der Dienstseligkeit ist es zu verstehen, daß Müller „alles Naturrecht außer oder über oder vor dem positiven Rechte“ leugnet, und „alles positive Recht für natürliches anerkennt“ (ib. S. 138); ist es zu verstehen, daß solcher Konsequenz gegenüber, die sich freilich selbst ad absurdum führen muß, da anders jede Tyrannei Recht wäre, ein Savigny als vom Rationalismus angehaucht erscheinen mußte, und daß dieser Mann nur im Schöße der katholischen Kirche seinen Frieden finden konnte. Von hier führt der Weg zu Ranke (ib. S. 150), und von Ranke zu Treitschke und dem „Machtstaat“.
[5] Metzger, a.a .a. O. S. 303.
[98]
Die starke Säule der Romantik war, wie wir schon andeuteten, das Dogma der kanonisch-mittelalterlichen Staatslehre, und zwar auf dem Kontinent vorwiegend [1] in ihrer, ihr von Thomas von Aquino verliehenen Ausgestaltung, während in England eine skeptischere Richtung sich durchsetzte: dort führten die Dominikaner, bei denen „der Geist ihres größten Bruders Thomas[2],“ der beherrschende blieb, hier die Franziskaner, die Schüler des Heiligen Franz von Assisi. Als der große Mystiker, der er war, hatte er seinen Nachfolgern auch jene, aller Mystik eigene, Einstellung zur offiziellen Kirche hinterlassen, die zwar nicht gerade feindlich, wohl aber fremd genannt werden kann[3]; „die an sich antikatholische Auffassung von der Berechtigung individueller religiöser Überzeugung, die zum Skeptizismus führte, ... indem sich der gesunde Menschenverstand, die individuelle Persönlichkeit gegenüber der mittelalterlichen Gebundenheit durchsetzt“[4]. So trat hier Duns Scotus, „der Zertrümmerer fremder Spekulation, als Kritiker dem dogmatischen Thomismus entgegen“[5]. Dieser Gegensatz beruht, wie Brodnitz richtig erkennt, vor allem darauf, daß England ein „Seestaat“ mit Staatswirtschaft und eigener Staatswirtschaftspolitik ist, während „der Thomismus auf wirtschaftlichem Gebiete den adäquaten Ausdruck der kontinentalen Stadtwirtschaft“[6] des noch nicht voll entfalteten „Landstaates“ darstellt. Das wirkt auch auf die Staatslehre: „wo der Aquinate von civitas spricht, da nennt Duns die respublica“: der Nationalstaat meldet seine Ansprüche gegen die Einheitskultur Ganz-Europas an. Dieser Zug ist es, der sich auch auf dem Kontinent, vor allem in den protestantischen Ländern, mehr und mehr durchsetzt. Wir kommen auf diese Gegensätze bei der Analyse des Seestaates noch einmal zurück.
Hier interessiert uns mehr, was alle Richtungen des Katholizismus gemeinsam haben. Das läßt sich in einer kurzen Formel nicht erschöpfen, aber wohl genügend andeuten: ihre Staatslehre ist immer eine gewisse Mischung von Philosophie und Soziologie; oder: was das gleiche sagt, ihr Staatsbegriff ist immer eine Kreuzung von „überhistorischem“ und historischem Staat. Dabei liegt in der Regel der Nachdruck auf dem, was der Staat sein soll, gegenüber dem, was er in Wirklichkeit ist.
Und zwar liegt hier keine Inkonsequenz, keine Konfusion mit-
[1] Nur vorwiegend, nicht ganz. In Deutschland sind die Cluniazenser päpstlich, die Benediktiner kaiserlich. (Die Benediktiner sind große Feudalherren und bedürfen des kaiserlichen Schutzes (Salomon S. 446.) Später sind auch hier die Franziskaner kaiserlich gesonnen (Salomon, S. 452).
[2] Brodnitz, Engl. Wirtsch. Gesch. I, S. 291.
[3] S. S. I, S. 321, S. 423.
[4] Brodnitz, a. a. O. S. 292.
[5] Brodnitz, a. a. O. S. 292.
[6] Brodnitz, a. a. O. S. 296.
[99]
einander unvereinbarer Begriffe vor, sondern gerade diese Synthese scheint uns die Quintessenz der christlichen Staatslehre zu sein. Sie ist im Kerne immer platonisch orientiert geblieben; und so ist ihr der Staat, was dem Platonismus alle Wirklichkeit im Grunde ist: eine an sich vollkommene, in ihrem Ursprung göttliche Idee, die in ihrer Verwirklichung, durch die Mischung mit dem „in Wahrheit nicht Seienden“, der Materie, von ihrer Vollkommenheit stark verloren hat, wie ein Gebild, das zwar in einer vollkommenen Form, aber aus einem Stoff gegossen wird, der viel zu grob ist, um sich in alle feinen Falten des Modells einzuschmiegen. Und wie Platon hinter der groben „Erscheinung“ immer die vollkommene Idee erblickt, so sieht auch die Kirche hinter der groben, von ihr selbst als im höchsten Grade unvollkommen anerkannten Gestalt des historischen Klassenstaates die reine Idee des Gottesstaates, wie etwa ein feiner Kenner in der grotesken Form eines von primitiver Hand geschnitzten Heiligenbildes mit gerührtem Lächeln das vollkommene Urbild wiedererkennt, oder, wie wir ein edles Musikstück auch in der Wiedergabe durch Dorfmusikanten noch erkennen und trotz aller Leiden unseres Ohres genießen.
Das wenigstens ist die Stellung der Kirche zum Staate seit der Zeit, wo sie ihr triumphierendes Bündnis mit dem Staate geschlossen hatte. Vorher, in der Zeit der Verfolgung, hatte sie sich zu ihm, als einem Gebilde dieser Welt, bestenfalls gleichgültig-negativ verhalten: „Gib dem Kaiser, was des Kaisers ist“. Aber wir wisser, daß die Stellung bei Augustin eine geradezu feindliche wird : der weltliche Staat erscheint als Werk des Bösen. Und wir haben gesehen, wie in allen Zeiten des Kampfes zwischen Kirche und Staat diese Vorstellungen wieder aufleben: im Investiturstreit, dann bei den Monarchomachen.
Aber solche Kämpfe sind, weil sie eine Erschütterung der Autorität mit sich bringen, auch für die Kirche selbst gefährlich, und so ist die reguläre Staatslehre die soeben von uns kurz gekennzeichnete. Es scheint uns charakteristisch, daß Pesch die abweichende Meinung einiger Kirchenväter, die im Staat eine Folge des Sündenfalls, eine durch die gefallene Menschennatur herbeigeführte Notwendigkeit, erblicken, nur in einer Anmerkung erwähnt [1]. Die sozusagen offizielle Lehre aber sagt weniger, was der Staat ist, als was er sein soll — oder: als was ihn der gläubige Christ trotz seiner Unvollkommenheiten betrachten und verehren soll: Der Christ sieht im Staate: „einen notwendigen, von Gott geforderten Zustand, ein Vermögen, eine natürliche Ausstattung der Menschheit, welche die Gattung zur Vollendung zu führen bestimmt war, aber auch eine ursprüngliche, von Gott gewollte Ordnung, mit einer durch ihren Begriff, ihr Wesen, ihren Zweck geforderten
[1] Der christliche Staatsbegriff, S. 53.
[1OO]
Gliederung, kein bloßes Nebeneinander und Durcheinander freier und gleicher Atomindividuen“ [1].
Selbstverständlich wird dabei nicht bestritten, daß der menschliche Wille bei der Bildung und Veränderung der verschiedenen einzelnen Staaten seine Rolle gespielt hat, aber: „Das Eine ist zurückgewiesen: als ob es in dem Belieben der Menschen gelegen habe, den Staat überhaupt einzuführen oder nicht; als ob ... der Staat nicht selbst ein Naturzustand und durch die Macht der vernünftigen Natur gefordert und verwirklicht sei“ (S. 52/3).
Um noch einen zweiten berühmten katholischen Gelehrten anzuführen, so ist des Grafen von Hertling Staatsdefinition in ihrer nackten Gestalt nicht so voll von Inhalt, wie die soeben angeführte. Es zeigt sich aber, daß dieser Inhalt durch die Erläuterung hineingebracht wird. Ihm „ergibt sich, als der allgemeinste Begriff des Staates, daß er die dauernde Verbindung einer Vielheit von Menschen ist unter einer gemeinsamen Obrigkeit zur geordneten Erfüllung aller Zwecke des Gemeinschaftslebens“[2]. Hertling sieht wohl, daß der empirische, historische Staat in der Regel aus Eroberung und Unterwerfung entstanden ist (67), aber das ist offenbar Gottes Weg zu seinem Zwecke, und dieser Zweck ist „die Aufrechterhaltung der sittlichen Ordnung, ... und darum ist die Unterwerfung unter die Anordnungen der staatlichen Autorität sittliche Pflicht“ — bis zu einer unüberschreitbaren Grenze: „Aber diese Pflicht reicht nur soweit, als sich staatliche Autorität in den Schranken hält, welche ihr durch ein höheres Gesetz vorgezeichnet sind“ (74).
Das sind im Kerne die Gedanken, die über anderthalb Jahrtausende hin die Kirche in die Köpfe und Seelen eingeprägt hat. In der Atmosphäre der nachrevolutionären Romantik gewinnen sie neuen Schwung, so sehr, daß eine Anzahl der führenden protestantischen Romantiker, Adam Müller und andere, in den Schoß der alten Kirche zurückkehren; und sogar bei den katholischen Schriftstellern der Periode ersteigt der Staatsenthusiasmus zuweilen die gleiche Höhe wie auf der anderen Seite, so daß die alte Zurückhaltung gegenüber dem wirklichen Staate der Geschichte verschwunden erscheint. Bezeichnend dafür ist eine Auslassung des verdienstvollen Geschichtsschreibers der Nationalökonomie, Julius Kautz: „Der Staat ist ein ursprüngliches, in dem innersten Wesen der Menschennatur wurzelndes, menschheitliches Institut, das sich nach bestimmten geistigen Lebensgesetzen entfaltet, allen sozialen Lebenssphären und Elementen fördernd und schützend nebenordnet und nach den immer und überall gleichen unveränderlichen Prinzipien des Rechts und der Gerechtigkeit unterstützend und helfend,
[1] Der christliche Staatsbegriff, S. 74.
[2] Recht, Staat und Gesellschaft, München 1906.
[101]
überwachend und beaufsichtigend, schirmend und stärkend zur Seite steht ... Er ist die Voraussetzung und das Fundament alles wahren Fortschritts, aller echten Zivilisation, Bildung, Macht und Wohlfahrt“ [1].
Diese katholischen Gedanken drangen in die deutsche Romantik namentlich durch den Einfluß Edmund Burkes[2] ein, dessen leidenschaftliche Anklage gegen die französische Revolution, von dem bekannten Gentz, der „âme damnée“ Metternichs, ins Deutsche übertragen, lange geradezu das Brevier der Gegenrevolution war. Sie war es, die vor allem auf die Protestanten wirkte. Aber auch in dem katholischen Frankreich hat er tief gewirkt auf den geistreichen Grafen Joseph de Maistre.der in seinen „Soirées de St. Pétersbourg“ das unverfälschte Credo des Ancien Régime vortrug, und den Kardinal Bonald, der in seiner „Urgesetzgebung“ den Versuch macht, die Naturrechtler mit naturrechtlicher Methode zu schlagen. Er meint, „aus seiner einfachen Theorie ließen sich, wie aus algebraischen Formeln, allgemeine Grundsätze ableiten, womit man alle Aufgaben der Gesellschaft, vergangene wie künftige, lösen könne! Dies klingt genau, als habe es Condorcet geschrieben: so nahe stehen sich philosophische Gegenfüßler, wenn sie auf der Höhe verneinender Abstraktion stehen bleiben“[3].
Vor allem ist in die deutsche Romantik aus Burke eingegangen die großartige Vorstellung des Katholizismus von der Gesellschaft als einem über Zeit und Raum gespannten ewigen Lebewesen, zu dem die Toten geradeso gehören wie die noch Ungeborenen[4]. Der tiefsinnige v. Baader in seinen „Grundzügen der Sozietätsphilosophie“[5] (S. 10) beruft sich ausdrücklich auf den Iren, wo er diese Lehre in dessen
[1] Die Nationalökonomie als Wissenschaft, Wien 1858, S. 265ff. zit. nach Pesch S. J., „Der christliche Staatsbegriff“, S. 116/7. (Die soz. Frage, beleuchtet durch die Stimmen aus Maria-Laach), Freiburg 98.
[2] Betrachtungen über die französische Revolution (1796). Über Burke vgl. Meinecke, (Weltb. S. 135ff.). Es wird von ihm gesagt, daß er der erste war, der die Tatsachen von den Interessen der Staaten als lebendiger Individuen, die seit Machiavelli jedermann bekannt waren, die man aber als ein „Pudendum“ zu betrachten gewöhnt war, (so Montesquieu, so noch W. v. Humboldt), mit Freude als die Auswirkung individueller verehrungswürdiger Kräfte anschaute. So lehrte er die höhere Zweckmäßigkeit vieles dessen, was bisher nur als Schwäche oder Unvernunft gegolten hatte, verstehen ... Überall, im Großen und im Kleinen, konnte man nun den „ganzen Schmuck der köstlichen Nebenideen gewahr werden, welche das Herz umfaßt und selbst der Verstand billigt, weil er ihrer bedarf, um die Mängel unserer nackten gebrechlichen Natur zu bedecken“ (Burke).
[3] Raumer, a. a. O. S. 84/5. Vgl. S. 92: „Und wie wir ihn an Condorcet, Hobbes und Helvetius streifen sahen, so langt der, vorgeblich so folgerechte Denker bei Rousseau an, wenn er sagt: „Die Regierung soll nur Gesetze geben, deren Notwendigkeit die Natur anzeigt“.
[4] Vgl. S. S. I, S. 94 Anm. 2.
[5] Würzburg 1865. v. Baader war Ratgeber des Zaren Alexander in der Heiligen Allianz (v. Martin, Weltanschauliche Motive usw. S. 379).
[102]
prachtvoller Diktion vorträgt: „Jeder Kontrakt eines einzelnen Staates ist nur ein einzelner Paragraph in dem großen primitiven Urkontrakt einer ewigen Sozietät, niedrige Naturen mit höheren verbindend, die sichtbare Welt mit der unsichtbaren, die Zeit mit der Ewigkeit“ [1].
Diese Gedanken sind heute noch auch in protestantischen Kreisen lebendig, ohne wesentliche Unterschiede von den Katholiken. Gemeinsam ist besonders der Glaube an einen idealen Urzustand. So meint R. Rocholl, daß der erste Mensch „königlich und herrschend stand“ und mit Kräften ausgestattet war, die „wir jetzt mehr erraten als deutlich erkennen“[2]. Die gleiche Vorstellung finden wir in Madatsch' „Tragödie des Menschen“ und im russischen Volksmärchen, das Tolstoj erzählt: von den riesenhaften unbekannten Getreidekörnern und den drei Greisen, von denen je der Ältere immer der Stärkere und Frischere ist.
Ein zweiter, unendlich fruchtbar gewordener Gedanke, den die Romantik aus Burke übernahm, ist sein berühmtes Wort: „Nature is wisdom without reflexion and above it“. Von hier aus ist namentlich Schelling weitergegangen; aber auch Savigny ist von Burke beeinflußt gewesen[3].
Es würde uns viel zu weit von unserem Wege abführen, wollten wir den Versuch machen, die Anschauungen der verschiedenen Vertreter der Romantik vom Staate auch nur im Umriß darzustellen. Ihnen allen ist der historische Staat mit der gewachsenen Gemeinschaft, und daher mehr oder weniger mit dem idealen Staate eines und dasselbe. Ihr größter Staatsichrer, Fichte, spricht ja, wie wir wissen, grundsätzlich nur von dem überhistorischen Philosophenstaat — der historische „geht den Erleuchteten gar nichts an“ —, wenn er auch gelegentlich in einem geschichtlichen Ausblick den „Gewaltstaat“, in dem die Beherrschten den Herrschern unterworfen sind, von dem ihn allein interessierenden „Rechtsstaat“ unterscheidet, in dem Freie der Vorsicht und dem Willen anderer Freier unterworfen sind[4].
Die Fäden, denen wir hier zu folgen haben, sind erstens die Vernichtung des dogmatischen Naturrechts durch die historische Schule der Rechtswissenschaft und zweitens die Andeutungen, die sich von einer geschichtlichen Auffassung des Staates zeigen.
[1] Vgl. S. S. I, S. 94/95 Anm. — Oskar Ewald (Probleme der Romantik, S. 32) bringt die Burkesche Stelle im vollen Wortlaut.
[2] Barth, Phil. d. Gesch., S. 744, Schelling steht fest auf diesem Boden: „Es gibt keinen Zustand der Barbarei, der nicht aus einer untergegangenen Kultur herstammte ... Ich halte den Zustand der Kultur durchaus für den ersten des Menschengeschlechts, und die erste Gründung der Staaten, der Wissenschaften, der Religion und der Künste für gleichzeitig oder vielmehr für Eins“ (a. a. O. S. 168/9). Vgl. S. 30/1 über das „Urvolk“.
[3] Landsberg, a. a. O. S. 212.
[4] Vgl. Metzger, a. a. O. S. 182/3, Heller, a. a. O. S. 13. Über Novalis Metzger S. 288, über Adam Müller S. 264.
[103]
„Die neuere deutsche historische Rechtswissenschaft datiert von Gustav Hugo (1764—1844); er hat ihr Raum geschaffen negativ durch Beseitigung des alten Naturrechts .. ., das er mit den Waffen der Kantischen Philosophie zu Scherben geschlagen hat“ [1].
Aber Hugo, der noch ganz im Kantischen Rationalismus wurzelt, der freilich insofern schon einen neuen, moderneren Typ darstellt, als er sich durch einen großen Historiker wie Gibbon anregen läßt[2] (Landsberg 7), kann nicht der Gründer der historischen Schule genannt werden, die, ausgesprochen gegenrevolutionär eingestellt, gleich dieser ganzen Geistesrichtung nicht eine geschichtliche Auffassung schlechtweg, sondern eine solche vertrat, „die die Vergangenheit romantisch verklärt, um die Gegenwart auf sie zurückzulenken“ (46).
Die historische Rechtsschule ist eine bewußte Gründung Friedrich Carls von Savigny (199ff.); erst „er hat der empirisch-historischen Richtung, für die Hugo als Kantisch rauher Bußprediger gegen den Götzendienst des Naturrechts gewirkt hatte, den warmen Lebensatem der Liebe zur Sache eingeblasen. Erst damit war das Naturrecht, weil ersetzt, innerhalb wahrhaft überwunden“ (252). Sein Freund und Mitstreiter Eichhorn hat den Sieg durch Ausrottung des alten Naturrechts auch aus dem Kirchenrecht vollendet (270).
Der Ausgangspunkt ist typisch gegenrevolutionär: „die Abneigung gegen die aufklärerischen und naturrechtlichen Ideen der unmittelbar vorhergehenden Generation“ (273). „Das Rechtsleben ist weiter nichts als ein Teil des allgemeinen Volkslebens. Durch dieses allen Volksgenossen gleiche Gefühl innerer Notwendigkeit wird aller Gedanke an zufällige und wirkliche Entstehung ausgeschlossen .. . Wie die Sprache in die Zucht der Grammatiker genommen wird, ... so kommt bei fortgeschritteneren Zuständen das notwendig mit fortschreitende Recht in die Hand der Juristen und Gesetzgeber, die aber auch ... nicht beliebig neuen Rechtsinhalt setzen können“ (204). „Die Quelle des Rechts ist nicht in der individuellen Vernunft, sondern im Volksgeist“, im Gegensatz zu den Physiokraten, die man fälschlich mit Savigny hat zusammenbringen wollen. „Bei ihnen Reflexion, Absolutismus der Lösung, bei Savigny Instinkt, Gefühl, Relativität nach Nation und Zeit; bei jenen ein Drängen auf Ausführung der Ergebnisses der Re-
[1] Landsberg, a. a. O. S. 40.
[2] Schelling war auch ein Verehrer des großen Historikers: „Wenn wir von Gibbon absehen, ... existieren bloß wahrhaft nationelle Historiker, unter denen die spätere Zeit Machiavelli und Johannes Müller nennen wird“ (Vorlesung S, 225). Johannes Müller ist ein heute fast vergessener Schweizer Historiker, den allerdings auch Bluntschli (a. a. O. S. 507ff.) sehr hoch einschätzt. Seine Jugendschrift über die Schweizer Geschichte hat Schiller zu seinem Wilhelm Teil angeregt (ib. S. 510).
[104]
flexion, bei Savigny Zweifel an der Fähigkeit und dem Berufe der Zeit, Gesetze zu geben“ [1].
Verwandt mit der Physiokratie, aber rein äußerlich, ist diese Auffassung nur darin, daß sie beide dem Gesetzgeber die Aufgabe zuschreiben, das Gesetz zu erkennen und einzuführen: aber bei Quesnay und den Seinen ist es das für alle Völker unwandelbar gleiche, durch die individuelle Vernunft erkennbare Naturrecht, bei Savigny aber das für jedes Volk individuell aus seiner besonderen Wesenheit erwachsende Volksrecht, „Weisheit ohne Reflexion“. Wenn der Gesetzgeber dieses Recht nicht trifft, wird es ihm ergehen wie den Fürsten, die dem Gelde einen höheren als den ihm innewohnenden Wert verleihen wollen, wozu sie ja auch formell berechtigt sind, und damit notwendig Schiffbruch leiden. (Ein sehr bedenklicher Vergleich, da dies ein aus der individuellen Vernunft mit Sicherheit abzuleitender und für alle Völker ausnahmslos gültiger Satz ist.) Das eben sei der Unterschied zwischen Despotismus und Freiheit, „daß der Regent dort eigenwillig und willkürlich schaltet, hier aber Natur und Geschichte in den lebendigen Kräften des Volkes ehrt, daß ihm dort das Volk ein toter Stoff ist, den er bearbeitet, hier aber ein Organismus höherer Art, zu dessen Haupt ihn Gott gesetzt hat, und mit welchem er innerlich eins werden soll“.[2]
Man sieht, hier bleibt die Lehre vom Staat und Recht im Negativen stecken : es wird gesagt, was der Staat nicht sein soll, aber nicht, wie er geworden ist, und was er sein soll. Das geschichtlich Gewordene erscheint, so wie es ist, als gut und ehrwürdig, und man versteht nicht, wie Savigny den Despotismus mit seiner Willkür im einzelnen Falle vom echten Recht und Staat unterscheiden will, wenn es nicht ein über allen Einzelrechten stehendes Recht gibt, an dem sie gemessen und bewertet werden können. All das bleibt im unklaren, und wird durch Behauptungen im Stile der folgenden nicht klarer, daß „wir die Entstehung des Staates in eine höhere Notwendigkeit, in eine von innen heraus bildende Kraft setzen müssen“, oder wenn die Staatsentstehung als „eine Art von Rechtserzeugung, ja, als die höchste Stufe der Rechtserzeugung überhaupt“, und an anderer Stelle der Staat als die „leibliche Erscheinung des Volkes“ bezeichnet wird[3].
Was nun zweitens die historischen Vorstellungen der Romantiker anlangt, so beschränken sie sich im allgemeinen auf die andächtige Verehrung des Gewordenen; oder, wie schon gesagt, sie sprechen vom überhistorischen Philosophenstaat anstatt des geschichtlichen Gebildes.
Eine gewisse Ausnahme stellt Schleiermacher dar, der, wie Metzger
[1] Hasbach, a. a. O. S. 129.
[2] Landsberg, a. a. O. S. 206.
[3] Gumplowicz, Gesch. d. Staatsth., S. 348/9. Bluntschli nennt den Staat eine „Volksperson“.
[105]
annimmt, unter dem Einfluß Savignys sein Augenmerk je länger je mehr auf die geschichtliche Seite des Problems gerichtet hat. Es ist sicherlich historisch gemeint, wenn er den Staat ohne jeden schroffen Übergang in dem Augenblicke aus der vorstaatlichen Horde hervorgehen läßt, wo „die unbewußte aber beharrliche Gleichförmigkeit im Leben, d. h. die Sitte, zur bewußten, d. h. Gesetz wird. Staat ist, wo Gesetz ist, denn mit dem Gesetze wird ein vorher instinktartiges Zusammensein ein bewußtes“ [1].
Wie das gemeint ist, erkennt man aus anderen Auslassungen. Das unbewußte Gesetz muß als Gesetz ausgesprochen werden[2], und das heißt: es muß als positives Gesetz verkündet sein: dann erst ist Staat vorhanden. Und aussprechen kann das Gesetz nur ein Oberhaupt : Solange noch kein Oberhaupt vorhanden ist, Horden. Sowie ein Complexus von Familien die Form des stätigen Gegensatzes von Befehlen und Gehorchen annimmt, Staat, der daher aufgelöst wird durch Anarchie und Despotie. Wir sehen den Staat als vergrößerte Familie an.... Wenn aber die Gehorchenden willenlos sind, kein Staat; ebenso ist ein aus Usurpation hervorgehender Staat nicht haltbar; der Staat muß vielmehr auf dem Gesamtwillen beruhen und ist nicht mehr, wenn die Gesamtheit willenlos ist[3].
Wir haben hier die charakteristische Mischung von Vorstellungen über den historischen und den überhistorischen Staat. Aber es ist wieder ganz historisch gemeint, wenn Schleiermacher sich zu der Meinung bekennt, daß die ersten Staaten monarchisch gewesen sein müssen; erst später könnten, durch Vereinigung mehrerer Familienhäupter oder durch Trennung mehrerer Mitglieder der gleichen Familie nach dem Tode des Häuptlings, Republikaner entstanden sein (2 ff.).
Jedenfalls hat seine historische Einstellung Schleiermacher vor der kritiklosen Staatsanbetung bewahrt, in die so viele seiner Zeitgenossen verfallen sind. Er ist, wie Metzger (S. 303) sagt, „durchgängig von der Auffassung beherrscht, daß im Staat gerade nur die .weltliche' Seite der Kultur vertreten und verkörpert sei ; für deren geistige und .geistliche' Seite muß es .andere Gemeinschaften' geben, .Akademie' und Kirche'[4].“ Hier klingt leise die Ahnung an, daß es neben dem Staate
[1] Zit. n. Metzger, a. a. O. S. 293/4.
[2] Die Lehre vom Staate, Berlin 1845, S. 9.
[3] Die Lehre vom Staate, Berlin 1845, S. 180. Der Gedanke findet sich auch bei anderen. Waxweiler spricht erst von einer „Gruppe“, wenn die unorganisierte „Truppe“ sich einen Häuptling gesetzt hat; das nennt er „céphalisation“. Vgl. S. S., I, S. 461.
[4] Hier klingen Gedanken an, die im Keime schon bei Herder zu finden sind, und dann bei Hegel zum vollen Ausdruck kommen: der Gegensatz von „objektiven“ und „absoluten“ Werten. Zu jenen gehört der Staat selbst, sowie Recht, Wirtschaft und Wissenschaft, zu diesen Religion, Kunst, und Philosophie: jene der Inbegriff der „Zivilisation“, diese der „Kultur“. Vgl. S. S. I, S. 437ff.
[106]
noch etwas anderes geben müsse; und das kann ja nichts anderes sein, als die „Gesellschaft“.
Aber es bleibt bei der Ahnung. Ex officio werden Staat und Gesellschaft nicht nur nicht unterschieden, sondern geradezu gleichgesetzt. Wir haben soeben eine Stelle angeführt, wo unser Autor, vermeintlicharistotelisch, den Staat als vergrößerte Familie ansah; eine Familie aber, gefaßt als moderne Kleinfamilie, ist offenbar ein Gebilde der Natur. Und so wird auch der daraus hervorgegangene Staat dazu: „Wir wollen den Staat als Naturerzeugnis betrachten (φύσις), nämlich wie die menschliche Intelligenz ihn ihrer Natur gemäß gestaltet. Zugleich ist darin der Begriff der organisch-lebendigen Natur, wie es auch unsere Absicht ist, den Staat als einen bestimmten Organismus zu betrachten“ [1].
Hier haben wir zum zweiten Male das Stichwort der Romantik: der Staat ist ein Organismus.
„Der Gedanke war schon mannigfach vorgedacht worden: naturphilosophisch und ästhetisch von Goethe und Schiller, historisch von Herder; das logische Fundament hat ihm aber erst Kant gegeben, der ihn auch schon politisch verwendet. Er hat 1790 definiert: „Ein organisiertes Produkt der Natur ist das, in welchem alles zweck- und wechselseitig vermittelt ist — also nicht bloß Maschine ; denn die hat lediglich bewegende Kraft“; die Teile sind „nur durch ihre Beziehung auf das Ganze möglich“ ..., auch die Anwendung dieser Organisation auf den Staat findet sich bereits bei Kant“[2].
Der Staat als Organismus im spezifisch modernen Sinne wurde aber erst von Hegel verkündet, von dem Schelling den Gedanken übernommen hat[3]. Indessen scheinen die Romantiker die Anregung im wesentlichen von Schelling übernommen zu haben, der ein scharfer Gegner der französischen Revolution (a. a. O. S. 106) und der „wohlbekannten Aufklärerey“ (S. 149) [4] war. Freilich ist seine Bezeichnung des Staates als eines „absoluten Organismus“ nicht im mindesten naturwissenschaftlich gemeint : sie soll nichts anderes ausdrücken, als daß der Staat nicht als Mittel zu irgendeinem außerhalb seiner selbst liegenden Zwecke[5] aufgefaßt werden darf, sondern Selbstzweck ist, Selbstverwirklichung des „Absoluten“, das wir als, noch etwas intellektualistisch gefärbten, Verwandten von Schopenhauers „Willen“ zum Leben
[1] Lehre vom Staat, S. 2 Anmerkung.
[2] Heller, a. a. O. S. 90/91.
[3] Heller, a. a. O. S. 91, 132ff.
[4] Vgl. Falter, Staatsideale unserer Klassiker, S. 121.
[5] „Der Zweck ist so wenig der Schöpfer des Rechts oder des Staates, wie die Sonne damit definiert ist, daß sie ein Feuer sei, von frierenden Wilden angezündet, um die Glieder daran zu wärmen“ (Schmitt-Dorotic, Der Wert des Staates, S. 93).
[107]
und Toennies „Wesenswillen“ auffassen, und dessen Abstammung von Spinozas „Substantia sive Deus“ uns sehr wahrscheinlich ist [1].
Wir sind dem Ausdruck „Organismus“ schon bei Savigny begegnet; hier ist der Einfluß Schellings sicher bezeugt : die beiden Männer standen in freundschaftlichem Verkehr ; Savigny hatte Schelling in Jena kennen gelernt und seinen Freunden gegenüber den starken Eindruck geschildert, den er von Schellings Ideen empfangen hatte. Diese Ideen sind, soweit sie hierhergehören, die „Aufhebung des Kantischen Gegensatzes zwischen Geist und Natur, von Schelling bereits übertragen auf den Rechtsgedanken in der Weise, daß die Rechtsordnung als ,ein höheres Naturgesetz gleichsam eine zweite Natur', das Rechtsgesetz als eine Art Naturgesetz bezeichnet wird, worin sich der allgemeine Wille objektiviert. Ferner die Anschauung von der bewußtlosen Intelligenz“ (nature is wisdom without reflexion), „der blinden Zweckmäßigkeit, die eben das Gemeinsame zwischen Natur und Geist bildet, einer Lehre, der freilich schon Fichte nicht fremd, die aber erst bei Schelling zu voller Ausprägung gelangt ist ... Nicht nur als Vergleich, als heuristisches Prinzip sondern als dem Kern der Dinge näher führende Wahrheit erscheint, in Schellings Denken zentral, der Begriff des auf geistige Dinge übertragenen Organischen[2], der Organisation, deren Grundcharakter es ist, ,daß sie, aus dem Mechanismus gleichsam hinweggenommen, nicht nur als Ursache der Wirkung, sondern weil sie selbst beides zugleich vor sich selbst ist, durch sich selbst besteht'. Dieser Organismus der zweiten Natur, d. h. des Staates, als einer absoluten Rechtsordnung, ist für uns das Entscheidende. Hatte wohl Kant zuerst in technischer Schärfe dem Mechanischen in der Natur das Organische gegenübergestellt, ... so wird nun dieser Begriff auf die Verhältnisse des geistigen, besonders des staatlichen, Lebens durch Schelling übertragen, um einen teleologischen Entwicklungsprozeß unbewußt zielstrebsamer Kräfte zu rechtfertigen. Als organische Grundlage der gesamten Natur aber dient Schelling die Weltseele, seine Schrift ,Von der Weltseele, eine Hypothese der höheren Physik zur Erklärung des allgemeinen Orga-
[1] Wir bringen weiter unten eine Stelle, wo ganz spinozistisch von Substanz und Accidens gesprochen wird. Hier eine andere Parallele: Wir haben gezeigt, daß die Natur nicht um eines Zweckes willen handle ; denn jenes ewige und unendliche Seiende, welches wir Gott und Natur nennen, handelt nach derselben Notwendigkeit, nach welcher es da ist (Ethik, IV. Einl., S. 151).
[2] Er spricht vom „organischen Leib des Wissens“ (a. a. O., S. 83, 154, 158, 159); für ihn ist die „organische Auffassung“ die eigentlich philosophische, die von der „reinendlichen an und für sich aufgehoben wird, die an die Stelle die einfache Reihe des Mechanismus setzt, so wie an die Stelle der Konstruktion die Erklärung“ (S. 245). Er will, mystisch-verzückt, die beiden uns erkennbaren „Attribute“ der Substanz, Ausdehnung und Denken, in einem Akte des Schauens zusammen als die Einheit erkennen, die sie im Grunde sind.
[108]
nismus', ist es bekanntlich, durch die er 1798 zuerst seiner persönlichen Richtung unter Abfall von Fichte Ausdruck gegeben hat. Das erst später für die geschichtliche Schule festgebräuchlich gewordene Wort ,Volksgeist' rührt freilich nicht von Schelling her, sondern von Hegel. Daher erst ist dieses Wort von Puchta entnommen, erst auf diesem Umwege in die späteren Schriften Savignys eingeführt worden, wie Brie zutreffend dargelegt hat. Die Sache ist aber von vornherein bei Schelling wie bei Savigny vorhanden... . Durch die Schellingsche Weltseele einerseits, durch Savignys nationale Rechtsauffassung andererseits sind die beiden Elemente gegeben, die in der Bezeichnung Volksseele oder Volksgeist nur ihren zusammengesetzten Namen gefunden haben... . Kuno Fischer stellt Schellings Staatsauffassung folgendermaßen dar: „Der Staat ist ein Organismus, der nicht gemacht und fabriziert werden kann, sondern sich entwickelt und gliedert. Die Geschichte ist der Baumeister dieses Organismus, der Bildner dieses Kunstwerks, in welchem sich die göttliche Idee des Rechtes offenbart' [1]“. Es ist völlig gewiß, daß dieser Schellingsche Begriff des „Organismus“ zwar von naturwissenschaftlichen Vorstellungen ausgeht[2], daß er aber nicht im mindesten naturwissenschaftlich gemeint ist. Aber die Geistesgeschichte zeigt leider (wir haben einen solchen Fall soeben an dem Wort „Familie“ dargestellt), daß die Entwicklung viel mehr dem Klang als dem Sinn der Worte folgt, und so kann es nicht wundernehmen, daß der Schellingsche Begriff immer mehr ins Naturwissenschaftliche umgedeutet wurde: war es doch die Zeit, in der, nach den Triumphen der Mechanik, auch die biologischen Wissenschaften ihren Aufschwung zu nehmen begannen (wir denken hier vor allem an die Ausbildung der Entwicklungslehre durch Geoffroy St. Hilaire, Lamarck, Goethe und Oken) ; und stimmte doch die Auffassung mit der Neigung der Romantik zusammen, den Staat als ein naturwüchsig, „pflanzenhaft“, Gewordenes
[1] Landsberg, a. a. O. S. 215/6.
[2] Er findet die Einheit, die er sucht, im Organismus gegeben; er geht nicht vom Denken, sondern vom Leben aus, wie neuerdings Bergson: „Wie der Organismus.. . nichts anderes als die Natur im Kleinen und in der vollkommensten Selbstanschauung ist“ (a. a. O. S. 283). „Der Organismus ist es also, welcher Substanz und Accidens als vollkommen Eins, wie in dem absoluten Akt der Subjekt-Objektivierung, in Eins gebildet darstellt“ (S. 288). Über die Entwicklung des Begriffs des Organismus von Herder über Kant zu Schelling vgl. Quarch, a. a. O. S. 56ff. Seh.'s eigener Staatsbegriff ist nichts als eine Anwendung seiner Grundidee: „Der Staat ist in dem Verhältnis vollkommen, in welchem jedes Glied, in dem es Mittel zum Ganzen, zugleich in sich Zweck ist“ (44). „Alles Objektivwerden des Wissens geschieht nur durch Handeln, welches selbst wieder sich äußerlich durch ideale Produkte ausdrückt. Das allgemeinste derselben ist der Staat, der ... nach dem Urbild der Ideenwelt geformt ist“ (158). „Die vollendete Welt der Geschichte wäre demnach selbst eine ideale Natur, der Staat, als der äußere Organismus einer in der Freiheit selbst erreichten Harmonie der Notwendigkeit und der Freiheit“ (214).
[109]
zu begreifen. Freilich geht zuerst von Schelling „eine Verwilderung der Naturwissenschaft aus, ein Rückfall ins Phantastisch Konstruktive“ [1].
Bei dieser Rezeption erfuhr nun auch der Begriff der „Natur“ selbst eine Umdeutung, die beachtet werden will. Bisher bedeutete er die Natur des Menschen, so vor allem bei Aristoteles, wenn er die Familie als natürlich bezeichnet, weil es Sklaven von Natur gibt. Später denkt man bei dem Worte vor allem, wenn nicht allein, an die menschliche Seele mit ihren angeborenen Bedürfnissen und Trieben, in der Regel, so vor allem bei Spinoza, mit dem Nebensinn, daß sie irgendwie göttlichen Ursprungs, vielleicht sogar ein Teil des Göttlichen, also vernünftig sei. Sogar der skeptische Hobbes nennt die Natur „die Kunst Gottes“. Jetzt wird die Natur entgöttert; die Klage darüber erklingt tragisch aus Schillers „Götter Griechenlands“:
„Fühllos selbst für ihres Künstlers Ehre,
Gleich dem toten Schlag der Pendeluhr,
Dient sie knechtisch dem Gesetz der Schwere,
Die entgötterte Natur.
Morgen wieder neu sich zu entbinden,
Wühlt sie heute sich ihr eignes Grab,
Und an ewig gleicher Spindel winden
Sich von selbst die Monde auf und ab“.
Jetzt bedeutet das Wort „Natur“ immer mehr und immer ausschließlicher den Inbegriff der gesetzlich zusammenhängenden äußeren Erscheinungen, „das Dasein der Dinge, sofern es nach allgemeinen Gesetzen bestimmt ist“[2]; und zwar aus diesem Komplex nur das „Naturganze, das als Maschine angesehen wird“, „nach Gesetzen äußerlich genötigter wirkenden Ursachen“[3].
Diese Wandlung mitzumachen, lehnt Schleiermacher in der zuletzt angeführten Stelle ausdrücklich ab; es scheint uns wenigstens so, als wenn der Wortlaut nur so verstanden werden kann, daß eine neue, unsympathische Auffassung, auf die man sich nicht geradezu einlassen mag, abgewiesen wird. Aber die Wandlung der Bedeutung des Begriffs „Organismus“ scheint uns klar vorzuliegen.
Hier zweigt eine Entwicklungslinie ab, die zuletzt die romantische in die positivistische Doktrin einmünden läßt. Schon Schleiermacher selbst bezeichnet seine Staatslehre gleich zu Anfang als „Phsyiologie des Staates“. Etwas später (Schleiermachers Vorlesungen über den Staat wurden 1829 gehalten) erscheint Heinrich Leos Buch „Studien
[1] Landsberg, a. a. O. S. 353.
[2] Grundlagen zur Metaphysik der Sitten, Ausg. Reclam, S. 56.
[3] Grundlagen zur Metaphysik der Sitten, Ausg. Reclam, S. 76, vgl. Hasbach, a. a. O. S. 143.
[110]
und Skizzen zu einer Naturlehre des Staates“ [1] (1833). Es ist freilich wenig von Natur darin zu finden : es enthält weiter nichts als die, aller Romantik eigentümliche, Ablehnung der naturrechtlichen Vertragstheorie: „Der Staat ist unmittelbar mit dem Menschen gegeben, und wäre nur Eine Familie auf der Welt, sie bildete einen Staat ... und alle Attribute der Staatsgewalt fielen in den Kreis der Familie hinein. Eine Regel, eine in irgendeiner Hinsicht vorhandene Schranke des Subjekts, sei es auch nur ein, durch die auf irgendeinem Punkte wirklich vorhandene größere Kraft festgestelltes allgemeines Verhältnis, muß da sein, sobald Menschen sind, und alles gesellschaftliche Leben des Menschen fängt mit dem Staate an“[2].
Ungefähr gleichzeitig finden wir in Friedrich Julius Stahls (des berühmten Konvertiten und Schöpfers des Programms der deutschen konservativen Partei) Hauptwerk: „Die Philosophie des Rechts nach geschichtlicher Ansicht“ (1830) die Forderung, daß im Staate, „weil er zum Dienste eines Höheren, zum Dienste Gottes, vorhanden ist, alles Persönliche, Private, bloß Menschliche sich unterordnen und das Anstaltliche, das eigentlich Organische hervortreten muß“[3].
[1] Auch in die Jurisprudenz dringt diese Spielerei ein. Arnold bezeichnet seine Schriften als „physiologische Beiträge zur Natur der Rechtsverhältnisse“ (Landsberg, a. a. O. S. 761). L. nennt das ein „Mitmachen der damaligen naturgeschichtlichen Analogiemode“; es handle sich aber (sechsziger Jahre) schon nicht mehr um romantische Auffassung, die Begriffe „Volksgeist'· und „organisch“ würden scharf unter die Lupe genommen und als Schlagwörter befunden, mit denen man nichts mehr ausrichten könne. Noch Ihering spielt fortwährend mit diesen Begriffen: „anatomische und physiologische Betrachtung des Rechtsorganismus und seiner Aggregatzustände“, er will „eine Naturlehre des Rechts“ schaffen usw. (Landsberg, a. a. O. S. 792/3). In allen diesen Dingen kommt die Bodenlosigkeit der rein historischen Rechtsschule zum Ausdruck ; es hat denn auch nicht mehr lange gedauert, bis das Naturrecht in einem besseren, nicht mehr dogmatischen Sinne mit Leist sich wieder vorwagen durfte (Landsberg S. 836). Es gibt eben „Konstanten des Rechts“, die ihre Erklärung fordern und, wie Grotius sagt, als universal nur aus einem universalen Grunde erklärt werden können, und es ist auf die Dauer doch keine „Rechtswissenschaft ohne Recht“ möglich, auch nicht als „realpolitische Jurisprudenz“ (!) (Landsberg, S. 819, S. 824). Puchta „konnte das Völkerrecht nicht gebrauchen, weil ihm die Rechtsurquelle der Volksüberzeugung mangelte; zu dem von Savigny herangezogenen Surrogat einer (auf Stammes- oder Religionsverwandtschaft) beruhenden gemeinschaftlichen Rechtsüberzeugung hat er nicht greifen mögen“ (ib. 449). Gerber hat schon 1848/9 erkannt, „daß ein großer Teil des Privatrechts der Volksüberzeugung fern steht und die Bestimmung seiner Grenzen durch die bei Völkern ... immer in demselben Gleise sich offenbarende allgemein menschliche Idee der Gerechtigkeit empfängt“ (ib. S. 782).
[2] Zit. nach v. Below, Der Deutsche Staat des Mittelalters, S. 12/3.
[3] Zit. nach Gumplowicz, Gesch. d. Staatsth. S. 343. Auch Stahl entging dem Vorwurf nicht, den damals fast jeder zu hören bekam, der auch nur im mindesten ein allgemeines Recht anerkannte, dem Vorwurf, rationalistisch oder „pantheistisch“ zu sein. Stahl wagte es, von einer „über den Fürsten stehenden Staatsidee“ zu sprechen und zog damit das Mißfallen der um das „Berliner politische Wochenblatt“ gescharten Junker auf sich (Meinecke, Weltb., S. 244 Anm. Vgl. ib. S. 263ff.).
[111]
Wie schon aus dem Titel des Werkes hervorgeht, spielt auch hier die historische Rechtsschule und ihr Begründer Savigny eine Rolle. Außerdem hat Schelling starken Einfluß auf die geistige Erziehung Stahls gehabt [1].
In diesen Nebel schien bald darauf das Licht der großen umwälzenden Erkenntnis, der neueren Evolutionstheorie. Und damit wurde aus der „Physiologie des Staates“ bei Schleiermacher und der „Naturlehre“ bei Leo allmählich eine wirklich geschichtliche Naturlehre des Staates. Die Schule St. Simons wirkt gewaltig in die Weite und Tiefe. Sein Schüler Augustin Thierry schreibt auf Grund der von seinem Meister neu entdeckten Tatsache[2], daß die Staaten durch Eroberung und Unterwerfung einer völkischen Gruppe durch die andere entstehen, seine „Conquête de l'Angleterre“ (1825) und seine „Lettres sur l'histoire de la France“ (1827). Der andere große Schüler St. Simons, Auguste Comte, der schon vor Darwin Entwicklungstheoretiker war[3], wirkt stark auf Konstantin Frantz, wie wir gezeigt haben; und entweder Darwin unmittelbar oder Herbert Spencer mittelbar haben den ausgesprochenen Positivisten Hermann Post und den bedeutendsten Vertreter des „Organizismus“ in Deutschland, Schäffle, entscheidend beeinflußt[4]. Gleichzeitig wirkt von anderer Seite her der St. Simonismus durch Vermittlung Lorenz Steins und des zweiten Hegelschülers Karl Marx auf das deutsche Geistesleben ein, hilft eine sozialistische Staatslehre entwickeln und drängt auch von hier aus die bürgerliche Wissenschaft in die Defensive und zu erneuter Formulierung ihrer Begriffe und Systeme.
Mit den letzten Ausführungen sind wir vordeutend schon weit über die zeitliche Grenze der uns augenblicklich beschäftigenden geistigen Richtung, der bürgerlichen Romantik, hinausgegangen. Versuchen wir nun, den in allen den verschiedenen Auffassungen liegenden gemeinsamen Kern herauszuschälen:
Dieses Gemeinsame ist, daß sie sämtlich annehmen, der Staat habe sich aus einem „natürlich“ gewachsenen Urverband, Horde oder Familie (im nichtaristotelischen Sinne), rein durch immanente Kräfte, allmählich friedlich entwickelt. Selbstverständlich kann nicht bestritten werden und wird nicht bestritten, daß Eroberung, Gewalt, Unterwerfung usw. geschichtlich gewesen
[1] Bluntschli, a. a. O. S. 696. Eine sehr feine Würdigung des viel verkannten Stahl bei von Martin, a. a. O. S. 361.
[2] S. S. III, S. 150.
[3] S. S. I, S. 22.
[4] Zur Entwicklung der historischen und der „naturalistischen“ Richtung vgl. die ausführlichere Darstellung bei Gumplowicz, a. a. O. S. 346. Noch Röscher gibt seiner „Politik“ den Untertitel: „Geschichtliche Naturlehre der Monarchie, Aristokratie und Demokratie“.
[112]
sind, aber es besteht unausgesprochen die Überzeugung, daß sie geschichtlich nicht gewirkt haben [1]. Die Vorstellung scheint, wenn die Frage sich überhaupt gestellt haben sollte, etwa die zu sein, daß der „Organismus“ Staat zwar zuweilen von Feinden verwundet und von Parasiten gequält werden mag, daß solche Störungen aber sein Wachstum und seine Entwicklung wohl aufhalten, vielleicht sogar verkrüppeln, im schlimmsten Falle ihn sogar töten, aber den geprägten Typus nicht irgendwie ändern können.
Daß die Doktrin dogmatisch ist, kann nicht geleugnet werden. Denn sie entscheidet ein mit Notwendigkeit sich aufdrängendes Problem, ohne es zu diskutieren, einfach durch Übersehen oder Verschweigen. Hier wirkt, selbstverständlich optima fide, die „persönliche Gleichung“ aller dieser ausgesprochen bürgerlich eingestellten Theoretiker. Daß es keinen anderen Staat als den Klassenstaat geben kann, ist ihnen a priori so gewiß, wie es dem Sklavenhalter gewiß ist, daß es ohne das Institut, dem er seine Stellung und seine wirtschaftliche Existenz verdankt, keine haltbare Ordnung der Dinge geben kann[2], und wie es etwa dem heutigen Kapitalisten gewiß ist, daß es immer mehr Arbeiter geben muß, als die Industrie einstellen kann, und daß immer Kapital Zins hecken muß. Man kommt fast so schwer aus seiner Klassenhaut heraus, wie aus seiner leiblichen Epidermis.
Wir haben in der Grundlegung zu unserer „Theorie der reinen und politischen Ökonomie“ (S. 159ff.) gezeigt, daß alle bisherigen ökonomischen Lehren Klassentheorien waren. Daß das Gleiche für alle Theorien vom Staat gilt, hat Hasbach in einer prächtigen Ausführung gezeigt, die wir abgedruckt haben[3] ; hier mag eine ebenso eindrucksvolle Stelle aus Gumplowicz' „Geschichte der Staatstheorien“ folgen (S. 559): „Staatstheorien wurden immer nur als Mittel für Parteizwecke aufgestellt: nie im Interesse der Wissenschaft. Sie gingen immer hervor aus dem Kampfe der Parteien und feindlichen Gewalten ... Und wenn auch hie und da der gute Glaube vorhanden war, der Wissenschaft zu dienen ... : so stand doch die subjektive Befangenheit der Forscher einer objektiven Erkenntnis des Staates im Wege.“
Wir haben hier nur zu bemängeln, daß Gumplowicz, der Vertreter der Lehre vom „sozialpsychologischen Determinismus“ in seiner krassesten, in der Tat übertriebenen Gestalt[4], sehr inkonsequent der
[1] „Das Auffallendste dabei ist die allgemeine Abstraktion von dem geschichtlichen Charakter des Staates ... Gerade als ob dieser Charakter nicht zum Wesen des Staates gehörte, sondern der Staat an und für sich außerhalb der Geschichte stände, als etwas bloß Seiendes, während er doch immer etwas Gewordenes und Werdendes ist“ (Frantz, Naturlehre des Staates, S. 68).
[2] S. S. I, S. 974/5.
[3] S. S. I, S. 958/9.
[4] S. S. I, S. 606.
[113]
Mehrzahl der hier Beteiligten den guten Glauben abspricht: sachlich aber hat er unzweifelhaft Recht.
Die bürgerlichen Staatsdenker haben sich aus gutem Instinkt gehütet, das sehr heiße Eisen des hier auftretenden Problems anzufassen, etwa wie Ricardo sich instinktiv hütete, den Begriff des Monopols unter die Lupe zu nehmen [1]. Einmal gestellt, war das Problem nämlich auch schon so gut wie entschieden: daß Eroberung, Unterwerfung, Gewalt und Verbrechen aller Art wenigstens in sehr vielen Fällen die Grundlage der heutigen Klassenordnung in Gestalt des Eigentums und der sozialen Rangklassen geschaffen haben, wissen wir nämlich ganz genau. Und es scheint von vornherein nicht unwahrscheinlich, daß der Klassenstaat ohne diese von außen eingreifenden Kräfte sich überhaupt nicht, mindestens nicht so entwickelt hätte, wie wir ihn geschichtlich beobachten, und wie er uns als Gegenstand der Erklärung aufgegeben ist.
Um diesen peinlichen Konsequenzen auszuweichen (wir wiederholen, daß wir an der bona fides nicht einen Augenblick zweifeln), setzt die bürgerliche Romantik Staat und Gesellschaft gleich. Die Ansätze zu einer reinlichen Scheidung der beiden Begriffe, die schon das Mittelalter und später das Naturrecht geschaffen hatten, werden verschüttet[2].
Kein Zweifel, daß alle die enthusiastischen Attribute, die die Schule dem Staat andichtet, der Gesellschaft (oder der „Gemeinschaft“ im Sinne von Toennies) zukommen. Nur in der und durch die Gesellschaft wird das anthropoide Tier zum Menschen; nur in ihr und unter ihrem Schirm können Zivilisation und Kultur, Recht, Wirtschaft und Wissenschaft, Religion, Kunst und Philosophie erwachsen. Kein Zweifel, daß sie „ewig“ ist, daß sie mit dem Menschen im Sinne des homo sapiens zusammen geboren ist, wenn sie ihm nicht schon vorhergeht:
[1] S. s. III, s. 505.
[2] Eine Ausnahme macht Wilh. v. Humboldt, der ja überhaupt mehr der individualistischen als der romantischen Richtung zuzuzählen ist, und der vor allem kein Staatsanbeter war. Er unterscheidet zwischen dem Staat und dem „Nationalverein“ (ob hier nicht vielleicht eine Linie zu Stirner führt ?), die „wie eng sie auch miteinander verwebt sein mögen, niemals miteinander verwechselt werden sollten. Wenn die Staatsverfassung den Bürgern ... ein bestimmtes Verhältnis anweist, so gibt es außerdem noch ein anderes, freiwillig von ihnen gewähltes unendlich mannigfaltiges und oft wechselndes. Und dies letztere, das freie Wirken der Nation untereinander, ist es eigentlich, welches alle Güter bewahrt, deren Sehnsucht die Menschen in eine Gesellschaft führt“. (Meinecke, Weltb., S. 41). So werden „Nation“ und „Gesellschaft“ im Gegensatze zum Staate für ihn Synonyme (45). Aber hier ist nicht der massive Gegensatz, den die soziologische Auffassung zwischen den beiden Phänomenen konstatierte, nicht das Verhältnis zwischen einer civitas dei et diaboli, sondern, wie Meinecke feinsinnig bemerkt, mehr zwischen der Realität, die der Staat verkörpert, und dem „leichtesten und körperlosesten“, das man sich vorstellen kann, zwischen „Lebensmacht“ und „Lebensgeist“ (43).
[114]
denn nur in der Tierhorde kann die Sprache, des Menschen geistiges Werkzeug, und die Hand, sein körperliches Werkzeug, entstanden sein [1]. Kein Zweifel, daß die Gesellschaft von Natur ist, erwachsen aus dem Wesenwillen, Schellings „Absolutem“; kein Zweifel sogar, daß sie göttlich ist, wenn wenigstens die gut begründete Anschauung[2] gelten darf, daß Gott nichts ist als die ins Transzendente erhobene, auf den Himmel projizierte menschliche Gesellschaft. „Sie ist ,der Gott', wie Hegel sagt, ,ewig' von Anfang an und in alle Zukunft ,lebendig', der Schöpfer und .Vater' des Einzelmenschen, als Naturwesen wie als Vernunftwesen, die Urquelle aller Sittlichkeit, allen Rechts und aller Ordnung, die strafende Macht für jeden Bruch von Sitte, Recht und Ordnung, der geheime, unbestechliche Wächter in jeder Brust, das Gewissen“[3].
Indem man alle diese Attribute auf den Staat übertrug, heiligte man ihn, erhob ihn über alles Menschliche weit hinaus — und konnte auch die Klassenordnung mit allen ihren Schäden rechtfertigen. Ist doch nichts Irdisches vollkommen, bleibt doch überall „ein Erdenrest, zu tragen peinlich“. Keine einzige „Idee“ verwirklicht sich ja ohne häßliche Mängel: warum sollte die Idee des Staates sich vollkommen verwirklichen ? ! Wie er auf jeder Stufe der Entwicklung ist, so ist er so vollkommen, wie das eben nur möglich ist; er ist ja ein „Organismus“, der pflanzenhaft unter der Leitung heiliger Kräfte wächst. Und zu der Natur dieses Organismus gehört eben, daß er Klassenherrschaft ist; wenn man sonst überall die Deduktionen der Naturrechtler abwies und auch die auf dem gleichen Boden erwachsene Nationalökonomie des französischen und britischen Liberalismus mit Hohn und Spott überhäufte: in dieser einen Beziehung hatte man nichts zu bemerken und zu kritisieren: man nahm an, was sie gelehrt hatten, wenn auch nicht die Prämissen, so doch die Konsequenzen.
Ein einziges Beispiel! Fichte beschreibt folgendermaßen, wie eine Vielheit von Personen „rechtgemäß“ über die Sachenwelt verfügt: „Stellt euch einen Haufen Menschen vor, die mit Ackergerät und Zugvieh auf einer wüsten unangebauten Insel ankommen. Jeder setzt seinen Pflug in die Erde, wo er will; wo der seinige steht, kann kein anderer stehen. Jeder ackert um, was er kann, und wer am Abend das größte Stück urbar gemacht hat, wird das größte Stück rechtlich besitzen. — Jetzt ist die ganze Insel umgeackert. Wer den Tag verschlafen hat, wird nichts besitzen, und das von Rechts wegen“[4].
[1] S. S. I, S. 85, 274.
[2] S. S. I, S. 392 (Hegel), 420ff. (Simmel).
[3] S. S. I, S. 393.
[4] Zit. nach Metzger, a. a. O. S. 141/2. Zu Fichtes Vorstellungen über die organische Staatsidee vgl. Bluntschli (a. a. O. S. 411).
[115]
Hier haben wir das Gesetz der ursprünglichen Akkumulation mit allen seinen Kennzeichen, so wie es die naturrechtliche Schule ausgebildet, und wie es am klarsten Turgot definiert hat: der Ursprung der gesellschaftlichen Ungleichheit aus der Verschiedenheit der wirtschaftlichen Tugend; die Supposition, daß im Urzustände bereits das Interesse bestehe, möglichst viel Land zu okkupieren; die ungeheuerliche Überschätzung der auf diese Weise möglichen Unterschiede des Bodenbesitzes; und schließlich und hauptsächlich: die weitere Supposition daß das Land alsbald „voll besetzt“ sei. Jede einzelne dieser Annahmen ist handgreiflich falsch. Das haben wir ausführlich bereits nachgewiesen [1]. Wir werden diesen Nachweis in Kürze wiederholen. Zuvor aber ist noch der zweite Quellfluß des Pseudogesetzes der ursprünglichen Akkumulation aufzuweisen, der aus der proletarischen Staatsidee stammt. Darunter wollen wir hier ausschließlich den Marxschen Sozialismus verstehen; wir lassen es ununtersucht, ob es außer ihm noch andere Formen dieser Denkweise gibt: es genügt uns, zu wissen, daß sie auf die heutige Auffassung, mit der wir kritisch abzurechnen haben, die allgemeine Lehrmeinung von der Entstehung der Klassen, keinen erkennbaren Einfluß gehabt haben.
C. Die proletarische Staatsidee.
Die Staatsauffassung des Marxismus ist, wie jede große Theorie, eine Synthese der vorhergegangenen Lehren. Wir erkennen in ihr drei verschiedene Wurzeln: eine, die aus der jungen Soziologie[2], eine, die aus der Aufklärung, und eine, die aus der Romantik und Nachromantik stammt. Oder vielmehr: jede dieser Wurzeln ist an sich noch ein Doppelgebilde, selber aus zwei Elementen zusammengewachsen.
a) Die soziologische Wurzel. (Staat und Gesellschaft.)
Die beiden Wurzeln, die aus der Soziologie in die Marxsche Staatslehre eingegangen sind, stammen einerseits von St. Simon und den St. Simonisten entweder unmittelbar oder über Lorenz Stein mittelbar[3] ; und andererseits von seinem Meister Hegel.
Daß die westeuropäische Soziologie die Synthese von Aufklärung und Romantik ist, haben wir ausführlich dargestellt. Sie übernimmt
[1] S. S. III, S. 214ff.
[2] Daß Marx' Größe vor allem in seiner konsequent soziologischen Einstellung zu den menschlichen und insbesondere den ökonomischen Dingen liegt, haben wir immer mit Nachdruck betont (z. B. S. S. III, S. 849). Der Gegenstand ist vortrefflich und erschöpfend behandelt von Max Adler; Die Staatsauffassung des Marxismus, S. 17, 19, 20, 31ff.
[3] S. S. I, S. 41f.
[116]
den „Universalismus“ der Romantik, der vom Ganzen der Gesellschaft und seinem „notwendigen Consensus“ zu den Teilen vorgeht, und damit sein „irrationales“ Element. Aber sie behält den Rationalismus als die einzig mögliche Methode des Denkens bei [1].
Das gleiche haben wir für Hegel festgestellt[2]. Zuerst stark romantisch angehaucht, ist er in seinen späteren Arbeiten zu jenem gemäßigten Rationalismus zurückgekehrt.
Aus dieser soziologischen Einstellung hat die sozialistische Romantik denjenigen Zug erhalten, der sie am entscheidendsten von der bürgerlichen trennt: die Unterscheidung von Staat und Gesellschaft.
Wir haben uns in unserer allgemeinen Soziologie über die Geschichte dieser Unterscheidung schon kurz geäußert. Hier interessiert uns der Gegenstand in einer anderen Ansicht:
Es sind drei verschiedene Aussagen über das Verhältnis der beiden Begriffe möglich, die sorgfältig geschieden sein wollen: zwei „theoretische“ und eine „praktische“.
Von den theoretischen wollen wir die erste die „klassifikatorische“ nennen. Man kann den Staat als eine bestimmte Form der Gesellschaft auffassen, als Unterbegriff, der der Gesellschaft als seinem Oberbegriff untergeordnet ist. Wenn wir z. B. die Reihe der „Rahmengruppen“ aufstellen, so erhalten wir die Unterarten, die zugleich als der geschichtliche Stammbaum erscheinen: Horde, Hordenverband, Stamm, Stammesverband, Staat. Oder wir kontrastieren, noch weiter schreitend, die über die Rahmengruppen hinausreichenden menschlichen Verbände mit jenen, etwa die katholische Kirche, oder die „Völkerfamilie“, oder die „ Welt wir tschaf tsgesellschaf t“ : dann erscheint der Staat nicht nur als der Unterbegriff, sondern auch gleichzeitig als der kleinere Kreis, der größeren „eingeschrieben“ ist. Diese naheliegende Auffassung kann sich auf die Autorität des Aristoteles stützen, der den Staat als eine Art der „Koinoneia“ bezeichnet hat; ihm folgend hat dann Cicero den Begriff der societas „als alle organisierten menschlichen Gemeinverhältnisse umfassend aufgestellt“[3].
Die Konstatierung dieses Verhältnisses zwischen Staat und Gesellschaft ist noch nicht Wissenschaft, sondern nur Vorstufe zu einer
[1] S. S. 1, s. 6.
[2] S. S. I, S. 40. Vgl. Rothacker Einl. in d. Geisteswiss. Tübingen, 1920, S. 120/4. Vgl. ferner Metzger, a.a.O. S. 309: „zu einem höheren Rationalismus nicht des , Verstandes' sondern der .Vernunft', die zwar dem Rationalen die Herrschaft, aber auch dem Romantisch-Irrationalen eine höchst wichtige Teilfunktion zuerkennt“.
[3] Jellinek, a. a. O. S. 85. Rein klassifikatorisch behandelt das Verhältnis z. B. Georg v. Mayr (Begriff und Gliederung der Staatswissenschaften, S. 5), kommt aber sofort in eine tragikomische Verlegenheit, weil ja doch Staat und Gesellschaft in Konflikte geraten können: Ober- und Unterbegriff, wie etwa Löwe und SaugetierI Das ist dann eine „pathologische Sondererscheinung“.
[117]
solchen, ist eigentlich nur eine Terminologie, bestenfalls Beginn einer Deskription. Wirklich wissenschaftlich ist erst die zweite, theoretische Unterscheidung, die wir die „methodologische“ nennen wollen.
Wenn wir „den“ Staat als Erfahrungsobjekt betrachten und nach seinen verschiedenen Kennzeichen verschiedene Erkenntnisobjekte daraus bilden, so erhalten wir, wie ausführlich dargestellt, den juristischen und den soziologischen Staatsbegriff, indem wir einmal die Rechtsform, und das andere Mal den geschichtlichen Inhalt des Staates herausheben und zum System ordnen. Das ist der Gegensatz, den namentlich Kistiakowski herausgearbeitet hat [1].
Dieser methodologische Gegensatz ist es, der den Unterscheidungen der Naturrechtler hauptsächlich zugrunde liegt. Ihnen „fällt unter dem Einfluß des aristotelischen Gedankenkreises der Staat mit der societas civilis zusammen, die als andere Art derselben Gattung“ (hier sehen wir die Klassifikation deutlich) „neben sich nur die societas domestica kennt. Es ist aber auch im Naturrecht eine leichte Differenz zwischen Staat und bürgerlicher Gesellschaft, trotz der Gleichsetzung beider, wahrzunehmen. Namentlich seit Hobbes wird nämlich der Staat...
[1] Gesellschaft und Einzelwesen, Drittes Kapitel: Staat und Gesellschaft. Felix Rachfahl (Staat, Gesellschaft, Kultur und Geschichte) trägt eine Mischung der klassifikatorischen und methodologischen Unterscheidung von Staat und Gesellschaft vor. Er stellt zunächst fest, daß „der Staat eine besondereForm der Gesellschaft ist“ (3). Dann unterscheidet er zwischen losen Gruppen einerseits und geschlossenen Verbänden mit besonderen Organen andererseits (13) und kommt schließlich zu dem Ergebnis: „Der Staat ist somit derjenige Verband, welcher auftritt mit dem Anspruch der Ausübung der Gewalt in oberster Instanz unter Anwendung einfacher Machtmittel behufs Wahrnehmung oder, präziser gesagt, behufs Regulierung der Totalität der Zwecke, welche die in ihm vorhandenen Personen und Gesellschaften aller Art verfolgen und behufs Ausgleiches der Konflikte, die sich daraus ergeben können“. Dazu die Anmerkung: „Es kommt nicht darauf an, ob das Gesamtinteresse dabei wirklich wahrgenommen wird oder ob die Handhabung des regulativen Prinzips in der Praxis auf die Wahrnehmung eines spezifischen Klasseninteresses, d. h. des Sonderinteresses einer einzelnen Gesellschaftsgruppe oder selbst einer einzelnen Person hinausläuft.“ Wir müssen leider bekennen, daß wir immer noch nicht wissen, was der Staat nach der Meinung dieses Autors ist; es scheint uns, daß die Anmerkung den Text aufhebt; und wenn wir uns an den Text allein halten, so werden wir eine ganze Anzahl unzweifelhafter „Staaten“ vorstellen, deren einziger Zweck die Erpressung von Tribut von den Untertanen ist. Eine von einem Historiker gegebene Definition des Staates sollte doch eigentlich auch diesen Fällen genügen. Rachfahl ist mit den soziologischen Anschauungen über den Staat nicht einverstanden, aber er zitiert niemand als Toennies' „Gesellschaft und Gemeinschaft“, und eine kurze Arbeit von Hermann Kantorowitz. Das erstgenannte Buch ist nicht eigentlich soziologisch, sondern sozialphilosophisch aufzufassen ; und Kantorowitz wird selbst nicht den Anspruch darauf erheben, der repräsentative Vertreter der heutigen Soziologie zu sein. Wir meinen, jemand, der sich gezwungen fühlt „die Kategorien der bisherigen Gesellschaftslehre auf ihre Stichhaltigkeit hin zu prüfen“, sollte doch noch einige Literatur mehr heranziehen; sie ist reich genug.
[118]
als Person aufgefaßt, in der die Gesellschaft ihre Vollendung erreicht [1]“ Das geschieht, fügen wir hinzu, weil bei Hobbes die juristische Auffassung des Staates ihren Gipfel ersteigt. Für ihn beginnt ja erst mit der juristischen Konstruktion der Zustand der Vernunft, „denn der Naturzustand (Freiheit) verhält sich zum bürgerlichen (Unterwerfung) wie die Begierde zur Vernunft, wie ein wildes Tier zum Menschen“[2] Dieser Naturzustand „ist bei denen, die weder regieren noch regiert werden, Anarchie oder Kriegszustand“[3]. Also erst Unterwerfung und Regieren bzw. Regiertwerden beenden den Naturzustand, der noch nicht einmal eine „Gesellschaft“ genannt werden kann. Wie ausschließlich Hobbes das juristische Erkenntnisobjekt im Auge hat, kann man daran erkennen, daß er den alten Organizismus, der „den Staat und die Bürger mit den Menschen und seinen Gliedern verglich und sagte, daß der Souverän im Staate sich zu diesem wie das Haupt zu dem ganzen Menschen verhalte, abweist und dagegen sagt, „daß der Souverän, sei er ein Mensch oder eine Versammlung, sich zu dem Staate nicht wie das Haupt, sondern wie die Seele zum Körper verhält. Denn durch die Seele hat der Mensch einen Willen“[4]. Das ist der ausgesprochen juristische Gesichtspunkt: den Staat als das, mit einem einheitlichen, Recht setzenden und Recht schützenden Willen ausgestattete, Gebilde zu betrachten.
Ist bei Hobbes vor der Staatsgründung durch den Unterwerfungsvertrag eine eigentliche Gesellschaft noch gar nicht vorhanden, sondern nur eine Vielheit von atomisierten Individuen, so muß das spätere Naturrecht schon juristisch eine dem Staate voraufgehende Gesellschaft konstruieren, weil vor dem Unterwerfungsvertrag mindestens der Unionsvertrag abgeschlossen werden muß, durch den „eine, wenn auch der Verfassung und der leitenden Gewalt entbehrende Gesellschaft entsteht“[5]. Mit der dargestellten Wendung des Naturrechts aus dem Juristischen ins Historische tritt auch hier ein Wandel auf: Locke unterscheidet zwar noch nicht civil und political society, aber doch schon society und government[6]. Dann „vertritt der Schotte Ferguson eine Lehre, welche den Staat zu bereits früher vorhandenen menschlichen Gemeinschaftsverhältnissen geschichtlich hinzutreten läßt. Sodann hat ... Schlözer die logische Konsequenz der Naturrechtslehre gezogen
[1] Jellinek. a. a. O. S. 85.
[2] Vom Menschen und vom Bürger, S. 165.
[3] Vom Menschen und vom Bürger, S. 243.
[4] Vom Menschen und vom Bürger, S. 150/1; vgl. Leviathan, Einleitung: „Is qui summam habet potestatem pro Anima est, corpus totum vivificante et movente“ (a. a. O. S. I). Das Bild stammt bereits von Thomas v. Aquino (Bluntschli, a. a. O. S. 6); Pufendorf hat es später von Hobbes übernommen (ib. S. 152).
[5] Jellinek, a. a. O. S. 85.
[6] A. a. O. § 211; vgl. Barth, Phil. d. Gesch. als Soz. S. 251 Anm.
[119]
und als erster deutscher Schriftsteller Staat und Gesellschaft zu unterscheiden getrachtet“ [1].
Mit dieser Wendung ins Historische ist nun notwendig der Übergang zu der dritten, der praktischen Reihe von Aussagen verknüpft, die über den Staat gemacht werden können. Denn sobald er nicht mehr als juristisches System, sondern als geschichtliche Tatsache beobachtet wird, entsteht notwendig die Frage, ob dieser, uns in diesem Moment gegebene Staat, dieses government, und weitergreifend die allgemeinere Frage, ob „der“ Staat überhaupt das ist, was er sein sollte. Er wird an irgendeinem Ideal gemessen.
Nur von dieser Unterscheidung zwischen dem Staate, wie er ist, und dem Staate, wie er sein sollte, kann in einer soziologischen Untersuchung des Staates die Rede sein. Die klassifikatorische Unterscheidung gehört in einen kurzen Satz der Grundlegung der „Allgemeinen Soziologie“[2], und die methodologische Unterscheidung in die Begriffsbestimmung der Soziologie des Staates — wo wir sie denn auch vorgenommen haben.
Wir haben gesehen, daß diese Gegensetzung jedesmal auftritt, wenn der Staat mit einer anderen gesellschaftlichen Macht, sei es die Kirche, sei es der dritte Stand, in Konflikt gerät. Aber Augustin, Gregor VII. und die Monarchomachen unterscheiden nur zwischen dem guten und dem schlechten Staat, der civitas caelestis et terrena, dei et diaboli, der Idee und ihrer irdischen Verwirklichung. Noch die Physiokraten stehen auf diesem Standpunkt: Quesnay stellt den „ordre positif“ dem „ordre naturel“ entgegen.
Da tut Jean Jacques Rousseau einen weiten Schritt der wahren Unterscheidung entgegen. Er trennt terminologisch, was bekanntlich fast immer das Entscheidende ist ; und er scheidet auch sofort inhaltlich Staat und Gesellschaft. Und zwar dient ihm dazu der Begriff der „partikulären Interessen“, den er von einer anderen, bisher von uns nur gelegentlich gestreiften Richtung der Staatswissenschaft übernommen hatte: der Lehre von der Politik des wirklichen, des historischen Staates. Dieser Ideenrichtung müssen wir nun für kurze Zeit unsere
[1] Jellinek, a. a. O. S. 85. Heller bemerkt zu der Stelle, daß schon vor Schlözers allgemeinem Staatsrecht (1793) Staat und Gesellschaft scharf unterschieden wurden. „Kaum auf Schlözers Einfluß wird es sich zurückführen lassen, daß schon im Jahre 1795 eine bürgerliche Deputation des Kreises Hagen dem Freiherrn vom Stein u. a. nachrühmt, er habe hier eine Besteuerung eingerichtet, die dem Staate seinen Bedarf und der Gesellschaft den Genuß der möglichsten bürgerlichen Freiheit gewähre.“ (Nach Lehmann, Freiherr vom Stein I, S. 133, berichtet von Heller, a. a. O. S. 65, Anmerkung 19.) Hoetzsch (Rußland S. 300/1) teilt mit, daß die staatliche Bürokratie, der die Idee einer Selbstverwaltung im englischen oder preußischen Sinne fremd, ja widerwärtig war, in dem Zemstvos „Organe der Gesellschaft“ erblickte.
[2] S. S. I, S. 465.
[120]
Aufmerksamkeit zuwenden, zumal die Lehre vom überhistorischen Philosophenstaat von hier aus die mächtigsten Anregungen empfangen hat, in Widerspruch und teilweiser Anerkennung, in äußerlichem Synkretismus und wirklicher Synthese [1].
1.1. Staatsräson und „Interessenlehre“. (Die politischen Interessen.)
Der Denker, dessen gewaltige Schriften bis tief in das 19. Jahrhundert immer wieder den größten Theoretikern und Praktikern der Staatswissenschaft und Staatskunst zugleich ein Stein des Anstoßes und ein Schleifstein des Geistes — und ein unerschöpfliches Arsenal praktischer Klugheit gewesen sind, ist Niccolò Machiavelli, einer der zeitlich und rangmäßig ersten Köpfe der Renaissance (1469—1527).
Er war „ein Heide, der dem Christentum den bekannten schweren Vorwurf machte (Discorsi II, 2.), die Menschen demütig, unmännlich und schwach gemacht zu haben“[2], völlig losgelöst von christlicher Religion, trotz „seines äußerlichen Respekts vor der Kirche“ und aller christlichen Sittlichkeit: ein echter Sohn jener gewaltigen und gewaltsamen Zeit, in der das Individuum sich um jeden Preis durchzusetzen suchte.
In diesen Kämpfen stand er an erster Stelle als hoher Beamter seiner Vaterstadt, in alle Geheimnisse der Staatskunst seiner Zeit eingeweiht, auf Gesandtschaften mit den Verhältnissen der anderen europäischen Staaten bekannt geworden. Was er als Historiker und als Lehrer der Staatskunst geleistet hat, ist von hier aus angeregt und befruchtet worden: er war kein Aktenwurm, sondern wie Thukydides ein Fachmann der Politik, der über den Staat und die Staaten erst schrieb, als er zur Muße gezwungen wurde.
Was ihn vor allem trieb, war die große Not seines Vaterlandes. „Die Katastrophen, die über Italien seit 1494 durch den Einbruch der Franzosen und Spanier, durch den Untergang der Selbständigkeit Neapels und Mailands, durch die sich überstürzenden Wechsel der Staatsform in Florenz und vor allem durch den übermächtigen Gesamtdruck des Auslandes auf die ganze Apenninhalbinsel kamen, reiften den politischen Geist zu jener leidenschaftlichen Kraft, Tiefe und Schärfe, die in Machiavelli sich offenbarte“[3].
In solcher Zeit spekuliert der Tätige nicht, sondern versucht, dem Unheil in die Speichen zu fahren. Was nützt es, über den besten Staat
[1] Vgl. Hasbach, a. a. O. S. 32 über die Anregungen, die Thomasius u. a. durch den Kampf mit den „Statistae“ empfingen, Politik und'Naturrecht zu sondern, vgl. 42.
[2] Meinecke, a. a. O. S. 39.
[3] Meinecke, a. a. O. S. 37.
[121]
für alle Welt zu philosophieren: Florenz, die Vaterstadt, Italien, das Vaterland, gesehen mit den Augen der Renaissance, d. h. im Lichte der alten Römerherrlichkeit, das soll erst einmal ein Staat werden, der leben kann, ein wirklicher, geschichtlicher Staat, ein Nationalstaat. Dann wird man vielleicht die allmenschlichen Ideale hervorholen und betrachten dürfen: jetzt, in der höchsten Not, gibt es nur eines: mit allen, aber auch mit allen Mitteln, der Fremdherrschaft ledig zu werden, den eigenen freien Staat zu erbauen. „Da die Ursache der Niederlage gegen Frankreich in der politisch-militärischen Überlegenheit gesehen wird, so muß ein Fürst kommen, den Staat zu retten, ein Fürst, der nicht den alten Geschlechtern entstammt, ein neuer Herrscher, der durch die Bewaffnung der Bauern erfolgreich Widerstand leistet und die Ordnung durch Niederhaltung des Adels wiederherstellt. So spekuliert über Mittel und Ziele der Politik der „Philosoph der Politik“ dieser Zeit: Machiavelli“ [1].
Mit allen Mitteln! Man wird anfangs sehr schwach sein, also wird man sich, da die Kraft mangelt, um so mehr der List bedienen müssen: „vulpinari cum vulpibus“. Man wird zwischen den großen Mächten, Spanien-Österreich und Frankreich, zu lavieren haben, mit Verträgen, die immer dem zurzeit Schwächeren zuhilfe kommen, um sich Vorteile auszumachen, und dann wieder dem anderen mit gleichem Erfolge dienen. Treulosigkeit ? Not kennt kein Gebot ! Sie sind nicht besser, nur stärker. Fortuna, das Weib, ist tückisch : also muß es auch die männliche „virtù“ sein[2], das aktive Heldentum, das sich für eine heilige Sache durchsetzen will und muß[3]. Um stark zu werden, muß der Fürst die Granden niederwerfen, die gentilhuomini, die jeder Republik und jedem Lande verderblich sind, besonders, wenn sie „Burgen und Söldner haben, wie es solche in Neapel, Rom, in der Romagna, und der Lombardei so viele gibt... . Solche Leute sind Gegner jeder civiltà; in solchen Staaten ist es am besten, wenn ein Königtum aufkommt, um den Ausschreitungen der Feudalen einen Zügel anzulegen“ (Discorsi I, 55). Sie sind mächtig? Ja aber, sie sind so schlecht und verrucht und dem Lande so verderblich, daß, gerade weil sie so mächtig sind, jedes Mittel erlaubt ist, um sie niederzuwerfen: so rechtfertigt er den Borghia, den Cesare, der wirklich alle Mittel des Verrats, der
[1] Salomon, a. a. O. S. 459.
[2] Meinecke, a. a. O. S. 46.
[3] Wie „zwangsläufig“ (Meinecke) diese Realpolitik in der Tat ist, darüber ein Zeugnis aus einer ganz anderen Welt. Hillebrandt (Altindische Politik, S. 35) schreibt: „Merkwürdig ist Abschnitt 12,80,1 ff. wo Bhîsma unter den Freunden des Königs erst an letzter Stelle den Rechtskundigen (dharmâtman) nennt, der 1 . . von Dingen, die ihm nicht gefallen könnten, nichts erfahren solle. Denn der Weg der Könige, die auf Sieg ausgehen, führe über Recht und Unrecht“. Über das Dharma und die übrigen arischen Urrechte vgl. Vinogradoff I, S. 367.
[122]
Untreue, des Mordes anwendete, um den italischen Staat seiner Familie zu gründen.
Gewiß „fürchterlich und erschütternd“ [1], aber fürchterlich und erschütternd war auch die Zeit, in der sogar ein Papst, Sixtus V., wie Ranke berichtet, „große Zufriedenheit empfand“, als eine ganze Räuberbande, deren seine Beamten nicht habhaft werden konnten, durch List vergiftet wurde : man ließ sie einen Transport Nahrungsmittel abfangen, die den tödlichen Stoff enthielten[2]. Eine Zeit, in der kein menschliches noch göttliches Gebot mehr galt : kann man es dem Manne übelnehmen, wenn er den Menschen für böse hält und danach handelt ? „Wie alle politischen Schriftsteller beweisen, ... muß der Ordner eines Staatswesens und der Gesetzgeber davon ausgehen, daß alle Menschen böse sind und ihrer bösen Gemütsart folgen, sobald sie Gelegenheit dazu haben“[3]. Und von hier aus kann er wirklich zu keinem anderen Schlüsse kommen, als dem: „Jemand, der es darauf anlegt, immer moralisch gut zu handeln, muß unter einem Haufen, der sich daran nicht kehrt, zugrunde gehen“[4]. Also „kann ein kluger Fürst sein Wort nicht halten, wenn die Wahrung des Versprechens sich gegen ihn selbst kehren würde, und die Ursachen, die ihn dazu bewogen haben, nicht mehr bestehen. Wenn die Menschen insgesamt gut wären, so wäre das ein schlechter Rat; da sie aber nicht viel taugen und dir ihr Wort auch nicht halten werden, so brauchst auch du es ihnen nicht zu halten; und ein Fürst wird ja immer einen guten Vorwand zu finden wissen, wenn er es bricht“.
Und so wird Machiavelli der Schöpfer der wissenschaftlichen Realpolitik: „Meine Absicht ist, für den, der etwas davon versteht, etwas Nützliches zu schreiben; daher scheint es mir schicklicher, die Wahrheit so darzustellen, wie sie sich in Wirklichkeit findet ..., weil ein so großer Unterschied ist zwischen dem, was geschieht, und dem, was geschehen sollte“ (Princ. cap. 19). Er will nicht „Fürstentümer und Republiken ersinnen, wie sie nie gesehen worden sind“. Der Theorie des besten Staates tritt die Kunstlehre des wirklichen Staates mit vollem Bewußtsein zur Seite und zugleich entgegen: die Lehre von der Staatsräson und den politischen Interessen.
Oncken macht in seiner vortrefflichen Einführung zur „Utopia“
[1] Meinecke, a. a. O. S. 49. Rousseau (contrat social, III, 6) nennt Machiavellis „Principe“ das „Buch der Republikaner“... Er glaubt, M. habe unter der Maske des Absolutisten die Grundsätze der Freiheit vertreten und den Despotismus an den Pranger stellen wollen (Anm. dazu). So erklärt er sich den auffallenden Gegensatz zu den „Discorsi“.
[2] Meisterwerke VI, S. 432.
[3] Polit. Gespräche S. 15.
[4] Principe cap. 19.
[123]
des Monus darauf aufmerksam, daß diese unendlich einflußreiche Schilderung des besten Staates im gleichen Jahre mit dem „Principe“ erschien, in demselben Jahre, in dem auch Martin Luther zum ersten Male auftrat. „Machiavelli sieht den Staat von oben, als Kunstwerk in der Hand seines Schöpfers; Monis geht von dem Individuum und seinen unveräußerlichen Rechten aus. Machiavelli hält die Menschen von Natur für böse und sieht in dem Namen der Freiheit nur einen Vorwand für Aufstände... . Monis dagegen hält den Menschen von Natur für indifferent, aber erziehbar zum Guten, und sein Optimismus lehrt ihn, immer an dieser Erziehung zu arbeiten und an die Freiheit als ein heiliges Gut zu glauben; mit seinem tiefen sittlichen Triebe erfaßt er den Ernst und das Verpflichtende der sozialen Frage seiner Zeit“ (S 38/9). Und er erkennt wenigstens den Hauptgrund dieser tiefen Verschiedenheit der Auffassung in der verschiedenen Lagerung der „Gruppe“, der die beiden Denker angehören: Machiavelli im zerrissenen, von Fremden geschändeten und ausgebeuteten Italien, Monis auf der sturmfreien Heimatinsel „mit unbestrittener nationaler Staatseinheit“: und dennoch sah er sogar sich in seiner Utopie gezwungen, der Machtpolitik gewisse Konzessionen zu machen : Englands harte äußere Politik des Gleichgewichts auf dem Kontinent, auf dem es sich stets einen „Degen“ hält, ist auch die seiner Utopier [1].
Meinecke zeigt in seiner meisterhaften Untersuchung: „Die Idee der Staatsräson“[2] die Entwicklung und den Einfluß der von Machiavelli so kühn ausgesprochenen Gedanken. Jeder folgende Staatslehrer hatte sich mit ihm auseinanderzusetzen und keiner ist von ihm unberührt geblieben.
Das Schlagwort von der ragione di stato muß sich seit den zwanziger Jahren des 16. Jahrhunderts allmählich eingebürgert haben (58). Schon Guicciardini, der Machiavelli so nahe stand, sprach einmal von ragione e uso dello stato; und um die Mitte des Jahrhunderts bezeugt der Erzbischof und Humanist Giovanni della Casa, daß es sich um ein fertiges Schlagwort handelt. Fünfzig Jahre später sprachen schon alle „Sackträger“ davon (147).
Schon Bodins Buch über den Staat, das 1576 zuerst französisch erschien, machte den Versuch, die Machiavellischen Gedanken vom Standpunkte der neuen gesellschaftlichen Mächte aus zu widerlegen. Die Rechtsidee des Staates galt es, herauszuarbeiten, ihn auf sich selbst zu stellen, frei atmend und autonom, um ihn dann vielleicht, eben weil er Rechtsstaat sein sollte, von den rechtsgefährdenden Wirkungen des Machiavellismus zu befreien (71). Daher Bodins antifeudale, absolu-
[1] Vgl. Meinecke, a. a. O. S. 491.
[2] Der wir jetzt folgen werden, die eingeklammerten Zahlen beziehen sich auf das Buch.
[124]
tistische Einstellung, die wir ja als großbürgerlich erkannt haben, daher seine Epoche machende Entdeckung des Begriffs der Souveränität, in dem er freilich, wie wir sahen, noch die des Staates mit der des Fürsten verwirrte. Und hier bereits ist die klare Erkenntnis, daß die Staaten Individuen sind, die man nicht über einen Kamm scheren kann, für deren Leiden man keine, alle und alles heilende, wundertätige Panacee auffinden kann. „Das muß das erste Gesetz der gut und klug zu leitenden Staaten sein, ihren Zustand, die Kraft und Natur eines jeden und die Ursachen ihrer Erkrankungen anzuschauen“ (74). Leitstern aber der ratio des Staates sei das Wohl des Volkes. Diese Gedanken wirkten auf alle nachfolgenden Staatsphilosophen weiter [1].
Inzwischen entstand eine ganze große Literatur über die Staatsräson. Zuerst wurde Machiavelli als der größte aller Frevler verrufen; seine Bücher kamen auf den Index[2]. Er hatte mit gar zu rauher Hand den Schleier von dem Bilde gerissen ; er hatte sozusagen den Zeitgenossen den Rücken der großen Buhlerin Kultur gezeigt, wo statt der Pracht und Schönheit die eklen Spuren der Verwesung sich dem erschreckten Auge darboten. Seine „Lehre war ein Schwert, das in den staatlichen Leib der abendländischen Menschheit gestoßen wurde, und sie aufschreien und sich aufbäumen machte“ (61). Aber man konnte das Gift wenigstens als Arznei nicht entbehren[3], und so begann man es nach erprobtem Rezept einfließen zu lassen, indem man den Autor zu widerlegen und abzuschwächen versuchte. So schon Boterò (1540—1617),
[1] Locke schreibt (a. a. O. § 160): „This power to act according to discretion, for the public good, without the prescription of the law, and sometimes even against it, is that which is called prerogative“. Er spricht freilich nur von Notfällen, wo es not tut, schnell in vom Gesetz nicht vorgesehenen Fällen zu handeln. Vgl. § 164: „But, since a rational creature cannot be supposed, when free, to put himself into subjection to another for his own harm, ... prerogative can be nothing but the peoples permitting their rulers to do several things, of their own free choice, where the law was silent, and sometimes too against the direct letter of the law, for the public good.“ Es liegt klar auf der Hand, daß hier leise gegen die Staatsraison polemisiert wird. Wo aber das öffentliche Wohl verletzt wird, da bleibt dem Volke als letztes Mittel, kraft eines Rechtes, „antecedent and paramount to all positive laws of men“, der Appell an den Himmel d. h. die Revolution (§ 168).
[2] Heute steht auf seinem Grabmal in Florenz nichts als: „Machiavelli. Der Name ist größer als jede Grabschrift“.
[3] Die höchste Ausbildung erreichte wohl die praktische Staatsraison in Venedig. Hier soll es, wie Bischof Burnet versichert, sogar einen eigenen Staatsgiftmischer gegeben haben (Röscher, Politik, S. 176). „Es war Grundsatz der Staatsinquisition, politische Verbrecher nie zu begnadigen, jeden Verdächtigen, der sich nicht vollkommen reinigen kann, für schuldig zu halten, und sich selbst der Unschuldigen, die sie einmal gemißhandelt, aus Furcht vor ihrer Rache lieber zu entledigen“ (ib. S. 182). Jemand der es wissen konnte, Dionysius von Syrakus, ein Mann, dessen Privatleben fleckenlos war, hat in einer seiner Tragödien ausgesprochen, daß die Tyrannis die Mutter alles Unrechts ist (Beloch, a. a. O. III, 1 S. 128).
[125]
ein eleganter, gepflegter Jesuit, bei dem sich, was für unsere Betrachtung wichtig ist, schon die Gleichsetzung von ragione di stato mit ragione d'interesse findet (85); so kraftvoller und schmerzlicher Boccalini (1556—1613), der die fruchtbare Zwangsläufigkeit der Staatsräson tief empfand und gleichfalls das Interesse als die bewegende Kraft der Staatsräson verstand: „Das Interesse des Staates ist gerade wie die Hunde des Aktäon, es zerreißt die Eingeweide des eigenen Herrn. Die Höllen haben keinen Schrecken, der ein Herz abschrecken könnte, das von der Brunst zu herrschen erfüllt ist“ (96). Meinecke bemerkt feinsinnig dazu, daß seine Worte „an die unruhig sich wälzenden, von Brunst und Leidenschaft bewegten Gestalten der Barockkünstler erinnern, während in Machiavelli einst die herben, tatenschwangeren, aber gefaßt sich zusammenhaltenden Gestalt en Michel Angelos sich spiegelten“. Boccalini sieht bereits, daß die Haltung der protestantischen Fürsten durch ihr Interesse bedingt ist.
„Seine dauernde geschichtliche Bedeutung liegt darin, daß er das Problem zum ersten Male in seiner furchtbaren Zwiespältigkeit gesehen hat. Er mußte ein Italiener und Nachfahre Machiavellis sein, um es empirisch in voller Schärfe zu erfassen, um die naturhafte Notwendigkeit und Unvermeidlichkeit des Handelns nach Staatsräson anzuerkennen. Es mußte ein Kind der Gegenreformation sein, um gleichzeitig auch die Sünde, die damit verbunden war, unmittelbar zu empfinden. Machiavelli hatte diese Sünde nicht empfunden, seine Gegner wieder verstanden in der Regel nicht die naturhafte Notwendigkeit der Staatsräson“ (111).
Den ersten großartigen Versuch einer Synthese der philosophischen und der politischen Staatsidee machte der glühende süditalienische Mönch Tommaso Campanella, der für einen Aufstand gegen die spanische Gewaltherrschaft mit mehr als zwanzigjährigem Kerker zu büßen hatte: der berühmte Verfasser des „Sonnenstaates“. Er wollte die Politik der Staatsräson als Hebel für die Verwirklichung seiner kommunistischen Utopie benützen, die „Monarchia hispanica“ : eine päpstlich-spanische Weltherrschaft (135), die der geplagten Welt den Frieden und die Wohlfahrt bringen sollte. Mehr als ein Menschenalter später, als inzwischen die „wie ein Wildbach“ wütende spanische Weltmacht an ihrer Weltpolitik verronnen war, versuchte er, den großen Richelieu für den gleichen Gedanken, aber unter französischer Hegemonie, zu begeistern (139). Er hat auf einflußreiche Schriftsteller der Zeit tiefen Eindruck gemacht, namentlich während seiner letzten Flüchtlingsjahre in Paris, auf den Franzosen Naudé und den Deutschen Schoppe (Scioppius).
Inzwischen waren seit dem Erscheinen des „Principe“ mehr als hundert Jahre verstrichen. Der „stato“ des Florentiners, zu seiner Zeit nichts als der Inbegriff des fürstlichen Machtapparats, hatte sich
[126]
mit neuem Inhalt gefüllt, während er sich, von seinen inneren Feinden erlöst, konsolidierte: er bedeutet jetzt bereits Gebiet und Bevölkerung (150). So brauchte man die grauenhaften Methoden der Borghia und ihrer Zeitgenossen nicht mehr oder doch nicht mehr so oft; und so verlor das Wort der Staatsräson etwas von dem höllischen Nimbus, der es zuerst umgab. Man unterschied jetzt zwischen der guten und der schlimmen Staatsräson, „aber man mußte dabei gestehen, daß das, was man im gewöhnlichen Sprachgebrauch unter ihr verstehe, eben die böse Lehre sei, daß der Fürst seinem eigenen Interesse mit allen, auch unanständigen Mitteln folgen dürfe“ (148). Die in einer ungeheuren Literatur enthaltene Quintessenz lief schließlich darauf hinaus, „daß die Erfordernisse und Notwendigkeiten des öffentlichen Wohls zwar göttliches und natürliches Recht nicht, wohl aber das positive Recht und die vom Staate gegebenen Gesetze verletzen dürfe“ (159)[1].
Die aus Staatsräson erfolgte Ermordung Wallensteins stellte auch vor Deutschland (auf das die blutige Tat den gleichen Eindruck machte, wie seinerzeit auf Frankreich die Bartholomäusnacht, die die Hochflut der monarchomachischen Schriften hervorrief) (63/4) das Problem als lebendig und erzeugte auch hier eine große Literatur (163) ; die Situation lag hier kaum besser als zur Zeit Machiavellis in Italien: auch hier Kriegsfurie, Verlust der nationalen Einheit, Verwüstung und Verwilderung. Und auch hier konnte nur das Aufkommen eines absoluten Staates mit ausreichender Gewalt das Elend bessern. Die neu gebildeten Landesfürsten konnten daher den Machiavellismus vortrefflich gebrauchen, um im Inneren ihrer Staaten den Rest der selbständigen Gewalten, die Stände mit ihren „Libertäten“, niederzuwerfen (161). Und so kommt jetzt in Deutschland die Literatur der „Arcana“[2], der Staatsgeheimnisse, auf, zuerst als literarischer Niederschlag der italienischen Publikationen noch vor der Katastrophe des großen Krieges, mit Clapmarius, „De arcanis rerum publicarum libri VI“ (1605). Während des Krieges aber schwillt diese Literatur an; „die bekannten Gelehrtennamen Reinking, Böcler und Conring tauchen ... auf, und vor allem gehört zu ihr das gewaltige antihabsburgische Pamphlet des Bogislav Chemnitz, der als Hippolytus de Lapide bald nach 1640 seine „Dissertatio de ratione status in imperio Romano-Germanico“ mit einem allgemeinen Abschnitt über das Wesen der Staatsräson eröffnete“ (164). Mitte des 18. Jahrhunderts verschwand das Thema von der Tagesordnung[3].
[1] Vgl. Treitschke, Pol. I, S. 92.
[2] Vgl. Schmitt-Dorotic, Die Diktatur: „Rücksichten, wie sie im Privatrecht herrschen, aequitas und justitia, auf das öffentliche Recht anzuwenden, scheint dieser Literatur eine weltfremde Naivität“ (S. 18).
[3] Von der Mitte des 16. Jahrhundert an trennen sich jus publicum und ratio status, Staatsrecht und Politik, in Deutschland (Stintzing, a. a. O. S. 30/ [1]. 1653 nennt Conring die Staatsraison eine „ratio diaboli“ (ib. S. 207); 1655 verwahrt sich V. L. v. Seckendorff in der Vorrede zu seinem „Teutschen Fürstenstaat“ dagegen, daß er „mit dem Worte Staat keineswegs das gemeint, was darunter heutzutage öfters begriffen werde und fast eine Untat, Schandtat und Leichtfertigkeit zu nennen sein wird, die an etlichen verkehrten Orten mit dem Staat, ratione status oder Staatssachen entschuldigt werden“. Noch 1685 erklärt er (Vorrede zu dem Christenstaat), der Gebrauch, des Wortes Staat ekle ihn eigentlich an“, sei aber leider nicht zu umgehen (Kelsen, a. a. O. S. 138). Man sieht, daß das heute so vergötzte Wort keine edlere Abstammung und ursprünglich keinen besseren Klang hat als das aus dem gleichen Kreise stammende Wort „Politik“. Übrigens trat 1666 Carpzov für eine gewisse Geltung der ratio Status ein, die Reinking für ein „mon- strum rationis“ erklärt hatte (Stintzing, S. 83).
[127]
Es war unmodern geworden. Auch hier hatte der Absolutismus sein Ziel im ganzen erreicht. „Staatswohl über Privatwohl, das war der harte und historisch fruchtbare Kern ihrer Lehre“ (179). Noch umschloß dieses Staatswohl freilich „keine feineren und geistigeren Kulturaufgaben und beschränkte sich auf die alten Aufgaben der Pflege von Recht und Religion und die neuen der Machtsicherung und Wirtschaftspflege“ (179, 244). Aber allmählich tritt die Erfüllung mit neuem Inhalt ein: der bloße Machtstaat wird zum Wohlfahrts- und Kulturstaat [1]. Im Inneren der Staaten war auch auf dem Kontinent die Macht des Adels und der Stände gebrochen, und das machte dem Staate und seinem Fürsten die Hände frei für neue Aufgaben (353). Schon konnten gewisse Gedanken der Aufklärung hier Wurzel fassen, wie das bei Friedrich dem Großen der Fall war (355); die Furcht vor dem Pöbel war geschwunden, der miles perpetuus konnte ihn sicher niederhalten; im Inneren gab es jetzt auch hier keine Gewalten mehr, gegen die man die häßlichen machiavellistischen Mittel hätte anwenden müssen; im gefestigten Militärstaate konnte man sich auch die Toleranz leisten.
Das ist eine neue Errungenschaft. Im Altertum freilich bildet Platon eine Ausnahme, der — ganz aufklärerisch — für seinen „besten Staat“ eine Staatsreligion konstruiert hatte, die man, bei Todesstrafe wegen „Asebeia“, zu bekennen hatte. Aber der theokratische Staat des Mittelalters und noch mehr der absolute Staat der beginnenden Neuzeit nahmen es sehr ernst mit der Staatsreligion und dem Zwange, sie zu bekennen. Calvin war bekanntlich nicht weniger intolerant als die katholischen Inquisitoren: auch er ließ „Ketzer“ wie den unglücklichen Servet verbrennen; der vierte Band seiner Institutio religionis christianae handelt nur von den „externis mediis ad salutem“. Besonders merkwürdig berührt uns, daß der vollkommen aufgeklärte
[1] Paulsen (Ethik II, S. 4) sieht die Entwicklung des Staates gehen von der Horde, deren Ziel hauptsächlich die Selbsterhaltung nach außen ist, über die geschlechtsmäßig gegliederte Völkerschaft, deren Hauptaufgabe der innere Frieden ist, über den Stadtstaat, der den Frieden nach außen und nach innen wahrt, zum modernen Staate, der die Wohlfahrtsverwaltung zu Gesetzgebung und Rechtsbildung fügt.
[128]
und offenbar religiös gleichgültige Hobbes, aus reiner Staatsräson [1], ähnlich wie Platon, eine offizielle, zwangsmäßig zu bekennende Staatsreligion fordert: „Religion ist nicht Philosophie, sondern Staatsgesetz, und darum ist sie nicht zu erörtern, sondern zu erfüllen“[2].
Spinoza folgt Hobbes auch hier, nur daß er stärker als der Engländer die Macht des Staates auf das äußere Handeln einschränken will und Gedankenfreiheit fordert[3].
Auf protestantischer Seite war noch Althusius[4], der große Schüler Calvins, auf katholischer Seite Bossuet[5] Verfechter der einheitlichen staatlichen Zwangsreligion; Milton ist für Toleranz, aber er verweigert, — und zwar aus wesentlich politischen Gründen (er fürchtet die außerstaatliche Gewalt des Papsttums) den Katholiken die Duldung, die er allen protestantischen Sekten einzuräumen bereit ist[6]. Auch die namhaften Juristen der Zeit sind Anhänger der Staatsreligion : Carpzov[7], Mevius[8], Reinking[9].
Allmählich ändern sich die äußeren Bedingungen des Staates und damit seine Stellung zu dem Problem: „Im innerlich schwächeren, von inneren Spaltungen bedrohten Staate der Renaissance und Gegenreformation war Intoleranz Staatsräson gewesen. Im gefestigten Militärstaate des 18. Jahrhunderts war diese Maxime veraltet. Das Staatsinteresse hatte es nicht mehr nötig, die Glaubenseinheit der Untertanen als Klammer des Untertanengehorsams zu benutzen“[10]. Und damit ändert sich auch die Stellungnahme der großen Publizisten. England geht mit Locke voran, der nicht nur, wie Milton, für die verschiedenen protestantischen Dissenters, sondern auch für die Katholiken, Juden und Mohamedaner volle Religionsfreiheit fordert[11]. In Deutschland ist es erst der edle Thomasius, der die Frage, ob Ketzerei ein strafbares
[1] Vgl. G. B. Gooch, Political Thought, S. 45. Er fürchtet, wie Milton, vor allem den „ultramontanen“ Einfluß des Papsttums, läßt aber auch den Puritanismus nicht gelten.
[2] Vom Menschen und vom Bürger, S. 48, vgl. a. S. 60. Im Leviathan (Ausgabe Amsterdam von 1668) heißt es V. Kap. 6: „Metus Potentiarum invisibilium, sive Fictae illae sint sive ab Historiis acceptae sint publice, Religio est, si publice acceptae non sint, Superstitito“. Vgl. Kap. XII: „Ratio naturalis Cultus alios quam quos dixi non suggerii, sed quicquid ultra est, Legibus relinquit singularum civitatum“.
[3] Vgl. Theol. pol. Traktat (Übersetzung Auerbach), 2. Aufl., S. 362, 396, 399, 400; — Pol. Traktat, III, § 5, § 14.
[4] Bluntschli, Gesch. d. neueren Staatsw., S. 87.
[5] Bluntschli, S. 196.
[6] Bluntschli, S. 118.
[7] Stintzing, a. a. O. II, S. 90/1.
[8] Ib. S. 111.
[9] Ib. S. 205.
[10] Meinecke, Staatsräson, S. 356.
[11] Bluntschli, a. a. O. S. 118.
[129]
Verbrechen sei, verneint und folgerichtig dem Fürsten die Befugnis abspricht, die Ketzer zu bestrafen [1]. „Seine eigenen Untertanen kann der Fürst zu seiner Religion nicht zwingen, nicht einen, geschweige denn alle[2]“.
Dennoch hat noch Rousseau gewisse Rückfälle in die scheinbar überwundene Richtung. Er wendet sich freilich gegen seinen Landsmann Calvin, ohne ihn übrigens zu nennen, dem er zu bedenken gibt, daß der Staat „im Jenseits keine Befugnisse besitzt, und es ihn nicht zu kümmern hat, welches Los seine Bürger im kommenden Leben haben, vorausgesetzt, daß sie in diesem Leben gute Bürger sind“ (Contrat social, IV, 8). Aber er lobt doch Hobbes, weil er „vorgeschlagen habe, die beiden Köpfe des Adlers zu vereinigen und die staatliche Einheit herzustellen“ (ib.). Und so predigt er zwar selbst Toleranz und Gewissensfreiheit, aber doch mit einer charakteristischen Einschränkung, die ganz Platon nachempfunden ist: es soll eine „bürgerliche Religion“ eingeführt werden, die jeder bekennen muß, bei Strafe, als ungeselliges Wesen verbannt zu werden. Die Glaubenssätze dieser Staatsreligion, die nur wenige und einfache sein dürfen, und die ohne Katechismus (explications et commentaires) gelehrt werden müssen, haben folgenden Inhalt: „Die Existenz der mächtigen, vernünftigen, wohlwollenden, vor- und fürsorgenden Gottheit — das Leben nach dem Tode —, das Glück der Gerechten und die Strafe für die Sünder, die Heiligkeit des Gesellschaftsvertrages und der Gesetze, die Verwerflichkeit jeder Intoleranz“ (IV, 8).
Nachdem das zaristische Rußland zusammengebrochen ist, gibt es kein größeres Staatswesen mehr, das offiziell einen religiösen Gewissenszwang auf seine Bürger ausübt: man hat den Druck auf eine andere Stelle verlegt, auf das nationale Bekenntnis; an die Stelle des verderblichen Satzes „cujus regio, ejus religio“ ist der nicht minder verderbliche Satz getreten: „cujus regio, ejus lingua“[3].
So wandelt sich mit dem Staate auch seine Räson: „Überhaupt, indem der Staat mächtiger wurde, konnte er auch sittlicher und liberaler werden, freilich nur auf dem Gebiete, das seine Macht jetzt ganz beherrschte, innerhalb der eigenen Grenzen“. Als FriedrichII. seinen „Anti- machiavell“ schrieb, wies er mit Recht darauf hin, daß für den Fürsten einer Großmacht nicht gelte, was den „principini“, den „Zwergfürsten“ oder „Zaunkönigen“ des Cinquecento, bittere Notwendigkeit gewesen[4].
[1] Bluntschli, S. 223/4.
[2] § 74 aus den „Kurze Lehrsätze vom Rechte eines christlichen Fürsten in Religionssachen“ (1724), zit. n. Bluntschli, S. 228.
[3] Vgl. Karl Renner, Das Selbstbestimmungsrecht der Nationen, I. Teil, Nation und Staat, Leipzig und Wien 1918, passim. Vgl. meinen Aufsatz „Nationale Autonomie“, Neue Rundschau, Febr. 1917.
[4] Meinecke, Staatsräson, S. 347.
[130]
Friedrich bewies durch sein Leben, daß dieser moderne gefestigte Großstaat sich noch mehr leisten konnte, ja, sogar mußte: einen „rationaleren Monarchentypus, den Bruch mit der dynastischen Konvention des Königtums, die Verscheuchung der höfischen und theokratischen Nebel, die es umgaben“ (420). Kurz, mehr und mehr „beherrscht der großpolitische Macht betrieb die Lage ; damit verschieben sich auch die Mittel der Staatskunst. Die Staatsräson wird nicht etwa im Kerne sittlicher und skrupulöser, aber die kleineren und roheren Rezepte des Machia- vellismus werden seltener gebraucht, weil man bessere und stärkere Machtmittel hat“ (516). Nach der Restauration (nach 1815) wurde man noch behutsamer, weil die Regierenden die dämonischen Mächte der Tiefe zu fürchten hatten, die man entfesselt gesehen hatte (518). Und schließlich wurde der Staat durch die allgemeine Wehrpflicht und die übrigen liberalen Errungenschaften zum Nationalstaat und konnte und mußte sich nun als solcher weitere und inhaltreichere Ziele stecken als der von den Herrschern und Kabinetten geleitete Großmachtstaat der früheren Jahrhunderte“ (523).
Wir haben weit vorgreifen müssen, um die Entwicklung desStaates von der Tyrannis des erfolgreichen Condottiere zum modernen Nationalstaat zu zeichnen und verständlich zu machen, wie der Typus Cesare Borghia allmählich überging in den aufgeklärten Despoten, den konstitutionellen Herrscher und schließlich in den Präsidenten einer freien Republik. Jetzt müssen wir uns noch einmal rückwärts wenden, um die Entwicklung des Begriffs zu finden, der uns vor allem wichtig ist: der „partikulären Interessen“.
Machiavelli spricht noch nicht von den „Interessen“ des Staates, sondern von seinen „cure principale“ (187). Aber schon um die Mitte des 16. Jahrhunderts spricht man von dem „Interesse di stato“, das aus seiner ragione entspringe, „aus der generellen Regel, daß jeder Staat vom Egoismus des eigenen Nutzens... getrieben werde und rücksichtslos alle anderen Motive schweigen lasse, wobei aber ... die Voraussetzung gilt, daß die ragione di stato immer nur den wohlverstandenen, den rationellen, von bloßen Instinkten der Gier gereinigten Vorteil bedeute“. (188).
Damit hat sich ein bedeutsamer Wandel der Auffassung vollzogen: man spricht nicht mehr von „dem“, sondern von „den“ Staaten. Jeder einzelne von ihnen wird betrachtet daraufhin, was sein wahres und wohlverstandenes Interesse ist, als Sonderfall des allgemeinen Interesses jeder Gruppe, sich zu erhalten und an Zahl und Macht zu wachsen [1], das selbstverständlich auch das allen diesen „Rahmengruppen“ gemeinsame Grundinteresse ist. Aber jetzt fragt man nicht
[1] S. S. I, S. 595ff., S. 890ff. In diese „Arcana“ wurde z.B. der junge Leibnitz durch den Frhrn. v. Boyneburg eingeführt (Bluntschli, a. a. O, S. 167).
[131]
mehr nach dem allgemeinen Gesetz, sondern nach seiner besonderen Auswirkung. So entsteht die „Interessenlehre“, die aus der geographischen und internationalen Lagerung der einzelnen Staaten, aus ihrer militärischen und finanziellen Macht, ihren inneren wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen usw. abzuleiten versucht, was ihre cura principale, ihr wohlverstandenes Interesse, ihnen zu tun und zu lassen gebieterisch vorschreibt. Um Beispiele aus der neuesten Zeit zu wählen, die dem Leser sofort zeigen, um was es sich handelt, so würde eine Interessenlehre des 19. Jahrhunderts ausgesagt haben, daß Rußland den Zugang zu einem freien Meere gewinnen muß, daß England niemals das Aufkommen einer seine Seeherrschaft bedrohenden anderen Seemacht dulden kann, daß die Vereinigten Staaten jede Einmischung einer europäischen Macht in die amerikanischen Dinge bekämpfen müssen. So wird die Staatenpolitik zu einem leidenschaftslosen Rechenexempel, namentlich auf der Höhe des reifen Absolutismus. „Man billigte dem Gegner, wie der Kaufmann dem Konkurrenten, das Recht auf klugen und selbst skrupellosen Egoismus innerlich zu... Der politische Haß zwischen den Regierungen ging nicht bis auf die Knochen, er wurde durch keine Völkerleidenschaft geschürt“. Auch die konfessionelle Leidenschaft hatte abgeebbt, und „damit stand denn auch die Staatsräson, verstanden als reiner, unbedingter, von überflüssigen Leidenschaften befreiter Egoismus des Staatsinteresses, auf der Höhe ihrer geschichtlichen Entwicklung“ (404).
Zuerst brach sich diese neue Art der Betrachtung Bahn in der nächsten Umgebung des größten politischen Genies seiner Zeit, des Kardinals Richelieu. Um die Wende der Jahre 1623/4 erschien anonym eine Schrift, die manche dem berühmten Pater Joseph, dem Vertrauten des großen Staatsmannes, zuschreiben: „Discours des Princes et Estats de la Chrestienté plus considérables à la France, selon leurs diverses qualitez et conditions“. Sie zeigt schon im Titel den soeben dargestellten Wandel der Betrachtung: sie spricht von „den“ Staaten und ihren verschiedenen Eigenschaften und Bedingungen. Dann schrieb einer der großen Feldherren und Politiker der Zeit, der hugenottische Herzog Heinrich de Rohan, zuerst der Gegner, dann aus nationalem Bewußtsein der Gehilfe des Kardinals, eine ihm gewidmete Denkschrift: „De l'Interest des Princes et Estats de la Chrestienté“ (1638). Hier haben wir im Titel auch schon den Ausdruck, der in der folgenden Zeit der Wissenschaft den Namen geben sollte: „Interessen“. Und wir haben wichtigeres, die Unterscheidung, die Richelieus ganzes politisches Denken beherrschte (209 ) : zwischen dem öffentlichen Interesse des Staates- und den „partikulären“ Interessen im Staate. „Auch der König steht demnach für ihn unter dem Staatsimperativ, und letzten Endes soll eigentlich nicht die empirische Persönlichkeit des Königs,
[132]
sondern die „Göttin Vernunft“ auf dem Throne sitzen“ (210), eine grandiose Vorstellung, die auch die der großen Staatsphilosophie von Platon an über Spinoza und Locke bis auf Nelson in seiner „Philosophischen Politik“ ist: mit absoluter Gewalt soll herrschen nur das Recht, vertreten durch den Regierenden. Freilich bedeutet bei Richelieu und Rohan die .Vernunft' etwas anderes, nämlich die von aller Leidenschaft gereinigte Staatsräson, den Ausdruck der ehernen Notwendigkeit, eines Naturgesetzes eher als eines Sittengesetzes. Kraft dieser Notwendigkeit, Machiavellis „necessità“, brach der große Kardinal die Macht des französischen Adels und sperrte ihm erfolgreich den Weg zum Landesfürstentum (239) ; das ist der Grund seiner Hugenottenpolitik, der Eroberung von La Rochelle.
„Die Fürsten kommandieren den Völkern, und das Interesse kommandiert den Fürsten“ so begann Heinrich Rohans Denkschrift. Er war, trotz des Titels seiner Schrift (der Ausdruck .Christenheit' bedeutet nur noch einen geographisch-politischen Begriff (211), wie hundert Jahre später bei Friedrich dem Großen, der ihn aus der Literatur übernommen haben wird) (392) ein ganz moderner Mensch; „Es ist, wenn man Rohan liest, wie wenn man aus dem 16. ins 17. Jahrhundert hinübertritt“ (208). Und der gleiche Geist der Selbständigkeit, der keiner Zitate aus der Bibel oder den Alten mehr bedarf, wirkt sich nun auch aus in der sich jetzt allmählich entwickelnden „Interessenlehre“ der Staaten, die von Gelehrten, nicht mehr von praktischen Staatsmännern geschrieben wird. So schon bei Campanellas Freund Naudé (1600—1653), dem Verfasser des Buches „über die Staatsstreiche“, und vor allem bei Pufendorf, der sozusagen Konsiliarius für Interessenberatung an den verschiedensten Höfen und nebenbei Hofhistoriograph war, wie er auch als Naturrechtler arbeitete und derart so etwas wie eine persönliche, freilich nicht auch sachliche Synthese der beiden Disziplinen darstellte. Er unterschied prinzipiell zwischen dem Interesse des Fürsten und dem des Staates und gab damit Friedrich dem Großen das Stichwort zu seiner berühmten Wendung vom „ersten Diener des Staates“.
Wie sehr das Wort von den Staatsinteressen sich bereits eingebürgert hatte, zeigt das 1658 erschienene Buch des genialen Lumpen Gatien des Courtilz de Sandras, einer Figur, ähnlich den Cagliostro und Casanova: „Nouveaux intérêts des Princes de l'Europe“: eines Mannes, der heutzutage die politischen Leitartikel einer großen Tageszeitung schreiben würde ; seine Leidenschaft, die Arithmetik der Politik herauszufinden, erinnert an die Leidenschaft derartiger Naturen, das Gesetz der Roulette zu entdecken. Dann folgt in der Reihe der vornehme und anständige, in Holland lebende französische Réfugié Rousset mit seinem 1733 erschienenen Lehrbuch „Les Intérêts présens et les prétentions des puissances de l'Europe“, grundsätzlich gleichen Inhalts. Von ihm
[133]
wie von Gundling haben wir bereits gesagt, daß sie anfingen, den wirtschaftlichen Verhältnissen der Staaten besonderes Gewicht beizulegen. Damit kommen die wirtschaftlichen Interessen zum ersten Male in dieser Literatur zu Worte [1]. Von hier aus kam die Lehre, entsprossen der Praxis großer Politiker, von Machiavelli bis zu Richelieu, wieder zu einem der größten Politiker der Geschichte zurück, zu Friedrich dem Großen: „Man muß blind dem Interesse des Staates folgen“, lehrt das Testament von 1768 (389).
Damit haben wir den Gedanken schon ein Stück weiter verfolgt, als für unseren unmittelbaren Zweck nötig ist. Wir wollen noch einen Schritt weiter gehen und sagen, daß Machiavelli und der Machiavellismus etwas später in Hegel[2] einen starken Verteidiger fanden : hier kam es zu einer wirklichen Synthese der beiden Wissenschaften vom besten philosophischen und wirklichen historischen Staat: einer Synthese, die schon bei Spinoza anklingt, aber doch nur äußerlich durch den pan- theistischen Gottesbegriff vermittelt wird, indem Spinoza zu verstehen gibt, daß, sub specie aeterni betrachtet, auch diese Handlungsweise der Staaten Gottes Wille und Werk sei (272).
Dieses „Doch getrost, auch das ist Gottes Wille“, wie der spöttische Christian Morgenstern einmal in ganz anderem Zusammenhang schreibt, war schon vor Spinoza und noch lange nach ihm die Antwort auf die peinliche Frage, wie sich die Völker gegenüber schlechten Monarchen zu verhalten hätten. Schon Grotius hatte geschrieben: „Deus sibi curae peculiari esse testatur, quia ea aut vindicat, si ita opus judicet, aut
[1] Schon Pieter de la Court meint: L'on doit croire que dans toutes les assemblées ou Sociétés l'intérêt particulier est préféré à toutes choses“. Er plädiert stets für die Freiheit, hauptsächlich, weil sich Holland und die Holländer materiell wohl dabei befinden ... der volkswirtschaftliche Nutzen liegt ihm am meisten im Sinne (Hasbach, a. a. O. S. 111). Spinoza nennt ihn rühmend (v. H.) Pol. Traktat VII, 31. Auch Luther beschäftigt sich spöttisch mit dem „edlen, teuren, zarten Wörtlein Interesse“ (v. Schubert, a. a. O. S. 74). Matheus Schwarz, der Hauptbuchhalter der Fugger, schreibt Anfang des 16. Jahrhunderts: „Interesse, das ist höflich gewuchert, Finanzen (d.h. Finanzgeschäfte treiben), ist gleich höflich gestohlen“ (ib. Anm.zu S.74). Hier wird das Wort allerdings im Sinne von Zins gebraucht : aber der Zusammenhang zwischen dem Zins und dem Interesse des „Partikulier“ ist ja klar gegeben: es ist beide Male der Kapital prof it. Fast gleichzeitig stellt Morus in einer unten anzuführenden Stelle das Sonderinteresse der Privateigentümer scharf den „Interessen der Allgemeinheit“ gegenüber (Utopia, S. 109).
[2] Wir zeigten schon, daß Schelling Machiavelli als großen Historiker zu würdigen wußte. Auch in Fichte fand er einen Verteidiger. In seinem Aufsatz über Machiavelli „spricht ein Mann, der Machiavellische Realpolitik tief verstanden hat, der einen harten aber gesunden Kern in ihr findet und seiner Zeit wieder einpflanzen will... . Ein großer Willensmensch sah hier dem anderen ins Auge, ein radikaler Wahrheitssucher dem anderen“. Der Aufsatz wurde 1807 in Königsberg geschrieben, in der tiefsten Not Deutschlands, und „das konnte wohl auch den Gedanken eingeben, den Ranke dem Machiavell zugeschrieben hat, daß nämlich für den verzweifelten Zustand seines Vaterlandes nur noch Gift als Heilmittel möglich sei“ (Meinecke Weltb., S. 101/2).
[134]
tolerat in poenam aut explorationem populi“ (Lib. I, Kap. III, § 8, 14). Melanchthon stand zuerst auf dem Standpunkte, Willkür und Abweichungen von der Vernunft seien als Züchtigungen Gottes zu tragen; später bekannte er sich auf die Autorität der Juristen hin zu einem gemäßigten Widerstandsrecht [1]. Jakob L, ein fermer Kenner der Theologie, der widerwillige Schüler des Monarchomachen Buchanan, vertrat den Grundsatz in seiner Schrift: True Law of free Monarchies: „Ein böser König ist als Plage für des Volkes Sünden von Gott gesandt, und es ist wider das Recht, diese gottgesandte Bürde abzuschütteln“[2].
Sein großer Gegner Milton war jeder Zeit ein Gegner des bequemen Grundsatzes[3]. Die preußischen Konservativen waren selbstverständlich begeisterte Anhänger des Grundsatzes. Friedrich Julius Stahl meint, „die Völker müssen das Unglück eines unfähigen und unwürdigen Regenten mit Geduld und Demut ertragen, weil das der Fluch des zeitlichen Daseins im Gegensatz zum ewigen sei, daß die Menschheit nicht in Gott ist und von ihm selbst beherrscht wird“[4]. Der ihm nahestehende Wilhelm von Gerlach führt 1833 im politischen Wochenblatt aus, das Recht der Obrigkeit beruhe auf einer besonderen göttlichen Anordnung: „Sie ist eine Folge der Erbsünde und ein Zuchtmittel für die gefallene Welt, von Gott selbst als zur Bändigung des Unrechts auf Erden eingesetzt“[5].
Rousseau schreibt (Contrat social III, 6) zu dem Gegenstande: „Diese Schwierigkeiten sind unseren Autoren nicht entgangen, aber sie setzen sie nicht in Verlegenheit. Sie sagen, Gott gibt die schlechten Könige, und man muß sie als die Zuchtruten des Himmels ertragen. Das ist ja recht erbaulich, paßt aber eher auf die Kanzel als in ein politisches Werk“[6].
Noch heute ist nach Kelsen die Lehre in beiden christlichen Konfessionen offiziell[7].
Was übrigens Spinozas Stellung zu Machiavelli betrifft, so zitiert er ihn rühmend im Politischen Traktat, wo er ihn „höchst scharfsinnig“ nennt. In der Einleitung zu diesem seinem spätesten Werk erklärt er, ganz wie Machiavelli, er wolle nicht vorgehen, wie die meisten Staatsphilosophen, die „die Menschen nicht auffassen, wie sie sind, sondern wie sie sie eben haben möchten“. In § 4 schreibt er, er sei „sorgfältig
[1] Stintzing, a. a. O. I, S. 286.
[2] Gooch, a. a. O. I, S. 13.
[3] Bluntschli, a. a. O. S. 114/5. Vgl. über die Stellung Mornays dazu Wolzendorff, a. a. O. S. 107.
[4] Bluntschli, a. a. O. S. 703.
[5] Meinecke, Weltbürgertum, S. 242.
[6] Vgl. IV, Kap. 8 kurz vor dem Schluß, wo er das Christentum mit verantwortlich macht.
[7] Kelsen, a. a. O. S. 233·
[135]
bemüht gewesen, die menschlichen Handlungen nicht zu beweinen, nicht zu belachen, und auch nicht zu verabscheuen, sondern zu verstehen“, als was sie sind, nämlich als elementare Naturdinge. V. § 7 gibt er der Ansicht Ausdruck, gerade wie später Rousseau, der vielleicht hier die Anregung geschöpft haben möchte, daß Machiavelli habe „zeigen wollen, wie sehr sich ein freies Volk hüten müsse, seine Wohlfahrt einem Einzigen unbedingt anzuvertrauen ... Dieses von jenem höchst einsichtsvollen Manne zu glauben, finde ich mich um so mehr bewogen, weil er bekanntlich für die Freiheit war, zu deren Schutz er auch die heilsamsten Ratschläge gegeben hat“ [1].
Um zu unserem Hauptgegenstande zurückzukehren, so übernahm der deutsche Historismus, ausgehend von der Romantik und ihrer Begeisterung für das Individuelle, die wissenschaftliche Weiterführung der älteren Interessenlehre[2]. Er fand von hier aus den Weg zur Theorie des Machtstaates, den dann Treitschke bis zu Ende ging. Er hielt die Sorge des Staates für seine Macht für „absolut sittlich“ und stellte diese Aufgabe, eben als sittlich, allen seinen anderen Verpflichtungen voran[3].
Von der durch Hegel versuchten Synthese werden wir sofort in einem anderen Zusammenhange zu sprechen haben; hier wollen wir die Untersuchung der Wurzeln des Gesetzes der ursprünglichen Akkumulation weiterführen:
Der Hauptinhalt der Entwicklung der Interessenlehre von Machiavelli bis auf Friedrich ist der, daß erstens die Existenz von Partikulärinteressen im Staate festgestellt wurde, mit denen er zu ringen hat, um seine eigenen, an Wert und Würde weit überragenden Interessen zu befriedigen; und zweitens, daß diese feindlichen Interessen, die zuerst rein politische waren, nämlich ständisch-feudale, allmählich mit dem Niedergang des Adels und dem Aufstieg des Großbürgertums, zu wirtschaftlichen Interessen werden. Wir finden hier, in der wissenschaftlichen Politik, also die gleiche Umbiegung, die wir schon auf dem Nachbargebiete der philosophischen Staatslehre sich haben vollziehen sehen[4].
[1] Auch X. 1, wird er rühmend angeführt. Die Grundsätze der Staatsräson werden vorgetragen Theol. Pol. Traktat, S.357, Pol. Traktat, III, §§ 14—17, IV, § 4. „Der Staat sündigt also, wenn er das tut oder geschehen läßt, was die Ursache seines eigenen Unterganges sein kann“. Er ist aus dem schon genannten Grunde nicht verpflichtet, sich an abgeschlossene Verträge zu halten, daß zwischen Staaten der Naturzustand, d. h. der Stand der Rechtlosigkeit, fortbesteht.
[2] Meinecke, Staatsräson, S. 449.
[3] Ib. S. 508.
[4] Vgl. Montesquieu a. a. O. Livre III, Chap. 3: „Die griechischen Politiker, die im Volksstaat lebten, erkannten keine andere Kraft an, die ihn erhalten könnte, als die Tugend. Die von heute sprechen nur von Fabriken, Handel, Finanzen, Waren Tind sogar Luxus“. Vertu ist bei M. Vaterlandsliebe, d. h. Liebe zur Gleichheit (Seite 127 im avertissement).
[136]
An dieser Stelle nimmt Rousseau die beiden Lehren auf und verschmelzt sie in großartiger Synthese.
2.2. Staatsmacht und Wirtschaftsmächte. (Die ökonomischen Interessen.)
Diese Synthese ist der „Contrat social“, der nur als solche völlig verstanden werden kann.
Das Problem wird nach mathematischer Art gestellt, gerade wie Karl Marx, in der gleichen geistigen Linie, ein Jahrhundert später das Problem des Mehrwertes stellte:
„Zu finden ist eine Form der Vergesellschaftung (association), die mit der ganzen Gesamtkraft Person und Eigentum eines jeden Gliedes schützt, und in der doch jeder einzelne, indem er sich Allen verbindet, nur sich selbst gehorcht und so frei bleibt wie zuvor“ (B. I, c. VI.) [1].
Die zu überwindende Schwierigkeit ist in dem voraufgehenden Satze klargestellt: „Da die Freiheit und die Kraft des Individuums die ersten Werkzeuge seiner Selbsterhaltung sind: wie kann er es fertig bringen, die anderen Gesellschafter davon zurückzuhalten, ihn zu schädigen, und die Pflicht gegen sich selbst erfüllen?“
Wir treten den Beweis an, daß Rousseau damit das folgende Problem stellen wollte, das er freilich nicht ausdrücklich formuliert hat:
Ein Staat ist zu konstruieren, dessen „Räson“ das Recht im höchsten philosophischen Sinne ist.
Man hat Rousseau bisher immer in die Reihe der Philosophen des überhistorischen, besten Staates eingeordnet. Aber niemand scheint gesehen zu haben, daß er geradeso in die Reihe der wissenschaftlichen Politiker gehört, die von Machiavelli ausgehen. Bei ihm zuerst fließen die beiden Ströme in ein Bett zusammen und vereinigen sich durchaus : eine Synthese, die der von Spinoza versuchten und der später von Hegel auf andere Weise durchgeführten unendlich überlegen ist, trotzdem sie noch mit zwei schweren Fehlern behaftet ist: dem Individualismus oder besser Atomismus, der aus der Aufklärung stammt, und, wie wir
[1] Schon vor ihm hatte Spinoza das Problem mit ähnlicher Genauigkeit gestellt, freilich nicht im entferntesten so genial gelöst, vielleicht, weil es sich um ein Fragment handelt, vielleicht, weil er die Dinge trotz seiner Stellung zwischen und über den Klassen immer noch zu sehr als Großbürger sah. Er schreibt (Pol. Trakt. I, § 6): „Die öffentlichen Angelegenheiten müssen ... so geordnet werden, daß diejenigen, welche sie verwalten, mögen sie von der Vernunft oder von Affekten geleitet werden, nicht dazu gebracht werden können, treulos zu sein oder schlecht zu handeln“. Ebenso I, 3. Eine Anwendung des Prinzips, sehr „bürgerlich“, VIII, § 31. Aus der gleichen Wurzel, angeregt wahrscheinlich durch Machiavelli, wächst sein Vorschlag, in der „Demokratie“ kein privates Grundeigentum zuzulassen, durch dessen Anhäufung in einigen Händen nach des Florentiners richtiger Ansicht gewaltige Partikulärinteressen entstehen müssen.
[137]
wissen, mit der „Wurzel aller soziologischen Übel“, dem Glauben an das Pseudogesetz von der ursprünglichen Akkumulation.
Er stellt sich das Problem sofort im ersten Satze der eigentlichen Darstellung, nach dem „avertissement“ mit voller Klarheit: „Ich will untersuchen, ob es, unter den beiden Voraussetzungen, daß die Menschen nicht idealisiert werden (en prenant les hommes tels qu'ils sont) [1], und daß man keine unmöglich auszuführenden Gesetze einführt, gesetzmäßige und erfolgessichere Regeln der Regierung (administration) geben kann. Ich werde in dieser Untersuchung mich bemühen, immer das, was das Recht erlaubt, mit dem, was das Interesse fordert, in Übereinstimmung zu halten“.
Was hier unter dem bedeutsamen Worte „Interesse“ verstanden ist, geht aus dem folgenden klar hervor. Es ist das „öffentliche Interesse“ einerseits und das „partikuläre Interesse“ andererseits. Daß er diesen Gegensatz im Auge hat, ist nicht nur aus den Ausdrücken erkennbar, die er in voller Anlehnung an die „Interessenlehre“ in deren Sinne gebraucht, sondern auch aus der Tatsache, daß er den Schöpfer der Unterscheidung, Machiavelli, unmittelbar zitiert und an anderen Stellen dessen Gedanken in eigener Sprache wiedergibt.
Charakteristisch ist bereits, daß er den Begriff „Individuum“ überall mit dem Worte „Particulier“ bezeichnet, das aus jener Lehre stammt und — das müssen wir wieder empfinden lernen — ursprünglich gar nichts anderes enthielt a}s den Begriff eines Individuum, dessen Interessen, wenn sie auch vielleicht zufällig gerade mit denen der Gesamtheit oder des Staates übereinstimmen, doch grundsätzlich von ihnen verschieden sind. In diesem Sinne braucht Rohan das Wort ; und nur, weil es im Grunde kein Individuum geben kann, dessen Interessen prinzipiell immer mit denen des Staates übereinstimmen, ist das Wort allmählich ein Synonym des Begriffes „Individuum“ geworden. Im Deutschen, wo es allerdings sehr selten geworden ist, hat es noch etwas mehr von seinem ursprünglichen Inhalt bewahrt: es bezeichnet den Kapitalisten, noch spezieller den Rentier.
Ferner spricht Rousseau (II, Kap. V) vom „öffentlichen Interesse“, an unzähligen Stellen vom „Partikulärinteresse“ (z. B. I, Kap. VII, II, Kap. I, II, Kap. III[2]. Ebensooft spricht er von dem Gegensatz
[1] Schon das ist ein Machiavellischer Grundsatz und findet sich auch bei Spinoza.
[2] Hier heißt es in ein wenig abgewandelter Form: „L'intérêt privé“, aber es wird hinzugefügt, daß es „aus einem partikulären Willen stammt“. Ich finde den Ausdruck „particulier“ schon bei Bodin (a. a. O. S. 93, I, Kap. VIII). „Und aus den gleichen Ursachen, aus denen ein Partikulier von einem ungerechten oder unverständigen Versprechen befreit werden kann, weil es ihn übermäßig belastet, oder weil er durch List oder Trug oder Irrtum oder Gewalt oder durch berechtigte Furcht dazu gebracht worden ist, wegen laesio enormis, ebensowohl kann der Fürst Wiedereinsetzung in seine Souveränetäts- rechte herbeiführen, wenn sie seine Majestät berühren, wenn es sich eben um einen souveränen Fürsten handelt. Und so bleibt es bei unserer Maxime, daß der Fürst weder seinen eigenen noch den Gesetzen seiner Vorgänger unterworfen ist, wohl aber seinen gerechten und vernünftigen Verträgen“, „et en l'observation desquelles les subjects en general ou en particulier ont interest“. Es ist mindestens auffallend, daß die beiden Ausdrücke hier unmittelbar nebeneinander stehen. Das 5. Kap. des dritten Buchs führt die Überschrift: „De la puissance des Magistrats sur les Particuliers“. Locke spricht wenigstens von einem „distinct interest“, das den oder die Gesetzgeber vom Rest der Gemeinschaft trennt, und sie verleiten könnte, das Volk unbillig zu belasten (§ 138). Und er berichtet, daß sich im Verfassungseide Jakobs I. die Worte fanden: „Ich will immer das öffentliche Wohl und das der Gesamtheit (commonwealth) allen meinen partikulären und privaten Zwecken vorziehen (any particuliar and private ends of mine). Vgl. dazu Gooch, I, S. 13: Jakob macht alle Anstrengungen, um seinen Krönungseid als ungültig zu erklären: „Ich leugne diesen Vertrag, aber ich gestehe, daß ein König verspricht, sein Amt getreulich zu verwalten“.
[138]
der beiden Interessen oder Willen, die es zu versöhnen gilt, z. B. in der sehr bekannten Stelle: „Sehr oft ist der Wille aller von dem allgemeinen Willen sehr verschieden; dieser hat nur das allgemeine, der andere nur das private Interesse im Auge und ist nichts als eine Summe von Partikulärwillen; aber nehmt von diesen Willen die Plus und Minus, die sich gegenseitig aufheben, fort — und es bleibt der allgemeine Wille“ (II, Kap. III).
Und schließlich findet sich auch das Wort „Staatsräson“: „Auf daß ein Volk der gesunden Maximen der Politik genießen und die Grundregeln der Staatsräson befolgen könne“ (II, Kap. VII).
Um die Kette der Beweise zu schließen, zitiert Rousseau wörtlich eine außerordentlich charakteristische Stelle aus Machiavellis selten gelesener Geschichte von Florenz : „Die Wahrheit ist, daß einige Sondergruppen (divisioni) den Staaten nützlich, andere schädlich sind: die schädlichen sind die, die mit der Bildung von Sekten und Parteigängern einhergehen; die nützlichen, die sich ohne Sekten- und Bandenbildung (senza partigiani) erhalten. Da nun kein Gründer einer Republik imstande ist, es zu erreichen, daß es in ihr keine Gegensätze (nimicie) gibt, so hat er wenigstens dafür zu sorgen, daß es keine Sekten gebe“ (II, IV. Anm.). Rousseau sagt dazu im Text: „Es ist also von Wichtigkeit, daß es im Staate keine Sondergruppe (Société partielle) gebe, auf daß der allgemeine Wille sich vollkommen ausdrücken könne“ [1]. Wenige Seiten weiter zitiert er wieder Machiavelli[2], dieses Mal die „Discorsi“,
[1] Diese Vorstellung besaß bereits Aristoteles. Er preist die Kleisthenische Reform wegen ihrer politischen Weisheit: „Es gilt überhaupt alles zu ersinnen, damit so viel als möglich alle miteinander vermischt, und die alten Verbände aufgelöst werden“. Vgl. Busolt a. a. O. S. 160.
[2] Weitere Zitate die oben angeführte Stelle aus dem „Principe“, ferner III, 9. Anm. zweimal; auch hat er M.s Lehre von den zyklischen Katastrophen, dem ewigen Kreislauf des Staates (III, 11). Das ganze dritte Buch des Contrat ist eine allgemeine Intei- essenlehre. Er nennt keine Namen weiter, spricht aber von „nos auteurs“ und „les politiques“ (III, 6 und 7).
„Lorsque Rousseau demandait que la démocratie ne supportât dans son sein aucune association particulière, il raisonnait d'après la connaissance qu'il avait des républiques du Moyen Age; il savait mieux que ses contemporains cette histoire et il était frappé du rôle énorme qu'avaient joué alors les associations politico-criminelles; il constatait l'impossibilité de concilier la raison dans une démocratie avec l'existence de telles forces.“
(Sorel: Réflexions sur la violence, 3 èmе édition, Paris 1912, S. 298.)
[139]
und dieses Mal ablehnend, aber nur in bezug auf die Notwendigkeit göttlich-religiöser Sanktion der zu erlassenden Gesetze. Er glaubt, aufklärerisch [1], lieber an die Vernunft in Gestalt der „sagesse“ großer Männer ; und wenn er auch Voltaire einen Rüffel gibt, weil er Religionsstifter wie Moses und Mahomet für „imposteurs“ erklärt hat (er nennt ihn nicht, aber der Hinweis ist deutlich), so „hat doch der wahre Politiker in ihren Schöpfungen das große und mächtige Genie zu bewundern, das Dauerhaftes zu schaffen vermag“ (II, VII). Hält er sich doch selbst für einen so weisen Gesetzgeber!
Damit dürfte zur Genüge erhärtet sein, daß die „Interessenlehre“ als Thesis in die Verbindung eingegangen ist[2] : daß die Antithesis, die philosophische Staatslehre, in sie eingegangen ist, unterliegt keinem Zweifel und bedarf keines Beweises. Rousseau zitiert polemisierend unaufhörlich alle die uns bekannten Namen der großen Reihe.
Wie ist nun die Synthese gestaltet? Rousseau konstruiert eine Gesellschaft, in der es keine partikulären Willen und daher kein partikuläres Interesse geben kann, oder in der sie doch allzu schwach sind, um auch nur den Versuch machen zu können, sich gegen das Allgemeininteresse aufzulehnen.
Die zweite, etwas weniger optimistische Ansicht findet sich in der soeben abgedruckten Stelle ausgesprochen, wo er sagt, daß „die Plus und Minus der privaten Willen sich aufheben, so daß „als Differenz der Summe“ nur der allgemeine Wille übrig bleibt. Die erste, völlig optimistische Auffassung findet sich beispielsweise in einer kleinen Polemik gegen den Marquis d'Argenson : „Er sagt, jedes Interesse hat verschiedene Prinzipien. Die Verbindung zweier „intérêts particuliers“ (auch hier der charakteristische Ausdruck!) geschieht als Ausdruck des Gegensatzes gegen das Interesse eines Dritten“ (einer der Hauptgrundsätze der politischen Interessenlehre!). Rousseau bemerkt dazu: „Er hätte hinzufügen können, daß die Übereinstimmung aller Interessen sich bildet als Ausdruck des Gegensatzes gegen das Interesse von Jeder-
[1] Daß Rousseau's „Contrat social“ nicht ,rousseauistisch' oder ,romantisch' ist, daß er stoisch gedacht ist, intellektualistisch, nicht schon „voluntaristisch“ d. h., daß „die traditionelle Überordnung eines rationalen Vermögens über die irrationalen Affekte noch nicht umgekehrt ist“, zeigt sehr klar Schmitt-Dorotic, Diktatur, S. 122.
[2] Ihr ganzer Inhalt steckt in den folgenden Sätzen, die wahrscheinlich unmittelbar durch Machiavelli angeregt sind: „Wenn man die Dinge menschlich betrachtet, sind die Gesetze der Gerechtigkeit unter Menschen kraftlos (vaines); sie fördern nur den Bösen und schädigen den Gerechten, wenn dieser sie jedermann gegenüber, und keiner ihm gegenüber beobachtet“.
[140]
mann. Wenn es keine widerstreitenden Interessen gäbe, so würde das Gemeininteresse kaum bemerkt werden, da es niemals an ein Hindernis stieße; alles würde von selbst laufen, und die Politik würde aufhören, eine Kunst zu sein“ [1]. Hier spricht ganz deutlich Mandeville und die „List der Idee“. Es ist übrigens interessant, daß auch heut noch die konsequenten Schüler des Genfers, die marxistischen Gesellschaftsphilosophen, die Existenz einer Politik als besonderer „Kunst“ schlankweg leugnen: „Eine .politische Theorie' des Marxismus, die man unabhängig von seiner soziologischen Theorie behandeln könnte, gibt es überhaupt nicht. Denn die Politik, das heißt die Aufstellung eigener und die Bekämpfung gegnerischer staatlicher Ziele, ist für den Marxismus nur ein Stück des kausalgesetzlichen Gesellschaftsprozesses“[2]. Das steht selbstverständlich in einem anderen Zusammenhang und ist anders gemeint als die soeben angeführten Worte Rousseaus: aber es liegt doch der gleiche großartige Gedanke zugrunde, daß es in einem auf der Gerechtigkeit aufgebauten, und das heißt: einem klassenlosen Staate keine Politik geben würde, weil es keine Partikulärinteressen gibt, die sich kämpfend auszugleichen haben[3].
Einen solchen Staat zu „imaginieren“, ist die Absicht Rousseaus. Er „soll“ so beschaffen sein, „als ob“ die Gesellschaft, nachdem sie sich durch einen Unionsvertrag erst einmal begründet hätte, sich als „Constituante“, wie man später sagte, eine Verfassung gegeben hätte, die die Souveränität des Allgemeinen Willens über alle partikulären Willen begründet und aufrechterhält. Dann sind alle frei: denn jeder ist nur seinem eigenen, in seiner Eigenschaft als Gesetzgeber ausgesprochenen Willen unterworfen; und dieser Wille, der ja per definitionem nichts als die allgemeine Freiheit und das allgemeine Wohl wollen kann, ist allmächtig und allgütig und, wenigstens auf die Dauer, auch allweise[4].
[1] A. a. O. II, Kap. III, Anm.
[2] Adler, Staatsauffassung des Marxismus, S. 18.
[3] Auch für Quesnay sind Ethik, Ökonomik und Politik eines und dasselbe. Er beruft sich auch hierfür auf China: „Les Chinois ne distinguent pas la Morale de la Politique“. Aug. Oncken, Gesch. d. Nat.-Ök. I, S. 341.
[4] Vgl. Schmitt-Dorotic, Diktatur, S. 120. Übrigens findet sich auch dieser Gedanke recht deutlich bei Spinoza: er spricht von der Übertragung aller Rechte des Naturzustandes auf eine Genossenschaft, deren „Recht Demokratie genannt wird“, „die demnach als eine allgemeine Verbindung von Menschen definiert wird, die gemeinschaftlich das höchste Recht zu allem hat, was sie kann. Hieraus folgt, daß die höchste Macht durch kein Gesetz gebunden sei, sondern daß ihr alle in allem gehorchen müssen. ... In einem demokratischen Staate ist Widersinniges weniger zu befürchten, ... wegen der Grundlage und des Zweckes desselben, der kein anderer ist als das Widersinnige der Triebe zu vermeiden und die Menschen, soweit es geschehen kann, damit in den Grenzen der Vernunft zu halten“. (Theol.-Polit. Trakt., S. 353/4). „Der Untertan kann sogar nichts gegen den Beschluß und die Vorschrift seiner eigenen Vernunft tun, so lange er nach den Anordnungen der höchsten Gewalt handelt; denn er hat ja auf den Rat der Vernunft sich durchaus entschlossen, sein Recht, nach eigenem Urteil zu leben, ihr zu übertragen“ (ib. S. 411). In dieser Abdikation des eigenen Partikulärwillens liegt gerade die rechte Freiheit, und „der Endzweck des Staates ist also im Grunde die Freiheit“: ebenfalls einer der wichtigsten Gedanken Rousseaus, der dann von Kant weitergeführt worden ist. Denn „der von der Vernunft geleitete Mensch ist im Staate, wo er nach gemeinsamem Beschlüsse lebt, mehr frei als in der Einsamkeit, wo er sich allein gehorcht“ (Ethik, S. 202).
[141]
Diese Unterscheidung zwischen dem allgemeinen und den partikulären Willen und Interessen wird nun auch terminologisch festgelegt. Jene sind der Inbegriff des „Staates“, diese der „Gesellschaft“. Rousseau sagt in dem für die Enzyklopädie geschriebenen „Discours sur l'Economie politique“: „Jede staatliche Gesellschaft ist aus anderen kleineren. Gesellschaften zusammengesetzt, die verschiedenen Gattungen angehören, von denen jede ihre Interessen und Maximen hat. (Wieder die Formeln der „Interessenlehre“!) Aber diese in anerkannter und sichtbarer Form jedem wahrnehmbaren Gesellschaften sind nicht die einzigen, die im Staate existieren: alle einzelnen, die ein gemeinsames Interesse miteinander verbindet, bilden ebenso viele dauernde oder vorübergehende, deren Macht nicht weniger wirklich ist, weil man sie weniger bemerkt, und deren verschiedene wohlbeachtete Verhältnisse die wahre Kenntnis der Sitten ausmachen. Alle diese förmlichen oder stillschweigenden Gesellschaften modifizieren auf vielerlei Art die Äußerungen des öffentlichen Willens durch ihren Einfluß“ [1]. Die „anerkannten und sichtbaren“ Gesellschaften sind die Korporationen, namentlich die privilegierten, die Zünfte, Handelskompagnien usw. : aber die „stillschweigenden, deren Macht nicht weniger wirklich ist“, sind die Wirtschaftsmächte, die man noch heute als das „Agrar“- oder „Industrie“-, oder „Handels-“, oder „Kohlen-“, oder „Petroleuminteresse“ zu bezeichnen pflegt: die neu aufgekommenen Mächte des neuen Feudalismus, die den „Staat“ gerade so lähmen wie seinerzeit die des alten[2].
Die Lehre hat sehr weit gewirkt, im Praktischen wie im Theoretischen. Praktisch geht von hier die Forderung des Grafen Abbé Emmanuel Sieyès aus, alle Innungen, Gewerkschaften, Korporationen usw. zu verbieten: eine Forderung, die der französischen Bourgeoisie selbstverständlich sehr behagte und alsbald zum Gesetz erhoben wurde. Jede solche Einung wurde wie gesagt als „Verbrechen gegen die
[1] Zit. nach Jellinek, Allg. Staatsl., S. 86. Dieselbe Unterscheidung auch im Contrat social IV, cap. 1.
[2] Vgl. Beard (The economical basis of politics, S. 99: „A landed interest, a transport interest, a railway interest, a shipping interest, an engineering interest, a manufacturing interest, a public-official interest, with many lesser interests, grow up of necessity in all great societies and divide them into different classes actuated by different sentiments and views.“
[142]
Menschenrechte“ mit Strafe bedroht; „man sicherte auf diese Weise den Arbeitgebern ein Jahrhundert der Willkürherrschaft ohne Schranken“ [1]: es war ein „verhängnisvolles, vollständiges Versagen der Regierung, die Probleme der Arbeiterklasse zu verstehen“[2].
Praktisch ist von hier ferner und vor allem ausgegangen der Terrorismus der französischen Revolution und neuerdings des Bolschewismus. Das hat Schmitt-Dorotic vortrefflich nachgewiesen: „So viel von Freiheit gesprochen wird, diese Freiheit entspringt nicht dem praktisch vernünftigen Sicherheits- und Behaglichkeitsstreben wie bei den Engländern und bei Montesquieu, sondern trägt das moralische Pathos der vertu. Nur wer moralisch gut ist, ist frei und hat das Recht, sich als Volk zu bezeichnen und mit dem Volk zu identifizieren. Die weitere Konsequenz ist, daß nur, wer die vertu hat, berechtigt ist, in politischen Angelegenheiten mit zu entscheiden. Der politische Gegner ist moralisch korrupt, ein Sklave, der unschädlich gemacht werden muß. Stellt sich heraus, daß die Mehrheit der Korruption verfallen ist, so kann die tugendhafte Minorität alle Mittel anwenden, um der vertu zum Siege zu verhelfen. Der Terror, den sie ausübt, ist nicht einmal Zwang zu nennen, er ist nur das Mittel, dem unfreien Egoisten zu seinem wahren eigenen Willen zu verhelfen, den citoyen in ihm zu wecken. Der Contrat social, der die unmittelbare Selbstherrschaft des freien Volkes als unveräußerliches Recht zum Grundaxiom gemacht hatte, diente so zur Rechtfertigung einer Diktatur und lieferte die Formel für den Despotismus der Freiheit. Das radikalste Freiheitspathos verbindet sich mit rücksichtsloser faktischer Unterdrückung des Gegners, aber das ist eben nur eine faktische und keine moralische Unterdrückung“[3].
In der Literatur der Zeit der absolutistischen, namentlich der gegenreformatorischen, Kämpfe der Landesfürsten gegen die Stände heißt der mit außergewöhnlichen Vollmachten ausgestattete Diktator, der kraft der Staatsräson das positive Recht brechen darf, ein „Kommissar“; so z. B. Wallenstein[4]. Auch hier ist die geistesgeschichtliche Linie zu Rousseau klar gezeichnet. Er nennt im „Contrat“ (III, 1) die Regierung („le prince“) nichts als eine „Kommission“, ebenso die Deputierten (III, 15).
Sobald nun der „Souverän“ selbst, der Gesetzgeber, das freie Volk, (übrigens gegen Rousseaus Rat[5]) die Regierung übernimmt, um die
[1] Antonelli, a. a. O. S. 32.
[2] Laski, a. a. O. S. 49.
[3] Die Diktatur, S. 123.
[4] Bodin hat ein ganzes Kapitel über „offiers et commissaires“ (III, 2).
[5] Vgl. Contrat social, IV, cap. 16: „Gesetzgebende und ausführende Gewalt sind durch die Natur der Sache getrennt. Wenn es möglich wäre, daß der Souverain als solcher die ausführende Gewalt hätte, so würden das Recht und die Tat so miteinander verwirrt werden, daß man nicht mehr wissen könnte, was, und was nicht, Gesetz ist, und der politische Körper, derart entartet (dénaturé), würde bald der Gewalt, zu deren Bekämpfung er begründet ist, zur Beute fallen.“
[143]
Staatsräson des freien Rechtsstaates, die Freiheit aller, gegen die partikulären Willen durchzusetzen, ist der Terror fertig : denn der Kommissar hat sich um das positive Recht nicht zu kümmern: „Der Inhalt der Tätigkeit des Legislators ist Recht, aber ohne Macht, machtloses Recht; die Diktatur ist Allmacht ohne Gesetz, rechtlose Macht [1]... . Der Legislator steht außerhalb des Staates, aber im Rechte, der Diktator außeihalb des Rechts, aber im Staat. Der Legislator ist nichts als noch nicht konstituiertes Recht, der Diktator nichts als konstituierte Macht. Sobald sich eine Verbindung einstellt, die es ermöglicht, dem Legislator die Macht eines Diktator zu geben, ... ist aus der kommissarischen die souveräne Diktatur geworden. Diese Verbindung wird bewirkt durch eine Vorstellung, die inhaltlich die Konsequenz des Contrat social ist, die er aber noch nicht als eine besondere Gewalt nennt, den pouvoir constituant“[2].
Das ist in der Tat der Weg, von dem aus Maximilien Robespierre, „le citoyen vertueux“, und in neuester Zeit Männer von der unzweifelhaft ethischen Grundhaltung eines Lenin zur Verhängung des Terror über ihre Volksgenossen gelangt sind. In unserer kommunistischen Jugend von heute, die neben vielen Wirrköpf en, Verrückten und Verbrechern[3] unzweifelhaft eine große Reihe sittlich höchst stehender Jünglinge umfaßt, ist dieser Gedanke: das Recht des Wissenden zur Anwendung jedes Zwanges gegen die Nichtwissenden oder aus partikulärem Interesse Widerstrebenden, die treibende Kraft; auch hier wird der höchste Idealismus zum Hebel der verderblichsten Pläne und Handlungen.
Aber: ist nicht hier der, kraft der „imitation par opposition“, umgekehrte Machiavellismus auf das deutlichste zu erkennen? Ist Robespierres „vertu“ nicht der nächste Verwandte, geradezu ein Zwillingsbruder der „virtù“ des Florentiners[4] ? Besteht nicht
[1] „Wenn die Gefahr des Gemeinwesens so groß ist, daß der Apparat der Gesetze zum Hindernis wird, ernennt man einen obersten Befehlshaber, der alle Gesetze schweigen heißt“. Ein Diktator darf ungetadelt auch Bürgerblut vergießen, auch gegen die Gesetze (Contr. soc. IV, 6).
[2] Schmitt-Dorotic, Die Diktatur, S. 128/9.
[3] Man sagt Lenin das trübe Bekenntnis nach, daß unter 100 Bolschewisten 50 Verbrecher, 49 Verrückte und ein Idealist sind.
[4] Rousseaus Begriff der „vertu“ ist nicht ganz rein Machiavelli. Auf diesen stützt er sich Contrat social II, 11, wo er als „Hauptinteresse“ der Juden und neuerdings der Araber die Religion, der Athener die Wissenschaften, der Karthager und Tyrer den Handel, der Rhodier die Flotte, Spartas den Krieg, und Roms die Tugend nennt“. Ferner III, 9. Anm., wo er sich unmittelbar auf Machiavellis Ausdruck bezieht. Aber er zitiert auch Montesquieus „Esprit des Lois“, wo die Tugend der Republik als konstituierendes Prinzip beigelegt wird, ein Einteilungsgrund, den R. übrigens nicht gelten lassen will. Man darf übrigens dabei nicht vergessen, daß Montesquieu ausdrücklich nicht von einer „moralischen“ oder „christlichen“, sondern von der „politischen Tugend“ spricht, als die er die „Liebe zum Vaterlande, d.h. zur Gleichheit“ bezeichnet. (Esprit des Lois S. 127, 143).
[144]
auch hier die Gewißheit, daß man um eines hohen Zweckes willen alle, aber auch alle Mittel anwenden darf? Daß dieser höchste Zweck bei Machiavelli die Erlösung des Vaterlandes, bei Rousseau und den Seinen die Erlösung der Menschheit aus grauenhafter Not ist, erklärt sich auf das einfachste aus der Situation : damals war die Not politisch, national, jetzt ist sie ökonomisch, international, bedingt.
Um auf die theoretischen Auswirkungen der Lehre zu kommen, so hat sie einen ungeheuren Einfluß auf keinen Geringeren als Kant ausgeübt. Er formuliert als „drittes praktisches Prinzip des Willens, als oberste Bedingung der Zusammenstimmung desselben mit der praktischen Vernunft, die Idee des Willens jedes vernünftigen Wesens als eines allgemein gesetzgebenden Willens ... Der Wille wird also nicht lediglich dem Gesetze unterworfen, sondern so unterworfen, daß er auch als selbstgesetzgebend und eben um deswillen allererst dem Gesetze (davon er selbst sich als Urheber betrachten kann) unterworfen angesehen werden muß“ [1].
So individualistisch und rationalistisch der Ausgangspunkt (bei dieser Art von Betrachtungen notwendigerweise) ist, so greifen sie doch sofort ins Soziale hinüber[2]. Denn offenbar kann es für ein isoliertes Wesen keine Pflichten geben, weil es keine fremden Interessen gibt, die Anspruch auf Achtung haben. Und so „führt denn dieser Begriff eines jeden vernünftigen Wesens auf einen ihm anhängenden sehr fruchtbaren Begriff, nämlich den eines Reiches der Zwecke. Ich verstehe aber unter einem Reiche die systematische Verbindung verschiedener vernünftiger Wesen durch gemeinschaftliche Gesetze“ (70). „Es gehört aber ein vernünftiges Wesen als Glied zum Reiche der Zwecke, wenn es darin zwar allgemein gesetzgebend, aber auch diesen Gesetzen selbst unterworfen ist. Es gehört dazu als Oberhaupt, wenn es als gesetzgebend keinem Willen eines anderen unterworfen ist“ (70/1)[3].
Wenn Kant die Folgerung aus der von Rousseau gemachten Unterscheidung, den souveränen Volksstaat, ins Metaphysische erhöhte und aprioristisch unterbaute, so hat Hegel die Unterscheidung selbst nicht nur begrifflich, sondern auch (auch er war ja Staatsphilosoph) ter-
[1] Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, S. 67/8.
[2] Von hier aus hat Fichte den vollen Schritt zur Romantik getan, indem er, fortschreitend „über das Naturrecht und seine eigene Frühzeit mit dem Rechtsbegriff das Moment der Rechtsgemeinschaft als solcher unlösbar verknüpft“ (Metzger, a. a. O. S. 161) und zugleich den Rechtsstaat zum Kulturstaat erweiterte und erhöhte.
[3] Das ist fast wörtlich aus dem Contrat social I, 6 entnommen.
[145]
minologisch angenommen; in seiner 1821 erschienenen Rechtsphilosophie ist sie durchgeführt [1]. Und zwar wird die Gesellschaft, ganz im Sinne Rousseaus, zum „System der Bedürfnisse“, dem der Staat, als das „System der Sittlichkeit“, entgegensteht[2]. Auch hier stehen volonté générale und particulière im Streit: „Jetzt aber tritt das Verhältnis ein, daß das Besondere das erste für mich bestimmende sein soll, und somit ist die sittliche Bestimmung aufgehoben. Aber ich bin eigentlich nur darüber im Irrtum, denn indem ich das Besondere festzuhalten glaube, bleibt doch das Allgemeine und die Notwendigkeit des Zusammenhanges das Erste und Wesentliche; ich bin also überhaupt auf der Stufe des Scheins, und indem das Besondere mir das Bestimmende bleibt, das heißt der Zweck, diene ich damit der Allgemeinheit, welche eigentlich die letzte Macht über mich behält“[3].
Die Stelle ist aus zwei Gründen sehr wichtig. Erstens enthält sie offenbar einen der Gedanken Hegels, von denen die Marxsche „materialistische Geschichtsauffassung“ ausgegangen ist, wie Adler selbst andeutet, „nur daß Marx die Auflösung dieses „Scheines“ anders vollzieht als Hegel. Bei diesem erwächst der Schein notwendig aus der Entzweiung des objektiven Geistes und kann erst überwunden werden durch einen geistigen Prozeß, nämlich durch die Hinlenkung des Bewußtseins auf das einheitliche Wesen dieses objektiven Geistes. Bei Marx wird dieser Schein als das notwendige Produkt einer bestimmten historischen Form der menschlichen Vergesellschaftung aufgezeigt, nämlich jener Form, in welcher alle Akte der Vergesellschaftung lediglich durch isolierte, sich ihrer Vergesellschaftung nicht bewußte Individuen vollzogen werden müssen, und wird überwunden durch die Beseitigung dieser Gesellschaftsordnung. Bei Hegel bleibt Entstehung des atomistischen Scheins und seine Auflösung ein Prozeß innerhalb des Bewußtsein, bei Marx wird er zu einem Prozeß des realen Geschehens, der diese Wandlungen des Bewußtseins unmittelbar kausal bestimmt“ (S. 42/3).
Auf diese Weise hat Marx bekanntlich den „Fetischismus“ der Ware und ihres Wertes aufgedeckt, jenen Prozeß, in dem die Menschen ihr eigenes gesellschaftliches Produkt wie ein selbständiges, mit Kräften begabtes Wesen ansehen, während doch der Wert nichts anderes ist als „ein Verhältnis zwischen Personen, vermittelt durch Sachen“. Diese, völlig richtig beobachtete, psychische Täuschung soll nun auf den Staat Anwendung finden. Aber der Vergleich hinkt auf beiden Füßen. Denn der Staat ist eben kein Produkt der gesellschaftlichen
[1] Vgl. Barth, Philosophie der Gesch. als Soziologie, S. 251 Anm.
[2] Vgl. Adler, Staatsauffassung des Marxismus, S. 39.
[3] Zit. nach Adler, a. a. O. S. 41.
[146]
Arbeitsteilung wie die Ware, sondern „ganz etwas anderes“, wie uns Wundt sagte. Wir werden sofort einiges über die „materialistische Geschichtsauffassung“ zu sagen haben: hier mag es uns erlaubt sein, vorgreifend folgendes zu bemerken:
Die Auffassung „der bürgerlichen Gesellschaft als eines bloßen Scheines der atomistischen Selbständigkeit ihrer Elemente“ ist auch die unsere. Aber wir sehen die reale Ursache nicht in der Isolierung der Individuen in der Arbeitsteilung: denn diese hat, abgesehen von dem sehr problematischen Urkommunismus, den auch Adler selbst als „legendarisch“ bezeichnet, immer bestanden, auch in der „einfachen Warenproduktion“ [1] und sogar auf jeder nur etwas geförderten Stufe der prähistorischen Gesellschaft[2]. Und so erblicken wir die reale Ursache jenes Scheins freilich ebenfalls in „einer bestimmten historischen Form der menschlichen Vergesellschaftung, in welcher alle Akte der Vergesellschaftung lediglich durch isolierte, ihrer Vergesellschaftung nicht bewußte Individuen vollzogen werden müssen“ : aber wir erkennen mit Hegel den „Prozeß des realen Geschehens“, durch den sie isoliert worden sind, in der Zerstörung der alten, natürlich gewachsenen Bindungen der vorkapitalistischen Zeit[3] durch die, „zur Macht gewordene Gewalt“[4]: den absoluten Staat und den mit ihm verschwisterten Kapitalismus.
Um nun zu Hegel zurückzukehren, so kam er von der sehr wenig begründeten Annahme aus, daß schon heute ohne weiteres, kraft der List der Idee, jeder, der sich von seinem Besonderen bestimmen läßt, eben dadurch „der Allgemeinheit dient“, zu der Staatsvergötzung, mit der er die Staatsvergötterung der Romantik noch übergipfelte. Denn die bürgerlichen Romantiker vergötterten den Staat, weil sie ihn mit der gewachsenen Gemeinschaft verwirrten, die ihnen, weil sie gewachsen, und nicht gemacht war, mit allen ihren „Knorren und Knubben“[5] als heilig erschien, jedem Volke die seine. Hegel aber identifiziert
[1] S. S. III, S. 387/8.
[2] S. S. I, S. 866ff. namentlich 870ff.
[3] Hegel sagt (cit. nach Raumer, Gesch.d.Entw.d.Begr.Recht, Staat,Pol., S. 179): „Ohne Mitglied einer berechtigten Körperschaft zu sein, ist der Einzelne ohne Standesehre, durch seine Vereinzelung auf die selbstsüchtige Seite seines Gewerbes zurückgebracht, sein Unterhalt und Genuß nichts Stehendes. In der Körperschaft verliert die Hilfe, welche die Armut empfängt, ihr Zufälliges so wie ihr mit Unrecht Demütigendes; und der Reichtum, in seiner Pflicht gegen die Genossenschaft, den Hochmut und Neid, den er (und zwar jenen in seinem Besitzer, diesen in andern) erregen kann ; die Rechtschaffenheit erhält ihre wahre Anerkennung und Ehre. Heiligkeit der Ehe und Ehre in der Korporation sind die zwei Momente, um welche sich Erhaltung und Auflösung der bürgerlichen Gesellschaft drehen.“
[4] S. S. I, S. 376ff.
[5] Lessing, Ringfabel im „Nathan“.
[147]
den überhistorischen mit dem historischen Klassenstaat der Wirklichkeit.
Freilich ist dieser überhistorische Staat nicht der absolute Rechtsstaat Kants. Aber er ist doch in jeder Zeit die vollkommenste mögliche Verwirklichung dieses Ideals. Denn „alles, was ist, ist vernünftig“ in dem Sinne, daß der Weltgeist — oder der objektive Volksgeist [1] — in dialektischer Selbstentwicklung die geschichtlichen Geschehnisse aus sich herausstellt, um in immer neuen Synthesen immer höhere Stufen zu ersteigen. „Auf diese Weise wird die Spitze der revolutionären Waffe umgedreht ... und die Spitze auf den Revolutionär selbst gerichtet. Die Forderung nach Freiheit wird angenommen, aber als Gehorsam gegen das Gesetz gedeutet. Dem Verlangen nach einer durch Vernunftprinzipien geordneten Gesellschaft wird nachgegeben, aber in der Weise, daß diese Vernunft der bestehenden Gesellschaft zugeschrieben wird. Sogar das Selbstbewußtsein der Persönlichkeit wird ... auf feinste und leiseste Weise in einen Ausdruck des allgemeinen Willens verwandelt“ : das beste Beispiel für die höchste Maxime dialektischer Kunst, Anerkennung der Behauptungen eines Gegners als das sicherste Mittel seiner Vernichtung.[2]
„Hegel gibt ja zu, daß schlechte Staaten existieren, aber er behandelt sie sehr summarisch. Er sagt: „Der Staat ist wirklich, und seine Wirklichkeit besteht darin, daß das Interesse des Ganzen sich in die besonderen Zwecke realisiert... Insofern diese Einheit nicht vorhanden ist, ist etwas nicht wirklich, wenn auch Existenz angenommen werden dürfte. Ein schlechter Staat ist ein solcher, der bloß existiert, ein kranker Körper existiert auch, aber er hat keine wahrhafte Realität“[3].“
Mit solchen Wortspielen, der Unterscheidung ohne Unterschied zwischen „Existenz“ und „Wirklichkeit“, die die Entscheidung nur
[1] „Der Weltgeist, dessen alleinigen Inhalt die Vernunft selbst bildet, und der zu seiner Selbstoffenbarung den Sternenreigen der Volksgeister hervorruft, bildet und leitet“ (Meinecke, Staatsräson, S. 441). Derselbe (Weltb. S. 231) zitiert folgende Stelle aus Hegels Rechtsphilosophie: „Der Staat ist kein Kunstwerk, er steht in der Welt, somit in der Sphäre der Willkür, des Zufalls und des Irrtums, übles Benehmen kann ihn nach vielen Seiten defigurieren. Aber der häßlichste Mensch, der Verbrecher, ein Kranker und Krüppel ist immer noch ein lebender Mensch: das Affirmative, das Leben besteht trotz des Mangels, und um dieses Affirmative ist es hier zu tun“. Meinecke zeigt sehr fein, daß der friderizianische Staat, der auf die Hegeische Weise vergötzt wurde, doch nicht als der Träger der Humanitätsidee betrachtet werden durfte, wie das die jungen Preußen taten, die gern den deutschen Kulturgedanken mit dem preußischen Staatsgedanken verschmelzen wollten. Waren auch Kants Rigorismus und Preußens Beamten- und Militärgeist innerlich verwandt, so war doch ein Zufall, daß Weimar und Potsdam in eine Zeit fielen (Weltb. S. 37).
[2] Hobhouse, Die metaphysische Staatsidee, S. 24/5.
[3] Hobhouse, a. a. O. S. 104.
[148]
terminologisch erzwingen wollen [1], kann man nur solche täuschen, die getäuscht sein wollen.
Und so gab denn Hegel seiner brüchigen Konstruktion eine sehr starke Stütze, indem er die ganze Fülle der heiligenden Attribute, die die Romantik auf die als Staat mißverstandene Gemeinschaft gehäuft hatte, auf seinen Staat übernahm, wie das schon vorher vor allem Fichte getan hatte, der den dürren Rechtsstaat der Aufklärung zum Kulturstaat erhöhte[2].
Das übernahm Hegel von der Romantik ; indem er auch noch alle die ewigen, göttlichen Eigenschaften der Gemeinschaft auf seinen historisch-überhistorischen[3] Staat überträgt, — Eigenschaften, die Niemand jemals so wunderbar erkannt und in so hinreißendem Hymnus beschrieben hat als er[4] — so kann nur jene Staatsidolatrie daraus werden, die ihm so viele Feinde gemacht hat: „Während das nationale Gemeinwesen früher nicht anders als das „Volk“ bezeichnet wurde, was gerade in der damaligen Situation durchaus romantisch-„organisch“ klang, hat Hegel nunmehr — in keineswegs bloß terminologischer Umprägung — das Faktum des „Staates“, also die festgefügte und festgeregelte Rechtsorganisation, als die „wahrhafte Gestaltung des sittlichen Lebens“, als die „Wirklichkeit der sittlichen Idee“ in Kraft und Geltung gesetzt. Mit dieser Wendung gelangt aber Hegel auch zur Anerkennung und Rechtfertigung der zeitgenössischen Wirklichkeit. Was er damals das „Volk“ nannte, das war ein merkwürdiges Gemisch aus romantisierter Antike und romantisierter Feudalzeit, jedenfalls ein durchaus unwirkliches Gedankending; wenn er aber jetzt „den Staat“ konstruiert, so ist das (obwohl sich ja scheinbar wiederum ein Gebilde von zeitlos überhistorischer Bedeutung ergibt) nichts anderes als ein Abbild — freilich ein ins Typische erhobenes Abbild — des Tatbestandes der neuzeitlich bürgerlichen Lebens- und Gesellschaftsordnung“[5]. Daher kam Hegel von hier aus notwendig zum „Machtstaat“ an Stelle des früheren „Rechtsstaates“[6], und gab damit der späteren Machttheorie des Staates das Stichwort, wie sie zuerst Ranke
[1] Ungefähr ebenso hat J. B. Say seine Behauptung bewiesen, daß eine allgemeine Wirtschaftskrise unmöglich sei, weil jedes Angebot von Produkten zugleich Nachfrage nach anderen sei. Nun gab es aber allgemeine Krisen! Da erklärte Say, er verstehe unter dem Begriff „Produkte“ nur solche Waren, die Nachfrage und Absatz fänden. Vgl. S. S. III, S. 1014.
[2] Mehlis, Lehrbuch d. Gesch.-Phil., S. 448. Zu Fichte vgl. a. Metzger, a. a. O. S. 161/2; ferner Ewald, Probleme der Romantik, S. 42.
[3] Man denkt hier wirklich an Mephistos „sinnlich-übersinnlichen Freier“, die hohe Intuition, die dann, „ich will nicht sagen, wie“ schließt.
[4] S. S. I, S. 392.
[5] Metzger, a. a. O. S. 313. Vgl. Raumer, a. a. O. S. 217.
[6] Metzger, a. a. O. S. 338
[149]
vertrat, ohne den Kulturcharakter des Staates zu verkennen; er zuerst hat mit vollem Bewußtsein die Erkenntnisse der Interessenlehre für die Historik nutzbar gemacht [1]; von hier aus ist dann die massivere Schule der Machttheoretiker ausgegangen, deren Hauptvertreter Treitschke ist[2], zu der aber auch in gewissem Sinne Frantz gerechnet werden muß.
Diesen Zusammenhängen ist Heller mit großer Liebe nachgegangen. Er zeigt ebenfalls, daß Machiavelli bei Hegels Arbeit Pate gestanden hat (a. a. O. 53), und daß vielleicht noch stärkere Anregung ihm von Spinoza zugekommen ist (57). „Hegel hat die von Spinoza und Machiavell empfangenen Anregungen in das großartige Gebäude seiner Staatslehre mit eingebaut. „Ihm ist der Staat Macht und nichts anderes als Macht, in erster Linie Kriegsmacht, in zweiter Finanzmacht“ (38). Heller zeigt in Uebereinstimmung mit Meinecke, daß Rankes „Prinzip der allgemeinen Geschichte“ dem Hegeischen Weltgeist sehr nahesteht, jenes Prinzip, das sich „in steten Konflikten und Kämpfen durchsetzt“ (49/50). Auch Droysen (176, 181) und Duncker (185) waren in dieser Beziehung Schüler Hegels, ebenso Bismarck (195) und Clausewitz (203)[3].
Wie in die Politik drangen über Hegel fort Rousseausche Gedanken auch in die Jurisprudenz ein. Vor allem ins Strafrecht. In der „Neuen Revision der Grundbegriffe des Kriminalrechts“ des erklärten Hegelianers Köstlin (1845) heißt § 6: „Das peinliche Unrecht ist die Verletzung des Rechts als Recht, die direkte Entgegensetzung des besonderen Willens gegen die Forderung seiner Identität mit dem allgemeinen“[4]. Später schreibt Ihering: „daß die Gewalt den Sonderwillen mit eiserner Faust bricht“ (819).
[1] Vgl. Meinecke, Weltbürgertum, S. 301 ff.
[2] Politik I, S. 33: „Die Macht ist das Prinzip des Staates“, S. 35: „Als eine unabhängige Macht haben wir den Staat bezeichnet“.
[3] Von hier geht der Weg zu Treitschke: „Daraus ergibt sich also, daß man unterscheiden muß zwischen öffentlicher und privater Moral. Die Rangordnung der verschiedenen Pflichten muß für den Staat, da er Macht ist, notwendig eine ganz andere sein als für die einzelnen Menschen. Eine ganze Reihe dieser Pflichten, die dem Einzelnen obliegen, ist für den Staat überhaupt nicht zu denken. Als höchstes Gebot für ihn gilt immer, sich selbst zu behaupten; das ist für ihn absolut sittlich. Und darum muß man aussprechen, daß unter allen politischen Sünden die der Schwäche die verwerflichste und verächtlichste ist, sie ist die Sünde gegen den heiligen Geist der Politik... . Verfolgen wir aber die Konsequenzen dieser Wahrheit, so ist klar, daß der Staat sich nur sittliche Zwecke setzen darf... . Dagegen beginnt eine Reihe der schwierigsten Fragen mit der Erwägung, inwiefern für an und für sich sittliche Zwecke in der Politik die Anwendung von Mitteln erlaubt ist, die im bürgerlichen Leben als verwerflich betrachtet werden würden. Das bekannte Jesuitenwort ist ja in seiner Schroffheit roh und radikal, aber daß es eine gewisse Wahrheit enthalt, kann niemand bestreiten“ (Politik I, S. 100ff.).
[4] Landsberg, a. a. O. S. 675/6.
[150]
Und auch die Interessenlehre spielt in die Gedanken dieses großen Kopfes ein: „Auch die Rechtssätze und die Rechtsbegriffe, selbst die Regeln der Rechtslogik fügen sich dem unüberwindlichen Druck des Interesses“ (807). Das ganze Privatrecht ist nicht nur eine „Arena für den Willen, sich darauf zu bewegen und zu üben, sondern er stellt nun bereits ab auf die Vorstellungsreihe: Nutzen, Gut, Wert, Genuß, Interesse“ (812). Der praktische Zweck als Triebkraft treibt Staat und Recht hervor, nicht die logische Triebkraft des Begriffes (818).
---
Hier haben wir eine andere Synthese der beiden von Anfang an so verschiedenen, miteinander dauernd im Kampfe liegenden Lehren vom Staate, Platon vermählt mit Machiavelli, der, wie schon gesagt, wie in Rousseau so auch in Hegel einen entschlossenen Verteidiger fand. „Es wurde erreicht, was Spinozas Pantheismus versuchte, aber mit den mechanischen und ungeschichtlichen Denkmitteln seiner Zeit nicht hatte zustande bringen können. Es wurde die Vernunft, die in der geschichtlichen Wirklichkeit selber steckt, erfaßt und als ihr Kern, als ihr innerstes Lebensgesetz verstanden... Die Einheit der Gottnatur offenbarte sich in der geschichtlichen Welt. Dann traten aber auch Staatsraison und Machtpolitik in ein ganz neues Licht... . Dann konnte der neue Vernunftbegriff auch an den Widersprüchen und scheinbar ungelösten Gegensätzen dieses geschichtlichen Lebens nicht mehr scheitern, denn er nahm durch seine Dialektik ..., diese Gegensätze als notwendige Vehikel des Fortschritts und der Steigerung in sich auf, und sanktionierte damit nun in einem Grade, den man früher nie für möglich gehalten hätte, auch den gesamten Kausalzusammenhang der Geschichte mit all seinen düsteren und grauenhaften Abgründen. Alles, alles dient der fortschreitenden Selbstverwirklichung der göttlichen Vernunft, und ihre List ist es, auch das Elementare, auch das Böse für sich arbeiten zu lassen... . Dann mußte aber auch die Seele des Staates, die Staatsräson, und der Kern der Lehren Machiavellis sanktioniert werden. ... Es war fast wie die Legitimierung eines Bastards, was hier geschah“ [1]. „Der wirkliche Staat war der vernünftige Staat“[2].
Wenn wir die beiden Synthesen vergleichen, die von Rousseau und die von Hegel ersonnene, so unterscheiden sie sich vor allem dadurch, daß der erste, von dem historischen Staat der Wirklichkeit und seinen inneren Gegensätzen ausgehend, dadurch zum vollkommenen Rechtsstaate zu gelangen sucht, daß er diese inneren Gegensätze ausschaltet oder doch wenigstens entgiftet oder denaturalisiert. Hegel aber geht von dem besten Staate aus, den er auf Grund einer zweifellos
[1] Meinecke, a. a. O. S. 434/5.
[2] Ib. S. 453.
[151]
dogmatischen Metaphysik, durch Identifizierung der geistigen und der natürlichen Welt, als Stufe der Entwicklung (die mit der Dialektik des Weltgeistes eines und dasselbe ist) in dem verderbten Staate der Wirklichkeit erkennt. Jener geht vom Bekannten zum Unbekannten, dieser vom Unbekannten zum Bekannten vor: welche Methode — (nur von der Methode soll hier die Rede sein, die Kritik verschieben wir bis zu dem Zeitpunkte, wo wir dieses ganze Geknäuel von Philosophemen, halben und falschen Beobachtungen, vorschnellen Verallgemeinerungen usw. zusammen unter die Lupe werden nehmen können) — welche Methode vorzuziehen ist, braucht nicht ausgesprochen zu werden. Wir werden zu beweisen versuchen, und denken, daß uns der Beweis glücken wird, daß Rousseaus Grundgedanken völlig richtig war.
---
Damit haben wir die eine Quelle aufgewiesen, aus der die sozialistische Staatsidee ihre soziologische Einstellung erhalten hat. Die zweite Quelle ist, wie wir sagten, St. Simon und die St. Simonisten.
Eine kurze Vorbemerkung zur Aufklärung der Verwirrung, die in der Terminologie der Begriffe „Staat“ und „Gesellschaft“ besteht.
Der Staatsphilosoph, der sich des hier bestehenden Gegensatzes bewußt wird, hat als solcher den philosophischen Staatsbegriff, d. h. den des Ideal-oder Rechtsstaats. Das ist selbstverständlich für ihn „der“ Staat. Und so wird er dessen Gegenspieler als die „Gesellschaft“ bezeichnen. Umgekehrt wird der vorwiegend historisch oder ökonomisch eingestellte Nichtphilosoph den Staat der Wirklichkeit als „den“ Staat ansehen und ihm als das Ideal die „Gesellschaft“ entgegenstellen.
Rousseau und Hegel hatten die spezifische Einstellung des Philosophen, und daraus erklärt sich zwanglos die von ihnen eingeführte Bezeichnung.
Ob St. Simon als Philosoph gelten kann, ist hier nicht zu untersuchen: wenn er es war, war er es keinesfalls im Sinne der deutschen Idealphilosophie und Rousseaus. Er war mehr oder weniger bereits Positivist wie sein Schüler Comte. Er war vorwiegend historisch und ökonomisch gerichtet, und seine Schüler, die die berühmte „Doctrine St. Simonienne“ herausgaben, Bazard und Enfantin, waren schon fast ausschließlich Ökonomisten. Wenn sie vom „Staat“ sprechen, so meinen sie den Staat ihrer Wirklichkeit, dem der Meister namens der „Bienen“ gegen die „Drohnen“, dem die Schüler bereits namens der Ausgebeuteten gegen die Kapitalisten den Kampf ansagten. Und so stellen sie diesem verderbten, schlechten, todesreifen „Staate“ als sein ideales Gegenbild die „Gesellschaft“ gegenüber, die sie fast nur als ökonomische Gesellschaft begreifen.
Als die Hegelschüler Lorenz Stein und Karl Marx mit diesen Ge-
[152]
danken bekannt wurden, schlug der Flammenbogen zwischen der westeuropäischen und der deutschen Soziologie über [1].
Stein brachte die Staatsverehrung seines Meisters ein und behielt seine Terminologie bei. Aber inhaltlich trat ein radikaler Wandel ein; er übernahm die Kritik des St. Simonismus an dem aus Staat und Gesellschaft gemischten Komplex, aber er nannte das Schlechte umgekehrt wie Enfantin die „Gesellschaft“, und das Ideale den „Staat“. Aber wenn er auch die Hegeischen Ausdrücke bewahrte: den Hegel- schen Staatsoptimismus hat er ganz verloren. Es ist fast tragisch zu lesen, wie bei ihm „Ideal und Wirklichkeit“ sich begegnen, und das Ideal zerbricht. Es erkennt zu seinem Schmerze, daß der Staat durch die „Gesellschaft“ je länger je mehr gelähmt, gefesselt und verhindert wird, seine große Aufgabe des Schlichters und Richters über den partikulären Interessen zu erfüllen[2], dieser Interessen, deren Inbegriff ihm wie Rousseau und Hegel, die Gesellschaft ist:
„Die Gesellschaft ist derjenige Organismus unter den Menschen, der durch das Interesse erzeugt wird, dessen Zweck die höchste Entwicklung des Einzelnen ist, dessen Auflösung aber dadurch erfolgt, daß in ihm jedes Sonderinteresse sich das Interesse aller anderen mit allen Mitteln unterwirft. Der Staat dagegen ist als selbständige Persönlichkeit von dem Willen und dem Interesse der Einzelnen unabhängig, und da er die Einheit Aller in seiner Persönlichkeit umfaßt, so ist es klar, daß die Interessen jedes Einzelnen, mithin auch die Interessen desjenigen, der durch den Gegensatz der anderen Interessen bedroht ist, zugleich die seinigen sind.
„Es ist einleuchtend, daß, da der Staat als allgemeine Persönlichkeit eine Vielheit von Menschen umfaßt, ... dieselbe Einheit von Menschen, welche die allgemeine Persönlichkeit des Staats bildet, auch zugleich, auf der Grundlage ihrer Individualität, eine Gesellschaftsordnung bilden werden. Jede Betrachtung von Staat und Gesellschaft muß mithin davon ausgehen, daß jeder Staat zugleich eine Gesellschaftsordnung ist, und daß umgekehrt jede Gesellschaftsordnung ein Staat ist“[3].
Die letzten Worte sind weder klassifikatorisch noch methodologisch zu verstehen. Der Ausdruck „Gesellschaftsordnung“ könnte die letztgenannte Vermutung aufkommen lassen, aber mit ihm meint
[1] S. S. I, S. 40/1.
[2] Für Stein ist ganz genau dasjenige „Staat“, was Rousseau im „Contrat social“ „Etat“ nennt, wenn er passiv, Souverän, wenn er aktiv ist: die Fleisch gewordene „Volonté générale“: „Folgt daraus, daß der allgemeine Wille vernichtet oder verdorben ist? Nein, er ist immer da, unveränderlich und rein, aber er ist anderen Willen unterworfen, die ihn überwunden haben“: die partikulären Interessen. (Contrat social IѴ, Cap. 1). Von Stein übernahm Gneist den Gegensatz (Landsberg, a. a. O. S. 974f).
[3] Die Gesellschaftslehre, Stuttgart und Augsburg, 1856, S. 33.
[153]
er durchaus nicht die Rechtsform der Gesellschaft, sondern die Hierarchie der Klassen. Er meint genau das, was wir den „Klassenstaat“ nannten. Für ihn ist jede Gesellschaftsordnung eine „notwendige Ordnung der Ungleichheit“ [1]. Er steht durchaus im Banne der bürgerlichen Grundvoraussetzung, die wir hier in ihren Wurzeln aufsuchen: er kann sich eine nicht hierarchisch gegliederte Gesellschaft nicht vorstellen. Hier haben wir nicht, wie bei Kistiakowski, den Unterschied zweier verschiedener Erkenntnisobjekte, sondern den Gegensatz zweier Ordnungen des Eigentums und des Rechts: einer idealen, die er mit Hegel „Staat“ nennt, und einer „positiven“, die er „Gesellschaft“ nennt.
Genau diesen Gegensatz hat auch die sozialistische Staatsidee im Auge, nur daß sie die Bezeichnungen wieder umkehrt. Sie nennt „Staat“ das Positive, das verbessert, und „Gesellschaft“ das Ideal, das erreicht werden soll oder besser: naturgesetzlich erreicht werden wird. Denn auch sie hat, wie früher der dritte Stand, gegen den historischen Staat zu kämpfen, nur daß jetzt nicht mehr die feudalen Privilegierten, sondern die „Kapitalisten“ die Gegner sind. Deren Inbegriff wird jetzt die „kapitalistische Gesellschaft“ genannt, und der Staat wird als deren Scherge und Büttel aufgefaßt[2], während die von dem vierten Stande erstrebte ideale Gesellschaft als die sozialistische oder auch als „die“ Gesellschaft schlechthin bezeichnet wird[3]. Man nennt sie auch wohl, wenn weniger der wirtschaftliche Inhalt als die politischrechtliche Form ins Auge gefaßt wird, den „sozialistischen Staat“ oder den „Zukunftsstaat“. Hier wirkt die Hegeische Wortwahl noch nach, obgleich man ihn sonst überall „auf die Füße gestellt“, d. h. umgekehrt hat. Dieses Gebilde ist selbstverständlich, wenigstens der Absicht nach, identisch mit dem überhistorischen Philosophenstaat, dem „Rechtsstaat“ Fichtes, mit Rousseaus von allen partikulären Interessen befreitem Staat.
Hier gilt es, ein Mißverständnis zu verhüten. Max Adler sagt einmal : „Der Marxismus erblickt im Staat eine historische Erscheinungsform der Gesellschaft. Gesellschaft und Staat sind für den Marxisten nicht zwei verschiedene Dinge“[4]. „Das Eigentümliche der Staatsform ist also dieses, daß sie stets die Vergesellschaftung unter dem Begriff des Allgemeininteresses denkt, während es in Wirklichkeit stets die Sonderinteressen der innerhalb der Vergesellschaftung herrschenden Kräfte
[1] Vgl. S. S. I, S. 51/2.
[2] „Der Marxismus versteht unter Staat die organisierte Gewalt einer Klasse zur Unterdrückung einer anderen, wie bereits im Kommunistischen Manifest zu lesen ist“ (Adler, a. a. O. S. 63). „Nur jene Zwangsorganisation ist Staat, deren Inhalt die Klassenherrschaft ist“ (S. 74).
[3] „Die staatsfreie kommunistische Gesellschaft“, Adler a. a. O. S. 209.
[4] Staatsauffassung des Marxismus, S. 33.
[154]
sind, die den Staat konstituieren und sein Wesen ausmachen. Das heißt: es tritt nicht ein für sich bestehendes Etwas, der Staat, einem elementaren anderen Gefüge, der Gesellschaft, entgegen; sondern die Staatsform ist die widerspruchsvolle Ideologie, in welcher die gesellschaftliche Realität erlebt und gestaltet wird. Sie ist widerspruchsvoll, weil sie ihrer Form nach stets auf die Allgemeinheit der Gemeinschaft gerichtet ist, ihrem Inhalte nach aber stets nur Partialinteressen vertritt. Die Idee des Staates vertritt einen allgemeinen Willen und nimmt von dieser Voraussetzung die Berechtigung her, Gesetze zu diktieren, denen jeder sich fügen muß. Aber den Inhalt dieses allgemeinen Willens diktieren nicht „alle“, sondern die herrschenden Klassen, so daß die Gesetze eben nur der in der Form des allgemeinen Willens protokollierte Sonderwille der Herrschenden sind“ (S. 53). „Der richtige Kern in der Hegeischen Lehre von dem Widerspruch zwischen Staat und Gesellschaft ist also der, daß hier eine reale Gegensätzlichkeit innerhalb der gesellschaftlichen Lebensverhältnisse selbst vorliegt, die durch die ideologische Form, in welcher dieselbe im Staate zu einer scheinbar solidarischen Einheit verbunden auftreten, zunächst verdeckt wird. Diese ideologische Form, in welcher die Menschen sich ihrer Vergesellschaftung als eines Rechtszustandes bewußt werden, das heißt: als Glieder einer Allgemeininteressen vertretenden Ordnung, gehört zu den notwendigen Formen des sozialen Bewußtseins überhaupt, und daraus entsteht ja auch der Schein des Widerspruchs zwischen Staat und Gesellschaft“ (S. 55).
Diese Sätze scheinen unserer Behauptung zu widersprechen, daß die sozialistische Staatsidee die Rousseau-Hegelsche Unterscheidung angenommen hat. Aber es ist nur ein Schein. Abgesehen von einigen, der spezifisch Marxschen materialistischen Geschichtsauffassung an- gehörigen Gedanken können wir uns mit dem von Adler ausgeführten Standpunkt vollkommen einverstanden erklären (von der Geschichtsauffassung werden wir sofort zu sprechen haben).
Worum handelt es sich bei Adler? Um eine Polemik gegen eine Darstellung Kelsens, die wirklich oder nur kraft eines Mißverständnisses Adlers (das können wir jetzt nicht untersuchen) den nichthistorischen Juristenstaat mit dem überhistorischen Idealstaat verwirrt [1], das positive Recht ohne weiteres als „verbindlich“ erklärt und vor allem das Recht aus sich selbst ableitet : ein, wie wir wissen, völlig unmöglicher Versuch.
Wir aber sprechen hier nicht von dem „methodologischen“, sondern
[1] Die staatsfreie kommunistische Gesellschaft wird nicht zwangsfrei sein (Adler, S. 209). Wenn man, was eine „zulässige Abstraktion“ ist, die immer notwendige Zwangsorganisation „Staat“ nennt, dann ist auch die Zukunftsgesellschaft ein Staat (S. 121).
[155]
von dem „praktischen“ Gegensatz von Staat und Gesellschaft, dem Gegensatz des Staates — oder der Gesellschaft, wie er — oder sie — sein sollte, und wie er — oder sie — in Wirklichkeit ist. Daß das Ideal, an dem der historische Staat hier gemessen wird, in der Tat nichts als der ideologische „Oberbau“ bestimmter Klassengegensätze ist, deren Träger sich des Gegensatzes in dieser Form bewußt werden, ist auch unsere Meinung, wenn wir auch weit entfernt davon sind, zuzugeben, daß es sich hier nur um Spiegelungen der „Produktionsverhältnisse“ handelt: aber für unsere Betrachtung ist von Bedeutung nicht die Entstehung dieser Ideologie, sondern sie selbst, das Ideal, an dem der Staat der Wirklichkeit gemessen und zu leicht befunden wird. Und dieser „praktische“ Gegensatz ist geradezu der Lebensatem des Sozialismus; auch er stellt den heutigen Staat oder die heutige Gesellschaft messend, vergleichend, verurteilend gegen die Gesellschaft oder den Staat (Name ist Schall und Rauch) der Zukunft.
Ob dieser Staat der Zukunft Utopie ist, ist für uns im Augenblick ohne Interesse. Wir haben nur festzuhalten, daß die sozialistische Staatsidee sich von der großbürgerlichen dadurch unterscheidet, daß diese den inneren Gegensatz der vorhandenen zu einer seinsollenden Ordnung des Eigentums und der damit zusammenhängenden Rechte nicht sieht [1] oder nicht anerkennt, während gerade dieser Gegensatz für die andere der Ausgangspunkt ihrer theoretischen Problemstellung und ihrer praktischen Forderungen und Handlungen ist.
ß) Die aufklärerische Wurzel. (Die „Kinderfibel“.)
Gemeinsam aber hat die sozialistische mit der bürgerlichen und zwar sowohl der groß- wie der kleinbürgerlichen Staatsidee die Vorstellung, daß sich die Klassenordnung oder der Klassenstaat von einem natürlich gewachsenen Urzustand aus, rein durch immanente (hier ausschließlich ökonomische) Kräfte, ohne Eingriffe äußerer Gewalt allmählich friedlich entwickelt habe. Nur daß der Wertakzent der entgegengesetzte ist: während das Großbürgertum diese Entwicklung durch die rosige Brille
[1] Stein sieht den Gegensatz; er ist nicht mehr Romantiker, sondern Kathedersozialist, wie vor ihm Sismondi und nach ihm etwa Adolf Wagner. Sie idealisieren den historischen Staat nicht mehr, aber sie bringen die Kraft des Glaubens an die Möglichkeit seiner gründlichen Reform nicht auf: aus ihrer Klassenlage heraus; und das ist es, was die Sozialisten von ihnen unterscheidet, die aus ihrer Klassenlage heraus Optimisten sind, wie jene Pessimisten — und die entschlossen sind, nicht beim ersten Hindernis des Denkens „aufzugeben“. So kommen diese Halben zur „Reform“, zum „Merkantilismus“, zur „Intervention“!
[156]
sieht, schaut sie das Proletariat wie das Kleinbürgertum durch die schwarze an.
Diese Auffassung wächst, geistesgeschichtlich gesehen, aus zwei verschiedenen Wurzeln. Eine stammt aus der Aufklärung, unmittelbar von Jean Jacques Rousseau; und zwar sind hier wieder zwei Elemente zu unterscheiden: ein großbürgerliches, das den Inhalt, und ein kleinbürgerliches, das den Wertakzent bestimmt. Jenes ist die schon von Platon gehegte, dann namentlich von Locke übernommene und von der Bourgeoisie überall akzeptierte Lehrmeinung, daß Geldwirtschaft und Handel zur Klassenscheidung führen müssen; das kleinbürgerliche Element hat Rousseau als erster Schriftsteller von Einfluß dazugetan: das Ressentiment des Enterbten der Unterklasse, des akademischen Bohémien. — Die zweite Hauptwurzel stammt aus der Romantik: die Lehre, daß der Staat oder die Gesellschaft ein Organismus ist.
Aus der ersten Wurzel stammt der Kommunismus der sozialistischen Staatsidee. Seit Platon glaubt alle Welt, zu wissen, daß es nur die Wahl gibt zwischen der sozialen Zersetzung oder dem Kommunismus. In der „Utopia“ läßt Morus den Hythlodaeus über Platon sagen: „Denn das hat dieser tiefe Denker ohne weiteres gesehen, daß nur ein einziger Weg zum Wohle des Staates führt: die Verkündigung der Gleichheit des Besitzes, die doch wohl niemals durchgeführt werden kann, solange die einzelnen noch Privateigentum besitzen; denn solange jeder auf Grund gewisser Rechtsansprüche, soviel er kann, an sich zieht, mag die Menge der vorhandenen Güter noch so groß sein: sie wird doch nur unter wenige aufgeteilt, und für die übrigen bleibt Not und Entbehrung. ... So bin ich denn fest überzeugt, daß der Besitz durchaus nicht auf irgendeine billige oder gerechte Weise verteilt, und überhaupt das Glück der Sterblichen nicht begründet werden kann, solange nicht vorher das Eigentum aufgehoben ist“ [1]. Er schließt seine Schilderung: „Ich habe euch so wahrheitsgemäß als mir möglich war, die Form dieses Staates beschrieben, der nach meiner festen Überzeugung der beste, ja der einzige ist, der mit Recht den Namen eines staatlichen „Gemeinwesens“ für sich beanspruchen kann. Denn wer anderswo vom „Gemeinwohl“ spricht, denkt doch überall nur an seinen Privatvorteil; hier dagegen, wo es kein Privateigentum gibt, betreibt man ernsthaft die Interessen der Allgemeinheit“ (S. 109)[2].
[1] Morus' Utopia, Ausg. von Oncken, S. 39.
[2] Oncken (S. 43) vertritt entschieden und mit Glück die Ansicht, daß Morus selbst „nicht der Mann der Utopia und eines utopischen Radikalismus, sondern im Gegenteil der Mann der sozialen und kirchlichen Reform gewesen war“. Meinecke (Staatsräson S. 491) stimmt ihm zu.
[157]
Wir haben gesehen, daß auch Aristoteles ähnliche, wenn auch weniger radikale Anschauungen hatte; von hier aus sind sie in die kanonische Philosophie des Mittelalters eingegangen: „Die Kanonisten erblickten in der freien Konkurrenz die Wurzel alles Übels, die Ursache aller Ungleichheit, und riefen daher nach einer unumschränkten Intervention der öffentlichen Gewalten“ [1].
Dann glaubte eine Zeit lang alle Welt an das von Adam Smith und Quesnay ausgestaltete, von Mandeville und Vico entdeckte Wunder, daß gerade die freie Konkurrenz die Harmonie, und das ist: die vernunftgemäße Gleichheit entsprechend der Leistung, bringen werde. Als dieser Glaube erstarb, verlor das Bürgertum seinen frohen Glauben, und seine Klassentheorie wurde zur „dismal science“ (Carlyle) : zur trüben, unheimlichen Wissenschaft. Und das Proletariat, als ihrer selbst bewußte Klasse gerade als die Folge davon entstanden, daß jenes Gesetz der Harmonie sich nicht bewährt hatte, nahm das alte Dogma wieder auf. Und kam von hier aus mit vollster Logik zum Kommunismus[2].
Aber die Theorie des Proletariats nahm es auf nicht mit dem positiven, großbürgerlichen, sondern dem negativen kleinbürgerlichen Wertakzent, den ihm zuerst Rousseau verliehen hatte. Wenn sie im Aufbau, optimistisch, weit über den Genfer hinausging, der immer Kleinbürger und Antikommunist war und blieb, so nahm sie doch von ihm, dem großen Sprachrohr der Empörung der Enterbten, in der Kritik Tonart und Melodie an, freilich, aus Gründen, die wir aufweisen werden, sonderbarerweise sehr stark gedämpft und gemildert, wenigstens in den theoretischen Parteischriften, wenn auch im Tageskampf die schärfere Tonart galt und sogar oft noch verschärft wurde. Wir werden zeigen, daß diese Mäßigung aus der romantischen Wurzel wächst : vorläufig haben wir noch die Auszweigungen der aufklärerischen zu verfolgen.
Am reinsten finde ich ihren Gedankeninhalt enthalten in einer Ausführung von Friedrich Engels, die ich schon einmal abgedruckt habe[3] :
„Selbst wenn wir die Möglichkeit alles Raubs, aller Gewalttat und aller Prellerei ausschließen, wenn wir annehmen, daß alles Privateigentum ursprünglich auf eigener Arbeit des Besitzers beruht, und daß im ganzen ferneren Verlauf nur gleiche Werte gegen gleiche Werte ausgetauscht werden, so kommen wir dennoch bei der Fortentwicklung
[1] Hasbach, a. a. O. S. 135.
[2] Nicht nur Marx, auch der kommunistische Anarchismus: Kropotkin (vgl. L. Oppenheimer, Die geistigen Grundlagen des Anarchismus. Die Dioskuren, Bd. III (1925), S. 285ff.).
[3] Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft, 2. Aufl., Hottingen, 1886, S. 139, von uns abgedruckt, S. S. I, S. 991.
[158]
der Produktion mit Notwendigkeit auf die gegenwärtige kapitalistische Produktionsweise, auf die Monopolisierung der Produktionsmittel in den Händen der einen, wenig zahlreichen Klasse, auf die Herab- drückung der anderen, die ungeheure Mehrzahl bildenden Klasse zu besitzlosen Proletariern... . Der ganze Hergang ist aus rein ökonomischen Ursachen erklärt, ohne daß auch nur ein einziges Mal der Raub, die Gewalt, der Staat oder irgendwelche politische Einmischung nötig gewesen wäre“.
Diese Sätze haben die Präzision eines Dementi. Jede Unklarheit ist sorgfältig ausgeschlossen. Die Geschichte ist zwar gewesen, aber sie hat nicht gewirkt; der heutige Zustand würde auch erreicht sein, wenn weder „das unentfaltete politische Mittel“ : List, Raub und Gewalt, noch das „entfaltete politische Mittel“ der Staat [1], in die Geschehnisse eingegriffen hätten. „Alles ist aus rein ökonomischen Ursachen erklärt“ : die Monopole der heute besitzenden Klasse stammen nicht von „außerökonomisch“ gesetzten Monopolen ab, sondern haben sich aus der freien Konkurrenz heraus entwickelt, mußten sich so entwickeln.
Kein Zweifel, daß die Auffassung nichts anderes ist als die bourgeoise Lehre, die Marx als die „Kinderfibel“ bezeichnet und mit der vollen Schale seines ätzenden Hohnes übergössen hat, dieselbe Lehre, die er in den schönsten, geschichtlichen, Kapiteln des „Kapital“ induktiv vollkommen widerlegt hat. Wir haben dazu geschrieben: „Marx hat in nicht mißzuverstehender Deutlichkeit erklärt, daß das gesellschaftliche Klassenverhältnis durch außerökonomische Gewalt „produziert“ worden ist. Dann freilich „reproduziert“ es sich immer aufs neue, ohne neue Eingriffe außerökonomischer Gewalt („Kapital“, I. S. 703).“
Nun, wenn auch die Engelssche Auffassung nicht durchaus Marxorthodox ist, so ist sie doch um so konsequenter Kommunismusorthodox. Denn die Überzeugung, daß die freie Konkurrenz von jedem Ausgangspunkt aus, und sei es auch eine neue gleichmäßige Verteilung der Produktionsmittel, zu der heutigen Klassenscheidung führen muß, ist, wie wir gezeigt haben, die einzige logische Grundlage des Kommunismus[2].
Selbstverständlich geht die Identität der marxistischen mit der bourgeoisen Kinderfibel nicht so weit, daß jene auch die spezifisch bürgerlich-apologetischen Bestandteile aufgenommen hätte. Sie ist ja entstanden durch den psychischen Mechanismus, den Tarde als „imitation par opposition“ bezeichnet hat[3]. Sie legt daher mit Rousseau überall dort, wo die Bourgeois-Ökonomik den positiven Wertakzent hinlegt, den negativen hin. Nicht aus der Verschiedenheit wirtschaftlicher
[1] Vgl. S. S. I, S. 987; III, S. i48ff.
[2] S. S. III, S. 194ff.
[3] S. S. III, S. 193.
[159]
Tugend : Fleiß, Sparsamkeit, Voraussicht usw. sind die Klassen, ist der Klassenstaat entstanden, sondern auf eine viel weniger empfehlenswerte Weise. Wie, das legt Engels in einem Briefe an Dr. C. Schmidt dar: „Die Sache faßt sich am leichtesten vom Standpunkt der Teilung der Arbeit. Die Gesellschaft erzeugt gewisse gemeinsame Funktionen, deren sie nicht entraten kann. Die hierzu ernannten Leute bilden einen neuen Zweig der Teilung der Arbeit innerhalb der Gesellschaft. Sie erhalten damit besondere Interessen auch gegenüber ihren Mandataren, sie verselbständigen sich ihnen gegenüber — und der Staat ist da... . Die neue selbständige Macht hat zwar im ganzen und großen der Bewegung der Produktion zu folgen, reagiert aber auch, kraft der ihr innewohnenden ... relativen Selbständigkeit, wiederum auf die Bedingungen und den Gang der Produktion ... die ökonomische Bewegung setzt sich im ganzen und großen durch, aber sie muß auch Rückwirkung erleiden von der durch sie selbst eingesetzten und mit relativer Selbständigkeit begabten politischen Bewegung, der Bewegung einerseits der Staatsmacht, andererseits der mit ihr gleichzeitig erzeugten Opposition“ [1].
Hier mischen sich Stein - Rousseau mit Grotius - Hobbes- Epikur. Der gesellschaftliche Prozeß führt „naturnotwendig“ zur Ausbildung verschiedener, mit Macht begabter Interessen. Das ist Stein! Während diese Interessen aber nach Stein den existierenden Staat allmählich mattsetzen, machen sie nach Engels seine Einsetzung erst möglich. Mehr als das: notwendig, und zwar aus zwei Gründen: Erstens aus dem in dieser Briefstelle angegebenen Grunde, daß auch der Staat, in seiner Bedeutung als Regierung und Verwaltung, ein Stück gesellschaftlicher Arbeitsteilung ist; und zweitens aus einem anderen Grunde, der in einem gewissen Grade mit der Lehre von Hobbes und Epikur übereinstimmt: „Der Staat ist... ein Produkt der Gesellschaft auf bestimmter Gesellschaftsstufe, er ist das Eingeständnis, daß diese Gesellschaft sich in einen unlöslichen Widerspruch mit sich selbst verwickelt, sich in unversöhnliche Gegensätze gespalten hat, die zu bannen sie ohnmächtig ist. Damit aber diese Gegensätze, Klassen mit widerstreitenden ökonomischen Interessen, nicht sich und die Gesellschaft in fruchtlosem Kampf verzehren, ist eine scheinbar über der Gesellschaft stehende Macht nötig geworden ... ; und diese, aus der Gesellschaft hervorgegangene, aber sich über sie stellende, sich ihr mehr und mehr entfremdende Macht ist der Staat“[2]. Das aber will sagen, daß „der Staat in allen mustergültigen Perioden ausnahmslos der Staat der herr-
[1] Zit. nach Greulich, Die materialistische Geschichtsauiffassung, S. II.
[2] Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates, Stuttgart 1894, S. 177/8.
[160]
sehenden Klasse ist, und in allen Fällen wesentlich Maschine zur Niederhaltung der unterdrückten, ausgebeuteten Klasse bleibt“ [1].
Das ist im Grunde das „bellum omnium contra omnes“, zu dessen Befriedung der Staat notwendig wird. Selbstverständlich übersehen wir nicht die Unterschiede, die trotz alledem zwischen der Hobbesschen und dieser marxistischen Lehre bestehen: jene geht vom Individuum, diese von der Gesellschaft aus; jene stellt einen „Urzustand“, diese eine schon entwickelte Gesellschaft dem Staat gegenüber: aber sie stimmen doch beide darin überein, daß sie den Staat als eine zu einem Zwecke geschaffene Maschine auffassen, und zwar ist der Zweck für beide der gleiche. Das erkennt man, wenn man die folgenden Sätze von Hobbes gegen die von Engels hält: „Deshalb genügt die bloße Übereinstimmung oder der bloße Vertrag ohne Begründung einer gemeinsamen Macht, welche die einzelnen aus Furcht vor Strafe leitet, nicht für die Sicherheit, welche zur Übung der natürlichen Gerechtigkeit nötig ist“.
Diese Macht ist bei beiden der Staat. Und er erscheint beide Male als rein aus inneren Kräften der Gesellschaft friedlich entstanden.
Aber: sind diese rein inneren Kräfte wirklich auch „rein ökonomisch“ wie Engels behauptet? So vorsichtig er sich auch ausdrückt — aus guten Gründen, die wir sofort analysieren werden —, so schimmert doch durch alle Vorsicht so etwas wie der Vorwurf eines Mißbrauchs der Amtsgewalt. Wenn die im Dienste der gesellschaftlichen Arbeitsteilung zu Beamten „ernannten Leute besondere Interessen auch gegenüber ihren Mandataren erhalten“ : ist es dann „rein-ökonomisch“, wenn sie der Versuchung unterliegen, „sich zu verselbständigen“ und „auf die Bedingungen und den Gang der Produktion“ anders zu „reagieren“, als ihre Mandatare es bestimmt hatten? Daß die Versuchung sehr nahe liegt und sehr groß ist, ist zugegeben; wir selbst haben gezeigt, wie nahe den „Verwaltungsgruppen“ diese parasitäre Entartung liegt, die ihnen das Amt als Mittel zu ihren persönlichen anstatt zu den allgemeinen Zwecken erscheinen läßt[2] : aber die reine Ökonomie schließt auch solche Verfehlungen aus, wie aus Engels' eigener Bestimmung hervorgeht, wonach nicht nur Prellerei, Raub und Gewalt, sondern auch „der Staat und irgend welche politische Einmischung“ ausgeschlossen sind. Diese Ämter sind ja ihm zufolge ursprünglich der ganze Staat; und wenn er sich einmischt, indem er den Gang und die Bedingungen der Produktion beeinflußt, so ist das doch sicherlich eine „politische Einmischung“.
Hier liegt ein schwacher Punkt der Stellung, an dem, neben anderen, wichtigeren, unsere Kritik einzusetzen haben wird. Um zu zeigen, daß
[1] A. a. O., S. 185.
[2] S. S. I, S. 595.
[161]
wir nichts in die Worte hineinlesen, was nicht wirklich ihrem Sinne entspricht, mag noch eine soeben erst erschienene Auslassung des bedeutendsten marxistischen Staats- und Rechtsphilosophen folgen, die grundsätzlich ganz den gleichen Inhalt hat, aber diesen Mißbrauch der Amtsgewalt stärker betont. Max Adler schreibt: „Solange die reale Gestaltung einer Vergesellschaftung noch keine wirtschaftlichen Gegensätze in sich birgt, wie zum Beispiel innerhalb der mehr oder minder legendarischen (!) Lebensform des Urkommunismus, deckt sich die Bewußtseinsform dieses Lebens mit seinem Inhalt. Aber in dieser Organisation liegen selbst schon Keime, die diese Identität aufzuheben streben, indem die Machtfülle, die sie einzelnen Menschen verleiht, diese leicht instand setzt, ihre Stellung zwar weiter im Namen der Gesamtheit, aber in der Wirklichkeit zu eigenem Interesse auszuüben“ [1].
Nicht anders der, neben Hilferding, bedeutendste Vertreter der marxistischen Theorie, Rosa Luxemburg: „Da herrscht als alleiniges Gesetz über die Wirtschaftsverhältnisse die freie Konkurrenz. Damit ist aber jeglicher Plan, jegliche Organisation aus der Wirtschaft verschwunden“[2]. „So führt die Arbeitsteilung im Schöße der primitiven Gesellschaft früher oder später unvermeidlich zur Sprengung der politischen und ökonomischen Gleichheit von innen heraus“[3]. „Die Rangerhöhung des primitiven Adels, die despotische Gewalt der primitiven Häuptlinge sind ebenso naturwüchsige Produkte der Gesellschaft wie alle ihre sonstigen Lebensbedingungen“[4]. „Die primitive kommunistische Gesellschaft führt durch ihre eigene innere Entwicklung zur Ausbildung der Ungleichheit und der Despotie“[5]. „Die Gewalt ist auch hier bloß Dienerin der ökonomischen Entwicklung“[6].
Etwas anders ist die Darstellung bei August Bebel: „Der Staat entsteht als das Produkt einer gesellschaftlichen Entwicklung aus der primitiven, auf Kommunismus beruhenden Gesellschaftsform, die sich allmählich in dem Maße auflöste, wie das Privateigentum entstand. Mit dem Aufkommen des Privateigentums entstehen innerhalb der Gesellschaft notwendig antagonistische Interessen, die im Laufe ihrer weiteren Entwicklung zu Standes- und Klassengegensätzen führen und allmählich offene Feindschaft zwischen den verschiedenen Interessengruppen und damit Standes- und Klassenkämpfe erzeugen,
[1] A. a. O., S. 52/3. Im Orig. nichts gesperrt.
[2] Einführung in die Nat.-Ök., S. 62.
[3] Ib. S. 190.
[4] Ib. S. 195.
[5] Ib. S. 196.
[6] Ib. S. 198.
[162]
welche die neue Gesellschaftsordnung in ihrem Bestand bedrohen. Um diese ... Kämpfe niederzuhalten und die bedrohten Eigentümer zu schützen, bedarf es einer Organisation, die den Angriffen auf Besitz und Eigentum wehrt und den unter bestimmten Formen erworbenen Besitz für „rechtmäßig“ erklärt und „heilig“ spricht. Diese das Eigentum schützende und es aufrecht haltende Organisation und Gewalt ist der Staat. ... Er ist darnach die notwendige Organisation einer auf Klassenherrschaft beruhenden Gesellschaftsordnung... . Der Staat ist nur die Organisation der Macht zur Aufrechterhaltung der jeweiligen Eigentums- und sozialen Herrschaftsverhältnisse“ [1].
Man sieht, hier spricht mehr der große Agitator als der Wissenschaftler, der Engels doch sein wollte. Die Entstehung des Staates aus den Notwendigkeiten der Arbeitsteilung ist fortgefallen; er wird nicht allmählich aus einem Funktionär der gesamten Gesellschaft zu einem Instrument der Klassenherrschaft, sondern wird sofort als dieses, zu diesem Zwecke, eingesetzt. Darum kann denn auch Bebel sagen, was Engels in dieser Schärfe sicherlich nicht gesagt hätte, weil es dicht an anarchistische Gedankengänge streift[2]: „In dem Augenblicke, in dem die Klassengegensätze durch Aufhebung des Privateigentums fallen, verliert der Staat nicht nur das Recht zu seiner Existenz, sondern seine Existenzmöglichkeit“. Aus Engels' Grundanschauung würde nur folgen, daß der Staat als Klassenstaat verschwindet, aber der Staat, in seiner Bedeutung als Regierungs- und Verwaltungsausschuß der Gesellschaft, weiterbestehen muß[3].
Wir werden uns an die offiziellen Theoretiker und nicht an den Agitator zu halten haben, wenn wir die Lehre des Marxismus feststellen sollen. Für unsere Zwecke ist übrigens der hier aufgedeckte Unterschied ohne Belang. In dem, was uns interessiert, besteht Einigkeit : der Staat ist, ohne Einwirkung äußerer Gewalt, aus rein inneren Kräften der Gesellschaft entstanden.
In der Begründung also fast vollkommen, in den Folgerungen vollkommen die Stellung der Bürgerlichen zu dem Problem.
[1] Bebel, Die Frau und der Sozialismus, Stuttgart 1892, S. 263/4.
[2] Vgl. Jellinek, a. a. O. S. 224: „Aber auch die sozialistische Wendung des anarchistischen Gedankens, die den Staat als eine historische Episode betrachtet, leidet an demselben rationalistischen Optimismus, der eine in ungezählten Exemplaren vorhandene fleischlose Puppe mit demselben, stets gleichbleibenden ethischen Normalgehalt als die Grundlage der Gesellschaft ansieht: den in Freiheit dressierten, immer arbeitslustigen und kollektivistisch gestimmten Menschen.“
[3] Max Adler, Die Staatsauffassung des Marxismus, S. 276, sagt übereinstimmend, „daß selbstverständlich auch in diesem Gesellschaftszustande (dem Zukunftsstaat) Unterordnung und Überordnung, Organe und Befugnisse und Verhältnisse sein werden, auf die formal der Begriff des Rechtes, der Verfassung und des Gesetzes zur Anwendung kommen kann“.
[163]
y) Die romantische und nachromantische Wurzel. (Der „Organismus“.)
Im Voraufgehenden haben wir die erste naturrechtliche Wurzel der sozialistischen Staatsidee völlig aufgedeckt: es ist unsere Aufgabe, auch die zweite, aus der Romantik stammende, bloßzulegen. Hier werden wir noch einmal zu unterscheiden haben zwischen den Elementen, die von der eigentlichen Romantik, und denjenigen, die von Hegel herkommen.
Daß Karl Marx „der rechte Sohn des romantischen Gedankens“ war, hat ihm Croce bescheinigt [1], und Rubinstein hat es bestätigt[2]. Der leitende Gedanke der Romantik ist, wie wir wissen, die Auffassung der Gesellschaft, die sie mit dem Staate identifizierte, als eines lebendigen Organismus.
Wir haben schon gesagt, daß diese Auffassung gewisse Folgerungen geradezu aufzuzwingen scheint: ein Organismus kann verwundet, von Parasiten befallen, sogar getötet werden : aber man kann ihn nicht verändern: er bleibt immer „geprägte Form, die lebend sich entwickelt, nach dem Gesetz, nach dem er angetreten“. Niemals wird durch noch so grobe Eingriffe von außen her aus einem Hunde eine Katze oder aus einer Eiche eine Fichte werden.
Nun, wenn man das organische Gleichnis auch noch so buchstäblich nimmt, hätte man doch daran denken können, daß unter niederen Tieren die Vereinigung getrennter Exemplare der gleichen Art durch Zygose vorkommt — ; daß die Medusen in ihrer Jugendform frei umherschwimmen und sich erst spät zu ihrer Altersform verschmelzen — ; daß sogar die dauernde Vereinigung ganz verschiedener Arten als Symbiose beobachtet wird; unser kleiner Süßwasserpolyp, die Hydra viridis, lebt nicht in zufälliger, sondern in dauernder, sozusagen organischer Verbindung mit den grünen Algen, die in ihm leben und dem an sich glashellen Tierchen den Beinamen verliehen haben: sie assimilieren ihm die Nahrung kaum anders als dem Menschen seine Darmzellen. Und man hätte schließlich daran denken können, daß in der Natur Fälle von Parasitismus sehr häufig sind, vor allem daran, daß wir bei einer der wenigen Tierarten, die echte Gesellschaften bilden, den Ameisen, gewisse Unterarten kennen, die sich Blattläuse als „Milchvieh“, und sogar solche, die sich Ameisen anderer Arten als „Sklaven“ halten; eine dieser sklavenhaltenden Arten, der Polyergus, die Amazonenameise, hat sogar den Instinkt der eigenen Nahrungsbeschaffung völlig eingebüßt; die Tiere verhungern vor vollen Schüsseln, wenn man sie von ihren Sklaven isoliert, die ihnen die Nahrung vorzukauen und ein-
[1] Zur Theorie und Geschichte der Historiographie, Deutsch v. Pizzo, S. 223.
[2] Rubinstein, Romantischer Sozialismus, passim.
[164]
zuflößen haben [1]. Ja, ihre Kiefern, vollkommen in Kampforgane umgewandelt, sind nicht mehr imstande, Nahrung zu verarbeiten[2]. Und, wie uns Burckhardt belehrte: „Die einzelne Ameise funktioniert nur als Teil des Ameisenstaates, welcher als ein Leib aufzufassen ist“ (vgl. oben S. 14).
Wenn Naturforscher sich des Gleichnisses vom Organismus bedient hätten, so hätte vielleicht doch einer einmal diese Gesichtspunkte hervorgehoben, ehe er entscheidende Schlüsse zog. Aber das Gleichnis ist zuerst von Geisteswissenschaftlern gebraucht worden, die nur so, wie der Blinde von der Farbe, von dem ihnen fremden Begriff schwätzten[3].
Man dachte also lediglich an den höheren, eigentlich immer nur an den menschlichen Organismus: und von hier aus war es fast unmöglich, die Wirkung äußerer Eingriffe auf die Ausgestaltung der essentiellen Eigenschaften des Staates oder der Gesellschaft zuzulassen — obgleich man auch hier sogar daran hätte denken können, daß ein Mulatte doch recht deutlich von seinen beiden Erzeugern verschieden ist. Man kann diese Erscheinung ohne vielen Zwang als einen äußeren Eingriff in den „natürlichen“ Typus der Rasse zisten haben kühnere Deutungen gewagt.
Aber sogar Herbert Spencer, der ein ungeheurer Naturforscher war, hat sich diese Fragen nicht vorgelegt. Auch er läßt, wie wir noch zeigen werden, den Staat aus rein inneren Veränderungen erwachsen. Und so wird man es den vorwiegend geschichtlich und philosophisch
[1] Escherich: Die Ameise, S. 206ff. Alverdes schreibt (Tiersoziologie Seite 66): „Die sogenannten „Sklaven“ sind vollberechtigte „Bürger“ desjenigen Ameisenstaates, in dem sie die Puppenhülle verlassen, und nicht das, was man in der menschlichen Gesellschaftslehre unter Sklaven versteht. Man kann ihre Anwesenheit in einem Ameisenstaat nicht einmal mit der Verwendung Farbiger als Beamte und Soldaten von Seiten der abendländischen Kulturvölker vergleichen, denn mehr oder minder werden Farbige dort ja doch immer nur als Staatsangehörige zweiten Ranges angesehen.“
[2] Wenn die Entwicklung Europas noch einige Zeit in der eingeschlagenen Richtung weiter geht, könnten wir eine menschliche Parallele dazu erleben: Völker, die ihre ganze technische Kraft auf ihre Rüstung verwenden und auf die Tribute der von ihnen Unterworfenen angewiesen sind, um nur zu leben. Innerhalb der Gesellschaften sind solche Degenerationen an der Tagesordnung.
[3] „Dem Vorstellungsleben einer Zeit, der die Natur als Parallele, als Erweiterung des menschlichen Geisteslebens erscheint, für deren angeregte Phantasie Steine lebendig, Bilder und Abstraktionen lebendig sind, liegt es unerreichbar fern, diesen Gedanken zu Ende zu denken, so fern, daß dem Savigny selbst nicht gewachsen ist“ (Landsberg, a. a. O. S. 209). Von Puchta sagt derselbe Autor, er habe es „von Schelling gelernt, mit solchen verschwommenen Verallgemeinerungen wie mit organischen Lebewesen zu verkehren“ (S. 446). Dagegen wird von Böcking gerühmt, daß „sein gesunder Wirklichkeitssinn trotz seiner Freundschaft zu A. W. Schlegel ihm die Möglichkeit verschlossen habe, sich mit unklaren Wendungen, wie „Volksgeist“, „Volksüberzeugung“, „organische Entwicklung“ schon ein Genüge zu tun“ (S. 477).
[165]
gebildeten Gründern der sozialistischen Romantik als eine culpa levis anzurechnen haben, daß sie hier keine der Erwägung würdigen Probleme gesehen haben.
Um so mehr, als ihre Abstammung von Hegel — und damit kommen wir zu dem zweiten, hier zu beachtenden, nachromantischen Element — es ihnen in der Tat fast unmöglich machen mußte, die Dinge anders zu sehen, als sie sie sahen.
Nach Hegel denkt der objektive Geist [1] dialektisch, und seine Gedanken sind die Geschichte. Einer Thesis stellt sich ihre Antithesis gegenüber, und beide werden dann in der Synthesis versöhnt, indem der Gegensatz in jener geistreichen dreifachen Bedeutung „aufgehoben“ wird: aufgehoben, wie sich gleiche Größen in Nenner und Zähler des gleichen Bruches auslöschen; aufgehoben, d. h. aufbewahrt: denn die Gegensätze verschwinden nicht spurlos, sondern bleiben in der Synthese erhalten, lebendig, und bestimmen den Rhythmus des Geschehens; und schließlich aufgehoben, d. h. auf eine höhere Ebene des Gedankens und daher der geschichtlichen Existenz emporgehoben.
Nun entspricht dem objektiven Geist in der sinnlichen Wirklichkeit zunächst, bis einmal die Vereinigung der ganzen Menschheit zum Weltstaat erreicht sein wird, das „Volk“, der „Staat“, das „Vaterland“: das alles sind für Hegel synonyme Begriffe[2]. Und so kann, so scheint es wenigstens, jene Dialektik auch nur im Inneren eines solchen Körpers geschehen.
Auch hier hätte freilich ein wenig Umsicht und Weitherzigkeit in der Umgrenzung der doch schließlich dogmatisch angenommenen Begriffe einen anderen Weg zeigen können. Hegel selbst hätte sich wahrscheinlich mit der folgenden Deutung eines mindestens sehr häufigen geschichtlichen Prozesses einverstanden erklärt: die Horden einer Landschaft bilden in einem gewissen Grade eine einzige Gesellschaft, zumal, wenn sie, was häufig der Fall, in Tauschverkehr stehen : Hirten oder Jäger und Ackerbauern. Eine Horde lebt lange allein; sie wird sich ihrer Sonderexistenz und Eigenart nach dem psychologischen Gesetze des Kontrasts erst bewußt, wenn sie mit einer anderen, fremden, zu-
[1] Über die Verwandtschaft des objektiven Geistes der Romantik, eines blutvollen, individuellen Wesens, von dem recht dürren, aufklärerischen, sozusagen statistischen, und mit dem späteren Quételetschen Durchschnittsmenschen in der Tat nahe verwandten „Esprit général“ Montesquieus vgl. Salomon, a.a.O. S. 478; ferner Rosenzweig, Hegel und der Staat, S. 23/4, und Landsberg, a.a.O. S. 345ff. (Vgl. ferner die Anm. auf S.221/2 bei Meinecke, Weltb.) Auch hier hat Spinoza Hegel „präludiert“: „Hieraus folgt, daß das Denkvermögen Gottes seinem wirklichen Vermögen, zu handeln, gleich ist, d. h. alles, was aus der unendlichen Natur Gottes formal folgt, das folgt aus der Vorstellung Gottes in derselben Ordnung und derselben Verknüpfung in Gott objektiv“ (Ethik, S. 44, Lehrsatz 7 des 2. Buches, Folgesatz).
[2] S. S. I, S. 388.
[166]
sammentrifft[1] : Thesis und Antithesis. Die stärkere oder besser bewaffnete unterwirft die schwächere und schafft auf diese Weise einen Staat: Synthesis, in der die Gegensätze in jener dreifachen Weise „aufgehoben“ sind. Denn die beiden Gruppen ähneln sich aneinander an, sprechen die gleiche Sprache, verschmelzen oft zu dem gleichen Typus usw.; dennoch bleiben die alten Gegensätze aufgehoben, d. h. aufbewahrt, in Gestalt der jetzt entstandenen Klassen -oder Standesunterschiede. Und schließlich wird das Ganze auf ein höheres Niveau „aufgehoben“ : denn aus den beiden Horden ist ein größeres, wirtschaftlichtechnisch höher entfaltetes, nach außen mächtigeres, in seinem Aufbau verwickelteres Ganzes, ein Staat geworden[2].
Aber auch diesen möglichen Ausweg zu neuer Problemstellung mußte die sozialistische Romantik verfehlen, weil sie, indem Marx die Hegeische Philosophie, die „auf dem Kopfe gestanden hatte, auf die Füße stellte“, in den Irrweg ihrer spezifischen „materialistischen Geschichtsauffassung“ geriet.
Wir haben uns über die[4]sen Gegenstand in unserer „Allgemeinen Soziologie“ ausführlich geäußert (S. 913ff.). Wir haben den „genialen“ Grundgedanken angenommen[3], daß die „Ideen“ nichts als der Oberbau über den gesellschaftlichen „Interessen“ sind und sich mit ihnen „gesetzmäßig umwälzen“: diesen „vielgelästerten, aber wenig verstandenen Grundgedanken“[4]; auch wir nehmen „die Lehre von der soziologischen Motivation der Wertungen“[4] an.
Aber wir bestreiten mit aller Entschiedenheit, daß „die“, und das heißt alle, „moralischen, religiösen, künstlerischen usw. Wertungen ein Überbau auf der ökonomischen Grundlage sind“[4]. Denn erstens finden wir Interessen in der Gesellschaft lebendig, die nicht nur nicht „ökonomische“, sondern nicht einmal „sinnliche“ Interessen sind: Interessen a priori, deren soziologisch wichtigstes das sittliche Interesse, das Bewußtsein der Pflicht ist. Wir glauben sogar bewiesen zu haben, daß sie einen von den sinnlichen Interessen verschiedenen psychischen Ursprung haben: diese wurzeln im Ich-, jene im Wir-Interesse und -Bewußtsein[5]. Aber gleichviel: jedenfalls existieren sie, und es ist völlig unmöglich, die Entstehung und Entwicklung der Gesellschaft auch nur von ferne zu begreifen, wenn man ihre Rolle in dem großen Prozeß nicht würdigt. Nur dann ist es möglich zu verstehen, was Recht ist, und weshalb es als „Recht“, d. h.
[1] S. S. I, S. 255.
[2] S. S. III, S. 268ff.
[3] S. S. I, S. 600.
[4] Adler, a. a. O. S. 26.
[5] S. S. I, 101ff.
[167 ]
als ein Seinsollendes, sittlich Verpflichtendes empfunden und durchgesetzt wird. Nur dann ist zu verstehen, warum über allen Gesellschaften, mit jeder Technik der „Produktion“, auf jeder Stufe der Zivilisation, im Überbau sich gewisse, niemals veränderte, niemals, außer in Zeiten schwerster sozialer Zersetzung, auch nur schwankende Normen finden, Jellineks „konstante Elemente“ [1].
Und zweitens: wir haben gezeigt, daß der Marxsche Begriff der „ökonomischen Grundlage“ ein Unbegriff schlimmster Art ist.
Es gibt vier Arten der rationellen Handlung, d. h. derjenigen Handlung, die das Ziel des Begehrens nur mittelbar erreichen kann und daher, „rationell“, dem Prinzip des kleinsten Mittels zum größten Erfolge folgt[2]. Die erste Gruppe umfaßt die „wertvermehrenden Lusthandlungen“, das sind solche Handlungen, die, weil sie an sich Lust gewähren, das letzte Ziel des Begehrens selbst sind. Wenn eine solche Handlung den Wert einer Person zu vermehren trachtet, so ist sie Pädagogik, wenn einer Sache: Technik. Die zweite Gruppe sind die „wertverzehrenden Lasthandlungen“, das sind solche Handlungen, die ein äußeres Objekt in die Verfügungsgewalt des Individuum bringen, dessen Wert zu genießen, und das heißt in allen Fällen: zu verzehren, das Ziel des Begehrens ist[3]. Wenn der Gegenstand des Begehrens eine Person ist, so ist das Politik[4], wenn eine Sache: Wirtschaft. Das zugrundeliegende Begehren der ersten Gruppe
[1] A. a. O. S. 375. Marx' Fehler war, daß er die Menschen nur durch ökonomische Beziehungen miteinander verbunden glaubte, wenigstens primär, sie sind aber primär ebensogut durch Beziehungen des Rechts verbunden. Jedes wirtschaftliche Gut ist nicht nur „Produkt“, sondern auch Eigentum eines vergesellschafteten Menschen. (Vgl. S. S. III, S. 441, namentlich S. 714). Daß Marx dann alle ökonomischen Beziehungen auch noch auf eine solche der Gütererzeugung allein reduzierte, ist eine fast unvermeidliche Folge des ersten Fehlers. Manche Juristen machen den Marxschen Fehler mit umgekehrtem Vorzeichen: sie erkennen keine anderen als die Rechtsbeziehungen zwischen den vergesellschafteten Menschen an.
[2] Es scheint den Ökonomisten ganz entgangen zu sein, daß sich in Spinozas Ethik (IV, § 66) das Prinzip in voller Formel findet: „Nach der Leitung der Vernunft suchen wir ein größeres künftiges Gut statt eines gegenwärtigen geringeren zu erlangen und ein gegenwärtiges geringeres Übel statt eines größeren künftigen Übels“. Diese Formel ist sogar den heute gangbaren überlegen, weil sie unmöglich so gröblich mißverstanden werden kann, wie das jenen gegenüber noch immer vorkommt (vgl. den Exkurs zur Psychol. Grundlegung: „Das hedonistische Prinzip“, S. S. I, S. 333ff.).
[3] S. S. III, S. 35; I, S. 915.
[4] Natürlich „Realpolitik“! Daß unsere Definition dem Sprachgebrauch entspricht, dafür zeugt der folgende Satz: „Diese Staatsräson, eine Politik, die nur nach der Zweckmäßigkeit für den Staat fragte, wird gegen Ende des 17. Jahrhunderts von einer Gewissenlosigkeit, die wir uns jetzt gar nicht mehr vorstellen können. Aus jener Zeit kommt der häßliche Nebensinn, den das Wort „politisch“ so lange im Volke gehabt hat“ (Treitschke, Politik, I, S. 92). In Frankreich und Amerika gelten Politiker bis zum Beweise des Gegenteils nicht als Gentlemen.
[168]
lautet : „Ich will diesem Gegenstande so viel wie möglich Wert verleihen“, aber bei der zweiten: „Ich will den Gegenstand haben, um seinen Wert so gründlich wie möglich auszunützen.“
Von diesen vier, streng zu unterscheidenden, Begriffen sind nicht weniger als drei, nämlich alle außer der Pädagogik, in den Marxschen Begriff oder besser Unbegriff der „ökonomischen Grundlage“ oder gar der „Produktion“ zusammengewirrt. Er enthält die ganze Gesellschaftswirtschaft, d. h. die Kooperation, und die ganze Technik; namentlich im Begriff der „Produktion“ mischt sich der wirtschaftliche Begriff, das „Zumarktebringen“[1], unlöslich mit dem ganz verschiedenen technischen Begriff des „Erzeugens“. Und er enthält schließlich auch noch die ganze Politik, da Marx auch den gesamten Inbegriff der Klassenordnung, alle Verschiedenheiten des sozialen Ranges und der Vermögen und Einkommen, in seine „Produktionsverhältnisse“ aufgenommen hat. Er hat, ein einziges Mal, in der Einleitung zu seiner „Kritik der politischen Ökonomie“, das Problem gestellt, ob nicht vielleicht die geschichtliche Eroberung und Unterwerfung, durch gewaltsame Verteilung der „Produktionsfaktoren“, die erste, unabhängige Ursache, die wahre causa causans, der dann folgenden Erzeugung und vor allem Verteilung der Güter sei; er hat sie verneinend beantwortet, aber mit Gründen von einer Schwäche, die der Widerlegung nicht wert wären, wenn es sich nicht um Karl Marx handelte[2].
„Daß ein solcher zum Unbegriff geweiteter Begriff zu jedem gewünschten Beweiszweck dienen kann, ist nicht erstaunlich“, haben wir an der oben zitierten Stelle gesagt. Man kann leicht die Tauben aus dem Hute fliegen lassen, wenn man sie vorher hineingetan hat. Die Marxisten rühmen sich gern, daß es ihnen so leicht gelingt, auf Grund ihrer Geschichtsauffassung nicht nur die Dinge der Vergangenheit in neuen und glaubhafteren Zusammenhängen zu zeigen, sondern auch, noch nicht Geschehenes vorauszusagen. Mag dem so sein (obgleich wir auch einige falsche Deutungen und eitle Prophezeiungen aufzuweisen imstande wären) : aus der Wahrheit der Konklusio folgt erstens bekanntlich nichts auf die Wahrheit der Prämissen; ein anderer Satz der formalen Logik lehrt uns zweitens, daß „nihil probat qui nimis probat“: und aus der Prämisse der materialistischen Geschichtsauffassung, die alle soziologisch erheblichen Grundbegriffe in Verknäuelung in ihren Unbegriff der „Produktionsverhältnisse“ aufgenommen hat, kann man gerade so gut
[1] S. S. III, S. 39/40, 358. „So werden Gesellschaft und Produktion für den Marxismus Wechselbegriffe“ (Adler, a. a. O. S. 32; vgl. a. 87/8).
[2] Wir haben diese Dinge in einem Exkurs in unserem „Kapitalismus, Kommunismus, wissenschaftlicher Sozialismus“ ausführlich abgehandelt.
[169]
alles erklären, was sich nicht begeben hat, wie alles, was sich begeben hat. Und schließlich und endlich: trotz aller ihrer Fehler ist der „Grundgedanke“ der Lehre so wahr und fruchtbar, daß sie in nicht zu ungeschickten Händen immer noch viel mehr leisten kann als die älteren Methoden der Geschichtsschreibung.
Wir haben diesen Teil der Kritik vorausgenommen, weil der Gegenstand nur durch mehrere Zwischenglieder hindurch mit dem Axiom zusammenhängt, dessen Geschichte wir hier schreiben. Das Eine wird klar sein, daß von diesem Standpunkt aus der Blick noch starrer auf die inneren Verhältnisse der einzelnen Gesellschaft gebannt sein mußte, als durch die Lehre vom Organismus und durch die Anhängerschaft an Hegel. Denn wie sollten wohl fremde Technik, fremde Wirtschaft, fremde Produktionsverhältnisse auf diese Gesellschaft einwirken können? Wohlverstanden: auf organische Weise einwirken können? Das wäre eine Vorstellung, als könnte ein Mensch für den anderen essen, verdauen, wachsen und lernen.
Nein, diese Theorie ist die Gefangene ihrer Voraussetzungen; sie kann unmöglich ihren Blick über die Grenzen eines Volkstums, einer Rahmengruppe, einer Gesellschaft hinaus tun. Der ganze großartige Mechanismus, den sie in der Geschichte erblickt — und der für die Entwicklung der Staaten weithin wahr ist, nur nicht für ihre Entstehung und ihren grundsätzlichen Aufbau —, diese „Dialektik der Entwicklung“ kann sich nur im Inneren abspielen: der Kampf der „Produktivkräfte“ mit den „Produktionsverhältnissen“. Wir haben die Lehre folgendermaßen kurz dargestellt: „Jede geschichtliche Epoche entwickelt die ihr eigentümlichen Produktivkräfte in „Eigengesetzlichkeit“ weiter, vor allem die Technik zu immer größerer Ausgestaltung und Wirksamkeit. Es muß einmal der Zeitpunkt kommen, wo diese Kräfte in ihrem Gehäuse, eben den historisch gegebenen Produktionsverhältnissen, nicht mehr Platz haben. Eine Umwälzung ist notwendig geworden, aber die Nutznießer der alten Ordnung leisten Widerstand: der Konflikt, der Klassenkampf, bricht zwischen ihnen und den Trägern der Produktivkraft, den durch die alte Ordnung Gehemmten und Geschädigten, aus ... In einer „Revolution“ wird das alte, zu enge Gehäuse gesprengt, entsteht eine neue, mit den entwickelten Produktivkräften verträgliche, weil ja von ihnen geschaffene Ordnung der Gesellschaft: aus Thesis (Produktionsverhältnis) und Antithesis (Produktivkraft) ist die Synthesis entstanden, die nun sofort als neue Thesis ihre Antithesis herauszutreiben beginnt: verstärkte und neue Produktivkräfte. So schreitet der gesellschaftliche Prozeß in dialektischer Selbstentfaltung weiter, bis er in der klassenlosen Gesellschaft sein letztes Ziel erreicht, weil es hier keine Antithesis
[170]
zwischen den Produktionsverhältnissen und der noch so hoch gesteigerten Produktivkraft mehr gibt noch geben kann“ [1].
Das ist ein Prozeß, der von außen her nur gestört, aber niemals verursacht oder grundsätzlich verändert werden kann. Er kann nur aus inneren Kräften des „Organismus“ selber erklärt werden. Von diesen Voraussetzungen aus ist keine andere Erklärung denkbar.
Und das ist der letzte Grund, aus dem die sozialistische Romantik mit dem Bürgertum in der Lehre übereinstimmt, daß der Staat rein aus inneren ökonomischen „Bewegungsgesetzen“ geworden und gewachsen ist. Eroberung, Unterwerfung, Prellerei, List und Gewalt, Wucher, Sklaverei, Leibeigenschaft, alles das ist wohl gewesen, hat auch gestört, zuweilen sogar vernichtet, aber auf das Lebende ändernd gewirkt hat es nicht!
D. Die soziologische Staatsidee. (Die Eroberung.)
Während die beiden Staatstheorien des heutigen Bürgertums und des Marxismus darin übereinstimmen, daß die Staaten durch rein innere Kräfte auf friedliche Weise entstanden sind, vertritt die, wesentlich aus dem Positivismus, der Synthese von Aufklärung und Romantik, stammende soziologische Auffassung die Behauptung, daß der Staat immer aus außerökonomischer Gewalt und beinahe immer aus äußerer Gewalt, entstanden ist; wobei das Wort „äußere“ die Doppelbedeutung hat erstens einer von außen, von fremden Gruppen ausgeübten Gewalt, und zweitens einer Gewalt, die sich äußerer, kriegerischer Mittel bedient, im Gegensatz zu der von überlegenen Intelligenzen, namentlich Priesterschaften, ausgeübten geistigen oder geistlichen Gewalt. In jedem Falle stamme der Staat nicht aus dem „ökonomischen“ Mittel: der Arbeit und dem äquivalenten Tausch, sondern aus dem unentfalteten „politischen“ Mittel: Raub oder Betrug oder Einschüchterung bzw., um auch hier den Ausdruck des Strafgesetzbuches anzuwenden, Nötigung.
Es ist nicht zu leugnen, daß offenbar hier und da ein Staat sich als Herrschaft einer Priesterschaft darstellt; das große Beispiel ist Tibet; andere Staaten, namentlich in Afrika, sind Herrschaften von Kaufmannschaften. Wir wollen vorerst dahingestellt sein lassen, ob es sich hier um originäre, und nicht vielmehr um solche Staaten handelt, die schon vorher auf dem sozusagen regelmäßigen Wege entstanden waren und nur durch Einflüsse, die wir überall, wenn auch schwächer, am Werke sehen werden, umgeformt worden sind. Nehmen wir vorläufig an, daß in gewissen Ausnahmefällen Staaten auch von innen heraus durch Anwendung, nicht „rein-ökonomischer“, sondern politischer
[1] S. S. I, S. 1098/9.
[171]
Mittel entstehen, d. h. durch überlegene Mitglieder der gleichen Gruppe gebildet werden können.
Solche Fälle, wenn sie in der Tat originäre Staaten geschaffen haben sollten — die nicht-originären interessieren uns hier noch nicht — würden mit der soziologischen Staatsidee durchaus nicht in Widerstreit stehen; sie behauptet nur, daß „der“ Staat immer durch Unterwerfung einer Gruppe unter eine andere entsteht; dabei läßt sie als möglich zu, daß die Unterwerfung gelegentlich, statt durch militärische, durch geistige Gewalt geschieht, und daß unterwerfende und unterworfene Gruppe zuvor einer und derselben Rahmengruppe angehörten.
Es ist klar, daß diese Ausnahme mit der zuletzt dargestellten marxi- , stischen Meinung große Ähnlichkeit hat, derzufolge Beamtengruppen sich allmählich zur Herrschaft aufgeschwungen hätten. Der große Schulfall dafür wäre China. Wir wollen auch diese Möglichkeit zunächst als gegeben annehmen: aber die soziologische Auffassung unterscheidet sich selbst dann entschieden von der marxistischen durch den dem Vorgang beigelegten Wertakzent. Sie hebt mit Nachdruck hervor, was der Marxismus verschleiern muß, daß es sich auch in diesem zunächst noch hypothetischen Falle um Gewalt, d. h. um eine Verfahrensweise handelt, die dem Rechts- und Sittengesetze zuwiderläuft.
Noch näher steht der soziologischen Staatsidee die Meinung, daß es ein erfolgreicher Häuptling gewesen ist, der über seinen Mitbürgern die Herrschaft, und damit den Staat errichtet hat. Das war schon die Meinung Herbert Spencers, der ja von seinem ausgesprochen organizistischen Standpunkt aus schwer zu einer anderen Auffassung hätte gelangen können [1]. In seinem „The man versus the State“ schreibt er : „Mag es nun wahr oder falsch sein, daß der Mensch in Ungerechtigkeit geschaffen und in Sünde empfangen ist, so ist doch über jeden Zweifel erhaben, daß die Herrschaft (government) aus und durch Krieg (aggression) entstanden ist... . Wir finden Beweise dafür, daß die zuerst nur während des Feldzuges zeitweilig anerkannte Autorität des Kriegshäuptlings sich für die Dauer befestigt, und zu großer Kraft erwächst, wo ein erfolgreicher Angriffskrieg zur Unterwerfung benachbarter Stämme führt“.
Hier ist wohl zu beachten, daß Spencer den Nachdruck auf die Ausgestaltung der Herrschaft über die eigenen Stammesgenossen des siegreichen Führers legt. Selbst wenn der Krieg nicht zur Unterwerfung der Nachbarn führt, entsteht bereits dauernde Herrschaft — sie
[1] Schon vor ihm steht Herder dieser Auffassung nahe: „Aus ursprünglich-patriarchalischen Zuständen des Vertrauens zwischen Volk und Fürst entwickelt sich durch Mißbrauch dieses Vertrauens der Despotismus, den die Völker dann gesetzlich einzuschränken suchen. Es entsteht der Staat“. (Nach Rosenzweig, Hegel und der Staat, I S. 28.) Das ist v. Haller mit einem Schuß Rousseau.
[172]
wird nach solchem Erfolge nur viel stärker. Diese Dinge kommen vor, und die Soziologie des Staates hat sie zu beachten: aber sie betrachtet sie erstens als sek undär und ist zweitens und vor allem der Überzeugung, daß das Primäre die durch den glücklichen Krieg erzeugte Herrschaft des ganzen siegreichen Stammes über den ganzen besiegten Stamm ist.
Auf ähnlichem Standpunkt steht der italienische Soziologe M. A. Vaccaro. Er ist der Meinung, daß der glückliche Kriegshäuptling in der Regel auch der große Zauberer seines Stammes geworden sei; er habe somit die beiden vornehmsten Machtquellen jener fernen Vorzeit in seiner Hand vereinigt und, darauf gestützt, durch Mißbrauch seines Amtes im Schöße der angestammten (ancestral) Gruppe die Tyrannis und die Autokratie errichten können [1].
Was an dieser Anschauung unbedingt richtig ist, ist die viel bezeugte Tatsache, daß aller „Cäsaropapismus“ schon auf sehr tiefer Stufe die Ausbildung despotischer Herrschaftsformen mehr als anderes befördert. Wir werden ausführlich davon zu handeln haben. Aber wir halten mit Seiliiere, dem wir die Stelle verdanken[2], die Meinung für wenig wahrscheinlich, ja, für vollkommen widerlegbar. Seillière vergleicht die Lehrmeinung mit der von Rousseau in seinem „discours sur l'inégalité“ ausgesprochenen entgegengesetzten Anschauung[3] und bemerkt, sie sei recht unwahrscheinlich; es sei viel leichter, einem besiegten Volke sein Gesetz aufzuerlegen, als irgendeine Gewalt in der eigenen Gruppe zu usurpieren. Wir behalten es der zusammenfassenden Kritik vor, diese uns als streng beweisbar erscheinende Meinung zu erhärten.
Um nun über diese Zwischenstufen hinweg zu der eigentlichen soziologischen Staatsidee zu kommen, so taucht der so nahe liegende Gedanke, daß der Staat die Schöpfung äußerer erobernder Gewalt sei, überall mit Selbstverständlichkeit auf, wo der Staat mit anderen Mächten in offenen Konflikt gerät. Einer der Ersten, die ihn literarisch geäußert haben, scheint der oben erwähnte evangelische Monarchomache Hotman gewesen zu sein. Dann wird die Auffassung, in einem der ersten Konflikte des jungen Sozialismus mit dem bürgerlichen Staat, kennzeichnenderweise sofort nach dessen erstem Siege unter Cromwell, (die Gruppen reagieren in der Tat mit der Präzision eines chemischen Experiments[4]) Teil des theoretischen Bekenntnisses der „True Levellers“ oder „Diggers“: so genannt, weil sie auf ungenütztem Brachland zu graben (dig) anfingen, um dort ohne Erlaubnis der Eigentümer, deren Recht sie nicht anerkannten, zu siedeln. Sie hatten die richtige Vor-
[1] Les bases sociologiques du Droit et de l'Etat.
[2] L'Impérialisme démocratique S. 59.
[3] S. oben 77 ff.
[4] S. S. I, S. 970ff.
[173]
Stellung, die so viel später erst ihr großer Landsmann Charles Hall wieder aussprach [1], daß die Bodensperre die eigentliche große Ursache der sozialen Leiden sei, die Erbsünde, Adam in Person, nämlich „a dam“, ein sperrender Damm, eine Aussperrung der Menschen von ihrem natürlichen Erbgute, dem Grund und Boden. Gerrard Winstanley[2] und William Everard, ihre geistigen Führer, tragen in zwei Flugschriften die soziologische Staatsidee vor. Sie betrachten sich als die Rechtsnachfolger der von den Normannen expropriierten Sachsen; jetzt, nachdem der Nachfolger des Eroberers, Karl IL, hingerichtet sei, fordern sie im Namen des Urrechts sowohl wie des jetzigen Siegrechtes ihr Eigentum zurück[3].
Dann lebt der Gedanke in soziologisch ähnlicher Situation anderthalb Jahrhunderte später in Frankreich wieder auf, aber als Argument im geistigen Aufmarsch der Bürgerklasse gegen den Absolutismus. In seiner berühmten Streitschrift: „Qu'est ce que le Tiers Etat?“ sagt der Abbé Sieyès, der Adel sei ein besonderes Volk in der Nation, die ganz allein durch den dritten Stand dargestellt sei: „Was ist der Dritte Stand? Nichts! Was soll er sein? Alles!“ Und er beruft sich dabei auf einen typischen Junker, „den Historiker Boulainvilliers, der (1727) in einer Denkschrift an den Prinzen von Orleans größere Freiheiten für den Adel verlangte, mit der Begründung, daß dessen Vorgänger, die Franken, das gallische Volk unterjocht und Frankreich begründet haben“[4]. Und auch Sieyès verlangt nicht nur kraft des natürlichen Rechts, sondern auch kraft des Rechtes des Schwertes, auf das sich die die Legitimisten berufen, Restitution[5].
Wir haben hier in der Tat ein Argument des Legitimismus, das, mit umgekehrtem Vorzeichen versehen, wie ein Pfeil wirkt, der auf den Schützen zurückschnellt. Schon lange vorher war es durch einen unbefangenen Historiker und Soziologen von hohem Range zu ausschließlich wissenschaftlichen Erkenntniszwecken als die schlichte Wahrheit ausgesprochen worden, die es in der Tat ist, und die niemals hätte verschleiert werden können, wenn nicht die philosophischen Vorstellungen vom überhistorischen, und die juristischen Vorstellungen vom nichthistorischen Staate in Europa die geschichtlichen Vorstellungen vom Staate der Wirklichkeit fortwährend verbogen und verdorben hätten.
Ibn Chaldûn, ein vornehmer, in Tunis 1332 geborener Maure, hoher Staatsbeamter zuerst in Tunis, dann in Marokko, dann in Granada,
[1] S. S. III, S. 225.
[2] Vgl. Gooch, a. a. O. S. I22ff.
[3] Adler, Gesch. d. Soz. und Kommun. I, 1899, S. 230. Vgl. S. S. III, S. 150.
[4] Gumplowicz, Gesch. d. Staatsth. S. 278.
[5] Vgl. S. S. I, S. 989.
[174]
dann Professor in Ägypten, noch später im Dienste des siegreichen Timur Lenk, kann es mit Händen greifen, wie Staaten entstehen : überall herrscht der siegreiche Nomadenstamm, in Afrika und Spanien die Araber, in Asien die Mongolen, über unterworfene und mit aller Härte niedergehaltene und wirtschaftlich ausgebeutete fremde Völker. Die ethnische und sprachliche Verschmelzung, die in West- und Südeuropa eine ursprüngliche Einheit vortäuschte, bestand hier nicht oder noch nicht. Und so schreibt Ibn Chaldûn in seiner berühmten „Einleitung in die Geschichtswissenschaft“ kurz und knapp: „Die Staaten entstehen durch Eroberung... ; nach erfolgter Landnahme müssen die Anhänger der neuen Dynastie, der siegreiche Stamm, sich über das ganze Land verteilen, und in den einzelnen Provinzen die Burgen ... besetzen“ [1].
Hatte der Angehörige der herrschenden Erobererschicht und Herrengruppe keine äußere Veranlassung, die Dinge durch eine gefärbte Brille zu sehen, so hatte er auch keinen inneren Grund dazu. Denn der Islam ist, gleich der nordischen, eine Religion des Krieges, nicht, wie das Christentum, des Friedens. Seine Bekenner hatten es nicht nötig, ihr wahres Leben mit ihrem Bekenntnis durch Fiktionen in künstlicher Übereinstimmung zu halten. Nicht Menschenliebe predigt der Khoran, sondern die Herrschaft des Rechtgläubigen über den Giaur kraft des natürlichen Rechts des Schwertes und des göttlichen Befehls[2].
Um uns wieder nach Europa zurückzuwenden, so trug nach der Revolution von 1789, vielleicht von Sieyès angeregt, der Graf St. Simon, der Gründer der modernen Soziologie und des modernen Sozialismus [1], denselben Gedanken vor. Und jetzt wirkte er endlich gewaltig in die Weite und Tiefe, namentlich in der geschickten Form, in der seine Schüler, Bazard und Enfantin, ihn ausgestalteten[3]. Proudhon, Comte, wahrscheinlich Carey und sicherlich sein Schüler Dühring sind von hier ausgegangen[4], ebenso Rodbertus[5], und schließlich Gumplowicz, der den bezeichnenden Terminus geprägt hat: die soziologische Staatsidee. Die Bezeichnung ist noch glücklicher, als ihr Autor wußte: nach unserer immer wieder ausgesprochenen festen Überzeugung besteht die Hauptaufgabe der Soziologie darin, diese Staatsidee nicht nur zu be-
[1] Gumplowicz, a. a. O. S. 124ff. Vgl. auch seine „Soziologischen Essays“ S. 150ff.
[2] Mohammed sagt: „Der Unterhalt meiner Gemeinde beruht auf den Hufen ihrer Rosse und den Spitzen ihrer Lanzen, solange sie nicht den Acker bestellen; wenn sie aber anfangen, das zu tun, so werden sie wie die übrigen Menschen“. (Zitiert nach Neurath: Antike Wirtschaftsgeschichte, S. 20.) Neben dem „dorischen Tischliede“, das wir weiter unten abdrucken werden, ist dies das uns bekannte freimütigste und großartigste Bekenntnis zum „Politischen Mittel der ökonomischen Bedürfnisbefriedigung“.
[3] S. S. I, S. 45/6, III, S. 150.
[4] S. S. I, S. 985. Auch John Stuart Mill in seiner letzten Periode (vgl. S. S. III, 206).
[5] S. S. II, S. 150.
[175]
weisen, sondern in ihren gesamten Konsequenzen auszuführen. Und das heißt nichts anderes, als ihren kontradiktorischen Gegensatz, das „Gesetz der ursprünglichen Akkumulation“, die soziologische Wurzel aller Übel, aus den Grundlagen aller, buchstäblich aller Gesellschaftswissenschaften auszurotten: nicht nur der Staats-, sondern auch der Wirtschafts- und der Rechtswissenschaft und der politischen Geschichte. Ihnen allen ist es das grundlegende Axiom [1], und sie alle werden davon verheert, wie wir in unserer Ökonomik schon gezeigt haben und in dieser Staatslehre und später, in einem universalgeschichtlichen Versuch von größter Spannweite, zu beweisen versuchen werden.
Ludwig Gumplowicz hat leider seine richtige und schon fast zu voller Ausbildung gestaltete Lehre vom Staate mit ganz überflüssigen philosophischen und anderen Velleitäten belastet, die der Einbürgerung der Vorstellung noch größere Schwierigkeiten bereiteten als die Neuheit und Tragweite des Gedankens selbst, der den beati possidentes der Wissenschaft nicht nur ein vollkommenes Umlernen und den offenen Verzicht auf uralten, gesicherten Besitz zumutete („Die Kapitalisten des Geistes wehren sich gegen ihre Expropriation“, schrieb ich einmal über die Grenznutzenschule)[2], sondern der auch außerdem noch an den persönlichen Mut desjenigen, der ihn vortragen sollte, sehr hohe Ansprüche stellte. Denn nichts kann „staatsgefährlicher“ sein als eine wahre Lehre vom Staate[3].
So war es denn menschlich zu verstehen, wenn Gumplowicz' erste Veröffentlichungen entweder sekretiert, d. h. totgeschwiegen, oder nach bewährter Methode derart kritisiert wurden, daß nur jene harmlosen philosophischen Schwächen, aber nichts von dem Neuen und Wichtigen dargestellt wurde. Und da der derart Behandelte immer bitterer und seinerseits aggressiver wurde, so gab auch das wieder Grund oder doch Vorwand, um die unbequemen und gefährlichen Gedanken auf den Index zu setzen.
Gumplowicz ist „Monist“, und nicht einmal nur „Methodenmonist“, sondern wirklicher Bekenner der Überzeugung, daß auch die geistiggesellschaftlichen Dinge nichts als unter Naturgesetzen stehende Erscheinungen sind. Wir haben in der Grundlegung unserer allgemeinen Soziologie gezeigt, inwieweit dieser Standpunkt richtig, und inwieweit er unhaltbar ist. Selbstverständlich sind wir berechtigt, alle äußeren Phänomene, also auch das Gesellschaftsleben, das uns ja unmittelbar
[1] S. S. III, S. 208.
[2] S. S. in, s. 131.
[3] Man lese, wie geradezu entsetzt der alte prächtige Adolf Wagner, trotz großer persönlicher Freundschaft für den Autor, und trotz höchster Anerkennung für das Buch, von unserem „Staat“ spricht: es kann doch nicht wirklich so sein ? ! (Art. Staat in nationalökonomischer Betrachtung. Hdw. d. Staatsw. 4. Aufl.)
[176]
nur durch unsere Sinne gegeben ist, als äußere Phänomene, d. h. mit der „mechanischen Betrachtungsweise“ [1] anzuschauen. Aber dann dürfen wir aus unserem inneren Wissen nichts hinzu tun, dürfen mit anderen Worten in dieser Betrachtung nur von Bewegung und Änderung, aber beileibe nicht von Leben und Bewußtsein sprechen. Das ist ausschließlich Sache der „psychologischen Betrachtungsweise“, die geboren ist aus unserer, uns unmittelbar, ohne Vermittlung unserer Sinne, gegebenen Selbstbeobachtung, die wir dann, durch einen notwendigen Schluß, auf diejenigen Wesen übertragen, die wir, durch äußere Beobachtung, als uns ähnlich erkennen: denn wir kennen unseren Körper ja auch durch unsere Sinne.
Daß wir diese beiden Betrachtungsweisen kombinieren, ist wieder denknotwendig: aber wir dürfen sie niemals verwirren, sonst machen wir uns einer „Grenzüberschreitung“[2] schuldig. Und in diese Schuld ist Gumplowicz verfallen. Er ist philosophischer Materialist etwa wie Häckel. Und so ist alles Psychische ihm nur der naturnotwendige, naturgesetzliche Ausdruck der Gruppenlagerung.
Die Vorstellung ist nicht absolut falsch. Sie enthält in Übertreibung den gesunden Grundgedanken der materialistischen Geschichtsauffassung, wonach die „Ideologien“ nichts sind als der Überbau über den Interessen der Gruppe. Im allgemeinen, berechnet auf die Dauer und den Durchschnitt, also in der „Statik“, kann man wohl sagen, daß eine bestimmte Lagerung der Gruppe in ihren Mitgliedern bestimmte Interessen hervorruft, die nun wieder bestimmte Handlungen nach sich ziehen. Und so kann man von dem determinierten Mittclglicdc abstrahieren und den Sachverhalt derart beschreiben, daß eine bestimmte Lagerung der Gruppe eine bestimmte Handlung notwendig nach- sich zieht[3].
Aber man darf die Dinge doch erstens nicht darstellen, als wenn die Motivation der Menschen überhaupt in dem Vorgange keine Rolle spielte, gerade so, als wenn es sich um den Einfall eines Lichtstrahls in ein Medium handelte (Gumplowicz braucht dieses Bild)[4]. So materialistisch darf man den historischen Materialismus nicht auffassen: „Vergißt man nie das Marxsche Wort: ,Bei mir ist das Ideelle das im Menschenkopf umgesetzte Materielle', so weiß man, um es nie mehr zu übersehen, daß es keine ökonomische Verursachung gibt, die nicht zugleich im Menschenkopf sich vollzieht“[5]. Vor allem aber gilt diese absolute Determination der Handlung
[1] S. S. 1, s. 191 ff.
[2] S. S. I, S. 201 ff.
[3] S. S. I, S. 600/1.
[4] Grundriß der Soziologie, S. 167—-8.
[5] Adler, Staatsauffassung des Marxismus, S. 163.
[177]
eben nur für die „Statik“ der Gesellschaft — und die ist eine methodische Fiktion im Sinne der Philosophie des Als-Ob, ist ein „irreales Gedankenbild“ [1]. In der Realität gilt die absolute Determination aber nicht uneingeschränkt, sondern das Geschehen zeigt nur starke Annäherung an diesen absoluten Typus. Denn hier greifen die, der Soziologie nicht durchaus erfaßbaren „suprasozialen Persönlichkeiten“ in das Geschehen ein und hemmen oder fördern den Ablauf[2]. Sie sind die Träger der neuen Werte oder die Prägemeister alter Werte in neuer gangbarer Form. Das leuchtet sogar durch die Auffassung des besten marxistischen Rechts- und Staatsphilosophen hindurch: „Aber zu dieser Wirklichkeitserkenntnis gehören ja ... natürlich auch die sittlichen und politischen Werte, die ihr Ergebnis erst kausal determinieren — das heißt, erst dadurch wirklich machen, daß sie als Kausalfaktoren in der Geschichte wirken. Und indem eine Kausalerkenntnis des geschichtlichen Prozesses nachweist, daß gewisse sittliche Werte und Zielsetzungen immer massenhafter aus bestimmten sozialen Lebensumständen motiviert werden, immer größere soziale Kraft erhalten müssen, ergibt sich zuletzt die mit dem Ideal übereinstimmende Richtung des Kausalprozesses nicht mehr als ein Zufall und auch nicht als eine geschichtsphilosophische Konstruktion, sondern als kausalgenetischer Zusammenhang“[3]. Hier fehlt nur der ausdrückliche Hinweis, daß diese sittlichen Werte und Zielsetzungen sehr oft zuerst von Einzelnen, führenden, suprasozialen Persönlichkeiten, empfunden und ausgedrückt werden — und wie könnte ein Apostel von Marx das nicht anerkennen?! — um unseren Gedankengang ungefähr wiederzugeben.
Diese wichtigen Einschränkungen der Lehre vom sozialpsychologischen Determinismus hat Gumplowicz nicht gemacht, und darum erscheint in seiner Darstellung vieles übertrieben und verzent. So er-
[1] S. S. I, S. 606, 613.
[2] S. S. I, S. 615, S. 791 ff. „In der öffentlichen Meinung ist alles Falsche und Wahre, aber das Wahre in ihr zu finden, ist Sache des großen Mannes. Wer, was seine Zeit will und ausspricht, ihr sagt und vollbringt, ist der große Mann der Zeit. Er tut, was das Innere und Wesen der Zeit ist, verwirklicht sie“. (Hegel, Grundl. d. Philos, d. Rechts, Werke, Bd. VIII, 3. Aufl., S. 404). Schelling schreibt (a. a. O., S. 178): „Die Zufälligkeit der Begebenheiten und Handlungen findet der gemeine Verstand vorzüglich durch die Zufälligkeit der Individuen begründet. Ich frage dagegen: was ist denn dieses oder jenes Individuum anders als eben das, welches diese oder jene bestimmte Handlung ausgeführt hat; einen anderen Begriff gibt es von ihm nicht; war also die Handlung notwendig, so war es auch das Individuum. Was selbst von einem untergeordneten Standpunkt allein als frei und demnach objektiv zufällig in allem Handeln erscheinen kann, ist bloß, daß das Individuum von dem, was vorherbestimmt und notwendig ist, dieses Bestimmte gerade zu seiner Tat macht: übrigens aber und was den Erfolg betrifft, ist es, im Guten wie im Bösen, Werkzeug der absoluten Notwendigkeit“. Und „Das Genie ist nur Genie, insofern es die höchste Gesetzmäßigkeit ist“ (316).
[3] Adler, a. a. O. S. 27.
[178]
klärt es sich, daß er die aristotelische Lehre gründlich mißversteht, zwar nicht wie die Romantik durch eine falsche Deutung seines Begriffs der „Familie“ (hier versteht er ihn ganz richtig), wohl aber in seiner Deutung des aristotelischen Begriffs „Natur“. Er begreift den Ausdruck, daß „der Staat ein Naturprodukt“ sei, derart, daß Aristoteles habe sagen wollen, er stehe auf exakt einer Stufe mit dem Bienenstock oder Ameisenhaufen [1]. Der Stagirit hat aber ganz gewiß an die „menschliche Natur“, d. h. Seelenbeschaffenheit gedacht, auch wenn er von den „Sklaven von Natur“ sprach: denn diese unterschieden sich ja leiblich nicht von den Hellenen: was sie zur Sklaverei vorbestimmte, war ihm eben ihre minderwertige Seelenanlage.
Von diesen Velleitäten abgesehen, hat aber Gumplowicz die soziologische Staatsidee nicht nur als Erster geradezu in den Mittelpunkt der Soziologie gestellt, sondern auch sogleich in allen ihren Hauptrichtungen ausgestaltet, so daß dem Nachfolger nichts geradezu Entscheidendes mehr zu tun blieb. Wir stellen die wichtigsten Sätze, die er unermüdlich in den verschiedensten Publikationen wiederholt hat, zusammen :
„Die Soziologie erklärt es klipp und klar, daß Staaten nie und nirgends auf andere Weise entstanden sind, als indem mindestens zwei heterogene soziale Gruppen feindlich aufeinanderstoßen, wobei die eine die andere überwältigt und unterjocht, und daß die Entwicklung des Staates gar nicht anders vor sich gehen kann, als in stetem Kampfe heterogener und differenter sozialer Gruppen gegeneinander“[2].
Der zweite Satz gibt das Motiv: „Der Staat ist von Natur nichts anderes als die Einrichtung, vermöge welcher die siegende Gruppe sich ihren Lebensunterhalt von der unterliegenden in der einen oder anderen Form beschaffen läßt. In dem naturgesetzlichen ewigen Kampf der Gruppen bildet der Staat das natürliche Mittel, den Siegern den von den Besiegten zu leistenden Siegespreis sicherzustellen“[3].
Das ist die einzige uns aufgefallene Stelle, in der Gumplowicz, der sonst nur von „HerrSchaftsbedürfnis“ und ewigem Antagonismus sprach, das wirtschaftliche Motiv der Staatsbildung erwähnt. Vielleicht gehen wir nicht fehl, wenn wir in dieser Stelle ein Ergebnis der zwischen dem Grazer und uns selbst (in den freundschaftlichsten Formen)
[1] Sozialphilosophie im Umriß, S. 30. S. 33 hat er wieder einen anderen Begriff von „Natur“, nämlich den Kantischen, wo er ungefähr „Vorsehung“ bedeutet; hier erscheint ihm der Zusammenstoß als ein Mittel, durch welches „die Natur ihre Absicht, eine das Recht verwaltende bürgerliche Gesellschaft zu erzeugen, zu verwirklichen versucht“. Setzt ihn dem aristotelischen und schließlich ganz naiv seinem monistischnaturalistischen gleich !
[2] A. a. O. S. 33.
[3] Allgemeines Staatsrecht, 3. Aufl. (1907), S. 31.
[179]
stattgehabten Debatte erblicken [1]. Aber er spricht auch hier noch immer von dem „naturgesetzlichen ewigen Kampfe der Gruppen“. In diesem Punkte ist es mir also nicht gelungen, ihn von seinem soziologischen Pessimismus zu heilen, der den Gruppen- und Klassenkampf für gerade so „naturgesetzlich ewig“ hielt wie etwa die gegenseitige Anziehung der Gestirne. Und doch hätte der Wandel seiner Anschauung über das Motiv der Staatsgründung ihm wenigstens einen Zweifel an der ewigen Naturnotwendigkeit des Klassenkampfes[2] und Klassenstaates erwecken sollen. Denn, wenn die Möglichkeit gegeben sein sollte — die er nicht ausschließen konnte —, daß der wirtschaftliche Eigennutz der Menschen sich besser und billiger auf andere Weise befriedigen könnte, dann wäre ja mit dem Motiv der Unterwerfung und Ausbeutung auch die Handlung, mit der Ursache die „naturnotwendige“ Folge verschwunden.
Der dritte Satz lautet: „Wir werden nicht fehlgehen, wenn wir zunächst den Staat definieren als eine naturwüchsige Organisation der Herrschaft behufs Aufrechterhaltung einer bestimmten Rechtsordnung“[3]. Hier ist die Grundlegung der soziologischen Fundier ung des nichthistorischen Juristenstaates, dem damit gegeben wird, was die rein juristische Betrachtung, wie wir wissen, niemals auffinden kann: die Entstehung wenigstens großer Teile des im Staate waltenden Rechts.
Der vierte Satz lautet: „Dieses Verhältnis (zwischen den beiden Gruppen) ist ganz gewiß gedeihlich und ersprießlich für die Gesamtheit, d. h. für das neu entstandene soziale Gebild — den Staat. Denn es begründet die Arbeitsteilung und bahnt einer höheren Kultur die Wege. Aber im Inneren legt es zugleich den Keim zu jahrhundertelangem „Antagonismus“, zu einem sozialen Gegensatz und zu sozialen Kämpfen, die zunächst niedergehalten werden müssen durch eine „Rechtsordnung“ die Mühe hat, sich zu behaupten, und einmal mehr oder minder mühsam gesprengt wird“[4].
Hier haben wir in nuce den ganzen Inhalt der Staatsentwicklung.
[1] Ich muß das hier betonen, weil ich in meiner „Theorie“ (1.—4. Aufl.) ausgesprochen habe, daß ich „der im wesentlichen staatsrechtlichen und staatsphilosophischen Lehre die nötige staatswirtschaftliche Ergänzung gegeben habe“. Auf diese Debatte spielt G. schon in seiner „Geschichte der Staatstheorien“ (1905) S. 43 an.
[2] Er sprach zuerst von „Rassenkampf“, sah aber dann ein, daß auch nächst verwandte Gruppen die Rollen des Hammers und Ambosses spielen können, und daß in den späteren „Klassen“ durchaus nicht immer noch ausschließlich Angehörige der alten Sieger- bzw. Knechtegruppe vorhanden sind.
[3] Allg. Staatsrecht, S. 24.
[4] Sozialphilosophie im Umriß, S. 54. 12*
[180]
Der fünfte Satz gibt in gleicher Knappheit den ganzen Inhalt der Realpolitik: „Die Beherrschten sind in der Majorität und werden durch die Minorität der Herrschenden mittels politischer Kunst niedergehalten. Diese Kunst besteht in der Anwendung verschiedenster Maßregeln, welche den Zweck verfolgen, die Majorität in einem Zustande der Schwäche zu erhalten, so daß die Minorität ihr trotz der numerischen Schwäche überlegen ist“ [1]. An anderer Stelle aber heißt es: „daß all und jedes geschichtliche und öffentliche Leben, all und jede Politik nichts anderes ist, als ein Kampf sozialer Gruppen miteinander, die uns im öffentlichen Leben als Klassen und Parteien entgegentreten“[2].
So richtig der erste Satz ist, so falsch ist der zweite. Es ist nicht wahr, daß alles geschichtliche und öffentliche Leben nur Kampf, daß alle Politik nichts ist als Klassenkampf. Es lebt in jeder nicht heillos zerrütteten Rahmengruppe außer den Klasseninteressen und dem sie begleitenden Klassenbewußtsein auch noch ein, und in aller Regel stärkeres, Gemeininteresse und Gemeinbewußtsein. Und so dient auch ein Teil des öffentlichen Lebens und der Politik diesem Gemeininteresse: es gibt z. B. Seuchen-, Deich-, Forst- usw. -politik; und selbst in die Kirchen-, Schul-, Arbeiterpolitik usw. tritt das Gemeininteresse mit starken Wurzeln ein. Es ist nötig gewesen, gegenüber der ganz einseitigen Betonung des Gemeininteresses in der bürgerlich-apologetischen Literatur die Klasseninteressen und den Klassenkampf mit allem Nachdruck zu betonen: aber es ist ebenso einseitig, das Gemeininteresse und die ihm dienende Tätigkeit des entfalteten Staates nicht zu sehen oder abzuleugnen. Der Staat ist eben eine „Mischform menschlicher Beziehungen“[3].
Gumplowicz' Schüler Ratzenhofer ist namentlich der zweiten der hier unterschiedenen Wegrichtungen seines Meisters gefolgt[4]. Wir haben ihm in der Grundlegung der allgemeinen Soziologie[5] eine ausführliche Würdigung zuteil werden lassen, von der wir trotz v. Wieses Urteil, er habe den Gegenstand „meisterhaft“ behandelt[6], es „bleibe sein dauerndes wissenschaftliches Verdienst, daß er das Wesen der Politik innerhalb der sozialen Betätigungen mit Sicherheit und Schärfe erfaßt und analysiert hat“[7], kein Wort zurücknehmen können. Sein Ausgangsaxiom, die angeblich bestehende „absolute Feindseligkeit“, ist ein Pseudogesetz : es beruht mindestens auf einer vorschnellen Ver-
[1] Sozialphilosophie im Umriß, S. 54/5.
[2] Sozialphilosophie im Umriß, S. 39.
[3] S. S. I, 367, 1040 „Aus Kratos und Ethos gemischt“, sagt Meinecke.
[4] Wesen und Zweck der Politik, 1893; Soziologie, 1907.
[5] S. S. I, S. 362 ff.
[6] Allgem. Soziologie, S. 131.
[7] Allgem. Soziologie, S. 173.
[181]
allgemeinerung, auf unzureichender Induktion, wenn es nicht einfach eine Reminiszenz an Hobbes ist; und außerdem spricht bei wenigen Autoren ihre „persönliche Gleichung“ so naiv und so ärgerlich.
Es war unsere Pflicht, auf die Fehler und Ausschreitungen der bisherigen Hauptvertreter der „soziologischen Staatsidee“ mit allem Nachdruck hinzuweisen, gerade weil wir selbst die Lehre uns in ihren Hauptzügen vollkommen zu eigen machen. Es war zu verhüten, daß wieder die Kritik sich an die schwachen Stellen halte, um desto sicherer von den Stärken der Lehre schweigen zu können.
Es wird die Hauptaufgabe dieses Buches sein, die von den Schöpfern der soziologischen Staatsidee bezeichneten Wege weiter, wo möglich bis zu Ende zu gehen.
Vorher aber wird die Lehre mit ihren Vorläufern und Gegnern im bürgerlichen und marxistischen Lager zu konfrontieren und kritisch zu sichern sein.
E. Zusammenfassung.
Wir haben jetzt in langer, mühsamer, geistesgeschichtlicher Arbeit alle Wurzeln des Pseudogesetzes der „ursprünglichen Akkumulation“ einzeln bloßgelegt.
Seine naturrechtliche Wurzel ist, um es zu wiederholen, entsprossen aus zwei einander schnurstracks widersprechenden antiken Philosophemen, der Stoa und dem Epikuräismus, die beide dogmatischmetaphysisch begründet waren, und die man notdürftig mit eingestandenen oder verhohlenen theologischen Mitteln zu einer Art von Synkretismus zusammengeleimt und durch die Hereinnahme einiger Rechtssätze, die hier, gelinde gesagt, keine Geltung haben (Pacta sunt servanda, Volenti non fit injuria) aus einer staatsphilosophischen in eine staatsrechtliche Lehre verwandelt hatte. Durch eine nochmalige Metempsychose wurde dann aus dieser schematisch-juristischen, ausgesprochenermaßen nicht-historischen Konstruktion oder Rechtsfiktion eine historisch-soziologische Theorie.
Der Legitimismus fügt hinzu ein lächerliches Mißverständnis des aristotelischen Begriffs „Oikos“ (Familie); man versieht die patriarchalische Großfamilie mit ihrer Sklavenschaft in die moderne, nur aus Freien, Weib und Kindern, bestehende Kleinfamilie.
Die Romantik gibt in das Gebräu die Gleichsetzung von Staat und Gesellschaft oder „Gemeinschaft“ und den unglücklichen, unverstandenen Begriff des „Organismus“.
Die proletarische Staatstheorie verstärkt diese letztgenannte Irrung noch durch ihre einseitige, „produktionistische“ Zuspitzung der richtigen ' Lehre von der „sozialpsychologischen Determination“.
[182]
Das sind die Wurzeln. Man wird kaum erwarten, daß daraus ein gesundes Gewächs entsprossen sein könnte. Und dennoch ist diese edle Mischung, wir wiederholen es mit allem Nachdruck, die tragende Säule, das Grundaxiom, aller Soziologie, der bürgerlichen und der proletarischen; und ist darum „die Wurzel aller soziologischen Übel“ : der theoretischen, und derer, die aus jenen folgen, der praktischen. Sie ist die einzige logische Grundlage des Kommunismus in seinen sämtlichen Gestalten, von dem törichten Gewerkschaftssozialismus an, der eine große Volkskatastrophe, statt in eine Neugestaltung der öffentlichen Dinge, in eine — Lohnbewegung ausmünden ließ, bis zu dem Bolschewismus, der im Dienste seiner Phantasmen einen ganzen Erdteil — denn Rußland ist ein Erdteil — verheert. Nichts ist, im Guten wie im Bösen, so praktisch wie die Theorie! Die Kluft, die heute die europäische Menschheit in zwei tödlich verfeindete Lager spaltet, würde sich sofort schließen, an Stelle des Kampfes auf Tod und Leben träte die Befriedung, an Stelle der Verzweiflung der frohe Glaube an den Menschen und seine Zukunft, wenn es gelänge, dieses Unkraut endlich mit allen seinen Wurzeln auszuroden.
Den Versuch zu machen, ist des Schweißes der Edelsten wert. Er wird im Folgenden unternommen werden.
Uns plagt nicht der mindeste Zweifel, daß dieser Versuch glücken wird, soweit die Arbeit der Logik aus verifizierten Prämissen in Frage steht. Die Dinge liegen so sonnenklar, daß vorurteilslose Leser ohne weiteres einstimmen müssen. „Nam harum rerum est demonstratio“ (Hobbes). Aber: wo sind vorurteilslose Leser zu finden?!
Die ungeheuersten Interessen der mächtigsten Klassen sind unlöslich mit der Geltung des Gesetzes der ursprünglichen Akkumulation verknüpft; der geistige Besitz fast aller Forscher auf den weiten Gebieten der Gesellschaftswissenschaften ist bedroht; die Politiker fast aller Parteien müßten öffentlich bekennen, daß sie anbeten werden, was sie bisher verflucht, und verfluchen werden, was sie bisher angebetet haben; die Herausgeber und Schriftleiter der achten Großmacht, der Presse, müßten nicht nur die Kraft haben, sich der Umklammerung durch das Kapital — und nicht bloß durch das der Kapitalisten — zu entziehen, sondern auch umzulernen und die neue Erkenntnis auch zu bekennen. Wer, der Menschen und Menschliches kennt, kann den Mut haben zu glauben, daß unser Versuch auch in dieser Beziehung glücken wird?! Von Ihering sagt einmal, ein bestehendes Recht aufheben, heiße einen Polypen losreißen, der sich mit tausend Armen anklammert. Nicht minder schwer, vielleicht schwerer ist es, einen in alle Interessen tief verwurzelten Irrtum auszurotten [1].
[1] Vgl. dazu Erik Nölting, „Der liberale Sozialismus Oppenheimers als proletarische Ideologie“, Festschrift für Franz Oppenheimer, S. 365ff.
[183]
Dennoch würden wir, die wir den Menschen nicht für bös, — auch nicht für gut! — halten, nicht daran zweifeln, daß, wenn nicht diese, so doch eine der nächsten Generationen zu gewinnen sein wird, zumal der Bankerott sowohl der bürgerlichen wie der sozialistischen Theorie [1] und Praxis immer klarer zutage tritt, und die verzweifelnde Welt Europas nach neuer froher Botschaft schreit — : aber wir kennen den Psychomechanismus allzugut, den „sozialpsychologischen Determinismus“, der es auch den Gutgläubigen geradezu unmöglich macht, dort zu erkennen, wo ihr Interesse, das ihrer Klasse noch weit mehr als das eigene, widerspricht. Wir haben immer wieder den Klassentheoretikern die volle Gutgläubigkeit zugebilligt[2] : wir billigen sie auch unseren Zeitgenossen und künftigen Kritikern schon heute zu: ein Generalpardon, ein Ablaß für die Zukunft.
Wir haben schon mehrfach in ebenso sauberen „Sektionsprotokollen“ einflußreiche Doktrinen seziert: den Malthusianismus, der nichts anderes ist als die in die Zukunft projizierte Kinderfibel von der ursprünglichen Akkumulation[3], den Marxismus[4], und die Ricardosche Theorie der Grundrente[5]. Nur das erstgenannte Buch hat einen Öffentlichkeitserfolg gehabt, und zwar nicht durch die Kraft seiner Gründe, sondern nur, weil der bedrohliche Rückgang der Geburtlichkeit auch in Deutschland das Interesse der herrschenden Klasse umgelegt und ihr empfohlen hat, der Arbeiterschaft nicht mehr die Beschränkung, sondern im Gegenteil möglichst ausgiebige Vermehrung der Kinderzahl anzuraten. Ebensowenig ist es den besten Gründen geglückt, die von uns sofort als unendlich gefährlich erkannte Geschichtsklitterung Houston Stewart Chamberlains zu erschüttern[6] : eine der Geistesleistungen, die uns in das Elend dieses entsetzlichen Weltkrieges geführt haben.
Überall hier haben wir erleben müssen, daß die von uns mit der größten Mühe entwirrten Fäden der sich verknäuelnden falschen Theoreme wieder verwirrt wurden: nahezu ein Schöpfen ins Faß der Danaiden !
[1] „Die zerfetzte und spukhaft ragende Bruchstückgröße, die sich heute noch Marxismus nennt“ schreibt Nölting, a. a. O. S. 370.
[2] S. S. III, S. 160ff.
[3] Das Bevölkerungsgesetz des T. R. Malthus, Darstellung und Kritik, Jena 1901, S. S. III, S. 1034—1080.
[4] Das Grundgesetz der Marxschen Gesellschaftslehre, Darstellung und Kritik, Berlin 1903; Kapitalismus, Kommunismus, wissenschaftlicher Sozialismus, Berlin 1919; Die soziale Frage und der Sozialismus, Jena, zuerst 1912, jetzt 12.—13. Tausend 1924, S. S. III, S. 71 iff., S. 1084ff.
[5] David Ricardos Grundrentenlehre, Berlin, 1909, S. S. III, S. 731 ff.
[6] Frankfurter Zeitung, 1902. Ausführlicher in „Verhandlungen des zweiten Soziologentages“, 1913.
[184]
So wird es auch hier wieder gehen. Der Staatsbegriff ist von einer so herrlichen Vielfältigkeit! Wenn man den über-, und den nichthistorischen Staatsbegriff wieder mit dem historisch-soziologischen, und die Staatstheorie mit der Politik zusammenwirrt, kann man auch in Zukunft dem schon von vornherein überzeugten Leser oder Hörer gerade so gut alles beweisen, wie man es in der Vergangenheit gekonnt hat [1].
Nun, dem Denker ziemt das „Selbstvertrauen der Vernunft“. Und so wollen wir denn das klassische Gleichnis vom Faß der Danaiden abweisen und es mit Herakles halten, der die nachwachsenden Häupter der Hydra nicht nur abschlug, sondern auch ausbrannte. Lassen wir es darauf ankommen, ob unsere Waffe scharf, und unsere Glut heiß genug ist.
2. Kritik,↩
a) Der Naturzustand.
Wir können nicht bis zum Naturzustande unseres Geschlechts „hinauflangen“, wie Kant sagt: wir können nur die ersten Anfänge durch Schlüsse erreichen, die jeden zwingen müssen, der auf dem Boden der Evolutionstheorie steht.
Der Mensch kann nur von gesellig lebenden Proanthropoi abstammen ; nur in der Herde, nur unter dem Schutz der Genossenschaft, kann sich ausgebildet haben, was ihn zum Menschen macht und über das Tier erhöht: die Sprache vor allem, das gewaltige Werkzeug einerseits der sich immer höher erhebenden Kooperation, andererseits der
[1] „Die Geschichte der Staatslehre ist aber nicht zum geringen Teile Geschichte der Versuche, den typischen Staat zu erkennen, bedeutet daher im Grunde die Verwandlung aller Staatslehre in Politik“ (Jellinek, a. a. O. S. 35). „Man sagt, was sein soll, ohne zuvor untersucht zu haben, was wirklich ist. Man verwandelt der Staat in einen bloßen Zweckbegriff, gerade als ob er kein reales Wesen, oder sein Wesen mit seinem Zweck identisch wäre, wahrend doch beides handgreiflich verschieden ist“ (Frantz, Naturlehre, S. 71). Vgl. derselbe, S. 207, 209. „Darum ist Hegels Staatsbegriff unbedingt der richtigste und unangreifbarste, wenn man vom methodologischen Monismus der Sozial- und Moralwissenschaften nicht abgehen und den Staat unbedingt in einem Begriffe definieren will. Alle späteren Definitionen des „Wesens“ des Staates ..., beeinträchtigen die rechtliche und ideelle Seite des Staates als des Inbegriffs aller rechtlichen Normen“ (Kistiakowski, a.a. O., S. 162/3). „Je nach der überwiegenden Bildung des Autors tritt die spekulativphilosophische, die historisch-politische, die juristische Betrachtungsweise des Stoffes als die leitende hervor“ (Jellinek, a. a. O. S. 64). „Noch schlimmer aber steht es, wenn der Staat einmal das bedeutet, was allen stabilen, politischen Organisationen gemeinsam ist, und ein andermal als ideale Funktion einer möglichen politischen Organisation aufgefaßt wird... . Daß sie von einer fundamentalen Vermengung der Idee und der Wirklichkeit ausgeht und sie nie berichtigt“ (Hobhouse, a. a. O. S. 14). — Wir könnten die Liste dieser Selbsterkenntnisse der Staatswissenschaft ad libitum verlängern.
[185]
Begriffsbildung, der Rationalisierung des Lebens, der Verwandlung von Folgen in Zwecke [1]; ferner die Differenzierung der Gliedmaßen in Fuß und Hand, das Organ aller „Handlung“[2], und schließlich die Verlängerung der Kindheitsperiode[3], die dem Gehirn eine ganz andere, viel höhere Ausbildung gewährt, und mit der die den meisten Tieren weit überlegene Lebensdauer verknüpft ist, ohne die die Ansammlung von Erfahrungen undenkbar wäre.
Die tierische Herde kann sich ihrerseits nur aus der tierischen „Ehefamilie“ im Sinne Westermarcks entwickelt haben[4]. Aber das sind Dinge, die uns hier nicht interessieren; uns genügt die notwendige Annahme, daß der Mensch sich in der Herde, d. h. der gesellschaftlich lebenden Tiergenossenschaft, entwickelt hat. Mit der allmählichen Verdrängung des Instinktes durch den Verstand, vor allem mit der damit eng zusammenhängenden Ausbildung des Werkzeugs wurde aus dem Tiere der Mensch, aus der Herde die Horde.
Es hat nicht viel Zweck, sich über die innere Organisation dieser ersten, gerade aus der Tierheit zum primitivsten Menschentum aufgestiegenen Horden den Kopf zu zerbrechen. Die meisten Anthropologen, die sich das Problem gestellt haben, glauben, daß sie etwa die Verfassung eines Hirschrudels gehabt haben wird: ein „Platzhirsch“ als Patriarch, der die jüngeren und schwächeren Männchen als Haremsmonopolist von den Weibchen abwehrt, solange seine Ueberlegenheit andauert, und der dafür die Herde bewacht, und, bewegt von dem „Vorkämpfertriebe“[5], beschützt. Derart leben z. B. die Paviane in sehr großen Verbänden, wahren „Völkerschaften“ im Ausdruck Schaffles[6]: wir haben aus dem Leben dieser Affen eine Reihe von wahrhaft menschlichen Zügen der monopolistischen Brutalität einerseits, des heldenhaften Opfermuts andererseits zusammengetragen[7].
Wir werden von den möglichen Hypothesen über den Urzustand diese als unseren Ausgangspunkt wählen, weil sie für uns die ungünstigste ist, indem sie annimmt, daß schon in den Herden der tierischen Vorfahren des Menschen Ungleichheit und Gewalt eine nicht unbedeutende Rolle spielten[8]. Selbstverständlich ist hier zu der Entstehung sozialer
[1] S. S. I, S. 239/40, S. 85.
[2] S. S. 1, S. 275.
[3] S. S. 1, s. 58/9.
[4] S. S. I, S. 1064. Der vollentwickelte Begriff findet sich schon bei Locke, § 79.
[5] S. S. I, S. 264 vgl. Freud, Totem und Tabu.
[6] Bau und Leben des sozialen Körpers. Tüb. 1896.
[7] S. S. I, S. 264/5.
[8] Früher hat die Meinung gegolten, daß die großen Anthropoiden nur in der Ehefamilie leben. Nach Alverdes ist das ein Irrtum. Auch Gorillas und Schimpansen leben in Sozietäten, in denen mehrere starke Männchen mit ihren Harems vereinigt sind.
Das politische Mittel, angewendet gegen die eigenen Gruppengenossen, ist den Tieren nicht völlig fremd. Pinguine zanken sich um ihre Brutplätze und stehlen sich gegenseitig die Steine, aus denen das Nest gebaut ist (Alverdes S. 35). Tauchenten stehlen sich gar, unter dem allmächtigen „Elterninstinkt“ Eier und Junge, um sie zu pflegen (S. 37). Einige solitäre Wespen gehen gemeinsam auf Jagdzüge aus, was allerdings nicht hindert, daß sie sich bei der Rückkehr gegenseitig berauben (S. 57). Auch Tragbienen überfallen fremde Stöcke (S. 59), Ameisenstaaten führen förmliche Kriege gegeneinander, die monatelang dauern können und zuweilen in gegenseitiger Duldung oder gar Freundschaft endigen (S. 62). Die Ameisen haben außerdem jenes Mittelding zwischen politischem und ökonomischem Mittel, die Züchtung nicht nur von Pflanzen (S. 65), sondern auch von Tieren, Läusen verschiedener Art, Zikaden und Schmetterlingsraupen. Die Honigameisen speichern ihre Vorräte im Kröpfe junger normaler Arbeiter auf, „die solange gefüttert werden, bis durch Füllung ihres Kropfes der ganze Hinterleib unförmlich geschwollen erscheint; in diesem Zustand hängen die betreffenden Tiere den größten Teil ihres Lebens unbeweglich an der Decke ihrer Vorratskammer“ (S. 64/65).
[186]
Dauerklassen kein Ansatzpunkt vorhandenn[1] : denn die Periode der männlichen Reife geht in die Schwäche des Greisenalters über, während auf der anderen Seite die Jugend immer stärker wird; es kann ferner die „Dichtigkeit“ der Bevölkerung unter rein natürlichen Bedingungen niemals jenen gefährlichen Grad erreichen, der zur Differenzierung der Klassen führen soll, und schließlich ist ja von einem Eigentum hier nicht die Rede.
Wenn wir von diesem hypothetischen Anfang aus mit einem ungeheuren Sprung über wahrscheinlich viele Jahrhunderttausende die heute so genannten „Primitiven“, die Urjäger und -fischer, betrachten, so finden wir auch hier noch keine Andeutung von einer Schichtung in Klassen. Sie haben, so haben wir geschrieben[2], bereits einen unermeßlichen Kulturweg zurückgelegt; denn keinem dieser Völkchen fehlt das Feuer, fehlt eine leidlich entwickelte Sprache, fehlen Waffen, fehlen Keimformen religiöser Vorstellungen. Und dennoch bieten sie fast noch ungetrübt das Bild des Anfangs einer Entwicklungsreihe, das Nebeneinander gleichartiger, unverbundener Teile[3]. Alle sind gleich, kleine Horden blutsverwandter Elemente, alle haben die gleichen Existenzbedingungen menschlicher Raubtiere, die lediglich von den freiwilligen Gaben der Natur leben. Und alle leben unverbunden nebeneinander, abgesehen von den schwachen Fäden der Integration, die sich hier, auf der ja verhältnismäßig schon hohen Entwicklungsstufe, bereits angelegt haben: Ansätze zum Völkerrecht[4], Unverletzlichkeit der Gesandten und friedenbietender Händler, hier und da bereits einige gemeinsame Feste und Märkte. Jedenfalls herrscht hier nicht Ratzenhofers „ab-
[1] Das stellt auch Pontus Fahlbeck fest (Die Klassen und die Gesellschaft S. 20/1): „Geschlecht, Alter und persönliche Begabung“ schaffen keine Klassen: Das Klassenwesen ist kein Naturerzeugnis.
[2] S. S. III, S. 256.
[3] S. S. III, S. 255 (Spencers Evolutionsformel).
[4] S. S. I, S. 281.
[187]
solute Feindseligkeit“, und die Ansätze zu einer Arbeitsteilung zwischen den Horden, die je nach ihrem Wohnsitz an der Küste, im Waldlande oder in der Steppe verschiedene Produkte zum Tausche anzubieten haben, sind vorhanden [1].
Die Friedlichkeit der zwischenstammlichen Beziehungen wird übereinstimmend von den verschiedensten Forschern über sämtliche primitiven Jäger, die heute so genannten „Pygmoiden“ berichtet. Schmidt-Koppers[2] trägt die Zeugnisse zusammen. Wir entnehmen ihm einige Sätze Wheelers: „Im Gegensatz zu den ausschweifenden Ideen, die über den Gegenstand ... verbreitet sind, kann man den Krieg bei diesen Stämmen nicht als den Normalzustand betrachten. Die gewöhnliche Methode, Streitigkeiten, selbst in Fragen von Mord, zwischen den Lokalgruppen zu schlichten, ist vielmehr die eine oder andere Form einer geregelten Justiz. Es besteht ein Streben darnach, es zu vermeiden, jemandem das Leben zu nehmen, ausgenommen in gewissen Fällen, in welchen ohnedies die Todesstrafe von den beiden Gruppen als Strafe des betreffenden Vergehens anerkannt wird; die Todesstrafe erfolgt nicht, weil der Schuldige zu einer fremden Gruppe gehört, sondern würde auch verhängt worden sein, wenn er das Vergehen innerhalb seiner eigenen Gruppe begangen hätte. Der Krieg dagegen stellt sich als die weniger gebräuchliche Form der Rache oder Sühne für eine Bluttat dar. Territoriale Eroberungen werden niemals gesucht; denn das absolute Recht der Lokalgruppen auf ihr Gebiet wird voll anerkannt, und es gibt keine ständigen Anhäufungen von persönlichem Eigentum (wenigstens nicht von einiger Bedeutung). Der Krieg hat deshalb in diesen Stämmen keinen anderen Zweck, als den, Gerechtigkeit oder Rache für Unrecht zu suchen ; während in allen Fällen, die nicht Mord betreffen, und in den meisten Fällen von Mord, das ungeregelte Kriegführen durch geregelte Formen ersetzt ist, die darauf abzielen, das Wegnehmen von Menschenleben zur Wiedervergeltung zu vermeiden. Man geht also nicht über die Evidenz hinaus, wenn man behauptet, daß Frieden, nicht Krieg, der normale Zustand unter den australischen Stämmen war“.
Wie steht es nun um die innerstammlichen Beziehungen?
Derselbe Mangel an Differenzierung und Integrierung wie zwischen den Horden, intertribal, besteht auch innerhalb der Horden, intratribal. Kaum höher ist sie gefördert als bei den in Herden lebenden höheren Tieren, etwa Rindern, Wildpferden oder gar Pavianen. Auch hier wie in der Herde ist im Grunde noch jede engere Familie, jeder Mann mit Weib und unmündigen Kindern, autarkisch, sich selbst genügend und versorgend, jeder hat dieselbe Arbeit, vollzieht dieselbe Leistung, das
[1] S. S. I, S. 870ff.
[2] Schmidt-Koppers: Der Mensch aller Zeiten, S. 188.
[188]
Weib als Gebärerin und Lasttier, der Mann als Jäger und schützender Krieger.
Und wie es keine wirtschaftliche Differenzierung gibt, so gibt es auch keine soziale. Alle erwachsenen Männer sind gleichen Rechts, niemand hat zu befehlen, der nicht zwingen kann, niemand zu gehorchen, der Widerstand leisten kann [1]. Die Jäger sind nach Ernst Großes treffendem Worte „praktische Anarchisten“. Er schreibt: „Da es keine wesentlichen Vermögensunterschiede gibt, so fehlt eine Hauptquelle für die Entstehung von Standesunterschieden. Im allgemeinen sind alle erwachsenen Männer innerhalb des Stammes gleichberechtigt. Die älteren danken ihrer reicheren Erfahrung eine gewisse Autorität; aber niemand fühlt sich ihnen zum Gehorsam verpflichtet. Wo einzelne Häuptlinge anerkannt werden — wie bei den Botokuden, den Zentral- kaliforniern, den Wedda und den Mincopie — ist ihre Macht außerordentlich gering. Der Häuptling hat kein Mittel, um seine Wünsche gegen den Willen der übrigen durchzusetzen. Die meisten Jägerstämme haben jedoch überhaupt keine Häuptlinge. Die ganze männliche Gesellschaft bildet noch eine homogene, undifferenzierte Masse, aus welcher nur diejenigen Individuen hervorragen, die man im Besitz magischer Kräfte glaubt“[2].
Leopold, der dem Gegenstande besondere Aufmerksamkeit geschenkt hat, berichtet folgendes, nachdem er den Gegensatz zwischen der Wildheit mancher „Wilder“ nach außen und ihrer Güte nach innen hervorgehoben hat[3]:
In jedem Stadium wilder Völkerschaften stoßen wir auf klassische Beispiele von Scheinkönigen, die nur die „primi inter pares“, die „duces ex virtute“, aber nicht „ex nobilitate reges“ sind. Die Wilden von Chile wählen den Mann zu ihrem Häuptling, der einen Baumstamm am weitesten schleppen kann. Anderenorts sind Tapferkeit, Beredsamkeit, Kunstfertigkeiten, Zauberkunst die Quelle der in der Regel überaus geringen Ehre, die dem Häuptling zukommt. „Wildstämme auf der tiefsten Stufe der Zivilisation sind gleich Affenhorden auf der Grundlage der Autorität organisiert. Das stärkste alte Männchen erringt durch seine Körperkraft eine gewisse Überlegenheit, die nicht länger dauert als die
[1] Schmidt-Koppers (Der Mensch aller Zeiten, S. 178) sagt von den Primitiven im „Pygmäenstaat“: „Nirgendwo ist die Gewalt des Häuptlings eine weitgehende ...; kriegerische Tapferkeit ist nicht immer erfordert; ... er erscheint kaum mehr denn als der Primus inter pares, besonders außerhalb seiner Amtstätigkeit“.
[2] Die Formen der Wirtschaft und die Formen der Familie, S. 39.
[3] Prestige, englische Ausgabe, S. 59ff. L. unterscheidet nicht streng zwischen den „Primitiven“, die im allgemeinen sehr friedlich sind, und den schon höher entwickelten „Wilden“, namentlich Ackerbauern mittlerer Stufe, die bereits Sklaven- und Kopfjagden veranstalten. Dennoch, ja, gerade deshalb, ist seine Übersicht sehr lehrreich.
[189]
Überlegenheit seiner physischen Kraft über jedes andere Männchen“. Neuere gewissenhafte Forscher über Tasmanien und Australien warnen uns, älteren Berichten Glauben zu schenken, die von der Existenz von Prestige reden. In Australien ist es sogar auf dem Schlachtfelde jedem überlassen, wie weit er gehorchen mag, und selbst dann, wenn einmal ein wirklich hervorragendes Mitglied des Stammes eine praktisch diktatoriale Macht besitzt, so ist sie doch rein faktisch und verschwindet mit ihrer Ursache. Frühere Reisende, sagt Sutherland, sprachen von den „Häuptlingen“ der Hottentotten; jetzt wissen wir, daß die Autorität dieser Stammesleute aufs äußerste beschränkt war. Wallace erzählt uns von den Waldindianern Brasiliens, ihre Häuptlingswürde sei im Mannesstamme erblich: heute wissen wir, daß es sich lediglich um einen „Sprecher“ oder „Geschäftsführer“ („manager“) handelt, der allen Gliedern zu dienen hat. Bei etwas höheren Wilden finden wir auch die Häuptlingswürde etwas mehr entwickelt, „aber der Führer hat keinen persönlichen Anspruch auf den Gehorsam der Genossen, geschweige denn auf knechtsmäßige Ehrerbietung“. Bei den Nordindianern hat der „Älteste“ nach Schoolcraft die Führung militärischer Verbände, wenn sein Mut und Tapferkeit ihn zu einer gewissen Auszeichnung berechtigen: aber er ist nur der „Vertreter der öffentlichen Meinung und ist erledigt, sobald sie sich von ihm abwendet“. A. W. Howitt berichtet, daß bei den Südwestaustraliern sehr zahlreiche Gesetze für die Regelung der geschlechtlichen Verhältnisse, die Mysterien und die Festmähler bestehen, aber daß sie all diesen Gesetzen und Gebräuchen gehorchen, ohne daß eine, individuelle oder kollektive Stammesgewalt die Verletzung mit Strafe bedrohte; die von frühester Kindheit eingeprägte Furcht vor einer übernatürlichen Strafe genügt vollkommen... . Auch bei den Australiern kann nur der Tapfere, Beredte, der Held zur Häuptlingswürde gelangen... T. W. Powell teilt mit, daß der Sachem der Wyandot nichts anderes zu tun hat, als die Entscheidung zu verkünden, wenn eine Mehrheit des Rates eine Handlung beschlossen hat“.
Ähnliches berichtet Lewis Morgan, der der Adoptivsohn eines Irokesenstammes war, von der außerordentlich weit ausgebildeten Demokratie dieser höchst entwickelten Indianer, die in ihrem Bund der „fünf Nationen“ die oberste Stufe der vorstaatlichen Stammesorganisation erstiegen hatten, den „Stammesverband“: [1] hier bestand keine Andeutung einer Klassenschichtung; auch die Frauen hatten volle, in einigen Stämmen sogar überwiegende Bürgerrechte; niemals kam der Verdacht
[1] Über diesen und andere nordamerikanische Bünde vgl. Schmidt, ethnol. Volksw. S. 172. Über den „alten Manaosbund, der mit straffer Organisation versehene große Stammeseinheiten zur ansehnlichen Macht zusammenschloß“, Schmidt, Die Aruaken S. 19. Über die Bünde der Hellenen vgl. Busolt, a. a. O. S. 3i4ff.
[190]
auf, daß einer der Beamten des Stammes, der Chief (Kriegshäuptling) oder der Sachem (Friedenshäuptling) sein Amt zur Begründung einer Dauerherrschaft mißbrauchen könnte [1]. Herbert Spencer macht mit Recht darauf aufmerksam, daß erst die Notwendigkeit des Krieges die dauernde Häuptlingschaft und die Tyrannis bringe[2].
Die Gesellschaften der primitiven Hackbauern[3] haben kaum mehr Ähnlichkeit mit einem „Staate“ als die Jägerhorden. Wo der mit der Hacke den Boden bearbeitende Bauer in Freiheit lebt — der Pflug ist schon immer Kennzeichen einer höheren Wirtschaftsform, die nur im Staate vorkommt, nämlich der von unterworfenen Knechten betriebenen Großwirtschaft[4] — da gibt es noch keinen Staat, denn es gibt keine Klassenscheidung. „Noch auf der Totemstufe gibt es nicht arm noch reich, nicht vornehm noch gering, sondern nur Unterschiede der persönlichen Leistung und Geltung“[5]. Isoliert voneinander, weithin zerstreut in einzelnen Gehöften, vielleicht Dörfern, durch Streitigkeiten wegen Gau- und Ackergrenzen zersplittert, leben sie bestenfalls in losen Eidgenossenschaften, nur locker von dem Bande zusammengehalten, das das Bewußtsein gleicher Abstammung und Sprache und gleichen Glaubens um sie schlingt. Selten nur, vielleicht einmal im Jahre, eint sie die gemeinsame Feier berühmter Ahnen oder der Stammesgottheit. Eine über die Gesamtheit herrschende Autorität besteht nicht; die einzelnen Dorf-, allenfalls Gauhäuptlinge haben je nach ihren persönlichen Eigenschaften, namentlich nach der ihnen zugetrauten Zauberkraft, mehr oder weniger Einfluß in ihrem beschränkten Kreise. Wie Cunow[6] die peruanischen Hackbauern vor dem Einbruch der Inka schildert, so waren die primitiven Bauern überall in der Alten und Neuen Welt: „Ein ungeregeltes Nebeneinander vieler unabhängiger, sich gegenseitig befehdender Stämme, die sich ihrerseits wieder in mehr oder weniger selbständige, durch Verwandtschaftsbande zusammengehaltene Territorialverbände spalteten“.
Wir haben nun die Frage zu stellen, wodurch diese so überaus locker organisierten Gesellschaften denn doch zusammengehalten werden ?
Die Antwort scheint nahe zu liegen: es ist die Geister fur cht, die Superstition; sind wir doch in der kurzen ethnologischen Übersicht, die wir soeben gegeben haben, immer wieder auf diese starke Kraft
[1] Ancient society.
[2] Princ. of Sociology I. Part II. Chapt. IX.
[3] S. S. III, S. 150, S. 368.
[4] Ratzel, Völkerkunde, 2. Aufl., II S. 372. S. S. I, S. 1042.
[5] Wundt, Elemente der Völkerpsychologie, S. 286.
[6] Die soziale Verfassung des Inkareichs, S. 51.
[191]
des Zusammenhalts gestoßen! Und in der Tat ist sie auf primitiver Stufe, in den „segmentären“ Gesellschaften (Durkheim) [1] mit sehr stationärer Verfassung, die stärkste aller bindenden Gewalten[2].
Aber bei näherer Überlegung bemerken wir, daß diese Erklärung gerade an dem Punkte versagt, wo die eigentliche Antwort erfolgen sollte. Sie sagt uns, daß gewisse Regeln und Gebräuche durch die Geisterfurcht sanktioniert und gewährleistet werden: aber sie sagt uns nicht, welche Regeln und Bräuche derart gesichert werden. Das aber ist die eigentliche Frage.
Wir kommen auch nicht wesentlich weiter, wenn wir hören, daß in aller Regel die alten Gebräuche heilig gehalten werden. Wir verstehen sehr wohl, daß es Energie kostet, die Bahnen alter Gewohnheit zu durchbrechen, und daß die Gruppe, um überflüssige Ausgabe von Energie zu vermeiden, das Alte sanktioniert, so daß, wie wir schrieben, „dieser energetische Imperativ der Gruppenbetätigung sich wie alles für den Bestand der Gruppe Wichtige als sozialer Imperativ der Sittlichkeit darstellt und als solcher einen Teil des Motivationsapparates jedes Gruppengliedes in der Statik bildet“[3]. Wir sagen: auch das bringt uns nicht weiter; denn wir haben noch immer zu fragen, welche Regeln und Gebräuche denn so beschaffen waren, daß sie überdauerten und daher, von dem Standpunkt der lebenden Generation aus, alt und heilig sind?
Nun, es finden sich in den oft ganz wunderbar komplizierten Sitten- kodizes der Primitiven gewiß sehr viele Regeln und Gebräuche, die irgendeinem Zufall ihre Entstehung und Erhaltung verdanken: bestimmte Regeln des Heiratswesens, der Männerweihe, der Fetischwahl, der Opferriten und derartiges mehr. Diese Bestandteile der Kodizes sind von Volk zu Volk, von Horde zu Horde, und sind auch von den Sitten des heutigen Europäers durchaus verschieden. Aber es finden sich außer diesen Dingen, die wir, vergleichend, eben, weil sie nicht überall vorhanden sind, trotz ihrer Heilighaltung bei einzelnen Gruppen, für unwesentlich zu halten das Recht haben, andere Elemente, die überall vorhanden sind. Und diese müssen darum der wichtigste Gegenstand unserer Betrachtung sein. Es sind die Gesetze der Reziprozität, deren positiven Inhalt ungefähr, freilich schon auf ein etwas höher entwickeltes Volk zugeschnitten, die Zehn Gebote, deren negativen Inhalt das Jus talionis: „Auge um Auge, Zahn um Zahn, Leben um Leben“, enthalten. Diese Reziprozität, der Ausdruck der subjektiven (nicht der objektiven)[4] Gerechtigkeit, ist der Kitt jeder Gruppe, das
[1] S. S. I, S. 500.
[2] S. S. I, S. 718ff.
[3] S. S. I, S. 718ff.
[4] S. S. I, S. 396f., S. 907ff.
[192]
Element der Kohäsion, die Grundlage des „Konsensus“, die nicht erschüttert werden darf, bei Gefahr, daß die Gruppe auseinanderbirst wie eine platzende Granate [1]. Es ist, zuweilen merkwürdig verkleidet und entstellt, nicht bloß die Sitte, sondern die zur Sitte und zum Recht gewordene Sittlichkeit, um die es sich hier handelt.
Jellinek schreibt: „Alles Recht in einem Volke ist ursprünglich nichts als faktische Übung. Die fortdauernde Übung erzeugt die Vorstellung des Normmäßigen dieser Übung, und es erscheint damit die Norm selbst als autoritäres Gebot des Gemeinwesens, also als Rechtsnorm“[2].
Jellinek kann sich sicherlich darauf berufen, daß starke Normen der Sitte und des Rechts auf diese Weise faktisch durch Übung und „Domestikation“ der Einzelnen zum Rechte eines Volkes werden können. Vielleicht wird ein Südsee-Insulaner geringere Reue über einen Mord als über die Verletzung eines Tabu-Gebotes empfinden; und das Verbot an die Schwiegermutter, dem Schwiegersohn zu begegnen, wird wahrscheinlich von den Völkern, bei denen es besteht, nicht minder skrupulös gehalten als die Gebote gegen Diebstahl und Ehebruch.
Aber Jellinek unterscheidet selbst an einer Stelle, die wir schon mehrfach angezogen haben, zwischen den „konstanten oder doch nur sehr langsam umzubildenden und den variablen Bestandteilen des Rechts“[3]. Und er sagt von jenen: „Diese Konstanten sind aber in dieser Eigenschaft gemäß der ganzen Kulturlage eines Volkes ausdrücklich oder stillschweigend anerkannt und bilden damit einen rechtlichen Maßstab für die Beurteilung auch der formal unanfechtbaren Staatswillensakte. Daher kann ein Gesetz oder ein rechtskräftiger irreversibler Richterspruch als unrecht, nicht nur als ungerecht gewertet werden. Ferner ist damit eine Richtschnur de lege ferenda gegeben.“
Hier wird also gesagt, daß in einem gegebenen Volke gewisse konstante Rechtsbestandteile ebenso konstanten gewissen Elementen der Kulturlage entsprechen: wenn und soweit sich der „Unterbau“ nicht ändert, bleibt auch der „Oberbau“ unberührt. Und man könnte auf diese Weise in der Tat verstehen, daß es ein Recht über dem positiven Rechte gibt, kraft dessen „sogar auch die rechtschaffende Tätigkeit des Staates rechtlich gewertet werden kann“, ja, sogar muß: denn „der Akt der Rechtsschöpfung, selbst wenn das also Geschaffene rechtsbeständig ist und bleibt,kann einen Rechtsbruch in sich schließen“ (a. a. O. S. 373).
Aber wie will Jellinek erklären, daß bei schlechthin allen Völkern, nieder und hoch zivilisierten, von allen Rassen, Zeiten und Erdteilen
[1] Allg. Staatslehre, S. 339.
[2] S. S. I, S. 908.
[3] A. a. O. S. 375.
[193]
trotz der denkbar größten Verschiedenheit ihrer „Kulturlage“ die Verletzung der subjektiven Reziprozität durch den Genossen der eigenen Gruppe als Unrecht empfunden wird? Das deutet doch wohl auf Elemente im Unterbau, in der Kulturlage, die mit dem Wesen der Gesellschaft als solcher untrennbar, essentiell, verknüpft sind ! Hier muß jede andere Erklärung versagen, als diese, daß das Recht und die Pflicht der Reziprozität „Was du nicht willst, das man dir tu', das füg' auch keinem andern zu“, nicht die Folge, sondern die Ursache der Gesellschaft ist, oder wenigstens ihre unerläßliche Bedingung [1]; „allgemeine Wirkung setzt eine allgemeine Ursache voraus“, sagte uns Grotius: das jus gentium ist dem Staate a priori.
Wir haben uns in der Grundlegung unserer allgemeinen Soziologie ausführlich über den Gegenstand ausgelassen und müssen hier darauf verweisen[2].
Nur das allerwichtigste sei hier wiederholt: die vorstaatlichen Gruppen, von denen wir hier handeln, sind „Gemeinschaften“ in dem Sinne von Ferdinand Toennies. Er sagt von ihnen: „Gemeinschaftliches Leben ist gegenseitiger Besitz und Genuß, und ist Besitz und Genuß gemeinsamer Güter. Der Wille des Besitzes und Genusses ist Wille des Schutzes und der Vereinigung“[3]. Die Gemeinschaft entstammt aus dem „Wesenwillen“, der das Denken in sich einschließt, nicht aus dem „Kürwillen“, der in das Denken eingeschlossen ist, und aus dem das entstammt, was er die „Gesellschaft“ nennt. Jene ist, nach unserer Terminologie, Ausdruck des „Wir-Interesses“, das aus dem positiven Triebe des Kräfteüberschwangs entspringt, diese des „Ich-Interesses,“ das aus dem negativen Triebe der Bedürftigkeit entspringt. Jener Trieb dient der Erhaltung der Art, dieser des Indi-
[1] Der bedeutendste Historiker des Rechts, Vinogradoff (a. a. O. I, S. 118) schreibt folgendes: „Gerichtshöfe wenden das gesatzte Recht an ... aber sie teilen auch Gerechtigkeit aus, d. h. sie betrachten widerstreitende Ansprüche ihrer Substanz nach und wenden ihre Macht der Formulierung und Anwendung des Rechts dazu an, um Lücken auszufüllen, Mißbräuche (miscarriages) des Rechtes zu verhüten, schreiende Mißbräuche abzustellen und dringenden Ansprüchen Raum zu schauen. Was aber die Richter in der ihnen gelassenen Sphäre der freien Bewegung tun, ist im Grunde ganz bestimmt das gleiche, was der Gesetzgeber selbst tut, wenn er Regeln prägt, obgleich diese nach vorn weisen, während Entscheidungen sich auf vergangene Dinge beziehen. Und da dies so ist, kann die Rechtswissenschaft das sachliche Ziel des Gesetzes unmöglich vernachlässigen, ohne eines seiner grundlegender Erfordernisse (characters) zu verzerren: nämlich das Streben nach Gerechtigkeit“.
Carl Schmitt (Der Wert des Staates S. 46) schreibt: „Das heißt, daß das Recht nicht aus dem Staat, sondern der Staat aus dem Recht zu definieren, der Staat nicht Schöpfer des Rechts, sondern das Recht der Schöpfer des Staates ist ; das Recht geht dem Staat vorher.“
[2] S. S. I, S. 349ff., S. 394ff.
[3] Gemeinschaft und Gesellschaft S. 19.
[194]
viduum; aus jenem stammt alles, was groß, schön und sittlich ist, aus diesem alle Behelfe der Notdurft; aus jenem die Kultur, aus diesem die Zivilisation.
Alle vorstaatlichen Gruppen sind „Gemeinschaften“ in diesem Sinne. Sie sind in der Tat Auszweigungen der Familie im nicht-aristotelischen Sinne: der ersten, halb noch subsozialen, halb schon sozialen Bildung und Bindung, in der der Elterntrieb der gleichmäßigen Liebe zu allen ihren Jungen zum Keim der Gerechtigkeit — denn Gerechtigkeit ist Gleichheit! — wurde [1]. Von hier ging das Bewußtsein dieses Gesetzes aller Gemeinschaft auf die Herde, und dann auf die Horde über und blieb intratribal, den eigenen Genossen gegenüber, herrschend, — bis der Staat entstand. Davon sofort!
Hier interessiert uns zunächst, daß aus dieser Gerechtigkeit überall Rechtwerdenmußte. „Alles, was dem Sinne eines gemeinschaftlichen Verhältnisses gemäß, was in ihm und für es einen Sinn hat —, das ist sein Recht; das ist, es wird als der eigentliche und wesentliche Wille der mehreren Verbundenen geachtet“[2].
Der Sinn aber jeder solcher aus dem Wesenwillen, pflanzenhaft, aus geheimnisvollen Kräften gewachsenen Gemeinschaft ist „Frieden, Sittlichkeit, natürliches Recht“, ist genossenschaftlicher Geist und im Praktischen gegenseitige Hilfe. Und weil das der Sinn jeder Gemeinschaft ist, und ein anderer Sinn nicht gedacht werden kann, der jeder Gemeinschaft zugrunde liegt; — weil hier ein Gesetz waltet, das Rechtsgesetz: deshalb die seltsame Konstanz der Jellinekschen „Konstanten“ im Rechte bei allen vorstaatlichen Gruppen und die seltsame Hartnäckigkeit der Menschen, auch rechtsbeständige Staatswillensakte und irreversible Richtersprüche als unrecht zu erkennen, wenn sie diesem Grundgesetz aller Gesellschaft widersprechen. Wenn das der Relativismus von heute nicht anerkennen will oder kann, so haben es nicht nur die Romantiker, die in begreiflichem Irrtum den Staat für die gewachsene Gemeinschaft hielten, sondern auch so ungefähr alle „Aufklärer“ erkannt und anerkannt. Um zuerst einen Romantiker anzuführen, so sagt Bonald, „daß die Kenntnis der moralischen Wahrheiten nicht dem Menschen, wohl aber der Gesellschaft angeboren ist; ... daß es unmöglich ist, daß sie nicht, in mehrerem oder geringerem Maße, in allen Gesellschaften sich finde, indem es ja keine Gesellschaft geben kann, die ohne alle Kenntnis irgendeiner moralischen Wahrheit wäre“[3]. Und es klingt wie eine Erinnerung an das schöne
[1] „Where could they find a fitter umpire than he (Der Vater), by whose care they had everyone been sustained and brought up, and who had a tenderness for them all“ (Locke, a. a. O. § 75).
[2] Toennies, a. a. O. S. 23 (2. Aufl.).
[3] Die Urgesetzgebung, S. 18/9.
[195]
Wort des Heraklit, das wir oben angeführt haben: „Alle menschlichen Gesetze nähren sich aus dem einen göttlichen“, wenn Bonald schreibt: „Die schlechten Gesetze haben einen Anfang, allein die guten, ein Strahl der höchsten Güte, sind ewig wie diese“ [1].
Und nun zwei typische Aufklärer: Leibniz schreibt, „daß ein Recht, ja, daß ein jus strictum noch vor der Gründung der Staaten bestehe“[2]. Und Kant „läßt den sachlichen Gehalt des Rechtes im Naturrecht wurzeln, hält aber für dessen adäquate Durchführung und Ausübung die Errichtung eines bürgerlichen Zustandes für erforderlich... Mehr als einmal hat er betont, daß man, wollte man solche vorstaatlichen Rechte nicht anerkennen, auch die Möglichkeit einer rechtmäßigen Staatsordnung nicht einsehen könne“[3]. „Das Recht ist da, und ist von Haus aus nicht Staatsrecht, sondern Menschenrecht“[4]. Kant hat hier offenbar nicht einen vorstaatlichen Naturzustand im Auge, in dem sich lauter völlig isolierte Individuen gegenüberstehen : denn sonst hätte es keinen verständlichen Sinn, wenn er den Individuen „vor der bürgerlichen Verfassung oder von ihr abgesehen“ Pflichten und Rechte, und zwar in dem Sinne von durch Selbsthilfe zu behauptenden Zwangsrechten, zubilligt[5]. Sondern die ganze Konstruktion ist auch hier wieder durchaus nicht historisch verstanden: Kant will lediglich in der Konstruktion des idealen Rechtsstaates einen Maßstab für den wirklichen Staat gewinnen und sieht, daß in einer nicht von einer rechtschützenden Gewalt gelenkten Gemeinschaft jedermann das „natürliche Recht“ haben würde, sich selbst und das Seine zu schützen. Das geht aus den Worten: „oder von ihr abgesehen“ mit aller Klarheit hervor.
Wenn aber Fichte „schon 1796 erklärt, es gäbe gar kein Naturrecht im Sinne eines vor- und außerstaatlichen Rechtes“; wenn er „seit 1798 sein ganzes angewandtes Naturrecht, d. h. seine Eigentums- und Wirtschaftslehre auf den Staatsgedanken gründet, weil doch überhaupt nur im Staate etwas rechtlich gilt“ : dann will er gar nichts anderes damit sagen als Leibniz, Kant und Bonald; nur der Ausdruck ist gegen Kant geändert: Fichte ist in dieser seiner Spätperiode bereits Romantiker und setzt wie Bonald den Staat der Gesellschaft gleich, und zwar viel mehr den überhistorischen als den historischen Staat. Denn der ideale Staat ist Gemeinschaft, und jede Gemeinschaft, sei sie noch so primitiv, verwirklicht den idealen Rechtsstaat viel näher als irgendein Staat der Weltgeschichte.
[1] Die Urgesetzgebung, S. 61.
[2] Zit. nach Metzger, a. a. O. S. 30 Anm. Von Locke wissen wir das gleiche.
[3] Metzger, a. a. O. S. 86.
[4] Metzger, a. a. O. S. 87.
[5] „Gesellschaften kann es auch im Naturzustande geben, betont er ausdrücklich“ (Metzger, a. a. O. S. 85).
[196]
Wenn Fichte kein vorstaatliches Recht anerkennt, weil ihm jede Gemeinschaft bereits „Staat“ heißt und als solcher irgendwie den „überhistorischen“ Rechtsstaat verwirklicht, so leugnet Gumplowicz, und von diesem Standpunkt ebenfalls mit Recht, die Existenz eines solchen Rechts, weil er nur den nicht-historischen Juristenstaat im Auge hat und nur dasjenige „Recht“ nennt, was ausdrücklich vom Staate „gesatzt“ ist: „Außer dem Staate gibt es kein Recht, denn das Recht ist ein eminent staatliches Institut, es ist Fleisch von seinem Fleisch, und Blut von seinem Blut“ [1]. Es würde ihm, der ja soziologisch überall von gewachsenen vorstaatlichen Gruppen ausgeht, niemals einfallen zu bestreiten, daß diese Gruppen einen Apparat von Normen besitzen, hinter denen starke Garantien der öffentlichen Meinung und sogar der Gewalt stehen: aber er weigert sich, als der Jurist, der er von Haus aus ist, diese, weil gewährleistet, aus bloßen Normen zu wahrhaften Imperativen gewordenen Verhaltungsregeln als „Recht“ zu bezeichnen.
Wir erkennen, welche Schwierigkeiten es mit sich führt, daß der Begriff „Staat“ wenigstens drei wohl zu unterscheidende Begriffe deckt, und wie notwendig es ist, sie auf das genaueste zu unterscheiden. Wenn man es nicht tut, so sieht man sich vor einander schnurstracks widersprechende Behauptungen gestellt, die sämtlich wahr sind: „Es gibt kein vorstaatliches Recht“ ist wahr für die philosophische und die juristische Staatsauffassung; — und der entgegengesetzte Satz: „Es gibt ein vorstaatliches Recht“ ist wahr für die soziologische Staatsauffassung. Der überhistorische Staat beginnt selbstverständlich mit dem Rechte, denn er ist ja nur seine Verwirklichung „in der Natur“; und das gesatzte Recht beginnt natürlich mit dem Staate, denn nichts heißt dem Juristen Recht, als was der Staat gesatzt hat. Dort besteht aller Staat im Recht, hier alles Recht im Staat. Aber für die soziologische Auffassung ist es anders: sie betrachtet den „Staat“ nicht, wie der Philosoph, als die Urform der menschlichen Vereinigung, sondern weiß, daß ihm ganz anders geartete Organisationen vorangehen, die ihren Apparat von Normen und Imperativen besitzen, und sie kann nicht einsehen, wie ihr der Jurist sollte verbieten können, diesen Apparat als „Recht“ zu bezeichnen, da ja „Gewalten“ dahinter stehen.
Und wir erkennen weiterhin, wie leicht es ist, im Trüben solcher Begriffsverwirrung zu fischen und immer gerade das zu „beweisen“, was das Interesse der eigenen Gruppe verlangt.
Sehen wir nun zu, ob und inwieweit dieser aus ihrem Begriffe deduzierte „Sinn“ auch wirklich das Wesen der realen vorstaatlichen Gemeinschaft ist.
Toennies formuliert ihren Sinn als „gegenseitigen Genuß und Besitz
[1] Grundriß der Soziologie, S. 191.
[197]
und Genuß gegenseitiger Güter“. Wir haben, sachlich übereinstimmend, formuliert: „Frieden, Sittlichkeit, natürliches Recht“, d. h. Gerechtigkeit.
Wenn wir Toennies recht verstehen, so meint er mit der Wendung: gegenseitiger Besitz und Genuß, die herzerfreuende Geselligkeit in einem wesentlich weiteren als dem modernen Sinne, wo der Begriff, wenigstens bei den oberen Klassen, in eine „Spielform der Gesellschaft“ (Simmel) eingeschrumpft ist [1]. Er versteht darunter die „Nachbarschaft“ im besten Sinne, wo sie ein geistiges Gemeinschaftsgefühl bedeutet. Und das finden wir in den vorstaatlichen Gruppen überall. Sie tragen Freude und Leid treu zusammen, wie mit einer Seele: bei Hochzeit und Männerweihe, Krankheit und Totenklage ist die Horde oder das Dorf nur ein Körper; alle Feste, Opfer, Spiele und Tänze sind allen gemeinsam.
„Besitz und Genuß gegenseitiger Güter“! Wir finden überall zwar nicht den „legendären“ Urkommunismus[2], denn Leibwaffe, Leibwerkzeug, Leibschmuck[3], Geräte, Kleidung, Hütte und Weib hat jeder für sich[4], wohl aber einen naturwüchsigen Kommunismus des Verzehrs, der sehr oft geradezu religiös normiert und sanktioniert ist. Ein erlegtes Wild gehört der Gesamtheit, nur daß der glückliche Schütze das Recht auf gewisse bevorzugte Stücke hat[5]. So ist dafür gesorgt, daß niemand darbend dem Schmausen des Genossen bei vollen Schüsseln zuschauen muß. Dieses Recht der Nachbaren auf Anteilnahme wird heute noch in entlegenen Dörfern unseres Kulturkreises als dem Einzelrecht überlegen anerkannt. Rosegger schildert in seinem Gebirgsroman „Das ewige Licht“ prächtig die ethische Energie, mit der ein kraftvoller Gemeindevorsteher in schwerer Notzeit mit rücksichtsloser „Expropriation“ der Bessergestellten alle Vorräte des Dorfes in seine Amtsgewalt bringt und die gesamte Einwohnerschaft durch Streckung und Rationierung über die schlimme Periode fortführt. Und in großer Volksnot, in einem Kriege, bei der Blockade einer Stadt oder eines ganzen Landes, lebt dieses Urrecht der Gemeinschaft gegenüber dem Einzelnen sogar in unserer verkommenen Zeit des bösen Atomismus wieder auf, wie uns der Weltkrieg gezeigt hat : wenn der Schatten einer gewaltigen Gefahr das Gestirn des Tages, das in unserer Zeit gewöhnlich alles überstrahlende Ich-Interesse, verdeckt, dann wird die, in der echten Gemeinschaft[6] herrschende, „komplexe Vorstellung“ des Sternen-
[1] S. S. 1, s. 267.
[2] „Ein Märchen“. Schmidt, ethnol. Volksw., S. 149.
[3] Schmidt, ethnol. Volksw., S. 144, S. 153.
[4] S. S. I, S. 371.
[5] Schmidt, S. 148 vgl. S. S. I, S. 867.
[6] Wir haben an der Stelle, wo wir das oben abgedruckte Gleichnis brauchten (S. S. I, S. 102), eine Anzahl von ethnologischen Belegen für die Tatsache angeführt, daß das „Bewußtsein von diesem Wir-Interesse ontogenetisch und phylogenetisch älter ist als das Ich-Bewußtsein“. Wir können jetzt eine neue Autorität sehr hohen Ranges dafür anführen: Jellinek. Er schreibt: „Die kollektivistische Seite der menschlichen Handlungen wird überall früher erkannt als die individualistische. Je niedriger die Kulturzustände einer Epoche sind, je mehr die Gruppe von außen her bedroht, je mehr gemeinsame Tat notwendig ist, desto mehr fühlt sich das Individuum selbst unmittelbar als Gruppenmitglied und beansprucht daher für sich auch nur gliedschaftliche Rechte. Es ist allemal das Ergebnis der tiefstgehenden Revolution, wenn das Individuum sich der Gruppe bewußt als gleichberechtigte und von ihr anzuerkennende Macht gegenüberstellt“. Jellinek begründet zutreffend darauf, daß die Handlungen des Individuums den Außenstehenden gegenüber als solche der Gruppe gelten, und gewinnt so den Anschluß an den „Staats will en“, der durch das vertretende Organ, das „Verbandsorgan“, vollzogen wird (Allgem. Staatslehre S. 541).
An diesen Worten ist kaum etwas auszusetzen, wenn man eben nur schon hier von einem „Staatswillen“ sprechen will. Und selbst das können wir mit einem Körnchen Salz gelten lassen, da in der Tat, wie wir noch zeigen werden, der „Staatswille“ als „Verbandswille“ nur dadurch zustande kommen kann, daß er sich den „Gemeinschaftswillen“ einverleibt, mindestens als dieser maskiert.
Dennoch möchten wir den Sinn des Verhaltens etwas anders formulieren. Es ist sicherlich richtig, daß das Gemeinschaftsinteresse in primitiven Zeiten und Gruppen durch die Lagerung, durch die in der Regel Allen drohenden Gefahren, wachgehalten wird. Aber wir würden uns so ausdrücken, daß sogar der Schein vermieden wird, als glaubten wir das Wir-Interesse durch das Bewußtsein der überall lauernden Gefahren entstanden. Es ist logisch und geschichtlich älter als die Gemeinschaft. Vollkommen richtig dagegen ist, daß dieses Wir-Interesse durch die immer mehr fortschreitende Sicherung der Gemeinschaft vor den von der Natur und den anderen Menschen drohenden Gefahren allmählich eingeschläfert wird.
Wenn Jellinek auf der folgenden Seite sagt: „Das Dasein eines unmittelbar auf den Verband bezogenen, dem Verbände selbst zurechenbaren menschlichen Willens ist ein wesentliches Merkmal des Verbandes selbst“, so stimmen wir auch hier zu. Der Satz ist juristisch gemeint und als solcher unanfechtbar, ist aber, wie bei Jellinek alles, soziologisch unterbaut: „Der Vorgang der Organisierung ist anfänglich stets ein rein tatsächlicher“ (S. 542; vgl. a. S. 567). Es sei noch bemerkt, daß nach Metzger (a. a. O. S. 114) auch Fichtes Ethik zwei Spitzen hat, das Ich und die Anderen; einmal die Realisierung Meiner absoluten Selbstheit und Vollkommenheit, und zweitens Meine Selbstaufopferung für die (rechtlich-sittliche) Gesellschaft.
[198]
himmels auch unseren nicht mehr geblendeten Augen wieder sichtbar. Was aber hier als Recht gegen die anderen von der organisierten Gewalt, der Gemeinde oder des Staates, ausgeübt wird, das wird heute noch in einfacheren Verhältnissen als Pflicht der Nachbarschaft lebendig empfunden. Kropotkin in seinem prächtigen Buche „Gegenseitige Hilfe bei Menschen und Tieren“ zeigt an vielen Fällen, daß überall in den Quartieren der Armen die Nachbarn bei Krankheit und Tod wie selbstverständlich eingreifen, daß z. B. verwaiste Kinder selbst dann von unbemittelten Familien als eigene aufgenommen und erzogen werden, wenn die eigene Kinderzahl schon groß, und die Sorge nicht gering ist. Das sind nur die schwachen aber ehrwürdigen Reste einer besseren Vergangenheit, und, wie wir fest glauben, die Bürgen einer besseren Zukunft.
[199]
Schmidt-Koppers tragen unter der Überschrift „Soziale Fürsorge im Urstaat“ eine große Reihe von Tatsachen zusammen, die diesen genossenschaftlichen Geist beweisen: bei den „Initiationsfeiern“ werden den Jünglingen die Pflichten gegen die Gemeinschaft eingeprägt; dazu gehören die Pflichten, ihre Habe mit ihren Freunden zu teilen, mit ihren Freunden im Frieden zu leben, und mit Mädchen und verheirateten Frauen keine Beziehungen anzuknüpfen (S. 183). Und so finden wir denn hier überall „nicht den rücksichtslosen Egoismus, sondern ausgesprochenen Altruismus, Fürsorge füreinander, für die Familie, besonders für Kranke, Schwache, Alte, Arbeitsunfähige, ganz ausgesprochene soziale Fürsorge. ... Zu all dem kommt eine ausgesprochene Friedfertigkeit und Höflichkeit in allen Beziehungen miteinander“ (185). Es werden Berichte der verschiedensten Forscher zitiert : von den Andamanesen, den Negritos der Philippinen, den Buschmännern, bei denen es Gesetz ist, daß stets ein Teil der Jagdbeute den Witwen abgetreten werden muß, von den Wedda, den Australiern, kurz von allen Pygmoidenstämmen.
Wenn demnach das Verhältnis der Genossen der Sippe oder Horde untereinander dem Sinne der Gemeinschaft entspricht, so gilt das Gleiche für die Beziehungen innerhalb der engeren Familiengruppe. Dem scheint zu widersprechen, was wir soeben selbst über die Funktion des Weibes bei den Jägern als „Lasttier“ gesagt haben. Aber wir müssen uns hüten, „nynoskopisch“ oder „egomorphisch“ [1] mit den Kategorien unserer Zeit Urteile über ganz anders geartete gesellschaftliche Verhältnisse zu fällen. Wir sind empört, wenn wir erfahren, daß das Weib unter der Last der Kinder, der Geräte, der Vorräte dahinkeucht, während der Herr Ehegemahl leichten Fußes, nur mit Spieß und Bogen belastet, nebenher spaziert. Aber wenn wir die Frau selbst fragen würden, so würde sie mit starker Verwunderung über den törichten Europäer antworten, daß doch gar keine andere Möglichkeit bestehe, sintemalen der Mann jeden Augenblick kampffertig sein müsse. Er könne nicht erst die Kinder niedersetzen und das Gepäck ablegen, wenn plötzlich ein Raubtier oder ein menschlicher Feind sich zeige. (Nach Westermarck, Geschichte der menschlichen Ehe[2].)
Im allgemeinen hören wir von dem Familienleben der Primitiven nichts Nachteiliges. Sie leben zumeist in Einehe auf Lebenszeit; und wenn auch Müller-Lyer („Formen der Ehe, der Familie und der Verwandtschaft“) darin recht haben wird, daß er diese Einehe als „Monogamie der Notdurft“, als einfache „Syndyasmie“ bezeichnet, die mit der „echten Monogamie im ethischen Sinne, die aus Grundsatz gehalten wird“, nichts gemein habe als die äußere Form, so spricht sich doch der ge-
[1] S. S. 1, 205.
[2] S. S. 1, S. 1054.
[200]
nossenschaftliche Geist darin aus, daß eben doch jeder, auch der Stärkste, nur eine Frau hat, und deshalb niemand sich ohne Eheweib durchs Leben schlagen muß [1]. Wundt schildert das eheliche Leben der Bergwedda und anderer primitiver Jäger nahezu als Idyll[2]. Von da an hebt sich die Stellung der Frau immer mehr, bis sie in der „hochverwandtschaftlichen Phase“ ihren Höhepunkt erreicht : bei den niederen Ackerbauern und den Nordindianern ist die Frau dem Manne mindestens gleichberechtigt. Dann geht es reißend abwärts — aber dann haben wir auch bereits die Grenze überschritten, die die vorstaatliche Rahmengruppe vom Staate trennt; Polygynie, Patriarchat und Mißbrauch des Weibes sind Schöpfungen der staatlichen Klassenordnung.
Was die Behandlung der Kinder anbetrifft, so wird von allen Primitiven und „Barbaren“ übereinstimmend berichtet, daß sie mit großer Zärtlichkeit und fast ohne Zwangsmaßregeln erzogen werden[3]. Selbst in den Stämmen, wo der Kinder-, namentlich der Mädchenmord im Schwange ist, wird das einmal „aufgehobene“ und dadurch von dem Vater angenommene Kind liebevoll behandelt. Wir haben in unserer allgemeinen Soziologie[4] eine Anzahl von Belegen für diese schöne Sitte zusammengestellt, die sich auf einige der wildesten und grausamsten Völker der Welt, auf Kannibalen sogar, z. B. die Maori, beziehen. Auch hier herrschen durchaus gesunde Verhältnisse, die den Vergleich mit denen der sogenannten Zivilisation wahrlich nicht zu scheuen haben. Wie viele von unseren „monogamischen Ehen“ werden denn wirklich „aus Grundsatz“ gehalten? Und hat Müller-Lyer nicht recht, wenn er sagt, „daß eine polygame Ehe, bei der ein Mann mit drei oder vier Frauen auf Lebenszeit verbunden ist, viel weniger polygam sein kann als eine Einehe, bei der der Mann etwa alle Jahre seine Frau wechselt“ ? Die folgende Schilderung aus dem Leben der so tief verachteten Neger nimmt sich auf der Folie unserer eigenen ungeheuerlich verdorbenen Verhältnisse geradezu ideal aus: „Ebensowenig gibt es, wie von den allerverschiedensten Seiten festgestellt wurde, sexuelle Verirrungen; jedenfalls gehören Masturbation, Homosexualität, Masochismus und alle die übrigen krankhaften Erscheinungen auf diesem Gebiete bei den Negern in Afrika zu den allerseltensten Seltenheiten. Die allerwichtigste und psychologisch interessanteste Tatsache in dieser Hinsicht ist jedoch folgende: die Negerkinder sehen und hören von Jugend auf alles, was mit dem Geschlechtsleben der Tiere und Menschen zusammenhängt;
[1] S. S. I, S. 1051.
[2] Ebenso neuestens Schmidt-Koppers (a. a. O., S. 164ff. Das Kapitel trägt die Überschrift: „Gleichstellung von Mann und Frau in der Urfamilie“.
[3] Max Schmidt, Die Aruaken, S. 39, 50, 55. (Geschwisterliebe) ebenso Schmidt» Koppers a. a. O. S. 168 mit vielen rührenden Einzelzügen.
[4] S. S. I, S. 293.
[201]
und doch finden wir bei ihnen nur äußerst selten vorzeitige Libido, sexuelle Phantasieprodukte oder unnatürliche Manipulationen“ [1].
Wir sehen also, daß das Wesen der vorstaatlichen Gemeinschaft in der Tat ihrem „Sinne“ im großen und ganzen entspricht. Selbstverständlich sind Roheit und Brutalität nichts allzu Seltenes; diese Menschen können, wenigstens auf den niederen Stufen, unmöglich die Besonnenheit besitzen, um immer dem ersten Impuls der Leidenschaft zu widerstehen, und gewiß wird es oft genug vorkommen, daß der Starke den schwächeren Genossen, oder der Mann sein Weib oder seine Kinder in der Wut mißhandelt. Aber — das ist immer Unrecht, von der öffentlichen Meinung getadeltes und oft genug auch durch Mißachtung des Schuldigen oder auf körperlich empfindlichere Weise gestraftes Unrecht. Außerdem: wir gehören nicht zu denen, die schwärmend, vielleicht unter dem Einfluß der biblischen Sagen, den Zustand dieser Gruppen zu idealisieren beabsichtigen: uns erscheint die Aufgabe der Menschheit vielmehr darin zu bestehen, sich von der Tierheit zur Humanität emporzuarbeiten; und so erwarteten wir von diesen, der Tierheit noch so nahestehenden Menschen eher weniger als mehr gegenüber dem, was uns die besten Berichte übereinstimmend mitteilen. Im übrigen wird von etwas höherer Stufe von großer Selbstbeherrschung der Starken berichtet: es ist charakteristisch, daß jeder Amerikaner, der auf sich hält, auf der einen Seite von den frommen Pilgrim-Fathers der „Mayflower“, aber auf der anderen Seite von Indianern abstammen will, am liebsten von der „Prinzessin“ Pocahuntas, während der Verdacht auch nur eines Tropfens Negerblut in der Mischung den Träger gesellschaftlich ächtet. Die stolze Würde der roten Krieger hat doch auf die selbst zum großen Teile recht rohen Einwanderer der ersten Jahre einen gewaltigen Eindruck gemacht.
Es zeigt sich also, daß der „Naturzustand“ doch überwiegend der Auffassung der Stoa entspricht, wenn wir auch alle Übertreibung ablehnen und nicht im mindesten geneigt sind, von einem „Goldenen Zeitalter“ zu schwärmen oder gar, wie Rousseau, Seume und die Schäferdichter des Rokoko, uns in jene Zeit der „Unschuld“ zurückzuwünschen.
In der Tat sind diese ersten menschlichen Gesellschaften „physei“, zusammengeführt und zusammengehalten durch einen starken Naturtrieb (den nicht einmal der Pessimismus eines Hobbes zu leugnen wagt)[2]. Und in der Tat sprechen wir diesen Trieb als das dunkle Gefühl
[1] Oetker, Die Negerseele und die Deutschen in Afrika, S. 28.
[2] „Ich bestreite daher nicht, daß die Menschen durch einen Naturtrieb einander aufsuchen; aber die menschlichen Gesellschaften sind nicht reine Zusammenkünfte, sondern Bündnisse, zu deren Abschluß Treue und Verträge nötig sind“. (Vom Menschen und vom Bürger, S. 80 Anm). Über den Gesellungstrieb der Tiere vgl. Alverdes, a. a. O. S. 72/3, S. 80.
[202]
eines höheren Gesetzes, des Rechtsgesetzes der Gleichheit an, das vor aller Erfahrung, a priori, besteht, so daß wir wohl im dichterischen Gleichnis mit der Stoa und Spinoza sagen könnten, jede individuelle Vernunft enthalte ein Fünkchen der alles zum Kosmos ordnen wollenden Weltvernunft, nämlich des „inhärenten Gruppeninteresses“ an der Gerechtigkeit des Zusammenlebens vernünftiger Wesen in der Natur, der Reziprozität [1]. Es gibt intratribal, zwischen den Genossen der gleichen Gruppe, nicht das „natürliche Recht“ auf alles, von dem Hobbes, Spinoza, Rousseau und so viele andere fabeln[2]. Es kann also nicht davon die Rede sein, daß der Krieg aller gegen alle der Gesellschaft vorangegangen ist[3], wie Lester Ward noch immer glaubt, der das „Gesetz von Klaue und Zahn“, den Kampf ums Dasein, also den Kampf aller gegen alle in Darwinscher Ausgestaltung, für die „natural justice“ hält[4], die erst allmählich durch die „civil justice“ ersetzt worden sei, und zwar unter der Wirkung dreier Elemente: durch Vermehrung der Empfänglichkeit für Sympathie, durch Vermehrung in der Voraussicht kommender Dinge — und durch Gesetze (codes)[5]. Die Berufung auf die Sympathie zeigt seine Herkunft klar: er ist ein Schüler Rousseaus, und so hält denn auch er den Staat (government) für eine kluge Erfindung, um dem Kampfe ein Ende zu machen, unter dem Alle litten: „Es traf sich, daß alle zu gleicher Zeit Geschädigte und Schädiger waren. Alle waren zu Übergriffen geneigt und Übergriffen ausgesetzt. ... So kam es, daß jeder in Bedingungen einwilligte, die seine eigene Handlungsfreiheit einschränkten“[6].
Hier spricht über Rousseau fort deutlich Hobbes: „Quoties unus aliquis agrum paulo commodiorem possederit ..., expectandi sunt alii viribus conjunctis parati, non modo laboris ejus fructum, sed etiam vitam, vel libertatem sublaturi, idem rursus passuri ipsi a se fortioribus“[7].
Und doch hatte Hobbes die Wahrheit in der Hand, verstand aber
[1] S. S. I, S. 907ff.
[2] Grotius, a. a. O. (Protag. 23) S. XIII/XIV erinnert an des Aristoteles berühmte Feststellung, daß sogar in einer Räuberbande der Rechtszustand besteht.
[3] Hobbes, a. a. O. S. 87: „So kann man nicht leugnen, daß der natürliche Zustand der Menschen, bevor sie zu Gesellschaften zusammentraten, der Krieg schlechthin gewesen ist, und zwar der Krieg Aller gegen Alle“. Vgl. Spinozas Ethik (Dürrsche Ausgabe S. 505/6, zit. nach dem „Spinozabrevier, S. 97/8). Vgl. ferner daselbst aus dem Theol. pol. Traktat, S. 104—107.
[4] Dynamic Sociology, S. 503/4.
[5] Ib. S. 508.
[6] Ib. S. 513/4. Die Formel stammt bereits von Epikur (Hasbach, a. a. O. S. 8).
[7] Leviathan, cap. XIII, S. 63 der Opera von 1648, Amsterdam. (Im Text steht „ipse“, offenbar ein Druckfehler.) So stellt neuerdings Anatole France in seiner köstlichen „Isle des Pingouins“ die Zustände der Urzeit und die Entstehung des „heiligen Eigentums“ dar (vgl. S. S. III, S. 732).
[203]
nicht, sie zu würdigen. In einer bisher kaum beachteten Stelle des Leviathan schreibt er von den Nordindianern: „Die Amerikaner, abgesehen davon, daß sie, in kleinen Familien lebend, den väterlichen Gesetzen unterworfen sind, Familien, deren Eintracht nur durch die Gleichheit der Begierden aufrechterhalten wird, leben derart“ [1], nämlich im dauernden Kriegszustande: er unterscheidet ausdrücklich gelegentliche Raufereien von dem „bellum uniuscujusque contra un- umquemque“, der eben der regelmäßige, der dauernde Zustand vor der Staatsbildung sei (64)[2].
Um die Stelle vollkommen zu verstehen, muß man die oben (S. 13) von uns angeführte Auslassung aus dem Buche „vom Menschen und vom Bürger“ über die subhistorischen Tiergesellschaften heranziehen. Hobbes sagte dort, es sei „richtig, daß bei diesen in bloßen sinnlichen Empfindungen und Begehrungen lebenden Geschöpfen die Übereinstimmung der Neigungen so beständig ist, daß sie nichts weiter brauchen als ihr rein natürliches Begehren, um diese Übereinstimmung und damit den Frieden sich zu erhalten“. Er betrachtet also die Nordindianer, die höchstentwickelten der primitiven Jäger, die in den Irokesen bereits bis zur Stufe des Stammesverbandes, und bei den Inka und Azteken schon bis zur vollen Staatsbildung gediehen waren, als noch im Tierzustand befindlich. Hier hat ihm die grenzenlose Überschätzung des Humanismus und namentlich der Aufklärung von der eigenen Kulturhöhe, und „wie wir's so herrlich weit gebracht“, einen bösen Streich gespielt. Und doch fließt ihm aus der Feder, daß diese „Geschöpfe den väterlichen Gesetzen unterworfen sind“. Wenn er diesen innerstammlichen Beziehungen nachgegangen wäre, statt nur die — außerdem noch stark übertrieben aufgefaßten — zwischen- stammlichen einzustellen, so hätte er zu ganz anderen Ergebnissen kommen müssen[3].
[1] Ib. s. 65.
[2] Max Schmidt (Grundriß der ethnol. Volkswirtschaftslehre, S. 142/3) hebt das Bestehen des Rechtszustandes auch bei den primitiven Gesellschaften hervor.
[3] Vgl. Gumplowicz, Gesch. d. Staatsth., S. 199, der Hobbes Unkenntnis der soziologischen Tatsachen vorwirft und ihm entgegenhält, daß auch die Wölfe sozial leben; daß schon Cicero sagte: „Non est solivagum genus humanuni“; daß innerhalb der Blutskreise auch auf niedrigster Gesittungsstufe Friede herrscht. Aber erstens zeigt die angeführte Stelle, daß Hobbes nicht aus Unkenntnis, sondern aus Nichtbeachtung der ethnologischen Fakten zu seinen Irrtümern gelangte, und zweitens fragen wir: wo bleibt denn die „absolute Feindseligkeit“ Ratzenhofers, den Gumplowicz so überaus hoch schätzt ?
Grotius sagt dazu (a. a. O. S. V. Proleg. 7) : „Denn auch einige der übrigen Lebewesen beherrschen ihren Egoismus aus Rücksicht auf ihre Brut und ihre Artgenossen einigermaßen, und wir glauben, daß dies aus einem Vernunftsprinzip a priori folgt“ (ex principio aliquo intelligente extrinseco). Er verweist auf das Sprichwort: „Canis caninam non est“ und auf Juvenal: „Tigris agit rabida cum tigride pacem“.
[204]
Es war eigentlich erst Kropotkin, der in seiner „Gegenseitigen Hilfe bei Menschen und Tieren“ diese Tatsachen, zwar nicht entdeckte, wohl aber gegen die alte, noch durch Darwins Lehre vom Kampf ums Dasein verstärkte Lehre in den Mittelpunkt der Debatte rückte. Aber bis dahin hat Hobbes' Anschauung alle Welt beherrscht.
Wie mächtig diese Anschauung war, kann man am besten daran erkennen, daß sogar der fromme Romantiker Bonald ihr Zugeständnisse macht: er läßt den Staat, zwar nicht aus dem Kampfe der einzelnen, wohl aber aus dem der Familien hervorgehen [1]. „Diese also zu einem Ganzen vereinigten Familien bilden eine Nation rücksichtlich des gemeinsamen Ursprungs, ein Volk rücksichtlich der Gemeinschaftlichkeit des Gebietes, einen Staat rücksichtlich der gemeinsamen Gesetze“. Auch hier spricht deutlich der fast unheimliche Einfluß Rousseaus: „Die Republik, oder der politische Körper (Bonald sagt: der öffentliche Zustand), der Staat heißt, wenn er passiv, Souverän, wenn er aktiv ist, und Macht heißt im Vergleich zu seinesgleichen. Die Vereinigten aber heißen als Gesamtheit Volk, einzeln betrachtet Bürger als Teilhaber an der souveränen Gewalt, und Untertanen als den Staatsgesetzen Unterworfene“[2].
Nun, ob stoisch oder epikuräisch oder mit Bonald aristotelisch, jedenfalls ergibt unsere ethnologische Übersicht, daß auch wir zu dem Anfangs- oder Urzustände kommen, von dem das Gesetz der ursprünglichen Akkumulation ausgeht: zu der Gesellschaft der Freien und Gleichen.
Aber damit ist für die Anhänger des Gesetzes nichts gewonnen. Denn wir bestreiten gar nicht, daß es einen vorstaatlichen Zustand dieser Art gegeben hat, im Gegenteil! Wir bestreiten aber mit aller Entschiedenheit den Hauptinhalt des angeblichen Gesetzes, wonach sich aus diesem Anfangszustande heraus, aus rein inneren Kräften, ohne Einwirkung äußerer Gewalt, der Staat und die Klassenschichtung entwickelt haben.
b) Die angebliche „organische Entwicklung“.
Die Annahme einer solchen „organischen“ Entwicklung ist der Kern des Pseudogesetzes, gegen das wir zu kämpfen haben. Prähistorische
[1] Die Urgesetzgebung, S. 269/70.
[2] Contrat social I, 6. Wir haben schon oben mitgeteilt, daß Raumer (a.a.O. S.92) Bonald eine nahe Verwandtschaft mit Rousseau spöttisch ins Album schreibt. Er scheint nicht bemerkt zu haben, daß Bonaids ganzeGrundidee, der sozusagen „GoldeneSchnitt“ des idealen Staates, in dem sich „das Oberhaupt zu seinen Ministern wie diese zu den Untertanen verhalten“, wörtlich dem Contrat social entnommen ist: „Man kann das Verhältnis des Souveräns zum Volke als die Extreme einer Proportion auffassen, deren Mittelglied die Regierung ist“ (III 1, vgl. a. II, 5). Bei Spinoza findet sich eine ähnliche Proportion: in seiner „Aristokratie“ soll sich die „Zahl der Syndizi zu der der Patrizier verhalten wie ihre Anzahl zur Anzahl des Volkes“ (Pol. Traktat, VIII, § 22).
[205]
Gruppe und historischer Klassenstaat sollen eine einzige, durch nichts unterbrochene oder auch nur abgelenkte Entwicklungslinie darstellen. Am klarsten finden wir die Vorstellung bei Schleiermacher ausgesprochen : Horde und organisierter Staat verhalten sich wie das Unbewußte zum Bewußten; „und er findet, daß der Moment, wo aus der Horde der Staat entsteht, ... durch den herausstrebenden Gegensatz von Obrigkeit und Untertanen bezeichnet sei. ... Er meint gewissermaßen, einen bestimmten Zeitpunkt angeben zu können, vor dem noch die „Sitte“ herrschte, nach dem schon das „Gesetz“ in Geltung war ... Staat ist, wo Gesetz ist, denn mit dem Gesetz wird ein vorher instinktmäßiges Zusammensein ein bewußtes“ [1].
In der Tat entsteht der Staat in dem Augenblick, wo der Gegensatz von Obrigkeit und Untertanen sich herausbildet. Nur geschieht das freilich ganz anders, als Schleiermacher es sich vorstellt, und nicht im mindesten auf „organische“ Weise. Man muß ihn beim Worte nehmen, indem man jenen Gegensatz streng im Sinne des „Obrigkeitsstaates“ faßt, in dem Schleiermacher lebte, und den er ahnungslos idealisierte.
Jellinek hat das Gefühl, daß man diese Dinge nicht allzu „linear“ sehen darf[2]. Es sei ja wahr, daß „niemals ein staatloser Zustand unter Menschen angetroffen sei“, sondern „daß Menschen stets in, wenn auch noch so lose organisierten, Gruppen gelebt hätten“[3], und „eine jede organisierte weltliche Gemeinschaft, die keinen Verband über sich hat, sei Staat“. Aber „dieses Merkmal ist (auch) das einzige, welches die frühesten Anfänge der politischen Entwicklung mit den ausgebildeten souveränen Staaten der Gegenwart verbindet“[4]. Und: „Nur in dem weitesten Sinne eines persönlichen Machtverbandes kann bei Nomaden, bei Jäger- und Hirtenvölkern von einem Staate gesprochen werden. Erst bei den Ackerbauern beginnt der vollendete Staat, der mit einem festen Territorium ausgerüstet ist“[5]. Darum ist er der Meinung, daß „die Lehre von dem rudimentären Staatsleben der Jäger- und Hirtenvölker sowie der auf der niedersten Stufe stehenden Naturvölker von der Staatslehre billig auszuscheiden und der Völkerkunde zu überlassen sei“[6].
Hier besteht offenbar keine Vorstellung von der tiefen Wesens-
[1] Metzger, a. a. O. S. 292ff. Wir erinnern an Waxweilers Vorstellung, daß erst durch die „céphalisation“, die Unterordnung unter einen Häuptling, aus der „troupe“ eine „groupe“ wird (S. S. I, S. 461). Ähnlich sah es Spencer.
[2] Über diese Unart, alles linear zu sehen, vgl. S. S. I, S. 877.
[3] Allg. Staatsl. S. 542.
[4] Allg. Staatsl. 364/5.
[5] Allge. Staatsl. S. 197, Kelsen (Soz. u. jur. Staatsbegriff S. 90) hat dagegen nichts einzuwenden.
[6] Allg. Staatsl. S. 82; vgl. a. Anm. 83.
[206]
Verschiedenheit der vorstaatlichen und der staatlichen Rahmengruppen, sondern nur die Meinung, daß die primitiven Gruppen doch allzuwenig entwickelt seien, als daß man an ihnen den voll entfalteten Staat studieren könnte. Aber auch dieser Autor hat Recht, wenn man ihn nur beim Worte nimmt : denn in der Tat ist der Staat erst auf der Stufe des Ackerbaus vorhanden, aber nicht, weil hier ein festes Territorium gegeben ist: denn das haben die Hackbauern auch, die ebenfalls das sind, was Jellinek sagen wollte, nämlich seßhafte Landwirte; aber sie haben dennoch keinen „Staat“. Übrigens haben auch die primitiven Jäger nach Holsti (oben S. 20) und die Nomaden nach Ratzel ein festes Territorium: „Der Boden der Mongolei ist ebenso bestimmt geteilt wie der Boden Arabiens. Nicht nur die Stämme, auch die kleineren Abteilungen grenzen sich ab“ [1]. Danach müßte Jellinek also die Nomaden-Stämme als „Staaten“ anerkennen.
Eduard Meyer polemisiert gegen Ratzel, den er nennt, und vielleicht auch gegen Jellinek, den er nicht nennt, mit der Behauptung, daß „der Besitz eines fest umgrenzten Gebietes keineswegs einen integrierenden Bestandteil des Staatsbegriffs bildet“, und daß man den Begriff auch auf primitive Organisationen anwenden müsse, sogar auf die „subhistorische tierische Herde, als den Verband, der älter ist als das Menschengeschlecht überhaupt[2]. Also das lineare Sehen in der höchsten Potenz ! Das ist fast der einzige Punkt von Bedeutung, in dem wir von diesem ganz vortrefflichen Abriß der Soziologie abweichen: auch hier hat die „Kinderfibel“ ihre Verwüstungen angerichtet.
Wie Ed. Meyer denken noch heute fast alle Historiker und die meisten anderen Forscher auf dem Gebiete der Gesellschafts- oder Geisteswissenschaften[3]. Nur selten klingt die entgegengesetzte Meinung an, und auch dann zumeist noch in einer gewissen Verhüllung. So z. B. sagt Metzger: „Die prähistorischen Gruppen .... sind „natürliche“, pflanzenhafte Gebilde, deren Teile ein „natürlicher“ Gemeintrieb, eine ganz ursprüngliche Einheitstendenz belebt: der Staat aber, wie ihn schon Thukydides und Tacitus kannten, wie ihn Hobbes, Locke, Rousseau und Kant theoretisch, und die Revolution praktisch vollendete, diese schlechthin rationale, auf vernünftiger Berechnung und peinlicher Wahrung der gegenseitigen Rechte gegründete „Gesellschaft“ ist alles andere, bloß kein Organismus“[4].
[1] Anthropogeographie, I, S. 43.
[2] Elemente der Anthropologie S. 11.
[3] Below, D. dt. St. d. M. S. 201 Anm.). „Auf die Frage der Entstehung der Staaten einzugehen ist hier kein Anlaß. Ich möchte aber nicht unterlassen, mich zu der Meinung derjenigen zu bekennen, die den Satz aufstellen, daß Staat und Recht von An beginn miteinander verknüpft sind“. Vgl. Rachfahl a. a. O.
[4] A. a. O. S. 41/2.
[207]
Hier spricht bereits die moderne Soziologie, aber sie spricht noch, der Ausdruck läßt keinen Zweifel, aus dem Munde von Ferdinand Toennies. Wir haben in unserer Allgemeinen Soziologie ausführlich dargestellt, inwiefern diese geniale Lehre ihr Ziel erreicht, und inwiefern, und warum, sie es verfehlt. Aber sie legt schon den Finger auf den wirklich vorhandenen Gegensatz.
Wir werden jetzt die einzeln bloßgelegten Wurzeln des Gesetzes der ursprünglichen Akkumulation einzeln ausroden und ausbrennen.
A. Die romantische Wurzel. (Ist der Staat ein Organismus?)
Als erste mag die romantische Wurzel an die Reihe kommen. Wir haben das wichtigste bereits in unserer Allgemeinen Soziologie gesagt. Wir wiederholen in äußerster Kürze:
Es gibt im strengen Sinne kein Individuum in der Bedeutung als Einzelwesen. Denn „wir hängen alle durch die Nabelschnur zusammen“. Jeder von uns war einmal ein Organ seiner Mutter, diese ein Organ der ihren, und so führt uns die Reihe zurück über das erste weibliche Wesen, das schon nicht mehr ganz Äffin, und noch nicht ganz Menschin war, bis zu jenem ersten Weibchen, das nicht mehr ganz wirbelloses und noch nicht ganz Wirbeltier war, und weiter und weiter „bis zu jener kleinen Menge gelatinöser Substanz, die zweifellos die Wurzel des Lebensstammbaumes ist“ [1]. Es gibt also, nicht etwa philosophisch, sondern strengstens naturwissenschaftlich gesehen, nur ein einziges Individuum, nämlich das ganze Leben in seiner Erstreckung über Raum und Zeit, ausgefaltet in allen den unzähligen Arten und Einzelwesen von Pflanze und Tier. Das Einzelwesen ist nur ein Gradbegriff.
Auch die Art ist noch nur ein Gradbegriff, aber sie kann mit wesentlich besserem Rechte als ein „Individuum“ bezeichnet werden. Und eine Gesellschaft ist eine gesellschaftlich lebende Art, uns nicht mehr gegeben als Inbegriff aller Einzelwesen der gleichen Beschaffenheit, sondern als Inbegriff aller Gesellschaften von Einzelwesen der gleichen Beschaffenheit.
Eine Gesellschaft ist also einmal ganz gewiß ein Lebewesen. Und wenn man jedes Lebewesen als einen „Organismus“ bezeichnet, so ist daher die Gesellschaft auch ein Organismus.
Fragt sich nur, was für ein Organismus?!
Leute, die nichts von den Naturwissenschaften kennen als einige Kunstausdrücke, die sie entsprechend ihren ungeklärten Begriffen und dem gemeinen Sprachgebrauch mit Inhalt füllen, denken bei der Analogie zwischen Gesellschaft und Organismus immer nur an den höher
[1] Bergson, L'évolution créatrice, 9. Aufl., S. 46/7. Vgl. S. S. I, S. 84.
[208]
entwickelten Einzelorganismus und speziell an den Menschen. Was dabei herauskommt, ist der „Organizismus“: eine in vergangener Zeit sehr beliebte und als heuristisches Prinzip ganz fruchtbar gewordene soziologische Anschauung, die heute vollkommen aufgegeben ist [1]. Wir haben sie in unserer Allgemeinen Soziologie unter dem Titel „Zwei erledigte Probleme“ abgehandelt und abgewiesen (S. 60ff.).
Wir übergehen die dort behandelten verschiedenen großen Schwierigkeiten, in die sich diese Auffassung verwickeln muß, Schwierigkeiten, die bereits Herbert Spencer angemerkt hat, und beschränken uns darauf, den entscheidenden Gegensatz zwischen Gesellschaft und Einzelwesen noch einmal herauszuheben. Er besteht darin, daß jene sich im Generationenwechsel erneuert, während das höhere Einzelwesen dem Tode verfallen ist. (Das niedere Einzelwesen, das sich nicht zwiege- schlechtlich fortpflanzt, ist dem Begriffe nach unsterblich. Erst die Zeugung brachte den Tod als unentrinnbare Notwendigkeit in die Welt.) Selbstverständlich können, worauf z. B. der Hauptverfechter des Organizismus, v. Lilienfeld, sich beruft, Völker und Staaten sterben, wie auch eine Amöbe sterben kann, an Krankheiten, durch stärkere Feinde: aber nicht darauf kommt es an, sondern darauf, daß Amöben, Staaten und Völker nicht sterben müssen, nicht an Altersschwäche sterben müssen, wie jedes von zwei Eltern gezeugte Einzelwesen.
Wer also die Gesellschaft dem höheren Einzelwesen vergleicht, vergleicht das absolut Unvergleichbare: „das im Sinne Spinozas Substantiale mit dem Modalen“ (S. 64).
Man darf also die Gesellschaft allenfalls nur einem Kollektiv-Lebewesen vergleichen. Dann freilich hört die beliebte Analogiespielerei sofort auf[2]: denn alles, was von einem, was von jedem Kollektivwesen ausgesagt werden kann, ist, daß er sich lebend seiner Umwelt angepaßt hat, und daß es sich lebend in dieser Anpassung erhält, bis die Umwelt sich ändert und entweder neue wirksame Anpassung erzwingt oder den „Organismus“ vernichtet; und, daß diese Anpassung darin besteht, das Zusammenspiel der Organe oder „Teile“ und ihrer Funktionen, den „notwendigen Consensus“ (Comte) zu erhalten.
[1] Sogar René Worms, früher der entschlossenste Organizist („Organisme et Société“) hat neuerdings seine Meinung abgeschworen („La sociologie“, 1921).
[2] Dann kann man auch nicht mehr mit Izoulet (oben S. 23) die Klassenscheidung einfach damit begründen, daß jeder höhere Organismus nicht nur eine „solidarité“, sondern auch eine „hiérarchie“ sei. Außerdem wird hier in einer sehr seltsamen Weise Führerschaft und Herrschaft verwirrt. Es mag von unserem entwicklungsgeschichtlichen und physiologischen Standpunkt aus richtig sein, das Gehirn als ein „höheres“ Organ zu bezeichnen: aber beutet es die Muskeln und anderen Organe aus? Da war Menenius Agrippa konsequenter und kam der Wahrheit näher, als er die Aristokratie dem Magen verglich, der entwicklungsgeschichtlich das älteste und primitivste aller Organe ist und gewiß nicht „subordinierend“, im Sinne einer „Hierarchie“ regierend wirkt. Übrigens kennt I. den Unterschied, vgl. S. 476ff. bes. 478/9.
[209]
In diesem Sinne ist nun zunächst einmal eine prähistorische Menschengruppe sicherlich ein Organismus. Ist auch der Staat in seiner soziologischen Bedeutung, als Herrschaft einer Gruppe über eine andere, als Organismus aufzufassen?
Hier bereitet ein anderes populäres Mißverständnis neue Schwierigkeiten.
Man glaubt nämlich, ein Kollektivwesen müsse aus lauter gleichartigen Einzelwesen bestehen. Man definiert z. B. einen Wald als den Inbegriff der in ihm stehenden Bäume. Das ist wieder ganz verkehrt. Zum Kollektivwesen eines Waldes gehören nicht nur die Bäume, sondern auch das Unterholz, die Krautpflanzen, die in dem Erdreich lebenden und wirkenden Bakterien, das Wild, die Vögel, die Schlangen, die niederen Tiere : Insekten, Würmer usw. Dieser ganze Komplex bildet eine einzige Gemeinschaft gegenseitiger Anpassung in Förderung und Hemmung. Wir haben es erlebt, was es für das Leben eines Waldes bedeutet, wenn der Mensch, um mehr Nutzholz zu gewinnen, die Laubbäume ausrottet, Koniferen dafür pflanzt und mit dem Unterholz die Niststätten der Vögel vernichtet. Dann wird das Gleichgewicht der Kräfte, der Consensus, zerstört, und ein überhandnehmendes Insekt, z. B. die Nonne, verheert den ganzen Bestand. Darwin hat sehr schön an einem Beispiel gezeigt, wie wunderbar die Zusammenhänge sind: je mehr Katzen es in einer Gegend gibt, um so besser wird die Klee-Ernte. Denn der Klee wird von Hummeln befruchtet, die Feldmäuse aber zerstören die Hummelnester, und die Katzen fressen die Mäuse. Also: je mehr Katzen, um so weniger Mäuse, um so mehr Hummeln, um so mehr Klee!
Überall also, wo Wesen verschiedener zoologischer und botanischer Art zu einem System des Gleichgewichts zusammengebunden sind, besteht ein kollektiver Organismus [1].
Simmel sagt: „Einheit im empirischen Sinne ist nichts anderes als Wechselwirkung von Elementen: ein organischer Körper ist eine Einheit, weil seine Organe in engerem Wechseltausch ihrer Energien stehen als mit irgendeinem anderen äußeren Sein, ein Staat ist einer, weil unter seinen Bürgern das entsprechende Verhältnis gegenseitiger Einwirkung besteht“[2].
Kelsen, der die Stelle anführt[3], polemisiert mit Recht dagegen, daß hier körperliche und geistig-gesellschaftliche Wechselbeziehungen ohne weiteres gleichgesetzt werden. Wir brauchen auf diesen erkenntnis-
[1] Mit den Ameisen vergesellschaftet leben zahlreiche Insektenarten, die Myrmekophilen“ (Wasmann), ... Manche der Ameisengäste sind so an dieses Zusammenleben angepaßt, daß sie ohne Ameisen nicht lebensfähig sind (Alverdes, a. a. O. S. 67).
[2] Soziologie, S. 5.
[3] A. a. O. S. 5.
[210]
theoretischen Gegenstand hier nicht einzugehen: die Einwände treffen uns nicht, weil wir hier lediglich von körperlichen, biologischen, nicht aber von seelischen Dingen sprechen. Es handelt sich hier um nichts anderes, als um die Frage, ob der Staat als ein Organismus aufgefaßt werden kann, nicht als ein „geistiger“ oder „kontraktueller“ (Fouillée), sondern als ein leiblicher „Organismus“. Das aber kann keinem Zweifel unterliegen — womit wir dem „Organizismus“ nicht die geringste Einräumung machen. Der Staat ist, äußerlich betrachtet, eine „Einheit im empirischen Sinne“, weil er „eine Wechselwirkung von Elementen“ ist; — weil seine „Organe in engerem Wechseltausch ihrer Energien stehen als mit irgendeinem anderen äußeren Sein“.
Das gilt nicht nur für den „Kommensalismus“, sondern auch für Symbiose und Parasitismus [1]. Die Hydra und die in ihr lebenden Zoochlorellen bilden zusammen einen solchen Kollektivorganismus; und nicht minder bilden die Ameisenstämme, die sich Blattläuse als Milchvieh züchten, mit diesen, und sogar die Amazonenameisen (Polyergus) mit ihren „Sklaven“ ein derartiges Kollektivwesen, dessen Teile wechselseitig aufeinander angewiesen, aneinander angepaßt Sind. Denn auch in dem Sklaven ist der Instinkt gezüchtet, mehr Nahrung zu kauen, als sein eigenef Körper braucht, und so ist er auf die Herren angewiesen wie die stillende Mutter auf den Säugling.
Um diese Ergebnisse auf die menschliche Gemeinschaft und weiterhin auf den Staat anzuwenden, so besteht also bereits jene (biologisch, nicht soziologisch gesehen: wir haben zurzeit mit dem „Erkenntnisobjekt Gesellschaft“ der Biologie zu tun) nicht nur aus den Menschen, sondern auch aus ihren Haus- und Jagdtieren, den „Wohnparasiten“ ihrer Häuser und Gewänder, von den Nagern abwärts über die Insekten bis zu den Mikroparasiten ; und aus allen den Pflanzen, mit denen sie in Wechselwirkung leben: Holz- und Fruchtpflanzen, Getreidearten usw. Alle diese Lebewesen bilden zusammen ein „System“, ein Gleichgewicht, das erhalten, das nach jeder Störung wieder hergestellt werden muß, soll sich das Ganze nicht verändern, vielleicht zugrunde gehen. Wir haben hier, wir wiederholen: biologisch gesehen (denn das soziologische Erkenntnisobjekt bilden selbstverständlich nur die vereinigten Menschen in ihren psychisch vermittelten Wechselbeziehungen) einen aus vielen Kollektivorganismen bestehenden noch höheren Kollektivorganismus: die Menschengesellschaft steht im Verhältnis von Kommensalismus oder Parasitismus oder der merkwürdigen, nur bei den höchsten Arten sich findenden Synthese der beiden: der Züchtung, mit den Gesellschaften des Waldes, der Felder[2], den
[1] Vgl. S. S. III, S. 254/5.
[2] „Die Eiche kann sich im Fichtenwalde nicht halten und umgekehrt. Auch der Roggenhalm kommt einzeln nicht fort; er bedarf des Zusammenseins mit dem ganzen Saatfelde zu seiner Existenz“ (Barth, a. a. O.).
[211]
Kolonien der Haus- und Ackermikroorganismen, den Gesellschaften der Haustiere und der Nager in Haus und Speicher.
Und so ist denn auch der Staat als ein solcher Kollektivorganismus, biologisch angeschaut, anzusehen.
Aber aus dem derart geklärten Begriff lassen sich nun die Folgerungen der romantischen Staatsidee und ihrer Zuspitzung in der proletarischen Staatsidee nicht mehr ziehen. Denn sie waren durchaus abgeleitet aus der jetzt abgewiesenen Voraussetzung, der Staat sei das Homologon eines höheren Einzelwesens und habe sich wie ein solches entwickelt, nach einer ihm innewohnenden „Entelechie“ [1], wie Hans Driesch, der Naturphilosoph, es mit Aristoteles nennt: wie nach einem vorher bedachten weisen Plane, der, Stufe für Stufe, sich erfüllt, selbst gegen schwere von außen her einwirkende Störungen; auch aus dem mehrfach künstlich geteilten Ei eines See-Igels entwickeln sich zwar abnorm kleine, aber vollständige junge Tiere.
All das gilt für einen Kollektivorganismus durchaus nicht. Er hat keine „Entelechie“. Der Gläubige einer Theo-oder Ideophanie mag eine solche ja annehmen, aber das ist dann nicht mehr Wissenschaft oder gar Naturwissenschaft, sondern dogmatische Metaphysik[2]. Ein Kollektivorganismus kann sich, wenn die Änderungen seiner Umwelt nicht stark und plötzlich genug sind, um ihn zu zerstören, allmählich in ganz andere äußere Formen mit ganz anderem funktionellen Inhalt umwandeln, ohne daß er auch nur einen Augenblick aufgehört hätte, ein „Organismus“, d. h. nach innen hin ein konsensuelles System und nach außen hin erfolgreich angepaßt zu sein. Er kann es nicht nur: er muß es sogar: denn es ist unmöglich, daß die Umwelt sich nicht ändere[3].
Es ist also notwendig, daß er sich entwickelt, aber es ist durchaus
[1] „Schon Aristoteles hatte die politischen Verbände als Entelechien, d. h. als Organismen betrachtet, deren einzelne Teile ihren Sinn durch die Beziehung auf das Ganze erhalten, und die Staatslehre des Thomas von Aquino hatte dieses System des natürlichen Konservatismus ... in das christliche Weltbild eingegliedert“. (Peter Richard Rohden, Deutscher und französischer Konservatismus, S. 98.)
[2] Das hat schon Fries ganz klar gesehen: „Unter den Organisationen an der Erde ist der Staat die einzige, welche nicht notwendig nur nach einem blinden Naturtrieb, sich selbst unbewußt, sich aus dem Keim entwickeln muß“ (Politik, S. 14). Er polemisiert anschließend scharf gegen die „unbestimmten Reden“ der Romantiker, namentlich Adam Müllers.
[3] Indem wir das aussprechen, ändern wir nur unseren methodologischen Standpunkt, schaffen uns aus dem gemeinsamen Erfahrungs- ein neues Erkenntnisobjekt, das der Entwicklungslehre, der Geschichte, anstatt der Embryologie. Wir betrachten die gleichen Erscheinungen nicht mehr von dem methodologischen Standpunkt der Statik, sondern zuerst von dem der Kinetik, wo die Veränderungen der Umwelt als „Störungen“ aufgefaßt werden, und dann von dem der komparativen Statik, wo sie als entwickelnde Momente erscheinen. Vgl. S. S. I, S. 71ff.: „Der Begriff des Prozesses“.
[212]
kein Ergebnis rein immanenter Kräfte wie beim Ei des See-Igels, daß er sich so entwickelt, sondern es ist das das Ergebnis des „Zufalls“ im wissenschaftlichen Sinne, d. h. der Kreuzung zweier voneinander unabhängiger Kausalreihen (vgl. S. S. I, S. I79ff.): der Richtung, Art und Stärke der von außen her angreifenden „Störungen“ und der inneren Organisation des betroffenen kollektiven Lebewesens. Auf unserer Erde hat sich aus diesem Gegenspiel allmählich aus der Amöbe der Wurm, aus dem Weich- das Wirbeltier, aus dem Reptil der Vogel, aus der Affenherde die Menschenhorde entwickelt: nichts kann unwahrscheinlicher sein, als daß sich auf den etwa dreißig bis vierzig Millionen Weltkörpern, die unsere Instrumente von der Erde aus entdecken können [1], und auf den unzähligen, die sich unserer Beobachtung entziehen, ganz die gleichen Formen des Lebens in ganz der gleichen Reihenfolge entwickelt haben sollten.
Mit diesen Erörterungen ist die romantische Staatsidee als völlig abgewiesen zu betrachten. Wenn sie jemals mehr war als eine Redensart, „ein Wort, wo Begriffe fehlen“, so kann sie nur den Sinn gehabt haben, auszusagen, daß aus der primitiven Horde der Staat mit der gleichen zwangsläufigen Notwendigkeit, „pflanzenhaft“, erwächst, wie aus dem Ei der Embryo, und aus diesem der fertige Einzelorganismus. Denn nur aus der Annahme einer immanenten Entelechie kann ihr Schluß folgen, daß, wie wir sagten, „die Geschichte zwar gewesen sei, aber nicht gewirkt habe“: daß Eroberung, Gewalt, Versklavung, Amtsmißbrauch, Wucher und Monopol usw. den Organismus in seinem Wachstum vielleicht hemmen, sogar verkrüppeln oder töten, aber niemals in eine grundsätzlich verschiedene Lebensform umwandeln konnten.
B. Die naturrechtliche Wurzel.
Der Rationalismus der naturrechtlichen Aufklärung glaubte nicht an die immanente Entelechie eines gewachsenen Organismus, als er daran ging, die Entwicklung des Staates zu erforschen. Er mußte daher das Problem grundsätzlich richtig wie folgt, stellen: wie hat sich aus dem Anfangszustand der allgemeinen Gleichheit und Freiheit durch die Gegen- und Wechselwirkung der inneren Kräfte der Gruppe einerseits und der Angriffe oder Widerstände der Außenwelt andererseits allmählich der Staat entwickelt?
So war das Problem, wie gesagt, grundsätzlich richtig gestellt, und dennoch wurde die Lösung sofort beim ersten Versuch gründlich verfehlt durch eine zu enge Fassung des Wortes: Außen- oder Umwelt. Man dachte nur an die „äußere Natur“ in ihrer Bedeutung als Inbegriff
[1] Aug. Kühl, Der Sternhimmel, Bücher der Naturwissenschaft (Reclam) Nr. 6 S. 35.
[213]
aller nicht-menschlichen, elementaren Kräfte und vergaß, daß zur Umwelt einer Gruppe, und zwar gleichfalls alseinStückelementarer Natur, der nicht der eigenen Genossenschaft angehörige Mensch, und vor allem: die fremde Genossenschaft gehört.
Zuerst wurde die Gruppe als so gut wie passiv, als lediglich das Objekt der Natur in jenem Sinne, angesehen. Das war z. B. die Stellung Montesquieus, der die Völker als das passive Produkt ihrer geographischen Umwelt betrachtete; dennoch gehört er zu den Vorläufern der Soziologie, weil er als einer der ersten in der Neuzeit das Problem der den Staat und die Gesellschaft entwickelnden Kräfte wenigstens stellte und aus seiner Problemstellung auch sofort zu einer ersten Annäherung an die Konzeption eines Gruppengeistes gelangte.
Wir haben den Einfluß Montesquieus in der Darstellung der Theorien kaum gestreift. Hier mag einiges Geistesgeschichtliche nachgeholt werden. Zunächst die von Bluntschli stark hervorgehobene Tatsache, das Jean Bodin sein „gediegenerer Vorgänger“ war (S. 26). Er hat in seiner „République“ (V, 1) in der Tat die berühmten Montesquieuschen Ausführungen über den Einfluß des Klimas auf den Volkscharakter in weitgehendem Maße vorausgenommen (Bluntschli S. 49/53)[1].
Sein Hinweis auf die englische Verfassung, der so weithin gewirkt hat, namentlich auf die „Verteilung der Gewalten“, beruht, wie Lord zeigt, namentlich auf Locke, den er vielfach mißverstanden hat (a. a. 0. S. 112) ; und es ist außerordentlich interessant, daß diese von dem Franzosen mißverstandene englische Verfassung das Vorbild der Verfassungen der verschiedenen nordamerikanischen Freistaaten, und damit zuletzt auch der französischen Verfassung von 1793 geworden ist[2].
Was nun seinen „Esprit général“ anlangt, so hat er allerdings „wie ein Auftakt zu der romantischen Theorie vom Volksgeist als dem schöpferischen Ursprung der Staatsverfassungen“ gewirkt. Man darf dabei aber nicht übersehen, daß seine Konstruktion durchaus unromantisch-rationalistisch ist, dem „homme général“ Quételets viel näher verwandt als dem mystischen Volksgeist Hegels, wenn auch historische Elemente eintraten. „Dem Janus-Charakter seiner Theorie entsprach die doppelseitige Wirkung, die von ihr ausging. Das analytisch-konstruktive Element seiner Methode regte zu politischer Bautätigkeit an und beflügelte so das revolutionäre Pathos. Freilich fühlten sich seine Jünger von 1789 bald von der vorsichtigen modération abgestoßen, die sich mit einer relativ guten Verfassung begnügen wollte. Je mehr aber Montesquieu in den Geruch eines Reaktionärs kam, desto stärker wirkte sich das konservative Element seiner Lehre aus. Fast zu der-
[1] Auch Vico ist ihm vorangegangen (vgl. „Neue Wissenschaft“ S. 191).
[2] Vgl. a. Laski, a. a. O. S. 70/1. Die Amerikaner schwärmten außerdem für Harrington (vgl. Gooch, a. a. O. S. 121).
[214]
selben Zeit, wo ihn Robespierre als schwaches fanatisches Hirn abtat, feierte ihn Burke als den größten Genius, der dieses Zeitalter erleuchtet hat“ [1].
Damit war der Anschluß an die Romantik und über diese fort an die moderne Soziologie gegeben, die ja, wie wir fanden, die Synthese von Romantik und Rationalismus ist. Auch Auguste Comte hat Montesquieu geschätzt und als einen der wenigen von ihm anerkannten Vorläufer bezeichnet[2].
Allmählich kam man weiter und verstand, daß nicht nur die Natur auf den Menschen, sondern auch der Mensch auf die Natur verändernd einwirkt, und vor allem, daß die äußere Natur, indem sie die Natur des Menschen verändert, ihm immer neue Mittel liefert, um wieder sie zu verändern: ein typischer Wechselprozeß.
Aber den letzten, entscheidenden Schritt tat erst die soziologische Staatsidee. Sie verstand endlich, daß von allen Elementarkräften auf diesem Planeten („Nichts ist gewaltiger als der Mensch“) keine, auch die gewaltigste und zerstörendste nicht, entfernt von der unendlichen Stärke ist, wie die im Gesellschaftsprozeß sich bildende Elementarkraft der kooperierenden Gemeinschaft. Diese ungeheuerste aller Kräfte hat der naturrechtliche Rationalismus nicht gesehen oder nicht sehen „wollen-können“ — und darum hat er sein Beweisziel verfehlt.
Die Erklärungen, die er gefunden zu haben glaubte, um das Werden des Staates aus der ursprünglichen Gemeinschaft der Freien und Gleichen abzuleiten, haben wir ausführlich dargestellt. Es wird jetzt unsere Aufgabe sein, diese Erklärungen, eine nach der anderen, zu widerlegen und damit auch die letzten Wurzeln des Pseudogesetzes der ursprünglichen Akkumulation abzuschneiden und auszubrennen.
a) Die angeborene Ungleichheit.
Die Grundlage aller übrigen Erklärungsversuche ist die Annahme der angeborenen Ungleichheit der Menschen. Hier glaubt die Lehre ihre unerschütterliche Grundlage zu besitzen. Denn welcher besonnene Mensch könnte auch nur versuchen zu bestreiten, daß die Menschen an Begabung des Körpers, Geistes und Willens beträchtlich verschieden sind?! Und so scheint denn bereits mit dieser ersten Feststellung der Streitfall im wesentlichen entschieden.
Wir sind durchaus nicht gesonnen, dieses Grundaxiom zu bestreiten. Wir gehen sogar noch weiter mit unseren Gegnern mit. Wir behaupten zwar, daß die Menschen kraft des „natürlichen Rechts“ gleich in Rechten
[1] Rohden, Deutscher und franz. Konservatismus, S. in. Vgl. oben S. 165 Anm. 1.
[2] Vgl. S. S. I, S. 659.
[215]
und Ansprüchen sind, lehnen aber gerade im Namen der Gerechtigkeit und des Wohles der gesellschaftlichen Gesamtheit den Schluß ab, den der Kommunismus zieht, daß darum auch die wirtschaftliche Lage aller gleich sein solle. Ganz sicher — das beweist der Mißerfolg aller bisherigen kommunistischen Versuche —, leidet das Wohl der Gesamtheit, wenn Alle, ganz unabhängig davon, wie viel sie zu dem gemeinsamen Vorrat beigetragen haben mögen, aus diesem Vorrat gleichmäßig beteilt werden. Wie der Mensch einmal geartet ist, setzt er nur dann seine ganze Kraft ein, wenn Anstrengung und Erfolg in dem rechten Verhältnis stehen : das ist das alles Leben beherrschende „Prinzip des kleinsten Mittels“. Darum wird in kommunistischen Gemeinwesen sehr schlecht gearbeitet, und der zur Verteilung an alle kommende Gütervorrat bleibt weit unter dem Möglichen und Wünschenswerten, oft sogar unter dem Notwendigen.
Aber die kommunistische Verteilung nach einem nicht der geleisteten Arbeit entsprechenden Maßstabe, entweder nach dem Bedürfnis oder mechanisch nach Köpfen, widerspricht, das ist unsere Überzeugung, auch der natürlichen Gerechtigkeit. Jedenfalls widerspricht sie dem Grundprinzip ihrer selbst : dem sozialistischen Endziel. Denn aller Sozialismus baut grundsätzlich seine Forderung auf das Prinzip, daß die Arbeit, die einzige Schöpferin aller Güter, auch ihre einzige Genießerin sein soll. Daraus schließen wir, daß nicht nur alle Güter allen Arbeitern zu gehören haben, sondern, daß auch jeder einzelne Arbeiter nach dem Werte seiner Arbeit zu entlohnen ist. Zu diesem Ergebnis kommt auch Nelson, der „den unaufhcbbaren Widerspruch in der Idee des Kommunismus als der vollendeten Durchführung des Sozialismus“ feststellt [1].
Damit scheinen alle Voraussetzungen der Gegner zugegeben, und kein Entrinnen mehr von ihren Schlüssen möglich. Aber es ist nur ein Schein.
Denn das Problem muß viel schärfer gestellt werden, als es bisher geschehen ist. Es muß wissenschaftlich streng, d.h. quantitativ gestellt werden. Es genügt durchaus nicht, festzustellen, daß die Menschen von Haus aus an Begabung und Leistung verschieden sind, und daß daraus nach den Regeln der Logik und der Gerechtigkeit auch eine Verschiedenheit ihrer Güterversorgung folgen muß: sondern die Frage ist, ob die bestehende Ungleichheit, ja sogar, ob die Ungleichheit in der wirtschaftlichen Lage, wie sie in jenem Zeitpunkt der „kritischen
[1] System der philos. Rechtslehre usw. S. 397. Rousseau schreibt (Contrat social II, II): „Ohne Gleichheit kann die Freiheit nicht bestehen. Aber das Wort bedeutet nicht die absolute Gleichheit der Macht und des Reichtums. ... Es soll nur keiner reich genug sein, um einen anderen kaufen zu können, und keiner arm genug, um sich verkaufen zu müssen“.
[2l6]
Dichtigkeit der Bevölkerung“ sich ausgebildet hat, der Verschiedenheit der wirtschaftlichen Begabung proportional war oder nicht. Das ist die Behauptung, und sie allein steht zur Diskussion. Was abzuleiten ist, ist die Entstehung der Klassen aus der Verschiedenheit der wirtschaftlichen Begabung : und das heißt, der Nachweis sehr grober, sehr bedeutender, erblicher klassenbildender Verschiedenheit der Begabung.
Wir wollen an einem Beispiel zu illustrieren versuchen, welcher Denkfehler hier regelmäßig gemacht wird. Es werde die Frage aufgeworfen, welche Kräfte die Gebirge geschaffen haben. Jemand sagt: der Wind; denn wir können täglich beobachten, wie er an der Küste oder in der Wüste Sandhügel auftürmt. Damit ist offenbar für die Entstehung des Himalaya oder auch nur der Alpen oder des Harzgebirges nicht das mindeste bewiesen.
Ganz entsprechend, und zwar quantitativ mit kaum gröberer Übertreibung denken die meisten Verfechter des Gesetzes der ursprünglichen Akkumulation. Die naturrechtliche Kinderfibel wird unentwegt nachgebetet, wie zur Zeit eines Hobbes, Grotius und Rousseau. Wir bringen einige aus unzähligen herausgegriffene Belege:
Nach Treitschke „muß alles politische Denken mit dem Satz von der ursprünglichen Ungleichheit der Menschen beginnen. Nur dadurch erklärt es sich, daß einzelne Gruppen anderen untergeordnet sind“ [1]. Daß er dabei nicht etwa die Ungleichheit der Tapferkeit und der Bewaffnung im Auge hat, die den einen dem anderen gewaltsam unterwerfen, geht daraus hervor, daß er „schon die Urfamilie als den Urstaat gelten lassen muß, denn schon in der Familie finden wir das staatliche Prinzip der Unterordnung“ (16). „Nur die gleichen Rechte zum Erwerb kann der Staat gewähren, nicht den gleichen Reichtum. Denn dieser hängt hauptsächlich von den individuell verschiedenen Anlagen und Tüchtigkeiten des Einzelnen ab... . Die ganze Größe, Schönheit und Mannigfaltigkeit unserer Kultur müßte verloren gehen; wir können uns ein Leben in solch ödem Einerlei gar nicht denken. Ein weiteres Moment tritt der Vermögensgleichheit hindernd entgegen. Weitaus der größte Teil unseres Vermögens ist nicht durch das gegenwärtige Geschlecht erworben, sondern ein Erzeugnis des Fleißes gestorbener Generationen. Denjenigen, die das Vermögen erworben haben, muß aus Gründen der Gerechtigkeit die Entscheidung über dessen Verteilung und Besitz anheimgestellt werden. Hieraus folgt ganz naturgemäß die Notwendigkeit eines Erbrechts“ (188/9). Und daraus folgt nun logisch weiter, daß der Staat auch politisch ein Klassenstaat sein muß: „er wird am gesündesten sein, wenn er die vorhandenen Ungleichheiten
[1] Politik I, S. 19. Die Seitenzahlen der folgenden Zitate aus dem gleichen Buche in Klammern.
[217]
des Besitzes, der Geburt, der Bildung berücksichtigt“ (188); „einen Anspruch auf unmittelbare Teilnahme an der Staatsgewalt kann man aus der menschlichen Natur an sich nicht begründen“ (190/1).
Jellinek schreibt: „Diese dem Individuum gegebenen, von seinem Individualwillen unabhängigen Gemeinschaftsverhältnisse ruhen auf der ... Ungleichheit der Individuen, die somit etwas von Natur Gegebenes, nichts künstlich Erzeugtes ist. Dadurch gestalten sich die Gemeinschaftsverhältnisse in Abhängigkeitsverhältnisse um, die auch da vorhanden sind, wo ihnen staatlicher Zwang nicht zur Seite steht. Staatliche Herrschaftsverhältnisse sind daher präpariert durch die sozialen Abhängigkeitsverhältnisse, die in jeder sozialen Gruppe, nicht etwa nur in Beziehungen der wirtschaftlichen Klassen statthaben. Solche Abhängigkeitsverhältnisse sind „naturwüchsig“, d. h. ganz losgelöst von dem Willen der jeweiligen Gesellschaftsglieder, daher dauern sie auch im Staate, unabhängig von der staatlichen Herrschaft, fort. Kein geselliger Verein, keine wissenschaftliche Schule, keine künstlerische Richtung, in denen es nicht Leitende und Abhängige gäbe“ [1].
Nachdem er diese letzten, von niemandem bestrittenen Sätze ausgesprochen hat, kommt die ganze Kinderfibel in schönster Ausführlichkeit. (Wir machen ihm keinen Vorwurf daraus, denn hier gibt der Jurist nur unschuldig die Irrtümer der Ökonomik weiter, auf die er sich verlassen muß): „Privateigentum an Grund und Boden entsteht, der nunmehr verwickeitere Produktionsprozeß scheidet Berufe, erzeugt Verhältnisse der Unfreiheit, und damit bildet sich eine komplizierte Rechtsordnung, die einer stetigen schützenden Macht bedarf“ (107).
Nach dem repräsentativen Historiker und Staatslehrer noch je ein ebenso repräsentativer Meister der Volkskunde und Philosoph.
Riehl schreibt: „Als ob nicht die Mannigfaltigkeit des Besitzes und Nichtbesitzes eine ebenso unüberwindliche Notwendigkeit für den einzelnen wäre, wie Geburt, Talent und andere Dinge, über welche kein Mensch hinauskommen wird, solange die Welt steht“[2].
Und Simmel: „So sind wir auch genötigt, in der Entwicklung der sozialen Mannigfaltigkeiten von einem fiktiven einfachsten Zustande auszugehen; das Minimum von Mannigfaltigkeit, dessen es als Keim aller späteren Differenzierungen bedarf, wird dabei wohl in die rein personalen Unterschiedenheiten der Anlagen von Individuen gesetzt werden müssen. Die nach außen gerichteten Unterschiedlichkeiten der Menschen in den aufeinander bezüglichen Positionen werden also
[1] Allg. Staatsl., S. 91/2.
[2] Die bürgerliche Gesellschaft S. 370/1.
[2l8]
zu allererst von solchen qualitativen Individualisierungen abzuleiten sein“ [1].
Man sieht, der einzige Vorbehalt, den Simmel hier macht, besteht darin, daß er die „nach innen gerichteten“ Unterschiedlichkeiten etwas heraushebt: der Denker empört sich doch ein wenig über die groben Unterschiede der äußeren Position, die so oft offenbar nicht dem Werte der Personen entsprechen.
Noch entschiedener drückt er sich an anderer Stelle aus:[2]
„Sind alle äußeren Verschiedenheiten beseitigt, so muß die Verschiedenheit der inneren Potenzen sich in einer entsprechenden Verschiedenheit der äußeren Positionen ausdrücken: die Freiheit, die die allgemeine Institution gibt, wird durch die personalen Verhältnisse wieder illusorisch, und da in allen Machtverhältnissen der einmal gewonnene Vorsprung den Gewinn eines weiteren erleichtert — wovon die „Akkumulierung des Kapitals“ nur ein Einzelfall ist —, so wird sich die Ungleichheit der Macht in raschen Progressionen erweitern“. Lorenz Stein!
Um auch noch zwei Autoren zu nennen, die sich im Hauptfach mit Soziologie beschäftigen, so stehen auch L. v. Wiese[3] und Eleutheropoulos[4] auf dem gleichen Standpunkt. Wir können uns wörtliche Zitate ersparen: es sind immer die genau gleichen Vorstellungen.
Nirgend wird das quantitative Problem auch nur gestreift, geschweige denn gestellt oder gar in Angriff genommen. Die Ungleichheit der Anlage wird konstatiert, die Ungleichheit der Wirtschafts- und Klassenlage daneben gestellt: erledigt! Dabei beruft sich sogar ein so scharfer Kopf und besonnener Gelehrter wie Jellinek auf die Abhängigkeitsverhältnisse in wissenschaftlichen Schulen, geselligen Vereinen (!) usw., als ob jemals aus solchen Verhältnissen Klassen sich bilden könnten.
Wir werden bei dem Thema: Führerschaft und Herrschaft noch einmal darauf zurückzukommen haben.
Vorläufig wollen wir es uns genügen lassen, das quantitative Problem der Proportionalität zwischen Begabung und Wirtschaftslage scharf gestellt zu haben. Das genügt für unsere Beweiszwecke bereits vollkommen : denn nichts kann gewisser sein, als daß aus einer Ungleichheit von völlig unbestimmter Größe eine Verschiedenheit der wirtschaftlichen Lage von bestimmter Größe nicht abgeleitet werden kann. Auf diese Weise lassen sich allenfalls Vermutungen, aber keine wichtigen Schlüsse begründen.
[1] Soziologie, S. 235.
[2] Grundfragen der Soziologie S. 81.
[3] Allgemeine Soziologie S. 219/20.
[4] Soziologie S. 68.
[219]
Nun läßt sich aber die Größe der wirtschaftlichen Begabung und der Begabung überhaupt nicht messen, außer allenfalls, bei grober Akkordarbeit, an der Masse der Leistung. Wir haben kein Mittel zu solcher Messung und kaum Aussicht, eines zu finden. Galton hat es versucht [1], und Niceforo hat sich ihm zum Teil angeschlossen[2]. Das Ergebnis war sehr wenig befriedigend.
Galton vermutet, daß auch im Geistigen das schon von Quételet[3] im Körperlichen und Moralischen nachgewiesene Gesetz der „binomialen Kurve“, auch genannt das „Gesetz der großen Zahlen“ oder „das Gesetz der zufälligen Ursachen“ herrsche. Wenn das der Fall ist, dann steht die Sache unserer Gegner schlecht. Denn der größte Erwachsene auf Erden ist weniger als doppelt so groß wie der kleinste Erwachsene, wenn man nicht geradezu Monstrositäten von krankhaftem Riesen- und Zwergenwuchs heranzieht; und selbst dann ist das äußerste Verhältnis nicht höher als 1:4, vielleicht 1:5. (Der größte Mann der Erde hatte unserer Erinnerung nach eine Körperlänge von 254 Zentimetern.) Die Verschiedenheiten der Körperkraft und der Geschicklichkeit sind, soweit es sich um das handelt, was hier in Frage steht, die Anlage, gewiß nicht wesentlich größer: sie mögen beide, namentlich die letztgenannte, durch Übung, durch systematisches Training, noch etwas größer werden: aber was bedeuten diese Verschiedenheiten der Anlage gegenüber den ungeheuren Unterschieden des Besitzes und Ranges, von denen uns Geschichte und Beobachtung der Gegenwart berichten ? ! Ein Morgan hat das vieltausendfache Vermögen und Einkommen und die entsprechend größere soziale Macht als ein Arbeiter und sogar als ein hoher Beamter.
Die Ableitung der Klassenverschiedenheiten aus der Verschiedenheit der persönlichen Begabung setzt also voraus, daß das Gesetz der großen Zahlen, das für die körperliche und sogar, wie die Moralstatistik zeigt, für die moralische Anlage absolut gilt, für den Komplex der wirtschaftlichen Begabung keine Geltung hat, obgleich in ihn sowohl körperliche Elemente (Nervenkraft, Ausdauer, Zähigkeit, Sinnesschärfe usw.) wie auch moralische Elemente (Aufmerksamkeit, Nüchternheit, Pünktlichkeit usw.) eingehen. Die intellektuelle Begabung allein müßte also in einem Masse variieren, für das sonst ini Menschlichen jedes Beispiel fehlt. Die Menschen der Oberklasse müßten sich in dieser Beziehung zu denen der Unterklasse verhalten nicht nur wie Gulliver, sondern wie die Riesen von Brobdingnag zu den Liliputanern. Die Vorstellung, um uns milde auszudrücken, ist sehr unwahrscheinlich.
Die besten Köpfe, die sich mit der Frage beschäftigt haben, freilich
[1] Genie und Vererbung. Vgl. S. S. I, S. 763ff.
[2] Anthropologie der nichtbesitzenden Klassen.
[3] Zur Naturgeschichte der Gesellschaft, Dtsch. v. Adler, vgl. S. S. I, S. 735ff.
[220]
noch vor der Zeit, in der es galt, die faktischen Vorrechte der Kapitalisten zu rechtfertigen, haben diese groteske Vorstellung a limine abgelehnt, Am eingehendsten Hobbes. Er schreibt im Leviathan (Kap. XIII, erste Sätze) : „Die Natur hat die Menschen wie an Körper- so auch an Geistesgaben so gleich erschaffen, daß, alles in allem genommen, trotz noch so großer Vorzüge, durch die sich einige vor anderen auszeichnen mögen, keine Verschiedenheit von dem Ausmaße besteht, daß einer sich einen Vorteil versprechen könnte, auf den sich ein anderer keine Hoffnung machen dürfte. Was die Körperkraft anlangt, so wird man so leicht keinen Menschen finden, der zu dumm wäre, um den Stärksten zu töten, sei es durch List, sei es durch eine Verbindung mit anderen, die von der gleichen Gefahr bedroht sind.“ (Diese Stelle ist immer falsch verstanden worden; wir kommen sofort darauf zurück. Hier handelt es sich ja nicht um körperliche, sondern um geistige Gaben, zu denen Hobbes jetzt übergeht) : „Was aber die angeborenen geistigen Fähigkeiten anbelangt, so finde ich hier eine noch größere Gleichheit. Denn Klugheit stammt ganz aus Erfahrung, und diese gibt die Natur jedem in gleicher Zeit, der sich gleichmäßig darum bemüht. Was diese Tatsache zweifelhaft erscheinen läßt, ist nichts anderes als die Meinung derjenigen, die sich mehr als recht ist selbst einschätzen. Denn fast jeder glaubt, daß er viel weiser sei als irgendeiner aus der Menge, einige wenige ausgenommen, die er ihres Rufes halber oder weil sie mit ihm übereinstimmen, zu bewundern pflegt. Das nämlich ist des Menschen Natur, daß er wohl eingesteht, dieser oder jener sei beredter oder gelehrter als er selbst, aber niemals zugeben wird, daß jemand klüger sei. Denn den eigenen Geist sieht man immer aus der Nähe, den fremden aber immer aus der Ferne. Und so ist der beste bisher erreichte Beweis für die Gleichheit der geistigen Begabung, daß jeder mit der seinen zufrieden ist.“ Und er fügt dieser mit entzückender Ironie geladenen Auslassung im 15. Kapitel eine andere ernstere hinzu, in der er sagt: „Wenn also die Natur die Menschen gleich gemacht hat, so ist die Gleichheit anzuerkennen. Wenn sie sie aber ungleich gemacht hat, so bleibt doch bestehen, daß jeder sich dem anderen für gleich achtet, und darum kann der Frieden nur unter der Bedingung der Gleichheit gehalten werden. Also ist die Gleichheit anzunehmen, und das neunte Naturgesetz lautet, daß die Menschen gleich sind. Die Verletzung dieses Gesetzes heißt: Übermut (Superbia)“ [1].
Adam Smith nimmt bereits im Naturzustande eine gewisse Ungleichheit der Begabung an, die zur Arbeitsteilung und sogar zu einer gewissen Verschiedenheit des Einkommens und der Lebenshaltung führen könne. (Von hier ist die mehrfach erwähnte, unglaublich törichte
[1] Locke (a. a. O. § 54) spricht nur von der rechtlichen Gleichheit.
[221]
Ableitung ausgegangen, durch die Ricardo den Kapitalprofit rechtfertigen wollte.) Wie gering aber nach Smith diese Unterschiede zu bewerten sind, geht aus der bekannten Stelle seiner „Wealth of nations“ hervor, in der er sagt: „By nature a philosopher is not in genius and disposition half so different from a street porter, as a mastiff is from a grey-hound.“
Demgegenüber läßt der Physiokrat Mercier de la Rivière die Ungleichheit der Lebenslage entstehen vorzugsweise aus den „nuances prodigieuses qui se trouvent entre les facultés nécessaires pour acquérir“.
Wie ist diese auffällige Meinung entstanden, die von da an die Ökonomik und alles, was von ihr abhängig ist, beherrscht?
Nun, das ist sehr einfach : durch die Setzung einer qualitas occulta, durch einen typischen Kreisschluß, der von den ökonomischen Klassenverschiedenheiten ausgeht, um triumphierend zu ihnen zurückzuführen. Man findet als Ausgangsdatum gewisse sehr grobe Verschiedenheiten der Wirtschaftslage, lehnt dogmatisch jede andere Erklärungs- möglichkeit als die aus der Verschiedenheit der Begabung a limine ab, nimmt also an, daß die Verschiedenheit der Talente der der sozialen Lage proportional, d. h. enorm groß ist — und deduziert jetzt wieder aus der enorm großen Verschiedenheit der Begabung die gleich große der sozialen Lage[2]. Es ist genau der gleiche Kreisschluß, der auch im Historischen zu der „Große-Männer-Theorie“ geführt hat[3]. Zuerst leitet man aus dem Erfolg das „Genie“[4], und dann aus dem Genie den Erfolg ab. Wem es Freude macht, auf solchen Gedankenkaroussells im Kreise fahrend sein Steckenpferd zu reiten, den können wir nicht hindern.
ß) Die kritische Dichtigkeit der Bevölkerung.
Wir sind in der glücklichen Lage, unseren Gegnern selbst hier so weit wie nur möglich entgegenzukommen. Wir können per inconcessum
[1] Zit. bei Hasbach, S. 172.
[2] Wir müssen hier an den alten Studentenscherz denken, wie man einen Walfisch fängt. Man braucht nichts dazu, als eine Jagdtasche und ein Opernglas. Zuerst betrachtet man den Walfisch durch das umgekehrte Glas, dann ist er klein; dann die Jagdtasche durch die oberen Gläser, und sie ist groß. Und dann — hat man nichts weiter zu tun, als den kleinen Walfisch in die große Jagdtasche zu stecken.
[3] S. S. I, S. 781.
[4] Die bürgerliche Theorie hat in den letzten Jahrzehnten damit begonnen, die „Hero-worship“ der Historik auf die Ökonomik zu übertragen (S. S. I, S. 760). Demgegenüber wird es gut sein, daran zu erinnern, wie der Begriff des Genie entstanden ist. Die kanonische Geschichtsphilosophie faßte die geschichtlichen Führerpersönlichkeiten als Instrumente Gottes auf, der ihnen seinen Genius einhauchte. Als die Aufklärung „die Geschichte säkularisierte“, verschwand Gott, aber sein Genius blieb als rätselhafte persönliche Eigenschaft (vgl. S. S. I, S. 753ff.).
[222]
zugeben, daß ein Mensch vieltausendmal so fleißig, nüchtern, intelligent und umsichtig sein kann als ein anderer, sogar als der Durchschnitt, und können dennoch das Gesetz der ursprünglichen Akkumulation vollkommen widerlegen: es steht in flagrantem Widerspruch mit seinen eigenen Prämissen.
Unsere Übersicht der aufklärerischen Variante hat uns gezeigt, daß die einschneidende, klassenbildende Differenzierung erst von dem Augenblicke an beginnen soll, wo eine bestimmte, „kritische“ Dichtigkeit der Bevölkerung erreicht ist. Und zwar ist dieser Augenblick von Rousseau, der hier nur präziser ausdrückt, was alle seine Vorgänger gemeint haben, völlig exakt bestimmt worden als der Zeitpunkt, „in dem die Hufen, sich sämtlich berührend, das ganze Land bedecken“. Vorher kann offenbar eine irgend gröbere, die Generation überdauernde Verschiedenheit der Schichtung, d. h. kann Klassenbildung nicht eintreten. Denn, so sagt Turgot: „Wo jeder arbeitsame Mann noch so viel Boden fand, als er wollte, konnte niemand sich bewogen fühlen, für andere zu arbeiten“ [1]. Wo es aber keine Arbeiterklasse gibt, da ist ebenso offenbar die Bildung großer Vermögen unmöglich, vor allem nicht die Bildung großen Grundbesitzes, der die Verfügung über eine entsprechende Schaar von Arbeitern voraussetzt, der ohne diese Voraussetzung unmöglich gebildet, ja nicht einmal gewollt werden kann. Und der große Grundbesitz hat ja mit Ausnahme ganz kurzer Perioden die Geschichte der Menschheit und namentlich die Klassenbildung beherrscht. Wo keine Arbeiter zur Verfügung stehen, „muß jeder Eigentümer sein Feld selbst bearbeiten oder es ganz aufgeben“, sagt Turgot weiter[2].
Über diesen Gegenstand herrscht die vollkommenste Übereinstimmung zwischen bürgerlichen und sozialistischen Theoretikern. Auch Karl Marx trägt expressis verbis die Lehre in dieser Form vor. In „freien Kolonien“, sagt er, wo noch so viel Land verfügbar ist, daß „jeder Ansiedler einen Teil davon in sein Privat-Eigentum und individuelles Produktionsmittel verwandeln kann, ohne den späteren Pionier an derselben Operation zu verhindern“[3], da ist die Bildung von Klassen unmöglich; da kann sich deshalb auch kein „Kapital“ bilden. Der Zusammenhang ist ja auch in der Tat durchaus klar und unbestreitbar.
Wir dürfen also hier vom Kapital und seiner klassenbildenden
[1] Réflexions sur la production et distribution des richesses, § 10.
[2] Nach dem dreißigjährigen Kriege, als „mit Eintritt ruhigerer Zeiten in den Ostseeländern die Grundherrn ihre verödeten Ländereien wieder in Betrieb zu setzen unternahmen, fehlte es an Arbeitskräften; und da, wie Mevius sich ausdrückt, ihre Güter und Ackerhöfe des edlen unentbehrlichen Kleinods der Leute nicht entraten konnten, so begann ein eifriges Suchen und Verfolgen der vertriebenen oder entwichenen Bauern“ (Stintzing, a. a. O. II S. 133).
[3] Marx, Kapital, S. 730ff.
[223]
Kraft absehen, weil erstens die Klassen, deren Entstehung abzuleiten ist, existierten, Jahrtausende bevor von Geld und Kapital, sogar von Handel und Gewerbe in irgend größerem Maße die Rede war; — und zweitens, weil die größten Autoritäten aus beiden Lagern der wissenschaftlichen Ökonomik uns sagen, daß die Bildung des Kapitals an die „Vollbesetzung des Bodens“ gebunden ist.
Da es Klassen schon seit Jahrtausenden gibt, muß also die Vollbesetzung des Bodens bereits seit Jahrtausenden, in der Tat in prähistorischer Zeit, eingetreten sein. So schließt, wieder triumphierend, die naturrechtliche Variante des Gesetzes der ursprünglichen Akkumulation.
Und wieder ist es doch nur ein Scheinbeweis, wieder nichts als ein Kreisschluß, genau der gleiche, den wir soeben in der Frage der angeborenen Ungleichheit nachgewiesen haben. Man geht aus von dem Vorhandensein einer Arbeiterklasse, erkennt deutlich, daß eine solche nicht entstehen kann, ehe nicht aller Boden besetzt ist, lehnt wieder, dogmatisch, jede andere Erklärung dieser Vollbesetzung ab als diejenige, die in einer Gesellschaft freier und gleicher Menschen naturrechtlich möglich ist, ist also gezwungen, anzunehmen, daß eine kleine Hufe sich an die andere legte, „bis sie sich berührten und das ganze Land be deckten“ — und kann nun wieder auf dem Steckenpferde Karussell reiten.
In Wirklichkeit wissen wir nun aber nicht nur, daß das große Grundeigentum auf ganz andere Weise, nämlich durch Sperrung des ganzen vorhandenen Bodens gegen die Ansiedlungsbedürftigen, entstanden ist, sondern wir können es auch deduktiv beweisen.
Die Erde im ganzen und jedes einzelne Land oder Staatsgebiet im besonderen hat nämlich noch heute so viel Ackerland, daß unter der Voraussetzung der naturrechtlichen Variante der Kinderfibel auch heut noch viel mehr Land vorhanden wäre, als gebraucht wird ; — oder, mit anderen Worten, daß der Zeitpunkt, wo die Hufen, sich berührend, das ganze Land bedecken würden, in sehr weiter Zukunft vor uns liegen würde. Wir haben den Gegenstand mehrfach, zuletzt in der Grundlegung zu unserer „Theorie der reinen und politischen Ökonomie“ (S. 2i4ff.) auf das ausführlichste dargestellt. Hier nur eine kurze Erinnerung :
Der Bedarf an Ackerland ist unter primitiven Verhältnissen bestimmt: nach unten hin durch den Nahrungsbedarf eines bäuerlichen Haushalts, das Vieh eingeschlossen, nach oben hin durch die Arbeitslust und -kraft des Bauern. Kraft und Geschicklichkeit der einzelnen sind sicherlich nicht in sehr hohem Grade verschieden, trotz Fichte, der sich hier ganz ausschweifende Vorstellungen gemacht haben muß, wie die oben (S. 114) angeführte Stelle beweist, wo er starke Unterschiede der
[224]
Hufengröße durch die Pflugarbeit eines einzigen Tages für möglich hält. Aber, selbst wenn wir uns, wie wir versprachen, per inconcessum auf diese unmögliche Voraussetzung stellen, bleibt die Obergrenze der Hufe dennoch auf ein sehr geringes Maß beschränkt, weil unter primitiven Verhältnissen, wo es der Voraussetzung nach noch keine Städte und keinen Getreidehandel gibt, gerade der intelligente Mann sich hüten wird, mehr Land zu bebauen, als sein Haushalt braucht: er wird seine freie Zeit für lohnendere Dinge verwenden, wie uns Locke zeigte.
So ist denn die Hufe der primitiven Zeiten überall in der Welt recht klein, im Durchschnitt etwa 7—8 Hektar, etwa ein Hektar pro Kopf [1]. Jedes rationelle Motiv, mehr zu okkupieren, fehlt, und ebenso fehlt nach der naturrechtlichen Auffassung auch jede rechtliche Möglichkeit dazu. Die spekulative Bodensperre, die manche für möglich halten, ist unter den hier angenommenen Bedingungen nicht nur sinnlos, sondern auch ein Verstoß gegen die „natürliche Gerechtigkeit“. Hobbes schreibt: „Was ich die natürlichen Gesetze nenne, sind nur gewisse Folgerungen, welche die Vernunft erkennt, und die sich auf Handlungen und Unterlassungen beziehen“[2]. Aus ihnen „ergibt sich das neunte natürliche Gesetz, daß ein jeder die Rechte, welche er für sich verlangt, auch jedem anderen zugestehe... . Dieses Gesetz verbietet, dem einen mehr oder weniger als dem anderen zu geben“[3].
Quesnay schreibt: „On sera bien convaincu que le droit naturel de chaque homme se réduit dans la réalité à la portion qu'il peut se procurer par son travail“[4].
Alle Naturrechtslehrer haben derartig gedacht und mußten offenbar derart denken[5]. Und auch hier wieder können wir feststellen, daß die Wirklichkeit des „Naturzustandes“ der Konstruktion vollkommen entspricht: bei allen primitiven Völkerschaften ist das Recht auf den Boden streng an die Arbeit geknüpft, nicht nur so, daß niemand Boden beanspruchen darf, den er nicht bebaut hat, sondern sogar weitergehend so, daß aller früher bebaute, aber eine kurze Zeit, etwa im Durchschnitt
[1] Wir haben S. S. III, S. 226 eine Anzahl von Ziffern aus aller Welt zusammengestellt. Hier einige seitdem notierte. Nach Brodnitz (engl. Wirtsch.-Gesch. S. 30) war seit Ines die englische Hufe durchschnittlich 30 Acres oder 10 ha groß. Die Kötterstellen meistens 2—5 Morgen, selten 10—12, zuweilen unter 1 Morgen (63). Pettersen (Die Theorie des Teilbaus usw. Ldw. Jahrbücher XIX, S. 601) berechnet nach alten englischea Quellen die Größe der Ernteflache für Brotgetreide mit 10 Acres für die siebenköpfige Familie; S. 610 rechnet er für moderne Verhältnisse auf Mittelboden 8 ha, auf Weizenboden 6 ha (624), für Fruchtwechselwirtschaft noch weniger (625). — Nach Morison (The economic transition in India, S. 39) sind in Nordindien die Pachtungen im allgemeinen 4—-5 Acres groß.
[2] Vom Menschen und vom Bürger, S. 118 vgl. S. 91.
[3] Vom Menschen und vom Bürger, S. 110 vgl. Leviathan cap. XV (a. a. O. S. 77).
[4] Oeuvres S. 366.
[5] Sehr ausführlich Rousseau, Contrat social I 9.
[225]
zwei Jahre, liegen gebliebene Boden wieder der Allgemeinheit verfällt, d. h. von jedem okkupiert werden darf, der ihn bebaut: das Recht der „Rückennutzung“. Ein Versuch spekulativer Sperrung, wie ihn sogar ein Kant für möglich hielt, ist also ausgeschlossen ; er würde, theoretisch, nach dem Naturrecht, und praktisch, nach dem Recht der primitiven Gruppen, von der Gesamtheit als Rechtsbruch, als das Unternehmen, die Gleichheit umzustürzen, abgewehrt werden, — wenn sich ein Mensch fände, töricht genug, eine derartige Spekulation zu unternehmen, die auf Jahrhunderte hinaus auch seinen entferntesten Nachkommen keinen Vorteil bringen könnte : es sei denn, daß er es etwa fertig bekäme, dasganze Land für sich zu okkupieren; und das hieße nicht nur: das Recht zu beanspruchen, sondern auch seine Durchführung zu überwachen und im Notfall zu erzwingen — was beides offenbar unmöglich ist. Es kann allenfalls ein König ganze Erdteile für sein Staatsgebiet erklären, was ja immer wieder geschehen ist, seit Nunnez Balbao im Namen der Kastilianischen Krone ganz Südamerika in Besitz nahm, kaum daß er an die Küste gelangt war: aber wie ein Privatmann, der der Voraussetzung nach für seine Ernährung zu arbeiten hat, die Zeit — von der Kraft abgesehen — finden sollte, gewaltige Landstriche dauernd daraufhin zu überwachen, ob sich nicht irgendwo im Urwalde ein Ansiedler ohne seine Erlaubnis seßhaft macht: das ist eines der großen Geheimnisse, die uns die Kinderfibel aufgibt.
Es bleibt also dabei, was Locke [1] und ihm folgend mit fast den gleichen Worten Rousseau[2] sagte: „Dasselbe Gesetz der Natur, das uns ... Eigentum gibt, begrenzt es auch: so viel jemand zu irgendwelchem Nutzen für sein Leben verwenden kann, ehe es verdirbt, so viel darf er durch seine Arbeit als Eigentum aussondern — was darüber hinausgeht, ist mehr als sein Anteil und gehört den anderen“ — und zwar nicht nur nach dem natürlichen Recht, sondern auch nach der naturgesetzlichen Notwendigkeit: es ist nicht nur verboten, mehr zu nehmen, sondern es ist sogar unmöglich.
Locke sowohl wie Rousseau ziehen die Konsequenz ausdrücklich auf das Grundeigentum, soweit sie rechtlich ist ; soweit sie nur praktisch ist, können sie sie nicht ziehen, weil sie durch das Pseudogesetz geblendet sind. Und doch sagt Locke in einer Minute der Erleuchtung: „Dieses Maß beschränkte in den ersten Zeitaltern der Welt den Besitz jedes Menschen auf eine sehr bescheidene Grenze... . Und heute noch, so voll auch die Welt erscheinen mag, könnte man ohne Nachteil jedermann Eigentum in diesem Umfange zuerkennen“[3].
[1] Vgl. S. S. III, S. 224.
[2] Contrat social, I. 9.
[3] Wir haben (S. S. III, S. 224) Locke als den ersten Denker der Neuzeit bezeichnet, der unser „Divisionsexempel“ angestellt habe. Aber ihm ist schon der große Ökonomist und Statistiker Petty vorangegangen, gleichfalls, wie Charles Hall, der ihm folgte, ein Arzt. Er schreibt in „Verbum sapienti“ (Econ. Writings I, S. 118): „Eskommen in England mehr als vier Acres Pflug-, Wiesen- und Weideland auf jede Seele, von solcher Ertragsfähigkeit, daß die Arbeit eines Mannes für zehn die Lebensnotdurft davon erarbeiten kann. Es liegt also nur an dem Mangel an Ordnung (Discipline), daß es in England Armut gibt, und daß deswegen die Einen Hunger leiden, und Andere sich hängen lassen müssen“.
[226]
Er konnte das wissen: er hatte für die riesenhafte Konzession, die Karl II. acht adligen Engländern im Süden Nordamerikas verliehen hatte, die Verfassung ausgearbeitet [1] ; er konnte sich also nicht wohl verhehlen, wie Großgrundeigentum entsteht oder doch entstehen kann.
Damit haben wir das Ausmaß der Urhufe mit ausreichender Genauigkeit bestimmt, auf etwa ein ha auf den Kopf, und können nun, indem wir mit dieser Zahl in die vorhandene Ackerfläche dividieren, berechnen, wieviele Menschen auf der Erde siedeln konnten, ehe jener Augenblick der kritischen Dichtigkeit erreicht war, von dem an die Differenzierung der Klassen beginnen konnte.
Dabei stellt sich nun die erstaunliche Tatsache heraus, daß auf der Erde, unter der selbstverständlich unmöglichen, für uns ungünstigsten Voraussetzung, daß alle Menschen Bauern wären: daß es keine Stadt, keinen einzigen Jäger oder Fischer oder Bergmann usw. gäbe, für vier und eine halbe Milliarde Menschen Ackerland vorhanden wäre. Nun aber beträgt die Erdbevölkerung heute, nach der Periode des gewaltigsten Wachstums, das sie bisher erlebt hat, höchstens ein Drittel dieser Zahl[2]: es müßten also, wenn die Naturrechtler richtig gerechnet haben, noch viele Jahrhunderte vergehen, ehe die Bildung der Klassen auch nur beginnen könnte. Das gleiche ergibt jede Durchrechnung für ein zivilisiertes Land. Wir haben sie für Deutschland durchgeführt (a. a. O S. 228 ff.) und wollen hier nur wiederholen, daß die gesamte landwirtschaftliche Bevölkerung des Reiches vor dem Frieden von Versailles weniger als 17 Millionen Köpfe betrug, alle landlosen Arbeiter und alle Angehörigen miteingerechnet, die agrarische Nutzfläche aber, ohne Forsten und Unland, rund 34 Millionen ha: das ist fast genau das Doppelte der Nutzfläche, die nach der Meinung aller agrar- wissenschaftlichen Autoritäten und nach den Ausweisen der Statistik diese Menge von Landwirten brauchen würden, um in anständig-mittelständischer Lage nach heutigen Ansprüchen zu leben; dazu bedarf es nämlich immer noch etwa durchschnittlich eines ha pro Kopf, 5—7 ha für die bäuerliche Familie. Wenn die Ansprüche an die Lebenshaltung so viel höher geworden sind, so ist gleichzeitig auch der Ernteertrag der Flächeneinheit mindestens entsprechend gewachsen, und die
[1] Vgl. S. S. III, S. 547 Anm. 1. Vgl. Bluntschli, a. a. O. S. 198.
[2] Locke schätzte: die Hälfte (oben S. 68).
[227]
Nutzfläche ist bei gleichem Ausmaß der Hufe um das Doppelte bis um ein Drittel größer, weil die Brache fortgefallen ist.
Da nun aber die Entstehung der Klassen nicht vor uns, sondern in ferner Vergangenheit hinter uns liegt; da wir die Klassenscheidung bei allen Völkern der Geschichte schon in einer Periode antreffen, wo der Vorrat an Land im Verhältnis zu der noch geringen Zahl der Bevölkerung noch viel größer ist: so ist damit der Beweis geführt, daß die Rechnung der Naturrechtler falsch gewesen ist. Die Vollbesetzung des gesamten Grund und Bodens der Staatenwelt kann unmöglich aus rein naturrechtlichen Beziehungen zwischen Gleichen und Freien entstanden sein: und so zwingt sich der Schluß schon per exclusionem auf, daß beides, die Vollbesetzung und die Klassenscheidung, aus nicht-naturrechtlichen Beziehungen, d. h. durch Einwirkung außerökonomischer Gewalt entstanden sein müssen. Tertium non datur.
Wir sind aber auch hier wieder in der glücklichen Lage, unserem Gegner bis zur nachgewiesenen Unmöglichkeit entgegenzukommen. Wir wollen wieder per inconcessum unterstellen, die Grundvoraussetzung sei wahr; an irgendeinem hinter uns liegenden Zeitpunkt sei das Land irgendeiner Gesellschaft in der Tat derart besetzt gewesen, daß eine Hufe von 30 Morgen die andere berührte. Selbst dann, so unternehmen wir zu beweisen, hätte es in irgend absehbarer Zeit dennoch nicht zu der Scheidung des Volkes in Klassen kommen können.
Es handelt sich bei dem hier angeschnittenen Problem, das wir nur aus dem Grunde noch berühren, weil seine Lösung zugleich gewisse Ängste für die Zukunft bannen kann, um das sogenannte Bevölkerungsgesetz, das, wie wir wiederholt feststellen konnten, gar nichts anderes ist als das Gesetz der ursprünglichen Akkumulation, das nur, statt auf die geschichtliche Vergangenheit, auf die Zukunft angewendet worden ist. Derart maskiert, dient es nun sehr oft zu seinem eigenen Beweise : eine etwas feinere Art des Kreisschlusses! Das Verhältnis erinnert an gewisse scherzhafte Photographien, auf denen die gleiche Person in verschiedenen Anzügen und Stellungen mit sich selbst irgendwelche Handlung vorzunehmen scheint, indem z. B. die eine, als nüchtern dargestellte Figur die andere, als angeheitert dargestellte, stützt.
Wir haben das Malthussche Gesetz mehrfach in großer Ausführlichkeit dargestellt und widerlegt [1] und haben nicht die Absicht, diese Beweisführung hier zu wiederholen. Wir betrachten die negative Seite als erledigt und wollen hier nur noch einmal die positive Gegenseite herausheben.
Das Problem stellt sich folgendermaßen: wird mit dem Wachstum der Bevölkerung auf gegebenem Lande die gesellschaftliche Kraft
[1] S. S. III, S. 1034—1079, S. S. I, S. 820ff.
[228]
zur Überwindung der Widerstände der Natur größer oder geringer? Oder, anders ausgedrückt: wächst der Widerstand, den die Natur der Versorgung einer wachsenden Menschenzahl von beschränkter Fläche entgegenstellt, schneller oder langsamer als die Kraft der gesellschaftlichen Kooperation [1] ?
Die Naturrechtler standen sämtlich auf dem ersten Standpunkt, wie wir in mehreren Zitaten — wir erinnern namentlich an die kennzeichnenden Äußerungen Rousseaus über den Gegenstand — gezeigt haben. Die Neueren haben bis auf unsere Kritik, die zuerst 1900 in ausführlicher Weise erfolgte, so gut wie ohne Ausnahme sich an entscheidender Stelle auf Malthus berufen. Wir fügen den zahlreichen Belegen, die wir an anderer Stelle beigebracht haben, hier nur einen einzigen noch hinzu, herrührend von einem sehr einflußreichen Staatslehrer, der vermöge seiner persönlichen Gleichung jede Wendung des hier bekämpften Pseudogesetzes willig mitgegangen ist: Treitschke. Er schreibt: „Eine letzte Grenze findet sich auch hier, und die Schwierigkeit, einen Hausstand zu unterhalten, muß bei steigender Bevölkerung notwendig eine größere werden. Das ist die tiefe Wahrheit im Malthusschen Gesetz“[2].
Die Behauptung ist für alle Vergangenheit und für alle absehbare und praktisch belangreiche Zukunft falsch. Die kooperierende Kraft einer Gruppe wächst unter halbwegs gesunden politischen Verhältnissen, d. h. bei nicht übermäßigem Steuerdruck, bei nicht zu sehr zerstörenden Kriegen und bei einer nicht geradezu alle Quellströme der Intelligenz abdämmenden Kultur- und Schulpolitik immer stärker als die Widerstandskraft der Natur; oder, mit anderen Worten: statt daß mit wachsender Bevölkerung auf gegebener Fläche die der Natur abzugewinnenden Stoffe der Nahrung, Kleidung, Behausung usw., berechnet auf den Kopf, eine geringere Quote ergäben, wie man wohl annehmen möchte, wächst diese Quote beträchtlich stärker als die Bevölkerung. Da diese Behauptung für alle anderen Stoffe als die Nahrungsmittel fast allseitig zugegeben ist, können wir uns auf deren Betrachtung beschränken. Hier waltet das von dem deutschen Volkswirt Friedrich List
[1] Max Schmidt (ethnol. Volksw., S. 60/1) hat dieser Frage vom Standpunkt des Ethnographen aus seine Aufmerksamkeit zugewendet. Er kommt zu dem Ergebnis, daß Bevölkerungsdichtigkeit und Existenzmöglichkeit sich nicht, wie Malthus behauptete, umgekehrt, sondern direkt proportional verhalten: je mehr Menschen, um so mehr, je weniger, um so weniger Nahrung! Das dichtbevölkerte Peru der Inka gab seiner Bevölkerung reichliche Nahrung; „die geringen Reste, welche nach der spanischen Invasion übrig geblieben sind, fristen zurzeit trotz mannigfaltiger Berührungspunkte mit der europäischen Kultur nur noch ein kümmerliches Dasein“ (vgl. S. S. I, S. 1006ff. über Spanien usw.).
[2] Politik I, S. 231.
[229]
zuerst entdeckte [1], dann von dem Amerikaner Carey weiterentwickelte, von uns wieder aufgenommene und mit dem Handgriff eines eigenen Namens versehene „Gesetz der Kapazität“:
Wo die Bevölkerung sich auf gegebener Fläche verdichtet, wächst nach dem „Hauptgesetz der Beschaffung“[2] die Arbeitsteilung und -Vereinigung. Mit ihr wächst, das ist wenigstens für die industriellen Erzeugnisse unbestritten, die Ergiebigkeit der durchschnittlichen Leistung und damit das gesamte „Sozialprodukt“, d. h. der Reichtum der Gesellschaft, weil jedermann durchschnittlich mit besseren Werkzeugen und Methoden schafft und als Spezialist sich eine besonders wirksame Technik anerziehen kann.
Das gleiche gilt nun aber auch für den Landwirt einer sich verdichtenden Bevölkerung, freilich in geringerem Maße als für den Gewerbetreibenden. Denn in der Landwirtschaft besteht der in der Industrie nicht vorhandene Hemmschuh des „Gesetzes der sinkenden Erträge“, das in der Regel dahin mißverstanden wird (das war Malthus' Hauptfehler), daß es die Vermehrung der Nahrung pro Kopf unmöglich mache, während es nichts anderes aussagt, als daß die Vermehrung des agrarischen Erzeugnisses nicht in dem Tempo der Vermehrung des gewerblichen erfolgen kann. Aber die statistischen Zahlen zeigen in allen Ländern einigermaßen gesunder Verhältnisse, daß trotz jenes Gesetzes das agrarische Produkt nicht nur etwa pro Kopf des Landwirts, sondern sogar pro Kopf der Gesamtbevölkerung steigt, natürlich
[1] Man möchte fast sagen: wiederentdeckte. Denn der Hauptinhalt des Gesetzes findet sich bereits bei Locke, nur daß es eben nicht als ein für alle Stadien menschlicher Entwicklung gültiges Gesetz ausgesprochen ist; dazu war damals noch keine Veranlassung, da die Malthussche Theorie, gegen die List sein Gesetz entwickelte, noch unter dem Horizonte lag. Locke vergleicht den Naturzustand mit der Zivilisation und schreibt: „Wer durch seine Arbeit Land aneignet, vermindert nicht, sondern vermehrt den gemeinsamen Vorrat der Menschheit, denn die von einem Morgen eingehegten und bestellten Landes erzielten menschlichen Nahrungsmittel sind das Zehnfache der auf gleicher Fläche gleich reichen Bodens, der in Gemeinbesitz brach liegt, erzeugten. Und so darf man mit Recht sagen, daß der Mann, der von zehn Morgen eingezäunten Landes eine größere Menge von Lebensmitteln erntet als von hundert Morgen, die im unbebauten Zustande liegen, der Menschheit neunzig Morgen zum Geschenke macht... . Wahrscheinlich ist übrigens das Verhältnis nicht wie 10:1, sondern viel näher zu 100:1“ (a. a. O. § 37). Dieser Wortlaut entspricht der Formel, mit der ich zuerst das Gesetz der Kapazität ausdrückte: das Land wächst immer stärker als die Bevölkerung (vgl. S. S. I, S. 835). Im übrigen muß darauf aufmerksam gemacht werden, daß auch hier die großbürgerliche Einstellung sich bemerklich macht : Locke liefert mit seiner Darstellung seinen besitzenden Landsleuten die Argumente für die, durch die „Einhegungen“ des Gemeindelandes (inclosures of commons), bezweckte, Beraubung der Kleinbesitzer und ihre Verwandlung in eine Klasse abhängiger Arbeiter. (Vgl. Hasbach, „Die englischen Landarbeiter in den letzten 100 Jahren und die Einhegungen“ und S. S. III, S. 524.)
[2] S. S. III, S. 306/7.
[230]
nicht über die Grenze hinaus, die durch den Anspruch des Landwirts auf ausreichende Rentabilität notwendig gezogen ist [1].
Die steigende Arbeitsteilung stellt nämlich auch dem durchschnittlichen Landwirte bessere Werkzeuge und Methoden zur Verfügung und entlastet ihn geradeso wie den Gewerbetreibenden von vielen Nebenbeschäftigungen. Die wichtigste Folge ist, daß zunächst das zugängliche Ackerland an Fläche ungeheuer viel stärker wächst als die Bevölkerung, und zwar, weil die verbesserten Werkzeuge und Methoden dem Siedler gestatten, Land in Angriff zu nehmen, das für die primitiven Werkzeuge und Methoden der ersten Zeit schlechthin unangreifbar war. Das ist „Careys Gesetz des Anbaus[2]“: zuerst hat er theoretisch deduziert und historisch nachgewiesen, daß der Anbau nicht, wie Ricardo und Malthus dozierten, vom besten zu immer geringerem Boden fortschreite, weil die Menschen zuerst den besten Boden auswählten, sondern umgekehrt vom geringsten zu immer fruchtbareren Böden. Denn die schwachen Werkzeuge der Anfangszeit können nur die leichten, wenig fruchtbaren Sandböden der waldlosen Abhänge bewältigen, und erst nach Ausbildung der stärkeren Werkzeuge der Folgezeit ist es möglich, die reichen Schwemmebenen der Stromtäler zu entsumpfen und vom Urwald zu entstocken. Hier besonders zeigt sich die Wahrheit unserer Behauptung, daß mit steigender Volksdichtigkeit der Mensch immer stärker, d. h. die Natur relativ immer schwächer wird.
Nun könnte man glauben, daß nach dem Zeitpunkt, wo diese Eroberung der guten Böden sich vollzogen habe, dennoch der Abstieg eintreten müsse, d. h. daß von da an die Angriffskraft des kooperierenden Menschen relativ zum steigenden Widerstände der in ihren wesentlichen Kraftquellen ausgeschöpften Natur geringer werde. Aber auch das wäre eine falsche Annahme. Denn noch immer versteht es der Mensch, mit den immer weiter verbesserten Werkzeugen und Methoden dem Acker Erträge abzugewinnen, die stärker wachsen, als die Gesamtbevölkerung. Er holt aus der gleichen Fläche durch immer verbesserte Bearbeitung, Düngung, Ent- und Bewässerung immer mehr Urerzeugnisse, kann einen immer größeren Teil davon an die Gewerbetreibenden gegen Gewerbserzeugnisse vertauschen und erhält für jede Einheit seines Erzeugnisses immer größere Mengen des industriellen, weil nach dem Gesetz der sinkenden Erträge der Wert des Urprodukts, ausgedrückt im Werte des Gewerbsprodukts, immer größer werden muß.
Weil dem aber so ist, deshalb wird das Durchschnittsmaß der Ackerfläche, die der Landmann mit immer verbesserten Werkzeugen
[1] Wir sehen uns leider gezwungen, diese platte Selbstverständlichkeit hierherzusetzen , weil einige unserer Kritiker es fertig bekommen haben, aus dieser notwendigen Tatsache Argumente für den Malthusianismus abzuleiten. Vgl. S. S. III, S. 831ff.
[2] Vgl. S. S. I, S. 830ff.
[231]
immer intensiver, d. h. mit mehr Aufwand von Material und Arbeit zu bestellen hat, wenn er seinen Vorteil will, immer kleiner. Mit anderen Worten, der erforderliche Durchschnitt sinkt unter ein Hektar pro Kopf, und eine immer zahlreichere Landbevölkerung findet auf der unverändert großen Bodenfläche immer reicheres Auskommen.
Das ist das Gesetz der Bodenkapazität, das wir in der absichtlich paradox klingenden Formel ausgedrückt haben: Das Land wächst immer proportional seiner Bevölkerung“ [1].
Bis zu welcher Grenze der Dichtigkeit dieses Gesetz gelten wird, läßt sich nicht übersehen. Jedenfalls wirkt es seit Jahrhunderten und wird nach allem, was wir wissen, noch viele Jahrhunderte weiter wirken, selbst wenn, was äußerst unwahrscheinlich geworden ist, die Bevölkerung der Welt wieder anfangen sollte, im Tempo der ersten kapitalistischen Periode zu wachsen, die auch in dieser Beziehung eine Ausnahme darstellt. Was heute schon möglich ist, wo die Landwirtschaft eben die ersten schwachen Ansätze macht, in der Ausnützung der Elementar kraft der jüngeren Schwester Industrie nachzukommen, zeigen einige Beispiele, die wir an der zuletzt zitierten Stelle zusammengetragen haben. Auf Guernsey, auf durchschnittlich geringem Boden, leben 500, in einem von Simon (la cité chinoise) beschriebenen chinesischen Dorfe Uang-Mo-Khi gar 835 Menschen in vollem Behagen ihrer Zeit und Gruppe auf dem Quadratkilometer: die auf den Kopf erforderliche Fläche ist also hier auf ein Fünftel, im zweiten Falle sogar auf weniger als ein Achtel der in Deutschland jetzt noch als erforderlich betrachteten Fläche herabgedrückt worden. Und dabei handelt es sich in dem letzten Falle um eine technisch geradezu primitive sog. „Nachttopfkultur“. Was wird erst möglich werden, wenn der Benzolmotor den „Hafermotor“ ersetzt und die ungeheuren Kornbreiten, die heute mit Pferdefutter bestellt werden müssen, für Brotkorn frei macht; —wenn Beregnungsanlagen weithin die Ernten sichern, und der elektrische Dynamo die Zeit des Bauern, die heute durch Speicherarbeit sehr stark beansprucht wird, für die intensivste Kultur in Feld und Stall befreit.
Damit haben wir bewiesen, was wir behauptet haben, daß selbst unter der unmöglichen Voraussetzung unserer Gegnerin, alles Land sei auf naturrechtliche Weise okkupiert worden, dennoch die Scheidung der Klassen nicht hätte eintreten können.
Wir können uns jetzt zu der dritten und letzten Wurzel des Pseudo- gesetzes wenden.
[1] S. S. I, S. 838.
[232]
C. Die legitimistische Wurzel. (Herrschaft und Führerschaft.)
Unter dem Begriff „Legitimismus“ verstehen wir die Klassentheorie oder den Komplex von Klassentheorien der im vorbürgerlichen Staate herrschenden Stände. Auch er hat eine Wurzel in das Geflecht entsandt, gegen das, als das Grundaxiom aller heutigen bürgerlichen und proletarischen Soziologie, wie hier zu kämpfen haben.
Der Aristokrat hat für die „bürgerlichen Tugenden“ des Fleißes, der Sparsamkeit, Nüchternheit usw. wenig Bewunderung übrig. Ihm ist der „Pfennigkrämer“, der „Pfeffersack“, mitsamt seiner ganzen Psychologie herzlich widerwärtig. Wenn er es sich also nicht mehr leisten kann, wie der aufrichtige Junker Boulainvilliers, sich hohnlachend auf das Recht des Stärkeren zu berufen, weil leider die größere Stärke sich jetzt auf der Gegenseite findet, und das Argument sich gegen ihn selbst richten müßte; wenn er mithin darauf angewiesen ist, den Staat, seinen Staat, den er verloren hat wie die französischen Adligen nach 1789, oder gegen immer gefährlichere Angriffe zu schützen hat, wie die deutschen vor 1918, seinem Ursprung nach zu rechtfertigen : dann muß er sich schon nach anderen als jenen Händlertugenden umschauen. Und wenn's nicht der „Händler“ sein soll, so muß es eben der „Held“ sein.
Darum kommt alle legitimistische Theorie von dem Augenblick an, wo die Klasse um ihre Rechte zu kämpfen hat, darauf hinaus, die Herrschaft aus der Führerschaft abzuleiten.
Und zwar lassen sich hier zwei Arten unterscheiden, die übrigens durch keine allzu scharfen Kennzeichen voneinander geschieden sind: eine, die wir als die „naive“, und eine, die wir als die „motivierte“ Lehre bezeichnen wollen. Die erste sieht gar nicht, daß Führerschaft und Herrschaft zwei verschiedene Beziehungen zwischen Menschen bedeuten, und glaubt, ihren Beweis vollendet und den Staat als Herrschaft in seiner Begründung gerechtfertigt zu haben, wenn sie Führerschaft als notwendig und dementsprechend überall vorhanden aufzeigt. Mit dieser Abart hat Wissenschaft sich nicht zu beschäftigen.
Die zweite Art der legitimistischen Theorie versucht zum wenigsten, sich über den Mechanismus, der von der Führerschaft zur Herrschaft leitet, Gedanken zu machen. Eine Spielart davon stützt sich dabei auf die aufklärerisch-bürgerliche Variante, indem sie als axiomatisch feststehend betrachtet, daß die „angeborene Ungleichheit“ der Wirtschaftsbegabung die Klassenscheidung erzwingt. Wir betrachten sie als durch die Erörterungen der beiden vorangehenden Abschnitte als erledigt. Zu ihren Vertretern rechnen wir z. B. Jellinek in der schon oben angeführten Auslassung: „Staatliche Herrschaftsverhältnisse sind daher präpariert durch die sozialen Abhängigkeitsverhältnisse, die in jeder
[233]
sozialen Gruppe, nicht etwa nur in Beziehungen der wirtschaftlichen Klassen, statthaben... . Kein geselliger Verein, keine wissenschaftliche Schule, keine künstlerische Richtung, in denen es nicht Leitende und Abhängige gäbe“ [1]. Der Hinweis auf die wirtschaftlichen Klassen gibt so etwas wie eine Begründung; im übrigen wird, wie wir schon vordeutend sagten, hier ganz klar Führerschaft und Herrschaft identifiziert : wir haben also einen schwebenden Übergang zwischen naiver und motivierter Theorie.
Bevor wir die eigentliche motivierte Theorie ins Auge fassen, wollen wir unsererseits die beiden Begriffe scharf trennen. Herrschaft ist die Übersetzung des lateinischen Wortes „Imperium“, und zwar in der staatsrechtlichen Bedeutung des Wortes, wo es ungefähr mit Souveränetät[2] zusammenfällt. Der Begriff ist zum Zentrum der Staatsrechtslehre gemacht worden durch Gerber, der ihn „für das Staatsrecht mit solcher Energie umgestaltet, dann als staatsrechtlich ausschlaggebend so fest in Anspruch nimmt, daß damit allein schon eine neue Epoche des Staatsrechts begründet wäre, die demgemäß von 1865 zu datieren wäre. Gerber stabiliert diesen Herrschaftsbegriff gewissermaßen als Grund- und Eckstein, als rocher de bronze' des Staatsrechts.... Die damit begonnene neue Epoche setzt sich zur Aufgabe, ,die Staatsgewalt als eine alles durchdringende Herrschaft für Zwecke des Rechts und der Kultur zu entwickeln'. Damit ist der feste juristische Ausgangspunkt gefunden, um das moderne Staatsrecht im Sinne des modernen Staates aufzubauen“[3].
Diese Lehre richtet sich bewußt gegen die „genossenschaftlichen Theorien“ : gegen den Rechtsstaat Bährs, wohl auch schon ein wenig gegen Beseler, der der erste Begründer der Lehre von den, in den freien Genossenschaften sich auswirkenden, Recht bildenden, Kräften gewesen ist: das Institut, „welches so recht im Nationalcharakter seine Wurzel hat, und, eben deswegen von dem römischen Recht und den Romanisten auf alle Weise beengt, gehemmt und unterdrückt, doch stets bei den traurigsten Zuständen des Vaterlandes sein Leben fristete, in neuester Zeit aber, da sich in der Nation der Anfang einer freieren Erhebung zeigt, sofort seine volle Kraft wieder entwickelt und auf die großartigste Weise in das öffentliche und Privatleben eingreift“[4].
Diese Gedanken hat in bewundernswerter Weise der Beseler- schüler Otto Gierke weitergeführt, in schroffer Ablehnung der Gerber-
[1] Allg. Staatslehre, S. 91/2. Auch der scharfsinnige Kelsen begeht diese Verwirrung. (Soziol. u. jur. Staatsbegriff S. 18).
[2] Bodin übersetzt freilich Souveränetät mit Majestas, a. a. O. S. 85 (Lib. I cap. 8) und definiert sie als „puissance absolue“ (S. 89).
[3] Landsberg, a. a. O. S. 831. Im Orig. nichts gesperrt.
[4] Landsberg, a. a. O. S. 514·
[234]
sehen Einseitigkeiten [1]. Von ihm stammt die heute überall gebrauchte Entgegensetzung des Begriffspaares Herrschaft und Genossenschaft.
Völlig hat auch dieser große Kopf den Gegensatz nicht ausschöpfen können. Ihm fehlte noch die Einsicht in die Entstehung des Staates, die erst die soziologische Staatsidee geben kann, fehlte vor allem die Erkenntnis davon, daß das Gesetz der ursprünglichen Akkumulation nichts besseres als eine Klassenfiktion ist. Für ihn gehörte der Begriff der Herrschaft, die immer mit Klassenscheidung und, sagen wir milde, mit groben Unterschieden der wirtschaftlichen Lage verbunden ist, noch untrennbar zum Begriff der Ordnung, des Rechts, der Regierung. Erst die Erkenntnis, die die neue Staatsauffassung bedeutet, kann der Jurisprudenz die neue Grundlage ihres gesamten Aufbaus bescheren: die Erkenntnis, daß es zwei ganz verschiedene Quellen des Rechts gibt, von denen die eine in der „Gemeinschaft“, der freien Genossenschaft, entspringt, die andere in der zur Macht gewordenen Gewalt, d. h. im geschichtlichen Klassenstaate. Jenes ist Genossenschaftsrecht, dieses Herrschaftsrecht; und damit erst erhält das Begriffspaar seinen vollen weltgeschichtlichen und rechtsphilosophischen Inhalt[2]. Hier, so scheint es uns, ist eine wirkliche Synthese geglückt zwischen dem unverlierbaren Kern des alten dogmatischen Naturrechts und der romantischen Rechtsauffassung, die das Recht als die Blüte und Frucht eines Volkstums auffaßte: wie wir denn überhaupt die Soziologie zu begreifen haben als die Wissenschaft, die von dem „irrationalistischen“ Ausgangspunkt der Romantik: „Nature is wisdom without reflexion“ mit rationalistischen Mitteln, im „Selbstvertrauen der Vernunft“, ihren Weg zur Wahrheit sucht[3].
Wir geben nach diesen dogmengeschichtlichen Andeutungen einen kurzen Auszug aus den Ausführungen, die wir dem Gegenstande in unserer allgemeinen Soziologie (S. 367ff.) gewidmet haben.
Herrschaft ist oft, nicht immer, mit Führerschaft verknüpft, aber Führerschaft kann auch ohne Herrschaft bestehen. Sie ist ein neutraler Begriff: sie kann sich ebensogut mit Genossenschaft wie mit Herrschaft verbinden.
Herrschaft bedeutet eine Dauer bezieh ung. Das vor allem hat
[1] Landsberg, a. a. O. S. 912. Vgl. zu Gierke, Jellinek a. a. O., S. 57.
[2] Ich habe diese Gedanken, nach denen mein „Großgrundeigentum und soziale Frage“ (zuerst 1898) disponiert ist, in dessen Schlußbetrachtung: „Geschichtsphilosophische Aphorismen“ bereits scharf genug dargestellt. Aber, wie die Wirtschaftshistoriker, so haben sich auch die Juristen und Rechtsphilosophen nicht um das Buch gekümmert.
[3] S. S. I, S. 6.
[235]
Max Weber verkannt [1]. Der Hausvater führt, aber herrscht nicht, weil er seine Kinder zur Selbständigkeit zu führen sittlich verpflichtet und tatsächlich in der Regel willens und gezwungen ist[2] ; der Schullehrer führt, herrscht aber nicht, weil seine Schüler ihm entwachsen. Der Beduinenhäuptling, welcher Tribut von den durch sein Gebiet ziehenden Karawanen erpreßt, herrscht nicht „über alle jene wechselnden und unbestimmten Personen“, eben weil sie wechselnd und unbestimmt sind. Pure Gewalt — darin haben Locke und Rousseau recht, und wir werden uns mit ihrem Einwand gegen die Entstehung des Staates aus purer Gewalt ernstlich auseinanderzusetzen haben —, begründet überhaupt keine gesellschaftliche und gewiß keine Rechtsbeziehung, es sei denn, um mit Simmel zu sprechen, die „zwischen dem Tischler und der Hobelbank“.
Herrschaft soll heißen eine Beziehung sozialer Klassen, d. h. eine auf die Dauer gemeinte Beziehung zwischen Rechtsungleichen, einer Herrenklasse oben und einer Unterklasse unten. Sie ist, immer im Ausdruck Max Webers, eine „legitime“ Ordnung, die „Geltung“ besitzt. Sie enthält außer den notwendigen Sicherungen (Polizei, Heer usw.) folgendes :
Die Herrenklasse ist gegen die Untertanenklasse, also nach außen, „geschlossen“, insofern sie die „Zulassung ausschließt oder an Bedingungen knüpft“. Jene verwehrt dieser den Zutritt zu den „monopolisierten Chancen“, die ihr das positive Recht zugesteht, „Chancen der Befriedigung innerer oder äußerer Interessen“. Diese Chancen heißen, wenn sie appropriiert sind, „Rechte“, und wenn sie erblich appropriiert sind, „Eigentum“. Mit anderen Worten: zum Begriff der Herrschaft gehört nicht nur die Rechtsungleichheit, sondern auch die wirtschaftliche Ausbeutung auf Grund der „monopolisierten“ Eigentumsrechte.
Herrschaft hat im Sprachgebrauch eine doppelte Bedeutung. Das eine Mal bezeichnet das Wort die Verfassung eines Staates: dann ist sein Gegensatz (das Begriffspaar ist seit Gierkes meisterhafter Unter-
[1] Wirtschaft und Gesellschaft, I S. 28/9, S. 123. Vgl. S. S. I, S. 369, S. 372/3.
[2] Auf dieser Verwirrung beruht Filmers „Patriarcha“, gegen den Locke so ausführlich polemisiert. Er zeigt ihm entgegen, daß der Vater wohl führt, aber nicht herrscht, daß seine Macht über die Kinder nur aus seiner Pflicht entspringt, sie zur Selbständigkeit aufzuziehen (§ 57/8). Er unterscheidet aufs schärfste zwischen Führerschaft (paternal power) und Herrschaft (political power), und spricht den Regierenden nur die erste zu: das Schwert ist den Beamten nur gegeben, um die Übeltäter einzuschüchtern und dadurch die Menschen zur Einhaltung der positiven Gesetze zu bringen, die den Gesetzen der Natur, d. h. dem öffentlichen Wohle, dem Wohle jedes einzelnen Gliedes der Gesellschaft angepaßt sein müssen, soweit sich das durch öffentliche Regeln herbeiführen läßt. Das Schwert ist dem Beamten nicht für sein eigenes Bestes allein gegeben“ (§ 92). Das macht den Unterschied zwischen einem Herrscher und einem Usurpator, z. B. Cromwell (I, § 79).
[236]
suchung über das „Genossenschaftsrecht“ voll eingebürgert): Genossenschaft. Es bedeutet aber auch die Ausübung der in der Verfassung an die Oberklasse verliehenen Rechte, die herrschaftliche Leitung als Handlung: dann ist sein Korrelativbegriff: Dienerschaft oder Untertanenschaft, und sein Gegensatz ist die genossenschaftliche Führerschaft, deren Korrelativbegriff die Gefolgschaft ist.
Genossenschaft ist der Austausch von Diensten gegen Dienste, und zwar „freier“ Dienste, wie wir vorgeschlagen haben sie zu nennen [1] : „Darunter verstehen wir solche Aufwände von körperlicher Energie, die nicht im Markte gekauft und nach ihrem Marktpreis vergolten werden, sondern die Dienste der Liebe, der Freundschaft, Verwandtschaft, Nachbarschaft und Genossenschaft“. Genossenschaft ist die Gemeinschaft, insofern sie handelt. Sie ist ihrem Begriffe nach ein Verband von Gleichen, von Personen gleicher Würde. Sie ist daher, um wieder mit Max Weber zu sprechen, autonom und autokephal ; ist, wenn es sich um eine Rahmengruppe handelt, das, was Rousseau den „Souverän“ nennt. Sie braucht, um zu handeln, in der Regel eine Leitung, Rousseaus „prince“ (ein Wort, das durchaus nicht immer eine Einzelperson bezeichnen soll) : einen „Herzog“ im Kriege, eine Regierung und Richter im Frieden. Die Leitenden haben dem Sinn der Genossenschaft zufolge nur den Willen des Souveräns auszuführen und besitzen nur in den ihnen gesteckten Grenzen selbständige Verfügung; sie sind jederzeit abrufbar und für Überschreitungen ihrer Amtsbefugnisse verantwortlich. Das ist dasjenige, was wir im Gegensatz zur herrschaftlichen die genossenschaftliche Führerschaft, oder im folgenden kurz: Führerschaft schlechthin nennen wollen.
Diese Führerschaft hat sogar der wildeste aller Anarchisten[2],
[1] S. S. III, s. 58.
[2] Bei den übrigen Anarchisten versteht sich das von selbst. Stirner bezeichnet das Ideal der absoluten Freiheit als den Unsinn des Unmöglichen: „Beschränkung der Freiheit ist überall unabwendbar“. Aber die Bindu-igen des freien Vereins (wir sagen: der Genossenschaft) sind vom „Eigenen“ bejaht, erfreuen sich seiner Zustimmung und entsprechen seinem Interesse. — Kropotkin erkennt „das Prinzip der Rechtsgleichheit als unbedingt gültig an“, und mit dem Recht selbstverständlich auch die Rechtsordnung und dauernde Unterordnung unter das Recht. — Noch mehr gilt das selbstverständlich von Proudhon, der gar nicht „Anarchist“ im modernen Sinne des W'ortes war, sondern in ökonomischer Beziehung liberaler Sozialist und politisch nichts anderes als Föderalist, d. h. Gegner der übertriebenen Zentralisierung, die erst der moderne absolutistische Staat über die Menschheit gebracht hat. (Vgl. Ludwig Oppenheimer, Die geistigen Grundlagen des Anarchismus a. a. O. S. 263ff.) „Der Staat ist ein Feind und Mörder der Eigenheit, der Verein ein Sohn und Mitarbeiter derselben; der Staat ist ein Herr meines Geistes, der Glauben fordert und mir Glaubensartikel vorschreibt, die Glaubensartikel der Gesetzlichkeit; er übt moralischen Einfluß, beherrscht meinen Geist, vertreibt mein Ich, um sich als „mein wahres Ich“ an dessen Stelle zu setzen, mit einem Worte, der Staat ist „heilig“; — der Verein dagegen ist meine eigene Schöpfung, mein Geschöpf, nicht heilig, und übt nicht eine geistige Macht über meinen Geist aus so wenig wie irgendeine Assoziation, welcher Art sie auch sei“ (Stirner, zit. nach G. Adler, Stirners anarchistische Sozialtheorie S. 17).
[237]
Bakunin, als notwendig anerkannt: „Ich anerkenne, daß eine gewisse, nicht automatische, aber freiwillige und durchdachte Disziplin, die vollständig in Einklang steht mit der Freiheit der Individuen, immer notwendig ist und bleiben wird, und zwar jedesmal dann, wenn viele freiwillig vereinigte Individuen eine gemeinsame Aktion ausüben wollen. Diese Disziplin ist dann nichts anderes als die freiwillige und durchdachte Übereinstimmung aller individuellen Anstrengungen zur Erreichung eines gemeinsamen Zieles... . Inmitten der Aktion scheiden sich natürlich die Rollen... die einen leiten und befehlen, die anderen führen die Befehle aus. Aber keine Funktion erstarrt, fixiert sich und bleibt unwiderruflich einer Person übertragen... . Keiner erhebt sich über den anderen, oder wenn er sich erhebt, so geschieht es nur, um, wie die Wellen des Meeres, einen Augenblick später zurückzufallen... . In diesem System gibt es eigentlich keine Macht. Die Macht liegt in der Gemeinschaftlichkeit und wird der wahre Ausdruck der Freiheit eines jeden... . Jeder gehorcht nur, weil der Führer ihm nur das befiehlt, was er selbst will“ [1]. Und an anderer Stelle: „Wenn ich mich vor der Autorität von Spezialisten beuge,... tue ich das, weil diese Autorität mir von niemand aufgezwungen ist, nicht von den Menschen und nicht von Gott“[2]. Hier spricht für den Kenner des „Contrat social“ Rousseau aus jeder Zeile[3] : es ist die „volonté générale“, die, auch wenn sie einen widerstrebenden partikulären Willen mit Zwang überreitet, dennoch gerade dadurch die Freiheit des Bürgers wahrt: die wahre Freiheit, die er, bei richtiger „Abwägung“ (um mit Nelson zu sprechen)[4] als Souverän betätigen würde.
Die Führerschaft des Naturzustandes kann allen Voraussetzungen zufolge in der Tat keine andere als die hier beschriebene sein; und wir haben bereits gesehen, daß auch hier die Wirklichkeit, die Verfassung
[1] Das knutogermanische Kaisertum und die soziale Revolution, S. 9/10.
[2] Ebenda S. in.
[3] Freilich weniger unmittelbar als mittelbar durch Hegel, genauer die „Hegeische Linke“. Bei Bakunin „vereinigen sich die orthodoxe slawische Idee des Föderalismus und der russische Messianismus mit dem beginnenden Antiintellektualismus Westeuropas. Aus Hegels Philosophie nahm er wie die ganze Hegeische Linke die Begriffe des Prozesses, des ewigen Wandels, der umwälzenden Praxis, des revolutionierenden Geistes einseitig heraus und entwertete ihnen zuliebe die Gedanken von vernünftiger Erkenntnis und Durchdringung, objektiver Rechtsordnung, Synthese und Einheit, die dem in Hegels System die Wage halten“ (L. Oppenheimer, a. a. O. S. 280f.).
[4] Vgl. S. S. I, S. 355. Ich finde das Gesetz der Abwägung in prächtiger Formel bereits in Hobbes' Leviathan: „Quare ad totam Legem Naturalem perdiscendam alia re opus non est quam ut Actiones aliénas cum nostris pensitantes, in alteram lancem transferamus, ne Passiones propriae ponderi forte aliquid addiderint“ (cap. XV, S. 78).
[238]
primitiver Gruppen, der Konstruktion oder besser Deduktion aus der Prämisse allgemeiner Gleichheit vor dem Gesetz und allgemeiner Freiheit vollkommen entspricht. Wie kann nun, wenn man erstens alle Gewalt ausschließen und zweitens der wirtschaftlichen Tugend keine allzugroßen Einräumungen machen möchte, die Entwicklung aus der Führerschaft zur Herrschaft deduziert werden? Welche Tugend war es, zum wenigsten welche überragende Begabung, die den Staat erschuf und Herrschaft aufrichtete? Wir sagten es schon: wenn es nicht die Tugend des Kaufmanns sein soll, so muß es die des Helden sein und, da es nur zwei reine Heldentypen gibt, Achilleus und Odysseus, so muß es ein Starker oder ein Listiger gewesen sein, der das große Werk vollbrachte.
Die Meisten ziehen den Starken vor, entsprechend der Stimmung des arrivierten Großbürgertums, das sich psychisch feudalisiert hat und jetzt, nach dem Gesetz des Kontrastes, diejenigen Eigenschaften des depossedierten Adels, die es gern hätte, riesenhafte Kraft und heldenhaften Mut, am höchsten bewertet [1].
Die Vorstellung ist, daß in schweren Zeiten des inneren oder äußeren Krieges ein Starker sich aus der Masse heraushebt, den, wo die anderen zagten und verzagten, „sein Herz vom Platze riß“, wie Richard Dehmel von seinem Helden rühmt: etwa ein David, der allein es wagt, gegen Goliath auszuziehen; und daß die dankbare Volksmasse diesen ihren Abgott und Retter zum „Herzog“ erhebt. Und das ist gewiß sehr oft vorgekommen; aber es ist immer noch erst Führerschaft: wie kam es von da zur Herrschaft ? Betrachten wir zunächst die Wirklichkeit der äußeren Kriege im realen, nicht im bloß erdachten „Naturzustand“.
Holsti, der dem Gegenstande besondere Aufmerksamkeit geschenkt hat[2], berichtet, daß der Charakter der primitiven Kriege nach den
[1] Wir haben in unserer allgemeinen Soziologie (S. 702ff.) in einem „Versuch vergleichender Völkerpsychologie“ darauf hingewiesen, daß überall die Unterklassen die Oberklassen als ihr Modell wählen, und daß diese zu nahezu religiöser Verehrung gesteigerte „Imitation“ nirgend einen so hohen Grad erreicht hat, als in den Ländern des arriviertesten und daher psychisch am meisten feudalisierten Großbürgertums: in den angelsächsischen Staaten. Das erscheint in fast rührender Naivität in dem größten Teile ihrer Belletristik: überall ist der Held der riesenstarke Furchtlose, von Jack London und Rudyard Kipling, die beide große Künstler sind, abwärts bis zu Rider Haggard, der wenigstens noch ein leidlicher Schriftsteller ist, und schließlich bis zu dem heute gelesensten Autor der anglo- sächsischen Welt, Edgar Rice Burroughs, dem Schöpfer der Heldensaga von Tarzan dem Affenmenschen. Hier ist der mögliche Tiefpunkt erreicht: ärgster Kinokitschi Selbstverständlich ist auch dieser „weiße Riese“, der alle paar Seiten einen Löwen mit dem Jagdmesser tötet, wenn er ihm nicht einfach mit einem „Doppelnelson“ das Genick bricht, der Sohn eines Lords und auch in allen anderen Beziehungen der wahre Repräsentant des übermenschlich keuschen, selbstlosen, „fairen“ Gentleman, der der heutige Engländer der upper middle class sein oder doch scheinen — möchte.
[2] The relation of war to the origin of the state, Annalen der finnischen Akad. d. Wissensch., Serie B, Bd. XIII, 1, Helsingfors 1913. Ganz gleiches berichtet Max Schmidt, Grundriß der ethnol. Volkswirtschaftslehre.
[239]
Feststellungen der neueren Ethnographie ein wesentlich anderer ist, als man früher, auf Grund der Annahme von der im ersten Anfang bestehenden „absoluten Feindseligkeit“ mit Epikur und Hobbes annahm. Die Kriege der Primitiven sind meistens Racheakte für wirkliche oder eingebildete Übel; Plünderung und Eroberung erscheint nicht als Ziel (S. 19/20) ; erst auf höherer Stufe kommt die Sucht nach Beute als Motiv hinzu: die Irokesen kamen sogar bis zur Auferlegung von Tributen (21); und diese Motive werden dann auch offen eingestanden (22). Krieg und Jagd erscheinen als eines und dasselbe (25). Erstens, weil bei beiden die gleichen Waffen gebraucht werden, und zweitens, weil die Primitiven zwischen 'Mensch und Tier noch keinen grundsätzlichen Unterschied zu machen wissen. Aber so wenig man jagt um des Jagens willen, so wenig führt man Krieg um des Krieges willen. Eine Hauptursache des Krieges ist die Blutrache : aber die fällt nicht dem Stamme, sondern den nächsten Verwandten zu (29) ; auch sonst werden oft nur kleinere Gruppen, nicht der ganze Stamm in den Hader verwickelt; es ist also eher eine Fehde als ein Krieg zu nennen.
Die Gefechte sind nicht mörderisch[1], sie werden oft schon nach den ersten Verwundungen abgebrochen (32ff.), sind mehr harmlose Scharmützel[2]. Es gibt eine ganze Reihe von Gebräuchen, entsprungen aus der Absicht, die Schrecken des Krieges zu mildern: der Krieg wird regelrecht vorher angekündet (41), es gibt anerkannte Vermittler, die den beiden Stämmen angehören, wie das ja die Sitte des Totem oft mit sich bringt[3]. Frauen und Kinder werden fast nie angegriffen, getötet oder mitgeschleppt (44), Asyle bestehen und werden geachtet (46).
Die ausschließlich kriegerische Gesinnung der Primitiven ist eine Fabel. Fast überall hetzen die Frauen die Männer in den Kampf (48), und Feigheit führt noch nachträglich zu gesellschaftlicher Ächtung (50). Das heißt, daß der „instinct of pugnacity“[4] bei primitiven Menschen noch nicht oder nicht mehr so überragend stark ist wie bei vielen Raubtieren und auf höherer Stufe bei kriegerischen Stämmen, und daß er durch moralische Mittel angestachelt werden muß. Solche Mittel sind die ermutigenden Ansprachen der Führer, ferner Auszeichnungen, die den Tapferen verliehen werden; der Besitz von Skalpen oder Schädeln verleiht hohe Ehre (52) ; magische Mittel stärken den Mut, ebenso der Glaube an ein besonderes Glück im künftigen Leben. Außerdem unterbleibt der Zug oft, wenn die Vorzeichen ungünstig ausfallen (57ff.).
[1] S. S. I, S. 860ff.
[2] Schmidt, a. a. O. S. 174/5.
[3] Schmidt, a. a. O. S. 190.
[4] S. S. I, S. 226.
[240]
All das gehört übrigens, mindestens in seiner vollen Ausbildung, bereits einer späteren Stufe an.
Um die Kriege zu vermeiden, finden wir überall Friedensverträge und unverletzliche Gesandte (66), und gerade bei den Primitiven freundschaftliche Beziehungen zwischen den Nachbarstämmen, die untereinander Besuche austauschen und sogar an den Zeremonien teilnehmen [1]. Es gibt also schon primitive Formen des Völkerrechts. Alles das erklärt, daß so viele friedliche Völker haben überleben können. Sie haben schließlich mächtige Waffen in der Magie, die oft mehr gefürchtet wird als die Waffenkunde (76). Wenn der kriegerische Charakter der Primitiven von vielen Reisenden so stark übertrieben worden ist, so liegt es daran, daß die Wilden ebenso gern renommieren wie die Zivilisierten (81). Alles in allem spielt der Krieg in ihrem Leben eine viel geringere Rolle, als man angenommen hat.
Auch der Weiberraub, der zur Exogamie geführt haben soll, wird oft als die Ursache zu Kriegen angesehen. Aber hier ist selten der ganze Stamm beteiligt.
Der Charakter der Kriege wird mit der Entwicklung immer grausamer von dem Augenblicke an, wo die Absicht auf Beutemachen geht, namentlich auf Vieh und Sklaven. Das zeigt sich auch in der religiösen Auffassung: bei den Germanen z. B. wird der Allvater Tius verdrängt durch Wotan, ursprünglich der Gott des Todes, später des Krieges. Aber damit haben wir die Grenze unserer Betrachtung bereits wieder weit überschritten. (Holsti bediente sich in jener Arbeit noch der Methode, die heute von der Ethnologie als vorsintflutlich betrachtet wird, die einzelnen Sitten und Institutionen zu behandeln, ohne auf die Stufe Rücksicht zu nehmen, die ihre Träger, die Völkerschaften, einnehmen.[1]
Um zu unserem „Naturzustande“, d. h. zu den Primitiven, zurückzukehren, so stellt Holsti fest, daß hier der Kriegshäuptling kaum eine Rolle spielt. Ja, die kriegerische Tüchtigkeit wird auch noch auf weit höherer Stufe von anderen Fähigkeiten weit überwogen. Fast überall wird das Alter geehrt; man gehorcht den Alten und fürchtet sie noch nach ihrem Tode (142). Den ihnen geschuldeten Gottesdienst haben die Häupter der Familien und der größeren Einheiten (Clans, Phratrien) zu leisten und erlangen so die Würde des Priesteramts. Dadurch wird die
[1] Vgl. S. S. I, S. 864ff. über das „Intichiuma“. Andere merkwürdige Formen der friedlichen Beziehungen sind das „Tauvu“ der Fidschi-Insulaner (ib.) und das „Kula“ der Insulaner des westlichen Pacific, von dem von Wiese (allg. Soziol.) S. 43 Anm. nach Bronislaw Malinowski berichtet; eine eigentümliche Sitte, gewisse Gegenstände als Zeichen der Verbundenheit in zwei einander entgegengesetzten Ketten rundum zu senden, so daß jeder immer zu gleicher Zeit gibt und empfangt. Viele Beispiele bei Schmidt (Die Aruaken, S. 43ff.).
[241]
väterliche Autorität gestärkt (149). Die Neigung zur Subordination bildet sich aus und wird verstärkt durch das spezialisierte Priestertum und die geheimen Gesellschaften. Die größte Autorität bleibt immer die Gewohnheit ; und da Alte und Priester die Bräuche und Zeremonien am besten kennen, so stärkt das wieder ihre Autorität. So entsteht allmählich Häuptlingschaft; natürlich kann auch einmal ein erfolgreicher Krieger dazu aufsteigen, aber es bildet durchaus nicht die Regel. Die Hauptaufgabe des Häuptlings ist die Fürsorge für die Gruppe, namentlich in bezug auf die Nahrung (164). Alles in allem ist seine Zauberkraft mindestens so wichtig wie seine Tapferkeit (213, 216, 220). Vor allem fällt ihm das Regenmachen zu.
All das bezieht sich, wie gesagt, auf höhere Stufen als die jetzt von uns zu betrachtende. Und noch höher hinauf, fast schon in den vollendeten Staat hinein, führt Holstis Feststellung, daß auch der Besitz von Vermögen zur Häuptlingswürde prädestiniert, und zwar auch aus dem Grunde, weil solcher Besitz als das Zeichen besonderer Zauberkraft gilt. Jedenfalls bringt Holsti reiches Material dafür, daß der Reichtum der Häuptlinge im Interesse des Stammes verwendet wird; wir wissen aus anderen Quellen, daß die Reichen dieser Stufe sehr oft durch die Ansprüche der Genossen geradezu wirtschaftlich ruiniert werden.
Wir haben diesem Autor so ausführlich das Wort gegeben, weil er glaubt, die soziologische Staatstheorie mit gerade diesen Daten aus der Völkerkunde widerlegen zu können. Er polemisiert in seinem Aufsatz gegen Gumplowicz, Ratzenhofer und uns selbst. Aber alles, was er beibringt, kann die angegriffene Lehre nur stützen. Er identifiziert Staat und Regierung und wähnt daher, den Staat, den historischen Klassenstaat, die Herrschaft, abgeleitet zu haben, indem er die Wurzeln der genossenschaftlichen Führerschaft aufdeckt. Aber alles, was er uns mitteilt, macht die eigentliche, von ihm unerkannt gebliebene Aufgabe nur noch schwerer, den Übergang von jener zu dieser abzuleiten. Denn das kann man sich allenfalls vorstellen, daß ein ruhmreicher Krieger sich solchen Prestiges bei seinen Kampfgenossen erfreut, um auch im Frieden mit ihrer Hilfe über den Rest des Stammes eine wirkliche Herrschaft aufzurichten; freilich wäre das schon keine reine Heldentugend mehr, sondern bereits Gewalt und Mißbrauch des Amtes, selbst unter der Voraussetzung, daß die Lage der Gesamtheit die straffe Leitung unter einer überlegenen Kraft dringend nötig mache. Wenn aber der Häuptling ursprünglich mehr Priester und Magier als Krieger ist, so können wir uns allerdings den Übergang von der Führerschaft zur Herrschaft ebenfalls leicht vorstellen: aber dann handelt es sich sicherlich und ungemildert nicht, was zu beweisen wäre, um das „ökonomische“, sondern um das „politische“ Mittel: um Priestertrug, um Mißbrauch der Geisterfurcht zu eigenen selbstsüchtigen Zwecken.
[242]
Aber das sind Dinge, die uns noch nicht interessieren. Wir stehen noch bei dem realen Naturzustande der Primitiven — wenn wir Vorgriffen, so geschah es nur, weil der Autor mit seiner veralteten Methode uns dazu zwang. Auf den primitiven Stufen gibt es, so hat er selbst uns gezeigt, keinen dauernden Kriegszustand, also auch keinen dauernden Kriegshäuptling. Aus anderen Quellen wissen wir bereits, daß es auch keinen dauernden, „spezialisierten“ Priesterstand, und daß es keinerlei irgend bedeutsame Unterschiede des Besitzes gibt.
Da uns die Ethnographie im Stiche läßt, müssen wir versuchen, uns durch Deduktion zu orientieren. Unter welchen Bedingungen kann Herrschaft entstehen?
Das sagt uns einer der nüchternsten Beobachter des politischen Lebens, Machiavelli, mit vollster Klarheit : „Erstens muß ein Bürger, der Schaden tun und sich eine ungesetzliche Gewalt anmaßen könnte, viele Eigenschaften besitzen, die er in einer unverdorbenen Republik nicht besitzen kann. Er muß sehr reich sein, viele Anhänger und Parteigänger haben, und das ist unmöglich, wo die Gesetze beobachtet werden. Hätte er sie aber doch, so sind derartige Männer so gefürchtet, daß man sie aus freien Stücken nicht wählen wird“ [1]. Hier haben wir, positiv wie negativ, was wir zur Widerlegung der legitimistischen Auffassung brauchen. Negativ, daß „in einer unverdorbenen Republik“, und das ist der „Naturzustand“ in Machiavellis Sinne bestimmt, die Bedingungen, die wir suchen, nicht gegeben sind; sie bestehen nicht in übermenschlicher Stärke und Tapferkeit, sondern in Reichtum und der Verfügung über viele „Anhänger und Parteigänger“. Aus dieser Erkenntnis heraus riet er seinem „Principe“ die Ausrottung der großen italischen Magnaten an.
Er hat den Gedanken noch an anderer Stelle mit allem Nachdruck ausgesprochen: „Ich ziehe daher folgenden Schluß: wer in einem Lande, wo es viele Edelleute gibt, eine Republik gründen will, vermag dies nur, wenn er sie vorher alle ausrottet. Wer aber in einem Lande, wo große Gleichheit herrscht, ein Königreich oder ein Fürstentum aufrichten will, vermag dies nur, wenn er viele ehrgeizige und unruhige Köpfe aus dieser Gleichheit hervorzieht und sie zu Edelleuten macht, nicht nur dem Namen nach, sondern in der Tat, indem er ihnen Burgen und Güter
[1] Pol. Betrachtungen, S. 74. Rousseau sagt, wieder in voller Übereinstimmung mit seinem Meister: „Wenn Ihr dem Staate Bestand verleihen wollt, so müßt Ihr die wirtschaftlichen Verhältnisse nach Möglichkeit ausgleichen, dürft weder Reiche noch Bettler dulden. Diese beiden, naturnotwendig zusammenhängenden Klassen sind beide dem Gemeinwohl in gleichem Maße verderblich, aus der einen gehen die Helfershelfer der Tyrannei, aus der anderen die Tyrannen selbst hervor: sie sind es, die den Schacher mit der Freiheit treiben: die einen kaufen, die anderen verkaufen sie (Contr. social, II. 11, Anm.).
[243]
schenkt und sie mit Vorrechten an Besitz und über andere Menschen ausstattet. Dann wird er sich in ihrer Mitte und in der Macht erhalten, und sie werden durch ihn ihren Ehrgeiz befriedigen können, die übrigen aber ein Joch tragen müssen, das nur Gewalt ihnen aufnötigen kann“ [1].
Der Gedanke ist vollkommen klar : wer die Herrschaft erringen will, muß sich eine Gefolgschaft schaffen, die mit ihm auf Gedeih und Verderb verbündet ist, und auf die er daher mit Sicherheit rechnen kann, um mit ihrer Hilfe die Untertanen, deren Gleichheit er vorher mit Gewalt zerstören mußte, niederzuhalten. Und so klar er ausgesprochen ist, so unwidersprechlich wahr erscheint er uns auch. Einer ist immer schwächer als Viele oder Alle[2]. Nur Massenkraft kann Massenkraft besiegen und auf die Dauer niederhalten. Einzig die verrückte Heldenverehrung, die uns aus der Hofhistoriographie überkommen ist[3], die ihren Brotgeber als die einzige Kraft der Geschichte darstellte (wie die ägyptischen Hofmaler den Pharao als den riesenhaften Wagenkämpfer, der allein das feindliche Heer zu Paaren treibt) kann es zu der Vorstellung bringen, daß der freiheitliebende Primitive, der „praktische Anarchist“, sich von einem Einzelnen habe unterwerfen und auf die Dauer beherrschen lassen. Selbst wenn die Unterwerfung möglich sein sollte, so vergißt diese Theorie dennoch, daß auch der Stärkste alt wird und seine Stärke verliert. Spätestens in diesem Zeitpunkt würde das Joch abgeschüttelt werden (vgl. oben S. 186).
Damit also Herrschaft aus kriegerischer Führerschaft werden könne, muß erstens der Krieg zu einer Dauerinstitution geworden sein, und zweitens muß ein innerer Gegensatz in der Rahmengruppe existieren, der es einem Ehrgeizigen gestattet, sich auf eine Gruppe gegen die andere zu stützen.
[1] A. a. O. S. in. Vgl. Schmidt, Niccolò Machiavelli, S. 65. Bonald schreibt (Urgesetzgebung S. 338/9): „daß der Staat überall zur adelichen Aristokratie hinneigt, wo einige Adeliche ungeheures Territorialeigentum besitzen, wie in Polen, Ungarn, Rußland usw.; und daß da, wo der Untertan ungeheure Reichtümer in Kapitalien besitzt, der Staat sich zur Volksaristokratie oder Demokratie hinneigt, wie in Holland und England“.
[2] Nichts anderes will die vorhin erwähnte so viel mißdeutete Stelle aus Hobbes' Leviathan sagen: „Was die körperliche Anlage anbetrifft, so wird man selten einen Menschen von solcher Tölpelhaftigkeit finden, der nicht den Stärksten zu töten imstande wäre, sei es durch List, sei es in Verbindung mit anderen von der gleichen Gefahr Bedrohten“. Locke sagt (§ 205): „Der Harm, den der Fürst in seiner eigenen Person tun kann, wird nicht oft vorkommen und nicht weit reichen können. Denn er kann mit seiner Einzelkraft die Gesetze nicht umstürzen oder die Masse des Volkes unterdrücken“. So mag denn auch ein geisteskranker Herrscher der Unverletzlichkeit genießen, aber das hindert nicht, daß solchen Menschen, die in seinem Auftrage, als seine Kommissäre (wieder das bezeichnende Wort) gegen die Gesetze handeln wollen, Widerstand entgegengesetzt werde (§ 206).
[3] S. S. I, S. 754, 760.
[244]
Und zwar müssen die beiden Bedingungen zugleich gegeben sein ; der Dauerkriegszustand allein ist zwar notwendig, aber nicht ausreichend zur Erklärung. Vaccaros oben angeführte Meinung, der Häuptling, der die Würde des Feldherrn mit der des Oberpriesters vereinte, habe sich zum Tyrannen und Autokraten der eigenen angestammten Gruppe aufschwingen können, ist sicherlich falsch, obschon er bereits, von der modernen Soziologie beeinflußt, diese Entwicklung aus Mißbrauch des Amtes, also nicht mehr orthodox nach dem Gesetz der ursprünglichen Akkumulation, erklärt. Seillière hatte vollkommen recht, wenn er ihm einwandte, die Ableitung sei unwahrscheinlich ; es sei viel leichter, einem besiegten Volke sein Gesetz aufzuerlegen, als irgend eine Gewalt in der eigenen Gruppe zu usurpieren. Wir gehen noch einen Schritt weiter: es handelt sich nicht um Unwahrscheinlichkeit, sondern um Unmöglichkeit.
Die Vaccarosche Deduktion setzt folgendes voraus: die Jungmannen eines freien Stammes von Primitiven sind zum Kriege hinausgezogen und kehren nun heim, sieggekrönt und ruhmbedeckt, mit den Skalpen oder Schädeln der geschlagenen Feinde. Sie sind ihrem vergötterten Führer, dem Helden aller Helden, blind ergeben, bis zu dem Grade, daß sie ihm willig helfen, ihre eigenen Eltern und Geschwister, die zu Hause geblieben waren, mit Gewalt zu unterwerfen und für immer zu seinen Knechten zu machen. Ein Blick in das berühmte Buch seines Vorgängers, des Begründers der italischen Soziologie, Vicos, hätte ihn belehren können, daß diese Entwicklung unmöglich ist. Vico, der den richtigen Begriff von der „Familie“ des Aristoteles hatte, schreibt gegen Bodin: „Wenn, wie er zugibt, die Staaten sich aus den Famüien entwickeln, die aber bei ihm nur aus den Söhnen bestehen, wie sollten aus solchen Familien Monarchen sich bilden ? Dann hätten ja die Söhne ihre Väter verraten oder töten müssen, um einem anderen die Monarchie zu verschaffen“ [1].
Es kann wirklich nicht bestritten werden, daß die Vorstellung, wenn man sie zu Ende denkt, sich selbst ad absurdum führt. Schon die sehr menschliche, hier sicherlich vorhandene Eifersucht der Helden zweiter und dritter Klasse würde den Plan vereiteln, indem sie den Bedrohten ihre Waffen zur Verfügung stellen würden; vor allem aber verbietet der in diesen Gruppen herrschende, von uns dargestellte genossenschaftliche Geist es durchaus, daß ein solcher Plan im Herzen des Führers auftauche, und, wenn er selbst auftauchen sollte, daß dieser genügend Helfer fände. Alles, was in der Gruppe Kraft hat, die Blutsliebe und die religiöse Überlieferung mit ihrem ungeheuren Einfluß, würde sich gegen eine solche Usurpation empören müssen[2].
[1] a. a. O. S. 385.
[2] Locke sagt: „Also wollen wir einen Eroberer in einem gerechten Kriege betrachten und sehen, welche Macht er erhält und über wen. Zunächst ist klar, daß er keine Macht über seine Kampfgenossen erhält. Sie müssen wenigstens so frei bleiben, wie sie vorher waren. Und allermeist leisten sie ihre Dienste vertragsmäßig, unter der Bedingung, die Beute mit ihrem Führer zu teilen ... oder wenigstens einen Teil des eroberten Landes übertragen zu erhalten ... Diejenigen, die die absolute Monarchie auf das Recht des Schwertes gründen wollen, machen aus ihren Helden, den Gründern solcher Monarchien, „arrant Drawcansirs“ (Charakterfigur aus der satirischen Posse „The Rehearsal“ von Georges Villiers, Duke of Buckingham (1627—1688): der britische Bramarbas) und vergessen, daß sie Offiziere und Soldaten hatten, die in den siegreichen Schlachten an ihrer Seite fochten oder sie in der Unterwerfung oder der Besitznahme des Landes unterstützten, das sie bemeisterten“. Die Normannen, die mit dem Eroberer kamen, waren freie Leute, und ihre Nachkommenschaft ist es noch, und sie können doch nicht durch das Recht des Schwertes zu Untertanen des Absolutismus geworden sein (§ 177). Ganz ebenso sah es Vico (S. 392). Locke hat in dieser Beurteilung der Vorstellung einen Vorläufer in Spinoza, der sich ebenfalls über die lächerliche Heldenverehrung lustig macht. Statt auf Drawcansir beruft er sich auf den Rasenden Roland, der „eine ungeheure Menge von Menschen und Riesen ganz allein niedermetzelte“ und auf „Samson, der allein und unbewaffnet Tausende von Menschen niederhieb“, und „andere dergleichen Phantasiegebilde, die vom Standpunkte des Verstandes durchaus unbegreiflich sind“ (Theol. Pol. Trakt. S. 253/4). Diesen Kindereien gegenüber zeigt er, und beweist damit, daß er auch historisch denken konnte, wenn es an der Zeit dazu war, daß Alexander der Große „die Freiheit der Mazedonier, die er . . am meisten fürchtete, nicht eher unterdrücken konnte, als bis er die Anzahl der Soldaten durch die Gefangenen weit über die Anzahl der Mazedonier vermehrt hatte“ (Theol. pol. Trakt. S. 378). Und im Pol. Trakt. (VI, § 5) sagt er, daß kein Mensch persönliche Macht genug besitzen könne, um die Last der Alleinherrschaft zu tragen. Er müsse sich Feldherrn oder Räte oder Vertraute suchen, „so daß ein Reich, welches man schlechthin für ein monarchistisches hält, in Wahrheit und Wirklichkeit ein aristokratisches ist“. Auch hier die klare Erkenntnis, daß nur Gruppe gegen Gruppe stehen und siegen kann.
[245]
An dieser Klippe muß jeder Versuch scheitern, die Entwicklung der Herrschaft intratribal zu erklären. Nur die intertribale Erklärung kann uns zum Ziele führen. Muß ja doch sogar die hier von uns bekämpfte Lehrmeinung intertribale, äußere Kriege wenigstens als den Anlaß zu der von ihr deduzierten Änderung heranziehen.
Aber das reicht nicht aus. Die Erklärung muß sich ganz auf dem Felde der zwischenstammlichen Beziehungen halten. Nur auf diese Weise können wir zu der Ableitung der beiden Bedingungen kommen, die, wie wir fanden, nur in ihrer Verbindung die Entstehung der Herrschaft erklären können.
Der Krieg als Dauerzustand entsteht, wie Holsti uns sagte, erst von dem Augenblick, wo es möglich ist, Beute und namentlich Sklaven zu gewinnen. Diese Möglichkeit besteht nicht, solange nichts als primitive Jägerhorden das Gebiet bewohnen. Der Jäger kann dem Jäger nichts nehmen, was den Aufwand und die Gefahr eines Krieges lohnend erscheinen lassen könnte. Jede Horde ist so arm und reich wie die andere ; und wo eine gewisse Verschiedenheit der Erzeugnisse aus der Verschiedenheit der geographischen Lage oder aus alter Überlieferung wächst, da
[246]
ist es ein viel kleineres Mittel, sich das Begehrte durch friedlichen Tausch zu beschaffen. Und der Mensch wendet immer das kleinere Mittel an [1]. Das politische Mittel, Raub und Krieg, wäre hier ein „zu großes Mittel zum Erfolge“. Wir haben geschrieben: „Wo der Mensch rings um sich her in endloser Steppe nichts anderes finden kann als Horden von ebenso jämmerlicher Armut wie seine eigene, da ist sein kleinstes Mittel zum wirtschaftlichen Zwecke die eigene Arbeit in Jagd und Fischfang. Das ist die Hordenwirtschaft“[2].
Erst wenn sich in den reichen Schwemmebenen der Stromtäler wohlhabende Bauernschaften mit geringer militärischer Widerstandskraft angesetzt und vielleicht gar schon Städte und Gewerbe entwickelt haben, bietet sich der Gier des Primitiven ein Ziel, lockend genug, um Aufwand und Gefahr zu rechtfertigen, wird der Krieg zum Gewerbe, wird er Dauerzustand.
Das gleiche gilt von der Begierde nach Sklaven. Der Jäger kann mit dem Sklaven nichts anfangen. Man kann Jagdbeute nicht kapitalisieren, und für die Kooperation, die die Jagd zuweilen erfordert, reichen die Genossen hin. Darum tötet der Jäger den kriegsgefangenen Feind oder adoptiert ihn als gleichberechtigten Blutsbruder in seinen Stamm. Erst der Nomade und der see- oder stromanwohnende Wiking kann Sklavenarbeit verwerten, jener für die Hut der Herden, dieser für die Ruderarbeit im Kriegskanoe. Und erst auf dieser Stufe erlaubt die Reichlichkeit der Nahrungsquellen die Zusammenhäufung einer größeren Bevölkerung auf gegebener Fläche, und kann sich daher eine zu Angriffskriegen ausreichende militärische Macht entwickeln.
Erst hier also, wo der Krieg zum Dauerzustand, weil zum kleinsten Mittel der Güterbeschaffung, zum Gewerbe geworden, kann auch eine dauernde Kriegshäuptlingsschaft entstehen und kann sich, wie uns Spencer sagte, zur Tyrannis fortentwickeln. „Damit wird das Heer und sein Oberbefehlshaber eine stehende Einrichtung, und aus dem Oberfeldherrn wird leicht der unumschränkte Despot“[3].
Und jetzt erst ist auch hier die Klassenscheidung gegeben; jetzt erst steht, was wir als notwendige Bedingung erkannten, Masse gegen Masse: die siegreiche Kriegergruppe gegen die unterworfene Gruppe, Herren gegen Knechte, Freie gegen Unfreie. So erklärt die soziologische Staatsidee alles ohne Zwang, aber die legitimistische Auffassung dreht sich hilflos im Kreise: um den Staat, der nichts ist als das Gehäuse der Klassenordnung, abzuleiten, muß sie diese Klassenordnung voraussetzen, gerade wie die bürgerliche Kinderfibel den Kapitalismus voraussetzen muß, um ihn ableiten zu können.
[1] S. S. III, S. 146.
[2] S. S. III, S. 172.
[3] S. S. I, S. 1056 nach Müller-Lyer.
[247]
Niemals kann sich unter Gleichen eine Herrschaft entwickeln, oder Führerschaft zur Herrschaft entarten. Man denke an Loens' prachtvollen, nach den Akten gearbeiteten Roman aus dem Dreißigjährigen Kriege „Der Werwolf“. Bauer Wulff ist der anerkannte Führer der zur Abwehr der Plünderer verbündeten niedersächsischen Bauern. Ist auch nur die entfernteste Möglichkeit dazu gegeben, ja, kann in ihm auch nur der Gedanke aufkeimen, daß er sich zum Herrn seiner Genossen auf werf en, d. h. ihnen erblich zu seinem Privatnutzen Leistungen und Steuern auferlegen könnte ? ! Sie würden ihn einfach auslachen und, wenn er sie zwingen wollte, ebenso einfach totschlagen. Und so geht er denn, als endlich die Friedensglocken über das verheerte Land klingen, schlicht und ruhig zu seinem Pfluge zurück — wie Cincinnatus in der Zeit der römischen Freiheit.
Es ist also nichts mit Achilleus. Wie steht es um den vielgewandten Odysseus ?
Die Meinung ist weit verbreitet, daß der Staat die geniale Erfindung eines Einzelnen ist, der ihn schuf, um gewissen Schwierigkeiten abzuhelfen, die das Gemeinleben bedrohen. Der Merkwürdigkeit halber sei eine Vorstellung von Eleutheropoulos erwähnt, daß „die Verschmelzung von mehreren Sippen“ in einem Staate (ursprünglich in einer Stadt) durch eine Berechnung verursacht wurde, weil „der Staat die einzige Möglichkeit war, wie den Verwaltungsschwierigkeiten eines ansässigen Stammes abgeholfen werden konnte“ [1]. Abgesehen von der Skurrilität der Vorstellung, die in einem primitiven Stamme bereits Verwaltungsschwierigkeiten für möglich hält, wäre hier allenfalls eine Regierung, aber sicherlich keine Herrschaft abgeleitet.
In der Regel aber wirkt hier der epikuräische Gedanke vom notwendigen Kriege Aller gegen Alle, der die „Erfindung des Staates“ nötig gemacht habe. So, um den Größten zu nennen, bei Schopenhauer : „Der Staat, dieses Meisterstück des sich selbst verstehenden, vernünftigen, aufsummierten Egoismus aller, hat den Schutz der Rechte eines Jeden in die Hände einer Gewalt gegeben, welche, der Macht jedes Einzelnen unendlich überlegen, ihn zwingt, die Rechte aller andern zu achten. Da kann der grenzenlose Egoismus fast aller, die Bosheit vieler, die Grausamkeit mancher sich nicht hervortun: der Zwang hat sie alle gebändigt. Die hieraus entspringende Täuschung ist so groß, daß, wenn wir in einzelnen Fällen, wo die Staatsgewalt nicht schützen kann oder eludiert wird, die unersättliche Habsucht, die niederträchtige Geldgier, die tief versteckte Falschheit, die tückische Bosheit der Menschen hervortreten sehen, wir oft zurückschrecken und ein Zetergeschrei erheben, vermeinend, ein noch nie gesehenes Monstrum sei uns aufgestoßen: allein ohne den Zwang der Gesetze und die Notwendigkeit der bürgerlichen Ehre würden dergleichen Vorgänge ganz an der Tagesordnung sein... . Diese Tausende, die da, vor unseren Augen, im fried-
[1] Soziologie, S. 72.
[248]
liehen Verkehr sich durcheinander drängen, sind anzusehen als ebenso viele Tiger und Wölfe, deren Gebiß durch einen starken Maulkorb gesichert ist“ [1].
Wenn wir diese im tiefsten pessimistische Schilderung von Schopenhauers Zeitgenossen, die wir nicht als allzusehr übertrieben bezeichnen können[2], mit den Tatsachen vergleichen, die uns über den realen Naturzustand bekannt geworden sind, so erkennen wir mit Entsetzen, was die Zivilisation aus dem gutartigen Tier der Anfangszeit gemacht hat, und fühlen uns fast versucht, uns in jene schöne Zeit der rohen Unschuld zurückzuwünschen. Zum Glück sind wir in der Lage, die Ursachen, die diese grauenhafte Veränderung des Typus herbeigeführt haben, aufzuweisen und zu zeigen, daß sie abgestellt werden können. So ist uns, wir wiederholen es, der Naturzustand der „Wilden“ nur eine frohe Bürgschaft, daß es eine Zukunft geben kann und wird, in der die Roheit verschwunden und die Unschuld wieder errungen sein wird ; wir denken hier aber nicht etwa an eine Zeit, „wo die Menschen, gutartig wie die Schafe, die sie weiden“ (Kant), keiner leidenschaftlichen Aufwallung, keines Verbrechens aus Leidenschaft mehr fähig sind : wir möchten in solcher Zeit gewiß nicht leben. Nicht „Engel“[3] werden die Menschen werden, sie
[1] Grundlage der Moral, S. 575. Vgl. Ewald, Probleme der Romantik, S. 47/8.
[2] Hobbes (Leviathan XIII) sagt: „Denke doch darüber nach, warum du dir, wenn du eine Reise antrittst, Gefährten suchst und Waffen trägst, warum du beim Schlafengehen die Türe verriegelst, und das, obgleich die Gesetze und ihre bewaffneten Diener bereit sind, alle Gewalttat zu rächen ! Welche Meinung du von deinen Mitbürgern, Nachbarn und Dienern hast I Klagt deine Vorsicht nicht das Menschengeschlecht geradeso an wie ich ?“ (a.a.O. S. 65). Und im Kap. XV: „Nur die Furcht vor den übersinnlichen und den irdischen Mächten hält die Gesellschaft zusammen“ (S. 71). Diese schwer pessimistischen Gedanken, die übrigens für den realen Naturzustand und jedes Verhältnis echter Gemeinschaft nicht wahr sind, hat der Pessimist Hebbel in einer seiner Komödien ausgestaltet: ein heiliges Erbjuwel, der Talisman des Fürstenhauses, ist gestohlen worden. Dem, der es wiederbringt, wird außer einer hohen Belohnung Straflosigkeit für jedes Verbrechen zugesichert, durch das er sich in den Besitz des Schatzes gesetzt haben möchte ... und die menschliche Bestie zeigt sich in Entfesselung.
[3] Diesen recht abgestandenen Einwand erhebt jetzt wieder Prof. Dunkmann in seiner sonst sehr ehrenvollen Anzeige meines „Systems“ („Charakterköpfe deutscher Soziologie“, Der Arbeitgeber, 1924, Nr. 19, S. 381 ff.) gegen mich. Es scheint, man begeht fast ein Sakrileg, wenn man sagt, der Mensch sei durchschnittlich kein absoluter Schuft, der das Böse aus reiner Lust am Bösen tue, sondern ein geselliges Naturwesen, das normalen Versuchungen zu widerstehen vermöge (Ausnahmen selbstverständlich zugegeben, die aber die soziale Gesundheit nicht ernstlich stören könnten, ganz abgesehen davon, daß die meisten heutigen Ausnahmen geradezu von der heutigen Gesellschaft „gezüchtete Verbrecher“ sind, die die „Kollektivschuld“ der Gesellschaft (AI. v. Oettingen) zu büßen haben). Wenn man die heillose Bosheit der Menschen annimmt, hat man allerdings nicht nötig, die Argumente zu prüfen, die die heillose Bosheit der heutigen Gesell Schaft beweisen. Wie sich freilich jenes bequeme Grunddogma mit den Tatsachen verträgt, die wir soeben beigebracht haben, vermögen wir in unserem unheilbaren Utopismus nicht einzusehen. (Vgl. unseren Aufsatz: Die Utopie als Tatsache, Wege zur Gemeinschaft, S. 493ff.) Spinoza sagt: „Es ist sicher, daß Empörungen, Kriege, Verachtung oder Verletzung der Gesetze nicht sowohl der Bosheit der Untertanen, als vielmehr dem mangelhaften Zustande des Staatswesens beigemessen werden müssen; denn die Menschen werden nicht als Staatsbürger geboren, sondern werden erst dazu gemacht. Die natürlichen Affekte der Menschen sind zudem überall dieselben; wenn daher in einem Staate mehr Bosheit herrscht und mehr Sünden begangen werden als in einem anderen, so ist gewiß, daß ... ein solcher Staat nicht genug für die Eintracht gesorgt und die Rechte nicht weislich genug angeordnet hat“ (Pol. Traktat, V, § 2). Aber der beatus possidens hält immer die Gesellschaft, in der, und von der, er lebt, für die beste mögliche, auch die Sklavenhalter der Antike und die Männer des Ancien Regime unmittelbar vor der Revolution, und schilt die „Bosheit“ der Wenigen, die die Bosheit der Dinge anklagen. Die südlichen Sklavenhalter haben die „Abolitionisten“ geteert und gefedert und oft genug lynchmäßig aufgehängt: unsere Kapitalisten möchten mit ihren Abolitionisten am liebsten das gleiche tun ... bis auch ihnen eines Tages das Dach überm Kopfe brennen wird. „Den Teufel spürt das Völklein nie, und wenn er sie am Kragen hätte“, und „mit der Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens“: das bezieht sich beides auf unsere „Realpolitiker“ von rechts und links, die Schematiker des Gedankens und die Routiniers der Tat.
[249]
werden Menschen bleiben: aber man kann dafür Sorge tragen, daß sie nicht mehr in der Regel vor Versuchungen gestellt werden, denen ihre sozialen Regulationen nicht gewachsen sind. Und das ist möglich [1].
Auch Burckhardt nennt den Staat „die Abdikation der individuellen Egoismen“[2].
Das also sind die Schwierigkeiten, zu deren Behebung nach der Lehre der Gläubigen des Odysseus der Staat „erfunden“ worden ist. Wir haben die Anschauung Rousseaus über den Gegenstand dargestellt : ihm ist der Staat eine schlaue Erfindung der Reichen, die eine Garantie für ihren Besitz brauchen und es verstehen, die Armen durch wohlgesetzte Worte für ihren teuflisch schlauen Plan zu gewinnen. Lester Ward, den wir schon einmal als von Rousseau stark beeinflußt erkannt haben, wendet diese kleinbürgerliche Auffassung ins Großbürgerliche und tut noch die echt großbürgerliche und namentlich anglosächsische Heldenverehrung hinzu: „Der Staat (government) muß also als eine Erfindung des Menschengeistes, als eine außergewöhnliche Anstrengung der Verstandes- oder Denkkraft angesehen werden. Daher kann er nicht die Schöpfung einer ganzen Gemeinde, oder auch nur einer großen Zahl, sondern muß die Emanation eines einzelnen Gehirns oder allenfalls weniger übereinstimmender Geister, die besondere Auswirkung einer ganz besonderen Art von List (cunning) oder Scharfsinn gewesen sein, wodurch gewisse Individuen, von leidenschaftlicher Machtliebe getrieben, den Plan eines Staates entwarfen. Dieser Ehrgeiz zielt auf Ehre oder Macht, und so muß der Plan als die eigentliche Absicht den Schutz der Geschädigten und die Bestrafung der Schädiger angegeben haben.
[1] Vgl. das Vorwort zur zweiten Auflage unserer „Siedlungsgenossenschaft“.
[2] Weltgeschichtl. Betracht. S. 35.
[250]
Das, so sahen es die Gründer des Staates voraus, mußte ihnen Parteigänger sichern und ihre Autorität befestigen“ [1].
Aufkläricht vom reinsten Wasser! Aber auch in dieser uns heute fast lächerlich erscheinenden Gestalt liefert es uns immer noch erst nur Regierung, government, und nicht das, was hier deduziert werden soll: den geschichtlichen Klassenstaat, die Herrschaft. Um von hier aus weiter zu kommen, müßte man sich schon die oben (S. 65) dargestellte recht kindliche Phantasie von Hobbes und Grotius zu eigen machen, wonach, in einem Subjektionsvertrage, das Volk sich nicht nur einen Fürsten, sondern auch noch eine Aristokratie zu seiner Knechtung und Ausbeutung freiwillig gesetzt habe und zwar in einer ewigen, auch über die eigene Generation hinaus dauernden Bindung an die Heiligkeit dieses Vertrages! (Vom Menschen und vom Bürger S. 158 [2].)
Selbst der kluge Small, der Schüler Ratzenhofers, aber auch Wards, steht diesem Standpunkt nicht allzu fern. Von jenem hat er den Epikuräismus der Grundanschauung, die „absolute Feindseligkeit“ als Ausgangspunkt, von diesem den Rousseauismus. Er schreibt: „Überall ist es das Interesse Aller an den Wohltaten der Kultur, was den Staat, d. h. die Stätte der Zwangsgewalt, bildet. Wir haben den Staat dargestellt als den Bändiger (modifier) des Kampfes, als eine Art von Unparteiischem im Ring“[3]. An anderer Stelle nennt er den Staat „eine Vereinigung von Trennungen, eine Versöhnung von Konflikten, eine Harmonie von Dissonanzen. Der Staat ist eine Maschinerie (arrangement), durch die Kräfte, die sich gegenseitig abstoßen, zu einem gewissen Maße von Zusammenarbeit gebracht werden“[4]. Das ist für den entfalteten Staat bis zu einem gewissen Grade richtig, wenn auch die Hauptsache übersehen ist: eben die Herrschaft, die Klassenordnung. Sie erscheint sogar diesem vortrefflichen modernen Soziologen offenbar als selbstverständlich. Und auch er gibt uns nur die Entstehung der Führerschaft, der Regierung, aber nicht der Herrschaft.
Wir können daher nur zu dem Ergebnis gelangen, daß auch die Odysseus-Variante der legitimistischen Staatsidee das Rätsel nicht lösen kann.
Der Staat ist nicht intratribal, weder durch ökonomische Differenzierung noch durch heldenhafte Tapferkeit oder heldenhafte Schlauheit, weder durch legitimen Gebrauch noch durch illegitimen Mißbrauch der solchen Helden verliehenen Amtsgewalt entstanden, sondern er ist intertribal, durch Unterwerfung einer Gruppe unter die andere, gebildet worden.
[1] Dynamic Sociology II, S. 224.
[2] Das scheint auch Rousseau für denkbar zu halten (Contrat social III, 18).
[3] General Sociology, S. 347.
[4] General Sociology, S. 252/3.
[251]
c) Autoritäten.
Das ist die soziologische Staatsidee, die nicht nur mit den Tatsachen vollkommen übereinstimmt, wie wir im nächsten Abschnitt zeigen werden, sondern auch mit der Lehrmeinung ihrer meisten und wichtigsten Gegner.
Das werden wir in aller Kürze noch belegen. Dann können wir endlich von den Theorien Abschied nehmen und uns zu den Tatsachen wenden.
Wir haben Stellen angeführt aus Aristoteles, aus der epikuräischen Lehre, aus Bodin („la monarchie seigneuriale“), aus Herder, aus Kant („sie werden es mit der Gewalt angefangen haben“), aus Fichte („Gewaltstaat, der den Erleuchteten gar nichts angeht“), aus von Haller („militärischer Staat“), aus Savigny („Despotismus“), aus Schopenhauer, aus Hertling, um hier von den Vorläufern, Schöpfern und Vollendern der soziologischen Staatsidee: Ibn Chaldûn, Hotman, Winstanley, Sieyès, St. Simon, Comte, Gumplowicz, Ratzenhofer, zu schweigen. Hier mag noch eine Blütenlese aus den Jahrhunderten folgen:
Der heilige Augustin sagt in seiner „civitas Dei“, der weltliche Staat übe nicht Gerechtigkeit, sondern Gewalt. Er wird mit Räuber- horden verglichen: „Denn sind nicht auch Räuberhorden Staaten im kleinen? ... Was heißt die Grenznachbarn mit Krieg überziehen, als Räuberei im großen treiben?“
Entsprechend schrieb Böhmer in seiner „Introducilo in jus publicum internationale“, die zuerst 1710 erschien, die oft zitierten Worte: „Wenn wir die Anfänge und die Erweiterungen der vornehmsten Staaten betrachten, stellt sich heraus, daß Gewalt und Räubereien die Quelle der Herrschaft gewesen sind.“
Die Naturrechtslehrer haben sehr wohl ihre juristisch-philosophische Konstruktion von dem wahren geschichtlichen Staate zu unterscheiden gewußt, wie wir an Kant und Fichte bereits gesehen haben. Hobbes z. B. trennt sehr scharf seinen „institutiven oder künstlichen Staat, welcher durch Vereinbarung ... errichtet ist“ ... von dem „natürlichen“ Staat, der „auch der erworbene genannt werden kann, da er durch die Gewalt und die natürlichen Kräfte erlangt wird“ [1].
Bodin schreibt: „La raison et la lumière naturelle nous conduit à cela, de croire que la force et la violence a donné source et origine aux Républiques... . En quoy il appert que Démosthène, Aristote et Cicéron se sont mespris suivant l'erreur d'Hérodote, qui dit que les premiers Rois ont esté choisis pour leur justice et vertu“ (S. 48, I, 6). „La monarchie seigneuriale est celle où le Prince est faict Seigneur des biens et des personnes par le droit des armes et de bonne guerre, gouvernant
[1] Vom Menschen und vom Bürger, S. 166.
[252]
ses subjects comme le père de famille ses esclaves“ (190). „Et ne doit pas la Monarchie seigneuriale estre appellee tyrannie“ (191): denn nur ungerechte Mittel, also auch ein ungerechter Krieg machen den Tyrannen (II, 2). „Or l'une et l'autre Republique s'establit par la violence des plus forts (350, IV. 1). Er exemplifiziert auf die „Könige der Meder, Perser, Ägypter, Hebräer, Mazedonier, Korinther, Sizyonier, Athener, Kelten, Lazedämonier, die durch Erbfolgerecht zu der zumeist durch Gewalt begründeten Herrschaft gelangt sind, die erst später durch Gerechtigkeit und gute Gesetze verwaltet (policé) wurde“ (356). Auch die durch Mißbrauch der Amtsgewalt, z. B. durch Condottieri erfolgte Gründung der Staaten wird an zahlreichen Beispielen aus dem Altertum und der Neuzeit illustriert (362).
Locke schreibt höhnisch seinen Gegnern ins Stammbuch: „Wenn ich ihnen einen guten Rat geben darf, so möchte ich empfehlen, nicht allzu tief in den Ursprung der Staaten einzudringen; sonst würden sie an der Wurzel der meisten etwas entdecken, das ihrer Ansicht entschieden ungünstig ist“ (§ 103).
Er stellt die freien Indianer Nordamerikas und ihre politischen Gesellschaften in scharfen Gegensatz zu den Erobererstaaten Peru und Mexiko (§ 105) und unterscheidet auf das deutlichste die auf friedliche Weise entstandenen Regierungen von den durch die Eroberung begründeten (§ 112), denen er ein ganzes Kapitel, das XVI., über „Conquest“ widmet.
Wir wiederholen: diese Philosophen konnten sehr wohl historisch denken, wenn es ihnen eben aufs Historische ankam. Humc sagt, daß, soweit unsere Kenntnisse reichen, der geschichtliche Ursprung der Staaten zumeist in Usurpation oder in Eroberung gesucht werden muß. Nirgends finde sich ein Beispiel, daß eine Gesellschaft oder ein Staat aus einem Gesellschaftsvertrage seiner Bürger entstanden sei [1].
Um weitere Autoritäten zu nennen, so hat auch der berühmte Jurist Svarez bereits vor Kant zwar die dem Staatsoberhaupte zustehende Ausübung aller dem Staate gegen Mitglieder zustehenden Rechte auf den Staatsvertrag begründet, fährt aber fort: „Diesen Grundsatz halte ich zwar nicht für historisch richtig, weil die Geschichte, wenigstens der allermeisten älteren und neueren Staaten beweist, daß physische und moralische Unterjochung ihr Ursprung gewesen sey“[2].
Kant hat noch an anderer Stelle sehr klar zwischen seinem an Rousseau orientierten Vernunftstaat und dem Wirklichkeitsstaat unterschieden. Er hat, wie Metzger mitteilt, „keineswegs einen faktischen
[1] Lord, a. a. O. S. 61. Ganz ebenso Quesnay. Vgl. Daire, a. a. O. I, S. 32.
[2] Zit. nach Jellinek, Allg. Staatsl., S. 214 Anm. Vgl. Hasbach, a. a. O. S. 26. Das Buch trägt den Titel „Tractatus de legibus“, 1609.
[253]
Vertragsakt als den historischen Entstehungsgrund der damals bestehenden Staaten ausgeben wollen... . Denn, so lautet eine private Aufzeichnung, die .Ordnung der Natur will, daß vor dem Recht die Gewalt und der Zwang vorhergehe, denn ohne diesen würden Menschen selbst nicht einmal dahin gebracht werden können, sich zum Gesetzgeben zu vereinigen'. So ist dieser Vertrag, wie Kant vernehmlich erklärt, .keineswegs als ein Faktum vorauszusetzen nötig (ja, als solches gar nicht möglich), sondern es ist eine bloße Idee der Vernunft, die aber ihre unbezweifelte (praktische) Realität hat'“ [1].
Herder sieht im Kriege allein und in der Macht des Stärkeren den historischen Grund der „Erbregierung“, in der Tradition ihre Befestigung: „Nachfolger und Erbe bekamen, der Stammvater nahm“. Er ist kein Verehrer der Eroberer und der Gewaltherrscher. „Die berühmtesten Namen der Welt sind Würger des Menschengeschlechts, gekrönte oder nach Kronen ringende Henker gewesen“[2].
Fichte verteidigt Rousseau mit der Bemerkung, daß die geschichtlichen Staatsverfassungen wohl meistens nur „das Recht des Stärkeren“ darstellen, schließt aber von seinem uns bereits bekannten Standpunkt aus daran die weitere Bemerkung, daß rechtmäßigerweise eine bürgerliche Gesellschaft sich nur auf einen Vertrag gründen könne[3].
Hegel denkt den Staat vornehmlich durch Gewalt entstanden: „Die erste Produktion eines Staates ist herrisch und instinktartig. Aber auch Gehorsam und Gewalt, Furcht gegen einen Herrscher ist schon Zusammenhang des Willens“. Ein „Heroenrecht zur Stiftung von Staaten“ rechtfertigt die Gewaltanwendung in einem solchen „Naturzustand — Zustand der Gewalt überhaupt —, denn in Güte läßt sich gegen die Gewalt der Natur wenig ausrichten“[4].
Auch Raumer sagt klipp und klar: „Allgemeine Beistimmung zur Gründung eines Staates fand wohl nie statt; sie erwuchsen meist auf gewaltsamem Wege“[5].
Um neuere Staatslehrer von Rang anzuführen, so sagt Jellinek: „Die Machttheorie hat scheinbar eine feste Stütze an den geschichtlichen Tatsachen, da im historischen Staatenbildungsprozeß es nur ausnahmsweise ohne Sieg einer Übermacht zugegangen, und der Krieg der Schöpfer der meisten Staaten gewesen ist, sowie an der unleugbaren Tatsache, daß jeder Staat seinem Wesen nach eine Macht- oder Herrschaftsorganisation darstellt“ (194). Und an anderer Stelle: „Offene Gewalt in den mannigfaltigsten Formen ist der häufigste Grund der Bildung und Auflösung der Staaten gewesen“ (342).
[1] a. a. O. S. 101/2. Seite 145 findet sich eine ähnliche Ausführung Fichtes.
[2] Zitiert nach Bluntschli, a. a. O. S. 326.
[3] Ebenda S. 399.
[4] Zitiert nach Heller, a. a. O. S. 87.
[5] Geschichtl. Entw. d. Begr. Recht, Staat, Politik, S. 67.
[254]
Wenn Jellinek ebenso wie einige andere der angeführten Autoren die Entstehung aus Gewalt nur „für die allermeisten“ oder „meisten“ Staaten zugeben, so bedeutet das keinen Widerspruch gegen unsere Auffassung, daß „der“ Staat, und das heißt: alle Staaten auf diesem Wege entstanden sind. Der Theoretiker nämlich, der neben der sozialen auch die juristische Staatslehre zu vertreten hat, muß daran denken, daß geschichtlich nicht selten ohne Krieg und Unterwerfung aus einem Staate mehrere, und aus mehreren Staaten oder Staatsteilen ein Staat geworden ist. Das erstere ist der Fall bei den im Mittelalter sehr häufigen Erbteilungen zwischen Brüdern oder durch friedliche Gründung von Kolonien auf herrenlosem oder käuflich erworbenem Lande, wohin die Kolonisten die Verfassung und das Recht und meist sogar auch die Klassenscheidung der Heimat in Gestalt von Sklaven oder Leibeigenen mitbrachten oder sofort durch Sperrung des ganzen Bodens gegen neue Zuwanderer einführten [1], oder durch friedliche vertragsmäßige oder nur faktische Trennung eines großen Staatengebildes in mehrere kleinere. Vertragsmäßig ist die Trennung, wenn ein Bundesstaat sich auflöst, indem jeder der Teile seine volle Souveränität zurücknimmt, weniger deutlich, wenn ein Staatenbund das gleiche tut (Trennung von Schweden und Norwegen), oder durch friedliche Trennung von Kolonien aus dem Staatsverbande mit dem Mutterstaat, oder schließlich durch die Verleihung von Staatsrechten an bisher unselbständige Gebietsteile, wie das regelmäßig bei der Erhebung eines nordamerikanischen Territoriums zum Vollstaate geschieht[2]. Rein faktisch war das friedliche Zerfallen des alten deutschen Reichs in eine Reihe souveräner Territorialstaaten, „die in solcher Eigenschaft von dem Reiche niemals ausdrücklich anerkannt waren“[3].
Friedliche Bildung eines neuen Staates aus mehreren, früher getrennten Staaten oder Staatsteilen kann sich vollziehen durch Erbverträge zwischen Dynastien oder durch ein Bündnis, wie es die Schweizer Kantone unter sich abschlössen, oder, aus Staatsteilen, wie bei der Vergrößerung des Fürstentums Bulgarien durch volle Einverleibung der bis dahin unter türkischer Hoheit stehenden Dobrudscha.
An alle diese Dinge muß der Staatslehrer denken, der auch die juristische Seite des Problems behandelt. Für uns hat nur das eine dabei Interesse, daß auch in allen diesen Fällen der Staatsgründungsakt außerhalb des Rechts des neugegründeten Staatswesens liegt. Nur er allein! „Alle ihm vorausgehenden und nachfolgenden Akte sind in der heutigen Staatenwelt nach irgendeinem Rechte zu beurteilen. Die staatengründenden Personen sind stets einer
[1] Vgl. zur Geschichte der modernen Kolonien, S. S. III, S. 540—55.
[2] Jellinek, a. a. O. S. 275.
[3] Jellinek, a. a. O. S. 277.
[255]
Rechtsordnung unterworfen, an der gemessen ihre Handlungen, ehe die Gründung selbst erfolgt ist, entweder als rechtswidrig oder als rechtmäßig erscheinen“ [1].
Für unsere rein soziologische Betrachtung handelt es sich aber hier überall um bereits bestehende fertige Staaten oder Staatsteile, die irgendwie ihre juristische Form änderten. Das Problem der Entstehung des Staates wird dadurch nicht berührt: „der“ Staat, das Gehäuse der Klassenordnung, ist nirgend und nie anders als durch Eroberung und Unterwerfung entstanden.
Um nun noch andere, mehr historisch gerichtete Staatslehrer anzuführen, so hat schon der vorurteilsfreie, kluge und umsichtige und zu seinem Glücke nicht „industriezentrisch“, sondern durchaus „geozentrisch“[2] orientierte Justus Moser die gleiche Erkenntnis besessen: „So viel wir aus der Erfahrung wissen, sind überall — wenigstens in Europa — in jede Kolonie (Rousseau mag sagen, was er will), einige früher und andere später gekommen und geboren; und wo die ersten alles erobert hatten, da war es unmöglich, daß die letzteren mit den ersten zu gleichen Rechten gelangen konnten. Die letzteren mußten notwendig, solange sie das Recht der ersten Eroberung gelten ließen, von den ersten die Erlaubnis, sich niederzulassen, suchen, von ihnen das Land, was sie gebrauchten, in Erbzins, Pacht oder Steuer nehmen, und sich jede Bedingung, wäre es auch die Leibeigenschaft gewesen, gefallen lassen. Überall, in allen Ländern, Städten und Dörfern, ist — nach der Erfahrung und demjenigen, was wir vor Augen haben, zu urteilen — ein doppelter Sozialkontrakt entstanden: einer, welchen die ersten Eroberer unter sich geschlossen, und ein anderer, den diese ihren Nachgeborenen oder späteren Ankömmlingen zugestanden haben“[3].
Hier ist zu rühmen die, dem Kenner der Landwirtschaft, dem großen Bauernpolitiker selbstverständliche, aber wenigstens damals für Deutschland noch neue Erkenntnis, daß die Klassenscheidung nicht durch ökonomische Vollbesetzung des Bodens, „weil die Hufen, sich sämtlich berührend, das ganze Land bedeckten“, sondern durch politische Sperrung zustandegekommen ist. Zu bemängeln ist, daß auch Moser noch nicht den regelmäßigen Fall ins Auge gefaßt hat, daß die Einwanderer, die er kennzeichnenderweise als „Eroberer“ bezeichnet, im Lande eine schon seßhafte Bevölkerung vorfanden, die sie nicht vertrieben, sondern sich unterwarfen, in Leibeigenschaft hinabdrückten oder mit Erbzins, Pacht und Steuer belasteten. In „Dörfern und Städten“ freilich hat der von Moser geschilderte Typus bei weitem
[1] Jellinek, a. a. O. S. 278.
[2] S. S. III, S. 305.
[3] Gesellschaft und Staat, S. 236. Vgl. Meinecke, Weltb. S. 28.
[256]
überwogen. Aber hier handelt es sich schon um Geschehnisse im voll entwickelten Staate, von denen erst später zu reden sein wird.
Auch Treitschke, der Theoretiker des Machtstaates, der führende „Legitimist“ der neueren Zeit, steht unverhohlen auf dem Standpunkt, daß „der“ Staat immer durch Eroberung und Unterwerfung entstanden ist: „Ohne den Krieg gäbe es gar keinen Staat. Durch Kriege sind alle uns bekannten Staaten entstanden“ [1]. „Die weitere Entwicklung bringt dann den Kampf der Stämme untereinander und ein Zusammenballen von größeren Massen zu einer gemeinschaftlichen Ordnung; es wird also Eroberung und Unterwerfung der eigentliche bewegende Grund größerer Staatsbildung sein. Die Staaten sind nicht aus der Volkssouveränität hervorgegangen, sondern sie sind gegen den Willen des Volkes geschaffen; der Staat ist die sich selbst setzende Macht des stärkeren Stammes“ (113). Er gibt eine ganze Anzahl geschichtlicher Belege : England ist durch die Eroberung der Normannen in der Tat ein neuer Staat geworden (129); der Staat des Islam beruht auf der Unterdrückung der anderen Völker durch die Bekenner des Muhammedglaubens (II, 33); durch das Schwert entstand der dorische Staat in Sparta (II, 221/2). In Indien haben sich die Eroberer zur obersten Kastenstellung über den Eroberten aufgeschwungen (I, 300). Der germanische Eroberer römischen Landes ist selbstverständlich steuerfrei (11,86). Daneben findet sich dann freilich auch eine Auslassung wie die folgende: „Aristoteles wird doch recht behalten, wenn er naiv sagt, der Staat sei eine Kolonie des Hauses. Stammesgemeinschaften auf Blutsverwandtschaften beruhend sind nach aller Wahrscheinlichkeit die erste Form staatlicher Bildung“ (113).
Röscher schreibt: „Das Übergewicht des Grundeigentums, welches die Landaristokratie voraussetzt, ist insgemein die Folge einer Eroberung, indem nämlich frische jugendliche Völker über alte, abgelebte, oder reifgewordene Völker über noch gänzlich unreife, keimartige den Sieg davon tragen“[2].
Eduard Meyer, auf den sich die Verfechter der Entstehung des Staates aus inneren sozialpsychologischen Kräften mit einem gewissen Recht berufen dürfen, ist ein viel zu großer Historiker, als daß er nicht angebrachtermaßen seine grundsätzliche Auffassung zurücktreten ließe. So schildert er z. B. die fortwährende Berennung des Kulturlandes von Sinear durch die Nomaden des Nordens und Ostens und die Semiten der Wüste[3]. Ebenso den Ansturm der semitischen und hamitischen Hirten gegen Ägypten. Er schreibt z. B.[4], daß im Norden Sinears uns Die folgenden Stellen aus demselben Buche durch Angabe
[1] Politik I, S. 72. der Seitenzahlen im Text.
[2] Politik, S. 68.
[3] Geschichte des Altertums I, 2, S. 378.
[4] ib. a. a. O. S. 388.
[257]
schon früh die Semiten als Herren entgegentreten. Und in seinen „Elementen der Anthropologie“ sagt er wörtlich: „So wiederholt sich in den äußeren und inneren Schicksalen in den Völkern immer wieder der Kreislauf, in dem bereits der große maurische Historiker Ibn Chaldûn die Grundform geschichtlichen Lebens erkannt hat : ein rohes kräftiges Volk — Ibn Chaldûn kannte nur die Geschichte des Islams und der seinem Bereich angehörenden Wüstenstämme, doch gilt von allen anderen Völkern, die zu höherer Kultur gelangt sind, im Grunde dasselbe — setzt sich in einem Kulturlande fest und schafft eine höhere Kultur oder übernimmt dieselbe von der unterjochten älteren Bevölkerung“ [1].
Und noch eine Autorität, die man hier wohl kaum erwartet haben wird; einen der gepriesensten und von der Gegenseite am zornigsten bekämpften Kirchenväter des Bourgeois-Liberalismus: Frédéric Bastiat. Er hat historisch die beiden Mittel der Bedürfnisbefriedigung, das politische und das ökonomische, geradezu vorbildlich unterschieden, hat aber freilich versäumt, die zureichenden ökonomischen Konsequenzen aus seiner Erkenntnis zu ziehen. Er schreibt[2] : „Es gibt nur zwei Mittel, um sich die Sachen zu verschaffen, die für die Erhaltung, die Verschönerung und die Vervollkommnung des Lebens nötig sind: die Erzeugung und den Raub (production et spoliation). Nun sagen manche, der Raub sei ein Zufall, ein ort- und zeitbestimmter Mißbrauch, von der Moral gebrandmarkt, vom Gesetz verworfen und daher der Aufmerksamkeit der politischen Ökonomie unwürdig.
„Aber man muß, bei noch soviel Wohlwollen und Optimismus, dennoch anerkennen, daß der Raub sich in dieser Welt in allzu großem Maßstabe vollzieht, sich allen großen menschlichen Tatsachen allzu allgemein beimischt, als daß irgendeine soziale Wissenschaft, und nun gar die politische Ökonomie, ihn übersehen dürfte.
„Ich gehe weiter! Was die gesellschaftliche Ordnung von der überhaupt erreichbaren Vollkommenheit trennt, ist nur das beständige Bestreben ihrer Mitglieder, sich auf Kosten der Anderen Leben und Entfaltung zu bereiten.
„Sodaß, wenn es keinen Raub gäbe, die Gesellschaft vollkommen, und die sozialen Wissenschaften ohne Gegenstand wären.
„Ich gehe noch weiter! Wenn der Raub das Mittel der Existenz einer gesellschaftlichen Gruppe geworden ist, so schafft sie sich alsbald ein Gesetz, das ihn heiligt, und eine Moral, die ihn lobpreist.
„Es genügt, einige der ausgeprägtesten Formen des Raubes zu nennen, um zu zeigen, welchen Platz er in den menschlichen Beziehungen
[1] Elemente der Anthropologie, S. 82, im Original nichts gesperrt.
[2] Sophismes économiques, 2. Serie, I, unter dem Titel: Physiologie de la Spoliation.
[258]
einnimmt.“ Und er nennt in vollkommener Genauigkeit als diese Formen den Krieg, die Sklaverei, die Theokratie und das Monopol [1].
Auch Jakob Burckhardt verwirft die Hypothese des Kontrakts als „absurd“ : „Noch kein Staat ist durch einen wahren ... Kontrakt (inter volentes) entstanden; denn die Abtretungen und Ausgleichungen wie die zwischen zitternden Romanen und siegreichen Germanen sind keine echten Kontrakte. Darum wird auch künftig kein solcher entstehen.“ Ebenso falsch ist „die optimistische Ansicht, wonach die Gesellschaft das Prius, und der Staat zu ihrem Schutze entstanden wäre, ... sondern die Gewalt ist wohl immer das Prius... . Von den furchtbaren Krisen bei der Entstehung des Staates, von dem, was er ursprünglich gekostet hat, klingt noch etwas nach in dem enormen, absoluten Vorrecht, das man ihm von jeher gewährt hat. ... Ist die Krisis eine Eroberung gewesen, so ist der früheste Inhalt des Staates, seine Haltung, seine Aufgabe, ja, sein Pathos wesentlich die Knechtung der Unterworfenen“[2].
Albrecht Wirth sagt: „Nirgend ist ein Staat aus bloßer friedlicher Übereinkunft hervorgegangen“[3].
Es wäre uns ein leichtes, diese Liste noch sehr zu verlängern. Wir glauben, darauf verzichten zu können. Wo nicht die Konfusion zwischen den drei Staatsbegriffen einspielt, ist die Übereinstimmung der Theoretiker fast als vollkommen zu bezeichnen.
Damit stehen wir am Ende unserer Untersuchung der Staatstheorien im allgemeinen und des Gesetzes der ursprünglichen Akkumulation im besonderen.
Es stellte sich uns schon prima facie dar als die ungeheuerliche Zumutung an unsere Gläubigkeit, anzunehmen.daß dieGeschichte nicht gewesen sei, oder doch jedenfalls auf die heutige Verfassung der Menschheit, auf die politische und wirtschaftliche Schichtung, nicht gewirkt habe. Wir haben uns jetzt davon überzeugt, daß dieseZumutung ebenso unbegründet wie kühn ist. Das sogenannte Gesetz ist ein einziger Knäuel von ganz verschiedenen Begriffen, die, wie ein Ragout von verschiedenen Fleischarten, durch eine nicht eben appetitliche Sauce von falschen Verallgemeinerungen, Konklusionen aus falschen Voraussetzungen, Trugschlüssen und dergleichen mehr zu einer scheinbar einheitlichen Substanz umgetäuscht wurden. Es ist ein Pseudogesetz und muß aus den sämtlichen Gesellschaftswissenschaften verschwinden, die es sämtlich geradezu verheert.
[1] Er definiert sogar das Monopol vollkommen korrekt als mein einziger, mir bekannter Vorgänger: es führt die Gewalt in den Wettbewerb ein und verfälscht derart das gerechte Verhältnis zwischen dem empfangenen und dem geleisteten Dienste.
[2] Weltgeschichtliche Betrachtungen, S. 27ff.
[3] Geschichtsphilosophisches, Pol. Anthrop. Revue, 1908.
[259]
II. Die Tatsachen.
(Die Entstehung des Staates.)↩
Die im vorigen Abschnitt dargestellten Staatstheorien nehmen, mit einziger Ausnahme der soziologischen Staatsidee, sämtlich an, daß die Vorgeschichte ganz allmählich in die Geschichte übergegangen sei; daß also die hier zu ziehende Grenze so willkürlich sei wie etwa die zwischen „Mittelalter“ und „Neuzeit“ [1] oder zwischen „neuer“ und „neuester Zeit“. Oder man nimmt an, Geschichte sei der Inbegriff der vergangenen Tatsachen, über die wir aus „Denkmälern“ wenigstens einige unmittelbare Kunde haben, Vorgeschichte aber sei alles, was vorher geschehen sei und daher „im Dunkel“ liege.
Nichts kann falscher sein ! Zwischen Vorgeschichte und Geschichte klafft die tiefste Kluft, die jemals einen Abschnitt in der Entwicklung der Menschheit bedeutet hat, eine wirkliche „Epoche“ im Sinne eines ganz neuen Anfangs: das „Zeitalter der Wanderung und Eroberung“. Es scheidet zwei Perioden, die die Griechen, vielleicht in lebendiger Erinnerung an noch nicht allzu lang versunkene Zeiten, als das „goldene“ und das „eherne“ Alter bezeichneten. Damit ist gewiß die vor jener Weltenwende liegende Zeit sehr stark idealisiert worden : aber ein großer Kern von Wahrheit liegt zugrunde. Die Zeit vorher kennt nicht die Scheidung der Menschen in Klassen mit allen ihren Folgen, kennt nicht die „Ausbeutung des Menschen durch den Menschen“ als dauernde Institution der Verfassung der Gesellschaften; sie ist der „Naturzustand“, den wir in seiner Realität geschildert haben.
Dann aber schaffen Wanderung und Eroberung den historischen Staat als das „Gehäuse“ der Klassenscheidung und der mit ihr verbundenen, durch die Klassenscheidung bezweckten und erreichten Ausbeutung: der schreckliche dreiköpfige Höllenhund, der den verdammten Seelen den Weg der Erlösung gesperrt hat bis auf den heutigen Tag.
Auf der Wanderung, unternommen zum Zweck der Ausplünderung und Eroberung, trafen kriegerischere oder zahlreichere oder besser bewaffnete[2] Völkerschaften oder Teile solcher (Männerbünde)[3] mit weniger kriegerischen oder zahlreichen oder schwächer bewaffneten Völkerschaften zusammen, unterwarfen sie und gründeten über ihnen ihren Staat, als „eine Rechtsinstitution, einer besiegten Gruppe
[1] Vgl. dazu v. Belows Rede auf dem deutschen Historikertag von 1924. Er bekennt sich zur Datierung der „historischen Schule“, die den Umschwung auf etwa 1550 festsetzt. Ich halte demgegenüber an meiner Datierung auf etwa 1370 durchaus fest. Vgl. mein „Großgrundeigentum und soziale Frage“, S. 391. Ich komme darauf zurück.
[2] S. S. I, S. 849: Die Bronze besiegt den Stein, das Eisen die Bronze.
[3] Heinrich Schurtz, Altersklassen und Männerbünde.
[260]
durch eine siegreiche Gruppe einseitig auferlegt, mit dem ursprünglich einzigen Zwecke, die Besiegten zugunsten der Sieger so hoch und so dauernd wie möglich zu besteuern“ [1].
Darüber sind sich heute die Meister der Ethnologie einig; nur durch terminologische Mißverständnisse werden Meinungsverschiedenheiten vorgetäuscht, wie wir am Beispiel Eduard Meyers und Holstis gezeigt haben.
Wir haben in unserer allgemeinen Soziologie (S. 1041ff.) die Auffassung Wilhelm Wundts dargestellt; wir wiederholen hier die Hauptpunkte:
Mit dem „Zeitalter der Helden und Götter“, das dem „totemistischen Alter“ folgt, tritt der Staat auf, dessen Gründung den Eintritt in diese Periode bezeichnet; im Wogen und Drängen der Völkerbewegung zerfällt allmählich die alte Stammesorganisation, und der Staat entsteht auf ihren Trümmern aus persönlichen Herrschaftsformen. Aber es sind nicht mehr die tröpfelnden Stammeswanderungen der Totemzeit, sondern die großen reißenden Ströme der eigentlichen Völkerwanderung, die hier den Wandel der Zeit einleiten... . Noch auf der Totemstufe gibt es nicht arm noch reich, nicht vornehm noch gering, sondern nur Unterschiede der persönlichen Leistung und Geltung. Jetzt bildet der Sieger im Völkerkampf den Herrenstand; die besiegte Urbevölkerung ist besitzlos. Dazu kommt die Gewinnung von Kriegsgefangenen, die als Sklaven den Boden der Herren bebauen. Mit der Klassenscheidung im Zusammenhang steht die Entwicklung der Gesellschaftswirtschaft... .
Die Stammesorganisation ist ein natürlich Gewachsenes, die Staatsorganisation willkürliche Satzung... . Die Kriegsgenossen werden auf erobertem Lande zu Markgenossen. Besitzverteilung, territoriale und militärische Organisation bilden so in ihrer Vereinigung die politische Gesellschaft.
Die Ständescheidung durchspaltet die ganze Gesellschaft. Das erobernde Wandervolk hat die Urbevölkerung unterworfen oder verdrängt und enteignet; so entstehen bei großer Stammesverschiedenheit die Kasten, bei geringerer die sozialen Klassen verschiedenen Rechts. Diese Unterschiede sind gestützt durch die der Eroberung verdankten Besitzunterschiede. Diese gesamte Entwicklung ist die Bildung der politischen Gesellschaft, des Staates, der hier zum ersten Male auftritt; die Stammesorganisation der totemistischen Zeit ist „nicht im geringsten eine unvollkommene, noch unausgebildete Staatsordnung, sondern ganz etwas Verschiedenes. Der Staat ist durchaus nicht, wie so Viele glauben, ,die ursprüngliche Form eines geordneten gemeinsamen Lebens' “.
[1] S. S. I, S. 922, vgl. a. S. 387/8, S. 367.
[261]
Erst auf dieser Stufe tritt, erwachsen aus der mit dem Dauerkriegs- zustande verbundenen dauernden Kriegsführerschaft, und erhalten und gefestigt durch die Notwendigkeit, die Unterworfenen niederzuhalten, das Königtum auf, und mit ihm die „Geschichte“, insofern sie als der Inbegriff der auf „Denkmälern“ überlieferten Geschehnisse betrachtet wird: denn der durch die Tribute seiner Untertanen und die Arbeit seiner Sklaven bereicherte König kann als Erster steinerne Tempel und Paläste erbauen, Bildsäulen und Gedenksteine aufrichten [1], um den Ruhm seiner Taten der Nachwelt zu übermitteln. So liegt auch von diesem untergeordneten Gesichtspunkte aus die Grenze zwischen Vorgeschichte und eigentlicher Geschichte, d. h. Staatengeschichte, vollkommen sicher fest[2].
Wir haben ferner an der gleichen Stelle (S. 1055ff.) die Quintessenz der weit und tief greifenden Forschungen Müller-Lyers gegeben:
Mit der frühfamilialen Epoche treten wir in das Reich des Staates und damit der Geschichte ein. Die Sippe ist verfallen, an die Stelle der Verwandtschaftsorganisation ist die Herrschaft getreten; das goldene Zeitalter der Gleichheit und Brüderlichkeit ist verronnen, das der Knechtschaft beginnt, „die dämonische Macht des Reichtums, die den Naturmenschen in den Kulturmenschen verwandelt, hat diese Umwälzung bedingt“.
Der Staat, der „in der konkreten Gestalt eines Herrschers oder einer herrschenden Klasse auftritt“, entzieht der Sippe ihre rechtlichen, sozialen und politischen Funktionen[3], die immer mehr erstarkende Familie ihre wirtschaftlichen... . Die Sippenverfassung wird aufgelöst durch den privaten Reichtum, der wieder auf der Sklaverei und der gleichfalls auf erobernder Gewalt beruhenden Hörigkeit beruht; für den Sklaven gibt es in der Sippe keinen Raum: man kann ihn nicht adoptieren, ohne ihm die Bruderrechte zu geben.
„Der Staat ist daher bei seinem ersten Auftreten zunächst Kriegsstaat, Räuberstaat. Er ist nichts weiter als ein System, durch das eine herrschende Minderheit eine beherrschte Mehrheit im Zaume hält und nach Kräften ausraubt und ausbeutet“[4].
[1] Vgl. Breysig, Stufenbau, S. 49.
[2] Beloch, Griech. Gesch. I, 2, S. 2.
[3] „Als herrschende Meinung gilt es heute, daß der gentilizische Charakter der altgermanischen Verfassung sich nicht über die Ortsgemeinde hinaus erstreckt, daß also die Hundertschaft, der ordentliche Gerichtsbezirk, oder gar die Völkei Schaft, der umfassende politische Verband, nichts mit ihm zu tun haben“ (v. Below, Der deutsche Staat des Mittelalters, S. 223). Auch Wundt (Elem. d. Völkerpsych., S. 30&) ist der Meinung, daß die Einteilung in Zehn-, Hundert- und Tausendschaften eine staatliche Einrichtung in seinem, unserem, Sinne ist, während die alte Geschlechterverfassung nur das binare System kannte. Auch in Deutschland war ursprünglich „der Vicus gleichbedeutend mit dem Geschlecht“ (Sybel, zit. n. v. Below, a. a. O. S. 41).
[4] Die Familie, S. 125.
[262]
Wir gehen jetzt daran, diesen Prozeß der Staatsbildung im einzelnen zu betrachten: nach seinen Objekten und Subjekten, seinen Motiven und seinem Verlauf.
1. Die Objekte der Staatsbildung. (Die Bauern). ↩
Der unbändige Jäger, der „praktische Anarchist“, läßt sich nicht zur Untertanenschaft herabdrücken. Wo er der größeren militärischen Stärke des Angreifers nicht auf die Dauer widerstehen kann, da weicht er, wenn möglich, in die „Randgebiete“ aus, in die der Sieger, weil seine Herden keine Weiden finden, nicht folgen kann, oder nicht folgen will, weil es der Mühe nicht lohnt. Wenn man den heutigen Nordamerikaner fragt, warum Indianerblut als eine Ehre, Negerblut aber als eine unauslöschliche Schande betrachtet wird, antwortet er: „They never did submit slavery“. In diesen Randzonen, unzugänglichen Gebirgen, armen Steppen oder Wüsten, werden dann die verdrängten Stämme zu den „Kümmerformen“ [1], die wir kennen, deren Typ der Buschmann ist.
Aus diesem Grunde hat Norwegen niemals einen eingeborenen Adel und niemals eine hörige Klasse gekannt. Die finnische Urbevölkerung wich in die Eiskappen aus[2].
Wozu sich der Jäger allenfalls versteht, ist eine Art von Klientelverhältnis zu den wandernden Stämmen, eine Erscheinung, die sich namentlich in Afrika häufig und seit uralter Zeit findet. Schon mit den Hyksos zogen solche abhängigen Jäger ins Niltal ein. Sie zahlen wohl einen geringen Tribut in Jagdbeute gegen Schutz und verstehen sich zum Kundschafter- und Wächterdienst, aber sie lassen sich eher vernichten, als zu regelmäßigem Arbeitsdienst zwingen[3].
Das eigentliche Objekt der Staatsbildung ist der Ansässige, zunächst der niedere Hackbauer, aber dann, auf höherer Stufe, auch schon der seinerseits selbst aus früherer Eroberung entstandene Staa: der Pflugbauern und Städter. Sie sind selbst dann faktisch an ihre „Scholle gefesselt“, wenn sie persönlich frei sind: sie können nicht ausweichen, weil ihr Lebensberuf sie an Acker, Haus und Werkstatt bindet, die sie nicht aufgeben können, ohne zugrunde zu gehen. Wenn sie nich: widerstehen können, bleibt ihnen nur die Unterwerfung[4].
[1] S. S. I, s. 628.
[2] Lippert, Kulturgeschichte II, S. 539. Vgl. S. S. I, S. 709 über den psychologische! Gegensatz zwischen den Adelsländern Schweden und Japan auf der einen, und der Bauernländern Norwegen und China auf der anderen Seite.
[3] Ratzel (Anthropogeographie I, S. 165) schildert das Verhältnis eines Pygmäen- Jägerstammes, der Bayaga, zu den Fan als keineswegs unfrei, sondern als auf reine: Gegenseitigkeit beruhend. Wenn die Bayaga unzufrieden sind, haben sie die Freiheit sich andere Jagdgebiete zu suchen.
[4] „Die Eroberer kommen und gehn. Wir gehorchen, aber wir bleiben stehn“ (Schiller, Braut von Messina).
[263]
Wir haben oben die lockeren Verbände der Hackbauern geschildert ; wir fügen hier hinzu, daß auch die Pflugbauern viel höherer Stufe noch ähnlich lose zusammenhalten, bis eine starke Staatsgewalt sie organisiert. Als Beispiel nennen wir die griechischen Amphiktyonien und Stammesbünde [1] .
In einem solchen Zustande ist das Zustandekommen einer kriegerischen Organisation zu Angriffszwecken kaum denkbar. Vor allem: welchen Zweck sollte ein Raubzug in einem Gebiete haben, das weithin nur von Bauernschaften bewohnt ist ? Der Bauer kann dem Bauern nichts nehmen, was die Mühe und Gefahr der Rüstung lohnen könnte. Land, das Hauptbesitztum des Bauern, ist im Überfluß vorhanden, und das bißchen Vieh, das der Hackbauer hält : Hühner, Hunde und allenfalls Schweine, lohnt oder verträgt den Transport nicht. Die Bedingungen, unter denen der Wunsch entstehen könnte, die Feldarbeit auf Sklaven abzuwälzen, sind hier ebensowenig gegeben. Jeder Familie bringt geringe Arbeit, die noch dazu fast ganz auf die Frauen fällt[2], genug zum Leben; einen Überschuß herauszuwirtschaften, liegt kein Motiv vor, da man in diesem Zustande kein Getreide gegen andere Güter vertauschen kann; ist doch unter so primitiven Verhältnissen nicht einmal eine reiche Ernte von großem Nutzen; Ratzel berichtet, daß die Hackbauern Afrikas gezwungen sind, Überschüsse alsbald in Bier zu verbrauen, um sie vor Ameisenfraß und sonstigem Verderb zu bewahren.
Aus allen diesen Gründen geht dem primitiven Bauern der kriegerische Offensivgeist ab, der den Jäger und noch viel mehr den Hirten auszeichnet. Und diese friedliche Grundhaltung wird noch dadurch verstärkt, daß ihn seine Beschäftigung nicht gerade kriegstüchtig macht. Er ist zwar muskelstark und wetterhart, ausdauernd und zäh, aber von langsamen Bewegungen und zögerndem Entschluß, während der Jäger und der Hirt durch ihren Beruf zu schneller Entschlußfähigkeit erzogen werden. Darum ist der primitive Bauer zumeist von sanfterer Gemütsart als jene. Große sagt freilich, daß „man gerade in dem Bereich dieser Kultur eine Menge der kriegslustigsten und grausamsten Völker findet. Die wilden Kannibalen des Bismarckarchipels, die mordgierigen Vitianer, die Menschenschlächter von Dahome und Aschanti, sie alle betreiben die „friedliche Ackerwirtschaft“[3]. Hier wird nicht ausreichend zwischen
[1] Vgl. Busolt, a. a. O. S. 6off.
[2] Wo die Arbeit schwer ist und daher auf die Männer fällt, liegen die Dinge anders. Das ist der Fall bei den brasilianischen Waldindianern, die nur auf mühsam gerodeten Urwaldlichtungen ihren Mais und ihre Manioka ziehen können, bei denen ferner das Schälen, Entgiften und Zubereiten der Manioka viele schwere Arbeit macht. Hier kommt es denn auch leicht zu Sklaverei, Hörigkeit und allem Zubehör. Wir werden diese Dinge, deren Kenntnis wir vor allem Max Schmidt („Die Aruaken“) verdanken, weiter unten genauer darstellen.
[3] Formen der Familie, S. 137.
[264]
den primitiven und den höheren Ackerbauern unterschieden; die letzteren, die mindestens schon „vorstaatlich“ leben, weil sie bereits Sklaven halten, haben die große Kluft zwischen Vorgeschichte und Geschichte bereits überschritten und die veränderte Psychologie, die wir kennen, angenommen.
Kurz, in den ökonomischen und sozialen Verhältnissen des primitiven Bauerngaus besteht keine Differenzierung, die zu höheren Formen der Integrierung drängte, besteht weder der Trieb noch auch nur die Möglichkeit zu kriegerischer Unterwerfung der Nachbarn, kann also kein Staat entstehen, und ist auch nie ein solcher entstanden. Wäre kein Anstoß von außen, von Menschengruppen anderer Lebensweise, gekommen: der primitive Bauer hätte die Herrschaft, die Ausbeutung und den Staat nicht erfunden. Es ist schon schwer genug, die lose Eidgenossenschaft in höchster Not einmal zu gemeinsamer Abwehr zu sammeln.
2. Die Subjekte der Staatsbildung. (Hirten und Wikinge.) ↩
Dagegen finden wir beim Hirtenstamme, auch bei dem isoliert vorgestellten, eine ganze Reihe von Elementen der Staatsbildung vor, und in der Tat haben die vorgeschrittenen Hirten den Staat schon fast völlig ausgestaltet, bis auf das letzte Merkmal, das den modernen Begriff des Staates erst ganz erfüllt: die Seßhaftigkeit; denn, wie wir zeigten, ein festes Gebiet besitzen sie schon, abgegrenzt nicht nur nach außen, sondern auch nach innen: auch die kleineren Stammes- abteüungen haben ihre fest bestimmten Gebiete und Grenzen [1].
Das eine der staatsbildenden Elemente ist die bis zu einem gewissen Grade gegebene Möglichkeit der Differenzierung in ökonomischer Hinsicht. Auch ohne das Dazwischentreten von äußerer Gewalt kann sich im Nomadenleben eine immerhin fühlbare Verschiedenheit der Vermögen ausbilden. Nehmen wir selbst als Ausgangspunkt die volle Gleichheit des Herdenbestandes an, so kann und wird doch nach einiger Zeit der eine reicher, der andere ärmer sein. Ein besonders geschickter Züchter wird seine Herde schneller anwachsen sehen, ein besonders aufmerksamer Wächter oder kühner Jäger wird sie besser vor der Zehn- tung durch Raubtiere bewahren. Das Glück tut das seine dazu: der eine findet eine besonders gute Weidestelle und gesunde Wasserplätze, dem anderen raubt eine Seudhe oder ein Schnee- oder Sandsturm den größten Teil seines Bestandes.
Indessen hält sich diese Differenzierung, solange der Stamm isoliert bleibt und sich keiner außerökonomischen Gewalt bedient, in
[1] Ratzel, Anthropog., I. S. 43.
[265]
sehr bescheidenen Grenzen. Geschick und Tüchtigkeit sind nicht mit Sicherheit erblich; Kraft, Sinnesschärfe und Gewandtheit schwinden mit dem Alter; der größte Herdenbestand wird in kleine Vermögen zersplittert, wenn viele Erben in einer Jurte heranwuchsen; und das Glück ist launisch. „So kam es im Winter bei längerer Dauer von Schneeverwehungen oder Glatteis häufig vor, daß der größte Teil der Herden in einem einzigen „Dschut“ verhungerte. Aber auch abgesehen von solchen besonderen, aber immerhin recht häufigen Unglücksfällen forderte überhaupt ein jeder Winter eine erhebliche Anzahl von Opfern“, wird uns von den Kirgisen berichtet [1]. Noch in unseren Tagen ist der reichste Mann der schwedischen Lappen, der „Renntierkönig“, durch derartige Unfälle so vollkommen verarmt, daß er von der Unterstützung der Regierung leben mußte.
All diese Gründe wirken dahin, den ursprünglichen Zustand ökonomischer Gleichheit immer wieder annähernd herzustellen; niemals kann es hier dahin kommen, daß die geringen Unterschiede des Besitzes sich sozial, als Klassenscheidung, auswirken. Und so ist denn auch das schon bestehende Patriarchat hier noch keine Herrschaft in irgendeinem Sinne: „Je friedlicher, ursprünglicher, echter der Nomade ist, um so weniger gibt es fühlbare Unterschiede des Besitzes. Die Freude ist rührend, womit ein alter Fürst der Tsaidam-Mongolen sein Tributgeschenk: eine Handvoll Tabak, ein Stück Zucker, und 25 Kopeken empfängt“[2].
Aber Ratzel fährt fort: „Wo Krieg geführt und Beute gemacht wird, gibt es größere Unterschiede, die im Besitz von Sklaven, Weibern, Waffen, edlen Reittieren zum Ausdruck gelangen“.
Der Besitz von Sklaven! Der Nomade hat die Sklaverei erfunden[3] und damit den Keimling des Staates geschaffen, das erste Klassenverhältnis in die Welt gestellt: die systematische Ausbeutung des Menschen durch den Menschen.
Wir haben gesehen, daß auch der Jäger unter Umständen Gefangene macht: aber er kann sie nicht mit Vorteil versklaven: darum tötet er sie oder adoptiert sie als gleichberechtigt in den Stamm. Auch der Hackbauer hat für unfreie Arbeit keine Verwendung. Erst der Hirt kann sie gebrauchen: hier existiert bereits ein Vermögenskern, ein echtes „Kapital“, sobald die abhängige Klasse vorhanden ist, deren Arbeit zu seiner Vermehrung, zur Steuer von „Mehrwert“ ausgenützt werden kann.
[1] Junge, Das Problem der Europäisierung des Orients, S. 265.
[2] Ratzel, Völkerkunde II, S. 555.
[3] Das ist cum grano salis zu verstehen: die Sklaverei zum Zwecke der dauernden wirtschaftlichen Ausbeutung! Wir kommen unten sub tit. „Sklaverei“ ausführlich darauf zurück.
[266]
Dieser Zustand ist erst auf der Stufe der Weidewirtschaft erreicht. Die Kräfte einer Familie langen ohne fremde Hilfe nur für den Schutz und die Leitung einer Herde von begrenzter Zahl hin. Solch fremde Hilfskräfte finden sich aber in der Horde vor Erfindung der Sklaverei nur in sehr geringem Maße : einige fremde Schutzbefohlene, Flüchtlinge zumeist vor der Blutrache, auf kürzere Zeit wohl auch ein durch ein Unglück verarmter Stammesbruder, der sich im Lohnwerk den Grundbestand einer neuen eigenen Herde erwirbt, wie etwa Jakob bei Laban. Wir finden solche Flüchtlinge überall, z. B. bei den Ovambo nach Ratzel, „wo sie sich zum Teil in sklavischer Stellung zu finden scheinen“ [1]. Hier und da tritt wohl auch ein ganzes armes Hirtenvolk halb freiwillig in den Dienst eines reichen: „So bemühen sich die Tungusen, die sehr arm sind, in der Nähe von Tschuktschen-Niederlassungen zu leben, weil sie bei den an Renntieren reicheren Tschuktschen als Hirten Verwendung finden; sie werden dann mit Renntieren bezahlt. Und die Unterwerfung der Ural-Samojeden durch die Sirjänen folgte der allmählichen Usurpation ihrer Weidegründe“[2].
Aber vielleicht mit Ausnahme des letzterwähnten Falles, wo die außerökonomische Gewalt bereits ihre Rolle spielt, reichen die wenigen im Clan vorhandenen kapitallosen Arbeitskräfte nicht hin, um sehr große Herden zu hüten. Und doch zwingt der Betrieb selbst dazu, sie wenn irgend möglich zu teilen: denn ein Weidegrund darf nicht ohne Schaden zu stark besetzt, „überstoßen“ werden, wie man in der Schweizer Alpwirtschaft sagt; und die Gefahr, den ganzen Bestand zu verlieren, mindert sich offenbar, gleiche Hütung vorausgesetzt, in dem Maße, wie man ihn auf verschiedene örtlichkeiten verteilt. Dann vernichten Seuchen, Stürme, Schneefall nur einen Teil, und auch der Grenzfeind kann nicht alles auf einmal nehmen. Wer es sich irgend leisten kann, handelt wie heute ein größerer Rentner: er setzt nicht alles auf eine Karte, versichert sich sozusagen in sich selbst. So war z. B. bei den Herero „jeder nur etwas reichere Besitzer gezwungen, neben der eigentlichen Hauptwerfte immer noch einige Viehposten zu haben, worüber die jüngeren Brüder oder andere nahe Verwandte oder in Ermangelung dieser erprobte alte Knechte (nämlich Sklaven) die Aufsicht führen“[3].
Aus diesem Grunde, weil er ihn als Weidesklaven brauchen kann schont der Nomade den gefangenen Feind. Wir können in einer Kultsitte der Skythen noch den Übergang von der Tötung zur Verknechtunr. beobachten: sie opferten an ihren Gaumalstätten je einen von hundert
[1] Völkerkunde I, S. 214. Auch Laveleye erzählt aus Irland von diesen „Fuidhirs' („Das Ureigentum“).
[2] Ratzel, Völkerkunde I, S. 648.
[3] Ratzel, Völkerkunde II, S. 99.
[267]
gefangenen Feinden. Lippert, der die Tatsache berichtet, erklärt sie wie wir aus dem „Werte“, den jetzt ein Weidesklave hat [1].
Mit der Eingliederung der Sklaven in den Hirtenstamm ist der Staat — bis auf das Moment der Seßhaftigkeit — in seinen wesentlichen Elementen fertig[2].
Er hat die Form: die Herrschaft, und den Inhalt: die wirtschaftliche Ausbeutung menschlicher Arbeitskräfte. Und nun kann die ökonomische Differenzierung und soziale Klassenbildung mit aller Kraft einsetzen. Zum ersten Male stoßen wir jetzt auf das Gesetz, das das wirtschaftliche Leben im Staate von hier an beherrscht : das Gesetz der Agglomeration um vorhandene Vermögenskerne. Die Herden der Großen, klug verteilt, und von zahlreichen bewaffneten Knechten bewacht, erhalten sich in der Regel auf ihrem Bestände und vermehren sich durch den größeren Anteil an der Beute, den der Reiche, entsprechend der von ihm ins Feld gestellten größeren Zahl (unfreier) Krieger erhält, wohl auch schon durch Raubzüge auf eigene Faust mit seinen Knechten erwirbt, schneller als die der kleinen Gemeinfreien.
Diese Differenzierung ergreift nun auch die inneren Beziehungen der Genossen untereinander. Zum ersten Male ist die Möglichkeit unbegrenzten Reichtums vor dem Geiste des Menschen auferstanden: die Habgier feiert ihrenEinzug in die Welt. Wenn jetzt einUnglück einen der Genossen heimsucht, findet er nicht mehr einen reicheren Bruder, der ihm gegen Dienste zu einer neuen Herde und bald wieder erlangter Selbständigkeit verhilft, sondern einen hartgewordenen Kapitalisten, der die Gewohnheit der Ausbeutung, erworben an seinen Sklaven, jetzt auch gegen den Clanbruder anwendet. Überall finden wir mit dem Institut der Sklaverei alsbald einen sehr üblen Wucher an den eigenen Stammesgenossen verbunden. Der verarmte Hirt muß sich dem reich gebliebenen verdingen und sinkt jetzt im Range unter ihn, wird von ihm abhängig, sein „Klient“. Das finden wir überall, wo Hirten leben, d. h. in allen drei Kontinenten der alten Welt. Meitzen berichtet von den nomadischen Lappen in Norwegen: „300 Stück pro Familie waren ausreichend; wer nur hundert hat, muß in den Dienst der Reichen treten, deren Herden bis zu 1000 Stück zählen“[3], und von den zentralasia-
[1] a. a. O. II, S. 302.
[2] Es gibt vielfach bereits eine halbe Seßhaftigkeit unter den Hirten wie unter den Jägern auch. Viele säen um die Zelte oder Hütten herum ein Sommerkorn (die Germanen z. B. den Hafer, die Tataren den nach ihnen benannten Buchweizen (Polygonum tataricum) und ziehen erst nach der Ernte auf die Winterweiden. Die volle Seßhaftigkeit ist nach Lacombe (a. a. O. S. 194) eine Folge der Entdeckung der Düngung;, sie macht das Wechseln der Böden überflüssig. Die Kultur ist „im wahrsten Sinne des Wortes eine im Mist gewachsene edle Pflanze“.
[3] Siedlung und Agrarwesen der Westgermanen usw. I, S. 273.
[268]
tischen Nomaden: „Eine Familie braucht 300 Stück Vieh zur Behaglichkeit; 100 Stück ist Armut; dann kommt Schuldnerschaft. Der Knecht muß den Acker des Herrn bauen“[1]. Aus Afrika berichtet Ratzel von den Hottentotten eine Art von „Commendatio“ : „Wer nichts hatte, suchte sich bei den Reichen zu verdingen ; sein einziges Ziel war, in den Besitz von Vieh zu kommen“ (a. a. O. I, S. 702). Laveleye, der aus Irland das gleiche erzählt, führt sogar Ursprung und Namen des Feudalsystems (système féodal) auf diese Viehleihe der reichen an die armen Stammesglieder zurück: danach war ein fee-od (Vieh-Eigen) das erste Lehen, mit dem der Große den Kleinen als „seinen Mann“ an sich band, mindestens so lange, bis das Darlehen zurückgezahlt war. (Bonald [a. a. O. S. 401] glaubt romantisch, Feudalität bedeute Treue [fidélité]).
Jetzt erhalten die Großen auch noch erblich das Oberpriesteramt; oder der erbliche Patriarch wird vermöge seiner Stellung reicher mit Beute beteilt und wächst derart über die Genossen empor. Damit wird auch der Mißbrauch dieses wichtigen Amtes, die Ausnützung des Aberglaubens der Menge durch den mit dem Dienst der Götter be- und allein vertrauten Mann, die Auflegung von ihm nützlichen Tabus, möglich und, wie Menschen nun einmal sind, auch fast notwendig. Und auch das wirkt auf die Differenzierung gewaltig fördernd.
Derart wächst die Macht des Patriarchen von allen Seiten her und ersteigt jetzt erst die Höhe, die wir mit dem Begriff zu verbinden gewöhnt sind. Die absolute Macht über die Sklaven dehnt sich auf das Weib — oder vielmehr auf die Weiber — aus : denn der Nomade, der es sich leisten kann, ist ausgesprochen polygam; die Frau sinkt tiefer und tiefer in ihrer sozialen Stellung, bis sie kaum mehr ist als Objekt der Geschlechtslust, Gebärerin und Haremssklavin; die Kinder werden der gleichen unbeschränkten Gewalt unterworfen. Auch in den Söhnen, die immer zahlreicher werden, je mehr der Harem wächst (nach Bérard haben Nomadenfürsten im Iran bis zu 100 Kindern) wachsen dem Herrn neue zuverlässige Wächter und Krieger heran, und für die Töchter erhält er reiche Brautgaben.
So spaltet eine immer breitere Kluft die ehemals gleichen Clangenossen, bis ein echter, unendlich stammesstolzer Adel, die reichen Nachkommen der reichen Patriarchen, den kleinen Gemeinfreien gegenübersteht. Auch das ist eine ganz neue Erscheinung, die unmittelbare Folge des Krieges und der Sklavenhaltung. „Die Rothäute haben auch in ihrer fortgeschrittensten Organisation keinen Adel und keine Sklaverei ausgebildet, und dadurch unterscheidet sich ihre Organisation am wesentlichsten von der der alten Welt. Beides erhebt sich erst auf dem Boden des Patriarchats tierzüchtender Völker“[2].
[1] Ib. 1, s. 38.
[2] Lippert, a. a. O. II, S. 522. Die Angabe ist nicht ganz korrekt. Die höchst entwickelten Indianer, die Fischervölker des Nordwestens, haben beides, Adel und Sklaven. In Mexiko gab es einen ausgesprochenen Adel, dem allein Eigenland zustand, während die Gemeinen keines hatten (Schmidt, Ethnol. Volksw. S. 152). Und in Peru waren die Inka geradeso der Adel wie die Spartiaten in Lakedaimon und Messenien, usw. Ferner finden wir über ganz Südamerika verbreitet die Kultur der Aruaken, höherer Bauern, die fast überall Sklaven jagen und halten, um die schwere Arbeit der Rodung im Urwald zu tun (Schmidt, Die Aruaken).
[269]
Und so finden wir denn bei allen entwickelten Hirtenvölkern die soziale Scheidung in drei distinkte Klassen: Adel (Fürsten der Stammhäuser im biblischen Ausdruck), Gemeinfreie und Sklaven, und vielleicht eine Mittelschicht zwischen den beiden letzten Klassen: die verarmten, in Schuldknechtschaft verfallenen Stammesgenossen. Nach Theodor Mommsen haben „alle indogermanischen Völker die Sklaverei als rechtliche Institution“ [1]. Das gleiche wie für die Arier gilt für die Semiten Asiens und Afrikas, die Masai und Wahuma usw., für die Mongolen und die Hamiten (bei allen Fulbe der Sahara „teilt sich die Gesellschaft in Fürsten, Häuptlinge, Gemeine und Sklaven“)[2] und für die Ho va auf Madagaskar[3].
Läge neben der Steppe nicht das Ackerland und das Städtewesen: der Hirt käme nimmer über dieses Stadium hinaus. Isoliert, lebt der Nomade in ewiger Urzeit. „Das patriarchalische Regiment verleiht der Rasse wie kein anderes Unveränderlichkeit, weil es von Jahrhundert zu Jahrhundert dieselben und gleichen Bedingungen der Existenz aufrecht erhält“[4]. Auch Lacombe zeigt, daß Hirten mit Hirten niemals eine höhere Form der Integration schaffen können[5]. Was ihnen isoliert möglich ist, ist nur die Zusammenballung ungeheurer Kriegerscharen zu gemeinsamem Raubzug unter gewaltigen Führern ; das gilt vor allem für die sehr beweglichen Kamel- und Rossenomaden, viel wenigei für die Rinderhirten, die nur langsam wandern können und dazu der besten Weiden bedürfen, während das Pferd, das Geschöpf der Steppe, und das Kamel, das Geschöpf der Wüste, schnell auch im armen Lande von Weide zu Weide, von Wasserstelle zu Wasserstelle kommt und den Reiter trägt. Darum ergießen sich die ungeheuren Heereszüge der Nomaden fast nur aus Asien und Arabien, den Ländern der Steppe und der Kamel- und Rossezucht, und später aus großen Weideländern, wie Ungarn und Südostrußland: aber Magyaren, Hunnen, Tataren, Türken sind ursprünglich Völker Zentralasiens.
Wenn, wie wir sahen, der Jäger dem Jäger, der Hackbauer dem
[1] Römische Geschichte I, S. 17. Es sind denn auch alle Arier patriarchalisch organisiert (Vinogradoff, a. a. O. I, S. 224).
[2] Ratzel, Völkerkunde II, S. 518.
[3] ib. 1, s. 425.
[4] Demolins, Comment la route crée le type social I, S. 18.
[5] De l'histoire considérée comme science, S. 194ff.
[270]
Nachbarn nichts nehmen kann, was die Mühe und Gefahr eines Feldzuges lohnt, so ist das beim Hirten anders. Sein Reichtum, und damit seine soziale Stellung, ruht auf seinem Herdenbesitz; den kann er fast grenzenlos vermehren, wenn er nur die nötige Anzahl von Sklaven zu seiner Bewachung gleich mit erbeutet. Darum bildet sich zwischen Hirten in der Tat leicht ein dauernder Kriegszustand aus, und der Patriarch erhält zu seinem Amt als erblicher Opferpriester des Stammes auch noch das des erblichen Kriegshäuptlings: der erste Caesaropapismus, eine ungeheure Erhöhung seiner Macht.
Jetzt tritt auch die psychische Veränderung ein, von der wir schon gehört haben. Die Stämme werden jetzt erst eigentlich kriegerisch und grausam. Der Raub und der Krieg sind das Hauptgewerbe geworden : damit wird die Tapferkeit die höchste aller Mannestugenden. Man verlangt vom Krieger Härte gegen sich selbst, stolzeste Todesverachtung, Widerstandskraft gegen Schmerz, Qual und Tortur, kein Wunder, daß er mit nicht geringerer Härte gegen den Feind verfährt, den er dadurch eher zu ehren meint. Und wie immer alle Ehre mit der Grundlage der Existenz verknüpft ist, wird jetzt der Raub zum ehrenvollsten aller Gewerbe: „Latrocinia nullam habent infamiam, quae extra fines cujusque civitatis fiunt“ (auch das wußte Hobbes und hätte es auswerten können), sagt Caesar von den Germanen und fährt fort: „atque ea juventutis exercendae ac desidiae minuendae causa fieri praedicant“ [1]. Und beiden Tataren muß sich der Jüngling den Ehrentitel „Batir“, Held, erst durch einen Viehraubzug erwerben[2].
So gewöhnt sich der Hirt allmählich an den Kriegserwerb und an die Bewirtschaftung des Menschen als eines verknechteten Arbeitsmotors. Und man muß anerkennen, daß seine ganze Lebensweise ihn für die Anwendung des „politischen“ anstatt des „ökonomischen Mittels“ geradezu prädestiniert:
Er ist körperlich stärker und ebenso gewandt und entschlossen wie der Jäger, dessen Nahrungserwerb, wenigstens in seinen heutigen Sitzen im Randgebiet, allzu unregelmäßig ist, als daß er zu der der Rasse bestimmten höchsten Größe und Kraft aufwachsen könnte. Der Hirt aber, dem in der Milch seiner Herdentiere der Nahrungsquell ohne Ende fließt[3], und der Fleischnahrung hat, so oft er sie begehrt, wächst fast überall zum Riesen, der Rinderhirt Asiens und Afrikas (Sulu und andere Kaffernstämme) gerade wie der arische Roßnomade Nordeuropas. Zum zweiten ist der Hirtenstamm an Kopfzahl unver-
[1] De bello gallico VI, 23.
[2] Ratzel, Völkerkunde II, S. 391. Vgl. Vico, der das auch bereits gesehen hat, a. a. O. S. 269/70.
[3] Nach Demolins (a. a. O.) haben auch hier die Rossenomaden einen Vorteil, weil Stutenmilch sich in Gestalt von Kumys besser konservieren lasse als Kuhmilch.
[271]
gleichlich größer als die Jägerhorde, nicht nur, weil die Gruppe viel mehr Nahrung aus gegebener Fläche holen kann — die Kapazität des Landes [1] ist ungleich größer für sie — : sondern vor allem auch aus dem Grunde, weil die Verfügung über tierische Milch die Säugeperiode der Mütter abkürzt und viel häufigere Geburten gestattet, während gleichzeitig die Säuglingssterblichkeit, die bei den Jägern enorm ist, stark zurückgeht, und die Kindertötung aus der Übung kommt; sie ist nicht mehr nötig. Daher sind die Weidesteppen der alten Welt zu jenen unerschöpflich scheinenden Staubecken geworden, die periodisch in ungeheuren Überschwemmungen das Tiefland der Kultur verheerten. „Vagina gentium“, nannten noch die Römer Germanien.
Eine bedeutend größere Zahl wehrhafter Krieger also, als bei den Jägern, jeder einzelne stärker, und doch alle zusammen mindestens ebenso beweglich wie die Jägerhorde, die Reiter unter ihnen, Kamel- und Rossereiter, sogar ungleich beweglicher. Und diese größere Masse bester Einzelkräfte zusammengehalten durch eine Organisation, wie sie nur unter der Befehlsgewalt des sklavenhaltenden, herrschaftsgewöhnten Patriarchats möglich war: eine Disziplin, die dem lockeren Gefolgsdienst der einem Häuptling geschworenen jungen Krieger eines Jägerstammes gar nicht vergleichbar ist, und die schon durch die nomadische Lebensweise vorgebildet, ja, zur Reife gebildet ist.
Der Jäger nämlich jagt in der Regel am vorteilhaftesten allein oder in kleineren Gruppen: der Hirt aber bewegt sich am vorteilhaftesten in dem großen Zuge, im geschlossenen Verbände, der seinen Herdentieren schon von Natur eingebildet ist, und dem er sich anpassen müßte, selbst wenn er keine Vorteile böte; in dem ferner der Einzelne am besten geschützt ist, dem Zuge, der in jedem Sinne bereits ein Heereszug ist, gerade wie der Rastplatz in jedem Sinne ein Feldlager darstellt. So bildet sich ganz von selbst die Übung taktischer Manöver, strenger Ordnung, straffer Mannszucht aus. Es klingt fast wie die Schilderung des Drills einer modernen berittenen Truppe, wenn Ratzel von den Nomaden erzählt: „Man geht wohl nicht fehl, wenn man zu den disziplinierenden Kräften im Leben der Nomaden die seit Urzeiten gleiche Zeltordnung rechnet. Jeder und Alles hat hier seine feste altbestimmte Stelle; daher die Raschheit und Ordnung im Auf- und Abbruch, Neu- Aufstellung und -Einrichtung. Nur dieser festen Ordnung ist es zu danken, daß das Zelt mit seinem ganzen Inhalt in Zeit von einer Stunde verpackt und verladen werden kann“[2].
Die gleiche, in friedlicher Wanderung ausgebildete und erprobte Ordnung beherrscht nun auch den kriegerischen Marsch der Hirtenstämme. Und dadurch werden sie zu berufsmäßigen und, bis der „Staat“
[1] S. S. I, S. 835/6.
[2] Völkerkunde II, 545.
[272]
unter dem Druck ihrer Angriffe noch höhere und militärisch noch wirksamere Organisationen schafft, zu unwiderstehlichen Kriegern. Hirt und Krieger werden zu identischen Begriffen, aber die letzte Eigenschaft überwiegt, je mehr Sklaven erbeutet werden. Denn jetzt ist der Freie von eigener Arbeit fast ganz entbunden und kann sich dem fröhlicheren Kriegshandwerk widmen. „Die Turkmenen konnten in erheblichem Maße ... Sklaven halten. Mit deren Hilfe aber konnten sie Ansässigenwirtschaft und Nomadenleben in ganz anderer Weise verbinden, als selbst die Bergkirgisen es vermochten... . Wer unter den Turkmenen über zahlreiches Vieh verfügte, lenkte im allgemeinen sein Hauptaugenmerk auf diesen Zweig der Urproduktion. Er ließ dabei die Sklaven arbeiten und g e η ο ß nomadisierend selbst gänzlich ein freies Soldatenleben“ [1].
Wir haben hier etwas vorgegriffen : denn der Turkmene herrscht bereits im Staat über unterworfene Bauern und Städter der Oasen; wir wollten zeigen, wie lange die gleiche Psychologie andauert, und vor allem, wie es noch auf der reinen Hirtenstufe zu jenen gewaltigen Massenzügen kommen kann, die wir aus der Geschichte Europas und Asiens kennen. Der sklavenhaltende Nomade kann sich für geraume Zeit von seiner Famüie trennen, deren wirtschaftliche Existenz durch die Arbeit der Sklaven sichergestellt ist, und auf Abenteuer und Beute ausziehen. Je größer die Masse, um so sicherer der Sieg; und so vereinen sich die wehrhaften Reiter vieler Stämme leicht unter dem Befehl eines berühmten Feldherrn: Dschinghis Khan, Tamerlan, Attila.
Was Ratzel von den zentralasiatischen Nomaden sagt, gilt für alle: „Der Nomade ist als Hirt ein wirtschaftlicher, als Krieger ein politischer Begriff[2]. Ihm liegt es immer nahe, aus irgendeiner Tätigkeit in die des Kriegsmannes und Räubers überzugehen. Alles im Leben hat für ihn eine friedliche und kriegerische, eine ehrliche und räuberische Seite; je nach den Umständen kehrt er diese oder jene heraus. Sogar Fischerei und Seefahrt schlugen in den Händen der ostkaspischen Turkmenen in Seeräubertum um... . Der Gang des anscheinend friedlichen Hirtendaseins bestimmt den des Krieges; der Hirtenstab wird zur Waffe. Im Herbst, wenn die Pferde gekräftigt von der Weide hereinkommen, und die zweite Schafschur vollendet ist, sinnt der Nomade, welchen Rache- oder Raubzug (Baranta, wörtlich: Vieh machen, Vieh rauben) er bis dahin vertagt hatte. Das ist der Ausdruck eines Faustrechts, das in Rechtsstreitigkeiten, im Ehrenhandel und bei Blutrache Vergeltung und Unterpfand im Wertvollsten sucht, das der Feind besaß, seinen Herden... . Zur Lust der Abenteuer gesellt sich die Freude am Besitz, und so entwickelt sich die dreifache, abwärtsführende Stufenreihe von Rächer, Held und Räuber“[3].
[1] Junge, a. a. O. S. 272/275. Vgl. Lippert, a. a. O. II, S. 539·
[2] Vgl. Anthropogeographie, S. 99.
[3] a. a. O. II, S. 390/1.
[273 ]
Ganz ähnlich wie bei den Landnomaden liegen die Verhältnisse bei den Seenomaden, den „Wikingen“, um den nordischen Ausdruck auf die ganz allgemeine Erscheinung anzuwenden. Um so mehr, als in den für die Universalgeschichte wichtigsten Fällen die Seenomaden nichts sind als auf das Meer hinausgegangene Hirten [1].
Wir haben soeben eine der unzähligen Tatsachen angeführt, die zeigen, daß der Hirt sich nicht lange besinnt, statt des Pferdes oder des „Schiffs der Wüste“ die „Rosse der See“ (die Ausdrücke allein sprechen Bände) zum Raubkriege zu benutzen. Was dort von den Turkmenen östlich der Kaspisee berichtet wurde, gilt von allen Hirten, die die See oder auch nur große Ströme erreichen, und gilt namentlich in allen Geschichtsepochen von dem großen meeranliegenden Steppenland im Süden und Südosten des heutigen Rußland. Schon von den Skythen sagt Lippert: „In dem Augenblicke, da sie den Nachbarn die Kunst ablernen, das Meer zu befahren, verwandeln sich die Wanderhirten, Homers ,verehrliche Rosselenker und Milchesser und Habelose, die rechtlichsten Menschen' (Ilias XIII, 3) genau wie die baltischen und skandinavischen Brüder in kühne Seefahrer. Strabo (Cas. p. 301) klagt : seitdem sie sich aufs Meer wagten, sind sie, Seeraub treibend und die Stammfremden ermordend, schlechter geworden, und, mit vielen Volksstämmen verkehrend, nehmen sie an dem Kleinhandel und der Verschwendung dieser Teil“ [2].
So geht es dort durch die Jahrhunderte fort. Die Nowgoroder „Uschkujniks“ führten auf der Kama und Wolga regelmäßig Raubzüge aus[3]; die Donkosaken des Taras Bulba drangen auf ihren leichten Kähnen tollkühn bis nach Konstantinopel vor und plünderten alle Küsten des Schwarzen und einige des Mittelmeers.
Ganz ebenso geschah es weiter westlich von den vielzerklüfteten Küsten Kleinasiens und der Balkanhalbinsel aus; „boten doch die griechischen Gewässer mit ihren zahllosen versteckten Buchten und kleinen Inseln dem Seeräuber die trefflichsten Schlupfwinkel“[4].
Auch die Hellenen, ursprünglich ebenfalls „ein Volk von Hirten und Ackerbauern“, begannen im XVI. Jahrhundert v. Chr. sich „auf die offene See hinauszuwagen, nicht so sehr zu Handelszwecken, sondern, wie es dem kriegerischen Sinne des Volkes und seiner Fürsten entsprach, zu Raubfahrten nach den Inseln“[5]. Ihnen fiel die alte kretische,
[1] „Steppe und Meer in ihrer einförmigen Schrankenlosigkeit sind gleich geeignet, große und schwer erreichbare Eroberervölker zu zeugen, deren größte Starke eben oft nur die Unmöglichkeit ist, sie in ihren Räumen zu erreichen“ (Ratzel, Anthropogeographie I, S. 292).
[2] Kulturgeschichte I, 471.
[3] Kostomarow, Russische Gesch. in Biographien I, S. 199/215.
[4] Beloch, Griech. Gesch. I, S. 282.
[5] Beloch, Griech. Gesch. I, S. 126.
[274]
„minoische“ Kultur zum Opfer, und Ägypten hatte so zu leiden, daß es den Hellenen die Häfen sperrte [1]. Bis spät in die eigentliche Staatszeit hinein blieben diese Gegenden Sitz einer Piraterie, die nur in kurzen Perioden durch eine starke Seemacht einigermaßen in Zaum gehalten werden konnte. Noch des Polykrates von Samos Herrschaft war nichts als ein Piratenstaat. Es ist, da wir einmal vorgegriffen haben, überall die gleiche Gelegenheit, die Seediebe macht, und überall die gleiche Psychologie, die die Handlungsweise (gerade so wie den verwandten Schmuggel auf höherer Stufe) sanktioniert. Aus England berichtet Brodnitz: „Unter Eduard II. sind Häfen wie Winchelsea, Rye und Romney richtige Piratennester, gegen die auch der König machtlos ist. Die Piraterei galt als erlaubt und minderte auch das soziale Ansehn nicht. Wir sahen ja, daß ein notorischer Seeräuber Bürgermeister von Winchelsea wurde, und ein Abt seelenruhig ein Weinschiff plünderte. Auf der See galt allein das Recht des Stärkeren, hier war die Schule, in der später die großen Piraten, wie Hawkins und Drake, die Begründer der englischen Seeherrschaft, heranwuchsen“[2].
Um zu den Anfängen zurückzukehren, so sind überall fast, mit einziger Ausnahme der Lydier[3], die Nomaden zu Piraten geworden: nicht nur die Hellenen, die früh schon Ägypten berannten und dank ihrer großen Kriegstüchtigkeit später als Reisläufer dem Psammetich die Alleinherrschaft erkämpfen halfen, sondern auch die Karier an den Felsschären der Südküste Kleinasiens, die Phönizier von ihren Sitzen in Syrien und später von ihren Kolonien in Nordafrika, Spanien, Sizilien, Sardinien und Korsika aus, die Etrusker, die Dalmatier, die Griechen von ihren Pflanzstädten am Mittel- und Schwarzen Meere; und wieder später die Araber und die aus ihnen und den eingeborenen Berbern entstandenen „Mauren“ und die Türken: alles ursprünglich Landnomaden ; bis tief in die Neuzeit hinein sind diese Küsten der Sitz einer nicht auszurottenden Seeplage, die den Handel und sogar die Küsten der christlichen Welt heimsucht, tausende in Sklaverei verschleppt, Städte und Dörfer zerstört. Nicht umsonst liegen trotz Wassermangel und äußerster Erschwerung der Landwirtschaft die meisten küstennahen Städte Italiens auf Hügeln; noch heute zeugen überall Wachttürme von der Bedrohung, die wie ein Alp auf den Seelen lag.
Vor allem aber sind es die Wikinge im eigentlichen Verstände, die Anwohner der Ost- und Nordsee, die ihre Herden verlassen und überall ihre Herrschaft begründen : in England, in Rußland, in Nordfrankreich, in Sizilien, die allen Völkern ihren Adel und ihre Fürstenhäuser geben.
[1] Kulischer, Zur Entw.-Gesch. d. Kapitalzinses (Jahrb. f. Nat.-Ök. III. Folge Bd. 18, S. 318).
[2] Engl. Wirtsch. Gesch., S. 342. Auch die Makololo und Marotse sind Land- und Flußräuber (auf dem Sambesi) zugleich (Richter, Die Marotse).
[3] Beloch, a. a. O. I, S. 126.
[275]
Indessen können Seenomaden, d. h. Seeräuber, auch ohne die Zwischenstufe des Hirtentums, unmittelbar aus Fischervölkern entstehen.
Wir haben soeben die Ursachen kennen gelernt, die dem Hirten die Überlegenheit über den Hackbauern verleihen : die relativ bedeutende Volkszahl der Horde, bei einer Tätigkeit, die den einzelnen Mann zu Mut und schnellem Entschluß, und die Masse als Ganzes zu straffer Disziplin erzieht. All das gilt auch für den seeanwohnenden Fischer. Reiche Fischgründe gestatten, wie die Nordwestindianer am Vancouver- Sund, die Tlinkit und andere, zeigen, eine stattliche Volksdichtigkeit [1] ; hier ist auch die Sklavenhaltung wirtschaftlich vorteilhaft, da der Unfreie beim Fischfang mehr erwirbt, als seine Ernährung kostet: darum finden wir, hier allein unter den Rothäuten, die private Sklaverei ausgebildet und finden dann auch alle damit zusammenhängenden anderen Institutionen: die einsetzende Klassenspaltung in Reiche und Arme und den Wucher.
Hier wie dort erzeugt der Befehl über Sklaven die Gewohnheit der Herrschaft und den Geschmack am „politischen Mittel“ ; und hier wie dort kommt diesem Wunsche die straffe Disziplin entgegen, die die Seefahrt geradeso ausbildet wie der Hirtenzug: „Beim gemeinsamen Fischfang ist nicht der letzte Vorteil die Disziplinierung der Mannschaften, die sich in den größeren Fischerbooten einen Anführer wählen, dem unbedingt zu gehorchen ist, da vom Gehorsam jeglicher Erfolg abhängt. Die Regierung des Schiffes erleichtert dann die des Staates. Im Leben eines gewöhnlich zu den Wilden gerechneten Volkes wie der Salomoninsulaner ist unzweifelhaft das einzige, kräftezusammenfassende Element die Schiffahrt“[2].
Aus diesen Gründen sind die Wikinge ebenso befähigt wie die Hirten, das politische Mittel zur Basis ihrer wirtschaftlichen Existenz zu machen, sobald eben nur Nachbarn vorhanden sind, die es auszuplündern und zu versklaven lohnt. „Die Schifferinseln bezeugen, daß auch Neid auf die Blüte eines in Frieden arbeitenden Stammes seinen guten Teil zur Entfachung immer neuer Kriege beitragen kann“[3]. Wenn die Nordwestindianer keine so berühmten Seeräuber geworden sind wie ihre altweltlichen Genossen, so liegt es nur daran, daß sich in ihrer erreichbaren Nähe — China konnten sie denn doch nicht in ihren Kriegskanoes erreichen — keine reichere Kultur ausgebildet hatte:
[1] Auch die kräftige Ernährung ist wie bei den Hirten gegeben. Die polynesischen Wikinge sind gerade so ein Geschlecht von Riesen wie die arischen Nomaden; sie gehören zu den größten Rassen des Planeten.
[2] Ratzel, Völkerkunde I, S. 123.
[3] Ratzel, Völkerkunde, I S. 272/3.
[276]
aber die Piraterie treiben alle höher entfalteten Fischer nach Kräften. Und so sind auch sie große Staatsgründer geworden [1].
3. Die Stadien der Staatenbildung. ↩
Wir werden im folgenden die von Seenomaden gegründeten Staaten als „Seestaaten“ von den durch Hirten (und in der Neuen Welt durch Jäger) gegründeten „Landstaaten“ unterscheiden. Von jenen wird ausführlich zu reden sein, wenn von den Ausgängen des primitiven Eroberungsstaates die Rede sein wird. Fürs erste, so lange wir von der Entstehung des Staats und dem primitiven Eroberungsstaat zu handeln haben, dürfen wir uns im wesentlichen auf die Betrachtung des Landstaates beschränken und den Seestaat zurücktreten lassen, weil dieser zwar in allen grundsätzlichen Dingen genau dasselbe Wesen und genau die gleiche Entwicklung zeigt, aber doch ihren typischen Gang minder deutlich hervortreten läßt.
Die Unterwerfung des Bauern durch den Hirten: das ist die Entstehung des Staates in der alten Welt.
In der Neuen Welt, wo die großen zähmbaren Weidetiere — der Bison ist jedenfalls nicht gezähmt worden —, wo Rind, Büffel, Kamel und Roß ursprünglich fehlen[2], tritt an die Stelle des Hirten der dem Hackbauern durch Waffengewandtheit und kriegerische Disziplin immer noch unendlich überlegene, höher entwickelte Jäger: „Der in der Alten Welt kulturzeugende Gegensatz von Hirten- und Ackerbauvölkern reduziert sich in der Neuen auf den Gegensatz von wandernden und ansässigen Stämmen. Wie Iran und Turan kämpfen mit den im Ackerbau aufgehenden Tolteken die von Norden hereinbrechenden wilden Scharen, deren militärische Organisation hoch entwickelt war“[3], die Azteken, und mit den Ureinwohnern von Peru die Inka.
Das gilt nicht nur für Peru und Mexiko, sondern für ganz Amerika; wir haben gehört, daß die kriegerisch hoch entfalteten Irokesen schon dazu übergegangen waren, den besiegten Nachbarn Tribut aufzuerlegen[4]. Wo er die Gelegenheit findet und die Macht dazu hat, zieht
[1] Die südamerikanischen Karaiben waren es. Sie haben ihre Seefahrten nach Max Schmidt auf über 1800 Kilometer ausgedehnt (Ethnol. Volksw. S. 129).
[2] Vgl. Schmidt, Ethnol. Volksw. S. 84, 207; Lama und Alpakka dienen nur als Lasttiere; es gibt außer diesen nur in beschränkten Gebieten gehaltenen Großtieren eigentlich nichts anderes von Nutz-Haustieren als Hund und Huhn — „eigentliche Viehzüchter hat es in ganz Amerika nicht gegeben“ (Schmidt, a. a. O. S. 207).
[3] Ratzel, Völkerkunde I, 591.
[4] Holsti, a. a. O. „So lebten die schweifenden Comantsches und Apatches mit den altansässigen Stämmen Arizonas und Neumexikos in beständiger Fehde, wobei es sich namentlich um den Raub resp. die Verteidigung der Ernteerzeugnisse der Bodenkulturvölker handelt“ (Schmidt, a. a. O. S. 183). Von der Anwendung des politischen Mittels durch die Aruaken handeln wir später im Zusammenhang.
[277]
der Mensch das politische Mittel dem ökonomischen vor: ein starkes Argument gegen die einseitig zugespitzte materialistische Geschichtsauffassung, da ja die „Produktion“ des Jägers eine ganz andere ist als die des Hirten. Übrigens finden wir diese Dinge überall da auch im Subhistorischen, wo Tiergesellschaften zu kooperierender überlegener Kraft gelangen. Wir haben die Umbildung der Ameisen in rein zum Kriege geeignete Arten (Polyergus) schon erwähnt; das gleiche hören wir von Arbeitsbienen [1]: Maeterlinck berichtet in seinem „Leben der Bienen“, daß sie, wenn sie ein einziges Mal einen durch Krankheit geschwächten oder durch Verlust der Königin in Verwirrung geratenen anderen Stock erfolgreich überfallen und geplündert haben, den Geschmack am ökonomischen Mittel ganz verlieren und sich fortan nach Möglichkeit nur des politischen noch bedienen: aus Arbeitsbienen sind Raubbienen geworden.
Lassen wir die neuweltlichen Staatenbildungen außer acht, die ja für die große Linie der Weltgeschichte keine Bedeutung gewonnen haben, so haben wir als Triebkraft aller Geschichte, als Entstehungsgrund aller Staaten zu betrachten den Gegensatz zwischen Ackerbauern und Hirten, zwischen Arbeitern und Räubern, zwischen Tiefland und Weidesteppe, wie Ratzel, der die Soziologie vom geographischen Zipfel aus faßte, sich treffend ausdrückt[2].
Kein primitiver Staat der Weltgeschichte ist anders entstanden. Wir fügen den Autoritäten-Stimmen, mit denen wir die Erörterung der Theorien beschlossen haben, eine hinzu, die von einem als Historiker wie als Ökonomisten gleich berühmten Manne herstammt: Carl Rodbertus-Jagetzow: „Die Geschichte vermag uns kein Volk aufzuweisen, bei dem die ersten Spuren der Teilung der Arbeit ... nicht auch mit solchen der wirtschaftlichen Ausbeutung zusammenfielen, bei dem nicht die Last der Arbeit den einen, und deren Frucht den andern zugefallen wäre, bei dem, mit anderen Worten, die Teilung der Arbeit sich nicht in der Form der Unterwerfung der einen unter die andern gebildet hätte“[3].
Die geringen Kenntnisse eines Mittelschülers in der Geschichte reichen hin, um zu erweisen, daß dieser Prozeß sich überall und zu jeder Zeit in ganz gleicher Weise abgespielt hat. Hier haben wir einmal so etwas wie ein wirkliches Gesetz der Geschichte, und man kann es verstehen, wenn Gumplowicz in ihm sogar ein „Naturgesetz“ erkennen wollte :
Überall bricht ein kriegerischer Wildstamm über die Grenzen eines von Ackerbau und Städtekultur lebenden Volkes, setzt sich als Adel
[1] Vgl. Alverdes, a. a. O. S. 59.
[2] Das sah schon Sismondi (Etudes I, S. 184), ebenso Carey (Lehrbuch, I S. 123).
[3] Zur Beleuchtung der sozialen Frage, S. 124.
[278]
fest und gründet seinen Staat. Im Zweistromlande Welle auf Welle und Staat auf Staat: Babylonier, Amoriter, Assyrer, Araber, Meder, Perser, Makedonier, Parther, Mongolen, Seldschucken, Tataren, Türken; am Nil Hyksos, Perser, Griechen, Römer, Araber, Türken; in Kleinasien Kimmerier [1], Galater usw., in Hellas die Dorierstaaten, typischen Gepräges, später die Kelten, die Kreuzfahrer, die Türken; in Italien Etrusker, Römer, Gallier, Zimbern und Teutonen, Ost- und Westgoten, Langobarden, Franken, Deutsche, Normannen; in Spanien Karthager, Römer, Westgoten, Araber; in Gallien Römer, Franken, Burgunder, Alemannen; in Britannien Sachsen, Dänen, Normannen. Welle auf Welle kriegerischer Wildvölker auch über Indien bis hinab nach Insulinde, auch über China ergossen : Hunnen, Mongolen, Mandschu. Und in dem „großen soziologischen Laboratorium“ Afrika der gleiche Typus bis auf unsere Tage: wir werden Beispiele dafür anführen.
Ja, selbst in den europäischen Kolonien der Neuzeit die gleiche Erscheinung, obgleich hier die Eroberer, schon längst staatlich organisiert, als Kämpfer eines fest organisierten Staatswesens eindrangen. Wo nur eine seßhafte Bevölkerung vorgefunden wurde, die nicht auswich, sondern sich unterwerfen und versklaven ließ, geschah es trotz Zivilisation und Christentum ohne Zögern : so überall in den spanischen Kolonien Amerikas: in Mexiko, auf den Antillen, wo die grauenhafte Mita, der Frondienst in den Bergwerken, die Eingeborenen fraß wie der Moloch die Kinderopfer[2]. Wo aber dieses ausbeutungsfähige Menschenmaterial fehlt, wie in den jetzigen Nordstaaten der Union, da hilft man sich, indem man die fronpflichtige Unterklasse importiert : als Kontraktarbeiter[3] (man deportiert den „Abschaum“ aus England zum Sklavendienst bei den großen Feudalherren, die man geschaffen hat) oder unverschleiert als Sklaven; Jahrhunderte lang hat die „Traite“, der Sklavenhandel, ganz Afrika den Plünderungen und Menschenjagden der Araber ausgeliefert, Millionen von Menschen von Haus und Familie gerissen, unzählige getötet, und die Händler und Grundbesitzer zu reichen Männern und dem wahren „Adel“ der Vereinigten Staaten gemacht, die formell denAdel nicht kennen. Außerdem aber hatte man sofort nach der Besitznahme überall die entscheidende Bedingung der Klassenscheidung eingeführt: die Bodensperre. Darüber haben wir uns ausführlich in unserer Theorie der reinen und politischen Ökonomie (S. S. III, S. 540 bis 556) ausgesprochen, wo wir zeigten, daß das Bodenmonopol die
[1] Beloch I, S. 344. Vgl. die eindrucksvolle Schilderung bei Wells, a. a. O. S. 100.
[2] Auch die Herrschaft der Ostindischen Kompagnie in Indien und der Holländer auf den Sunda-Inseln war nichts als eine nur sehr schwach verschleierte Sklaverei. Das gleiche gilt von den Eroberungen der Ritterorden in den baltischen Ländern, besonders von denen des Schwertordens in Liv- und Esthland.
[3] Vgl. S. S. HI, S. 544ff.
[279]
ganze Welt überspannt. Auf diese Weise war es, wie Roß schreibt, möglich, „durch die Verleihung fürstlicher Eigentumsrechte an die Wenigen den Feudalismus sogar in der Wildnis Wurzel schlagen zu lassen“. So sieht die Wirklichkeit aus; — sie gleicht nicht dem Phantasma der Naturrechtler von der friedlichen Entwicklung, die sich vollzog, „bis die Hufen, einander sämtlich berührend, das ganze Land bedeckten“.
Wo aber in solchen Kolonien die auszubeutende Urbevölkerung fehlt (weil es Jäger sind), und wo zu gleicher Zeit die Einwanderung sehr gering ist, sei es durch allzu große Entfernung von Europa, sei es durch gesetzliche Beschränkung, da finden wir eine Annäherung an das Endziel der Staatsentwicklung, dem wir sie als notwendig zutreibend heute schon erkennen können : an einen Endzustand, für den uns der Ausdruck noch fehlt, es sei denn, wir sprächen vom überhistorischen Philosophen- oder Rechtsstaat. Im australischen Commonwealth, vornehmlich in dem gesegneten Neu-Seeland, zeigt sich klar, daß mangels einer Klasse „freier“, d. h. besitzloser Arbeiter weder Großgrundbesitz noch Großbesitz an produzierten Produktionsmitteln, dem sogenannten „Kapital“, trotz der ungeheuerlichsten Bodensperrung, den gleichen wirtschaftlichen Inhalt haben wie in den Ländern starker und stark wachsender proletarischer Bevölkerung. Der „Ausbeutungsfaktor“ bleibt, um mit Marx zu sprechen „unanständig niedrig“. Wir sagen nicht, daß hier schon der Endzustand erreicht ist; wir sagen nur, daß die Gesellschaft sich ihm erkennbar angenähert hat: einem Zustand, der auf unvergleichlich höherer Stufe der Macht über die Elementarkräfte doch schon wieder dem „Naturzustande“ der vernunftgemäßen Gleichheit ähnlich zu werden beginnt — eine Noahtaube in der kapitalistischen Sintflut, die heute noch alle Gipfel überspült.
Wir haben hier noch einen „Staat“, insofern er straffe, durch äußere Machtmittel gesicherte Regelung des sozialen Zusammenlebens einer großen Menschenmenge darstellt: aber er ist nicht mehr in dem Maße, wie wir es gewöhnt sind, „Staat“ als Klassenstaat, als Instrument der politischen Beherrschung zum Zwecke der wirtschaftlichen Ausbeutung. Er nähert sich der Form, die ein zwischen Freien und Gleichen geschlossener Staatsvertrag herbeiführen würde. Wir haben vorgeschlagen, diese schon sich vorbereitende, noch nicht erreichte, Form des Gemeinlebens als „Freibürgerschaft“ zu bezeichnen.
Damit haben wir einen Ausblick getan auf den Weg, den der Staat im Leidensgange der Menschheit schon zurückgelegt hat, und aller Wahrscheinlichkeit nach in nicht allzu langer Zeit vollenden wird: vom unentfalteten politischen Mittel, dem Raube, durch qualvolle Übergänge zur Freibürgerschaft.
[***]
[280]
Dieser großartige Prozeß darf durchaus nicht nur im Lichte heutiger Moral angeschaut werden. Wenn er unendliches Leid, Knechtschaft, Ausbeutung, Versklavung, Krieg und Greuel aller Art über die Menschheit gebracht hat, so hat er doch auf der anderen Seite die Gruppen zu Völkern verschweißt, hat die Arbeit im Sinne unserer Ethik, als zielbewußte, anhaltende Tätigkeit, an die Stelle der halbspielenden Beschäftigung der Primitiven gesetzt und in ihr der Menschheit das große Instrument der Beherrschung der Elementarkräfte in die Hand gegeben, das sie heute schon von der harten Fron entlasten könnte, die seit der „Vertreibung aus dem Paradiese“, seit der Epoche der Wanderung und Eroberung, auf ihren Schultern liegt; er hat die nötige Grundlage jeder Kultur, die Zivilisation geschaffen: es ist die Aufgabe unserer Kinder, diese Versprechung einzulösen, an die Stelle der aufgedonnerten Barbarei, die wir heute als „Kultur“ zu benennen wagen, eine wirkliche, dauerhafte Kultur zu setzen [1]. Der Weg ist gewiesen.
Vielleicht ist wirklich alles, was ist, in dem Sinne vernünftig, daß die Geschichte keinen anderen Weg gehen konnte, als sie wirklich ging. Wir können es nicht wissen. Nur das eine sehen wir deutlich, daß der Weg aus der „Urzeit“ ohne den Staat und seinen Arbeitszwang sehr viel schwieriger, vielleicht unmöglich gewesen wäre. Das Eisen hat den Bau unserer Welt gefügt, und Ströme von Blut haben ihn gemörtelt: wenn wir nur nicht glauben, daß, was immer war, auch immer wieder sein muß; — wenn wir nur die Veränderungen der Lagerung deutlich erkennen, die eine Veränderung der Motivation der heutigen Völker schon heute nötig machen : dann dürfen wir hoffnungsvoll und dankbar die Opfer segnen, deren Asche den Fruchtacker unseres Kinderlandes gedüngt hat, reichen Ernten entgegen.
Diese Lichtseite der geschichtlichen Entwicklung schildert Wells in kurzen Worten: „Überall zerstörten die Nomaden viel, aber sie brachten auch überallhin einen neuen Geist der freien Forschung und der sittlichen Erneuerung. Sie stellten die Glaubenssätze unvordenklicher Zeiten in Frage, sie ließen Tageslicht in die Tempel, sie setzten Könige ein, die weder Priester noch Götter, sondern lediglich Führer im Kreise ihrer Hauptleute und Gefährten waren“[2].
Ausführlicher spricht Ratzel: „Daß der Nomadismus nicht rein zerstörend der sedentären Kultur gegenübertritt, ruft uns die Tatsache ins Gedächtnis, daß wir es von nun an nicht nur mit Stämmen, sondern mit Staaten, und zwar mit Staaten mächtiger Art zu tun haben[3].
[1] „We are living in the stone-age of the art of government“ (Ward, Dyn. Soc. S. 40).
[2] A short history of the world (Tauchnitz ed.) S. 100.
[3] Also auch bei diesem Meister der Ethnographie die Wundtsche Unterscheidung zwischen der vorstaatlichen und der staatlichen Organisation, die „etwas ganz anderes ist“.
[281]
In dem kriegerischen Charakter der Nomaden liegt eine große, staatenschaffende Macht, die sich vielleicht noch klarer als in den von Nomadendynastien beherrschten großen Staaten Asiens ... am Rande des Sudan ausspricht, wo die Verschmelzung der erst feindlichen, dann zu fruchtbarem Zusammenwirken vereinigten Elemente noch nicht so weit fortgeschritten ist. Nirgend zeigt es sich so klar auf der Grenze nomadisierender und ackerbauender Völker, daß die großen Wirkungen der kulturfördernden Anstöße der Nomaden nicht aus friedlicher Kulturtätigkeit hervorgehen, sondern als kriegerische Bestrebungen friedlichen zuerst entgegentreten, ja, schaden. Ihre Bedeutung liegt in dem Talent der Nomaden, die sedentären und leicht auseinanderfallenden Völker energisch zusammenzufassen. Das schließt aber nicht aus, daß sie dabei viel von ihren Unterworfenen lernen können... . Was aber alle diese Fleißigen und Geschickten nicht haben können, das ist der Wille und die Kraft zu herrschen, der kriegerische Geist und der Sinn für staatliche Ordnung und Unterordnung. Darum stehen die wüstengeborenen Herrn des Sudan über ihren Negervölkern wie die Mandschu über den Chinesen“ [1].
Bei der Entstehung des Staates aus der Unterwerfung eines Ackerervolkes durch Hirten oder Wikinge lassen sich, grob gesehen, sechs Stadien unterscheiden, zwischen denen es gelegentlich noch Übergänge gibt. Wenn wir sie im folgenden schildern, so ist nicht die Meinung, daß die geschichtliche Entwicklung gezwungen gewesen sei, in jedem Falle die ganze Treppe, Stufe für Stufe, zu erklettern. Zwar ist hier nichts bloße theoretische Konstruktion: jede einzelne Stufe findet sich in zahlreichen Exemplaren in Weltgeschichte und Völkerkunde, und es gibt Staaten, die sie offenbar alle absolviert haben. Aber es gibt andere, die eine oder mehrere Stufen übersprungen haben[2].
a) Das erste Stadium. (Das „Bärenstadium“.)
Das erste Stadium ist Raub und Mord im Grenzkriege: ohne Ende tobt der Kampf, der keinen Frieden noch Waffenstillstand kennt. Erschlagene Männer, fortgeschleppte Kinder und Frauen, geraubte Herden, brennende Gehöfte! Wenn die Angreifer mit blutigen Köpfen heimgeschickt werden, so kommen sie in stärkeren und stärkeren Haufen wieder, gestachelt und zusammengeballt durch den Trieb der Blut-
[1] Ratzel, Völkerkunde II, S. 370. Vgl. Anthropogeographie I, S. 293.
[2] Robert Weiß schreibt in seiner „Schichtengliederung der israelitisch-jüdischen Gesellschaft“, S. 3: „Die Ergebnisse der Untersuchung der sozialen Ereignisse, die den israelitisch-jüdischen Staat und seine Nachfolger ausgebildet haben, reihen sich fast lückenlos in jene universal-historischen Daten ein“, nämlich in diese Sechs-Stadien- Theorie.
[282]
räche. Zuweilen rafft sich wohl die Eidgenossenschaft auf, sammelt die Landwehr, und es gelingt ihr auch vielleicht einmal, den flüchtigen Feind zu stellen und ihm auf eine kurze Zeit das Wiederkommen zu verleiden: aber allzu schwerfällig ist die Mobilmachung, allzu schwierig die Verpflegung in der Wüste oder Steppe für die Bauernlandwehr, die nicht, wie der Feind, in seinen Herden die Nahrung mit sich führt. Haben wir es doch vor nicht langer Zeit im Kriege gegen die Her ero erlebt, was eine vortrefflich disziplinierte, weit überlegen bewaffnete Überzahl mit Train und Eisenbahnnachschub und den ungeheuren Kräften des größten Militärstaates hinter sich erdulden mußte, um eine Handvoll Hirten zur Strecke zu. bringen. Um wieviel schwerer hat es der primitive Bauer: und der Kirchturmsgeist ist mächtig, und zu Haus liegen die Äcker brach! Swjätopolks Heer war gegen den Feldzug — man hörte rufen: „Jetzt ist Frühling; wie darf man da den Knecht vom Acker wegholen? Er muß pflügen“ [1].
Das ist das erste Stadium der Staatsbildung. Sie kann Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende darauf stehen bleiben, wie das folgende, überaus charakteristische Beispiel zeigt:
„Jedes Weidegebiet eines Turkmenenstammes grenzte einst an eine zweite Zone, die man als sein Raubgebiet bezeichnen konnte... . Ähnlich waren Grenzstriche von Chiwa und Bochara den Raubzügen der Tekinzen verfallen, bis es gelang, andere Turkmenenstämme mit Gewalt oder durch Bestechung als Stoßkissen einzuzwängen. Die Geschichte der Oasenkette, die Ost- und Westasien quer durch die Steppen Zentralasiens verbindet, ... gibt zahllose weitere Belege. Immer versuchten die Nomaden von Süden und Norden her an den Inseln fruchtbareren Bodens zu landen, die ihnen wie die Inseln der Glück seligen erscheinen mochten, und jeder Horde stand, ob sie erfolgreich abzog oder geschlagen flüchtete, die schützende Steppe offen... . Noch der letzte Dunganenaufstand hat gezeigt, wie leicht doch die Wellen eines beweglichen Volkstums über diesen Kultureilanden zusammenschlagen. Erst die Vernichtung des Nomadismus, die unmöglich ist, solange es Steppen in Zentralasien gibt, vermöchte ihre Existenz ganz sicherzustellen“ [2].
Zum ersten Stadium zu rechnen sind auch die aus der ganzen altweltlichen Geschichte bekannten Massenzüge, soweit sie nicht auf Eroberung, sondern lediglich auf Plünderung abzielten, Überschwemmungen, wie sie Europa durch die Kelten, Germanen, Hunnen, Avaren, Araber, Magyaren, Tataren, Mongolen und Türken vom Lande her und durch die Wikinge und Sarazenen von der See her erlitten hat. Sie überbrausten weit über ihr gewohntes Raubgebiet hinaus ganze
[1] Kostomarow, a. a. O. S. 54.
[2] Ratzel, Völkerkunde II, S. 30/1. Vgl. Anthropog. I, S. 293.
[283]
Erdteile, verschwanden, kehrten wieder, versickerten und hinterließen eine Wüste. Häufig genug aber schritten sie in einem Teil des überfluteten Gebietes unmittelbar zum sechsten und letzten Stadium der Staatsbildung, indem sie eine dauernde Herrschaft über der Bauernbevölkerung errichteten. Ratzel schildert diese Massenzüge vortrefflich:
„Gerade der Nomadismus ist ausgezeichnet durch die Leichtigkeit, womit er aus dem patriarchalischen Stammeszusammenhange despotische Gewalten von weitreichendster Macht entwickelt. Dadurch entstehen Massenbewegungen, die sich zu anderen in der Menschheit vor sich gehenden Bewegungen wie angeschwollene Ströme zu dem beständigen, aber zersplitterten Geriesel eines Quellgeäders verhalten. Ihre geschichtliche Bedeutung tritt aus der Geschichte Chinas, Indiens und Persiens nicht weniger klar hervor wie aus der Europas. So wie sie in ihren Weideländereien umherzogen mit Weibern und Kindern, Sklaven, Wagen, Herden und aller Habe, brachen sie über ihre Nachbarländer herein, und was ihnen dieser Ballast an Schnelligkeit nahm, das gab er ihnen an Masse. ... So wie sie alles mit sich trugen, so ließen sie sich auch am neuen Orte mit allem nieder“[1].
Was hier von hamitischen, semitischen, mongolischen und sicher auch zum Teil von indogermanischen Hirtenvölkern gesagt wird, gilt auch von den echten Negern, soweit sie eben ein Hirtendasein führen :
„In den beweglichen, kriegerischen Hirtenvölkern der Kaffern ruht eine Expansionskraft, die nur eines verlockenden Zieles bedarf, um zur gewaltsamen Wirkung zu gelangen und die ethnologischen Verhältnisse weiter Gebiete von Grund aus umzugestalten. Ein solches Ziel bot das östliche Afrika, das zahlreichen friedlichen Ackerbauvölkern Raum zur Entwicklung gewährt hatte, ohne doch, wie die Länder des Inneren, aus klimatischen Gründen die Viehzucht zu verbieten und damit die Stoßkraft der Nomaden von Anfang an zu lähmen. Gleich verheerenden Strömen ergossen sich wandernde Kaffernstämme in die fruchtbaren Sambesüänder und bis an das Hochland zwischen dem Tanganyika und der Küste hinein, wo sie in Uniamwesi bereits dem Vortrupp einer von Norden kommenden hamitischen Völkerwelle, den Watusi, begegneten. Zum Teil sind die älteren Bewohner diese Gebiete vernichtet, zum Teil bebauen sie als Hörige den ehemals freien Boden ihrer Heimat, zum Teil endlich haben sie den Kampf noch nicht aufgegeben oder hausen noch ungestört in Siedlungen, an denen der Sturm der Eroberung seitwärts vorüberbrauste“ (a. a. O. II, S. 103/4).
Was sich hier noch soeben vor unseren Augen abgespielt hat, das hat seit vielen Jahrtausenden „ganz Ostafrika vom Sambesi bis zum Mittelmeere erschüttert“. Der Einfall der Hyksos,Ägyptens halbtausend-
[1] Völkerkunde II, S. 388/9, Diese Völkerzüge sind zu unterscheiden von den Kriegerzügen ohne großen Troß, von denen wir oben sprachen.
[284]
jährige Unterwerfung unter die Hirtenstämme der östlichen und nördlichen Wüsten, „Stammverwandte der Völker, die heute noch zwischen Nil undRotemMeer ihreHerden weiden“ [1], ist nur die erste uns bekannte dieser Staatsgründungen, denen im Nilland selbst und weiter südlich so viele andere nachfolgten, bis auf das Reich des Muata Jamvo, von dem die portugiesischen Händler in Angola schon am Ende des 16. Jahrhunderts erfuhren, und bis auf die Kaiserreiche Uganda und Unyoro, die erst in unseren Tagen der stärkeren Kriegsmacht der Europäer erlagen, obgleich Breysig sie, mit Recht, als volle Analoga der karlin- gischen Monarchie darstellt, und von dem durchgebildeten Kriegswesen der Zulureiche sogar sagt, daß es den entsprechenden europäischen Gebilden weit überlegen war[2].
Wir wollen die Entstehung eines solchen Staatswesens, wie es sich in Südafrika vor den Augen der europäischen Zuschauer gebildet hat, nach Franco Savorgnan etwas ausführlicher darstellen:
Ein Erobererstamm, die Griqua, überfielen und verheerten um 1820 das Gebiet derBasuto, eines Ackererstammes. Einige von diesen, darunter die tatkräftigsten, sammelten sich um einen Häuptling, namens Sebi- tuana, einen Mann von größter Energie. Die kleine Schar zog sich nach Norden zurück und führte das Leben kriegerischer Nomaden : Viehzucht und Beutezüge. Sie wuchs durch Adoption neuer Mitglieder — Sebituana schonte die kräftigsten Kinder der Überfallenen, während die Älteren ohne Gnade über die Klinge springen mußten, ließ ihnen eine vortreffliche militärische Erziehung geben und schuf sich auf diese Weise ein furchtbares Heer.
Nach einer gewissen Zeit, dank den Ratschlägen eines Propheten namens Tlapane, beschloß Sebituana, die von ihm besiegten Stämme nicht mehr bloß auszuplündern, sondern zu organisieren. Er unterwarf die Batoka und die Barotse seiner Herrschaft und verteidigte sich erfolgreich gegen die benachbarten Matabele. Auf diese Weise schuf er einen wahren Feudalstaat; da er klug genug gewesen war, alles, was in den besiegten Stämmen an Zauberern, Wahrsagern, Propheten usw. vorhanden war, auf seine Seite zu bringen, so bildeten alle diese Priester eine privilegierte und ihrem Herrn völlig ergebene Kaste. Jedes Dorf wurde von einer oder zwei Familien aus dem Stamme der Eroberer regiert, die in einer Art von Erdburg residierten; zuweilen betreuten auch die Frauen der Sieger in Abwesenheit ihrer Männer allein dieses Amt. Die Zentralgewalt hielt dauernd ein stehendes Heer, eine wahre
[1] Thurnwald, Staat und Wirtschaft im alten Ägypten, Ztschr. f. Soz.-Wissensch. Bd. 4 (1901) S. 700/1.
[2] Vgl. über die Zulu und ihren Organisator Tschaka: Schmidt, Ethnol. Volksw. S. 189, 191.
[285]
Prätorianergarde, auf Kriegsfuß, die überall erschien, wo es nötig war, die Ordnung herzustellen.
Die Herrenklasse hatte den Namen „Makololo“ angenommen. Ihre Regierungsform war anfänglich einigermaßen demokratisch. Sebituana faßte keinen Entschluß anders als nach Beratung mit dem „Pitscho“ (Rat), in dem zwar die Alten und die Priester den ersten Rang einnahmen, aber doch auch jeder Makololo, Mann und Weib, beratende Stimme hatte. Die Untertanen — Makalaka — hatten gewisse Rechte, und man war bemüht, sie an dem Gange der Staatsverwaltung zu interessieren. Rings um den neuen Staat lag ein Kreis von Völkerschaften, die lediglich Tribut zu zahlen hatten.
Die Herrenschicht, deren (trotz der Rassenmischung) helle Hautfarbe anzeigte, daß sie großenteils aus nordischerem Blute stammte, entartete sehr schnell in dem tropischen Klima. Sebituana hatte seine Tochter zur Thronerbin eingesetzt, aber nach seinem Tode wurde sein unfähiger, zudem noch von Aussatz befallener Sohn gekrönt. Die leibeigenen Makalaka empörten sich und stürzten das aristokratische Regiment. Dennoch bestand der Makololostaat auch nach dem Sturz seiner Gründer fort, deren Sprache er beibehielt. Er nahm die despotische Regierungsform an, die er noch hatte, als Livingstone und nach ihm Emil Holub ihn besuchten.
Wir haben in diesem Falle ein Staatswesen, das die einzelnen Stadien zum Teil übersprang, zum Teil nebeneinander aufzeigte. Wir werden jetzt in unsrer „idealtypischen“ Schilderung der Stadienfolge fortfahren: es wird sich zeigen, daß jede spätere Stufe gegenüber jeder vorangehenden das immer kleinere Mittel zum immer größeren Erfolge des Staatszwecks, der möglichst hohen Besteuerung der Untertanen, darstellt.
b) Das zweite Stadium. (Das „Imkerstadium“.)
„Wüste und Kulturland ruhen nie und nirgend kampflos nebeneinander; aber ihre Kämpfe sind einförmig und voll Wiederholungen“, sagt Ratzel [1]. Einförmig und voll Wiederholungen ist die Weltgeschichte überhaupt, weil die menschliche Psyche ebenfalls in ihren Grundzügen überall die gleiche ist und auf gleiche Einwirkungen der Umwelt gleichmäßig reagiert, bei allen Rassen aller Farben in allen Erdstrichen, in den Tropen wie in den gemäßigten Zonen[2]. Man muß
[1] Völkerkunde II S. 404/5.
[2] Vgl. S. S. I, S. 213ff. „Leibniz sagt, daß die Natur zwar einfach in ihren Prinzipien, aber unermeßlich reich in ihrer Anwendung ist“ (Meinecke, Weltb. S. 22). Das gilt auch von der Geschichte. Der Geist der Erde webt am sausenden Webstuhl der Zeit aus wenig Fäden die buntesten Muster zu der Menschheit lebendigem Kleid, Wir haben in unserem Vortrage über die Rassentheorie der Weltgeschichte darauf aufmerksam gemacht, wie sehr die Historik verarmen müßte, wenn der öde Stumpfsinn dieser sogenannten „Erklärung“, die alles und daher nichts erklärt und nur eines beweist, die Voreingenommenheit ihrer Vertreter, jemals die von ihr erstrebte Alleinherrschaft gewinnen sollte.
[286]
nur weit genug zurücktreten, in sozusagen kosmische Entfernung; man muß die Erscheinungen nur so unvoreingenommen betrachten, wie etwa, um ein wenig zu übertreiben, die Kämpfe der Infusorien in einem Tropfen Schlammwasser: dann verbirgt uns das bunte Spiel der „idiographischen“ Einzelheiten nicht mehr die großen, immer gleichen Massenbewegungen; dann entschwinden unserem Blicke die „Modi“ der kämpfenden, wandernden, arbeitenden Menschen, und die „Substanz“, die Menschheit, enthüllt uns ihre ewig gleichen, in allem Wechsel dauernden, „einförmigen“ Gesetze. Wir sehen nicht mehr bloß geschichtliche „Wirklichkeiten“, sondern geschichtliche „Wahrheiten“ (vgl. oben S. 15).
Allmählich entsteht aus dem ersten Stadium das zweite, namentlich dann, wenn der Bauer, durch tausend Mißerfolge gekirrt, durch Schwert und Richtbeil aller seiner mutigeren Führer beraubt, sich in sein Schicksal ergeben, auf weiteren Widerstand verzichtet hat. Dann beginnt es selbst dem wilden Hirten aufzudämmern, daß ein totgeschlagener Bauer nicht mehr ackern, ein abgehackter Fruchtbaum nicht mehr tragen kann. Er läßt im eigenen Interesse, wenn es praktikabel erscheint, den Bauern leben und den Baum stehen. Die reisige Expedition kommt nach wie vor, waffenstarrend : aber sie kommt nicht mehr eigentlich in Erwartung von Krieg und gewaltsamer Aneignung. Sie brennt und mordet nur so viel, wie erforderlich ist, um den heilsamen Respekt aufrechtzuerhalten oder vereinzelten Trotz zu brechen [1].
Aber im allgemeinen, grundsätzlich, nach einem fest gewordenen Gewohnheitsrecht — dem ersten Keim eines staatlichen Rechts! — nimmt der Hirt nur noch den Überfluß des Bauern. Das heißt: er läßt ihm Haus, Geräte und Lebensmittel bis zur nächsten Ernte. Es ist das „kleinere Mittel“: wir brauchen nicht auf irgendeine „Sympathie“ zurückzugreifen, um die Wandlung zu erklären: „Viele Sklaven zu halten, verbietet die Schwierigkeit ihrer Ernährung. Man hält also ganze Bevölkerungen in Abhängigkeit, denen man alles nimmt, was über das Bedürfnis der Lebensfristung hinausgeht. Man wandelt ganze Oasen in Domänen um, die man zur Erntezeit besucht, um ihre Bewohner auszurauben: eine echt wüstenhafte Beherrschung“, sagt
[1] Nach Konstantin Porphyrogenetos zogen die ältesten russischen Herrscher alljährlich im November mit einem Heere von Kiew aus, um alle Städte zu bereisen. Tribut einzukassieren und das Reich so zusammenzuhalten (Röscher, Politik, S. 57).
[287]
Ratzel [1] von den Arabern. Und aus der Sahara berichtet er: „Die Araber und Tibbu betrachten gewisse Oasen samt deren Bewohnern als ihr Eigentum. Sie erscheinen dort zur Ernte, um ihren Tribut einzutreiben, d. h. zu plündern und zu rauben, und überlassen in der Zwischenzeit die Unterworfenen ihrem Elend und ihrer Pflicht, für sie zu pflanzen“ (I, 116/7).
Der Hirt im ersten Stadium ist dem Bären zu vergleichen, der einen Bienenstock zerstört, um ihn des Honigs zu berauben; im zweiten gleicht er dem Bienenvater, dem „Imker“, der ihm genug Honig läßt, um zu überwintern[2].
Ein ungeheurer Schritt vorwärts vom ersten zum zweiten Stadium! Wirtschaftlich und politisch ein ungeheurer Schritt!
Wirtschaftlich: denn auf der Bärenstufe war der Erwerb des Hirtenstammes rein „okkupatorisch“ wie der des Tieres: schonungslos zerstörte der Genuß des Augenblicks die Reichtumsquelle der Zukunft. Jetzt ist der Erwerb „wirtschaftlich“, denn alles Wirtschaften heißt weise haushalten, den Genuß der Gegenwart um der Zukunft willen einschränken. Betrachtete der Sieger den Bauern und seine Habe zuerst als „freies Gut“, mit dem man nicht „wirtschaftet“, weil der Vorrat so groß und so bequem erreichbar scheint, daß aller Bedarf der übersehbaren Zukunft als ohne Arbeit überdeckt erscheint[3], so erkennt er jetzt zwar noch nicht seine Würde als Person, wohl aber seinen Wert als nützliche Sache. Er „beschafft“ sich den Untertan, um ihn pfleglich „vor Verlust und Verderb zu verwalten“, wie er früher sein Haus, sein Werkzeug und seine Waffen, sein Vieh und seine Kostbarkeiten beschafft und verwaltet hat. Damit ist an die Stelle der reinen Ausraubung die „Bewirtschaftung des Menschen durch den Menschen“ getreten, die sich von jener ihrer Vorläuferin grundsätzlich dadurch zu ihrem Vorteil unterscheidet, daß das neugewonnene Eigentum eben nicht nur beschafft und verwendet, sondern auch verwaltet wird. Der Hirt hat gelernt, zu „kapitalisieren“.
Ein ebenso gewaltiger Schritt politisch-rechtlich!
Wir sahen: der Bauer erhält eine Art von Recht auf die Lebens-
[1] a. a. O. II, S. 393.
[2] Ratzel (Anthropog. I S. 322) zeigt, daß bereits bei den primitiven Jägern der Raubbau an der Natur übergeht in die pflegliche Bewirtschaftung: „der Mensch versucht es, die Quellen seiner Ernährung gleichsam zu fassen. Das geschieht schon bei vielen Völkern Australiens durch strenge Verbote, die mit eßbaren Früchten gesegneten Pflanzen auszuraufen oder die Vogelnester zu vernichten, deren Eier man aushebt. Man läßt die Natur für sich arbeiten, indem man nur acht hat, sie nicht zu stören. Wilde Bienenstöcke werden oft so regelmäßig entleert, ohne zerstört zu werden, daß daraus eine primitive Bienenzucht entsteht“.
[3] S. S. III, S. 36И.
[288]
notdurft; es wird ein Unrecht, ihn gänzlich auszuplündern oder ihn zu töten, wenn er keinen Widerstand leistet. Und mehr als das! Feinere, zartere Fäden knüpfen sich zu einem freilich noch sehr schwachen Netze, menschlichere Beziehungen bahnen sich an, als sie aus dem puren, brutalen Gewohnheitspakt der „Löwenteilung“ erwachsen können. Da die Hirten nicht mehr in Kampfzorn rasend mit „ihren“ Bauern in Berührung kommen, so findet auch wohl einmal eine demütige Bitte Gewährung oder gar eine berechtigte Beschwerde Gehör. Der kategorische Imperativ der Gerechtigkeit und Reziprozität, dem, wie wir wissen, der Hirt in seinen innerstammlichen Beziehungen streng folgt, beginnt zum ersten Male, ganz schüchtern noch und leise, auch für den Stammfremden, vielleicht Rassefremden zu sprechen.
Hier ist der Keim der innerlichen Vereinheitlichung der von Anfang an in so viele Grüppchen zerspaltenen Menschheit, die vom Haß und der Verachtung der „βάρβαροι“ zur allumfassenden Menschenliebe schon geführt hat, wie sie Christus und Buddha lehrten; und ebenso der Keim zu jenem großartigen äußeren Verschweißungsprozeß, der aus den kleinen Horden die großen Völker schon gebildet hat und dereinst die ganze Menschheit vereinen wird: jener Doppel Vorgang, der den Begriff der „Humanität“ mit seinem vollen Inhalt erfüllen wird.
Volkstum und Staat, positives Recht und höhere Gesellschaftswirtschaft mit allen den Verzweigungen, die sie schon getrieben haben und noch treiben werden, entstanden gemeinsam in jenem Augenblick unvergleichlicher weltgeschichtlicher Bedeutung, wo zuerst der Sieger den Besiegten schonte, um ihn dauernd zu bewirtschaften. Die Wurzel alles höheren Menschlichen taucht in das dunkle Erdreich des Tierischen: Liebe und Kunst nicht minder wie Staat, Recht und Wirtschaft.
Bald kommt ein anderes hinzu, um jene seelischen Beziehungen noch enger zu knüpfen. Es gibt in der Wüste außer dem jetzt in den Bienenvater umgewandelten Bären noch andere Petze, die ebenfalls nach Honig lüstern sind. Unser Hirtenstamm sperrt ihnen die Wildbahn: er schützt „seinen“ Stock mit der Waffe. Die Bauern gewöhnen sich, bei drohender Gefahr die Hirten herbeizurufen; schon erscheinen sie nicht mehr als die Räuber und Mörder, sondern als die Schützer und Retter. Mit überströmendem Dank und unendlichem Jubel wird die Rächerschar begrüßt, die die gestohlenen Frauen und Kinder, die fortgetriebenen Herden samt den abgehauenen Köpfen oder abgezogenen Skalpen der Räuber ins Dorf zurückbringt. Was sich hier knüpft, sind keine Fäden mehr, es ist ein Band von gewaltiger Festigkeit und Zähigkeit. Hier ist die vornehmste Kraft der Integration aufgewiesen, die im weiteren Verlauf aus den beiden ursprünglich blutsfremden, oft genug
[289]
sprach- und rassefremden ethnischen Gruppen zuletzt ein Volk mit einer Sprache und Sitte und einem Nationalbewußtsein schmieden wird: gemeinsames Leid und Not, gemeinsamer Sieg und Niederlage, gemeinsamer Jubel und Totenklage. Ein neues Gebiet hat sich erschlossen, auf dem Herren und Knechte gleichen Interessen dienen: das erzeugt einen Strom von Sympathie, erzeugt das Bewußtsein der Zusammengehörigkeit. Jeder Teil ahnt, erkennt im anderen Teile mehr und mehr den Menschen; das Gleiche der Anlage wird herausgefühlt, während vorher nur das Verschiedene in der äußeren Gestalt und Tracht, in der fremden Sprache und Religion, zu Haß und Widerwillen aufreizte. Man lernt sich verständigen, zuerst im engeren Sinne des Wortes durch die Sprache, dann auch seelisch : immer dichter wird das Netz der inneren Zusammenhänge.
Man kann das auch anders ausdrücken: bis dahin hat der Begriff „Mensch“ nur die eigenen Stammesgenossen umfaßt; der Fremde rechnete zu den Tieren, die ja dem Naturmenschen viel näher stehen, die er als von sich längst nicht so verschieden begreift wie wir. Nun beginnt der Begriff „Mensch“ zum ersten Male alles zu umfassen, was Menschenantlitz trägt.
Jetzt sind wir weit genug gekommen, um den einzigen ernsthaft zu nehmenden Einwand zu widerlegen, der der soziologischen Staatsidee jemals entgegengehalten worden ist: den von Rousseau gemachten, daß niemals aus Gewalt Recht entstehen könne.
Die Lösung ist die folgende: Im ersten Stadium der Staatsbildung sind die sozialen Beziehungen zwischen den Räubern und ihren Opfern keine anderen als die „zwischen dem Tischler und der Hobelbank“. Hier ist von keinem „Recht“ die Rede, es sei denn, man wolle im Ernste von einem „Recht des Schwertes“ sprechen.
Im zweiten Stadium aber übernimmt der „Staat“ in statu nascendi die wichtigsten Funktionen der von ihm vernichteten oder doch auf die rein familialen und nachbarlichen Beziehungen eingeengten Gemeinschaft: den Rechts- und Grenzschutz. Wenn ein drastisches Bild erlaubt ist, so frißt er sich in den Körper der Gemeinschaft hinein, wie Münchhausens Wolf in das Schlittenpferd, bis er zuletzt im Geschirr steckt und das Gefährt zu ziehen gezwungen ist.
Auf diese Weise entsteht ein neuer Kollektivorganismus. Das kann niemand verstehen, der den alten Begriff des Organismus, oder sogar den gewöhnlichen des Kollektivum hat, demzufolge ein Wald nur aus Bäumen besteht. Ein Kollektivum ist aber, wie wir wissen, ein jedes System des Gleichgewichts, der gegenseitigen Anpassung, der verschiedensten auf einem gemeinsamen Grunde zusammenhausenden lebendigen Individuen und Arten. Als die asiatische Wanderratte in Europa eindrang und die europäische Hausratte zurückdrängte und nahezu vernichtete,
[290]
wurde der bestehende Kollektivorganismus von einer schweren Störung befallen und brauchte eine gewisse Zeit, bis die neue Anpassung erreicht war. Das gleiche würde eintreten, wenn stärkere Raubtiere z. B. auf eine Insel gerieten, und ist überall eingetreten, wo der weiße Mann mit seinem Feuergewehr in eine bis dahin von ihm unberührte Fauna eindrang, zu der wir ohne Zwang in diesem biologischen Betracht auch die eingeborenen Menschen rechnen dürfen. Und so auch hier: der Sieg der Hirten bedeutet eine schwere Störung des bisherigen gemeinschaftlichen Organismus, und sie wird in vielen Fällen stark genug gewesen sein, ihn zu töten: wenn er aber überlebt, so lebt er eben unter den veränderten Verhältnissen weiter, in neuer Anpassung, als ein neues System des Gleichgewichts, als ein tief und einschneidend veränderter Organismus, aber immer noch als ein solcher, zusammengehalten durch den einzigen Kitt jeder menschlichen Gesellschaft: die Gerechtigkeit in ihrer soziologischen Form als subjektive Reziprozität.
Was hier geschehen ist, ist die Verwandlung von Gewalt in Macht [1]. Zwar ist das Verhältnis hier dasjenige, was Vierkandt das „Übermachtsverhältnis“ nennt, aber es ist dennoch ein Rechtsverhältnis. „Wo überhaupt die Bevölkerung in Stände zerfällt, liegt in diesem Begriffe nicht nur die Ungleichheit der Machtverteilung, sondern auch die Sicherung gewisser Rechte für jeden Beteiligten enthalten“ (Vierkandt).
Die Sicherung gewisser Rechte! Jellinek sagt: „Alles Recht wird zu solchem nur dadurch, daß es nicht nur den Untertan, sondern auch die Staatsgewalt bindet. Recht in diesem vollen Sinne des Wortes ist also die zweiseitig verbindende Kraft des Gesetzes, die eigene Unterordnung der Staatsgewalt unter die von ihr selbst erlassenen Gesetze. ..» Der Staat befiehlt im Gesetze auch den ihm als Organe dienenden Personen, ihren Organwillen dem Gesetze gemäß zu gestalten... . Diese Bindung ist aber nicht etwa moralischer, sondern rechtlicher Natur“ [2].
Das ist das Geheimnis, das Rousseau für unlösbar hielt, wie aus der Gewalt Recht entstehen kann. Sein Irrtum lag vor allem darin, daß er als Philosoph nur das wirkliche Recht der absoluten Gerechtigkeit, d. h. Gleichheit, kannte oder anerkannte: es gibt aber auch ein Recht der Ungleichheit, das im Sinne der Soziologie ein volles Recht ist, weil es auf subjektiver Reziprozität beruht, wenn auch die Sozialphilosophie es nur als die Vorstufe zu dem Recht der Gleichheit anerkennm kann. Es ist nicht mehr „natürliches“, es ist positives Recht, aber, wr wiederholen: es ist Recht, nach allen seinen Kennzeichen.
Und nun haben wir noch eine überaus wichtige Folgerung zu ziehen: mit diesem Rechte trat zugleich die Sünde in die Weh.
[1] Vgl. S. S. 1, S. 376ff.
[2] Allg. Staatslehre S. 478.
[291]
Vorher, in der gewachsenen Gemeinschaft, gab es wohl Unrecht, wenn einer der Genossen, in leidenschaftlichem Impuls, das Recht des anderen kränkte. Aber „Sünde“ in der Bedeutung einer andauernd ungerechten Einstellung zu den Pflichten gab es nicht. Die trat erst mit dem Staate in die Welt, und zwar auch schon in dem zweiten Stadium seiner Entstehung.
Das erste Stadium ist nicht nur frei von Sünde, sondern sogar von Unrecht. Denn der Stammesfremde hat kein Recht, man kann ihm kein Unrecht tun. Er ist Jagdtier wie das Tier des Waldes und hat dankbar zu sein, wenn man seines Lebens schont. Der Besiegte und Unterworfene selbst empfindet sein Geschick nicht als „Unrecht“, sondern nur als „Unglück“, wie etwa eine durch elementare oder tierische Kraft erhaltene Verletzung. 'Es hat lange gedauert und bedurfte vieler grundstürzender Veränderungen des gesellschaftlichen Aufbaus, ehe die Sklaven des Altertums selbst die Sklaverei für etwas anderes als ein Unglück anzusehen lernten. Nur wenn der Herr die ihm zustehende Gewalt im Vergleich zu der Gewohnheit der Zeit mißbrauchte, fühlte der Knecht sein Recht verletzt.
So war die Bildung des Staates, der Klassen und der Ausbeutung ursprünglich vollkommen „unschuldig“; von einer subjektiven Sünde war keine Rede.
Wohl aber kann man von einer „objektiven“ Sünde sprechen, die in dem Augenblick begangen wird, wo Sieger und Besiegte zu einem Staate verschmelzen. Damit werden sie aus Ungenossen zu Genossen: jetzt sollte das Recht der Gerechtigkeit, der Gleichheit, zwischen ihnen konstituiert werden. Und wir werden bald sehen, daß in der Tat ein dunkles Gefühl für dieses Sollen besteht, das sich in den Klassentheorien in charakteristischer Weise ausdrückt. Aber diese Stimme spricht noch für Jahrtausende viel zu leise, als daß sie die laute Sprache der Interessen übertönen könnte. Und so wird das im philosophischen Sinne als Unrecht zu bezeichnende im soziologischen Sinne wirkliches Recht, subjektiv anerkannte Reziprozität.
Wir sind diesen Gedanken in den schon vorliegenden Bänden dieses Systems ausführlich nachgegangen. Hier können wir uns nicht des weiteren darauf einlassen. Um aber die weiten Perspektiven anzudeuten, die sich aus dieser Auffassung ergeben, sei es uns gestattet, einige Sätze zu wiederholen:
Wir müssen den allergrößten Wert auf die Feststellung legen, daß die Errichtung des Staates, der Klassenherrschaft und Ausbeutung in ihrem Ursprung durchaus unschuldig waren. Denn nur dadurch kann der alte Streit entschieden werden, ob der Mensch von Natur aus „çut“ ist, wie die Stoa und die englische Moralphilosophie Shaftesburys und seiner Nachfolger lehrten, oder „schlecht“, wie Epikur, Hobbes,
[292]
Schopenhauer und das Christentum lehren. Ist er, mit anderen Worten, sozial oder antisozial ? Ist das letzte der Fall, so kann nur eine starke Autorität, die ihr Amt unmittelbar aus göttlicher Verleihung ableitet, durch Zwang den „Consensus“ notdürftig herbeiführen und aufrecht erhalten : eine Theokratie, wie Platon sie in seiner Politela konstruierte, wie sie nach ihm so viele andere, am gewaltigsten und zynisch wie kein Anderer Hobbes forderte, und wie der Katholizismus sie am großartigsten zu verwirklichen verstanden hat. Ist aber das erste der Fall, so kann man die Gesellschaft getrost der eigenen Entwicklung überlassen, selbstverständlich, nachdem man die Hindernisse ihrer Einstellung zur Harmonie, zum Consensus, beseitigt hat [1].
Von wie entscheidender Wichtigkeit für die Entscheidung über dieses wichtigste aller theoretischen und daher praktischen Probleme es ist, ob man den Staat und die Klassenscheidung aus innerstammlichen oder zwischenstammlichen Beziehungen hervorgehen läßt, kann man an einer Auslassung des tiefsinnigen von Baader[2] ersehen. Auch er stellt bereits den Begriff der „politischen“ dem der „natürlichen Gesellschaft“ gegenüber; unter der ersteren versteht er ungefähr unseren philosophischen Rechtsstaat, den er eine „Theokratie im engeren Sinne“ nennt. Aus dieser entsteht „die politische Gesellschaft engeren Sinnes“ durch einen Sündenfall, durch „Übertretung des Gesetzes“: „Der Fall tritt ein, wo der Mensch, statt subjiziert zu sein, sub- jizierend wirkt“[3]. Aber er denkt, wie alle seine Zeitgenossen, nicht an die Entstehung des Staates durch äußere Eroberung, sondern an die „Subjizierung“ der eigenen Volks- und Rechtsgenossen. Das wäre in der Tat der schlimmste aller Sündenfälle, der keine andere Deutung zuließe, als die der angeborenen, tiefen Schlechtigkeit, Antisozialität des Menschen, und keinen anderen praktischen Schluß, als daß Restriktion, Zwang und Geisterfurcht ewig nötig sind, um diese Bestie in Zaum zu halten.
Wenn man aber, und dem ist nicht mehr auszuweichen, die Bildung des Staates, der Klassenscheidung und der Ausbeutung aus zwischenstammlichen Beziehungen: statt aus dem „Wir-Verhältnis“ der Genossenschaft und brüderlichen Liebe aus dem „Nicht-Wir-Verhältnis“ des Kampfes ableitet, so darf man mit uns den Menschen als ein soziales Wesen auffassen, das im Durchschnitt — es kommen nach oben wie nach unten hin Ausnahmen vor — mit „sozialen Regulationen“ ausgestattet ist, stark genug, um gegenüber normaler Versuchung als „Maximen“ den Entschluß zu bestimmen. Und daraus folgt praktisch sehr einfach, daß wir die Gesellschaft derart einzurichten haben, daß
[1] S. S. III, S. 198. Vgl. a. S. I, S. 1113/4.
[2] Grundzüge der Sozietätsphilosophie, Würzburg 1865.
[3] Vgl. die von uns veranlaßte Frankfurter Dissertation von Loewenthal (1923).
[293]
im Durchschnitt nur normale Versuchungen den Menschen treffen. Das ist möglich. Heute aber ist die Gesellschaft derart geordnet, daß den Menschen in der Regel abnorme Versuchungen heimsuchen, denen seine Psyche eben nicht gewachsen ist, weil „Einige so reich sind, um andere kaufen zu können, und Andere so arm, um sich verkaufen zu müssen“, wie Rousseau sagt.
Damit kehren wir zu unserer Betrachtung der Entwicklungsstadien des Staates zurück. Die Schöpfungen des zweiten Stadiums enthalten alle späteren Gestaltungen im Guten wie im Bösen bereits in der Anlage. Kein späteres Stadium kann sich ihm an Bedeutung vergleichen. Wir werden uns daher jetzt kürzer fassen dürfen.
c) Die weiteren Stadien.
Das dritte Stadium wollen wir das Tributstadium nennen. Es ist wieder für die Herren ein kleineres Mittel zu ihrem wirtschaftlichen Ziele als das vorausgehende. Sie lassen sich den üblichen Ertrag der bisherigen Züge in ihr Lager liefern. Ihnen erspart es die bisherige „Beschaffungsarbeit“ des Heereszuges und gibt ihnen die Möglichkeit, die ersparte Zeit auf die Unterwerfung bisher nicht betroffener Stämme zu verwenden, d. h., um im kaufmännischen Bilde zu bleiben, den „Betrieb“ zu erweitern. Und für die Bauern ist die Regelung offenbar noch von größerem Vorteil : die Unregelmäßigkeiten, die bisher mit der gewaltsamen Einziehung der „Herrenrente“ (Rodbertus) verknüpft waren: einige erschlagene Männer, vergewaltigte Frauen, verbrannte Hütten, fallen jetzt fort, und vor allem haben die Untertanen jetzt wieder ein Motiv, mehr zu erarbeiten, als das nackte Leben und jenesMinimum von Überschuß, das hinreicht, um blutige Strafe von ihren Häuptern fernzuhalten. Sie sind auf eine einigermaßen feste Grundrente gesetzt, und das heißt, daß aller Überschuß fortan ihnen selbst zugate kommt : eine Verbesserung, die aus dem Grunde unendlich wirtschaftlich wirkt, weil sie den Arbeitswillen mächtig anregt. Wir haben in unserem „Großgrundeigentum“ zeigen können, daß diese Änderung, freilich unter Verhältnissen, die den Fronbauern außerordentlich günstig waren, das deutsche Großgrundeigentum des zehnten in die Großgrundherrschaft des elften Jahrhunderts verwandelte und in kurzer Zeit aus dem rechtlosen armseligen Knecht den freien stolzen Bauern machte, dessen Kaufkraft die städtischen Märkte aus dem Boden springen ließ.
Dieses dritte Stadium, die Zahlung des Tributs, ist uns bereits aus der Staatengeschichte in zahlreichen Beispielen bekannt. Die deutschen Könige des 10. Jahrhunderts zahlten ihn an die Magyaren, bis Heinrich der Vogler statt des Schatzes den räudigen Hund übergab und damit den Entscheidungskampf herbeiführte, der auf dem Lechfelde ausge-
[294]
fochten wurde und die Macht der Nomaden brach. Schon vorher hatte Attila von den unterworfenen germanischen Stämmen, die selbst zum Teil schon Kriegsstaaten waren, Tribut und Heeresfolge erzwungen, und nach ihnen hat namentlich die „Goldene Horde“ der Mongolen das System zu einer nicht wieder erreichten Großartigkeit gesteigert. Die prachtvollen Kaiserstädte Irans, die jede neue Dynastie neu auf neuer Stelle erbaute, sind zum großen Teile gleichfalls aus solchen Tributen, namentlich des wehrlosen Indiens, errichtet worden. Auch die Türken haben vielfach, wenigsten im Anfang, sich mit Tribut begnügt; später schritten sie zumeist, unter politischem Druck, auch unter dem Antrieb ihrer religiösen Vorstellungen, zur eigentlichen Beherrschung [1].
Das vierte Stadium wollen wir das Stadium der mechanischen Mischung nennen. Der Fortschritt besteht darin, daß Sieger und Unterworfene gemeinsam ein Gebiet bewohnen, ohne daß jedoch eine eigentliche Verschmelzung zustande käme. Die Elemente liegen nebeneinander wie in einem Gemenge von Körpern, die nicht miteinander reagieren; sie sind noch nicht zu einer echten Verbindung im chemischen Sinne geworden. Von jetzt an wandeln sich die ursprünglich zwischen- stammlichen Beziehungen mehr und mehr in innerstaatliche um.
Diese räumliche Vereinigung kann verschiedene Gründe haben. Vielleicht haben stärkere Horden die Hirten vorwärtsgedrängt ; vielleicht ist die Volksvermehrung in der Steppe über die Nährkraft der Weiden hinausgewachsen, oder ein großes Viehsterben hat die Hirten gezwungen, die unbegrenzte Weite mit der Enge des Stromtales zu vertauschen. Wir brauchen aber nicht nach solchen äußeren Gründen zu suchen: im allgemeinen reichen die inneren völlig aus, um die Herren zu veranlassen, die unmittelbare Nachbarschaft ihrer Untertanen zu suchen: sie ist wieder das kleinere Mittel zum größeren Erfolge. Die Schutzpflicht gegenüber den fremden „Bären“ zwingt sie, mindestens ein Aufgebot junger Krieger in der Nähe des Stockes zu halten, und das ist gleichzeitig ein vortreffliches Mittel, um die Bienen von Aufruhrgelüsten oder einer etwaigen Neigung zurückzuhalten, einen anderen Bären als Bienenvater über sich zu setzen. Denn auch das ist nicht selten. So sind, wenn die Überlieferung wahr ist, die skandinavischen „Söhne Rjuriks“ nach Rußland gelangt.
Zunächst ist, wie gesagt, die räumliche Vereinigung noch keine staatliche Gemeinschaft im eigentlichen Sinne, noch keine Einheitsorganisation.
Wo sie es mit gänzlich unkriegerischen Stämmen zu tun haben, führen die Hirten, wandernd und weidend, ihr Nomadenleben ruhig
[1] Die Hyksos saßen im Osten des Delta, in Auaris und Tanis; „das ganze. Land brachte ihnen Tribut und alle Erzeugnisse Unterägyptens“ (Meyer, Geschichte des Altertums, S. 313 und 321).
[295]
weiter zwischen ihren „Perioeken“ und „Heloten“. So die hellfarbigen Wahuma, „die schönsten Menschen der Welt“, wie der deutsche Resident Kandt sie nannte, in Zentralafrika ; so der Tuaregclan der Hadanara vom Stamme der Asgar, der seine „Wohnsitze unter den Imrad genommen hat und zu wandernden Freibeutern geworden ist. Diese Imrad sind die dienende Klasse der Asgar, von der diese leben, obwohl jene imstande sind, zehnmal mehr Streiter zu stellen; ihre Stellung ist ungefähr wie die der Spartaner zu den Heloten“ [1]. So ferner die Teda im benachbarten Borku: „So wie das Land in nomadennährende Halbwüste und Gärten und Dattelhaine, so teilt sich seine Bevölkerung in Nomaden und Ansässige. Beide halten sich die Wage, was ihre Zahl anbetrifft: es mögen 10—12000 insgesamt sein; aber es ist selbstverständlich, daß diese von jenen beherrscht werden“[2].
Und ähnliches gilt von der gesamten Hirtenvölkergruppe der Galla, Masai und Wahuma: „Während die Besitzunterschiede groß sind, gibt es wenige Sklaven als dienende Klasse. Sie werden durch niedriger gestellte Völker vertreten, die räumlich abgesondert leben. Das Hirtentum ist die Grundlage der Familie, des Staates und zugleich das Prinzip der politischen Bewegungen. In diesem weiten Gebiet gibt es zwischen Schoa und dessen südlichen Vorländern auf der einen und Sansibar auf der anderen Seite keine feste politische Macht, trotz der hochentwickelten sozialen Gliederung“[3].
Wo aber entweder das Land für Viehhaltung im großen ungeeignet ist, wie in Westeuropa fast überall, oder, wo eine weniger unkriegerische Bevölkerung Aufstandsversuche befürchten läßt, da wird die Herrenklasse mehr und mehr seßhaft, sitzt, natürlich an festen oder strategisch wichtigen Punkten, in Zeltlagern oder Burgen oder ganzen Städten. Von hier aus beherrschen sie ihre Untertanen, um die sie sich übrigens nicht weiter kümmern, als das Tributrecht es verlangt. Selbstverwaltung und Kultübung, Rechtsprechung und Wirtschaft ist den Unterworfenen völlig überlassen; ja, sogar ihre autochthone Verfassung, ihre lokalen Autoritäten, bleiben unverändert.
Wenn Frants Buhl richtig gesehen hat, war das der Anfang der Hebräerherrschaft in Kanaan[4]. Alle Nomaden durchlaufen dieses Stadium. Junge berichtet von den Turkmenen: „Der, Nomade und Krieger bleibende Turkmene besaß in seinen Sklaven das Mittel, auch Ackerbau in bedeutendem Maße zu betreiben. ... So hielten sich die einzelnen Aule der Stämme in den gewonnenen Oasen trotz eines Nomadenlebens der Bevölkerung alsbald an feste Plätze. Wenigstens zu-
[1] Ratzel, Völkerkunde II, S. 485.
[2] Ratzel, Völkerkunde II, S. 480.
[3] Ratzel, Völkerkunde II, S. 165.
[4] Soziale Verhältnisse der Israeliten, S. 13.
[296]
nächst auf eine bestimmte Anzahl von Jahren hin. An diese Plätze zog man sich auch bei feindlichen Überfällen zurück“.
Von den Türken, vom Islam überhaupt heißt es: „Eigentlich nur auf Kriegs- und Finanzwesen erstreckte sich die Staatsverwaltung des Islam; in die inneren Angelegenheiten der Untertanen mischte sie sich möglichst wenig; so lange nur die Abgaben richtig einkamen, blieb ihnen eine weitgehende Autonomie“ [1].
In Rußland war diese Art der Beherrschung von allem Anfang vorhanden: „Unter den Fürsten des sogenannten Hauses Rjurik herrschte noch vollständige Barbarei. Diese Fürsten legten den russischen Völkern Steuern auf, suchten sie durch Unterwerfung zu vereinigen; ihre Herrschaft trug jedoch nicht einen staatlichen, sondern mehr einen räuberischen, parteigängerartigen Charakter. Sie umgaben sich mit Kriegerscharen, mit Banden verwegener Abenteurer, die auf Raub und Mord ausgingen; ihr Heer bestand aus Freiwilligen verschiedener Stämme, mit denen sie Streifzüge gegen ihre Nachbarn unternahmen“. Ist die Geschichte nicht wirklich „einförmig und voller Wiederholungen“ ? Hier haben wir die volle Parallele zu der Entstehung des Staates der Makololo, unter arischen Völkern und unter germanischen Fürsten. Kostomarow, dem wir die Stelle entnehmen[2], fährt fort: „Ihr Augenmerk war auf Beute gerichtet, und sie betrachteten ihr Verhältnis zu den von ihnen unterworfenen Völkern lediglich unter dem Gesichtspunkt des Tributs, von dem sie so viel als nur irgend möglich zu erpressen suchten. Dieser Tribut verpflichtete aber diejenigen, die ihn erhoben, durchaus nicht zu Gegenleistungen; diese Fürsten und ihre Kriegsknechte, die nur auf Tribut und Beute ausgingen, gaben sich nicht die geringste Mühe, das Leben ihrer Lehenspflichtigen irgendwie zu reformieren ... ; sie ließen ihnen ihre alte Lebensweise und kümmerten sich lediglich um den Eingang des Tributs und der Steuern“.
Dann kamen die Mongolen über diese Raubstaaten als stärkere Räuber, und es blieb in dieser Beziehung alles beim alten: „Die Mongolen betrachteten es als ihr Recht, auf Kosten der Besiegten zu leben; sie verlangten nur Unterwerfung von ihnen und kümmerten sich nicht um deren Glauben und Nationalität. Im Gegenteil, sie übten eine Art von philosophischer Duldung dem Glauben und der Nationalität der besiegten, aber fügsamen Völker gegenüber“[3].
Das haben die russischen Zaren von ihren Lehensherren gut gelernt. Moskau wurde groß und reich durch den Anteil an den Mongolen-
[1] Caro, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Juden im Mittelalter und der Neuzeit, Leipzig 1908, S. 122.
[2] a. a. O. S. 3.
[3] Kostomarow, a. a. O. I, S. 150.
[297]
tributen, die die Großfürsten für die Mongolenkhans erpreßten; sie verstanden es gut, sich Pfeifen zu schneiden, solange sie im Rohre saßen. Sie stellten so eine Art von Zwischenpächtern dar [1], „Gabellotos“, bekanntlich die schlimmste Art aller Blutsauger, seien es nun Grundoder Steuerpächter. Und nach der Befreiung vom Joch der Mongolen blieb für das niedere Volk wieder alles unverändert, bis auf die aller- jüngste Gegenwart. Nicht wie in Preußen „kam der Staat unter allen Umständen mit der Wehr- und Steuerpflicht und dem Anfange der Schulpflicht an den einzelnen heran... . Das Dorf, d. h. die Dorfgemeinde war solidarisch haftbar für den Anteil der Rekruten und Steuern. Wie sie diesen Anteil unter sich dann verteilte, wie sie überhaupt ihre Angelegenheiten — und diese waren außerordentlich umfassend — regelte, das blieb ihr völlig überlassen. Die russische Bauerngemeinde — und da in Rußland auch heute noch über vier Fünftel der Bevölkerung Bauern sind, hieß das: die überwiegende Mehrheit des russischen Volkes — hat sich bis in die unmittelbare Gegenwart einer Autonomie erfreut, von der man sich in Westeuropa kaum eine richtige Vorstellung gemacht hat“[2].
Ganz ähnlich war es bis zum Weltkriege in dem türkischen Palästina. Wenn die deutschen oder jüdischen Kolonisten nur ihre Steuern pünktlich abführten und nicht gerade grobe Verbrechen begingen, konnten sie tun, was sie wollten. Für die „Stadt auf dem Frühlingshügel“ (Tel-Awiw) hat der Vorsteher des zionistischen Palästinabureaus, Dr. Ruppin, Bauordnung, Straßenordnung und Gemeindeverfassung ganz autonom festgesetzt : eine Machtvollkommenheit, die uns Westeuropäer, über die „der moderne Staat hereingebrochen ist“, fast traumhaft anmutet. Und wenn die Söhne der württembergischen Kolonisten von Sarona bei Haifa aus Deutschland zurückkehrten, wo sie ihrer Militärpflicht genügt hatten, dann waren sie froh, wieder in ihr „freies Land“ heimzukommen.
Was der Staat seiner eigentlichen Natur nach ist, ein Institut der wirtschaftlichen Ausbeutung, das zeigt sich an diesen letzten Fällen mit ganz besonderer Deutlichkeit, weil es sich doch schon um vollentwickelte „Staaten“ handelt. Und die Beispiele ließen sich häufen. Ratzel stellt das gleiche summarisch für „die“ orientalischen Monarchien und den uns als Vollstaat imponierenden gewaltigen Militärstaat Abessinien fest: „Ihre Hauptsorge ist der Tribut, um die innere Regierung und Gerechtigkeitspflege der unterworfenen Völker kümmern sie sich nicht“[3].
Ein reines Beispiel des vierten Stadiums, zweite Abart, ist
[1] Ebenda, I S. 197.
[2] Hoetzsch, Rußland, Berlin 1913, S. 39.
[3] Völkerkunde II, S. 455.
[298]
Mexiko vor der spanischen Conquista: „Die Konföderation, an deren Spitze die Mexikaner standen, hatte etwas fortgeschrittenere Begriffe von Eroberung. Von ihr wurden nur die Stämme vernichtet, die Widerstand leisteten. Sonst aber wurden die Überwundenen bloß ausgeplündert und dann zu Tribut verpflichtet. Der geschlagene Stamm regierte sich wie vorher durch seine Vorgesetzten, kein Gedanke, wie in Peru, an Bildung eines zusammenhängenden Reiches begleitete den ersten Überfall, nur Einschüchterung und Ausbeutung. So war denn das sogenannte Reich von Mexiko zur Zeit der Eroberung nur eine Kette von eingeschüchterten Indianerstämmen, die, selbst untereinander scheu getrennt lebend, durch Furcht vor den Ausfällen aus einem unangreifbaren Raubnest in ihrer Mitte in Schach gehalten wurden [1]“.
Ob man hier schon oder noch nicht von einem „Staat“ sprechen soll, kann zweifelhaft erscheinen. Äußerlich-formal angeschaut, ist es noch keiner, aber seinem Inhalt nach angesehen, ist es schon Staat, aber noch Gewalt-, noch nicht „Machtstaat“. Ratzel will dem Gebilde den Namen noch nicht geben: „Sieht man, wieweit die von Montezumas Kriegern unterworfenen Punkte durch nicht unterworfene Gebiete voneinander getrennt waren, so fühlt man sich versucht, Vergleiche mit der Hovaherrschaft über Madagaskar zu ziehen. Die Verstreuung einiger Garnisonen, besser: militärischer Kolonien, die mühselig einen Beutekreis von ein paar Stunden in Unterwerfung halten, bedeutet uns nicht die Alleinherrschaft“[2].
Waren es wirklich nur „die orientalischen Monarchien“, die sich nur um den Tribut, und nicht um die inneren Angelegenheiten der Unterworfenen kümmerten ? Waren die von Germanen auf römischem Reichsboden begründeten Staaten anfänglich so ganz etwas anderes? „In manchen germanischen Stammesreichen ging das so weit, daß, wenigstens eine gewisse Zeit hindurch, sogar völlige Gleichgültigkeil des herrschenden Stammes gegenüber dem römischen Recht bestand, und die Folge davon war, daß das römische Recht dort während dieser Zeit nicht die Stellung einer vom Eroberer anerkannten Rechtsordnung besaß, sondern nur „unbeachtet weitergalt“ (Neumeyer, die gemeinrechtliche Entwicklung I, S. 80), und sich so einer bloßen Duldung erfreute. Auch für das Reich der Vandalen spricht Halban (Das römische Recht in den germanischen Volksstaaten, I, 76) von einer .stillschweigenden Duldung römischer Rechtsverhältnisse' “ [3].
Vom Perserreich heißt es, „daß es nur auf brutale Gewalt begründet
[1] Völkerkunde I, S. 628.
[2] Völkerkunde I, S. 625.
[3] Lukas, Territorial- und Personalitätsprinzip im Österreich. Nationalitätenrecht (Jahrb. d. öff. Rechts, II, 1908, S. 345).
[299]
war und durch brutale Gewalt zusammengehalten wurde. Kein gemeinsames Interesse irgendeiner Art verband die unzähligen Völker des Reiches; und die Perserherrschaft hat es nicht vermocht, diese Völker zu einem Ganzen zu verschmelzen. Babylonier, Meder, Ägypter, Kleinasiaten standen sich zu Alexanders Zeit noch genau so fremd gegenüber wie einst zur Zeit des Dareios“l). Den unterworfenen jonischen Städten blieb sogar das Fehderecht untereinander unbeschränkt; der König verlangte nichts weiter, als die Zahlung eines mäßigen Tributs und Heeresfolge im Kriege[2].
Das sind so Musterbeispiele für die Gültigkeit der Rachfahlschen Staats-Definition !
Bevor wir dazu übergehen, das nächste Stadium zu betrachten, seien noch einige weitere Beispiele für Übergangserscheinungen zwischen den ersten vier Stadien erwähnt, wie wir deren eines bereits bei den Makololo kennen gelernt haben. Dort bestanden die vier ersten Stadien nebeneinander in Gestalt von Zonen, deren innerste schon die mechanische Mischung, wenn nicht bereits die noch höhere Stufe repräsentierte, deren mittlere Tribut zahlte, während die äußerste noch Imker- und Raubgebiet darstellte. Einen anderen Fall derart schildert Ratzel (Anthropog. I, S. 174) sehr anschaulich aus Wadai. Diese Erscheinung ist sehr häufig, wie sich das von selbst versteht, und braucht nicht durch weitere Belege illustriert zu werden. Ein anderer Zustand des Übergangs wird von manchen Ansiedlungen der Fulbe, des Reiter- Herrenvolkes der Sahara berichtet: „Das erobernde Volk streckt wie ein Polyp zahlreiche Arme hier- und dorthin zwischen die bestürzten Eingeborenen, deren Uneinigkeit eine Menge von Lücken bietet. So fließen langsam die Fulbe in die Benueländer hinein und durchdringen sie ganz allmählich. Mit Recht vermeiden es daher auch neuere Beobachter, bestimmte Grenzen anzugeben... . Eigentliche Reiche, die sich fest gegeneinander und die unabhängigen Stämme abgrenzen, gibt es noch nicht. Selbst die Hauptorte sind weit davon entfernt, fest zu liegen“[3]. Einen anderen Übergang zwischen zweitem und viertem Stadium teilt Richter[4] von den Marotse mit : sie holen noch den Tribut, und zwar zumeist in Friedlichkeit, aber sie besetzen doch schon strategisch wichtige Punkte. Einen Übergang bildet auch das Verhältnis der Athener zu den Bundesgenossen des alten Seebundes[5], die teils durch Garnisonen, teils durch Zivilkommissare — Übergang zum nächsten Stadium! — in Räson gehalten wurden.
[1] Beloch, a. a. O. II, 1, S. 4.
[2] Ders. I, 1, S. 374.
[3] Ratzel, Völkerkunde II, S. 492.
[4] Richter, Kultur und Reich der Marotse, Leipzig 1908, S. 116.
[5] Beloch, a. a. O. II, 1, S. 188.
[300]
Auch das fünfte, das „Residentenstadium“, stellt gegenüber seinem Vorgänger ein kleineres Mittel zu größerem Erfolge der Staatszwecke dar. Es bereitet die „chemische Mischung“ der im Staate zu verschweißenden Elemente dadurch vor, daß es sozusagen ein Ferment einführt: Vertreter oder Beamte des herrschenden Stammes, die an den „Höfen“ der Gau- oder Dorfkönige (die oft kaum mehr als Dorfschulzen sind), sitzen und diejenigen Aufgaben der Rechtsprechung und Verwaltung übernehmen, die für die Oberklasse von Wichtigkeit sind. Auch das haben wir bereits bei den Makololo kennen gelernt.
Die Gründe dieser neuen Einrichtung liegen auf der Hand. Es entstehen Streitigkeiten zwischen den verschiedenen Dörfern oder Gauen oder Stämmen des Reiches, hervorgerufen durch Meinungsverschiedenheiten über Flurgrenzen, oder durch Weiberraub, oder, in schon höher entwickelten Verhältnissen, durch Erbstreitigkeiten zwischen den Söhnen eines verstorbenen tributären Fürsten. Blutigen Austrag zu vermeiden, liegt in dem wirtschaftlichen Interesse der Herren : denn durch Fehden leidet das, was man noch in fried er izianischer Zeit die „Prästationsfähigkeit“ der Bauern nannte [1]. Darum wirft sich die Leitung der Herrengruppe zum Schiedsrichter auf und erzwingt im Notfall ihren Spruch. Um solchen Schwierigkeiten in Zukunft vorzubeugen, setzt man immer häufiger „Residenten“ ein: offizielle Berater, inoffizielle Herren des Fürsten, wie wir es noch heute an den britischen Residenten bei den Höfen der „unabhängigen“ Rajahstaaten Indiens und am Hofe des Khedive von Ägypten beobachten können. Für primitive Verhältnisse bildet das Reich der Inka das typische Beispiel:
Hier saßen die Inka in Cuzco vereint, wo sie ihre Erbländereien und ihre Wohnungen hatten. Aber in jedem Bezirk des Reiches residierte ein Vertreter der Inka, der Tukrikuk, am Hofe des eingeborenen Häuptlings. Er „hatte die Aufsicht über alle Angelegenheiten seines Bezirks; er hatte die Aushebung der Mannschaften für das Heer zu veranlassen, die Einlieferung der Abgaben zu überwachen, die Frondienste, Wege- und Brückenbauten anzuordnen, das Rechtswesen zu leiten, kurz alles, was seinen Bezirk betraf, unterstand seiner Aufsicht“[2].
[1] Locke sagt sehr fein: Auch in absoluten Monarchien gibt es selbstverständlich Rechtsschutz und schlichtende Gewalten. „Aber es gibt gute Gründe zu bezweifeln, daß das aus wahrer Liebe zur Menschheit und Gesellschaft und der Güte (charity), die wir uns alle schulden, geschieht: denn es ist nicht mehr, als was jedermann, der seinen Vorteil, seine Macht und Größe will, tun mag und selbstverständlich tun muß, nämlich diese Tiere, die doch nur für seinen Vorteil und Vergnügen arbeiten und sich plagen, davon abzuhalten, daß sie sich verletzen oder umbringen, und so gibt ihr Heir Acht auf sie, nicht aus Liebe zu ihnen, sondern zu sich selbst, des Vorteils wegen, den sie ihm bringen“ (§ 93).
[2] Nach Cieza de Leon, berichtet bei Cunow, Inkareich, S. 62 Anm. 1. Ganz analog war die Stellung des römischen Statthalters in den Provinzen: „Er war in erster Linie militärischer Befehlshaber und die für die römischen Bürger zuständige Obrigkeit. Aber die Vollmacht, überall einzugreifen, wo es das römische Interesse gebot, und die Aufsicht über die römischen Einkünfte brachten ihn in fortwährende Berührung mit der Bevölkerung“ (Geizer, Gemeindestaat und Reichsstaat in der römischen Geschichte, S. 11). Wir werden von den hellenischen Harmosten und römischen Prokonsuln im Kapitel von den Seestaaten ausführlich zu handeln haben.
[301]
Derartige bewaffnete Heerlager finden wir ebenfalls überall in der Geschichte, wo die Notwendigkeit für die Eroberer besteht, ein nicht vollkommen gezähmtes Volk niederzuhalten, und auch dort, wo andere Erobererstämme oder -Staaten die Grenzen bedrohen. So hatten auch die Makololo unter Sebituana eine Zeit lang eine solche Burgstadt in der durch Sumpf und Fluß geschützten Niederung des Kwando [1], und von den Arabern berichtet Caro[2] das gleiche: „Die arabischen Eroberungen brachten nicht wie die germanischen Niederlassungen auf dem Boden römischer Provinzen eine Umwälzung in den Grundbesitzverhältnissen hervor. Landteilungen zwischen Siegern und Besiegten, wie im Occident, haben im Orient nicht stattgefunden“. Hier drückt sich die Tatsache aus, daß die Araber als reine Nomaden, die Germanen aber bereits als halbe Ackerbauern mit der alten Kulturwelt zusammenstießen. Caro fährt fort: „Die Moslimen bezogen aus der durch Grund- und Kopfsteuer der Untertanen gespeisten Staatskasse ein Jahrgehalt ; außerhalb Arabiens durften sie nach einem von Omar strengstens eingeschärften Gesetz weder Grundbesitz erwerben noch Ackerbau treiben. Wer zum Islam übertreten wollte, mußte auf seine unbewegliche Habe verzichten. So haben die Araber sich auch nicht zerstreut in den eroberten Landschaften angesiedelt. Zur Sicherung der Herrschaft wurden große Lagerstädte errichtet, Kufa und Bassra im Irak (Euphratgebiet), Kairwan in Nordafrika. Hier wohnten die Moslimen beisammen, als ständige Garnison, und immer bereit, ins Feld zu rücken“. Ebenso saßen die Hyksos in ihrer Lagerfeste Auaris[3].
Was amerikanische Jäger und semitische (übrigens auch mongolische) Hirten ausgebildet haben : dieses System der Beherrschung der Untertanen von festen Lagerstädten aus, während gleichzeitig Vertreter des Herrenstammes an den Höfen der eingeborenen Häuptlinge oder Fürsten die „Interessen“ des Staates wahrnehmen, das haben auch die afrikanischen Hirten überall auszugestalten verstanden. In Ashanti ist das System der Residenten völlig ausgebildet, und auch die Dualla haben über den, in abgesonderten Dörfern lebenden Untertanen „ein auf Eroberung beruhendes Mittelding von Lehnswesen und Sklaverei“ begründet[4]. In den Fulbeländern — hier handelt
[1] Richter, a. a. O.
[2] Caro, a. a. O. S. 124/25.
[3] Ed. Meyer, a. a. O. S. 321.
[4] Ratzel, Völkerkunde II, S. 346.
[302]
es sich also nicht um Neger, sondern um die hellfarbigen „Hamiten“ — „haben sich Verhältnisse entwickelt, die der Europäer schwer durchschaut, eine Leibeigenschaft, die hart an Sklaverei grenzt. Die Leibeigenen wohnen in besonderen Dörfern, bebauen neben dem Feld der Herren ihr eigenes, können sich frei verheiraten, sind aber an die Scholle gebunden. Man findet dieses System neben echter Sklaverei in Futa Djallon“ [1].
Und von den Barotse berichtet der gleiche Autor (a. a. O. S. 221) eine Verfassung, die ebenfalls schon fast völlig der mittelalterlichen Feudalordnung frühester Stufe entspricht; die „Dörfer sind in der Regel von einem Kranze von Weilern umgeben, wo Leibeigene wohnen, die in der nächsten Umgebung für ihre Herren Felder bestellen, Getreide anbauen oder auch Viehherden hüten müssen“. Hier ist für unseren Begriff nichts anderes mehr fremdartig, als daß die Herren nicht einzeln in Burgen oder „Hallen“, sondern dorfweise zwischen den Untertanen hausen.
[***]
Von den Inka führt kaum noch ein einziger Schritt zu den Doriern in Lakedämon, Messenien und Kreta[2], die auch zum Teil in befestigten Heerlagern hausen und sich von ihren Perioeken und Heloten ernähren lassen, und zu der thessalischen Ritterschaft, die von der Arbeit ihrer Penesten lebt; „diese sind selbständig in ihren inneren Angelegenheiten, aber zur Heeresfolge, wohl auch zu finanziellen Leistungen verpflichtet“, wie es von den unter Argos „Herrschaft gekommenen argolischen Städten heißt[3]. Und ebenso klein ist der Schritt, der von der lockeren Feudalherrschaft der Barotse, Dualla und Fulbe zu den verhältnismäßig straff organisierten Feudalstaaten — Staaten in jedem Sinne — der afrikanischen Reiche Uganda, Unyoro usw., und zu den ihnen ganz gleichen Feudalreichen Ost- und Westeuropas und ganz Asiens führt. Die Dinge entwickeln sich überall kraft derselben sozialpsychologischen Logik zu dem gleichen Ziele: als das immer kleinere Mittel zum Ziele der Staatsbildung, der dauernden wirtschaftlichen Ausbeutung der Untertanen. Die Notwendigkeit, sie in „Räson“ und bei ungeschwächter Prästationsfähigkeit zu erhalten, führt überall vom fünften zum sechsten Stadium: nämlich zur Vollendung des Staates in jedem Sinne, zur vollen Intranationalität und zur Ausbildung der „Nationalität“, der Entwicklung der Gesamtheit, der Herren samt den Untertanen, zu einer einzigen „hoch organisierten Gruppe“[4]. Immer
[1] ib. 11 s. 36/7.
[2] Vgl. Beloch, a. a. O. I, i, S. 130, 140.
[3] Vgl. Beloch, a. a. O. I, 1, S. 204.
[4] S. S. I, S. 573ff.
[303 ]
häufiger wird der Zwang, einzugreifen, zu schlichten, zu strafen, zu erzwingen; die Gewohnheiten des Herrschens und Beherrschtwerdens, die Gebräuche der Herrschaft, die Regeln einer Staatsverwaltung bilden sich aus.
Die beiden Gruppen, zuerst räumlich getrennt, dann auf einem Gebiete vereint, aber noch immer nur übereinandergeschichtet, dann durcheinander geschüttelt, werden mehr und mehr zu einer hierarchisch geordneten Einheit. Sie durchdringen sich, mischen sich, verschmelzen in Brauch und Sitte, in Sprache und Gottesdienst, und schon spannen sich auch Fäden der Blutsverwandtschaft von oben nach unten. Denn fast überall wählen sich die Herren die schönsten Jungfrauen der Unterklasse zu Kebsen, und ein Stamm von Bastarden wächst heran, bald der Herrenschicht eingeordnet, bald als Kebsenkinder, („Kegel“, daher das Sprichwort „mit Kind und Kegel“) aus dem Kreise der von gleich- bürtigen Müttern geborenen „Milchbrüder“ (Homogalaktes [1]) ausgeschlossen, und dann kraft des in ihren Adern rollenden Herrenblutes die geborenen Führer der Beherrschten. Der primitive Eroberungsstaat ist fertig, Form und Inhalt.
Exkurs : Zur Entwicklung in der Neuen Welt.↩
Max Schmidt schreibt in seinem „Grundriß der ethnologischen Volkswirtschaftslehre“, in der übrigens herzlich wenig von Volkswirtschaft die Rede ist (es ist die übliche Verwechslung von Technik und Wirtschaft), nachdem er die Tatsachen der Staat und Klassen bildenden Gewalt sehr summarisch gewürdigt hat, folgendes: „Aber diesen gewaltsamen Mitteln zur Aneignung fremder Arbeitskraft oder deren Erzeugnissen gegenüber dürfen die friedlichen, die allseitigen Interessen der Beteiligten mehr oder weniger befriedigenden Mittel zu diesem Zwecke nicht übersehen werde. So geht Oppenheimer, dessen großes Verdienst es ist, auf diesen Gegensatz der gewaltsamen und friedlichen Mittel mit aller Schärfe aufmerksam gemacht zu haben, meiner Ansicht nach in der zu einseitigen Betonung der gewaltsamen Mittel zu weit.“
Ich bedaure, entschieden protestieren zu müssen. Schmidt beruft sich auf einen einzigen Satz meiner „Theorie der reinen und politischen Ökonomie“, in dem ich ausdrücklich auf meine Abhandlung „Der Staat“ mit der Bemerkung hinwies, daß ich mich „mit Andeutungen begnügen müsse“. Das hätte meinem Kritiker die Pflicht auferlegen sollen, diese Schrift anzuziehen, ehe er ein noch so freundliches Urteil abgab. Er hätte dort die Auseinandersetzungen über die Wandlungen des
[1] Beloch, a. a. O. I, S. 84.
[304]
zweiten Stadiums gefunden, die fast wörtlich in diese hier vorliegende Untersuchung eingegangen sind, und darüber hinaus in den folgenden Abschnitten Darlegungen über die seelische Integration und das „Staatsbewußtsein“, die hier noch folgen werden und seine Meinung von der „einseitigen Betonung der Gewalt“ richtig gestellt hätten.
Nach dieser notgedrungenen Verwahrung sei es uns gestattet, auf die sehr interessanten Tatsachen einzugehen, die Schmidt in seiner aufschlußreichen Arbeit: „Die Aruaken, ein Beitrag zum Problem der Kulturverbreitung“ [1], dargelegt hat.
Wir haben schon vordeutend darauf hingewiesen, daß in den Bezirken Waldbrasiliens der Ackerbau mit schweren Arbeiten verknüpft ist, die über die Kräfte der Frauen hinausgehen. Der Urwald muß mit glatten Steinbeilen gefällt und gerodet werden, um Ackerland für die Kultur des Maises und der Manjoka zu gewinnen, und diese Arbeit muß von Zeit zu Zeit wiederholt werden, weil der Boden verarmt und vor allem in der großen Hitze ausdörrt, versteppt, wenn ihm der Waldschutz genommen ist. Außerdem verursacht die Zubereitung der ursprünglich giftigen Manjoka viele schwere Arbeit.
Unter diesen Umständen ist die Gewinnung von abhängigen Arbeitskräften, denen diese Arbeit aufgeladen werden kann, erwünscht. Und so finden wir denn überall in diesen Gebieten einen höher stehenden Stamm, die Sprachengruppe der Aruak, als Sklavenjäger und Sklaven-, halter. „Auch hier wird zu diesem Zwecke vielfach Gewalt angewendet, indem die Männer der Überfallenen Gemeinwesen erschlagen, und die Frauen und Kinder als willkommene Arbeitskräfte dem Stamme eingegliedert werden, aber neben diesen gewaltsamen Mitteln werden auch die verschiedensten friedlicher Art angewendet, wie Versorgung mit Lebensunterhalt für geleistete Dienste, Heranziehung von Arbeitskräften durch Heirat, Beeinflussung durch Verbreitung religiöser Vorstellungen, Handelsverkehr, Ausübung der Gastfreundschaft u. dgl. mehr“[2]. Dazu kommt die Klientel ganzer abhängig gemachter Völkergruppen, die „durch Bedrängnis von Seiten feindlicher Nachbarn in Notlage geraten sind“, die man „durch Gewährung von Schutz an sich fesselt und in Abhängigkeit bringt“.
Es handelt sich bei den Aruak im grundsätzlichen um ein Beispiel unseres vierten Stadiums, der mechanischen Mischung. Aber die Tatsache, daß es sich um reine Ackerbauern und nicht um Hirten, und in specie um Bauern des brasilianischen Waldgebietes mit seinen eigentümlichen Existenzbedingungen handelt, färbt doch das typische Geschehen in eigenartiger Weise.
[1] Leipzig 1917.
[2] Grundriß, S. 50.
[305 ]
Da der Wald langer Vorbereitung bedarf, ehe er Ernten trägt, sind weite Wanderungen und massenhafte Wanderungen nicht möglich. Die Kolonisation kann nur von einem festen Punkte aus in nicht allzu entfernter Nachbarschaft erfolgen, da schon der Transport der vielen erforderlichen Geräte sonst unüberwindliche Schwierigkeiten machen würde. Deshalb fließen die Aruak in kleinen Ansiedlungen ganz allmählich in das Gebiet der Nachbarn ein, etwa, wie wir es von den Fulbe in den Benueländern hörten, und zwar folgt sich eine Welle nach der anderen, indem immer wieder die inzwischen sozusagen vernegerten, mit den Unterworfenen gemischten, zum Teil sogar sprachlich entnationalisierten Herrengruppen von reinblütigen Nachwanderern unterworfen werden.
Der zweite große Unterschied gegen die altweltlichen Staatsbildungen besteht darin, daß hier ein höher gebildeter Stamm über weniger geförderte herfällt. Das ganze erinnert sehr an die Kolonisation der Europäer in Amerika und Afrika, wie denn auch die Aruak zu den weißen Brasilianern in den besten Beziehungen zu stehen pflegen, zwischen deren Handel und die Wildstämme sie sich mit Erfolg als monopolistische Zwischenhändler einzuschieben bestrebt sind, wie etwa die Küstenstämme Kameruns. Diese Eroberer sind also von vornherein mehr ökonomisch angelegt; sie wollen nichts als Arbeitskräfte und wenden zu dem Zwecke jedes geeignete Mittel an, das unentfaltete politische in Mord und Sklavenjagd, wie wir von Schmidt erfuhren, aber ebenso gern die weniger gefährlichen Abarten des politischen und das ökonomische Mittel. Als die Klügeren brauchen sie mit bedeutendem Erfolge die „geistliche Gewalt“ neben der des Schwertes, indem sie die Eingeborenen mit Dämonen ängstigen [1]. Und wo die ökonomischen Mittel ihren Zwecken dienen, wenden sie sie ebenso gern an: wir werden übrigens hören, daß auch die Hirten den friedlichen Verkehr neben der Eroberung und dem Raube zu schätzen und zu üben wissen. Zu diesen friedlichen Mitteln gehört auch die Gewinnung von fremden Frauen auf dem Wege der Heirat anstatt des Raubes, den sie vielfach üben (S. 38/9).
Im übrigen haben sie die Handlungsweise und Psychologie aller Herrenklassen: Arbeit schändet (32, 68), sie ist Sache der Unterklasse: die Heranschaffung des Brennholzes für die Beheizung der großen Sippenhäuser, und die Bereitung der Manjokapräparate, die Rodung, der Bau der Langhäuser usw. In diesen Arbeiten werden die Kinder der Unterklasse früh geübt, während die Herrenkinder frei bleiben;
[1] Die Aruak, S. 64/5, S. 71, S. 100. Von einem Häuptling heißt es: „Durch ein eigenartiges Gemisch von Gewalt und hinterlistiger, mit Zauberkünsten und Dämonenkult eng verknüpfter Kulturarbeit“ (S.65). Die nachfolgenden Zitate aus diesem Buche in( ).
[306]
charakteristisch ist, daß die Herrenklasse immer diejenige Eheform und Geschlechtsfolge hat, die ihren Interessen am besten dient, während die Untergebenen Mutterfolge haben. Vor allem aber ist man immer „aufs peinlichste bemüht, die unterworfene Bevölkerung nicht in den Besitz von Gütern gelangen zu lassen, die nicht für den augenblicklichen Konsum bestimmt sind. Das gebrauchsfertige Kulturland gehört der Herrenklasse, ihr gehört das Haus, die Vorräte an Lebensmitteln, die für bestimmte Jahreszeiten angelegt werden müssen, und ihr gehören endlich die Vorräte an Gegenständen, die zum Austausch gegen andere Güter hergestellt werden“ (54), und die eingetauschten Wertstücke selbst, vor allem die als Geld fungierenden europäischen Glasperlen, die die Unterklasse nur als Schmuck in bescheidener Menge besitzen darf. Wir haben also die „Monopolisierung der nicht erblichen und erblichen Chancen“ durch die Oberklasse genau wie in der alten Welt.
Schmidt legt großen Wert darauf, daß die Behandlung der Untergebenen eine durchschnittlich gute ist, daß namentlich im Konsum keine groben Unterschiede stattfinden, während freilich die Arbeit ganz auf ihre Schultern fällt. Das ist nichts Auffälliges und nichts, was diese Kulturen von den altweltlichen unterscheidet. Auch hier ist die patriarchalische Sklaverei sehr milde, abgesehen von einzelnen Impulshandlungen; die Sklaven sind in der Tat Mitglieder der „Familie“; ohne das hätte die rechtliche Gleichsetzung der eigenen Kinder mit den Sklaven doch wohl nicht geschehen können. Diese werden als Unmündige behandelt, haben ihreArbeitspflicht, der aber überall das Recht auf ausreichenden Unterhalt gegenübersteht, ein Recht, das der Herr schon im eigenen Interesse nicht verletzt; sie stehen oft in einem wahren Vertrauensverhältnis zu ihren Herren, die ihnen viel anvertrauen müssen und nicht riskieren dürfen, daß sie ihnen mitsamt einem Teile ihrer Herden zu den Grenzfeinden durchgehen. Und sie nehmen in der Regel an dem gemeinsamen Familienhaushalt teil. Auch mit Arbeit werden sie nicht unbillig belastet.
Erst die kapitalistische Sklavenwirtschaft bringt die Ausbeutung in ihrer gehässigen Gestalt. Dazu ist in der Hirtenwirtschaft der Ansatz schon von vornherein gegeben, da der Herdenbesitz fast grenzenlos wachsen kann, wenn die nötige Zahl von Wächtern vorhanden ist: aber in der Waldbauernwirtschaft gibt es keinen Reichtum, der durch Agglomeration um vorhandene Kerne ins Grenzenlose wachsen könnte. Das Ziel der politischen Mittels kann hier, wo nicht etwa schon europäischer Handelseinfluß einspielt, nicht weiter gehen als bis zur Befreiung von eigener Schwerarbeit : mehr ist von den ärmeren und in der Kultur weiter zurück stehenden Nachbarn nicht zu erreichen, während die altweltlichen Hirten in der Lage sind, reiche Städtervölker zu überfallen und auszuplündern, um sie zuletzt zu beherrschen. Aus diesem
[307]
Grunde ist wohl auch die Aruakkultur nirgends bis zur eigentlichen Staatsbildung vorgeschritten; es bleibt überall beim höchstens vierten Stadium; die einheimischen Autoritäten werden eingeschüchtert und fügsam gemacht, bleiben aber in ihrer Stellung. So zeigt also auch diese Entwicklung, die übrigens einen ungeheuer großen Teil Südamerikas beherrscht, grundsätzlich ganz die gleichen Züge wie die altweltliche, und die Verschiedenheiten lassen sich aus dem eigentümlichen Milieu sehr leicht ableiten. Es wäre zu wünschen, daß ein Mann, der die eigentlich volkswirtschaftlichen und vor allem die soziologischen Fragen fachmännisch beherrscht, sich dieser noch längst nicht ganz aufgeklärten Dinge annehmen möchte. Max Schmidt, ein so ausgezeichneter Ethnologe er ist, läßt hier viel, wenn nicht alles zu wünschen.
[308]
Dritter Abschnitt.
Der primitive Eroberungsstaat. ↩
I. Form und Inhalt. ↩
Wir haben im Laufe der Erörterung zwei verschiedene Definitionen des Staates gegeben. Die erste lautet:
Der Staat ist eine in Klassen gegliederte Rahmengruppe, die eine mit Machtmitteln versehene Anstalt für den Grenz- und Rechtsschutz besitzt.
Wir erinnern hier daran, erstens: daß der Begriff der „Rahmengruppe“ bereits die Kennzeichen der Autonomie oder „Souveränität“ und der Begrenztheit des Personenstandes und des geographischen Gebietes nach außen hin enthält. Zweitens: daß wir hier den Begriff der „Klassen“ in einem weiteren Sinne brauchen, wo er alle dauernde, erbliche hierarchische Gliederung, die Stände und Kasten eingeschlossen, umfaßt. Und drittens: daß unser Begriff als Oberbegriff aller historischen Staaten nur ein Minimum von Kennzeichen enthält; nichts hindert, daß wir Unterbegriffe mit viel mehr Kennzeichen bilden können, um zumBeispiel die „Kultur auf gaben“ des neueren Staates miteinzubeziehen.
Die zweite Definition lautet: Der Staat ist eine Rechtsinstitution, einer besiegten Gruppe durch eine siegreiche Gruppe einseitig auferlegt mit dem ursprünglich einzigen Zwecke, die Besiegten zugunsten der Sieger so hoch und so dauernd» wie möglich zu besteuern.
Die erste Definition enthält den Inhalt des Staates und gibt den soziologischen Staatsbegriff.
Die zweite Definition enthält die Form des Staates und gibt den juristischen Staatsbegriff [1].
Diesen beiden Definitionen entspricht auch das Wort, der Name. „Die Herrschenden und ihr Anhang heißen lo stato, und dieser Name durfte dann die Bedeutung des gesamten Daseins eines Territoriums usurpieren“, sagt Burckhardt [2].
[1] Wir erheben nicht den Anspruch, eine juristisch strenge Formel zu geben. Die „Ursprungsnorm“ dieser Verfassung lautet: „Ihr sollt uns unentgolten steuern; zu dem Zwecke habt ihr zu gehorchen, wenn wir befehlen, sonst trifft euch die Sanktion, die uns beliebt.“
[2] Kultur der Renaissance I S. 3.
[309]
Jellinek hat Bedenken gegen diese Ableitung; er meint, das Wort „bedeute, dem antiken Sinn von status entsprechend, die Verfassung, die Ordnung. Schon zu Beginn des 15. Jahrhunderts in diesem Sinne nachweisbar, ist stato am Anfang des 16. Jahrhunderts bereits die allgemein anerkannte Bezeichnung für jeden Staat. Vereinzelt kommt status gleich Staat schon in den Act. Arag. I, 395 (Anfang des 14. Jahrhunderts) vor, ferner in England ebenfalls im 14. Jahrhundert“ [1].
Diese Feststellungen scheinen uns keinen Widerspruch zu begründen. Denn erstens waren auch die Staaten Aragonien und England des 14. Jahrhunderts ihrem Ursprung nach charakteristische Eroberungsstaaten, in denen noch der private Haushalt des Fürsten mit dem öffentlichen ebenso zusammenfiel, wie sein und seiner engeren Gruppe Willen mit dem Staatswillen: vor allem aber wird ja nicht behauptet, daß das Wort „stato“ in der Zeit der siegreichen Kondottieri entstanden ist, sondern, daß es in jener Zeit den Charakter annahm, den es dann lange Zeit hatte, und der noch heute in den Ausdrücken: Hofstaat, Staatskleid, Staat machen, erhalten ist [2]. Jedenfalls haben sich weder Carl Schmitt noch Meinecke durch die Bedenken Jellineks abhalten lassen, sich Burckhardt anzuschließen. Jener übersetzt den Ausdruck „lo stato“ bei Machiavelli mit „Herrschaft [3]“, dieser mit „Machtapparat des Herrschers“ [4].
Wir haben also einen zwiefachen Staatsbegriff gewonnen. Das entspricht grundsätzlich, wenn auch nicht der Formel nach, der Stellung, die mit Jellinek die meisten heutigen Staatslehrer dem Problem gegenüber einnehmen; aber es widerspricht der Auffassung einiger anderer, deren geistiger Führer Hans Kelsen ist. Wir sind jetzt weit genug gekommen, um das oben (S. 9) gegebene Versprechen einlösen zu können, uns mit ihm auseinanderzusetzen:
1. Soziologischer und juristischer Staatsbegriff. ↩
Kelsen hat den Gegenstand in einem eigenen Buche behandelt, das das Streitobjekt bereits im Titel enthält: „Der soziologische und der juristische Staatsbegriff, kritische Untersuchung des Verhältnisses von Staat und Recht [5].“ Hier reklamiert er mit aller erdenklichen
[1] Allg. Staatslehre, S. 132 und Anm. daselbst.
[2] Vgl. zu der Streitfrage auch Loening, Art. „Staat“ im Hdwb. d. Stsw. 4. Aufl. VII, S. 692.
[3] Die Diktatur, S. 35.
[4] Die Idee der Staatsräson, S. 150. Vgl. S. 186. An der ersten Stelle zeigt er, wie das Wort allmählich den neuen Inhalt annahm, der für uns heute damit verbunden ist. Ebenso Jellinek, a. a. O. S. 133.
[5] Tübingen, 1922. Schon lange vorher (1911) war ein Aufsatz erschienen, „Grenzen zwischen juristischer und soziologischer Methode“.
[310]
Energie den Begriff des Staates ausschließlich für den Juristen. „Es ist für die moderne Staatslehre, die keine bloße Staatsrechtslehre sein will, bezeichnend, daß sie einen metarechtlichen Staatsbegriff postuliert“ (1). Der Grundgedanke sei, daß der Staat ein ... menschlicher Verband sei, der unter den Begriff der Gesellschaft im weitesten Sinne falle, eine soziale Tatsache und real sei, d. h. von der gleichen Realität wie soziale Tatsachen überhaupt. „Und schon mit dieser Qualifikation tritt der Staat in einen gewissen Gegensatz zum Recht. Dieses fällt unter den Begriff der Norm“ (2). „Diese Grundvorstellung kommt in den verschiedenen Theorien über das Verhältnis von Staat und Recht bald mehr, bald weniger zum Ausdruck.“ Die herrschende Lehre nimmt an, daß der Staat als Verband sich von dem Rechte als Norm unterscheiden müsse (2/3).
Aber: Verband und Norm „sind nur verschiedene Namen für einen und denselben Begriff“ (3). An anderer Stelle wird die Annahme der „realen sozialen Einheit des Staates, die sich als eine irgendwie organismusartige Verbindung der als real fingierten Staatsglieder darstellt“, als eine „Fiktion“ bezeichnet (73). Weiter unten wird die Identität von Staat und Recht nicht nur behauptet, sondern als erwiesen betrachtet (86/7). „Der Staat ist nichts anderes als ein Gedanke, ein Ordnungsgedanke“ (91). Zuletzt wird der „metarechtliche Staatsbegriff“ als eine verdoppelnde Fiktion im Sinne Vaihingers bezeichnet (205). Die Zitate lassen sich beliebig vermehren.
Um diese These, deren Kühnheit Kelsen wohl bewußt ist, zu widerlegen, gehen wir auf unsere Begriffsbestimmung im ersten Abschnitt zurück. Dort haben wir nach Vornahme der zeitlichen und sachlichen Ausscheidungen (des vor- und nachhistorischen Staates und der historischen und praktischen Aussagen über den historischen Staat) geschrieben: „Was jetzt von dem gewaltigen Stoff, der „gesellschaftlichgeschichtlichen Wirklichkeit“ der Staaten, noch übrig bleibt, ist das gemeinsame Erfahrungsobjekt zweier theoretischer Wissenschaften, aus denen sie sich, durch Auswahl der sie je interessierenden Kennzeichen, je ihr besonderes Erkenntnisobjekt bilden. Die erste ist die der Jurisprudenz angehörige Staatsrechtslehre, insofern sie nicht Normwissenschaft, sondern eben theoretische Wissenschaft ist . . . die zweite ist die soziologische Staatslehre.“ Wir haben dann gezeigt, daß diese Auffassung, eben mit fast der einzigen Ausnahme Kelsens, die der herrschenden Theorie ist, und konnten uns hier namentlich auf Jellinek und den Simmelschüler Kistiakowski berufen.
Gerade gegen diese beiden Denker, Kistiakowski als den Vertreter der „soziologischen“ und Jellinek als den der „juristischen Zweiseitentheorie“ richtet nun Kelsen seine uns interessierenden Angriffe (106 ff. und 114 ff.):
[311 ]
„Die Zweiseitentheorie hält es für möglich, eben denselben Gegenstand, den sie juristisch, d. h. auf juristische Methode, bestimmt hat, nun auch einer Betrachtung zu unterziehen, die zugestandenermaßen in ihrer Richtung von der juristischen Methode wesensverschieden ist. Die kausalwissenschaftliche Erkenntnis, der die andere, die nicht juristische Seite des Staates zugewendet ist, soll nämlich auf das Sein, die Naturwirklichkeit, gerichtet sein, während die juristische Betrachtung auf das Sollen, auf Normen zielt. Wenn zwischen Gegenstand und Methode der Erkenntnis — wie nicht anders möglich — Korrelation besteht, die spezifische Methode den spezifischen Gegenstand bestimmt und umgekehrt, dann kann unmöglich auf zwei nach verschiedenen Richtungen gehenden Erkenntniswegen derselbe Erkenntnisgegenstand erreicht, dann kann es nicht derselbe identische Staat, — der Staat als Ding an sich — sein, der zugleich durch kausale und normative Betrachtung erfaßt wird“ (106).
Die hier zugrundeliegende Idee ist die, daß die Rechtswissenschaft nicht, wie wir mit Jellinek und Kistiakowski annehmen, eine theoretische Wissenschaft ist.
Kelsen geht in seiner Schrift: „Grenzen zwischen juristischer und soziologischer Methode“ [1] aus von dem formal-logischen Gegensatz von Sein und Sollen, der auch der methodologische Gegensatz zwischen Soziologie und Jurisprudenz sei (5). „Die prinzipielle Verschiedenheit beider Denkformen läßt Sein und Sollen als zwei getrennte Welten erscheinen“ (6).
Auf diesen Gegensatz gründet sich nun die prinzipielle Unterscheidung der Wissenschaften in explikative und normative Disziplinen“ (10). „Zu den explikativen oder Kausalwissenschaften gehören vor allem die Naturwissenschaften, die Historik und die Soziologie: aber die Jurisprudenz gehört wie die Ethik, die Logik, die Grammatik zu den Normwissenschaften. Nicht in dem Sinne, daß ihr „eine normierende, normsetzende Funktion zugeschrieben würde, die unabhängig von jener des positiven Gesetzes ist“ (12), wohl aber in einem anderen Sinne:
„Zwar hat als 'normativ' im ursprünglichen Sinne des Wortes die Tätigkeit zu gelten, welche autoritär Normen für ein Verhalten von Subjekten setzt... In diesem Sinne kann eine Wissenschaft niemals als normativ bezeichnet werden. Nicht die ,Ethik' benannte theoretische Disziplin ist der sittliche Gesetzgeber, sondern das menschliche Gewissen. . . . Nicht die Wissenschaft der Grammatik ist die Sprachbefehle erteilende Macht, sondern die . . . soziale Gemeinschaft. Und so
[1] Tübingen 1911. Wir folgen dieser kleinen Schrift, weil sie in kurzer Darstellung die einschlägigen Darlegungen der „Hauptprobleme der Staatsrechtslehre“ (ebenfalls Tübingen 1911) wiedergibt.
[312]
ist auch die Jurisprudenz nicht normativ im Sinne einer rechtsetzenden Gewalt. Vielmehr muß hier, wie in allen Fällen, in denen von normativen Disziplinen gesprochen wird, der fragliche Terminus in abgeleiteter Bedeutung gebraucht sein. Er kann nicht eine besondere Art des Wollens, er muß eine bestimmte Form des Denkens, eine eigenartige Betrachtungsweise kennzeichnen, die sich von der anderer Wissenschaften durch ihre spezifische Richtung unterscheidet und die darum eine normative genannt werden darf, weil sie der Welt des Sollens zugewendet, und ihr Ziel die Erfassung von Normen ist.“
Der Fehler, der hier begangen wird, liegt klar auf der Hand. Kelsen hätte sich fragen müssen, ob denn der unversöhnliche Gegensatz zwischen Sollen und Sein, den er feststellen zu können glaubt, (davon später) auch noch für die „normativen Disziplinen in dieser abgeleiteten Bedeutung“ gilt.
Orientieren wir uns an den von Kelsen selbst angezogenen übrigen Normwissenschaften.
Logik, Ethik und Grammatik: die Begriffe werden in zwei wohl zu unterscheidenden Bedeutungen gebraucht. Das eine Mal bedeuten sie einen Inbegriff von Normen des Denkens, des Handelns, des Sprechens. In dieser Bedeutung sind sie, wie Kelsen mit Recht feststellt, nicht Wissenschaften. — Das andere Mal bedeuten sie die Wissenschaften, die sich mit der Auffindung, Formulierung, Ordnung und Erläuterung dieser Normen befassen, unter Umständen, bei der Sprache, einem historischen Objekt, den Wandel der Normen untersuchen. Diese Disziplinen sind, wie Kelsen selbst unvorsichtig für die „Ethik benannte Disziplin“ zugibt, theoretische Wissenschaften.
Wenden wir diese Ergebnisse auf die Jurisprudenz im Sinne Kelsens als die Lehre vom positiven Rechte an:
Der „Inbegriff von Normen“ ist das Recht. Als solches ist es keine Wissenschaft, weder eine explikative noch eine normative, wie auch Kelsen feststellt. Von diesem Inbegriff handelt auch in diesem Gebiet eine Wissenschaft, die sich gleichfalls mit der Auffindung, Formulierung, Ordnung und Erläuterung dieser Normen befaßt: die „Jurisprudenz im eigentlichen und engeren Sinne, die dogmatische Jurisprudenz“ (14) : warum soll sie nicht ebenso wie die Parallelerscheinungen im Gebiete der übrigen Normen eine theoretische Wissenschaft sein? Wie das die Rechtsgeschichte zugestandenermaßen in Wirklichkeit ist ? (14). Damit wird offenbar das Recht der Rechtswissenschaft gleichgesetzt: ein Fehler, der dem Neukantianismus bekanntlich sehr nahe liegt.
Hier scheint uns ein zweiter Irrtum einzugreifen. Kelsen betont mit äußerster Schärfe den unversöhnlichen Gegensatz zwischen Sollen und Sein. Ein Sollsatz soll niemals aus einem Seinssatz ableitbar sein.
[313 ]
Er verlangt mit dieser Begründung eine Reinigung der dogmatischen Jurisprudenz von fremden Bestandteilen, die ihr nach seiner Meinung anhaften: jede Norm soll auf eine andere Norm zurückgeführt werden. Das ist eine innere Angelegenheit der Juristen untereinander, in die wir uns nicht zu mischen haben. Es mag in der Tat richtig sein, daß die Grundbegriffe der dogmatischen Jurisprudenz nur auf diese Weise rein gewonnen werden können, wenn sie sich ausschließlich auf die rechtliche Form beschränkt, in rein „normlogischer Konstruktion“.
Wir aber haben das Recht und die Pflicht, uns daran zu erinnern, daß jener unversöhnliche Gegensatz zwischen Sein und Sollen nur für ein Sollen besonderer Art gilt : für das in den kategorischen Imperativen vorgeschriebene unbedingte Sollen. Aber er gilt nicht für das „Sollen“ des positiven Rechts [1]. Das ist, philosophisch gesehen, nämlich ein Müssen, „äußerlich genötigt“, wie Kant sagt; diese Normen sind nicht kategorische, sondern hypothetische Imperative : und diese stehen unbestritten unter dem Kausalgesetz und unterliegen kausalgesetzlicher Betrachtung.
Wenn das aber der Fall ist, so gibt es von dem Normeninbegriff des positiven Rechtes außer jener normlogischen noch eine andere Wissenschaft.
Die normlogische Konstruktion kann und will nicht weiter kommen als bis zu der oder den Ur- und Grundnormen, auf die jeder einzelne Rechtssatz zurückgeführt werden kann. Sie will und kann nichts anderes als von der Form des Rechtes sprechen [2]. Aber nichts kann verbieten, daß andere Wissenschaften nach dem Grunde der Grundnorm fragen und sich für den Inhalt des Rechtes interessieren.
Auf Grund dieser Erwägungen sind wir berechtigt, mit Kelsens methodologischer Grundauffassung auch die daraus gezogenen Schlüsse abzulehnen. Es gibt in der Tat ein „Erfahrungsobjekt“, den historischen Staat, und es gibt in der Tat von ihm zwei theoretische Wissenschaften, von denen die eine, die Staatsrechtslehre, sich mit der zeitlosen Form, die andere, die soziologische Staatslehre, mit dem geschichtlichen Inhalt des Staates beschäftigt [3].
Nach dieser grundsätzlichen die besondere Erörterung. Kelsen unternimmt in seinem „Staatsbegriff“ den Nachweis, daß die bisherige Soziologie es nicht zustande gebracht habe, einen eigenen, haltbaren, nicht-juristischen Staatsbegriff zu schaffen. Leider beschäftigt sich diese Kritik fast nur mit der zuerst von Simmel eingeführten, dann von
[1] „Wodurch sich das rechtliche von dem sittlichen Wollen unterscheidet, steht hier nicht in Frage“, sagt Kelsen (Staatsbegriff, S. 78).
[2] Vgl. Kelsen, Grundprobleme, 1. Aufl., S. VIII. „Es ist eine Binsenwahrheit, daß die Jurisprudenz eine formale Disziplin ist“.
[3] Vgl. Erich Kaufmann, Kritik der neukantischen Rechtsphilosophie. S. 14/5.
[314]
ihm aufgegebenen, von Vierkandt und v. Wiese wieder aufgenommenen, und von diesem allerneuestens (unserer Meinung nach außerordentlich unglücklich) vertretenen Auffassung [1], daß alle Soziologie mit nichts als den psychischen „Wechselbeziehungen“ der zur Gesellschaft vereinigten Individuen zu tun habe. Wenn Kelsen bei Abfassung seines Buches unsere zu gleicher Zeit erschienene „Allgemeine Soziologie“ schon hätte kennen können, so hätte er gesehen, daß diese Richtung, weit entfernt davon, die einzige oder auch nur herrschende der Soziologie zu sein, im Gegenteil sogar von ihren eigenen Vertretern, Vierkandt und v. Wiese, im Grunde schon aufgegeben ist [2]. Wir haben die gesamte „Soziopsychologie“ und sogar auch die „Psycho- soziologie“ in die Grundlegung verwiesen und haben dann ausdrücklich gesagt, daß wir „den Schritt von der Sozialpsychologie zur Soziologie im eigentlichen Sinne erst machen, wenn wir die Dinge, mit denen wir uns dort beschäftigten: Normen und Imperative, Werte und Unwerte, Staat und Gesellschaft, Recht und Sitte usw. nicht mehr betrachten in bezug auf ihre seelischen Wurzeln im Individuum, nicht mehr als „subjektive“ Bewußtseinsinhalte, die auf Verwirklichung in Betätigung drängen, sondern als objektive Strukturen und Funktionen der lebendigen Einheit Gesellschaft“ [3].
Die überaus tiefen, feinen und schlagenden Bemerkungen, die Kelsen gegen jene Auffassung macht, in der Tat wohl das beste, was wir über den Gegenstand bisher gelesen haben, die Einwände eines ausgezeichneten Fachmannes, der klar erkennt, daß diese Lehre auf seinem Gebiete vollkommen versagt, treffen also nur eine Schule der Soziologie, aber nicht sie selbst. Die „Beziehungslehre“, wie v. Wiese sein u. E. lebensunfähiges Geisteskind getauft hat, bleibt nicht nur hoffnungslos im Psychologischen stecken, sondern leidet auch an dem alten, unheilbaren Individualismus: jener verhängnisvollen Erbschaft aus dem Naturrecht und der Aufklärung, die ausgerottet werden muß, wenn Soziologie möglich sein soll, so leidenschaftlich Wieses Gefühlsliberalismus auch daran festhält. Unser Ausgangspunkt muß die unbestreitbare universalistische Erkenntnis sein, daß es, um es mit absichtlich paradoxaler Schärfe auszudrücken, ein „Individuum“ im strengen Sinne als physisches und vor allem als psychisches Wesen gar nicht gibt [4].
Auch die Einwände, die Kelsen gegen den konsequentesten bisherigen Vertreter der Soziologie als der Wissenschaft von den gesellschaftlichen Objektivitäten, Durkheim, erhebt, sind treffsicher und
[1] „Allgemeine Soziologie.“
[2] S. S. I. S. in—123, S. 446/7ff.
[3] S. S. I. S. 445.
[4] S. S. I. S. 83ff., namentlich 89ff.
[315]
schlagend; indes glauben wir, hier doch noch tiefer an die Wurzel der Irrtümer des bedeutenden französischen Denkers hinabgegraben zu haben, indem wir ihm nachwiesen, daß er eine schwere methodologische Grenzverletzung begeht; er will die „sozialen Tatsachen“ nur von außen, rein als den Sinnen gegebene äußere Phänomene, betrachten: und spricht doch von „Zwang“ und sogar von „willkommenem Zwang“, während er in dieser Art von Betrachtung, die, es ist die „mechanische“, an sich erlaubt ist, von nichts anderem sprechen dürfte als von ... Bewegung, allenfalls von äußerem Druck: und gerade den lehnt er ab [1]!
Während sich Kelsen mit diesen Vertretern der Soziologie, die nur gelegentlich einmal vom Staat gesprochen haben, ausführlich auseinandersetzt, tut er die eigentliche „soziologische Staatsidee“, wie Gumplowicz und nach ihm wir selbst sie verfechten, in einer Anmerkung (S. 40) mit den kurzen Worten ab: „Ein näheres Eingehen auf diese beiden Schriften ist darum nicht nötig, weil sie sich im wesentlichen darauf beschränken, eine Hypothese der Entstehung des Staates . . . zu geben.“ Ich sehe mich wieder gezwungen, mit aller Tatkraft zu protestieren: mein kleines Buch „Der Staat“, auf das hier verwiesen wird, enthält über diese „Hypothese“ hinaus die Entwicklung der Hauptformen des Staates, des See- wie des Landstaates, von der Urform des primitiven Eroberungsstaates an bis zu ihren Ausgängen bzw. bis auf den gegenwärtigen Staat. Und weiter: das kleine Buch gibt jene den juristischen Staatsbegriff enthaltende Definition des Staates: „Der Staat ist eine Rechtsinstitution usw.“. Da diese Auffassung grundsätzlich mit der Kelsenschen durchaus übereinstimmt, hätte man doch erwarten sollen, daß er sich das Buch ein wenig genauer anschaut, als er es offenbar getan hat; denn das seine läßt „meines Geistes keinen Hauch verspüren“.
Worin wir uns unterscheiden, ist nicht der Satz, daß das positive Recht als „ordnende Ordnung“ und der Staat als „geordnete Ordnung“ im Grunde eines und dasselbe sind — wir haben diesen treffenden Satz Radbruchs angenommen [2] wie auch Kelsen ihn annimmt (204). Wir unterscheiden uns in etwas anderem, nämlich darin, daß Kelsen (wenigstens ex professo) behauptet, der Staat sei nur und ausschließlich Recht, während wir behaupten, er sei außerdem noch etwas anderes. Er fragt nur nach der Form des Staates, wir außerdem nach seinem Inhalt. Freilich versucht auch Kelsen, diesem Gegensatz gerecht zu werden, aber bleibt doch immer im Formalen stecken. Es entsteht irgendwie und irgendwo — wie und wo, das kann der Jurist natürlich nicht angeben (101) — eine „Ursprungsnorm“, z. B., bei der Entstehung einer absoluten Monarchie: „Es soll Zwang unter den
[1] S. S. 1. S. 482ff.
[2] S. S. I. 399.
[31б]
Bedingungen und auf die Weise geübt werden, wie es der Monarch bestimmt“. Diese Ursprungsnorm „ist die Verfassung im rechtslogischen Sinne ; sie ist eine oberste Regel für die Erzeugung von Normen, für die inhaltliche Gestaltung, die Bildung und Fortbildung der in ihrer Gesamtheit das Normsystem darstellenden Rechtssätze“. Diese abgeleiteten Normen gebären wieder neue, noch mehr abgeleitete Normen, und „in dieser stufenweisen Abfolge . . . erfüllt sich die Staats- oder Rechtsordnung mit immer konkreterem Inhalt“ (94).
Wir haben uns an anderer Stelle ausführlich über das Gegensatzpaar „Form-Inhalt“ geäußert [1]. In der Regel läßt sich nichts klares dabei denken [2], und sein Gebrauch dient denn auch in der Regel dazu, tiefes Wasser und Schwimmen in tiefem Wasser vorzutäuschen, wo der Verfasser auf eine Sandbank geraten ist. Wenn es aber irgendwo mit Fug angewendet werden darf, dann dort, wo es gilt, die Norm der durch sie geregelten gesellschaftlichen Beziehung, als die Form dem Inhalt entgegenzustellen (vgl. oben S. 5). Denn unzählige Handlungen der Gesellschaftsglieder nehmen immer wieder die gleiche Form der gesetzlich vorgeschriebenen oder sittlich geltenden Norm an, gerade wie jede verkaufte Flüssigkeit die Form des staatlich vorgeschriebenen Hohlmaßes annehmen muß.
Kelsen aber setzt hier eine Norm als Form anderen Normen als Inhalt gegenüber. Das kann er schließlich tun, denn es besteht hier ein ähnliches Verhältnis, wie bei der analytischen „Explikation“, wo man aus einem Satze den in ihm verborgenen Inhalt anderer Sätze ausfaltet.
Aber er hat mit solcher rein terminologischen Entscheidung niemandem den Weg versperrt, der sich erstens dafür interessiert, wo und wie, unter welchen Umständen denn diese oder jene „Ursprungsnorm“ entsteht, und vor allem: welchen Inhalt in jenem ganz anderen Sinne denn jene Normen insgesamt haben. Kelsen sagt selbst (85) : „Es sind nicht die Menschen als biologisch psychologische Einheiten, sondern es sind menschliche Handlungen, die den Inhalt der staatlichen Ordnung bilden und so zu einer — von der für die Biologie oder Psychologie relevanten gänzlich verschiedenen — juristischen Einheit verbunden werden. Daß eine menschliche Handlung als Inhalt einer Norm, eines Sollens, d. h. daß sie als gesollt erscheint ...“
Für diese juristisch irrelevante Einheit interessieren sich andere Wissenschaften; vielleicht Biologie und Psychologie, jedenfalls aber, was uns hier allein angeht, die Soziologie in ihrer echten Bedeutung als die Lehre von den sozialen Objektivitäten.
[1] S. S. 1. S. 114ff.
[2] Vgl. Kelsen selbst ähnlich, Hauptprobleme S. VIII.
[317]
Daß es etwas derartiges gibt, das zu bestreiten, fällt selbstverständlich Kelsen nicht ein: „Für die Wahl des Ausgangspunktes Staats- oder rechtswissenschaftlicher Betrachtung, für die Gestaltung der entscheidenden Ursprungsnorm ist ein Postulat maßgebend, das eine bestimmte Relation zwischen dem Inhalt des durch die Ursprungsnorm zu begründenden Sollens und dem Inhalt des korrespondierenden Seins garantieren will: die Spannung zwischen dem Sollen und dem Sein, die als Möglichkeit einer inhaltlichen Differenz — dem Wesen jeder normativen Ordnung entsprechend — grundsätzlich bestehen bleiben muß, darf andererseits wieder nicht über ein bestimmtes Höchstmaß hinausgehen.“
Wir machen, bevor wir das Zitat zu Ende führen, darauf aufmerksam, daß hier die Verdoppelung des Begriffs „Inhalt“ ganz klar heraustritt, und zweitens, daß hier der Jurist „den Ausgangspunkt der rechts- oder staatswissenschaftlichen Betrachtung wählt“, und das heißt, „die Ursprungsnorm gestaltet“: zwei schielende Ausdrücke, gutgläubig gewählt, um einer argen Verlegenheit zu entrinnen. Der Jurist „wählt“ den Ausgangspunkt eines Rechtssystems nicht: der ist ihm gegeben; und zwar nicht als Tatsache des Rechts, sondern als außerrechtliche Ursache des Rechts gegeben. Und er „gestaltet“ die Ursprungsnorm nur allenfalls in dem Sinne, daß er sie formuliert, ihr eine juristisch brauchbare Form gibt, aber nicht so, daß er sie „gestaltet“ im Sinne des Erschaffens [1]. Was hier durch die Wahl der Worte verschleiert werden soll (wir wiederholen, daß wir, wie überall, so ganz besonders Kelsen gegenüber nicht im mindesten an eine mala fides glauben), ist die Tatsache, daß der Jurist als solcher weder von dem „Ursprung“ der „Ursprungsnorm“, noch von dem „Inhalt“ der Rechtsnormen irgendetwas wissen kann. Wenn der Staat gleich dem Recht, und das Recht „ordnende Ordnung“ ist, so muß doch wahrlich irgendetwas da sein, das geordnet wird. Die Ordnung kann sich doch nicht in alle Ewigkeit selbst ordnen. Um ein Beispiel zu geben: jemand
[1] Hier soll doch nicht der alte und wie wir glaubten erledigte Streit neu aufgenommen werden, wer das Recht schafft, das Volk durch seinen „Verkehr“ oder die Juristen ? Die Romantiker nahmen grundsätzlich das erste an, aber Savigny ließ von einem gewissen Zeitpunkte an die Juristen als die Vertreter des Volkes erscheinen. Dagegen wandten sich die Germanisten, die in dem von der historischen Schule mit Vorliebe betriebenen und als ewiges Muster angebeteten Römischen Recht eine Hauptursache des Verfalls des mittelalterlichen Consensus anklagten: Beseler schrieb sein berühmtes „Volksrecht und Juristenrecht“ (Landsberg, a. a.O. S. 513). Selbst Ihering sagt von der höheren Jurisprudenz, sie sei „nicht bloß Finderin, sondern auch Schöpferin des Stoffes“: also jedenfalls auch Finderini (801). Ähnlich Gerber (829). — Was aber die „Ursprungsnorm“ anlangt, so ist sie immer vorrechtlich, außerrechtlich: welche Revolution bedeutete es, als Carpzov feststellte, daß das römische Recht seine Gültigkeit in Deutschland nicht einem kaiserlichen Befehl verdankte! (Stintzing, a. a. O. II, S. 5.)
[318]
beschließe, eine Bibliothek zu gründen: der Beschluß ist die „Ursprungsnorm“. Dann legt er das Schema eines mit höchster Kunst gegliederten Katalogs an, „geordnet“ nach Wissenschaften und in jeder einzelnen nach dem raffiniertesten System, das je ersonnen wurde. Da ist der analytisch auseinandergelegte „Inhalt“ der Ursprungsnorm. Damit ist die bibliothekgerechte, im Bilde: die juristische Form vollkommen vorhanden, aber noch immer keine Bibliothek. Um sie wirklich zu schaffen, braucht es noch einer großen Zahl menschlicher Entschlüsse und Handlungen, der Hergabe von Geld, des Ankaufs von Büchern, der Aufstellung nach dem Plane usw., und das ist der „Inhalt“ im anderen Sinne.
Kelsen fährt fort: „In dieser Determination verknüpft sich Normativität und Faktizität in eigenartigster Weise zu einer charakteristischen Parallelität von Geltung und Wirkung. Was damit zum Ausdruck gebracht werden soll, ist die Tatsache, daß dem ideellen System der Staats- oder Rechtsordnung in seiner spezifisch normativen Gesetzlichkeit ein Stück des realen Lebens, des tatsächlichen, nach kausaler Gesetzlichkeit ablaufenden Verhaltens der Menschen irgendwie zugeordnet ist, und daß zwischen dem Inhalt des Systems: „Recht“ (oder „Staat“) und jenem des zugeordneten Stücks des Systems „Natur“ eine gewisse Übereinstimmung bestehen muß“ (96).
Man weiß nicht recht, ob dieser Zusammenhang mehr als psycho-physische Parallelität oder „okkasionalistisch“ aufgefaßt wird; wohl das zweite, da ja sonst doch eine irgendwie vorhandene Einheit, und nicht bloß eine „irgendwie geschehene Zuordnung“ zugegeben werden müßte.
Uns interessiert nun zunächst, wie man denn jenes dem Rechtssystem Staat zugeordnete „Stück Natur“ nennen soll: es muß doch irgendeinen Namen haben, wenn man es wissenschaftlich soll behandeln können.
Was Kelsen mit ungeheurer Energie in immer wiederholten leidenschaftlichen Worten streng verbietet, ist, daß wir dieses Stück Natur als „Staat“ bezeichnen. Und das führt zu den wunderlichsten Konsequenzen. Da der Staat ja durchaus nichts anderes sein soll als Recht, „so ist der Staat als ein bloßes Gedankending erkannt, das man — wenn es mehr als ein Ausdruck für die Einheit der Rechtswirklichkeit, das heißt: des positiven Rechtes, sein soll — als eine „unberechtigte Hinzufügung“ ablehnen muß“ (209). „Der Staat ist als das die Einheit des Rechts verbürgende Prinzip — im Verhältnis zu diesem nichts Reales, das heißt nicht von der spezifischen (von der Realität der Natur verschiedenen!) Realität des Rechtes als eines geordneten Ganzen ; er ist eine bloße — die Einheit und sohin Realität des Rechts — ermöglichende Kategorie, eine gedankliche Schöpfung“ (214).
[319]
So weit das als innere Auseinandersetzung zwischen Juristen gedacht ist, von denen die Einen Recht und Juristenstaat identifizieren, während die anderen sie zu trennen versuchen, hat sich der Soziologe nicht einzumischen. Da aber auch ihm verboten wird, das „Stück Natur“, das dem Rechtssystem „irgendwie zugeordnet“ ist, Staat zu nennen, da „Staat“ durchaus nichts anderes sein soll als ein Rechtssystem, so muß er zu dem Ergebnis gelangen, daß ein „Gedankending“ das Völkerrecht verletzen, sich verschulden, sich in sozialen Krämpfen winden, von auswärtiger Gewalt besetzt, aufgelöst, geteilt, mit Kriegsentschädigungen überlastet werden kann; daß eine „Kategorie“ in Revolutionen ihre „Ursprungsnorm“ und deren „Inhalt“ vollkommen erneuern kann (96) ; — oder daß Kelsens Verbot, das den sprachüblichen geschichtlichen Begriff des Staates ausschalten will, irgendwie auf einem Denkfehler beruhen muß. Es ist der Fehler der grundlegenden methodologischen Einstellung, den wir dargelegt haben.
Der gleiche Fehler läßt sich auch in der Anwendung des Prinzips auf den besonderen Fall des Staatsbegriffs nachweisen. Es läßt sich nämlich zeigen, daß die formale „Ursprungsnorm“, aus der angeblich der ganze „Inhalt“ des Staatswesens abgeleitet werden kann, durchaus nicht dazu hinreicht. Um das von Kelsen selbst gewählte Beispiel anzuziehen, so reicht die Grundnorm, die für den Staat der absoluten Monarchie gelten soll, durchaus nicht hin, um uns dessen Wesen verständlich zu machen: „Es soll Zwang unter den Bedingungen und auf die Weise geübt werden, wie es der Monarch bestimmt“. Sondern hier muß ein „Inhalt“ mitgedacht werden, der sich durchaus nicht „normlogisch“ aus der Urnorm ableiten läßt. Das hat Kelsen ja selbst in gewisser Weise anerkannt: „Für die Gestaltung der Ursprungsnorm ist das Postulat maßgebend, das eine bestimmte Relation zwischen dem Inhalt des begründenden Sollens und dem Inhalt des korrespondierenden Seins garantieren will“ : der Monarch darf also z. B. nicht Zwang dahin ausüben, daß sämtliche Männer sich zu verschneiden oder daß sämtliche Mütter ihre Kinder zu töten haben. Die von Kelsen gewählte Formel schließt solchen Inhalt nicht aus; logisch wäre er möglich, und das ist ja angeblich das Einzige, was hier in Betracht kommen soll [1]. Aber, um selbst von solchen krassen Extremen abzusehen, so enthält jeder Absolutismus faktisch und notwendig den weiteren „Inhalt“, daß das Interesse des Monarchen, und zwar sowohl sein persönliches Interesse an sehr gehobener Lebenshaltung in Speise und Trank, Wohnung und Kleidung usw. wie auch sein dynastisches Familieninteresse weithin
[1] „Nach derselben Konsequenz hätte ich aber auch zu entscheiden: eine Verfassung, in der Einer nach Lust und Belieben Köpfe abschlagen darf, Viele aber nach Belieben andere zu plündern befugt sind, sei mögliches Recht, denn sie ist ja marokkanisches Recht“ (Fries, Politik, S. 216).
[320]
den Interessen der Untertanen vorangehen soll. Normlogisch ließe sich auch das Gegenteil ableiten. Und gerade für diesen Inhalt interessiert sich die soziologische Staatslehre.
Denn das ist grundsätzlich der Inhalt aller historischen Staaten, daß immer eine Klasse (im weiteren Sinne) die Ursprungsnorm derart gestaltet hat, daß ihre Interessen denen der anderen Klasse vorangehen sollen. Und so zeigt sich, daß auch hier, wie immer, das Recht nicht verstanden werden kann, ohne sein Korrelat, das Interesse, mit einzubeziehen. Jede Herrenklasse verwehrt den Untertanen den Zutritt zu den „monopolisierten Chancen“, die ihr das positive Recht zugesteht, Chancen der Befriedigung innerer oder äußerer Interessen, so definierten wir oben nach Max Weber die Herrschaft.
Wir wollen hier die Kritik abbrechen. Sie wird vollendet werden, wenn wir unseren eigenen Standpunkt noch einmal hier zusammenfassen, um vor allem zu zeigen, daß „der Staat“ nicht nur eine Ordnung, sondern auch, von der anderen Seite her gesehen, ein 'Verband' ist.
Ein Staat ist, wie wir sagten, eine Rahmengruppe. Die gemeine Erfahrung gibt uns eine „Rahmengruppe“ als eine Vielheit von Menschen, die miteinander in Wechselbeziehungen aller Art stehen: in geselligen, wirtschaftlichen, rechtlichen, politisch-staatlichen; eine Vielheit, die sich im Wechsel der Geschlechter erhält, nach außen hin abgegrenzt ist, usw. Dieser Gegenstand ist einer dreifachen Betrachtungsweise zugänglich. Die „mechanische“, die hier kaum je in klarem Bewußtsein angewendet wird (es handelt sich regelmäßig, wie bei Durkheim, um Grenzüberschreitungen) würde ihren Gegenstand bestimmen als ein sich bewegendes Ausgedehntes und vielleicht gewisse Regelmäßigkeiten der Bewegung gewissen Änderungen des äußeren Sinnenscheines zuordnen können. Die biologisch-organische Betrachtungsweise bestimmt ihren Gegenstand als ein Lebendes mit Consensus und Stoffwechsel, die psychologische als einen Inbegriff von psychisch vermittelten Beziehungen, dessen Änderungen irgendwie denen der sinnlichen Erscheinung und der Lebensäußerungen zugeordnet sind. Die soziologische Betrachtung, die sich als eine — denknotwendige — Kombination der biologischen und psychologischen darstellt, faßt die Rahmengruppe auf als eine Lebendiges, und zwar als einen Kollektivorganismus, dessen Consensus nicht mehr, wie in einem Einzelorganismus, durch entelechiale feste Bindungen der einzelnen Funktionen aneinander bewirkt wird, auch nicht, wie etwa in einem Walde, durch mechanisches Ausbalancieren der verschiedenen Teile des Ganzen zustande kommt: sondern durch einen Apparat vonNormenund Imperativen, die in den einzelnen erwachsenen Mitgliedern als Motive wirken, sei es durch das dunkle Gefühl oder klare Bewußtsein eines „reinen Interesses“, sei es durch „Domestikation“: Erziehung, Tradition usw., hinter denen verstärkend
[321]
Gewalten mit Sanktionen stehen. Ein derart bewirkter Consensus heißt „Kooperation“ im weitesten Sinne des Wortes, wo es nicht nur die technisch-gesellschaftswirtschaftliche Gütererzeugung und -Verteilung, sondern auch den Austausch aller „Dienste“: der entgoltenen von Arbeitern, Beamten, Angehörigen freier Berufe usw. und der „freien Dienste“ umfaßt, die man sich in den Beziehungen der Liebe, Ehe, Freundschaft, Nachbarschaft, Landsmannschaft und Genossenschaft gegenseitig erweist.
Wir würden also definieren: „Eine Rahmengruppe ist die durch einen Apparat von Normen geregelte Kooperation innerhalb eines, durch das Gefühl oder das Bewußtsein der Zusammengehörigkeit verbundenen und durch das Gefühl oder Bewußtsein der Fremdheit gegenüber Außenstehenden nach außen abgegrenzten Personenkreises.“
Und wir würden den Staat definieren als „eine Rahmengruppe, deren Kooperation unter den Bedingungen des durch äußere Gewalt gesetzten Klassenverhältnisses und nach einem Normenapparat sich vollzieht, der dieses Klassenverhältnis sanktioniert“.
Also ist Kooperation der Inhalt, und der Normenapparat die Form des Lebens dieses Kollektivorganismus. Jener wie diese können der „Gegenstand“ einer eigenen Wissenschaft werden, jener der Soziologie, dieser der Jurisprudenz mit der Beschränkung auf den durch bestimmte, zwangsmäßige Sanktionen garantierten Teil des Normenapparats.
Wenn Kelsen die Kooperation und daher den Verband nicht sieht, so macht er, und das ist nicht ohne Interesse, genau den umgekehrten Fehler wie Marx in seiner Lehre vom Wert ; dieser sah nur die Kooperation, aber nicht, daß der durch sie verbundene Personenkreis außerdem durch Rechtsverhältnisse miteinander verknüpft ist. So kam er zu der irrigen Annahme, daß aller Wert nur durch das Verhältnis der in den ausgetauschten Waren inkorporierten Arbeit bestimmt wird, während auch durch Rechtsverhältnisse Wert entstehen kann: bei den Monopolgütern [1].
Damit dürfen wir diesen Gegenstand verlassen. Wir tun alles, was von uns verlangt werden kann, wenn wir unser Teilobjekt, den soziologischen Staatsbegriff, als den historischen Staat, klar und säuberlich von dem nicht-historischen Juristenstaat trennen.
2. Herrschaft und Ausbeutung. ↩
Von der Rechtsform des Staates hat der Soziologe nur insofern zu handeln, wie er die Entstehung der „Ursprungsnorm“ aufzeigt: ein Problem, das der Jurist anerkanntermaßen nicht einmal angreifen,
[1] S. S. III. S. 714.
[322]
geschweige denn lösen kann ; und daß er diese Ursprungsnorm auf das- jenige hin untersucht, was sie mit dem Inhalt des Staatslebens, der Kooperation, zu tun hat; wie sie namentlich die Verteilung in ihrer dreifachen Bedeutung beeinflußt : Verteilung des Eigentums, Verteilung der Arbeit, Verteilung der durch die Kooperation geschaffenen Wertdinge.
Die Ursprungsnorm des Staates ist Herrschaft. Das heißt, von der Seite der Entstehung angesehen: Macht gewordene Gewalt.
Die Gewalt ist wohl eine der mächtigsten, Gesellschaft bildenden, aber noch keine gesellschaftliche Beziehung [1]. Sie muß Recht im positiven Sinne werden, das heißt, soziologisch gesehen, muß es dahin bringen, daß die „subjektive Reziprozität“ zustande kommt: und das ist nur möglich durch gesetzliche Beschränkung der Gewalt und Übernahme gewisser Pflichten als Gegenleistung für die beanspruchten Rechte. So wird Gewalt zur Macht, und es entsteht ein „Übermachtverhältnis“, das nicht nur von den Oberen, sondern unter nicht allzu argen Umständen auch von den Unteren für den Ausdruck gerechter Reziprozität gehalten wird.
Aus dieser Ursprungsnorm entwickeln sich nun, wie Kelsen uns lehrte, sekundäre und aus diesen wieder tertiäre usw. andere Normen als ihr verborgener Inhalt: Normen des Privat-, des Erb-, des Straf-, des Obligationen-, des Verfassungsrechtes, die uns im einzelnen und als systematische Gesamtheit nur insofern interessieren, wie sie sämtlich den Stempel der Ursprungsnorm, der Herrschaft, tragen und sämtlich ihre Absicht oder ihren Zweck verwirklichen wollen, auf den Inhalt des Staatslebens mit dem Erfolge einzuwirken, daß die wirtschaftliche Ausbeutung der Unterklasse zugunsten der Oberklasse jeder Zeit das Maximum erreiche, das mit der Dauer dieses Verhältnisses der rechtlich geregelten Übermacht vereinbar ist. Sobald die Kooperation aus inneren Ursachen, vor allem unter der Wirkung der Vergrößerung des Marktes und der Verdichtung der Bevölkerung, eine Vermehrung des Gesellschaftserzeugnisses zustande bringt, gebiert die Ursprungsnorm neue Normen zu dem Zwecke, wenn auch nicht immer mit dem Erfolge, den besten Teil des Zuwachses der Oberklasse unentgolten zuzuführen.
Damit treten die juristischen Probleme endgültig aus unserem Gesichtskreis, wenigstens grundsätzlich, wenn wir uns auch vorbehalten müssen, gelegentlich darauf zurückzukommen. Aber niemals wird uns das Recht als solches interessieren, sondern immer nur als der Ausdruck bestimmter soziologischer Machtverhältnisse.
Was aber die soziologische Staatsidee der Jurisprudenz und der Rechtsphilosophie als Morgengabe bringt, ist die grundlegende Er-
[1] Ausführlich darüber S. S. I, S. 376ff.
[323]
kenntnis, daß das Recht aus zwei ganz wesensverschiedenen Wurzeln wächst, daß es seinen „Inhalt“ in Kelsens Sinne aus zwei miteinander verwachsenen „Ursprungsnormen“ entwickelt: aus dem Rechte der Genossenschaft der Gleichen, das man jedenfalls als „natürliches Recht“ bezeichnen darf, wenn es auch kein „Naturrecht“ ist, einerseits, und andererseits aus dem Rechte der zur Macht gewordenen Gewalt, des Rechts der Ungleichen [1] ; daß also das Recht, wie der Staat, eine „aus Kratos und Ethos“ gemengte „Mischform menschlicher Beziehungen“ ist. Hier ist, so scheint uns, ein vollkommen neuer Ausgangspunkt für die Theorie und daher auch für die Praxis des Juristen gegeben, ein neuer Ausgangspunkt für das Verständnis des positiven Rechts nach Herkunft und Wesen, ein neuer Ausgangspunkt für die Bewertung des positiven Rechts, vor allem des Rechts des Eigentums einschließlich des Erbrechts, für das jetzt ein absoluter Wertmaßstab in dem Rechte der freien Genossenschaft gegeben ist; freilich wird die Jurisprudenz hierbei der Hilfe der gleichfalls völlig neu zu orientierenden Ökonomik nicht entraten können, die ihr zu sagen hat, welche Formen des Eigentums nach jenem Naturrecht der Gleichheit entstehen können, d. h. vor einem höheren Richterstuhl „legitim“ sind.
Es würde unsere Kompetenz weit überschreiten, die Konsequenzen zu ziehen, die sich von diesem neuen Ausgangspunkt aus für die juristische Betrachtung der verschiedenen Rechtsgebiete ergeben müssen. Aber wir dürfen darauf hinweisen, daß sich auch für das Strafrecht neue wichtige Gesichtspunkte ergeben. Und zwar wird hier die Jurisprudenz mit der Moralphilosophie und Kriminalpsychologie zu kooperieren haben, die gleichfalls in unseren Feststellungen einen ganz neuen Ausgangspunkt gewonnen haben — könnten. Freilich hat die Moralstatistik seit Alexander von öttingen und schon vorher seit Quételet die „Kollektivschuld“ der Gesellschaft am individuellen Verbrechen zahlenmäßig festgestellt: aber es fehlte ihr die klare historisch-ökonomische Gedankengrundlage, fehlte auch ihr der unzweifelhafte historisch-rechtlich-ökonomische Wertmaßstab, den wir ihr geben konnten. Sie kann jetzt wenigstens erfahren, wie eine wirklich „geordnete Ordnung“ auszuschauen hat, und kann das Problem erkennen, daß es sich darum handelt, die normalen sozialen Regulationen des durchschnittlichen Menschen nicht stärker zu be-
[1] Max Weber schreibt (Wirtschaftsgeschichte, S. 303): „ursprünglich stehen zwei verschiedene Einstellungen zum Erwerb unvermittelt nebeneinander: nach innen Gebundenheit an die Tradition, an ein Pietätsverhältnis zu den Stammes-, Sippen- und Hausgenossen unter Ausschluß hemmungslosen Erwerbes innerhalb des Kreises der durch die Pietätsbande miteinander Verbundenen: Binnenmoral — und absolute Hemmungslosigkeit des Erwerbstriebes im Verkehr nach außen, wo jeder Fremde ursprünglich Feind ist, dem gegenüber es keine ethische Schranke gibt: Außenmoral“.
[324]
lasten, als ihrer angeborenen Stärke angemessen ist; daß also das Problem nicht mehr zu stellen ist: wie ist der Verbrecher, sondern wie ist die Gesellschaft zu bessern?
Hier möchten wir uns gegen den sicherlich sonst kommenden Vorwurf verwahren, als hielten wir es für möglich, daß es jemals eine Gesellschaft ohne Verbrechen und Verbrecher geben könnte. Es liegt uns nichts ferner als eine derartig verzückte Gläubigkeit. Jede Gesellschaft der Zukunft wird Strafrecht und Strafrichter brauchen : aber nicht mehr zur Repression von Massenphänomenen, sondern von Individualphänomenen. Und das ist eine der Unterscheidungen, an denen vorbeizusehen unsere großen Sozialpsychologen und -philosophen mit der größten Kunst verstehen. Um ein jedermann einleuchtendes Beispiel aus einem nahe verwandten Nachbargebiet zu wählen, so wird es niemals eine Gesellschaft geben, in der nicht akute und vor allem chronische Infektionskrankheiten Einzelne fortraffen; und das ist nicht einmal zu wünschen; denn diese Krankheiten, namentlich die Tuberkulose, wirken unter normalen Verhältnissen selektiv, nehmen die geringsten, die lebensschwächsten „Minusvarianten“ fort und erhöhen derart den Rassentypus: aber in unseren Verhältnissen sind jene Krankheiten, vor allem die Tuberkulose, kontraselektiv, raffen auch die von Natur besten „Plusvarianten“ massenhaft fort.
Gerade so steht es heute mit den beiden engverschwisterten Sozialkrankheiten des Kriminalismus und der Prostitution. Wie viele „geborene Verbrecher“ und „donne prostitute“ es in einer Gesellschaft geben würde, in deren Struktur und Recht niemals die außerökonomische Gewalt eingegriffen hätte, können wir nicht mit Sicherheit angeben, obgleich wir Tatsachen genug aus genossenschaftlichen Siedlungen besitzen, die zu der Erwartung berechtigen, daß ihre Zahl erstaunlich gering sein würde, Tatsachen, die freilich in die offizielle Wissenschaft kaum jemals Eingang finden [1]. Aber das eine können wir mit aller Sicherheit sagen, daß bei einer dem natürlichen Recht entsprechenden Verteilung der Vermögen und der Arbeitslast die Zahl sehr viel kleiner sein müßte als heute. Mehr zu wissen ist gar nicht erforderlich. Und diese Erkenntnis müßte das Strafrecht und noch mehr den Strafrichter erheblich beeinflussen.
Damit wenden wir uns zu unserer eigenen Aufgabe zurück, zu dem historischen Staat.
Was wir grundsätzlich über den Ursprung und die Verfassung „des“ Staates gesagt haben, das gilt für den Staat aller Zeiten und Formen ganz gleichmäßig. Wenn es einmal nicht mehr gelten wird, so wird der Staat als historischer Klassenstaat aufgehört haben zu existieren, und wird der „Freibürgerschaft“ den Platz geräumt haben.
[1] Vgl. „Die Utopie als Tatsache“, „Wege zur Gemeinschaft“, S. 493ff.
[325]
Im primitiven Eroberungsstaat besitzt eine kleine kriegsfrohe, enggeschlossene und -versippte Minderheit die Herrschaft über ein bestimmtes Gebiet und seine Bewohner. Sie ist Anwendung der Ursprungsnorm und der schon aus ihr entsprungenen sekundären Normen, eines durch Gewohnheit gewordenen Rechts, das die Vorrechte und Ansprüche der Herren und die Gehorsams- und Ehrenpflichten der Untertanen derart regelt, daß die Prästationsfähigkeit möglichst nicht leide. Also durch Gewohnheitsrecht festgelegtes „Imkertum“. Der Leistungspflicht der Bauern entspricht die Schutzpflicht der Herren, die sich auf verbotene Handlungen der eigenen Klassengenossen ebenso erstreckt wie auf Angriffe der äußeren Feinde.
Der Inhalt der Herrschaft ist außer den erwähnten, nicht sehr bedeutungsvollen Ehrenrechten der oberen und den entsprechenden Pflichten der unteren Klasse die Verteilung in jenem dreifachen Sinne. Von allem Anfang an wird das Eigentum — und hier gibt es in der Regel kein anderes als Grundeigentum mit seinem Zubehör an Menschen, Gebäuden, Vieh usw. — entweder ganz den Herren vorbehalten, oder sie nehmen sich Großeigen, wo den Unteren nur Kleineigen gestattet ist. Die Arbeit in der gesellschaftlichen Kooperation wird derart verteilt, daß alle angenehme und leichte Arbeit (hier Jagd, Krieg, politische Tätigkeit im Rate, als Gesandte, als Beamte) den Herren vorbehalten bleibt, während alle schwere, lästige, schmutzige, gesundheitsschädliche Arbeit der Unterklasse zufällt. Und der Ertrag der gesellschaftlichen Kooperation wird derart verteilt, daß die Unterklasse womöglich auf die Dauer nur den Notanteil der Bienen, den ganzen Rest aber der Bienenvater erhält. Das aber heißt auf dieser Stufe : der Bauer, ob formell frei oder unfrei, Höriger oder Sklave, gibt einen Teil seiner Arbeit oder seines Arbeitserzeugnisses unentgolten hin, unter irgendeiner Rechtsform, sei sie das Eigentum des Sklavenbesitzers am Produkt seines Sklaven, sei sie die Rechtspflicht der Fronarbeit und die Abgabe, die der Hörige von seinem Grundstück zu zinsen hat, sei sie ein Pachtvertrag, den der landlose Landbedürftige mit einem der Herren des ganzen gesperrten Gebietes abzuschließen gezwungen war: unter dem Monopolverhältnis.
Im Anfang war die Grundrente!
Die Formen, in denen sich der Bezug und Verzehr der Grundrente vollzieht, sind verschieden. Bald sitzt die Herrengenossenschaft als geschlossener Verband in einem festen Lager und verzehrt kommunistisch, „kasinomäßig“, den Tribut der Bauernschaften: so im Inkastaate. Bald ist schon jedem einzelnen Kriegsedeling ein bestimmtes Landlos zugewiesen, aber er verzehrt dessen Ertrag doch noch vorwiegend in der Syssitie, der Speisegenossenschaft, mit seinen Klassengenossen
[326]
und Waffengefährten: so in Sparta. Bald ist der Grundadel [1] über das ganze Gebiet zerstreut, haust einzeln mit seinen Sippen und Gefolgen auf seinen festen Burgen und verzehrt individualistisch den Ertrag seiner Herrschaft. Aber noch ist er kein Wirt; er empfängt nur den Tribut von der Arbeit seiner Hörigen und Zinspflichtigen, die er weder leitet noch auch nur beaufsichtigt. Das ist der Typus der mittelalterlichen Grundherrschaft, der „Fronhofswirtschaft“ in den Ländern des germanischen Adels. Und schließlich „verwandelt sich der Ritter in den Rittergutsbesitzer“ (Knapp), die hörigen Bauern werden zu Arbeitern seines Großbetriebes, und der Tribut erscheint jetzt als Unternehmergewinn oder als „Differentialgrundrente“ von den dem Markte näheren oder von Natur besseren Böden : das ist der Typus des „ersten kapitalistischen Großbetriebs der Neuzeit“ (Knapp), wenn man von dem kapitalistischen Großbetriebe der Heeresunternehmung, dem Kondottieretum, absieht. Zahlreiche Übergänge führen von einer Stufe zur anderen.
Felix Dahn sagt von dem deutschen Uradel, seine Entstehung, der Grund seiner Auszeichnung, entziehe sich der Forschung [2]. Vielleicht reichen die geschichtlichen Quellen nicht so weit hinauf; das entzieht sich unserer Beurteilung, da wir nicht den Anspruch erheben, Geschichtsschreiber zu sein: aber die soziologischen Beweisgründe lassen gar keinen Zweifel an der Mechanik dieses Einzelfalles, selbst wenn wir nicht schon berechtigt wären, auch aus rein historischen Gründen, die typische deutsche Entwicklung auf dieselben Ursachen zurückzuführen, die wir aus solchen Fällen kennen, in denen sich die Bildung des Adels unserer Kenntnis nicht entzieht. Und diese Fälle sind überaus zahlreich. Einige Beispiele zu denen, die wir aus der· Völkerkunde bereits beigebracht haben, aus der Geschichte:
Der polnische Historiker Piekosinski schreibt: „Das Resultat, zu dem ich in meinen früheren historischen Untersuchungen („Über die Genesis des polnischen Volkes im Mittelalter“, 1881, und „Verteidigung der Eroberungshypothese als Grundlage des polnischen Staates“, 1882) gelangte, ist kurz folgendes: daß die soziale Struktur Polens unter den Piasten, die uns drei streng geschiedene und verschieden berechtigte soziale Klassen aufweist, und zwar einen hohen Adel, einen niederen Adel und eine bäuerliche Bevölkerung—daß eine solche Struktur keineswegs ein Produkt einer normalen Entwicklung eines lechitischen Stammes, der sich (angeblich!) zwischen Weichsel, Oder und Netze ansiedelte, sein kann, sondern daß wir es hier offenbar mit einer Eroberung (najazd)
[1] Das Wort Adel stammt von Uod-al und bedeutet „Grundeigentümer“, Erbbesitzer (Kleinpaul, die deutschen Personennamen, S. 46/7).
[2] Zit. nach Gumplowicz, Allg. Staatsrecht, S. 55.
[327]
zu tun haben, welche die zwei oberen sozialen Schichten, d. h. hohen und niederen Adel schuf und die autochthone unterjochte Bevölkerung auf die unterste Staffel des sozialen Aufbaus herabdrückte“ [1].
Ebenso kennen wir die Entstehung des Adels aus den Erobererherren mit aller Sicherheit verbürgter geschichtlicher Quellenforschung aus den übrigen südlichen, westlichen, nördlichen und östlichen Nachbarländern Deutschlands: aus Rußland, Ungarn, den Baltenstaaten, aus Italien, Spanien, den Balkanländern, aus Frankreich, Großbritannien und Schweden. Will man da aus der Tatsache, daß wir über Deutschland und z. B. Schottland [2] keine Quellen haben (oder vielleicht die vorhandenen Quellen unter der Blendung durch das Gesetz der ursprünglichen Akkumulation nicht richtig ausgenützt haben: denn auch der Historiker findet in der Regel nur, was er sucht), wirklich den Schluß ziehen, daß hier allein in aller Welt, in der neuen wie der alten, sich die Dinge ganz anders entwickelt haben ? ! Oder sich mit einem vieldeutigen Ignoramus begnügen?! Wir würden diesen Mut nicht haben.
Gleichviel in welcher Form Rechtens der Tribut entrichtet wird: ob an die Herrenklasse insgesamt oder an ihre einzelnen Mitglieder: es ist überall im Kerne der gleiche Staat. Sein Zweck ist überall das „politische Mittel“: Aneignung zunächst der Grundrente, solange keine Gewerbsarbeit besteht, die angeeignet werden kann. Seine Form ist überall die Herrschaft: die Ausbeutung als Recht, als Verfassung auferlegt und streng, wenn nötig grausam, aufrecht erhalten und durchgesetzt, aber doch das absolute Erobererrecht im Interesse des dauernden Rentenbezuges ebenfalls rechtlich eingeengt. Die Leistungspflicht der Untertanen ist begrenzt durch ihr Recht auf Erhaltung bei der Leistungsfähigkeit, das Steuerrecht der Herren ergänzt durch ihre Schutzpflicht nach innen und außen: Rechts- und Grenzschutz. Und das Ganze aufgefaßt von oben wie von unten ais ein Rechtsverhältnis, nicht mehr als ein bloßes Gewalt Verhältnis : zwar keine objektive, wohl aber subjektive Reziprozität.
Damit ist der primitive Eroberungsstaat reif, in seinen sämtlichen wesentlichen Elementen voll ausgebildet. Das embryonale Stadium ist überwunden: was noch folgt, sind lediglich Erscheinungen des Wachstums.
Er stellt gegenüber den Sippenverbänden zweifellos eine höhere Art dar; der Staat umschließt eine größere Menschenmasse in strafferer Gliederung, fähiger zur Bewältigung der Natur und Abwehr menschlicher Feinde.
[1] Zit. nach Gumplowicz, Allg. Staatsrecht, S. 50. Vgl. seine Bemerkungen über die Entwicklung Böhmens, a. a. O. S. 63.
[2] Über Schottlands Entwicklung vgl. S. S. Ill, S. 522 ff.
[328]
Eine höhere Art! Schon Spencer hat es angedeutet [1], und Paul v. Lilienfeld hat es ausgeführt [2], daß hier eine besonders schlagende Analogie zwischen dem höheren individuellen und dem kollektiven Organismus gegeben ist. Alle höheren Wesen pflanzen sich zwiege-schlechtlich fort, die niederen ungeschlechtlich, durch Teilung, Knospung, allenfalls durch Kopulation. Nun, und der einfachen Teilung entspricht genau das Wachstum und die Fortpflanzung der vorstaatlichen Sippengenossenschaft : sie wächst, bis sie für den Zusammenhalt zu groß wird, schnürt sich ab, teilt sich, und die einzelnen Horden bleiben allenfalls in jenem losen Zusammenhang ohne irgendwie straffere Gliederung, den wir noch bei den Bauern beschrieben haben. Der Kopulation mag man die Verschmelzung exogamischer Gruppen vergleichen [3].
Der Staat aber entsteht durch geschlechtliche Fortpflanzung [4]. Alle zwiegeschlechtliche Fortpflanzung vollzieht sich derart, daß das männliche Prinzip, eine kleine sehr bewegliche, aktive Schwärmzelle (das Spermatozoid) eine große träge, der Eigenbewegung entbehrende Zelle (das Ovulum) aufsucht, in sie eindringt und mit ihr verschmilzt, worauf ein Prozeß gewaltigen Wachstums, d. h. wundervoller Differenzierung mit gleichzeitiger Integrierung, sich vollzieht. Die träge, schollengebundene Bauernschaft ist das Eichen, der bewegliche Hirtenstamm das Spermatozoid dieses soziologischen Befruchtungsaktes: und sein Ergebnis ist die Reifung eines höheren, in seinen Organen viel reicher gegliederten (differenzierten) und viel kräftiger und wirksamer zusammengefaßten (integrierten) sozialen Organismus. Die Art, wie im Physiologischen die unzähligen Spermatozoïde das Ovulum umschwärmen, bis endlich eines, das stärkste oder glücklichste, die „Mikropyle“ entdeckt und den Eingang erzwingt, ist den Grenzfehden, die der Staatsbildung voraufgehen, wohl vergleichbar, und ebenso die magische „chemotaktische“ Anziehungskraft, die das Ovulum auf die Schwärmzellen ausübt, dem Streben der Steppensöhne in die Ebenen.
Eine Bemerkung v. Lilienfelds ist übrigens soziologisch interessant, nicht für den Prozeß, sondern für den Beobachter: ein glorreiches Beispiel der „persönlichen Gleichung“. Er sagt an der soeben angeführten Stelle: „Beachtet man, wie die Spermatozoen die weibliche Zelle umschwärmen und gewaltsam in dieselbe eindringen, so hat man ein Bild des Kampfes zwischen einer unternehmenden, beweglicheren, aktiven Bevölkerung und einer verweichlichten und passiven“. Hier sieht
[1] Sociology I, s. 579.
[2] Die organische Methode in der Soziologie, S. 50.
[3] S. S. I, S. 860ff.
[4] Ähnliche Vorstellungen bei Frobenius, „Vom Kulturreich des Festlandes“, S. 118.
[329]
man das sozialpsychologisch determinierte Bedürfnis des Klassenmenschen, den Vorgang nicht nur zu beschreiben, sondern auch zu rechtfertigen. Ist das Eichen „verweichlicht“ ? Sind die Spermatozoïde biologisch höher zu bewerten ? Und wenn sie das sicherlich nicht sind: wie kommt der Organizist dazu, diesen, seinem grundsätzlichen Standpunkt ganz fremden, Gesichtspunkt in die Erklärung einzuschmuggeln ? Müßte er sich nicht gerade umgekehrt sagen, daß hier, in der biologischen Homologie, jede menschliche Bewertung grotesk ist?!
II. Das Wachstum. ↩
1. Die Integrierung.↩
Wir verfolgten die Entstehung des Staates vom zweiten Stadium an in seinem objektiven Wachstum als politisch-rechtliche Form und ökonomischer Inhalt. Wichtiger aber ist sein subjektives Wachstum, die Ausbildung und Festigung des „Consensus“, der subjektiven Reziprozität, seine sozialpsychologische Integrierung und Differenzierung. Sprechen wir zuerst von jener.
Das Netz seelischer Beziehungen, das wir bereits im zweiten Stadium sich knüpfen sahen, wird immer dichter und enger in dem Maße, wie die materielle Verschmelzung, die wir schilderten, voranschreitet. Die beiden Dialekte werden zu einer Sprache, oder die eine der beiden, oft ganz stammverschiedenen Sprachen verschwindet, zuweilen die der Sieger [1], häufiger die der Besiegten.
[1] Vgl. Ed. Meyer, Gesch. d. Altertums I, 2 (1921), S. 701. Koch-Grünberg teilt einen interessanten Fall mit, in dem ein Stamm seine Sprache zweimal hintereinander gewechselt hat. Die Kaua, ein vor Zeiten am Querary . . . wohnender Aruak- stamm, nahmen neben manchen Sitten auch die Sprache der dort einf all enden Kobeua an. Als sie ihre Wohnsitze zum Aiary verlegten, kamen sie wieder mit reinen Aruak in engste Berührung ... So kommt es, daß heute fast nur die älteren Leute Kobeua sprechen, während die jüngere Generation wieder einen Aruak-Dialekt spricht. Max Schmidt, dem wir die Mitteilung entnehmen (Die Aruaken, S. 20/1) bringt noch eine Reihe anderer Beispiele und fügt hinzu, „daß mit dem Zurückdrängen der Aruakdialekte nicht auch ein Zurückdrängen der Aruakkulturen verbunden zu sein braucht, daß vielmehr das Erlernen und der Gebrauch der fremden Sprachen gerade zum Zweck der Ausbreitung der eigenen Machtsphäre über fremde Einflüsse benutzt wird“. Wir möchten hinzufügen, erstens, daß wir uns einen solchen Sprachwechsel nicht so schwierig vorstellen dürfen, wie er etwa heute in unseren Verhältnissen sein würde: denn diese Stamme haben nur wenige, etwa 200 Worte; und zweitens, daß sich unter Umständen der Sprach Wechsel geradezu aufzwingen muß, wenn ein roher Stamm ein reich gegliedertes und gewerblich hoch entwickeltes Städtervolk unterwirft: er kann es nicht regieren, wenn er seine Sprache nicht annimmt, da er keine Ausdrücke für die unzähligen fremden Dinge hat. Max Schmidt macht an der bezeichneten Stelle auf die interessanten Fälle aufmerksam, wo ein Stamm zwei Sprachen hat, eine für den täglichen Verkehr, eine andere für die Zeremonien, oder wo, wie auf den Kleinen Antillen, die Männer Karaibisch, die Frauen Aruakisch sprachen.
[330]
Die beiden Kulte verschmelzen zu einer Religion, in der der Stammgott der Sieger als Hauptgott angebetet wird, während die Götter der Sieger bald zu seinen Brüdern oder Kindern, bald zu seinen Gegnern : Dämonen oder Teufeln werden. So ist Odhin der Kriegsgott der Erobererherren, Thor der Gott der freien Bauern, Lokhi der Gott der unterworfenen Urbevölkerung, die die geheimnisvolle Kunst der Feuerbeherrschung und des Schmiedens besaß. So ist Ahuramazda der Lichtgott der siegreichen Arier, Angra-Mainyus der Nachtgott der besiegten Ureinwohner (wenigstens nördlich des Himalaya; südlich sollen die entsprechenden Namen die entgegengesetzte Bedeutung haben, was darauf hindeuten würde, daß verschiedene Wellen arischer Einwanderer sich überlagerten) [1]. So wird in dem von Karl unterworfenen Sachsen der Christengott zum Lichtgott und Spender alles Guten, während die alten Götter zu „Valanden“ erklärt werden und feierlich abgeschworen werden müssen. Und so kommt schließlich die überaus komplizierte Mythologie z. B. der Griechen zustande: die Priesterschaft sieht sich gezwungen, in das Chaos der Götternamen Ordnung und Unterordnung, alle die Gaugötter in einen Zusammenhang zu bringen, und so ist der arme Zeus zu seinen unzähligen Liebesabenteuern verurteilt worden: ein Vorgehen, das ganz im Geiste der zurzeit herrschenden lustigen und übermütigen Ritterschaft war.
Die beiden leiblichen Typen gleichen sich mehr und mehr unter den Einflüssen des gleichen Klima und der ähnlichen Lebenshaltung aneinander an. Wo eine starke Verschiedenheit der somatischen Rasse bestand und sich erhält, füllen in der Regel die Bastarde die Kluft einigermaßen aus [2].
Wo der Typus von vornherein der gleiche war, und das ist überall
[1] Vgl. Ed. Meyer, a. a. O. S. 921, 923, 930/1.
[2] Es gibt selten Bastarde von Frauen der Oberldasse mit Männern der Unterklasse. Eine solche Vermischung gilt fast überall als ein schweres, oft todeswürdiges Verbrechen, als „Sünde wider das Blut“. So wird von den Wahuma erzählt, daß ihre Frauen, die eine höhere Stellung haben als bei den unterworfenen Negerstämmen, sorgfältig behütet werden. „Das trägt zur Erschwerung der Mischungen bei. Die Masse der Waganda wäre nicht noch heute ein echter Negerstamm mit dunkelschokoladenfarbiger Haut und kurzem Wollhaar, wenn sich nicht die beiden Völker als Ackerbauer und Hirten, als Beherrschte und Herrscher, als Verachtete und Geehrte trotz der Beziehungen, die in ihren höheren Klassen geknüpft werden, schroff gegenüberständen. In dieser Sonderstellung sind sie eine typische Erscheinung, die man immer leicht wiedererkennt“. (Ratzel, Völkerkunde II, S. 177.) — Aber es gibt wohl kaum Herrenklassen, deren Männer nicht in Geschlechtsverkehr mit Frauen der Unterklasse treten. Die vornehmen Plantagenbesitzer der Südstaaten zeugten mit ihren Negerinnen Kinder, die dann ihre Sklaven wurden, die Franzosen, Spanier, Portugiesen, Holländer, und sogar die rassenstolzen Engländer gehen in ihren Kolonien überall eine Art von Zeitehe oder selbst Dauerehen mit eingeborenen Frauen ein; die Kinder aus solchen Ehen sind freilich in allen britischen Ländern als „half-cast“ gesellschaftlich ausgeschlossen.
[331]
der Fall, wo weiße Männer sich als Sieger und Besiegte gegenüberstehen, und in gemindertem Maße auch dort, wo Mongolen und Weiße sich treffen, da schwindet die Erinnerung an die verschiedene ethnische Abstammung ganz: der Typus der Feinde jenseits der Grenze, mögen sie auch ganz der gleichen Rasse angehören, der Menschen fremder Lebensweise, fremder Tracht und Sitte, fremder Sprache und Götter, wird allmählich von Allen als stärker „fremd“ empfunden, als der sich immer mehr verwischende innere Gegensatz der Typen. Immer mehr lernen sich Herren und Untertanen als „ihresgleichen“ ansehen; die Erobererherren gelten als Abkömmlinge der alten Götter, sind es ja auch in der Tat oft, da diese Götter nichts anderes sind als die durch Apotheose vergotteten Seelen der berühmtesten Ahnen.
Je schärfer sich nun im Zusammenprall der benachbarten „Staaten“, die ja viel angriffslustiger sind als die alten Sippen ver bände, das Bewußtsein der Absonderung aller Insassen des staatlichen Friedenskreises von den auswärtigen Fremden ausprägt, um so stärker wird im Innern das Bewußtsein und Interesse der Zusammengehörigkeit; und um so mehr faßt der Geist der genossenschaftlichen Brüderlichkeit, der Billigkeit, hier Wurzel, der früher innerhalb der Sippenhorden lebte und noch jetzt im inneren Verhältnis der Klassengenossen oben und unten weiterlebt. Das sind selbstverständlich nur ganz schwache Fäden der Verbindung zwischen oben und unten ; Billigkeit und Brüderlichkeit können nicht mehr Raum erhalten, als das Recht auf oder die Pflicht zum Tribut es gestattet: aber so viel Raum erhalten sie.
Vor allem ist es der Rechtsschutz nach innen, der ein noch stärkeres Band der Gemeinschaft webt, den Consensus stärker entfaltet, die subjektive Reziprozität wirksamer einprägt, als der Waffenschutz nach außen. Justifia fundamentum regnorum. Wenn die Junkerschaft als soziale Gruppe „von Rechts wegen“ einen junkerlichen Totschläger, Frauenschänder oder Räuber hinrichtet ; — wenn Harun al Raschid den Richterstuhl mit der Haut eines ungerechten Kadi beziehen läßt und den Sohn des Hingerichteten von diesem Stuhl aus Recht sprechen läßt, mit dem grausigen Memento unter sich, dann dankt und jubelt der Untertan noch herzlicher als nach einer gewonnenen Schlacht.
Das sind die Hauptlinien in der Entwicklung des psychischen Consensus. Die Gemeininteressen an Rechtsordnung und Frieden erzeugen eine starke Gemeinempfindung, ein „Staatsbewußtsein“, wie man es nennen könnte.
So entsteht allmählich ein einziges Volk, eine einzige „Nation“ [1], eine „hochorganisierte Gruppe“ mit einer Sprache, einer Religion, einer hochgehaltenen Tradition von Ruhm, Ehre und Erfolg, eine
[1] S. S. I, S. 575, 643.
[332]
somatisch und seelisch vollkommene Mischung, in der nichts anderes mehr über die Zugehörigkeit entscheidet als der Wille der Zugehörigkeit, der übrigens auf den unteren Stufen der Entwicklung ein nichtbewußter, triebmäßiger, selbstverständlicher Wille ist. Und diese Mischung wird fortan der Träger der weiteren Ausgestaltung in allen guten und bösen Dingen, ohne daß es jemals möglich wäre, den Ursprung einer Errungenschaft, einer Entartung, einer Institution, auf eines der beiden verschmolzenen Elemente zurückzuführen, wie das die „Philosophen“ der rassentheoretischen Geschichtsauffassung immer wieder unter dem Beifall aller Narren tun, denen ihre eigene Kappe am besten gefällt. „So wissen wir bis zum heutigen Tage nicht, ob und inwieweit die sumerische Kultur das Werk der Sieger oder der Unterworfenen war, ob die Renaissance auf germanischer, romanischer, keltischer oder alarodischer [1] Grundlage erblüht. Ja, man kann die Frage stellen: geht die heutige Weltkultur mehr auf Arier oder auf Anarier zurück“ [2] ?
2. Die Differenzierung. (Gruppentheorien und Gruppenpsychologie.) ↩
Auf der anderen Seite entwickelt sich, wie in allem organischen Wachstum, pari passu eine ebenso kräftige psychische Differenzierung. Die Gruppeninteressen erzeugen starke Gruppenempfindungen; Oberschicht und Unterschicht entwickeln entsprechend ihren Sonderinteressen je ein „Gruppenbewußtsein“: eine allgemeine psychologische Einstellung, die sich, klarer oder weniger klar, zu einer „Gruppentheorie“ ausgestaltet.
„Das Lebensinteresse der ganzen Gesellschaft, und mithin auch das jeder einzelnen Klasse derselben, ist das Interesse. Der Inhalt des Interesses geht dahin, die gegebene gesellschaftliche Stellung zu behaupten oder zu bessern. Jede bessere gesellschaftliche Stellung beruht nun aber darauf, daß andere in anderen Stellungen von ihr abhängig sind. Das Interesse löst sich daher stets in das Streben auf, diese Abhängigkeit entweder hervorzurufen oder die hervorgerufene zu sichern oder zu vergrößern. . . . Indem nun die erste, in der Gesellschaft herrschende Klasse sich der Staatsgewalt bemächtigt, Privilegium, Stand und Kaste erzeugt und Verfassung und Verwaltung nach ihrem Interesse einrichtet, trägt sie etwas in den Staat hinein, was ohne sie nicht da sein würde; der Staat gewährleistet durch diese seine neue Gestalt ein Element, das ihm und seiner höheren Idee widerspricht ... er wird damit der Diener einer Macht, welche in Prinzip und Ziel ihm direkt entgegentritt; er sieht seine eigenste Natur gleichsam umgekehrt ... er ist unfrei ge-
1) Über die Alarodier, Ed. Meyer, a. a. O. S. 698.
[2] Albr. Wirth, Geschichtsphilosophisches, Pol.-Anthrop. Revue, 1908.
[333]
worden. . . . Die Unfreiheit entsteht, wenn die Staatsgewalt gezwungen ist, einem besonderen gesellschaftlichen Interesse zu dienen. Sie ist eine rechtliche Unfreiheit, wenn der Staat die Herrschaft eines solchen Sonderinteresses, die ohne ihn nur eine Tatsache ist und daher von jedem bekämpft werden kann, zu einem für jeden unantastbaren Recht macht. Sie ist eine politische Unfreiheit, wenn eine bestimmte Klasse der Gesellschaft die Herrschaft über die Staatsgewalt ausschließlich in Händen hat“ [1].
Die Schilderung ist vollkommen, nur daß hier überall der falsche Gedanke zugrunde Hegt, diese Herrschaft einer Klasse im Staate müsse sich notwendig aus innerstaatlichen Beziehungen überall herausbilden: „Die ernste Wahrheit, daß die Unfreiheit im Leben der menschlichen Gemeinschaft notwendig und unvermeidlich ist“ (69): die Kinderfibel!
Da das Sonderinteresse der Herrenklasse darin besteht, ihre „gesellschaftliche Stellung zu behaupten oder zu bessern“, d. h. das Recht auf den Ertrag des politischen Mittels aufrechtzuerhalten, ist sie überall legitimistisch und konservativ. Und da umgekehrt das Sonderinteresse der Unterklasse darin besteht, dieses Recht zu mindern oder ganz aufzuheben und durch das neue Recht der Gleichheit aller Insassen des Staates zu ersetzen, ist sie überall „liberal“ und revolutionär, wo sie überhaupt zu eigenem Klassenbewußtsein erwacht.
Dieses letztere gilt seit Nietzsche Vielen als nichts besseres denn als ein „Sklavenaufstand in der Moral“. All die Kleinen, die Gernegroße, die glauben, Riesen zu sein, wenn sie ihren Fuß „auf ellenhohe Socken stellen“ und sich „Perücken von Millionen Locken aufsetzen“, all die „Viel-zu-Vielen“, die gern als Übermenschen erscheinen möchten, berufen sich auf den großen Prediger der Revolution, des Rechts der Starken! Und doch brauchen sie sich bloß einmal in ruhiger „Abwägung“ im Geiste in die Unterklasse zu versetzen, um sofort zu erkennen, daß das Recht, auf das die „Sklaven“ sich berufen, das unverrückbar in den ewigen Sternen hängt, wirklich das Recht über allen Rechten ist; ja, sie können anders ihre eigene Theorie gar nicht verstehen: denn aller Legitimismus [2] ist nichts als eine verhohlene Anerkennung dieses natürlichen Rechts der Gleichheit, d. h. der Gerechtigkeit.
[1] Lorenz von Stein, Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich von 1789 bis auf unsere Tage, Erster Band, Der Begriff der Gesellschaft, München 1921, hrsg. von G. Salomon, S. 67/8.
[2] Der Ausdruck „légitimité“ ist nach Stein (a. a. O. Ill, S. 52) zuerst von Talleyrand auf dem Wiener Kongreß gebraucht worden, und zwar als Bezeichnung der fürstlichen Rechte, des „Gottesgnadentums“. Wir brauchen das Wort in einem weiteren Sinnie, als Bezeichnung des Gottesgnadentums der gesamten Klassenordnung.
[334]
Nirgends zeigt sich der allmächtige „sozialpsychologische Determinismus“ klarer als in diesen Klassenpsychologien und Klassentheorien, die sofort mit dem Staate nach strengen Seelengesetzen entstehen und all die kommenden Jahrtausende hindurch die Klassenkämpfe leiten und im Bewußtsein der Kämpfenden rechtfertigen werden.
Solange die Beziehungen der beiden Gruppen lediglich die zwischen- stammlichen zweier Grenzfeinde waren, bedurfte das politische Mittel keiner Rechtfertigung. Denn der Blutsfremde hat kein Recht, man kann ihm kein Unrecht tun; der Unterworfene hat noch dankbar zu sein, wenn man ihm das nach dem Recht des Schwertes verwirkte Leben, und noch dankbarer, wenn man ihm die bare Notdurft läßt. Sobald aber die psychische Integration das Gemeingefühl des Staatsbewußtseins, des Consensus und der Reziprozität einigermaßen ausgebildet hat, sobald der hörige Knecht ein „Recht“ erworben hat, bedarf das politische Mittel, das jetzt zur „Sünde“ geworden ist, der Rechtfertigung, und diese „Legitimierung des Bastards“ ist der Legitimismus.
a) Die Oberklasse.
A. Der Legitimismus.
Wir haben in den früheren Bänden dieses Systems und auch bereits in diesem Bande nicht nur den sozialpsychologischen Determinismus an zahlreichen Beispielen dargestellt, sondern auch gezeigt, daß hervorragende Forscher, auch anderer Richtung, seine Gewalt anerkennen, wo ihre „persönliche Gleichung“ ihnen die Augen nicht blendet. Wir erinnern an die klassische Stelle, die wir aus Hasbach, einem der großen Meister der geistesgeschichtlichen Analyse, zitiert haben (oben S. 112). Bei der Wichtigkeit des Gegenstandes möge es erlaubt sein, noch andere Auslassungen der gleichen Inhalts anzuführen. Die erste stammt von einem gleich berühmten Meister der Geistesgeschichte, Lujo Brentano: „In der Volkswirtschaftslehre gelangt eine richtige Lehre erst dann zu Anerkennung, wenn sie den Interessen einer mächtigen Partei entspricht, und nur so lange, als diese mächtig ist; wird eine andere mächtiger, so gelangen auch die irrigsten Lehren wieder zu Ansehen, sobald sie den Interessen der Mächtigen zu dienen geeignet scheinen“ [1].
Und ein dritter anerkannter Meister der Geistesgeschichte, Taine: „Denn wenn eine Lehre die Menschen hinreißt, so liegt das weniger an den Sophismen, mit denen sie operiert, als an den Versprechungen, die sie ihnen macht. .. . Ein System gefällt uns nicht, weil wir es für wahr halten, sondern wir halten es für wahr, weil es uns gefällt. Politischer oder religiöser Fanatismus wurzelt stets hauptsächlich in einem lebhaften
[1] Der Unternehmer, S. 6.
[335]
Bedürfnis, einer geheimen Leidenschaft, einer Ansammlung verborgener, aufdringlicher Wünsche, denen die Theorie einen Ausgang gewährt“ [1].
Der Legitimismus rechtfertigt — muß rechtfertigen — überall Herrschaft und Ausbeutung mit den gleichen anthropologischen und theologischen Mitteln.
Die Herrengruppe, die ja Mut und Kriegstüchtigkeit als die einzigen Tugenden des Mannes anerkennt, erklärt sich selbst, als die Sieger — und von ihrem Standpunkt aus ganz mit Recht — als die bessere, tüchtigere „Rasse“: eine Anschauung, die sich verstärken muß in dem Maße, wie die Unterklasse bei harter Arbeit, schmaler Kost und schlechter entwürdigender Behandlung leiblich und seelisch herunterkommt. Hier wurzeln alle Rassentheorien, die immer den ganz gleichen Inhalt haben, ob nun Arier oder Mongolen (Tataren, Türken, Mongolen engeren Sinnes), ob Hamiten oder Semiten die Oberschicht darstellen: von den Hellenen an, die alle anderen Völker des Mittelmeerbeckens, auch die arischen Makedonier, Thraker, Lydier und Phryger, als „Sklaven von Natur“ betrachteten, bis auf die Hellenomanen, Keltomanen, Germanomanen, Panslavisten, Panaraber usw. der Gegenwart [2].
Da nun ferner der Stammesgott der Herrenklasse in der neuen, durch Verschmelzung entstandenen Staatsreligion zum Obergott geworden ist, so erklärt die Herrengruppe — und wieder von ihrem Standpunkt aus ganz mit Recht —, die Klassen- und Staatsordnung für gottgewollt, für „Tabu“. Dazu kommt, daß der Staat, der ja die Funktionen der alten Gemeinschaft übernommen hat, vom Schimmer ihrer „Heiligkeit“ umwittert wird: „Der Staat als die höchste Form der Persönlichkeit, als die höchste Gewalt über alles, als das absolut von dem Individuum Unabhängige und ohne ihn Daseiende, sich notwendig Erzeugende, unwiderstehlich Wirkende, steht da als ein Heiliges und Unantast-
[1] Zit. nach Georg Adler, Die Zukunft der sozialen Frage, S. 49. Es wundert uns, daß die Anhänger der Freudschen „Psychoanalyse“ diese Stelle, die deutlich von „Verdrängungserscheinungen“ spricht, noch nicht herangezogen haben, soweit unsere Kenntnis reicht.
[2] Ein hübsches Beispiel aus unzähligen: „Der Araberstamm der Aulad Soliman hatte sich nach ruhmvoller Vergangenheit in die Wüste zurückziehen müssen und führte dort ein Räuber- und Nomadenleben. Nachtigal versuchte, sie zu überreden, ihr verbrecherisches Leben aufzugeben und zur Seßhaftigkeit überzugehen, und einzelne hatten schon vor ihm dergleichen Vorschläge gemacht, die Mehrzahl aber wollte davon nichts wissen: ,Wir leben freilich, sagten sie, ausschließlich von Unrecht und Sünde, doch auf welche andere Weise könnten wir unsern Lebensunterhalt erwerben, ohne zu arbeiten ? Gearbeitet aber haben unsere Vorfahren nie, und es würde eine Schande und ein Verrat sein, von dieser Sitte der bevorzugten Erdenbewohner abzuweichen. Wozu sind auch diese verdammten Kerâda (Schwarzen) anders auf der Welt, als um für die höherstehenden Menschen zu arbeiten ?' (Ferd. Goldstein, Die soziale Dreistufentheorie, Ztschr. f. Soz. Wiss. X, S. 593·)
[336]
bares. . . . Indem nun aber die ... herrschende Klasse sich mit der Staatsgewalt identifiziert, nimmt dieselbe. . . in ganz natürlicher Weise alsbald jene Idee der Heiligkeit, Unverletzlichkeit, Göttlichkeit des Staates für sich,. . . für ihr gesellschaftliches Recht in Anspruch“ [1]
Durch einfache logische Umkehrung erscheint der Oberklasse auf der anderen Seite die unterworfene Gruppe als solche schlechterer Rasse, als störrisch, tückisch, träge und feige und ganz und gar nicht fähig, sich selbst zu regieren und zu verteidigen: das war, wie Sismondi berichtet [2], und ist wahrscheinlich noch immer, die Ansicht vieler Engländer von den Iren, der deutschen Junker von den Polen; und die berühmte Feldwebelwendung: „Die Leute würden sich ohne uns auffressen“ findet sich in gröberem oder feinerem Wortlaut überall in der Literatur, in Anwendung auf niedere Stände und unterworfene Völker aller Rassen.
Ferner erscheint der Herrenklasse ebenfalls durch einfache Umkehrung jede Auflehnung gegen ihre Herrschaft als Empörung gegen Gott und sein Sittengesetz. Darum steht die Herrengruppe überall in enger Verbindung mit der Priesterschaft, die sich, wenigstens in allen leitenden Stellungen, fast immer aus ihren Söhnen rekrutiert und an allen ihren Rechten und Privilegien ihren Anteil hat. Wir haben einen Fall dieser Verbindung von „erstem und zweitem Stande“ bereits von der Staatsbildung der Makololo mitgeteilt ; weitere Beispiele anzuführen wäre Zeitverschwendung.
Das war und ist noch heute die Klassentheorie der Herrengruppe; es ist kaum ein Zug hinzugekommen, und keiner fortgefallen. Selbst jene sehr moderne Behauptung, mit der der Grundadel z. B. Frankreichs und Ostelbiens die Ansprüche der Landbevölkerung zurückzuweisen versuchte [3], daß ihm das Land von Anfang an gehört habe, während die Ackerknechte es nur von ihm zur Benutzung erhalten hätten, findet sich auch bei den Wahuma [4] und wahrscheinlich noch vielfach anderwärts. Hinzugekommen ist mit der Ausbildung von Künsten und Wissenschaften, an deren Ausgestaltung wenigstens im Anfang die Herrengruppe kaum einen erkennbaren Anteil nimmt, die Vorstellung, daß eine müßige Klasse da sein müsse, die Zeit habe, sich diesen unentbehrlichen Dingen hinzugeben. Die Vorstellung ist bei den Physiokraten bereits vollkommen ausgebildet: für sie ist die „classe noble“ als die „classe disponible“ des Königs, aus der er die Richter und sonstigen Beamten und die Heerführer und Offiziere entnehmen kann, eine unbedingte Voraussetzung des gesunden Staatslebens; diese Vorstellung ist dann
[1] Stein, a. a. O. I, S. 61.
[2] Nouveaux Etudes I, S. 247.
[3] Sie findet sich z. B. bei Vico, a. a. O. S. 259, 263, 403.
[4] Ratzel, Völkerkunde II, S. 178.
[337]
in den Gedankenkreis der Großbourgeoisie übergegangen. Sismondi, der Genfer Patrizier, schreibt, die Reichen hätten zwei Prärogative, deren Vorteile sich der ganzen Gesellschaft bemerkbar machen: „Die eine besteht darin, ihre Muße zur Ausbildung ihres Geistes, die andere darin, ihren Überfluß zur Linderung des Unglücks nutzbar zu machen. Darum sind die Reichen zum Fortschritt jeder Nation notwendig; ohne sie müßte jede Nation schnell in Unwissenheit, Barbarei und Selbstsucht verfallen“ [1]. Die Frage, ob die Existenz des Reichtums nicht etwa irgendwie mit der der Armut und der Unwissenheit zusammenhängt, stellt sich, im Banne der von uns widerlegten Täuschung, nicht einmal dieser ebenso feingebildete wie volksfreundliche Denker. Da wird man sich nicht wundern, wenn Köpfe viel geringeren Ranges, z. B. ein Treitschke, dieselbe Melodie aufspielen, so oft sich die Gelegenheit dazu bietet: „Wir kommen zu der Erkenntnis, daß die Millionen ackern, schmieden und hobeln müssen, damit einige Tausend forschen, malen und dichten können. Das klingt hart, aber es ist wahr und wird in alle Zukunft wahr bleiben“ [2]. Und an anderer Stelle: „Es ist unmöglich, daß jeder Knecht das Amt des Schulzen übernehmen könnte; es werden die eigentlichen Vollbauern sein, denen die Leitung zufällt. Man muß etwas Muße haben, die nur durch einen bescheidenen Besitzstand erworben wird. . . . Gegen diese gegebene soziale Notwendigkeit ist durch Staatsgesetze garnichts auszurichten“ [3]. Die Frage, ob es nicht möglich sei, jedermann einen „bescheidenen Besitzstand“ zu geben, wird selbstverständlich gar nicht erst untersucht.
Aber die alten Glaubenssätze des Legitimismus hat auch das Bürgertum in dem Augenblicke übernommen, wo es aus der Niedrigkeit seiner ursprünglichen Stellung in die herrschende Klasse einrückte. Vor allem die Rassentheorie. Wo ein Unterschied der ethnischen Grundlage bestand oder irgendwie geschichtlich konstruiert werden konnte, da wurde die Lehre in der alten Form vorgetragen, etwa im Verhältnis der Deutschen zu den Polen, der Engländer zu den Iren, der Franzosen zu den Elsässern (têtes carrées), um von wirklichen Verschiedenheiten der leiblichen Rasse ganz zu schweigen, wie sie etwa zwischen Engländern und Hindu oder zwischen Nordamerikanern und Negern oder auch nur zwischen Weißen und Mongolen (Japanern und Chinesen) bestehen. Wo aber von solchem Rassengegensatz im anthropologischen Sinne nichts vorhanden war oder ist, im Verhältnis also zu den Unterklassen der eigenen Volkheit, da erfährt die Rassenlehre eine seltsame Umbiegung. Entweder versucht man, mit allen, nur nicht mit wissen-
[1] Etudes sur l'Economie politique, S. 9/10; vgl. auch S. 174/5, wo die Reichen als die notwendigen Konsumenten des geistigen Reichtums erscheinen.
[2] Politik I, S. 51.
[3] a. a. O. S. 161.
[338]
schaftlichen, Mitteln einen Rassengegensatz dogmatisch aufzubauen, indem man z. B., aus Schädelmessungen die ausschweifendsten Schlüsse zieht, ohne sich im mindesten um das einhellige Votum der Sachverständigen zu kümmern, das schon die Grundlagen, und noch mehr die Schlüsse daraus vöUig verwirft [1]: das ist die „Methode“ der seltsamen Pseudogelehrtenfigur eines Ammon; — oder man verläßt sich „auf das Gefühl der Rasse im eigenen Busen“, d. h. baut sein System auf das trügerischste, was es in aller Soziologie geben kann, auf die eigene, ungeprüfte „persönliche Gleichung“: das ist die „Methode“ mit der uns Houston Stewart Chamberlain beglückt hat; — oder man nimmt schließlich an (z. B. Brooks-Adams) [2], daß aus einer und derselben ethnischen Gruppe sich verschiedene psychologische „Rassen“ herausdifferenzieren, wirtschaftlich Hochbegabte und Schwachbegabte — das ist nichts als die „Kinderfibel“, die aber erst dadurch legitimistisch wird, daß diese Begabungsunterschiede als erblich aufgefaßt werden. In dieser Gestalt hat sie Gustav Schmoller noch vor kurzer Zeit in einem posthum erschienenen Buche „Die soziale Frage“ vorgetragen: ein typischer, aristokratisierter Großbürger, der wenigstens verstanden hatte, was seine Gesinnungsgenossen immer noch nicht verstehen zu wollen scheinen, daß das Gesetz der ursprünglichen Akkumulation der Schlüssel der strategischen Stellung der Bourgeoisie ist ; er versucht, es mit seiner großen Gelehrsamkeit und Darstellerkunst zu halten. Er hat freilich der Theorie und seiner Klasse nur den Bärendienst erwiesen: er hat beide hilfsbereit totgeschlagen [3].
Carl Bücher, Schmollers großer Rivale, hat einmal diese Lehre unter die kritische Lupe genommen. Nachdem er leichthin einige sehr merkwürdige Sätze des sonst sehr gescheiten Riehl zerfetzt hat, fährt er fort : „Mit dem Anspruch streng wissenschaftlicher Beweisführung . . . hat erst G. Schmoller den Gegenstand erörtert und in sehr zuversichtlicher Weise dahin entschieden, die Anpassung der Individuen an verschiedene Tätigkeiten, in erblicher Weise durch Jahrhunderte und Jahrhunderte gesteigert, habe immer individuellere, verschiedenere Menschen erzeugt. Alle höhere Gesellschaftsorganisation beruhe auf fortgesetzter,
[1] Vgl. Eduard Meyer, Geschichte des Altertums, J, 2, S. 77/78.
[2] Das Gesetz der Zivilisation und des Verfalls.
[3] Vgl. S. S. III, S. 210ff. Die Auffassung ist heute noch auch bei den katholischen Theoretikern offiziell. Cathrein schreibt (Zur Charakteristik des Sozialismus, S. 15): „Wo Privateigentum ist, entstehen notwendig verschiedene Klassen: Unternehmer, Angestellte und Arbeiter ... die einen werden reich, die anderen gelangen zu einem mäßigen Wohlstand, wieder andere verarmen, bald mit und bald ohne Schuld. Mit der Verschiedenheit des Besitzes der Volksklassen kommt auch die Abhängigkeit des einen von dem andern“. — Man sieht auch hier die Selbstverständlichkeit, mit der hier die aus der Arbeitsteilung entstehende Schichtung der erblichen Klassenscheidung gleichgestellt wird.
[339]
durch die Arbeitsteilung hervorgerufener Differenzierung“ [1]. Bücher sagt dazu: „Ich könnte glauben, daß man den auffallenden Schlußsatz Schmollers unbedenklich umkehren und sagen kann : die Verschiedenheit des Besitzes und Einkommens ist nicht die Folge der Arbeitsteilung, sondern ihre Hauptursache. Für die Vergangenheit, soweit sie unseren Augen offen liegt, läßt sich das mit vollkommener Sicherheit dartun. Die ungleiche Größe und Besitzweise des Grundeigentums bildet bei den alten Griechen und Römern und auch bei unserem Volke vom frühen Mittelalter an die Grundlage der Ständegliederung. Der Adel, der Bauernstand, der Stand der Hörigen sind zunächst bloße Besitzstände und werden erst mit der Zeit zu einer Art von Berufsständen (333). ... So haben die großen Züge unserer sozialen Berufsgliederung sich historisch aus der verschiedenen Verteilung des Eigentums entwickelt, und sie ruhen fortgesetzt auf dieser Grundlage, die durch unsere heutige Wirtschaftsorganisation immer mehr befestigt wird. ... So weit unsere Besitzklassen auch soziale Berufsklassen sind, sind sie es nicht deshalb, weil der Beruf Besitz schafft, sondern vielmehr deshalb, weil der Besitz die Berufswahl bedingt, und weil in der Regel das Einkommen, das der Beruf abwirft, sich in ähnlicher Weise abstuft, wie der Besitz, auf welchem der Beruf sich gründet“ (336). Und er widerlegt Schmoller durch ein schlagendes geschichtliches Beispiel: „Auf dem Gebiet des zünftigen Handwerks unserer Städte haben sich infolge der engherzigen Abschließung der einzelnen Gewerbe vom XVI. bis zum XVIII. Jahrhundert die Meisterstellen tatsächlich mit verschwindenden Ausnahmen vom Vater auf den Sohn vererbt. Die Technik hat sich dadurch nicht nur nicht verbessert, sondern sie ist kläglich zurückgegangen und verkümmert (339/40). . . . Jene Vererbungstheorie trägt darum, ihrem Urheber gewiß ganz unbewußt, die unerfreulichen Gesichtszüge einer sozialen Philosophie der beati possidentes“ (346) : „A mill-owners philosophy“, sagt einmal Beard, „eine Fabrikbesitzerweisheit“. In seinen jungen Jahren stand Schmoller der von uns mit Carl Bücher vorgetragenen Auffassung bedeutend näher und wurde dafür von Treitschke gehörig gerüffelt [2], der nichts von einer „gleichsam tragischen Schuld“ wissen wollte, sondern hegeltreu behauptete: „Daß der Starke den Schwachen bezwingt, ist die Vernunft jenes frühen Lebensalters der Menschheit. Wo immer uns in helleren Jahrhunderten ein Daseinskampf der Völker entgegentritt... überall waltet dasselbe sittliche Gesetz: Das Gemeine soll dem Edlen dienen, das Veraltete dem Jugendlichen“ [3].
[1] Entstehung der Volkswirtschaft, S. 331.
[2] Meinecke, Staatsräson, S. 505.
[3] Wie naiv Treitschke die Dinge ansah, läßt sich sehr gut an folgender Auslassung (Politik I, S. 299) erkennen: „Wenn man die Geschichte des deutschen Adels betrachtet, so sieht man, daß er zu allen Zeiten sehr reich war an bedeutenden Männern. Wieviele Feldherrn und Staatsmänner in langer Reihe aus ihm hervorgegangen sind, ist bekannt“. Das ist allerdings eine sehr auffällige Tatsache, wenn man bedenkt, daß bis vor kürzester Zeit in Deutschland kaum jemand anders zu den Funktionen als Offizier oder Staatsmann zugelassen wurde als die Angehörigen des Adels I Und daß die wenigen Nichtadligen, die dazu gelangten, fast ausnahmslos in den Adelsstand eintraten! — Eine andere Auslassung von gleicher Tiefe (ib. S. 274): „Der Mulatte ist ein Neger mit hellerer Hautfarbe, im übrigen aber ganz ein Nigger, er fühlt das auch und hält sich zu den Niggers. Das gleiche gilt von den Mestizen“. Auch diese Tatsache ist überaus verwunderlich, wenn man bedenkt, daß die Weißen in der Regel Mulatten und Mestizen auf das strengste aus ihren geselligen Kreisen ausschließen!
[340]
Was an dieser großbürgerlich-legitimistischen Theorie allenfalls richtig ist, ist, daß man durch kapitalistische Mißhandlung auch eine von Natur edle Menschenrasse körperlich und seelisch allmählich so weit herunterbringen kann, daß die Mitglieder der Unterklasse aussehen, als gehörten sie einer anderen „Rasse“ an. Ich habe an anderer Stelle darauf hingewiesen, daß unsere ostelbischen Bauern und Landarbeiter Vettern zweiten oder dritten Grades sind, Abkömmlinge derselben Großväter oder Urgroßväter, die noch die Befreiung der Leibeigenen erlebten. Es war fast nur Zufall, wer damals Bauer wurde, und wer Arbeiter blieb: und heute haben wir zwei ganz verschiedene „Rassen“ vor uns; der Bauer ist auch körperlich ungleich stärker und gewandter und seelisch ein freier stolzer Mann, während man dem Landarbeiter nicht ganz mit Unrecht viele Untugenden nachsagt. Und was die körperliche Kraft anlangt, so hören unsere Agrarier nicht gern von der Mitteilung des preußischen Statistischen Jahrbuchs von 1908, derzufolge die Bauernschaft 184, die Landarbeiterschaft aber nur etwa 75 % ihres Soll an vollkommen brauchbaren Rekruten ins Heer lieferten.
Das bringt schon der landwirtschaftliche Kapitalismus fertig [1]. Da kann es nicht wundernehmen, daß der industrielle Kapitalismus die edelsten Bevölkerungen in körperliche und moralische Krüppel verwandelt hat.
Was uns Carl Bücher als für die wichtigsten geschichtlichen Völker gültig dargestellt hat, das gilt auch für die Geschichtslosen: „Bei allen Völkern, die später zum Kapitalismus aufgestiegen sind, war die Berufsgliederung nicht die Ursache, sondern die Folge der Klassenbildung. Zuerst entstand durch kriegerische Unterwerfung die soziale Differenzierung in Herren und Knechte, und unter den letzteren bildete sich dann die wirtschaftliche Differenzierung in die
[1] Marx berichtet aus der durch die „Clearings of estates“ (S. S. III, S. 522/3) berüchtigten Grafschaft Sutherland in Schottland, nach einer neuerlichen Untersuchung, „daß hier in Distrikten, einst so berühmt wegen schöner Männer und tapferer Soldaten, die Einwohner degeneriert sind zu einer mageren und verkümmerten Rasse. In den gesundesten Lagen, auf Hügelabhängen im Angesicht des Meeres, sind die Gesichter ihrer Kinder so dünn und blaß, wie sie nur in der faulen Atmosphäre einer Londoner Winkelgasse sein können“ (Kapital I, S. 232).
[341]
verschiedenen Gewerbe aus; die ersten, die ein Gewerbe ausübten, waren Unfreie, die dazu von ihren Herren gezwungen wurden, und auch die ersten freien Gewerbtreibenden waren Besitzlose, Krüppel [1], Fremdlinge. ... So war also schon im ersten Anfang die Klassenbildung das primäre, die Berufsgliederung das sekundäre Moment“ [2].
B. Junkerpsychologie.
Wie die Klassentheorie, so ist auch die Psychologie der Oberklasse überall die gleiche. Der wichtigste Zug ist der „Junkerstolz“: die tiefe Verachtung der Arbeit und der arbeitenden Unterschicht. Sie sitzt so tief im Blute, daß die Hirten sogar dann, wenn sie nach dem Verlust ihrer Herden in äußerste Armut, ja sogar in wirtschaftliche Abhängigkeit geraten sind, ihren Herrenstolz bewahren. Wir haben soeben von den Aulad Soliman einen solchen sehr kennzeichnenden Fall berichtet; einen anderen ebenso charakteristischen teilt Ratzel mit: „Selbst die Galla, die nördlich vom Tana durch die Somal ihres Herdenreichtums beraubt und dadurch zu Hirten fremder Herden, am Sabaki selbst zu Ackerbauern wurden, sehen mit Verachtung auf die ihnen unterworfenen suaheliähnlichen, ackerbauenden Wapokomo herab, weniger auf die gallaähnlichen und den Galla tributären Jägervölker der Waboni usw.“ [3]. Die Prinzen und Junker der Marotse verachten die Handarbeit ebenso [4]. Und die folgende Schilderung derTibbu paßt wie angegossen auf Gauthier Sans-avoir und die anderen armen Ritter, die in den Kreuzzügen und Albigenserkriegen Beute und Herrenland suchten; und nicht minder auf so manchen adligen Schnapphahn des deutschen Ostens und so manchen verlumpten Schlachzizen und Hidalgo: „Es sind Menschen voll Selbstgefühl. Sie mögen Bettler sein, aber sie sind keine Paria. Viele Völker wären unter diesen Umständen elender und gedrückter; die Tibbu haben Stahl in ihrer Natur. Sie sind zu Räubern wie zu Kriegern und Herrschern trefflich geeignet. Imponierend ist bei aller schakalhaften Gemeinheit selbst ihr Raubsystem. Diese verlumpten, mit äußerster Armut und beständigem Hunger kämpfenden Tibbu erheben die unverschämtesten Ansprüche in scheinbarem oder wirklichem Glauben an ihr Recht. Das Schakalsrecht, das die Habe des Fremdlings als gemeines Gut betrachtet, ist Schutz gieriger Menschen vor Entbehrung. Die Unsicherheit eines fast beständigen Kriegszustandes kommt hinzu, um dem Leben etwas Forderndes und sogleich
[1] Man bedenke, daß Schmied Wieland und Hephaistos lahm waren!
[2] Müller-Lyer, Phasen der Kultur, S. 218/9.
[3] Völkerkunde II, S. 198.
[4] Richter, Die Marotse, S. 42.
[342]
auf Erfüllung Dringendes zu geben“ [1]. Man mag nur die beiden folgenden Schilderungen zusammenhalten, von denen sich die eine auf den hamitisch-vernegerten Abessynier, die andere auf den nordgermanisch- keltischen Engländer bezieht, um zu sehen, wie gleichmäßig sich unter gleichen Umständen Stimmung und Haltung gestalten: „So ausstaffiert kommt er daher. Stolz blickt er auf jeden nieder: ihm gehört das Land, für ihn muß der Bauer arbeiten“ [2]. „Die Bauern wissen genau, daß einer, der im faulen Genußleben aufgewachsen ist, nichts anderes gewohnt ist, als einherzustolzieren mit Schwert und Schild, auf seine Umgebung herabzublicken, umnebelt von Eitelkeit, und alle Menschen im Vergleich mit der eigenen werten Person zu verachten“ [3].
So tief der Junker überall das ökonomische Mittel und seine Träger, den Bauern und den Städter, verachtet, so naiv bekennt er sich dort, wo er noch die Oberhand hat, zum politischen Mittel. Ehrlicher Krieg und „ehrlicher“ Raub sind seine Herrengewerbe, sind sein gutes Recht. Und dieses Recht reicht — selbstverständlich außerhalb seines Friedenskreises — genau so weit wie seine Macht. Nirgend wohl findet sich eine so kennzeichnende Lobpreisung des politischen Mittels wie in dem bekannten Dorischen Tischliede:
„Ich habe große Schätze, den Speer, dazu das Schwert,
Dazu den Schirm des Leibes, den Stierschild altbewährt.
Mit ihnen kann ich pflügen, die Ernte fahren ein.
Mit ihnen kann ich keltern den süßen Traubenwein,
Durch sie trag' ich den Namen „Herr“ bei den Knechten mein.
Die aber nimmer wagen, zu führen Speer und Schwert,
Auch nicht den Schirm des Leibes, den Stierschild altbewährt,
Die liegen mir zu Füßen am Boden hingestreckt,
[1] Ratzel, Völkerkunde II, S. 486. Ein anderes Beispiel sind die Turkmenen. Sie „sind nicht ein seit alters geknechtetes Volk, sondern dank ihres natürlichen Wohnsitzes und ihres kriegerischen Sinnes seit jeher ein zügelloses Herrenvolk. Maßloser Stolz und ein starkes Unabhängigkeitsbedürfnis sind eine weitere Folge hiervon. Auch der Turkmene ist ursprünglich sehr ehrlich. Er achtet vor allem auch fremdes Geld, mit dem er arbeitet. Sein Wort ist ihm unbedingt heilig. . . . Einen besonderen Einfluß auf die wirtschaftliche Betätigung übt der große Stolz des Turkmenen. Er verhindert z. B. diesen, Tagelöhnerarbeit oder auch Fabrikarbeit irgend welcher Art zu übernehmen“ (R. Junge, a. a. O. S. 100). Auf S. 104 führt er „den in Europa immer wieder kritiklos und bequem weiter vererbten Irrtum, welcher alle Türkstämme und türkischen Einschläge für dauernd wirtschaftlich untauglich erklärt“, mit Recht darauf zurück, daß man immer nur die türkischen Herrenschichten ins Auge gefaßt habe, die freilich unerziehbar seien.
[2] Ratzel, a. a. O. S. 453.
[3] Morus, a. a. O. S. 15. Hewlitt hat den Typus köstlich in seinem „Bronzehead“ gezeichnet.
[343]
Von ihnen, wie von Hunden, wird mir die Hand geleckt;
Ich bin ihr Perserkönig, — der stolze Name schreckt“ [1].
Wahrlich, die Herrschaft ist den Herren Pflug und Kelter! Hier ist das politische Mittel noch ehrlich unverschleiert, so unverschleiert, wie wir es auch bei dem Moslem Ibn Chaldûn antrafen. Man sprach es fröhlich aus, daß, um mit John Rae [2] zu sprechen, „acquisition“ nicht „creation“, oder, mit Bastiat, Spoliation nicht Production, oder, mit Lester Ward [3], „getting“ nicht „producing wealth“ ist. Man brauchte noch nicht „Rosen auf den Molch zu streuen“, bedurfte noch nicht des gräßlichen Cant, der heute alles vergiftet. Nur gelegentlich deckt ein großer Menschenverächter die Lüge auf; Hobbes schreibt: „Zwar können die Annehmlichkeiten dieses Lebens durch gegenseitige Hilfe vermehrt werden, allein dies kann viel besser durch Herrschaft über andere als durch Verbindung mit ihnen erreicht werden“ [4]. Und Schopenhauer sagt grimmig: „Reines Nichtstun und Leben durch die Kräfte Anderer, bei ererbtem Eigentum, kann doch schon als moralisch ungerecht angesehen werden, wenn es auch nach positiven Gesetzen recht bleiben muß“ [5].
Bei den Doriern handelte es sich wenigstens noch um legitimierte, zur gesetzlichen Macht gewordene Gewalt. Das Christentum war nicht einmal stark genug, um die Verherrlichung der puren Gewalt, des Raubes, in unserer Terminologie also des unentfalteten politischen Mittels, geschweige denn seine Anwendung zu verhindern. Das beweisen die folgenden Verse aus dem deutschen Mittelalter:
Wiltu dich erneren,
du junger Edelmann,
folg du miner 1ere,
sitz uf, drab zum ban!
halt dich zu dem grünen wald,
wan der bur ins holz fert,
so renn in freislich an!
derwüsch in bi dem kragen,
erfreuw das herze din,
[1] Kopp, Griech. Staatsaltertümer, 2. Aufl., S. 23.
[2] Zitiert nach Böhm-Bawerk, Gesch. d. Kapitalzinstheorien, 3. Aufl., S. 381.
[3] Dynamic Sociology, S. 497 ff.
[4] De cive I, § 2. Izoulet (a. a. O. S. 479) schreibt: „Die meisten Menschen bewahren unter der Herrschaft der volkswirtschaftlichen Arbeitsteilung die atavistischen Instinkte und die geheimen Maximen des „antagonisme pour la prédation“.“ Vgl. auch Daire: Physiocrates II, S. 742 über den Gegensatz zwischen der politique usurpatrice et économique.
[5] Welt als Wille, S. 439.
[344]
nimm im was er habe,
span uss die pferdelin sin [1].
Sombart, der die Verse anführt [2], hat den Schluß fortgelassen; — wie uns scheint, weil er ihm doch allzuwenig in das Bild des „Helden“ paßte, den er dem „Händler“ echt großbürgerlich so weit vorzieht. Er lautet:
„bis frisch und unverzagt,
wann er nummer Pfennig hat,
so riß im d' gurgele ab“ [3].
Der Straßenräuber, der in seiner Enttäuschung das Opfer abschlachtet, der hat denn doch allzuviel vom „Händler“. Übrigens ist der von Sombart konstruierte Gegensatz kaum geschichtlich begründet. „Krieg, Handel und Piraterie, dreieinig sind sie, nicht zu trennen“. Die nordischen Recken kamen auf den Markt von Nowgorod und anderen Handelsplätzen, boten und nahmen Frieden und trieben ehrlichen Handel. Dann zogen sie ab, kündeten den Frieden auf und trieben ebenso ehrlichen Raub. Und die Seehelden waren immer auch Händler, wie wir an den merchant adventurers sehen können.
Sombart fährt fort: „Wenn er es nicht vorzog, auf edleres Wild zu pirschen und den Pfeffersäcken ihre Ladungen abzujagen. Der Raub bildete immer mehr die selbstverständliche Erwerbsart des vornehmen Mannes, dessen Renten allein nicht ausreichten, um den wachsenden Anforderungen an täglichem Aufwand und Luxus zu genügen. Das Freibeutertum galt als durchaus ehrenhafte Beschäftigung, weil es dem Geiste des Rittertums entsprach, daß jedermann das an sich bringe, was der Spitze seines Speeres und der Schärfe seines Schwertes erreichbar war. Bekannt ist, daß der Edle Raubritterei lernte, wie der Schuster die Schusterei. Und im Liede heißt es lustig:
„Ruten, rover, det en is gheyn schände
dat doynt die besten van dem lande“.
Wie immer, wenn es gilt, gegen jemanden das politische Mittel anzuwenden, tritt die Rechtfertigung vor sich selbst ein, indem man den zu Beraubenden als einen Ausbund von Häßlichkeit und Niederträchtigkeit darstellt. Wir bringen charakteristische Belege aus drei ganz verschiedenen Kulturkreisen :
v. Pohlmann berichtet [4] über den „Ritterspiegel adeliger Sitte“, wie man die Dichtung desTheognis von Megara genannt hat, in der dieser
[1] Unland, Alte hoch- und niederdeutsche Volkslieder, I (1844), S. 339.
[2] Der moderne Kapitalismus, Leipzig 1902, S. 384/5.
[3] Uhland, Volkslieder, 2. Aufl. S. 256.
[4] Geschichte der sozialen Frage und des Sozialismus in der antiken Welt, 2.Au£l,, I, S. 175 ff.
[345]
„Herrenmoral in einer Weise Ausdruck verliehen ist, welche die scheue Furcht der Unterdrückten nur zu begreiflich erscheinen läßt“. Er ruft seine Standesgenossen an: „Tritt das törichte Volk mit der Ferse nieder, schlage es mit scharfem Stachel und lege ihm das Joch fest auf den widerspenstigen Nacken“, den „Gemeinen, den Memmen, den Schuften“, dem „dummen Volk“. „Voll Schmerz gedenkt er der Zeit, wo die Gemeinen „Gesetz und Recht nicht kannten“, wo die Leute mit dem Ziegenfell um die Schultern, die jetzt so zu Ehren gekommen, „noch draußen vor dem Tore wie Hirsche weideten“. Und jedenfalls war den Herrschenden ganz aus der Seele gesprochen der naive Wunsch des adeligen Sängers: „Es wäre gut, wenn alle Edlen Reichtum besäßen, dem gemeinen Manne ziemt es, sich in Armut zu mühen“. Ebenso dachte und dichtete Alkaios.
Ganz erstaunlich nahe steht diese Auffassung der eines anderen berühmten Minnesängers, des durch Uhland gepriesenen Bertran de Born [1]. Sein Lied „Mout mi platz“, das wir im Auszuge bringen, hat folgenden Inhalt :
„Ich freue mich, wenn ich die nichtsnutzigen Reichen [2] leiden sehe; denn aus dem stolzen Stande entsteht Streitsucht. Und es freut mich, wenn ich täglich 20 oder 30 zugrunde richten sehe und sie nackt und ohne Kleider finde . . . und wenn ich 'lüge, so soll meine Geliebte mir untreu werden.
„Der Bauer hat die Gewohnheit eines Schweines, denn er ärgert sich über feinere Lebensweise. Und wenn er zu großem Reichtum kommt, läßt ihn dessen Besitz allerlei Tollheiten machen, deshalb soll man ihm den Freßtrog jederzeit leer halten und ihn zwingen, sein Geld auszugeben und ihn Wind und Wetter aussetzen.
„Wenn einer seinen Bauern nicht tüchtig herrichtet, bestärkt er ihn in Ungesetzlichkeit . . . denn der Bauer, wenn er sich festsetzt und an sicherem Orte einschließt [3], hat an Schlechtigkeit nicht seinesgleichen; denn alles, was er erreicht, zerstört er.
„Einen Bauern soll man ja nicht bedauern, wenn man ihn Arme und Beine brechen, oder ihn an etwas Mangel leiden sieht; denn ein Bauer, so wahr mir Gott beistehe, will den, der ihn am nächsten angehen sollte, trotz dessen Wehklagens und Jammerns nicht von seiner Habe unterstützen. . . .
[1] Wenigstens wird ihm das Gedicht zugeschrieben, das in der Handschrift C (Ausgabe von A. Summing, kleine Ausgabe, 2. Auflage, Halle 1913, S. 145/146) abgedruckt ist. Nach mir gewordener sachverständiger Auskunft dürfte es eher dem Guilhem Magret zuzuschreiben sein.
[2] Aus dem Zusammenhang geht hervor, daß er nur an die Bauern denkt.
[3] Das geht wahrscheinlich auf die Bauern, die in den Städten des Frankenreichs, namentlich den geistlichen Städten, Schutz fanden und zu Wohlstand kamen. Vgl. Thierry: Geschichte des 3. Standes, S. 12/13. Wir kommen darauf zurück.
[346]
„Treuloses Bauernvolk voll Trug, Wucher, Hochmut und Überhebung! Seine Taten kann man nicht ausstehen, denn sie kümmern sich weder um Gott noch um Recht und Gesetz. Sie wollen es dem Adam nachmachen, Gott gebe ihnen Unglück!“
Aus dem gleichen Kulturkreis erklingt viel später fast das gleiche Wort, wie das, was wir soeben aus dem Theognis angeführt haben : Il faut museler la bête“: „Man muß der Bestie den Maulkorb anlegen“.
Der Züricher Chorherr Felix Hemmerlin steht drei Jahrhunderte später auf ganz demselben Standpunkt [1]: „Nicht wie ein Mensch, sondern wie ein scheußliches, halb lächerliches, halb furchtbares Gespenst tritt der Bauer dem Adel entgegen. Ein Mensch mit bergartig gekrümmtem und gebuckeltem Rücken [2], mit schmutzigem, verzogenem Antlitz, tölpisch dreinschauend wie ein Esel, die Stirn von Runzeln durchfurcht, mit struppigem Bart, graubuschigem, verfilztem Haar, Triefaugen unter den borstigen Brauen, mit einem mächtigen Kropf; sein unförmlicher, rauher, grindiger, dicht behaarter Leib ruht auf ungefügen Gliedern; die spärliche und unreinliche Kleidung läßt seine mißfarbige und tierisch-zottige Brust unbedeckt“. Und dieser Bauer, heißt es weiter, wolle noch hochmütig sein : darum möchte es ganz gut sein, wenn ihm alle fünfzig Jahre Haus und Hof zerstört würden, wodurch die üppigen Zweige seines ' Hochmuts beschnitten würden. Und so stellt Hemmerlin schließlich mit unglaublicher Schamlosigkeit die Maxime auf: rustica gens optima flens, — pessima gaudens.
Und noch ein anderes Beispiel:
Sismondi berichtet in seinem köstlichen ersten Essai in den „Neuen Studien“, daß die „neugebackenen Edelleute von ihren Wappenschildern die Schmach der Arbeit abzuwaschen und zu beweisen hatten, daß sie dazu geboren seien, den Reichtum nicht zu schaffen, sondern zu zerstören“ ... (S. 52). „Dem Edelmann bedeutete es viel weniger eine Schande, zu betteln“ — namentlich bei dem Roi Soleil — „und vor allem zu stehlen, als durch Arbeit seinen Unterhalt zu verdienen“ (50). „Die Komödien und Romane aus der Zeit Ludwigs
XV. und XVI. zeigen uns den armen Edelmann, der auf die Gunst des Königs, auf das Spiel, zuweilen auf Diebstahl und Betrug, aber niemals auf die Arbeit zählt,
[1] Adler, Geschichte des Sozialismus, S. 90.
[2] Dieser Hohn ist um so gehässiger, weil hier das menschliche Arbeitstier geschildert wird, das nur durch die Schuld der Herrenklasse selbst, in einzelnen schlimmen Exemplaren zu derartiger Abweichung vom Ebenbilde Gottes herunter entartet ist. Ganz ähnlich warfen die Sklavenhalter der Südstaaten den Negern vor, von Natur plattfüßig zu sein: „The hollow of the foot makes a hollow in the ground“. Aber der freie Neger hat, wie alle barfuß gehenden Völker, herrliche Füße, und der Plantagenneger ist zu seinen Plattfüßen nur gelangt, weil man ihn schon vor der vollen Ausbildung seines Skeletts im sumpfigen Boden der Plantagen schwere Lasten schleppen ließ.
[347]
die er als Schmach von sich weist“ (53) — gerade wie die Aulad Soliman und die Tibbu. Auch heute noch wird der verarmte Edelmann, wenn es ihm nicht gelingt, sein Wappenschild mit der Mitgift einer Händlertochter „heldenhaft“ zu vergolden, viel eher selbst Händler in Gestalt eines Wein- oder Zigarrenagenten, als daß er körperliche Arbeit leistete. Wenn die letzte Not aber auch diesen „Stahl“ bricht, dann erscheinen die lustigsten Finten, um das adlige Gesicht zu wahren. Nach Sismondi durften Edelleute ihr eigenes Feld pflügen, wenn sie den Degen auf den Pflug legten, und durften Glasbläser werden, „weil sie als solche nicht von ihrer Hände, sondern von ihrer Lunge Arbeit lebten“: die gentilshommes verriers. Simmel berichtet aus dem Spanien der Neuzeit : „Ein verarmter Adliger, der in einem großen Hause Koch oder Lakai wurde, verlor damit seinen Adel nicht definitiv . . . war er aber Handwerker geworden, so war sein Adel vernichtet“ [1]. Casanova erzählt in seinen Memoiren von einem spanischen Edelmann in Madrid, der sich von der Flickschusterei ernährte. Das zählte nicht als „Handwerk“ : als Neuschuster hätte er seinen Adel verloren.
Das ist also der Hauptzug dieser Klassenpsychologie : die Verachtung der Arbeit und die Hingabe an das politische Mittel in jeder seiner Gestalten. Ein zweiter, kaum weniger charakteristischer Zug ist die überzeugte oder doch wenigstens nach außen hin stark betonte Frömmigkeit, die allerdings zuweilen seltsame Züge annimmt; so, wenn der ostdeutsche Adel sich auch aus dem Grunde dem Pietismus zuwendet, weil dieser die Familienfeiern im Haus begeht, und damit der „disrepu- tierlichen“ Sitte ein Ende gemacht wird, daß ein „adlich kind“, das Kind des Kirchenpatrons, mit demselben Wasser getauft werde, „mit dem auch gemeine Kinder getauft sein“ [2].
Überall ist die Oberklasse der geschworene Verbündete der offiziellen Religion, deren höhere Priesterstellen, wie gesagt, fast immer durch ihre jüngeren Söhne besetzt werden. Dem protestantischen Adel hat lange der Pfarrer, selbst wenn er aus nichtadligem Hause war, als konnubialfähig gegolten. Regelmäßiger Kirchenbesuch gehört noch heute zu den Ehrenpflichten des Landadels in vielen Ländern, namentlich in^dem ja noch ganz aristokratisch gestimmten England.
Hierbei ist soziologisch bemerkenswert, daß noch immer, wie in grauester Vorzeit, Gott den Mitgliedern der Herrenklasse als ihr besonderer Stammes- und Klassengott erscheint: als Kriegsgott und als Schirmherr der „gottgewollten Abhängigkeiten“ d. h. der Klassenordnung. Nach wie vor erscheint ihr jede Auflehnung gegen diese Ord-
[1] Soziologie, S. 197. Vgl. auch über die Junkerpsychologie der südstaatlichen Plantagenbesitzer bei v. Halle, Baumwollproduktion usw. S. 29ff., S. 225 ft.
[2] Nach Toennies, Die Sitte, S. 84/5. Vgl. S. S. I, S. 5 Anm. 1.
[348]
nung als schwerer Frevel: daher die Wut und Giftigkeit der Klassenkämpfe, wo der alte Grundadel noch um seine Prärogative zu ringen hat [1].
Nennen wir noch, um das Bild der Herrenpsychologie zu vollenden, die Neigung zur Verschwendung, die sich oft edler als Freigebigkeit darstellen kann: leicht verständlich bei dem, der „nicht weiß, wie die Arbeit schmeckt“, und als schönsten Zug die todverachtende Tapferkeit, mitgebracht aus der Kriegerzeit, wach erhalten durch den der Minderheit obliegenden Zwang, ihre Rechte jeden Augenblick mit der Waffe zu verteidigen, und begünstigt durch die Befreiung von aller Arbeit, die es gestattet, den Körper in Jagd, Sport und Fehde auszubilden. Ihr Zerrbild ist die Rauflust und die bis zur Verrücktheit gehende Überspitzung des persönlichen Ehrgefühls, in Japan nicht weniger als in Mittel- und Westeuropa.
Eine geschichtliche Nutzanwendung : Cäsar fand die Kelten Galliens gerade in dem Stadium der Entwicklung (die wir sofort näher schildern werden), wo das Junkertum über den freien Bauern emporwächst. Seitdem gilt seine klassische Schilderung dieser Klassenpsychologie alsRassen- psychologie des Keltentums : selbst ein Mommsen ließ sich fangen — und seitdem geht der handgreifliche Irrtum unzerstörbar durch alle Bücher über Weltgeschichte und Soziologie, obwohl ein einziger Blick genügen sollte, um zu zeigen, daß alle Völker aller Rassen in dem entsprechenden Stadium ihrer Entwicklung ganz den gleichen Charakter zeigten: in Europa z. B. Thessaler, Apulier, Campaner, Deutsche, Polen, Schweden, während die Kelten und speziell die Franzosen auf anderen Stufen der Entwicklung ganz andere Charakterzüge aufweisen. „Stufenpsychologie, nicht Rassenpsychologie“, sagt Kurt Breysig irgendwo. Man wird einwenden, daß die Franzosen noch heute den scharfen, treffenden Witz, die „argutiae“, besitzen, die ihnen Cäsar nachrühmte; richtig: aber hier handelt es sich bestimmt um einen jener Züge eines Nationalcharakters, die zu dem Idealbilde gehören, das sich jede hochorganisierte Gruppe von sich selbst macht und durch Tradition einprägt. In Frankreich wird diese Art von Witz als „echt gallisch“ geradezu gezüchtet, während sie z. B. in England durch die Erziehung eher ausgejätet wird. Die dazu erforderliche geistige Einstellung läßt sich sehr leicht durch Domestikation anerziehen [2].
[1] Darauf macht z. B. Mommsen in seinen Kapiteln über die römische Revolutionsperiode ausdrücklich aufmerksam.
[2] Grote (Geschichte Griechenlands, S. 609) schildert die thessalische Ritterschaft als stolz, unordentlich, heftig, begierig nach bewaffnetem Feudalismus, treulos bezüglich ihrer Verpflichtungen, dennoch zugleich edelmütig in ihrer Gastfreundschaft und den Freuden der Tafel höchst ergeben. Die thessalischen Städte bieten ein Bild der äußersten unruhigen Oligarchie dar, gelegentlich durch einen Mann von größerer Kraft niedergetreten, aber wenig durch jenen Sinn politischer Gemeinschaft und Ehrfurcht vor den bestehenden Gesetzen gemäßigt, den man unter den besseren Städten von Hellas fand.
[349]
b) Die Unterklasse.
Von der Gruppentheorie der Unterklasse haben wir bereits das Wichtige gesagt. Überall, wo sie zu eigenem Gruppen- oder Klassenbewußtsein erwacht, weil die die Klassenordnung heiligenden religiösen Imperative schwach werden, namentlich also dort, wo zwischen dem Staat und der Kirche Konflikte ausbrechen, entsteht heller oder dunkler die Vorstellung des „natürlichen Rechtes“, vor dessen Tribunal jene Ordnung nicht bestehen kann. Wir können dem dorischenTischliede als ebenso kennzeichnendes Gegenstück einen altfranzösischen Vers zur Seite stellen, der die Empfindungen der von ihrem Königtum unterstützten Bauern [1] des XIII. Jahrhunderts wiedergibt:
„Nus sûmes homes cum il sunt,
Tex membres avum cum il unt, "
Et altresì granz cors avum,
Et altretant sofrir poüm;
Ne nus faut fors euer sulement“ [2].
„Wir sind Menschen wie sie“: die Unterklasse hält den Rassen- und Adelsstolz für eine Anmaßung, sich selbst für mindestens ebenso guten Blutes und guter Rasse, und wieder von ihrem Standpunkt aus mit vollem Recht, weil ihr ja immer gepredigt wird, daß Fleiß, Geduld und Ordnung hohe und Gott ganz besonders wohlgefällige Tugenden darstellen.
Um auch hier aus einem ganz anderen Kulturkreise ein weiteres Beispiel anzuführen, so hat vor dem Lollharden-Aufstand in England John Bull, der tolle Priester von Kent, wie ihn der höfische Chronist Froisard nennt, gedichtet: „Als Adam grub und Eva spann Wer war denn da ein Edelmann“. In einer seiner Reden heißt es: „Warum halten sie uns in Knecht-
[1] In der Ordonnance Philipp des Schönen von 1311 heißt es: „Attendu que toute créature humaine qui est formée à l'image de Notre-Seigneur, doit généralement être franche par droit naturel, et, en aucuns pays, de cette naturelle liberté et franchise par le joug de la servitude qui tant est haineuse soit effacée“. Zit. n. Thierry, Essai sur l'histoire du Tiers Etat, S. 29.
[2] Wace, Roman de Rou, zit. bei Thierry, a. a. O. S. 22. „Wir sind Menschen wie sie sind, haben dieselben Glieder wie sie und dieselben großen Körper und können ebensoviel wagen; nichts fehlt uns, als das Herz“, nämlich der Entschluß, das Joch abzuwerfen. Daß dieser Mut nicht ohne weiteres aufgebracht wurde, wird den Rassengläubigen bereits als ein Beweis ihrer Anschauung gelten. Aber diese Psychologie ist allen unterdrückten Wesen eigen. Alverdes berichtet a. a. O., S. 85: „Die sich gegen ihre Despotin auflehnende Henne führt den Kampf vielfach schlaffer, als sie sonst zu kämpfen pflegt ; sie ist also beim Angriff gegen ihre Despotin psychisch gehemmt“.
[3SO]
schaff, wir stammen doch alle von denselben Eltern ab, von Adam und Eva! Womit wollen die Herren beweisen, daß sie besser sind als wir? Etwa damit, daß wir erarbeiten und produzieren, was sie genießen?“ [1].
Anderthalb Jahrhunderte später lehrten die Bauernführer in Deutschland, daß alle Christen, weil sämtlich Kinder eines Vaters und mit Jesu Blute gleichmäßig erlöst, gleich seien.
Aus diesen Auffassungen ergab sich die politische Einstellung von selbst. Wenn die herrschende Minderheit auf dem Standpunkt steht, dem Sapieha in Schillers „Demetrius“ in den Worten Ausdruck gibt: „Was ist die Mehrheit, Mehrheit ist der Unsinn, Verstand ist stets bei Wenigen nur gewesen“, oder Fr. Jul. Stahl in dem Lakonismus : „Autorität, nicht Majorität“, so schwört die beherrschte Mehrheit auf die volonté générale und das allgemeine Stimmrecht. Wir haben in diesem Bande der politischen Klassentheorie des großen wie des kleinen Bürgertums die ausführlichste Darlegung gegönnt und in den anderen Bänden dieses Systems namentlich den ökonomischen Klassenlehren sowohl des Bürgertums wie des Proletariats die gleiche Aufmerksamkeit zugewendet, so daß es uns erlaubt ist, hier darauf zu verweisen [2].
Die Unterklasse, die die Staatskirche mit ihren Gegnern in festem Bündnis sieht, ist ferner sehr oft skeptisch gegenüber der offiziellen Religion und zu allen möglichen Sektenbildungen geneigt. Wie das Christentum in seiner ursprünglichen Gestalt eine Religion der kleinen Leute war, „der wandernden Handwerksburschen“ [3], so kommen ihm auch heute noch in den Kolonien die armen Klassen am willigsten entgegen. Richter erzählt, daß anfangs nur die Sklaven und Frauen der Marotse dem Missionar Coillard leicht folgten [4], und überall in Europa, wo der dritte und dann der vierte Stand zu eigenem Klassenbewußtsein gelangten, kam es zu religiösen Absonderungen: zu den reformatorischen Bewegungen des XVI. Jahrhunderts, deren Träger der dritte Stand war, und sehr bald zu starker evangelischer Sektenbildung: Indepen- denten, Presbyterianer, Pietisten usw., bis zuletzt die Partei zur Kirche, und das Programm zur heiligen Schrift wird, wie bei der Sozialdemokratie und dem Bolschewismus, die nur als religiöse Bewegungen ganz verstanden werden können.
Selbst hier, in diesen ihrer eigenen Meinung nach wenigstens
[1] Adler, a. a. O. S. 115.
[2] S. S. I, S. 678—694, namentlich eine Darstellung der verschiedenen Formen des Sozialismus, S. S. III, überall bei jedem Einzelproblem.
[3] Max Weber, Ges. Aufsätze zur Religionssoziologie, S. 293.
[4] Die Marotse, S. 43. Das gleiche berichtet Beloch (a. a. Ο II, ι S. 267) von den fremden Kulten des Orients, die in Hellas eindrangen. Auch hier schlössen sich besonders Sklaven und Frauen an.
[351]
areligiösen, sogar oft antireligiösen Bewegungen, ist die naturrechtliche Grundlage der Gesamtüberzeugung immer religiös gefärbt, chiliastisch- enthusiastisch unterlegt. Das ist in allen europäischen Revolutionen deutlich zu spüren, die sich sämtlich, wie Jellinek richtig betont, auf das Naturrecht berufen haben [1].
Was die Psychologie der Unterklasse anlangt, so ist es nicht zu erwarten, daß der auf sie ausgeübte Druck in Verbindung mit der deutlichen Empfindung, Unrecht zu erleiden, gerade nur die alleredelsten menschlichen Eigenschaften bei ihnen ausbilden sollte. Man kann ihren Mitgliedern gewiß manches Unerfreuliche nachsagen, vor allem ein häßliches „Ressentiment“. Von unserem Standpunkt aus, der vorsichtig die Kraft der sozialen Regulationen gegen die der gesellschaftsbedingten Versuchungen abwägt, fällt freilich jede berechtigte Anklage, die von der Herrenklasse gegen die Unteren erhoben wird, auf jene um so schwerer zurück, je mehr sie berechtigt ist: man kann aus Gottes Ebenbilde alles machen, auch schlimmes Gesindel.
Ein letzter allgemeiner Zug der Unterklassen-Psychologie ist noch zu erwähnen : die Neigung, die Herrenklasse in Haltung und Kleidung, in der Sitte und sogar der Ideologie so weit nachzuahmen, wie es der Gegensatz der Interessen irgend gestattet. Wir haben uns über diesen Gegenstand in unserer allgemeinen Soziologie ausführlich geäußert und können hier darauf verweisen [2]. Ganz arg und überaus lächerlich wird diese Neigung, sobald die oberste Schicht des Großbürgertums in die herrschende Klasse einrückt : dann gibt es keine feudaleren Feudalen als diese abgeschmackten Adelsaffen.
---
Von diesen Gedanken und Stimmungen heller oder dunkler geleitet, kämpfen beide Gruppen schon von der Entstehung des primitiven Eroberungsstaates an den Gruppenkampf der Interessen, und der junge Staat müßte unter der Wirkung dieser zentrifugalen Kräfte auseinanderbersten, wenn nicht in aller Regel die zentripetalen Kräfte des Gemeininteresses, des „Staatsbewußtseins“, stärker wären. Der Druck der Fremden, der gemeinsamen Feinde von außen, überwindet den Druck der widerstreitenden Sonderinteressen von innen. Und so würde der junge Staat, einem Planeten gleich, in der durch das Parallelogramm der Kräfte vorgeschriebenen Bahn kreisen, wenn nicht die Entwicklung ihn selbst und seine Umwelt wandelte, neue äußere und innere Kräfte entbände.
[1] Allg. Staatsl., S. 345. Vgl. Thierry, a. a. O. S. 21.
[2] S. S. I, S. 702ff.
[352]
III. Die Reife. ↩
Bau und Gliederung. ↩
Bedeutende Wandlungen bringt schon das Wachstum mit sich, und wachsen muß der junge Staat. Dieselben Kräfte, die ihn ins Leben gestellt haben, drängen ihn, sich auszudehnen, seinen Machtbezirk zu erweitern. Und wäre selbst ein solcher junger Staat „saturiert“, wie es mancher moderne Großstaat zu sein behauptet: er müßte dennoch sich strecken und dehnen, bei Strafe seines Untergangs. Denn schon in diesen urtümlichen Gesellschaftsverhältnissen heißt es mit härtestem Nachdruck : „Du mußt steigen oder fallen, siegen oder unterliegen, Hammer oder Ambos sein“. Die „Staatsräson“ wird mit dem historischen Staat geboren und kann nur mit ihm aus der Welt verschwinden.
Die Staaten werden erhalten durch das gleiche Prinzip, durch das sie geschaffen wurden. Der primitive Staat ist Schöpfung des kriegerischen Raubes: nur durch kriegerischen Raub kann er bestehen.
Das Bedürfnis der Herrenklasse nach Vermögen und Einkommen hat keine Grenze; denn der Reiche ist sich niemals reich genug. Das politische Mittel wird gegen andere, noch nicht unterworfene Bauernschaften oder noch nicht gebrandschatzte Küstenländer angewendet; dazu kommt überall die Notwendigkeit, die Verwandten der Steppe, die hungrigen „Bären“, von Einbrüchen in das eigene Herrschaftsgebiet zurückzuhalten, und aus Strafexpeditionen wird auch hier oft neue Herrschaft. Der primitive Staat wächst, bis er mit einem anderen, auf die gleiche Weise entstandenen Staate auf der Grenze der beiderseitigen „Interessensphären“ zusammenstößt. Jetzt haben wir zum ersten Male anstatt des kriegerischen Raubzuges einen wirklichen Krieg eigentlichen Sinnes, da jetzt gleich organisierte und disziplinierte Massen zusammenstoßen.
Das Endziel des Kampfes ist noch immer dasselbe: das Ergebnis der Arbeit der unterworfenen Bevölkerung und die Herrschaft über sie: aber er geht nicht mehr zwischen einer Gruppe, die ausbeuten will, und einer anderen, die die Ausbeutung abwehren möchte, sondern zwischen zwei Herrengruppen um die ganze Beute und Ehre.
Das Endergebnis des Zusammenstoßes ist fast immer die Verschweißung der beiden primitiven Staaten zu einem größeren. Dieser muß aus den gleichen inneren Gründen wieder über seine Grenzen greifen, frißt die kleineren Nachbarn, wenn sie sich nicht halbfreiwillig der Übermacht unterwerfen, und wird zuletzt vielleicht von einem noch stärkeren wieder gefressen. Es ist der epikuräische „Naturzustand“ zwischen den Staaten, wie ihn noch Hobbes und Spinoza sahen.
Die Knechtsgruppen sind am Ausgange dieser Herrschaftskämpfe nur wenig interessiert: es ist ihnen auf die Dauer recht gleichgültig,
[353]
ob sie dieser oder jener Herrengruppe zu steuern und zu fronen haben [1].
a) Die Stände.
Um so stärker sind sie am Verlaufe des Krieges interessiert: denn der wird auf ihrem Rücken ausgefochten, und ihr „Staatsbewußtsein“ leitet sie richtig, wenn sie ihrer angestammten Herrengruppe nach Kräften Kriegshilfe leisten, um so mehr, als ja in der Regel bereits eine ausreichende Reziprozität geschaffen ist: in Fällen allzu krasser Ausbeutung und Versklavung, wie sie die Araber in den Possessorenprovinzen Roms antrafen, machten sie selbstverständlich eher mit dem eindringenden Fremden gemeinsame Sache, zumal wenn er, wie der Moslem, als Befreier auftrat: der Übertritt zum Islam machte ja in der Regel den Sklaven zum Freien. In aller Regel aber ist ihr Sonderinteresse bei solcher Bedrohung des Gemeinwesens mit dem des Ganzen identisch, und sie kämpfen in der Tat für Weib und Kind, für Herd und Haus, wenn sie „für Thron und Altar“ fechten: denn im Falle der Niederlage trifft alle Verheerung des Krieges am schwersten die Untertanen.
Dagegen ist das Interesse der Herrengruppe am Ausgang dieser Kriege ein unendlich viel größeres, ein geradezu vitales. Im schlimmsten Falle droht ihr die völlige Ausrottung, wie sie den größten Teil des alten Volksadels der Bayern und Schwaben im Frankenreich betroffen zu haben scheint [2]. Fast ebenso schlimm, wenn nicht schlimmer, muß ihr die Aussicht erscheinen, in die Knechtsgruppe hinuntergestoßen zu werden. Zuweilen sichert ihr ein rechtzeitiger Friedensschluß wenigstens die gesellschaftliche Stellung als Herrengruppe niederen Ranges: so waren die russischen Großfürsten Sklaven der Mongolenkhane, aber Herren ihrer Untertanen, ja, verstanden es, mit Hilfe ihrer Lehnsherren die Untergruppe in immer tiefere Knechtschaft zu pressen und ihren Machtbereich über ihre Grenzen hinaus auf Kosten weniger
[1] Caro (a. a. O S. 147) berichtet aus dem westgotischen Spanien zur Zeit der arabischen Invasion: „Die Masse des Volks aber, die Kolonen und Unfreien auf den Gütern der Großen und der Kirche, ließen ruhig den Wechsel der Herren über sich ergehen, fast so wie einst bei der Festsetzung der Germanen in den römischen Provinzen. Was fragten sie danach, ob dem christlichen Grundherren oder dem mohamedanischen Staat ihre Abgaben zufielen. . . . Ähnlich lagen die Dinge in einem großen Teile des Frankenreichs“.
[2] Ross, Foundations of sociology, S. 224 berichtet nach Jenks „Law and Politics in the middle ages“ p. 252: „In verschiedener Art stören kriegerische Aktionen das Gleichgewicht der Macht zwischen den sozialen Klassen. Vor allem wird der alte Blutsadel zugunsten des staatlichen Amtsadels niedergedrückt. Der Blutsadel findet sich bei den Friesen, Sachsen, Angelsachsen, Thüringern und Bayern, nicht aber bei den Franken, Burgundern, Goten und Langobarden, die harte Kämpfe zu bestehen hatten, um sich im Römerreich festzusetzen. In diesen Kämpfen war der Staat, die neue kriegerische Einrichtung, stark geworden und hatte den alten Blutsadel durch einen neuen Dienstadel ersetzt. Ahnlich war es in England. Die Thane, die Würde und Amtsgewalt vom König haben, saugen den älteren Adel der Earls auf.“ Oppenheimer, System der Soziologie. Band II. 23
[354]
demütiger oder zu Hof- und Haremsintriguen weniger geschickter Nachbarn bedeutend zu vermehren. Derartige Formen der Unterordnung sind aber selbstverständlich im voll ausgebildeten Staate nicht möglich, wo die beiden Gruppen auf dem gleichen Räume miteinander verschmolzen sind. Dann läßt der Sieger unter Umständen der Herrengruppe der Besiegten eine gewisse Ehrenstellung als Honoratioren und ihr Eigentum ganz oder zum Teile : das ist die Stellung, die die Römer in der Regel den Aristokraten der besiegten Städte von Hellas einräumten; nur Einzelne wurden mit dem vollen Bürgerrecht geehrt; ebenso verfuhren die Venetianer später mit dem Patriziat der Städte auf der Terra ferma: Padua, Verona, usw. [1]. Die Franken machten die römischen Aristokraten, die sie in Gallien vorfanden, gleichfalls zu solchen Adligen zweiter Klasse: sie hatten nur das halbe Wergeid wie der freie Germane [2] (die Langobarden dagegen machten sie in der Regel zu Unfreien und Halbfreien) [3]. Wie die Franken mit den Römern verfuhren die Normannen in England mit den besiegten Sachsen und die Deutschen der Kolonisationsperiode hier und da mit dem besiegten Slavenadel: die „Suppane“. In anderen Fällen, bei rechtzeitiger Unterwerfung oder ungefährer Gleichheit der Kräfte, verschmelzen die beiden Herrengruppen zu einem einheitlichen, gleichberechtigten, im Konnubial- verbande stehenden Adel: einzelne Wendendynasten (z. B. Die Gänse von Putlitz) im slawischen Okkupationsgebiet, Verschmelzung deutscher Herrengeschlechter mit dem unbesiegten Slawenadel in Böhmen, Polen und Mecklenburg, albanische und etrurische Geschlechter in Rom, usw. [4].
Auf diese Weise kann die herrschende Gruppe des reifen primitiven Großstaates in eine Reihe mehr oder minder berechtigter Schichten zerfallen. Vorbereitet ist dies bereits dadurch, daß, wie wir wissen, schon der erobernde Hirtenstamm in aller Regel in den Staat eine aus zwei Schichten zusammengesetzte Herrenklasse einbrachte, die sich schon im Nomadenleben ausbilden mußten: die großen Herden- und Sklavenbesitzer, die in der Regel auch das Oberpriesteramt und damit die Patriarchalherrschaft über den ganzen Stamm innehaben: die „Fürsten der Stammhäuser“ einer-, und Fdie kleineren Gemeinfreien anderer-
[1] Treitschke, Pol. II, S. 239.
[2] Caro, Sozial- und Wirtschaftsgesch. d. Juden, S. 55.
[3] Caro, S. 67. Vgl. dort über die Vernichtung des Adels im Languedoc durch Simon de Montfort in den Albigenserkriegen, S. 302.
[4] Geizer, a. a. O. S. 9 schreibt: „Eine weitere wichtige Tatsache ist erst kürzlich entdeckt worden, daß nämlich die neuen Geschlechter, die in der Epoche der Reichsbildung in die Nobilität gelangten, zu einem guten Teil dem italischen Hochadel entstammten“. (Nach F. Münzer „Römische Adelspartei und Adelsfamilien“.) Im Heere Attilas scheinen die Edelinge der Goten, Gepiden, Thüringer und anderer germanischer Stamme durchaus ihre überragende Klassenstellung beibehalten zu haben. (Gumplowicz, Allgem. Staatsrecht, S. 475.)
[355]
seits. Wahrscheinlich kann man die geringere Standesgliederung der von Jägern geschaffenen Staaten der Neuen Welt darauf zurückführen, daß sie diese, nur bei Herdenbesitz mögliche, Urscheidung der Stände nicht mitbrachten. Wir werden weiterhin zu betrachten haben, mit welcher Kraft diese Unterschiede im Rang und Vermögen der beiden Schichten der Herrengruppe auf die politische und wirtschaftliche Entwicklung des altweltlichen Staates einwirken sollten.
Eine ganz entsprechende Differenzierung spaltet nun auch, wie die Herrengruppe, die beherrschte Gruppe in verschiedene, mehr oder minder leistungsverpflichtete, mehr oder minder verachtete Schichten. Wir wollen hier nur an den sehr starken Unterschied in der sozialen Stellung der bäuerlichen Bevölkerung in den Dorierstaaten Lakedaimon und Kreta und in Thessalien erinnern, wo die Periöken ein gutes Besitzrecht und leidliche politische Freiheit hatten, während die Heiloten (die mit der Waffe in der Hand Gefangenen) bzw. die Penesten fast recht- und besitzlos waren. Eine Zwischenklasse zwischen der Gemeinfreiheit und der Hörigkeit fand sich auch im alten Sachsenlande: die Liren [1].
Augenscheinlich haben diese und zahlreiche andere, von der Geschichte überlieferte Fälle gleicher Art ähnliche Ursachen wie die soeben beim Adel dargestellten: wenn zwei primitive Staaten miteinander verschmelzen, so lagern sich ihre verschiedenen Schichten in vielfach verschiedener Weise, etwa vergleichbar den Kombinationen, die zwei Häufchen von Spielkarten ergeben können, wenn man sie durcheinander mischt.
b) Die Kasten.
Kein Zweifel, daß diese mechanische Durchmischung durch politische Kräfte auch an der Entstehung der Kasten beteiligt ist. Kasten im strengsten Sinne des Wortes sind erbliche Berufsstände, die zugleich eine Hierarchie bilden. In diesem strengsten Sinne finden sie sich, wenigstens in Ländern der Voll- und Halbzivilisation, nur in Indien. „Eine Kaste des heutigen Indien ist eine in sich geschlossene Körperschaft mit altüberlieferter, selbständiger Organisation, deren Mitgliedschaft erblich ist, also durch die Geburt bestimmt wird, die in der Regel denselben erblichen Beruf hat, sich durch bestimmte, auf die Ehe, Speise und Unreinigkeit bezügliche Gesetze von anderen Genossenschaften absondert, sich unter einem Haupt oder Rat zur Feier von Festen oder
[1] Inama-Sternegg, Deutsche Wirtschaftsgesch. I, S. 59. Eine sehr eindrucksvolle Schilderung dieser Schichtengliederung gibt Thierry, a. a. O. S. 4/5 aus dem frühen Frankenreiche: zu oberst steht der unter fränkischem Recht stehende Franke, dann folgt der unter seinem Stammesrecht stehende Germane anderen Stammes, dann der freie römische Possessor, und, ihm gleichen Ranges, der germanische Lite oder Kolonus, dann der eingeborene Zinspflichtige, zuletzt alle Sklaven ohne Unterschied. 23*
[356]
bei anderen Gelegenheiten versammelt, und über ihre Mitglieder soweit die Jurisdiktion ausübt, als sie sie wegen Vergehens aus ihrer Mitte ausstoßen, nach erfolgter Sühne aber auch wieder aufnehmen kann. .. . Kein anderes Land der Erde außer Indien hat etwas den Kasten genau Entsprechendes. Es ist eine spezifisch indische Einrichtung, hervorgegangen aus indischen Anschauungen und indischen Lebensverhältnissen. Man hat in Ägypten auf Grund der Angaben der Griechen seit Herodot Kasten finden wollen, aber mit Unrecht, da weder das Konnubium zwischen den einzelnen Ständen noch ein Übergang von einem Stand in den anderen verboten war. Auch wo man sonst hat Kasten finden wollen, bei den Iberern, in Peru, in Abessinien, auf Madagaskar usw. handelt es sich nicht um Kasten, sondern um mehr oder weniger ausgeprägte Stände“ [1].
Wir haben es nicht nötig, den Begriff mit dieser fast juristischen Schärfe zu fassen; wir verstehen unter Kasten mit der Mehrzahl der Ethnologen mehr oder minder abgeschlossene Berufsstände, die in der Regel erblich sind, unter einer gewissen religiösen Sanktion stehen, und regelmäßige Glieder einer sozialen Hierarchie bilden. Wir drücken uns mit Absicht etwas ungenau aus, um das Phänomen, das ohne scharfen Übergang in die Handwerkerzünfte überspielt, auch in seinen weniger typischen Ausgestaltungen zu erfassen [2].
Kein Zweifel, daß Krieg und Unterwerfung auch hier stark beteiligt sind. Das hat schon Bagehot gesehen: „Wahrscheinlich bildet sich eine Kastennation nur in Ländern, welche mehrere Male erobert worden waren, und wo die Grenzen der verschiedenen Kasten ungefähr mit den Grenzen der verschiedenen Abteilungen von Besiegten und Siegern zusammenfielen“ [3]. Westermarck schließt sich ihm an: „Kasten sind häufig, wenn nicht immer die Folgeerscheinung der Eroberung und Unterjochung durch Fremde“ [4]. Ratzel sagt: „Daß die soziale Gliederung und die Kastenbildung in Beziehung stehen, zeigen die geschichtlichen Beispiele für die Mitwirkung ethnographischer Elemente in der Kasten- sonderung. Als die Radschputen im 4. oder 5. Jahrhundert die Dschat in der heutigen Radschputana unterwarfen, fand ihre geringe Zahl seitens der ackerbauenden Bevölkerungen nur schwachen Widerstand. Diese übergaben ihnen den Boden und ließen dafür ihre Oberherrschaft bestätigen. Die Kasten der Kshatriya und Vaicya, sowie die Kaste der gemischten Bevölkerung, Baran Sankar, öffneten sich mit der Zeit den Unterworfenen, keineswegs aber fanden sie auch den Weg in die Brah-
[1] Pischel, Art. „Kasten“, Hdw. d. Staatsw. V, S. 800/3.
[2] Nach Ratzel, Völkerkunde II, S. 596 steht es übrigens auch nicht so arg mit der Starre des indischen Kastenwesens. Die Zunft scheint ebenso oft die Grenze der Kaste zu überschreiten, wie umgekehrt.
[3] Ursprung der Nationen, S. 170. Vgl. M. Weber, Wirtsch.-Gesch., S. 116.
[4] History of human marriage, London 1891, S. 368.
[357]
manenkaste“ [1]. An anderer Stelle sagt er: „Den Sklaven nahe verwandt sind jene niedrig geachteten und niedrig gehaltenen Bevölkerungsteile, die wie scharf abgesonderte tiefere Schichten das herrschende Volk unterlagern. Fast jedes zu höherer Entwicklung vorgeschrittene Volk Asiens und Afrikas umschließt solche. Da nicht immer ethnische Unterschiede vorhanden sind, wird die soziale Differenz um so schärfer festgehalten und führt häufig genug selbst wieder zu Sonderungen innerhalb dieser niederen Klassen. In Südarabien unterscheidet man in einigen Teilen vier, in anderen zwei Klassen Parias, wovon die einen geborene, die anderen durch unreine Gewerbe erniedrigt sind. Die Kastensonderungen Indiens zeigen dieselben Verschiedenheiten, denn in den niedersten Kasten finden wir teils durch ihren Ursprung, teils durch ihre Beschäftigung Degradierte. Beides fließt in unseren Zigeunern, in den Jeta Japans u. a. zusammen“ [2].
Es handelt sich also um eine in Ursachen und Wirkungen sehr komplizierte Erscheinung, die sicherlich nicht überall nach einem einheitlichen Typus abgelaufen ist [3]. Man wird sich die Entstehung der Kasten etwa so vorzustellen haben, daß zunächst vorgefundene ökonomische Berufsgliederungen von den staatsbildenden Kräften durchdrungen und angepaßt wurden. Solche Berufsgliederungen fanden die Eroberer namentlich in alten, volkreichen, schon zu städtischer Kultur mit Entwicklung der Gewerbe und des Handels aufgestiegenen Ländern vor, so besonders in Indien, das ja in voller wirtschaftlicher Entfaltung mehrfach von Nomadenscharen überrannt worden ist. Aber auch unter primitiveren Verhältnissen hat es an solchen Berufsgliederungen niemals gefehlt. Wir haben in unserer allgemeinen Soziologie [4] unter dem Titel: „Der Güter tausch und die Arbeitsteilung“ eine Reihe von Tatsachen zusammengetragen, die beweisen, daß der weitverbreitete Glauben an die absolute Autarkie der Wild Völker irrig ist. Ratzel schließt an eine derartige Schilderung den Satz: „Daraus entstehen die merkwürdigen sozialen und politischen Sondergruppen, die aus Zünften Kasten und aus Kasten bevorrechtete Schichten in einem Volke werden“ [5].
[1] Völkerkunde II, S. 568.
[2] Völkerkunde I, S. 116. Max Weber (a. a. O. S. 128) sagt, die Kasten seien oft rituelle Zünfte. Auch als rituelle Handelsgilden kommen sie oft vor: die Bannja-Kaste (Ib., S. 204/5, vgl. 17 [5].
[3] Ganz unzureichend sind die Erklärungen, die Pontus E. Fahlbeck, Die Klassen und die Gesellschaft, S. 122ff. gibt, wie denn überhaupt das ganze Buch trotz eines mit größtem Fleiß verarbeiteten weitschichtigen Materials sehr wenig befriedigen kann. Die persönliche Gleichung des Verfassers, der auf dem Standpunkt eines sehr engen protestantischen Bourgeois steht, tritt überall der eigentlichen letzten Erkenntnis hindernd und verhindernd in den Weg. Er glaubt selbstverständlich an die natürliche Beschränktheit des Bodens, an das Bevölkerungsgesetz usw. usw. : das gesamte Credo seiner Klasse.
[4]S. S. I, S. 866ff.
[5] Völkerkunde I, S. 81.
[358]
Waren solche Berufsgruppen einmal in das staatliche Gefüge, als niedere oder hochgeschätzte Schichten, je nach der Seltenheit und Wichtigkeit ihres Gewerbes, eingeordnet, so konnten sie leicht unter der Wirkung religiöser Vorstellungen erstarren, die übrigens auch schon bei ihrer Entstehung mitgewirkt haben mögen. Wir wissen aus der allgemeinen Soziologie, daß schlechthin alle Institutionen der primitiven Stufen dahin tendieren, statisch, und in dieser Statik durch die Vorschriften der Religion sanktioniert zu werden. Daß dies auch für die Berufssonderungen zutrifft, beweist die bekannte Tatsache, daß schon zwischen Mann und Weib strenge, tabuierte Berufssonderungen häufig sind: während z. B. bei allen Jägervölkern der Bodenanbau der Frau zufällt, übernimmt ihn bei vielen afrikanischen Hirten der Mann von dem Augenblicke an, wo der Ochsenpflug zur Anwendung kommt; das Weib darf, ohne zu freveln, das Herdentier nicht gebrauchen (entsprechend gibt es auch, in Nordasien, Jägerstämme, wo es den Weibern streng verboten ist, das Jagdgerät zu berühren oder eine Spur zu kreuzen [1]). Derartige religiöse Vorstellungen werden dort, wo stamm- oder dorfweise ein bestimmtes Gewerbe für den Austausch betrieben wurde, häufig dahin gewirkt haben, den Beruf erblich und zwar selbstverständlich zwangserblich zu machen. Nach der Einordnung in den Erobererstaat wird oft genug die Herrenklasse diese religiöse Sanktion aus eigenem Interesse noch verstärkt, durch positives Gesetz eingeschärft haben, erstens aus allgemeinen Gründen, weil ja die ganze Ordnung unter die göttliche Sanktion gestellt ist, und zweitens, weil sie die Erzeugnisse der Berufe für den eigenen Konsum und öfters auch für den Export gut gebrauchen konnte. So berichtet Richter von den Marotse, daß die Stammesgewerbe von dem Herrenvolk in ihrem Tributinteresse „betont“ werden [2]. Hier „führen ganze Stämme den Namen von Handwerkerklassen“ [3].
Wenn sich nun, wie das gerade in den reichsten und am höchsten entfalteten Ländern der Fall war, eine Erobererwelle über die andere schichtete, so konnte die Bildung der Kasten sich vervielfältigen, namentlich, wenn und wo die ökonomische Arbeitsteilung zahlreiche Berufsstände entfaltet hatte.
Die Dinge komplizieren sich aber noch durch eine sekundäre, sozusagen aufgepfropfte Entwicklung. Wo einmal verachtete Klassen bestanden, lag es nahe, Verbrecher in sie zu verstoßen. Wir haben von solchen Fällen soeben aus Arabien und Indien gehört. Einen anderen Fall berichtet L. v. Wiese von der Pariakaste der Rodya in Ceylon, Mischlingen aus den niedersten Elementen mit verstoßenen Frauen der
[1] Ratzel, a. a. O. I, S. 650.
[2] Die Marotse, S. 119.
[3] Die Marotse, S. 125.
[359]
höchsten Brahmanenkaste, die trotz ihrer elenden Lage in ihrer äußeren Erscheinung — ein „Triumph des Blutes“ — die edle Abstammung deutlich zeigen sollen [1]. Ferner: war einmal die Gedankenassoziation zwischen einer verachteten Klasse und einem bestimmten Beruf fest gestiftet, so konnte es leicht dahin kommen, daß Jemand, der diesen Beruf ausübte, der Kaste zugerechnet wurde oder, als „unrein“ geworden, seine eigene Kaste verlor. Das konnte unter Umständen auch einer ganzen territorialen Gruppe geschehen. Wir kennen ähnliche Verhältnisse aus unserer eigenen Sozialgeschichte in der wachsenden Verkastung unserer zünftigen Handwerke, die eine soziale Gruppe nach der anderen als „unehrlich“ vom Zutritt zu dem Handwerk ausschloß; nicht nur Henker und Abdecker und ähnliche anrüchige Berufe, sondern auch z. B. die Leineweber von der Zeit an, wo die Landbevölkerung in neue Knechtschaft verfiel: die Leineweber wohnten zumeist, im Gegensatz zu den von jeher städtischen Wollenwebern, auf den Dörfern, wo ihr Handwerk als ländliches Nebengewerbe entstanden war. Von diesen und anderen [2] Einflüssen hat der eine hier, der andere dort stärker oder ausschließlich gewirkt : dadurch ist das Bild des Instituts so bunt und unübersichtlich geworden.
Am besten wird sich die Entwicklung wahrscheinlich an der Gruppe der Schmiede studieren lassen, die fast überall eine eigene, halb gefürchtete halb verachtete Stellung einnehmen. Schmiedekundige Völker finden sich namentlich in Afrika seit Urzeiten im Gefolge und in einer gewissen Abhängigkeit von den Hirten. Schon die Hyksos brachten solche Stämme mit ins Nilland und dankten vielleicht den von ihnen gefertigten Waffen ihren entscheidenden Sieg ; bis vor kurzem hielten die Dinka die eisenkundigen Djur in einer Art von Untertänigkeitsverhältnis. Ebenso sind die Matoka von den Marotse abhängig (Richter); gleiche Beziehungen finden wir bei den Saharanomaden, und auch aus unseren nordischen Sagen klingt noch der alte Stammesgegensatz zu den „Zwergen“ und die Furcht vor ihrer Zauberkraft. Eduard Hahn sagt: „Die Rolle, die zauberkundige schmiedende Zwerge, die den Hammer tragen, als Demiurgen und Weltschöpfer in weiten Kreisen unserer Zivilisation spielen, kann unmöglich ohne tiefere Bedeutung sein“ [3].
Bertholet in seiner Kulturgeschichte Israels schreibt: „Da Kain
[1] Archiv für Rassenbiologie, XI, i.
[2] Wir bringen weiter unten eine ausführliche Darstellung von de la Mazelière, derzufolge auch die Bildung neuer religiöser Sekten alte Kasten gespalten hat.
[3] Haustiere, S. 551, Anm. 6. Vgl. über die Schmiede, „die bald einen besonderen, bevorrechteten, bald aber einen niedrigen verachteten Stand bilden“, Max Schmidt, Ethnol. Volksw., S. 201/2. Vgl. ferner die ausführliche Darstellung bei Ratzel, Anthropog. II, S. 413.
[3б0]
als Appellativ den Schmied bezeichnet, ist es nicht unmöglich, daß Kain oder die Keniter ein Stamm von Wüsten-Schmieden war“ [1]. Max Weber sagt: „Überhaupt gilt jedes hochgelernte Gewerbe ursprünglich als magisch beeinflußt; besonders die Schmiede werden überall als Träger eines magischen Charisma angesehen, weil ein Teil ihrer Kunst geheimnisvoll erscheint und sie selbst ein Geheimnis daraus machen“ [2]. In Griechenland nehmen die Schmiede bis auf die klassische Zeit herab nur eine bescheidene Stellung ein [3]. Das gleiche gilt für die ursemitische Gesellschaft : „Nicht zur Stammgemeinde gehörig gelten diejenigen Volksgenossen, welche keinen Eigenbesitz haben und daher auch nicht als Vollfreie gelten können, sondern von der Arbeit für andere leben, teils als Knechte im Dienste einzelner, teils als Handwerker, wie vor allem die Schmiede (Metallarbeiter), aber auch Musikanten, Sänger und Tänzer u. ä. Sie stehen daher auch nicht in den Blutsverbänden; und eine geschlechtliche Vermischung mit ihnen (abgesehen von der Prostitution) gilt als schimpflich und wird vielfach streng bestraft. Sie sind Beisassen (gêr), die als Klienten unter dem Schutz des Stammes stehen, wie die Fremden, z. B. flüchtige Totschläger, die bei ihm Zuflucht gefunden haben“ [4]Ursprünglich standen bei den Ursemiten die Musikanten, die wie die homerischen Barden (Aöden) den Vollfreien am nächsten standen, im Range neben den Kindern der Hauptfrau, die Schmiede aber neben den Kindern der zweiten Frau.
Dagegen ist der Waffen- und Goldschmied bei den Skandinaviern hoch angesehen [5]. Wie Kaste und Schmiedezunft zusammenhängt, kann man an der staatlichen Organisation der Somali erkennen. Mit ihnen „leben die Achdam, ihnen dienstbar und tributpflichtig, mit anderen Gesetzen, Beschäftigungen und Gewohnheiten ... ; unter den Achdam sind die angesehensten die Tumalod. Sie sind eine aus allen Stämmen des Landes und Sklaven der Nachbarländer zusammengesetzte ethnische Mischung, die zugleich Schmiedezunft ist. Sie sind dem Stamme, in dem sie leben, tributar und seiner Gerichtsbarkeit unterworfen. Kein freier Somali betritt eine Schmiede oder begrüßt den Schmied mit einem Händedruck, keiner nimmt Frauen aus diesem Stamm oder gibt ihm seine Töchter“ [6].
Hier scheint noch ein neues Element in die Mischung einzugehen:
[1] Zitiert nach Robert Weiß, a. a. O. S. 9.
[2] Weber, Wirtschaftsgeschichte, S. 112.
[3] Beloch, a. a. O. I, I, S. 153.
[4]Eduard Meyer, a. a. O., S. 394. Auch heute noch bilden in Arabien die Schmiede vielfach eine scharf geschiedene stammartige Kaste, die sich auch im physischen Typus von den Stammgenossen unterscheidet (ib. S. 39 [5].
[5] Fahlbeck, a. a. O. S. 58. Vgl. auch Müller-Lyer, Phasen der Kultur, S. 163 : Die Schmiede sind teils geachtet, teils gefürchtet.
[6] Ratzel, Völkerkunde, II, S. 169/70.
[361]
die Schmiede scheinen hier die Stellung von „Metöken“ einzunehmen. Wir können uns vorstellen, daß die ersten Schmiede, wahrscheinlich noch zugleich Eisen- und Edelmetallschmiede, wie es auch noch die nordische Sage darstellt, als wandernde Handwerker von Ort zu Ort zogen und ihre Kunst „auf der Stör“ gegen Entgelt ausübten. So sieht es z. B. Lanessan. Fanden sie einen reichen Markt, so werden sie freiwillig geblieben sein und dann wahrscheinlich eine höhere Stellung eingenommen haben; wenn aber ein lokaler Machthaber sie mit Gewalt zurückhielt, wie es noch von Schmied Wieland berichtet wird, so wird ihre Stellung mehr knechtsmäßig gewesen sein [1].
Um ein Beispiel einer hoch bevorrechteten Kaste und zugleich der Mitwirkung religiöser Vorstellungen zu geben, sei die folgende Beobachtung aus Polynesien mitgeteilt: „Hier steht der Schiffbau, obgleich viele Eingeborene dazu fähig sind, nur einer privilegierten Klasse zu: so eng war das Interesse der Staaten und Gesellschaften mit dieser Kunst verbunden! Nicht nur früher in Polynesien, auf Fidschi noch heute bilden die fast nur Schiffbau treibenden Zimmerleute eine besondere Kaste, führen den hochklingenden Titel: ,des Königs Handwerker' und haben das Vorrecht eigener Häuptlinge. . . . Alles geschieht nach altem Herkommen, das Legen des Kiels, die Fertigstellung des Ganzen, der Stapellauf findet unter religiösen Zeremonien und Festen statt“ [2]. Hierbei ist zu bedenken, daß in Polynesien die Klassengliederung überhaupt schon durch das dort gebräuchliche strenge Tabu in seinem engeren Verstände einem „schroffest durchgeführten Kastensystem“ sehr ähnlich geworden ist [3].
Zum Schlüsse dieses Abschnitts sei es uns gestattet, eine überaus lebensvolle und soziologisch erhebliche Schilderung dessen, was das indische Kastenwesen dem Volke bedeutet und geleistet hat, aus de la Mazelière im Auszuge wiederzugeben [4]:
„Die Kaste ist die Lösung, die Indien für das Problem seiner nationalen und sozialen Einheit gefunden hat. Jedes Volk findet seine eigene Lösung, die seinem Geiste und seiner Gemütsverfassung entspricht. Wie Rom und Griechenland den Stadtstaat (cité) mit der Sklaverei, wie China das patriarchalische Regiment, so hatte Indien die Kaste, und man muß eingestehen, daß das Klima, die Größe und Be-
[1] Ratzel, Anthropogeogr. II, S. 413. Auch Ratzel glaubt, daß vielfach wandernde Stämme das Schmiedehandwerk betrieben haben. „In Kongo wurden sie als königlicher Abkunft hoch in Ehren gehalten, während sie bei den Mandingo als Unreine gemieden werden“.
[2] Ratzel, Völkerkunde, I, S. 156.
[3] Ratzel, Völkerkunde, I, S. 259/60. Weitere Mitteilungen über Kasten in Südarabien Ratzel a. a. O. II, S. 434.
[4] Essai sur l'évolution de la civilisation indienne. Wir bemerken, daß wir uns nicht mit allen Anschauungen des Verfassers zu identifizieren beabsichtigen.
[362]
völkerung des Landes und die Verschiedenheit seiner Rassen jede andere Gesellschaftsform unmöglich gemacht hätten.
Im alten Indien waren die Kasten weder so zahlreich noch so fest abgeschlossen wie heute, aber sie bestanden bereits, als eine soziale und politische Hierarchie, die verschiedene Stämme, Völker und sogar Rassen vereinigte; eine Organisation, die den Zünften und zugleich den Gesellschaften zu gegenseitiger Hilfe entspricht. In schlecht verwalteten Staaten glich der Rat der Kaste die Nachlässigkeiten und Ungerechtigkeiten der Strafpolizei aus, und ihre Vorschriften ersetzten das fast völlig fehlende bürgerliche Gesetz ; denn die Religion gab ihnen einen sakramentalen Charakter, und die Bildung neuer Sekten mußte daher immer neue Kasten hervorbringen.
Das stellt die Kaste heute dar, aber das Prinzip seiner Entwicklung muß man in der Verfassung der arischen Familie selbst suchen : in ihrem patriarchalischen Regiment, ihrem Kultus des Herdes, ihrer Ahnenverehrung, ihrer besonderen Auffassung der Ehe, der Verwandtschaft und des Eigentums.
Von hier aus versteht man, warum der Buddhismus daran scheitern mußte, die Kastenordnung zu beseitigen. Er war das Gewissen jener großen Bewegung, die das erste Kaiserreich, die Rasse und die Zivilisation der Hindu hervorbrachte. Aber sein voller Erfolg hätte die Anarchie und den Bürgerkrieg herbeigeführt. Nach der Zerstörung der Kaste wären noch immer die nicht in die Rasse der Hindu aufgegangenen übrigen Rassen Indiens und sogar in jener selbst die Verschiedenheit der Temperamente und der Intelligenz, und die Gegensätze des Geschmacks und der Bedürfnisse übrig geblieben. Und welche Ordnung hätte denn die Kaste ersetzen sollen ? ! Die Religion der Hindu schützt die niedersten die höchsten Kasten, politisch gegen die Tyrannei der Könige, wie sozial dadurch, daß sie auch den niedersten in eine Gruppe von Seinesgleichen einordnet, wirtschaftlich, indem sie jeder Kaste das Monopol ihres Gewerbes gegen die Ansprüche aller anderen, sogar der Brahmanen und der Könige gewährleistet. Für die Sudras und die ehrlosen Stämme bestand die wahre Errungenschaft nicht darin, daß man das Kastenwesen unterdrückte, sondern darin, daß man ihnen die Kaste gab, mit ihren Rechten und Privilegien. Der Buddhismus als individualistische Religion befahl den Menschen, die Pflichten des öffentlichen und privaten Lebens zu verachten, um sich ganz der Sorge für das Seelenheil hinzugeben. Auf ein solches Prinzip konnte man eine Kirche, aber nicht eine Gesellschaft aufbauen.
Zwei mächtige Prinzipien haben in Indien gegen die Kaste gekämpft, die Feudalität und der Islam: sie widerstand, aber nicht, ohne Veränderungen zu erleiden. Nur in der Radschputana gelang es der Feudalität, die Kaste zu zerstören: in den anderen Provinzen überlagerte
[363]
sie die Kastenordnung, und es gelang ihr, neun Zehntel der Bevölkerung der Leibeigenschaft im strengsten Sinne (pur et simple) zu unterwerfen.
Der Islam mit seinem Prinzip der absoluten Gleichheit ist der Feind der Kaste, und der Hindu hat ohne Zweifel aus Liebe zur Kaste den Islam abgelehnt. „Der Hindu hatte das Bewußtsein, daß die Kastenordnung sein Schutz war. Zuerst seiner nationalen Eigenart : denn ohne sie hätte in der Anarchie des Mittelalters und nach dem Verfall der brah- manischen Zivilisation Indien skythisch oder mongolisch werden können. Der Schutz ferner seiner Religion : Ramaniya, Kabir, Nanak ließen sich durch den Islam anregen, ihre Lehren unterscheiden sich weniger von denen Mahomets als die der Sufis. Ohne die Kaste hätte Indien muselmanisch werden können. Ferner der Schutz seiner politischen und sozialen Interessen: denn die Kaste machte es den Rajats möglich, der Feudalität Widerstand zu leisten und sich allmählich von der Leibeigenschaft zu befreien. Ohne sie wäre Indien wie Per sien und die Türkei die Beute der Despotie geworden : die vom Islam verkündete Gleichheit hätte die Genossenschaften zerstört, die die Allmacht des Herrn einschränkten. Und schließlich der Schutz ihrer wirtschaftlichen Lage: in der demokratisch-industriellen Zivilisation Europas sind Freiheit, Individualismus und Gleichheit die Hauptursachen der Reichtumshäufung [1]. In der asiatischen Zivilisation muß alles, was das Individuum isoliert, dahin drängen, seinen Ruin zu bewirken. Der moslemische Bauer ist der ärmste und rückständigste der ganzen Welt. Gewiß kann man sagen, daß der Niedergang des Islam vielerlei Ursachen hat; man kann ihn dem Fatalismus des Koran und dem Quietismus der Sufi zuschreiben; man kann darauf hinweisen, daß die semitischen Völker immer wenig Geschmack an Ackerbau und Gewerben gehabt haben, daß ihnen die körperliche Arbeit nicht zusagt, daß der Islam, als eine Religion der Krieger und Hirten, sich schlecht mit einer Zivilisation verträgt, deren Grundzüge die Seßhaftigkeit, der Frieden, ein voll ausgebildetes Staatswesen und die Pflege der Wissenschaften und Künste sind. Aber alle diese Gründe verlieren sehr viel von ihrem Gewicht, wenn man an die glorreiche Zivilisation des Islam in Bagdad, in Spanien, in Ägypten, im Indien Akbars, und in der Türkei Solimans denkt. Nein, die wirtschaftliche Entwicklung in allen Ländern der Musulmanen ist durch den Despotismus gelähmt worden : der Islam lieferte das vereinzelte Individuum dem Despotismus aus.
Als er aber auch in Indien, wie in Europa, in Kleinasien, in Afrika die unheilbare Zerrüttung herbeigeführt hatte, da war die Kaste noch
[1] Auch Max Weber betont mehrfach, daß das indische Kastenwesen ein starkes Hindernis für den Kapitalismus ist (Wirtsch.-Gesch. S. 117, S. 147, S. 160): freilich kein absolutes Hindernis. Kastenfremde dürfen in derselben Werkstatt arbeiten. Der Grundsatz gilt: „Werkstatt ist rein“.
[364]
der letzte Schutzwall gegen die Anarchie. Es gab weder ein bürgerliches Recht noch ein Strafrecht; Usurpatoren, Abenteurer, Räuber, alle Völker Asiens und Europas stürzten sich auf Indien wie auf eine Beute. Aber die Kaste blieb, sie zwang ihre Gesetze allen Hindu auf, und ihr passiver aber unbeugsamer Widerstand brach die Angriffe der Fremden“ (S. 352ff.)
Mag in diesen Worten des französischen Forschers manches angreifbar sein: wir haben die Stelle nicht gebracht, um in jeder Einzelheit geschichtliche Wahrheit über das Kastenwesen mitzuteilen, sondern, um zu zeigen, daß das Institut, das dem Europäer so leicht als die äußerste Tyrannei, als die schwerste Beschränkung der persönlichen Freiheit erscheint, bei alledem dennoch die große Eigenschaft aller Genossenschaft besitzt, die Pfeile zum Bündel zu vereinen und das Ganze unzerbrechlich zu machen; daß jede lebendige Volkheit die Kraft besitzt, auch solche Institutionen an sich anzupassen und sich ihnen anzupassen, die zu ihrer Unterdrückung geschaffen oder ausgestaltet worden sind: die wunderbare Fähigkeit alles Lebens! „Und ob von Zähnen rings umgiert, das Leben sitzt und jubiliert“ (Dehmel).
2. Die Ausgänge. ↩
Damit haben wir die Elemente des Baus des reifen Eroberungsstaates dargestellt. Sie sind vielfältiger und zahlreicher als auf der primitiven Stufe: aber Recht, Verfassung und volkswirtschaftliche Verteilung sind grundsätzlich ganz die gleichen geblieben.
Noch immer ist das Erzeugnis der gesellschaftlichen Kooperation, das Ergebnis des ökonomischen Mittels, das Ziel des Gruppenkampfes, der nach wie vor das Movens der inneren Politik des Staates ist ; — und das politische Mittel ist nach wie vor das Movens der äußeren Staatspolitik in Angriff und Abwehr. Und immer noch rechtfertigen sich oben und unten Mittel und Ziele der inneren und äußeren Kämpfe durch die gleichen Gruppenideologien.
Aber die Entwicklung kann nicht stillstehen. Wachstum ist im Organischen mehr als nur Massen-Vergrößerung: Wachstum bedeutet auch immer steigende Differenzierung und Integrierung. Je weiter der primitive Eroberungsstaat seinen Machtbezirk erstreckt, je zahlreicher die von ihm beherrschten Untertanen werden, und je dichter sie siedeln, um so mehr entfaltet sich nach dem „Hauptgesetz der Beschaffung“ die volkswirtschaftliche Arbeitsteilung und -Vereinigung und ruft immer neue Bedürfnisse und ihre Befriedigungsmittel hervor; und um so mehr verschärfen sich die Unterschiede der ökonomischen, und mit ihr der sozialen Klassenlage: hier waltet das „Gesetz der Agglomeration um vorhandene Vermögenskerne“, wie
[365]
wir vorgeschlagen haben es zu nennen. Diese wachsende Differenzierung wird entscheidend für die Weiterentwicklung und namentlich für den Ausgang des Eroberungsstaates.
Nicht von einem Ausgang im Sinne des Geschichtsschreibers soll hier die Rede sein : also nicht vom Untergang eines individuellen Staates, der im Zusammenprall mit einem anderen seine Selbständigkeit verliert; auch nicht von der Versumpfung, in die andere individuelle Staaten durch lange Zeiträume hindurch verfielen, bis aus ihren eigenen Kräften oder durch fremde Eroberung das Hemmnis beseitigt wurde ; auch nicht von der Erstarrung, in die z. B. China angeblich verfallen ist.
Sondern hier soll die Rede sein von den Ausgängen nicht „der“, sondern „des“ Staates: von Ausgängen im Sinne der Weiterentwicklung des primitiven Eroberungsstaates, die für die Auffassung der Weltgeschichte als eines Prozesses von Bedeutung sind. Solcher Ausgänge gibt es, wenn wir nur die ganz großen Linien der Entwicklung ins Auge fassen, zwei grundsätzlich verschiedene: und zwar ist diese polare Gegensätzlichkeit bedingt durch die polare Gegensätzlichkeit der ökonomischen Machtmittel, an denen sich das Gesetz der Agglomeration betätigt. Auf der einen Seite ist es der mobile, auf der anderen der immobile Reichtum; dort das Handelskapital, hier das Grundeigentum, das sich in immer wenigeren Händen anhäuft und dadurch die Klassengliederung und mit ihr das ganze Staatswesen grundstürzend umwälzt. Der Träger der ersten Entwicklung ist der Seestaat, der der zweiten der Landstaat [1]. Der Ausgang des ersten ist die kapitalistische Sklavenwirtschaft, der der zweiten zunächst der entfaltete Feudalstaat.
Die kapitalistische Sklavenwirtschaft endigt — muß, wie wir sehr bald zeigen werden, enden — nicht in Staatentod, was nichts bedeutet, sondern in Völkertod durch Völkerschwund. Der Seestaat bildet daher am entwicklungsgeschichtlichen Stammbaum des Staates einen Nebenast, von dem keine weitere unmittelbare Fortbildung ausgehen kann.
Dagegen stellt der entfaltete Feudalstaat den Hauptast, die Fort-
[1] „Binnenvölker und Küstenvölker, Gebirgsvölker und Inselvölker sind Typen, die unter allen Zonen wiederkehren. Wir finden sie in allen Größen- und Artabstufungen. . . Eskimo und Indianer, Athener und Thrazier, Phönizier und Juden sind verschiedene kleinere Ausprägungen des großen Gegensatzes von See- und Landvölkern und -mächten, den wir in der ganzen Weltgeschichte wirksam sehen“ (Ratzel, Anthropog., S.58); vgl. ib. S. 212: „Vergleichen wir ein Gebiet alten Binnenverkehrs mit einem Gebiet alten Wasserverkehrs, so sehen wir die unvergleichlich größere Bewegung, die dieser weckt, deutlich vor uns. Welches Vorauseilen der Entwicklung in dem thalassischen Teil der asiatisch-europäischen Grenze, welches Zurückbleiben in dem kontinentalen Strich 1 Dort das Völker verbindende, Europa und Asien verknüpfende ägäische Meer, hier der bis vor 350 Jahren Europa unbekannte, heute noch fremde Ural.“
[366]
setzung des Stammes, und daher den Ursprung der weiteren Entwicklung „des“ Staates dar, die von da aus zum Ständestaat, zum Absolutismus und zum modernen Verfassungsstaat schon geführt hat und, wenn wir recht sehen, zur „Freibürgerschaft“ weiter führen wird. Er hat außerdem einige Nebenäste ausgesendet, vor allem den „Oasenstaat“, der uns zu beschäftigen haben wird.
Solange der Staat nur in einer Richtung wuchs, bis zur Reife des primitiven Eroberungsstaates, konnte auch unsere idealtypisch-genetische Darstellung einheitlich vorgehen. Von jetzt an, wo der Stamm sich gabelt, muß auch unsere Darstellung sich teilen, um jedem der Äste bis in seine letzten Verzweigungen zu folgen. Wir beginnen mit der Geschichte des Seestaates. Nicht, weil er die ältere Form wäre : im Gegenteil, soweit wir die Nebel der Geschichtsanfänge durchdringen können, haben sich die ersten starken Staatsbildungen in Landstaaten vollzogen, die aus eigenen Kräften die Stufe des entfalteten Feudalstaates zu ersteigen vermochten. Aber darüber hinaus sind wenigstens diejenigen Staaten nicht gelangt, die als unsere unmittelbaren Ahnen den Europäer am meisten interessieren, sondern sind stehen geblieben oder den Seestaaten erlegen, und, mit dem tödlichen Virus der kapitalistischen Sklavenwirtschaft infiziert, gleich ihnen zugrunde gegangen.
Die weitere Emporentwicklung des entfalteten Feudalstaates zu höheren Stufen konnte erst erfolgen, nachdem die Seestaaten ihren Lebensgang vollendet hatten : mächtige Formen der Herrschaft und der Wirtschaft, gewaltige Ideologien, die hier erwachsen waren und nur hier erwachsen konnten, haben die Ausbildung der auf ihren Trümmern entstandenen Landstaaten entscheidend beeinflußt und gefördert.
Darum gebührt der Darstellung des Schicksals der Seestaaten als der Vorbedingung der höheren Staatsformen der Vortritt. Wir werden erst dem Nebenaste nachgehen, um dann zu dem gemeinsamen Ausgangspunkt, dem reifen Eroberungsstaat, zurückzukehren und den Hauptstamm bis zur Entwicklung des modernen Verfassungsstaates und, vorschauend, zur Freibürgerschaft der Zukunft zu verfolgen.
[367]
Vierter Abschnitt.
Der Seestaat. ↩
I. Die Bedingungen des Seestaates.
(Handel und Schiffahrt.) ↩
Der Lebens- und Leidensweg des von den Seenomaden, den „Wikingen“, begründeten Staates ist, wie soeben gesagt, bestimmt durch das Handelskapital, so wie der Weg des Landstaates durch das Bodenkapital und, fügen wir vordeutend hinzu, der des modernen Verfassungsstaates durch das Produktivkapital und der des Oasenstaates durch das Wasserkapital.
Aber der Seenomade hat Handel und Kaufmannschaft, Messen, Märkte und Städte nicht erfunden, sondern vorgefunden und nur seinen Interessen gemäß umgestaltet. All das war im Dienste des ökonomischen Mittels, des äquivalenten Tausches, längst ausgebildet.
Zum ersten Male in unserer Betrachtung stoßen wir hier auf das ökonomische Mittel nicht als das Objekt der Ausbeutung durch das politische, sondern als mitschaffendes Subjekt bei der Entstehung des Staates: als die „Kette“ sozusagen, die in den vom Eroberungsstaate geschaffenen „Aufzug“ eingeht, um mit ihm das reichste, bunteste und vielfältigste Gewebe zu wirken.
Genesis und Entwicklung des Seestaates können nicht anders zur klaren Darstellung gebracht werden, als dadurch, daß wir vorerst die selbständigen Schöpfungen des ökonomischen Mittels ins Auge fassen.
1. Der vorstaatliche Handel. (Märkte und Messen.) ↩
Wir haben in unserer Allgemeinen Soziologie (S. 857 ff.) die friedlichen Beziehungen zwischen den primitiveren Gruppen geschildert und bemerkt, daß sie im wesentlichen an den Tausch geknüpft sind. Als ersteForm desTausches glaubtLippert den Feuer tausch ansprechen zu dürfen; eine viel bedeutendere Rolle hat sicherlich der Frauentausch gespielt, wie er sich in der Exogamie und dem damit zusammenhängenden Totem ausgewirkt hat. Von hier aus ist es dann auch zum Gütertausch gekommen, da, wie Gräbner mitteilt, die exogamen
[368]
Gruppen häufig in verschiedenen geographischen Bezirken mit verschiedenen Rohstoffen und daraus hergestellten Erzeugnissen hausen, die dann zum Austausch gelangen. Umgekehrt hat dann auf höherer Stufe der Handel wieder zur Exogamie geführt, indem hausierende Händler sich in den Stätten ihres Berufes mit eingeborenen Frauen verheirateten, um derart mehr als das nur prekäre Gastrecht zu genießen.
Auch bei den friedlichen Versammlungen sonst getrennter Gruppen, die (entgegen der Ratzenhoferschen Überzeugung von der „absoluten Feindseligkeit“) sich auf primitivster Stufe nicht selten finden, mag es zu solchen gelegentlichen Täuschen zwischen Stamm und Stamm gekommen sein, z. B. bei der friedlichen Ausbeutung sehr reichlich vorkommender freier Güter (a. a. O. S. 866).
Ferner erwächst der Gütertausch aus Gastgeschenken und Friedensgeschenken, wobei es gelegentlich schon zu versteckten Kriegsentschädigungen kommt, die der stärkere Stamm von dem schwächeren erpreßt (869).
Für den Ausgleich von Streitigkeiten bestehen überall sozusagen völkerrechtliche Regulierungen: „Man hat bestimmte Regeln im Verkehr durch Botschafter ; bei den Südaustraliern versuchen die Beilegung eines Zwistes Weiber: statten die Weiber des anderen Stammes einen Gegenbesuch ab, so gilt der Streit für beigelegt“. (Man bevorzugt namentlich alte Weiber als Gesandte, zum Teil, weil ihre Zauberkraft gefürchtet wird, zum anderen Teil wohl auch aus dem Grunde, weil ihr Verlust dem Stamme nicht besonders schmerzlich ist). „Die Einrichtung der Ngia-Ngiampe wirft ein Licht auf die Auffassung des Verkehrs von Volk zu Volk als einer wichtigen Angelegenheit. Die Nabelschnur eines Kindes, mit einem Büschel Federn zusammengebunden, wird dem Vater eines gleichaltrigen Kindes in einem anderen Stamme übergeben. Beide Kinder stehen von da an einander als Ngia-Ngiampe gegenüber, dürfen sich nicht berühren, nicht miteinander sprechen; erwachsen, werden sie die Vermittler des Tauschhandels“ [1].
Wir haben in unserer Allgemeinen Soziologie an der Hand der Völkerkunde gezeigt, daß die Voraussetzung eines regelmäßigen Handels, die Arbeitsteilung, schon auf sehr früher Stufe gegeben ist.
Und zwar müssen wir hier die sozusagen natürlich-geographische von der gewerblichen Arbeitsteilung unterscheiden.
Die erste führt, wie wir dargestellt haben, schon zwischen den exogamen Gruppen eines und desselben Stammes, die Gebiete mit verschiedenartigen Naturprodukten bewohnen, zu regelmäßigen Tauschbeziehungen [2].
[1] Ratzel, Völkerkunde I, S. 348.
[2] S. S. I, S. 867/8.
[369 ]
Das gleiche findet sich häufig zwischen benachbarten, einander stamm- und sogar rassefremden Gruppen. So z. B. tauschen am Kongo die Uferbewohner ihre Fische gegen die Bananen der Binnenstämme [1].
Die primitivsten Formen dieses Handels könnte man als einen Handel ohne Verhandeln bezeichnen: „Die Akka z. B. brechen zur Zeit der Fruchtreife in die Felder der Neger ein, rauben Bananen, Knollen und Getreide, lassen dafür aber ein Äquivalent an Fleisch zurück. Die Berg-Wedda legen, nach Sarasin, erbeutetes Wild des Nachts vor den Hütten der Singhalesen-Schmiede nieder, rächen sich aber blutig, wenn sie nicht nach einigen Tagen eiserne Pfeilspitzen als Gegengabe abholen können“ [2]. Von hier führt der Weg zum sogenannten „stummen Tauschhandel“, von dem schon Herodot weiß (IV, 196) : „Wenn die Karchedonier an die westafrikanische Küste kommen, laden sie ihre Ware aus und legen sie am Strande der Reihe nach hin, dann gehen sie wieder in ihre Schiffe und machen einen großen Rauch. Wenn nun die Eingeborenen den Rauch sehen, so kommen sie an das Meer und legen für die Waren Gold hin und dann gehen sie wieder weit weg von den Waren. Die Karchedonier aber gehen an das Land und sehen nach, und wenn des Goldes genug ist, so nehmen sie es und fahren nach Hause. Ist es aber nicht genug, so gehen sie wieder an Bord und warten ruhig ab. Dann kommen jene wieder und legen noch immer etwas Gold zu, bis die Karchedonier zufrieden sind. Keiner aber betrügt den andern, denn sie rühren weder das Gold eher an, als bis die Waren damit bezahlt sind, noch rühren jene die Waren eher an, als bis das Gold genommen.“
Was nun die gewerbliche Arbeitsteilung anbetrifft, so haben wir (S. S. I, S. 870ff.) gezeigt, daß sie schon auf sehr früher Stufe gegeben ist, ja, daß geradezu fabrikmäßige Produktion für den Handel sich schon in prähistorischer Zeit findet. Wir tragen noch einige Daten nach: „Bei den Marotse fertigt z. B. der eine Stamm Boote und Ruder, ein anderer Lanzen, ein dritter widmet sich dem Fischfang. Die einzelnen Stämme sind Zünfte geworden, sie führen Handwerkernamen (wie z. B. die „Schmiede“, die „Fischer“ usw.), die nach und nach zu Stammesnamen geworden sind. Es gibt Handelsvölker wie die Jolofs, Schmiedevölker wie die Balongo in Usindya . . ., es gibt „Salzdörfer“, ferner Arbeiterkolonien, die sich mehr oder weniger ausschließlich mit Töpferei, Waffenschmiedekunst, Schifferei, Gerberei, Palmweinbereitung, Lederbearbeitung, mit der Herstellung verzierter Kleiderstoffe, mit Jagd u. a. beschäftigen; auch kommen unstete Paria Völker vor, die, wie unsere Zigeuner, als Zauberer, Wahrsager, Sänger, Töpfer, Chirurgen usw.,
[1] Müller-Lyer, Phasen der Kultur, S. 249.
[2] Ib. S. 282.
[370]
usw., unter der seßhaften Bevölkerung herumwandernd, ihr Leben fristen“ [1].
Und noch einen Beleg für die prähistorische gewerbliche Arbeitsteilung. Man fand allein im Poitou 53 Werkstätten, in denen Steinwerkzeuge in Massen hergestellt wurden, und zwar zum Teil aus Steinen, die aus der Ferne importiert waren [2].
Aus solchen Beziehungen entwickeln sich regelmäßige Märkte und Messen. „Es gibt Handelsverkehr, wandernde Händler, besonders Märkte auf allen Stufen der Kultur“ (Ratzel). So sind die Pelzmärkte der nordasiatischen Jäger, z. B. der Tschuktschen, uralt, und Bücher berichtet von den „Wochenmärkten, die von den Negervölkern Zentralafrikas mitten im Urwald unter besonderem Friedensschutz abgehalten werden“ (873).
Den Übergang vom stummen zum eigentlichen Handel bildet der Verkehr auf Märkten, die „zur größeren persönlichen Sicherheit der handeltreibenden Parteien an der Stammesgrenze, auf gewissermaßen neutralem [3] oder zumindest als herrenlos betrachtetem Gebiete“ abgehalten werden, meistens „in freiem Lande, oft auf Hügeln, so daß die Ankömmlinge schon von weitem sichtbar sind, und jede feindliche Bewegung leicht erkannt werden kann [4]. Kurz, das gegenseitige Mißtrauen war das für die Bestimmung des Marktortes ausschlaggebende Moment. Es wäre nur ein Beweis von politischer Unklugkeit gewesen, die stammesfremden Marktbesucher in das eigene Dorf einzulassen“ [5].
Sehr früh bildet sich eine Scheidung aus, die wir auf höherer Stufe als bedeutsam erkennen werden : der Unterschied zwischen den „Märkten“ im engeren Sinne, die alltäglich oder einmal oder mehrmals in der Woche gehalten werden, und den „Messen“, die nur einmal oder einige Male im Jahre stattfinden. Irgendwie hängt diese Scheidung mit der in Weiber- und Männerhandel zusammen ; Schurtz beschreibt den Männerhandel als Fernhandel, betont seinen kriegerischen Anstrich und stellt ihn in Gegensatz zum Frauenhandel, der sich stets in engeren Grenzen hält und zum Markthandel entwickelt, während der Männer-
[1] Müller-Lyer, a. a. O. S. 162.
[2] Ib. S. 107. Vgl. Ratzel, Anthropog. I, S. 294. Selbst in Gran Canaria sind Beile aus Chloromelanit gefunden worden, die nur von außen gekommen sein können, und in Korsika Feuersteinwaffen, deren Rohstoff auf der Insel nicht vorkommt.
[3] Solche Märkte finden sich oft in den neutralen „Grenzsäumen“ zwischen den Völkern (Ratzel, Anthropog. I, S. 176).
[4] Auch Gnus und Büffel rasten aus dem gleichen Grunde gern auf Hügeln (Al- verdes, a. a. O. S. 82). Aus dem gleichen Motiv sind oft die fruchtbaren Ebenen verlassen worden, um im Gebirge Sicherheit zu finden. Vgl. Schulman, Seidenindustrie, S. 261 über Syrien.
[5] Lasch, Das Marktwesen auf den primitiven Wirtschaftsstufen, Ztschr. f. Soz. Wiss. IX (1906).
[371 ]
handel sich oft in Gestalt bewaffneter Expeditionen nach, entfernt im fremden Stammesgebiet gelegenen, Fundorten seltener Naturschätze vollzieht [1]. Der Frauen- und Nahhandel ist der Verkehr der „primären Arbeitsteilung“ zwischen Landwirtschaft und Gewerbe: noch heute ist der Lebensmittelhandel auf den Wochenmärkten eine Hauptaufgabe unserer Bauernfrauen; der Fern- und Männerhandel ist der Verkehr der geographischen und gewerblich-sekundären Arbeitsteilung [2].
Alle diese Märkte stehen, wie wir soeben durch Ratzel erfuhren, unter besonderem Friedensschutze. Eines der frühesten und zweckdienlichsten Mittel dazu war das Verbot des Waffentragens der Männer auf dem Marktplatz und zur Marktzeit. „Bei den Battak trug jeder, der zu Markte ging, in der Mündung seines Gewehrlaufs einen grünen Zweig als Zeichen des Friedens; und wenn er auf den Marktplatz kam, schoß er die Ladung in einen Erdhaufen, aus welchem er erst vor der Abreise die Kugel wieder herausnahm“. Lasch, dem wir diese Mitteilung entnehmen (S. 770f.), hat noch eine Anzahl weiterer Belege für diese äußere Marktregelung zusammengetragen.
Wichtiger aber als diese äußere Polizei ist die innere durch „Tabuierung“ der Märkte, die regelmäßig unter den Schutz einer, den Marktfrieden wahrenden und rächenden, Gottheit gestellt sind. Diese Gottheiten werden oft als in den auf dem Marktplatz befindlichen Bäumen hausend gedacht. „Lubbock hat schon vor langer Zeit auf die Beziehung aufmerksam gemacht, welche der Name des griechischen Handelsgottes Hermes zu den Termen oder Grenzsteinen aufzeigt, welche den neutralen Marktplatz von den bewohnten Nachbarterritorien absonderten. Die Verletzung der Neutralität des Marktes wird als Beleidigung der . . . Götter empfunden und von ihnen mit Unglücksfällen, Krankheit oder Tod gerächt“ (Lasch, S. 769f).
Von jenen Negermärkten im Urwalde berichtet Ratzel aus dem Kongogebiet: „Sie werden als neutraler Boden angesehen, den kein Häuptling beanspruchen, und für dessen Benutzung sich niemand ein Vorrecht oder einen Tribut aneignen darf3“). An anderer Stelle sagt er: „Die Menge flößt dem Einzelnen Vertrauen ein, und die Unverletzlichkeit der Marktbesucher scheint ein durch lange Übung geheiligter Rechtsbegriff zu sein. Erinnert das nicht an den germanischen Marktfrieden“ [4]?
[1] Lasch, a. a. O. S. 623.
[2] Vgl. S. S. III, S. 247ff.
[3] Völkerkunde II, S. 310. Hier reiches Material. Vgl. ferner II, S. 168.
[4] A. a. O. S. 62. Müller-Lyer (Phasen der Kultur, S. 282) macht darauf aufmerksam, daß in den altarischen Sprachen die Worte für Fremder und Feind, z. B. hostis und xenos, dieselben waren, während andererseits sibja zugleich Frieden und Sippe bedeutet. Und de Greef schließt aus der Verwandtschaft der Worte pax und pactum, daß der Begriff „Frieden“ bereits eine abgeleitete Idee ist, einen Vertrag voraussetzt (Introd. à la Sociologie II, S. 17).
[372]
Richard Lasch schreibt zusammenfassend: „Die Strafen für auf dem Markte begangene Verbrechen waren im allgemeinen sehr streng. An der Person des Marktbesuchers verübte Gewalttaten, als Verletzung des Marktfriedens, wurden unnachsichtlich in der schärfsten Weise geahndet. Jeder, der den Marktplatz betritt, ist dort frei von Verfolgung wegen früher begangener Verbrechen ; nicht einmal der Bluträcher kann ihm etwas anhaben, ohne der Marktjustiz zu verfallen“ [1]. Hier wird nicht nur die Entstehung des Asylrechts, sondern auch des Grundsatzes anzuknüpfen sein, der in der deutschen Rechtsgeschichte eine so große Rolle spielte: „Stadtluft macht frei“.
2. Der Handel und der primitive Staat. ↩
Der Räuberkrieger hat zwei wichtige Gründe, die Märkte und Messen seines Einflußgebietes sehr pfleglich zu behandeln, gerade wie er — wir werden das an seiner Stelle genau zu betrachten haben — allen Grund hat, in Bewässerungsgebieten jene andere Institution zu pflegen, die das lebensnotwendige Werk verwaltet : die Priesterschaff.
Der erste Grund des Marktschutzes durch den Hirten ist ein außerwirtschaftlicher : auch er empfindet die abergläubische Furcht vor der magischen Kraft der den Friedensbruch rächenden Gottheit. Der andere, wirtschaftliche, und wahrscheinlich mächtigere, ist der — und hier glauben wir zum ersten Male auf diesen Zusammenhang hinzuweisen —, daß er selbst des Marktes nicht wohl entraten kann.
Seine Beute enthält auf primitiver Stufe viele Güter, die sich für seinen unmittelbaren Verzehr und Gebrauch nicht eignen. Er hat Güter nur von wenigenArten, von diesen aber bei gutem Glück so viele Exemplare, daß der „Grenznutzen“ jedes einzelnen für ihn gering ist. Das gilt vor allem für den wichtigsten Erwerb des politischen Mittels, den kriegsgefangenen Sklaven [2]. Um zunächst vom Hirten zu sprechen, so ist sein Sklavenbedarf durch die Größe seiner Herde eng begrenzt: er ist durchaus geneigt, den Überfluß gegen andere Güter auszutauschen, die für ihn von höherem subjektiven Wert sind : Salz, Schmuck, Waffen, Metalle, Gewebe, Geräte usw. Ja, er wird, wenn er erst einmal einen Markt dafür gefunden hat, die begehrten Artikel, vor allem Sklaven, zum Zwecke solchen Tauschhandels erbeuten. Darum vor allem ist der Hirt nicht nur fast immer Räuber, sondern auch Händler und schützt den Handel. Nichts kann, wenigstens für die frühen Perioden, gegenstands-
[1] A. a. O. S. 773.
[2] Für Carey, der den Handel haßt, beginnt sogar aller Handel mit diesem „Schacher in Knochen und Muskeln“ (Lehrbuch I, S. 124).
[373 ]
loser sein als die Sombartsche Gegensetzung von Held und Händler. Die beiden Begriffe fallen überall, bei allen Rassen, zusammen.
Der Hirt schützt den Handel, der zu ihm kommt, um ihm seine Beute gegen Güter eines fremden Kulturkreises abzutauschen. Von jeher haben die Hirten die, ihre Steppen und Wüsten durchziehenden, Karawanen gegen Schutzgeld geleitet. Ed. Meyer erzählt von den arabischen Beduinen: „Daneben aber vermitteln sie einen geregelten Verkehr durch weite Gebiete; denn gerade in der Wüste ist ein Austausch der Waren, deren man für das Leben bedarf, bei der Dürftigkeit der heimischen Produkte für die Beduinen ebensowenig zu entbehren wie für die seßhaften Stämme; und er wirft reichen Gewinn ab, zumal da jenseits der Wüstengebiete entwickelte Kulturländer liegen, deren Handel auf den Durchgang durch die Wüste angewiesen ist. So sind dieselben Stämme, welche oft genug als die wildesten und rücksichtslosesten Räuberstämme auftreten, zugleich zuverlässige Geleiter der Handelskarawanen, und gelten als „die gerechtesten der Menschen“, denen fremdes Leben und Eigentum absolut heilig ist, sobald es unter den Schutz des Stammes oder auch nur eines Stammesgenossen getreten ist“ [1]. Der Gegensatz zwischen „Binnen- und Außenmoral“ (Max Weber), den wir, als den entscheidenden und bewegenden Gegensatz der ganzen Geschichte, herauszuarbeiten bemüht sind, tritt hier mit ganz besonderer Klarheit hervor.
Aber die Hirten schonen und schützen den Handel auch dort, wo nicht er zu ihnen, sondern sie zu ihm kommen. Herodot berichtet erstaunt über den geweihten Markt der Argippäer mitten im gesetzlosen Lande der skythischen Hirten, daß seine waffenlosen Einwohner auf das wirksamste durch den heüigen Frieden ihrer Marktstätte geschützt seien: „Niemand tut ihnen ein Leid an, denn sie gelten für heilig; auch haben sie gar keine kriegerischen Waffen ; dabei sind sie es, welche die Streitigkeiten der Nachbarn schlichten, und wer zu ihnen als Flüchtling entkommen ist, dem tut niemand etwas zuleide“ [2]. Lippert erkennt hier einen sich häufig wiederholenden Typus: „Das alles ist immer wieder dieselbe Argippäergeschichte, die Geschichte von dem „heiligen“, gerechten „waffenlosen“ handeltreibenden und streitschlichtenden Stämmchen inmitten einer beduinenhaft nomadischen Bevölkerung“ [3].
Es sind ganz die gleichen Gründe, Kraft deren wir den Übergang von dem Bärenzum Imkerstadium sich vollziehen sahen, aus denen der Hirt solche Märkte schützt und erhält. Eine einmalige Plünderung hieße auch hier die Henne schlachten, die die goldenen Eier legt:
[1] Gesch. d. Altertums I. 2, S. 383/4.
[2] IV, 23. Zit. nach Lippert, Kulturgesch. I, S. 459.
[3] II, S. 170.
[374]
viel vorteilhafter ist es, den Markt zu erhalten, seinen Frieden eher noch zu befestigen, um außer dem alten Vorteil des Eintausches fremder Güter gegen Beute auch noch das Schutzgeld, die Herrensteuer, zu empfangen. Daher haben die Fürsten des Eroberungsstaates aller Stufen die Märkte, Handelsstraßen und Kaufleute unter ihren besonderen „Königsschutz“ genommen, oft genug sich sogar das Monopol des Fremdhandels vorbehalten. Aus der Kanzlei Ludwigs des Frommen ist uns das Formular eines Schutzbriefes vom Jahre 828 erhalten, das „gewiß vielen ähnlichen zum Muster gedient hat“. Es enthält die Pflichten und die dafür verliehenen Rechte der „Königskaufleute“ in großer Ausführlichkeit : sie haben sich in gewissen Zwischenräumen in der Pfalz einzufinden und eine Verehrung darzubringen. Dafür darf niemand ihnen widerrechtliche Beschwerde zufügen, ihre Schiffe sollen nicht unter dem Vorwande des Königsdienstes in Anspruch genommen werden, von persönlichen Dienstverpflichtungen sind sie befreit, Heerbann und andere Bußen dürfen die öffentlichen Beamten von ihnen nicht einziehen, Zoll haben sie nicht zu entrichten, Prozesse gegen sie und ihre Leute gelangen außer in schnell zu erledigenden Bagatellsachen an den König selbst oder den von ihm eingesetzten Magister der Kaufleute. Diese sollten also nicht bloß gegen Straßenraub und dergleichen, sondern auch und vor allem gegen die Willkür der königlichen Beamten geschützt werden. Gegen Gewalttat sind sie durch eine besonders hohe Buße (zehn Pfund Gold in einem für Juden ausgestellten Schutzbrief des gleichen Kaisers) geschützt; auch sonst erhalten jüdische Königskaufleute noch sehr wertvolle andere Privilegien in bezug auf die Ausübung ihrer Religion, ihr Vermögen und ihre Geschäfte; so z. B. dürfen sie, außer an Festtagen, christliche Lohnarbeiter verwenden, auch fremde Sklaven kaufen und innerhalb der Reichsgrenzen wieder verkaufen [1].
In ganz dem gleichen Geiste und aus ganz den gleichen Motiven wird der Königsschutz der Kaufleute in allen, nur ein wenig gefestigten, Staaten gehandhabt worden sein.
Und aus den gleichen Gründen und im gleichen Geiste schützen die Hirten und die Fürsten der von ihnen gegründeten Staaten auch die Straßen, die zu den Märkten ziehen, und diese Märkte selbst. Ed. Meyer berichtet von dem Jahwe-Heiligtum im Gebiet des Stammes Levi: „Hier besitzen die Priester eine große Autorität auch bei den Nachbarstämmen, deren Streitigkeiten sie beim „Prozeßquell“ schlichten. . . . Derartige Heiligtümer von weit verbreitetem Ansehen an einem Quell, wo die verschiedenen Stämme friedlich zusammenkommen, und das Gottesfest zugleich ein Jahrmarkt ist, . . . finden sich in der Wüste vielfach. . . . Auch das spätere Ansehen von Mekka mit seiner Messe
[1] Berichtet nach Caro, a. a. O. S. 130ff.
[375 ]
und seinem heiligen Stein, der Kaaba, beruht auf derselben Grundlage [1]. Caro sagt von Mekka: „Am Pilgerfeste beim arabischen Nationalheiligtum, der Kaaba, fanden Jahrmärkte statt, und unverletzlich gewahrte Stammessitte gewährleistete Wallfahrern wie Kaufleuten Sicherheit“ [2].
Auch das sagenberühmte Nippur, die Hauptstadt Sinears, des so genannten Mesopotamien, bildete „sozusagen ein neutrales Gebiet unter der Herrschaft des jeweiligen, von ihrem Gotte anerkannten Oberkönigs“ [3].
Solche befriedeten Märkte finden sich nun nicht bloß im Herrschaftsgebiet der Landhirten, sondern auch der Seenomaden. Als ein Beispiel viel höherer Stufe sei Caere genannt, dessen Einwohner nach Strabon „bei den Hellenen wegen ihrer Tapferkeit und Gerechtigkeit viel galten, und weil sie, so mächtig sie waren, des Raubes sich enthielten“. Mommsen, der die Stelle anführt, fügt hinzu: „Nicht der Seeraub ist gemeint, den der caeritische Kaufmann wie jeder andere sich gestattet haben wird, sondern Caere war eine Art von Freihafen für die Phönizier wie die Griechen“ [4].
Wir sind hier auf eine der typischen Bildungen gestoßen, die in ihrer Bedeutung u. E. bisher nicht nach Gebühr eingeschätzt worden sind. Sie haben, wie uns scheinen will, auf die Entstehung der Seestaaten einen mächtigen Einfluß ausgeübt. Die inneren Gründe nämlich, aus denen wir die Hirten zum Handel und, wenn schon nicht zur Gründung, so doch zur Schonung der Märkte kommen sahen, mußten mit noch vermehrter Kraft die Wikinge zu dem gleichen Verhalten führen. Denn der Transport der Beute, vor allem der Herden und Sklaven, der auf den Pfaden der Wüste und Steppe schwierig und wegen der Langsamkeit der Fortbewegung, die die Verfolgung erleichtert, auch gefährlich ist, ist im Kriegskanu und „Drachen“ leicht und gefahrlos. Darum ist der Wiking in noch ganz anderem Grade Kaufmann und Markthändler als der Hirt. „Krieg, Handel und Piraterie, dreieinig sind sie, nicht zu trennen“, heißt es im „Faust“. „Um der Horte willen zogen Helden auf Abenteuer aus“ [5].
II. Die Entstehung des Seestaates. ↩
Auf diesen Handel mit der Beute des Seeraubes ist, wie wir glauben, in vielen Fällen die Entstehung derjenigen Städte zurückzuführen, um
[1] Gesch. d. Altertums I. 2, S. 314.
[2] A. a. O. S. 109. Wells berichtet (a short history of the world, S. 145/6), Mekka habe den Islam nur unter der Bedingung angenommen, daß die uralten Pilgerfahrten zur Kaaba, von denen die Stadt lebte, weiter stattfänden.
[3] Meyer, a. a. O. S. 478.
[4] Röm. Gesch. I, S. 139.
[5] Neurath, a. a. O. S. 23.
[376]
die als ihre politischen Vororte sich die Stadtstaaten der alten Geschichte, d. h. der mittelländischen Kultur, auswuchsen; in sehr vielen anderen Fällen hat der gleiche Handel stark mitgewirkt, um sie zum gleichen Ziel der politischen Ausgestaltung zu führen.
Man wird die Entstehung dieser Markthäfen im allgemeinen auf zwei Typen zurückführen können: sie erwuchsen entweder als Seeräuberburgen unmittelbar durch Festsetzung an einer fremden Küste oder als „Kaufmannskolonien“, die auf Grund friedlichen Vertrages in Häfen fremder Eroberungsstaaten zugelassen wurden. In einzelnen Fällen mag auch das bloße Beispiel benachbarter Häfen hingereicht haben, um ganz aus inneren Kräften eine günstig gelegene Hafensiedlung zu der gleichen Ausbildung zu entwickeln.
1. Seeräuberburgen. ↩
Das Mittelmeer ist von der frühesten Zeit bis auf die allerneueste Geschichte fast ununterbrochen von Piraten heimgesucht worden, die an seinen häfenreichen Küsten und in dem Gewirre seiner Archipele und Schären (in Südkleinasien, Dalmatien usw.) sichere Schlupfwinkel hatten. Ähnlich liegen die Dinge im Indischen Ozean und auf der Inselwelt des Pacific wie an den Küsten der chinesischen und japanischen Meere.
Ägypten hatte früh von Piraten zu leiden. Die Inschriften des vierzehnten Jahrhunderts berichten schon von lykischen Seeräubern (Lukki, äg. Ruka), die der beiden folgenden Jahrhunderte von den Angriffen der Seevölker auf Libyen und Ägypten ; sie nennen außer den Danaern, Achäern und Lykiern noch andere Namen, so z. B. die Tursa, die mit den Etruskern identisch sind, die Philister (Persta) und die Zakkari [1]. Meyer ist sogar der Meinung, daß, wie die Thraker nach Kleinasien und die Illyrier nach Apulien, so auch die Italiker zur See nach der Apenninenhalbinsel gelangt sind [2]. Denn in der Po-Ebene, durch die sie hätten ziehen müssen, fand sich bis zur Kelteninvasion keine Spur einer indogermanischen Bevölkerung.
Was die Hellenen anlangt, so entnehmen wir dem ersten Bande von Belochs griechischer Geschichte folgende Daten: sie blieben lange ein Volk von Hirten und Ackerbauern; die Herrensitze lagen noch in mykenischer Zeit fast durchweg in einiger Entfernung vom Meere. Im XVI. Jahrhundert beginnen die Insassen der östlichen Landschaften als Piraten die See zu befahren, während die Hellenen des Nordens und Nordwestens noch sehr lange die Abneigung gegen die Seefahrt bewahrten. Die Raubfahrten richteten sich zuerst gegen das reiche Kreta, dessen
[1] Ed. Meyer, Gesch. d. Altertums I. 2, S. 801f.
[2] ibd. S. 884.
[377]
Städte fielen, und gegen die übrigen Inseln [1] (126). In der Ritterzeit galt der Seeraub ebenso als ein adliges Gewerbe wie das Forttreiben der Viehherden der Nachbarn (212). Im Laufe des VIII. oder spätestens im Anfang des VII. Jahrhunderts haben die Achäer sich am Golfe von Tarent festgesetzt (235) ; der äußerste Punkt, den sie an der italischen Küste erreichten, war Kyme; hier stießen sie mit der etruskischen Macht zusammen, die sich im VII. Jahrhundert stark entfaltete (244). Etwas später sind auch Propontis und Pontus erobert und besiedelt worden (257). Die Raubfahrten nach Ägypten wurden immer wieder aufgenommen, sobald das Reich durch innere Krisen erschüttert wurde, so z. B. in der Zeit vor Psammetich, der dann gerade mit Hilfe der Hellenen die assyrische Herrschaft abschütteln konnte (262). Noch zur Zeit des Kambyses (um 540) war die Piratenflotte des Polykrates der Schrecken des Ägäischen Meeres, und blühte der Seeraub an den Küsten des westlichen Mittelmeeres, wo zwischen Hellenen, Tyrrhenern und Phönikern ein beständiger Kriegszustand herrschte, und jedes fremde Schiff als gute Prise galt (283).
Die Träger sowohl des Seehandels wie des Seeraubs dürften zuerst die Könige gewesen sein ; in Ägypten waren immer nur der Pharao und die Tempel Schiffsbesitzer, eine Privatreederei bestand nicht. „Dagegen ist sie das Kennzeichen der Hellenen schon in homerischer Zeit und der Phöniker. Ursprünglich hat bei den Griechen wohl der Stadtkönig die Schiffe, und zwar für Tausch wie für Seeraub in der Hand gehabt. Aber er konnte nicht hindern, daß neben ihm große Geschlechter emporwuchsen, die am Schiffsbesitz beteiligt waren und ihn schließlich nur noch als primus inter pares duldeten“ [2].
Diese Raubfahrten führten nun vielfach zur Festsetzung an der Küste in Seeräuberburgen, von denen aus das umliegende Land gebrandschatzt und allmählich unterworfen wurde. Die ersten Träger dieser kriegerischen Invasion werden „Seekönige“ gewesen sein: jüngere oder vertriebene Königssöhne oder berühmte adelige Führer, die mit ihrem Gefolge hinauszogen, um sich Herrschaft zu gewinnen, wie das heute noch im malayischen Archipel vorkommt. Die auf diese Weise gegründeten Kolonien blieben politisch selbständig. Erst seit der Wende vom VII. zum VI. Jahrhundert sind Kolonien von der Regierung der Mutterstadt gegründet worden und dann auch in politischer Abhängigkeit von dieser geblieben [3].
Für diese Seeräuberburgen haben wir eine ganze Anzahl von wichtigen Beispielen aus der alten Geschichte. Zunächst von den
[1] Die Westküste Kleinasiens ist nach Beloch (a. a. O. S. 139) in der Zeit von etwa 1300 bis 1000 erobert worden.
[2] Max Weber, Wirtsch.Gesch. S. 180.
[3] Beloch a. a. O. I. 1, S. 232.
[378]
Phöniziern: die von Ed. Meyer [1] zusammengetragenen Daten — ihre wichtigsten Städte, Tyros, Sidon usw. liegen auf Felseninseln, die der Küste vorgelagert sind, und die Bevölkerung des Inneren ist wahrscheinlich anderer Art — lassen die Möglichkeit als gegeben erscheinen, daß dieses erste, uns aus der Geschichte der Antike bekannte, Räuber- und Händlervolk ebenfalls nicht zu Lande, sondern bereits zur See in das Gebiet gelangt ist, das ihren Namen trägt. Höchst wahrscheinlich aber ist ihre bedeutsamste Kolonie, Karthago, als solche Seeräuberburg an fremder Küste entstanden; und eine ganze Kette gleicher Seeburgen haben die hellenischen Seenomaden jonischen, dorischen, achäischen Ursprungs an der adriatischen und tyrrhenischen Küste Italiens, auf allen Inseln dieser Meere und an den Golfen Südfrankreichs, am schwarzen Meere und seinen Zugängen und in Nordafrika (Kyrene) angelegt. Auch die Etrusker und andere Mittelmeervölker sind in dieser Weise koloniebildend aufgetreten. Überall wurden die Einwohner verknechtet, in Leibeigenschaft herabgedrückt.
Einige dieser Küstenstaaten haben sich zu Gebilden ausgewachsen, die den Landstaaten sehr ähnlich waren ; die Herrenklasse war und blieb eine Aristokratie von Grundbesitzern [2]. Maßgebend dafür waren erstens geographische Verhältnisse: der Mangel an guten Häfen, das Vorhandensein eines leicht zu unterwerfenden und in Abhängigkeit zu haltenden Hinterlandes, sei es, weil man auf eine friedliche Bauernschaft gestoßen war, sei es, weil politische Zersplitterung die primitiven Staatsgebilde des Hinterlandes verteidigungsunfähig machte. Zweitens mochten die Bedingungen der aus der Heimat eingebrachten politischen Organisation wenigstens zuerst ihre Rolle spielen. Es waren in der Regel Edelinge, die „auf den Wiking“ zogen — als jüngere Söhne, die sich Herrschaft suchten, als Flüchtlinge innerer Fehden, zuweilen als feierlich eingesetzte Führer eines ganzen „Heiligen Frühlings“. Wenn diese Männer zu Hause als Landjunker aufgewachsen waren, so werden sie auch in der Fremde in der Regel nur „Land und Leute“ gesucht haben. Die Eroberung Englands durch die Angeln und Sachsen gehört hierher, vor allem aber die Conquista der Spanier und Portugiesen in Mexiko und Südamerika, während die neueren englischen Kolonisationsunternehmungen schon ganz den händlerischen Typus zeigen, von dem wir sofort zu sprechen haben werden.
Mommsen hat den Gegensatz sehr fein herausgearbeitet: „Der achäische Städtebund war eine eigentliche Kolonisation. Die Städte waren ohne Häfen — nur Kroton besaß eine leidliche Reede — und ohne Eigenhandel. Der Sybarite rühmte sich, zu ergrauen zwischen
[1] Gesch. d. Altertums I. 2, S. 422.
[2] Vgl. Beloch I. 1, S. 231.
[379]
den Brücken seiner Lagunenstadt, und Kauf und Verkauf besorgten ihm Milesier und Etrusker. Dagegen besaßen die Griechen hier nicht nur den Küstensaum, sondern herrschten von Meer zu Meer ... ; die eingeborene ackerbauende Bevölkerung mußte in Klientel oder gar in Leibeigenschaft ihnen wirtschaften und zinsen“. Diesen Landjunkern stellt er die königlichen Kaufleute der übrigen hellenischen Kolonien in Süditalien gegenüber: „Auch sie verschmähten den Ackerbau und Landgewinn keineswegs ; es war nicht Weise der Hellenen, wenigstens seit sie zu ihrer Kraft gekommen waren, sich im Barbarenland nach phönizischer Art an einer befestigten Faktorei genügen zu lassen. Aber wohl waren diese Städte zunächst und vor allem des Handels wegen gegründet, und darum denn auch, ganz abweichend von den achäischen, durchgängig an den besten Häfen und Landungsplätzen angelegt“ [1].
Wir dürfen wohl annehmen, daß hier die Stadtgründer nicht Landjunker, sondern bereits seefahrende Kaufleute, „Seekönige“, gewesen sind.
Jene Landstaaten in Seenähe haben auf den großen Gang der Weltgeschichte keinen erheblichen Einfluß geübt, wohl aber die eigentlichen Seestädte, die ihr Schwergewicht auf Handel und Kaperei verlegten.
2. Kaufmannskolonien. ↩
Aber solche Seestädte im eigentlichen Sinne sind, wie gesagt, auch noch auf eine ganz andere Weise entstanden, nämlich aus friedlichen Anfängen durch das, was man heute eine „friedliche Durchdringung“ zu nennen pflegt.
Wo die Wikinge nämlich nicht die Gewißheit hatten, mit Gewalt zu ihrem Ziele kommen zu können, weil stärkere Staatsbildungen die Küste beherrschten, da nahmen und boten sie Frieden und ließen sich als Kaufmannskolonien nieder. Und so wurden sie die Gründer der „Stadt“ im eigentlichen politisch-ökonomischen Sinne, der Handelsund Gewerbsstadt: „Städte sind in der weitüberwiegenden Zahl von Fremden, wenn nicht begründet, so doch erst aus ländlichen Ansiedlungen zu Städten umgestaltet worden. Soweit die Kulturgeschichte zurückreicht, sind Handel und Industrie nach den Orten, an denen wir sie vorfinden, aus fernliegenden Lebensbedingungen und Kulturverhältnissen übertragen worden“ [2].
Wir kennen solche Ansiedlungen aus aller Welt : in Häfen und Landmärkten. Die hier angesessenen Kaufmannschaften fallen unter den Oberbegriff der „Gilde“, Unterbegriff „Fremdengilde“; (der zweite Unter begriff, die „ansässige Händlergilde“, interessiert uns hier noch nicht). Die Fremdengilde kann entweder lokalen oder interlokalen
[1] A. a. O. I, S. i32ff.
[2] Hdwb. d. Stsw. I, S. 356.
[380]
Charakter haben: [1] für den zweiten Fall ist die deutsche „Hansa“ das große Beispiel; aber hier handelt es sich um eine sekundäre Bildung, um nachträglichen Zusammenschluß lokaler Gilden. Uns interessieren die primären Bildungen vor allem.
Von diesen stehen uns am nächsten die Niederlassungen der norddeutschen Kaufleute in den Nord- und Ostseeländern: der'Stahlhof in London, die hanseatischen Niederlassungen in Skandinavien (Tyske Brügge in Bergen), auf Schonen und in Rußland: der Petershof in Nowgorod, die Kolonie in Pskow usw. In Vineta befand sich zur Slavenzeit ein deutsches Kontor, das zu Magdeburg in engen Beziehungen stand [2], in Kulm war eine Griechenkolonie [3] wie seinerzeit die Griechenstadt Gelonos im Lande der Budinen bestanden hatte [4]. Die Russen, Tataren und Armenier hatten Niederlassungen in Lemberg [5], die verschiedensten Nationen in Wisby, auf Schonen, in Wilna [6].
Die Rechtsverhältnisse dieser Kolonien waren in späterer Zeit verschieden, je nach der Entwicklung des Gaststaates. Wo dieser bereits einen eigenen Händlerstand entwickelt hatte oder gar in seiner Entwicklung den Gästen voraus war, da „oktroyierten die einheimischen Kaufleute den fremden derartige Einrichtungen, um ihre Erwerbschancen zu kontrollieren und sie selbst im Zaume zu halten : so bei dem Fondaco der deutschen Kaufleute in Venedig“ [7], der fast keine Selbstverwaltung hatte; die Beamten wurden von der Stadt eingesetzt, die Kaufleute selbst durch Makler kontrolliert [8]. Wo aber die fremden Kaufleute in primitivere Verhältnisse eindrangen, da waren sie in aller Regel autonom, wählten ihre Vorsteher selbst und saßen nach ihrem eigenen heimatlichen Rechte. Und dieser Fall ist es, der für unsere idealtypische Betrachtung überwiegende Bedeutung hat.
Die Geschichte des Altertums ist voll von der Gründung solcher Niederlassungen. Auch hier sind die Phönizier [9] die Vorläufer. Im Gegensatz zu der ersten hellenischen Kolonisation, die, wie wir zeigten, vorwiegend auf die Eroberung von Land und Leuten gerichtet war, „war jede phönizische Kolonie zunächst eine Handelsfaktorei, die sich unter günstigen Umständen zur Ackerbaukolonie entwickeln konnte“ [10].
[1] Max Weber, Wirtscbaftsgesch. S. 204.
[2] Kloeden, Berlin und Kölln, S. 257.
[3] Kloeden, a. a. O. S. 253.
[4] Meitzen, Siedelung und Agrarwesen I, S. 498.
[5] Roepell-Caro, Geschichte Polens III, S. 59. ·
[6] Roepell-Caro, ib. III, S. 28.
[7] Weber, Wirtschaftsgesch., S. 190.
[8] Weber, ib., S. 194.
[9] Vgl. Winckler, Bedeutung der Phönizier usw., S. 350/1.
[10] Beloch, Griech. Gesch. I, S. 231. Der Satz ist wohl etwas zu apodiktisch. Karthago steht doch wohl dem ersten Typus näher.
[381]
Später, als das Gewerbe und der Handel Griechenlands sich entfaltet hatten, wendeten sich auch die Hellenen mehr und mehr dieser Methode zu. Von etwa 600 an, wo Massilia gegründet wurde, hat diese gewaltige Handelsstadt selbst und viele andere die Küsten des Mittelmeers mit solchen Faktoreien zu besetzen begonnen [1]. Und die Hellenen sind auch in das Gebiet der mächtigen Großreiche gelangt: so z. B.. hat Amasis von Ägypten vierzehn griechischen Handelsstädten, darunter sieben jonischen, das Niederlassungsrecht in der milesischen Gründung Naukratis verliehen, während er gleichzeitig alle übrigen Häfen des Landes für den Verkehr zur See sperrte [2].
Eine ganz ähnliche Tätigkeit, wie sie in dem Mittelmeer Semiten und Indogermanen ausübten, haben im asiatischen Mittelmeer die Malaien vollzogen: „GanzeVölkerschaften sind durch den Handel gleichsam verflüssigt, so vor allem die sprichwörtlich geschickten, eifrigen, allgegenwärtigen Malaien sumatranischer Abkunft und die ebenso gewandten wie verräterischen Bugi von Celebes, die von Singapur bis Neu-Guinea auf keinem Platz fehlen und neuerdings besonders auf Aufforderung einheimischer Fürsten in Massen eingewandert sind. Ihr Einfluß ist so stark, daß man ihnen gestattet, sich nach ihren eigenen Gesetzen zu regieren, und sie fühlen sich so stark, daß es an Versuchen, sich unabhängig zu machen, bei ihnen nicht gefehlt hat. Die At Chinesen nahmen ehemals eine ähnliche Stellung ein: nach dem Sinken des von sumatranischen Malaien zum Emporium gemachten Malakka war einige Jahrzehnte lang in der weltgeschichtlichen Wendezeit um den Beginn des 17. Jahrhunderts Atchin die lebhafteste Reede dieses fernen Ostens“ [3].
Der Typus in den Landstaaten ist ganz der gleiche. In Itil, der Hauptstadt des Chasarenreiches, dessen Staatsreligion bekanntlich das Judentum war, hatten die westlichen Juden solche Niederlassungen [4]. „In den israelitischen Staaten befanden sich kleine Kolonien von fremden Kaufleuten und Handwerkern, denen man bestimmte Viertel der Städte überließ, wo sie, unter dem Schutz des Königs stehend, nach ihren eigenen religiösen Sitten leben durften“ [5]. Ja, diese Niederlassungen waren Gegenstand diplomatischer Verhandlungen zwischen den Staaten [6]. „Der ephraimitische König Omri sah sich durch die kriegerischen Erfolge seines Gegners, des damaszenischen Königs, gezwungen, den aramäischen Kaufleuten gewisse Teile der Stadt Samaria zu überlassen, wo
[1] A. a. O. S. 251.
[2] A. a. O. S. 263, 278.
[3] Ratzel, Völkerkunde I, S. 160.
[4] Schipper, Anfänge des Kapitalismus bei den abendländischen Juden, S. 19.
[5] Frants Buhl, Die sozialen Verh. d. Israeliten, S. 48.
[6] A. a. O. S. 78/9.
[382]
sie unter königlichem Schutz Handel treiben konnten. Als später das Kriegsglück seinem Nachfolger Ahab günstig war, verlangte dieser vom aramäischen Könige dasselbe Vorrecht für die ephraimitischen Kaufleute in Damaskus“ (I. Kön. 20, 34). Ebenso hausten die römischen Kaufleute in dem ganzen Mittelmeergebiete: „Überall standen die Italiker zusammen als festgeschlossene und organisierte Massen, die Soldaten in ihren Legionen, die Kaufleute jeder größeren Stadt als eigene Gesellschaften, die in dem einzelnen provinzialen Gerichtssprengel domizilierten oder verweilenden römischen Bürger als „Kreise“ (conventus civium Romanorum) mit ihrer eigenen Geschworenenliste und gewissermaßen mit Gemeindeverfassung“ [1]. So ist es über die Jahrtausende fortgegangen. Die Ghetti der Juden waren vor den großen Judenschlächtereien des Mittelalters nichts als solche geschlossene Handelskolonien, wo die Fremden unter ihren eigenen Richtern und Gesetzen saßen [2]; und in Urga waren die chinesischen Kaufleute noch in allerneuester Zeit in eigenen Stadtteilen zusammengedrängt [3].
Ratzel sagt von den Chinesen in Urga, daß sie „politisch dominieren“: ein Zug, auf den wir immer wieder stoßen, und der für unsere Betrachtung von großer Bedeutung ist. An sich ist es leicht verständlich, daß die Kaufleute überall nicht nur die Tendenz, sondern sehr oft auch die Macht haben, ihren politischen Einfluß bis zur vollen Beherrschung auszudehnen. Ihre Lage wird, wo nicht etwa die starke Macht des Heimatstaates hinter ihnen steht (und selbst Roms ungeheure Macht reichte nicht hin, um seine Bürger vor dem Bluttage von Ephesus zu bewahren, den Mithridates ihnen bereitete) immer prekär sein, und um so prekärer, je reicher sie sind. Sie haben einen Reichtum an beweglichen Gütern, der durchaus geeignet ist, in den politischen Wirren, denen die primitiven Staaten fortwährend ausgesetzt sind, entscheidend einzuwirken, sei es in internationalen Fehden, sei es in nationalen Kämpfen, z. B. um die Thronfolge: und man wird es ihnen sehr oft unmöglich machen, sich neutral zu halten, selbst wenn sie es gern wollten. So werden sie, gezwungen oder freiwillig, Partei ergreifen und als Entgelt politische Rechte einhandeln können, wenn ihre in so kleinen Verhältnissen nicht verächtliche eigene Macht an kriegsgeübtem Schiffsvolk und Sklaven oder gemieteten Soldknechten den Ausschlag gibt. Dazu
[1] Mommsen a. a. O. II, S. 406. Vgl. Art. „Römische Kolonisation“, Hdwb. d. Stw. II. Suppl., S. 552.
[2] Vgl. Mayer, Die Wiener Juden, S. 37; „Es liegt in der Natur der Sache, daß die Juden vor allem von den sich zu jener Zeit mehr und mehr bildenden Städten als den Konsumplätzen angezogen werden, dort nach dem allgemeinen Brauch des geschlossenen Zusammenwohnens nach Nationalitäten und Berufen eigene Judenviertel schaffen. So trifft man deren urkundlich in Köln (cod. Theod.) schon im vierten Jahrhundert, in Regensburg nicht viel später, in Magdeburg und Merseburg schon im 10. Jahrhundert.“
[3] Ratzel, Völkerkunde II, S. 558.
[383]
kommt, daß hinter den Kolonisten oft die starke Macht ihres Mutterlandes oder ihrer Mutterstadt steht, mit der sie durch verwandtschaftliche Bande und stärkste kultische und kommerzielle Interessen eng verbunden sind. Die folgende Schilderung der Rolle, die arabische Kaufleute in Ostafrika gespielt haben, scheint uns einen bisher nicht genügend beachteten geschichtlichen Typus darzustellen:
„Als Speke 1857 als erster Europäer diesen Weg machte, waren die Araber Kaufleute, die als Fremde im Lande wohnten; als er 1861 denselben Weg zum zweiten Male betrat, glichen die Araber schon großen Gutsherren mit reichem Landbesitz und führten Krieg mit dem angestammten Herrscher des Landes. Dieser Prozeß, der sich ja auch in manchen anderen Ländern Innerafrikas wiederholt hat, ergibt sich mit Notwendigkeit aus den Verhältnissen. Die fremden Kaufleute, Araber und Suaheli, bitten um die Erlaubnis des Durchzuges, wofür sie zollen, gründen Warenlager, die den Häuptlingen genehm sind, weil sie ihrer Erpressungssucht und Eitelkeit zugute zu kommen scheinen, bereichern sich dann und erwerben Verbindungen, machen sich hierdurch verdächtig, werden gedrückt und verfolgt, weigern sich, die mit dem Wohlstande gestiegenen Zölle und Steuern zu zahlen; endlich ergreifen die Araber bei einem der unvermeidlichen Thronstreite Partei für einen Prätendenten, der ihnen fügsam zu sein verspricht, und werden dadurch in die inneren Streitigkeiten des Landes gezogen und in oft endlose Kriege verwickelt“ [1].
Diese politische Tätigkeit der kaufmännischen Metöken ist eine immer wiederkehrende Erscheinung. „Auf Borneo erwuchsen aus den Niederlassungen chinesischer Goldgräber eigene Reiche“ [2]. Und die ganze europäische Kolonisationsgeschichte ist im Grunde nichts anderes als eine einzige Reihe von Belegen für dieses Gesetz, das bei irgend erheblicher Macht der Fremden aus Faktoreien und größeren Niederlassungen Herrschaft entstehen läßt, wenn sie nicht dem ersten Typus der Seeräuberburgen näher stehen, wie die spanisch-portugiesische Conquista und die Eroberungen der ostindischen Kompagnien, der holländischen nicht minder wie der englischen. „Es liegt ein Raubstaat an der See, zwischen dem Rheine und der Scheide“ klagt Multatuli
[1] Ratzel, Völkerkunde II, S. 191. Vgl. a. S. 207/8.
[2] Ratzel, Völkerkunde 1, S. 363. Vgl. Handwörterbuch der Staatswissenschaften, II. Supplementband (Kolonisation, römische), S. 549/550: „In den Kriegen α er endenden Republik spielen die Konvente eine große Rolle. Sie beherrschen ihre peregrine Umgebung durchaus und nehmen Stellung für Cäsar oder Pompejus. Schon früher, im jugurthinischen Kriege, sind die Konvente ebensoviele Hochburgen des Römertums. Ihrer tapferen Haltung, besonders in Cirta, wird lobend gedacht (Sallust, Jugurtha). Die Nachkommen der in den afrikanischen Städten ansässigen Römer, wie der Konvent von Urica, unterstützen den letzten Kampf der Pompejaner in Afrika (s. bellum Africanum)“.
[384]
gegen sein Vaterland. Alle europäischen Kolonien in Amerika, Afrika und Ostasien sind nach einem der beiden Typen entstanden.
Nicht immer kommt es zur unbedingten Herrschaft der Fremden. Zuweilen ist der Gaststaat zu stark, und sie bleiben politisch ohnmächtige Schutzgäste, wie die Deutschen in England oder Venedig. Zuweilen erstarkt der schon unterjochte Gaststaat, so daß es ihm gelingt, die Fremdherrschaft abzuschütteln: so z. B. verjagte Schweden die Hansa, die ihm schon die Herrschaft auferlegt hatte; zuweilen kommt ein stärkerer Eroberer über Gaststaat und Fremdenkolonie und unterwirft beide: so z. B. machten die Russen den Republiken von Pskow und Nowgorod ein Ende. Häufig aber verschmelzen die fremden Reichen mit den einheimischen Edlen zu einer Herrenklasse, nach ganz dem gleichen Typus, den wir auch bei der Landstaatenbildung überall dort auftreten sahen, wo zwei ungefähr gleich starke Herrengruppen zusammenstießen. Und dieser Fall scheint uns für die Genesis der wichtigsten Stadtstaaten des Altertums, für die hellenischen Seestädte und Rom, die wahrscheinlichste Annahme.
Wir wissen genau aus Ortsnamen (Salamis ; Insel des Friedens, d. h. Marktinsel!), aus Heroennamen (Melikertes ist doch wohl mit Sicherheit aus Melkartx), dem phönizischen Sonnengott und Herakiest hellenisiert ?), aus Baudenkmälern und aus unmittelbarer Überlieferung, daß in oder bei vielen griechischen Hafenstädten phönizische Faktoreien bestanden, deren Hinterland von kleinen Eroberungsstaaten der typischen Gliederung in Edelinge, Freie und Sklaven bzw. Hörige, besetzt war. Mögen einzelne der phönizischen Seekönige und ihrer adligen Gefolgsmannen in das Konnubium der heimischen Edlen aufgenommen worden sein oder nicht, — daß die Ausbildung dieser Stadtstaaten durch die fremden Einflüsse mächtig gefördert wurde, kann gar nicht bestritten werden.
Dasselbe gilt von Rom. Mommsen sagt darüber : „Daß Rom, wenn nicht seine Entstehung, doch seine Bedeutung diesen kommerziellen und strategischen Verhältnissen verdankt, davon begegnen denn auch weiter zahlreiche Spuren, die von ganz anderem Gewicht sind als die Angaben historisierter Noveletten. Daher rühren die uralten Beziehungen zu Caere, das für Etrurien war, was für Latium Rom, und denn auch sein nächster Nachbar und Handelsfreund wurde ; daher die ungemeine Bedeutung der Tiberbrücke und des Brücken-
[1] Winckler (a. a. O. S. 345/6) sagt dazu, „Wenn Melkart bei Korinth verehrt worden ist, so ist das ein untrügliches Zeichen, so zuverlässig wie irgendeine Inschrift, daß das betreffende Land tatsächlich einmal von Phöniziern erobert worden ist . . .: eine ganz regelrechte politische Eroberung durch einen festorganisierten Staat . . . keine Kolonie, sondern nur Einsetzung einer phönizischen Verwaltung.“
[385 ]
baus überhaupt in dem römischen Gemeinwesen [1] ; daher die Galere als städtisches Wappen. Daher der uralte römische Hafenzoll, dem von Haus aus nur unterlag, was zum Feilbieten (promercale), nicht was zu eigenem Gebrauch des Verladers (usuarium) in dem Hafen von Ostia einging, und der also recht eigentlich eine Auflage auf den Handel war. Daher, um vorzugreifen, das verhältnismäßig frühe Vorkommen des gemünzten Geldes, der Handelsverträge mit überseeischen Staaten in Rom. In diesem Sinne mag denn Rom, wie auch die Sage annimmt, mehr eine geschaffene als eine gewordene Stadt und unter den lateinischen eher die jüngste als die älteste sein“ [2].
Von hier aus, so scheint es uns, könnte ein soziologisch und ethnologisch genügend vorgebildeter Historiker über manche noch dunkle Punkte zu Aufschlüssen gelangen, die nicht ohne Interesse wären : über die etruskische Herrschaft in Rom, über den Ursprung mancher reichen Plebejerfamilie, über die athenischen Metöken und anderes mehr.
III. Die Entwicklung des Seestaates. ↩
Alle diese Staaten, mögen sie nun entstanden sein aus Seeräuberburgen, aus Häfen an der Küste seßhaft gewordener Landnomaden, die dann aus eigenen Kräften zu Wikingen wurden, aus Kaufmannskolonien, die zur Herrschaft kamen, oder aus Kaufmannskolonien, die mit der herrschenden Gruppe des Gaststaates verschmolzen, — sie alle sind echte „Staaten“ im soziologischen Sinne, sind nichts anderes als die Organisation des politischen Mittels ; ihre Form ist die Herrschaft, und ihr Inhalt die ökonomische Ausbeutung der Untertanen durch die Herrengruppe. Grundsätzlich unterscheiden sie sich durchaus nicht von den durch Landnomaden im Binnenlande begründeten Staaten.
Aber sie haben aus inneren und äußeren Gründen dennoch andere Formen angenommen und zeigen eine andere Psychologie der Klassen.
Nicht als ob etwa die Klassenstimmung grundsätzlich eine andere wäre als in den Landstaaten ! Die Herrenklasse sieht mit der gleichen Verachtung auf den Untertanen herab, auf den „Banausen“, den „Mann mit den blauen Nägeln“, wie der mittelalterliche deutsche Patrizier sich ausdrückte, und wehrt ihm, auch dem Freigeborenen, die Ehegemeinschaft und den geselligen Verkehr : das Connubium und Commercium. Und ebensowenig unterscheidet sich die Klassentheorie der καλοικαγα&οί (der Wohlgeborenen) oder ομογάλακτες (der von
[1] Noch heute heißt der Papst der Pontifex maximus, der „oberste Brückenbauer“.
[2] Röm. Gesch. I, S. 89. Vgl. Neurath, a. a. O. S. 57.
[386]
adliger Milch Genährten) [1] oder der Patricii (Ahnenkinder) von der des Landjunkers.
Aber die andere Lagerung der Gruppe erzeugt doch hier notwendig Abweichungen, selbstverständlich dem Klasseninteresse entsprechend. So z. B. kann in einem von Kaufleuten beherrschten Gebiet unmöglich der Straßenraub geduldet werden, und er gilt denn auch den Seegriechen als ein gemeines Verbrechen. Die Theseussage hätte im Landstaat die Spitze gegen die Wegelagerer nicht erhalten. Dagegen wurde der Seeraub „von ihnen in den ältesten Zeiten als ein keineswegs entehrendes Gewerbe angesehen . . ., wovon noch in den homerischen Gesängen zahlreiche Beweise vorhanden sind ; noch in viel späterer Zeit hatte Polykrates auf Samos einen wohlorganisierten Räuberstaat gebildet“ [2]. Auch im Corpus juris ist die Rede von einem solonischen Gesetze, nach welchem die Piratenassoziation (επί λεϊαν οΐχόμενοι) als eine erlaubte Gesellschaft aufgefaßt wird“ [3]. Erst in verhältnismäßig später Zeit galt der Seeraub, wenn er gegen Hellenen geübt wurde, als unehrenhaft [4] : gegen Nicht-Hellenen war er immer sittlich erlaubt.
Aber abgesehen von solchen Geringfügigkeiten, die nur deshalb verzeichnet zu werden verdienen, weil sie ein helles Licht auf die Entstehung des „ideologischen Oberbaus“ überhaupt zu werfen geeignet sind [5], haben ihre von denen der Landstaaten sehr verschiedenen Existenzbedingungen in den Seestaaten zwei überaus wichtige Tatsachen geschaffen: eine politische, die Ausbildung einer demokratischen Verfassung, mit der jener Gigantenkampf in die Welt trat, der nach Mommsen den eigentlichen Inhalt der Weltgeschichte ausmacht: der Kampf zwischen orientalischem Sultanismus und occidentaler Bürgerfreiheit; — und zweitens wirtschaftlich: die kapitalistische Sklavenwirtschaft, an der alle diese Staaten zuletzt zugrunde gehen müssen.
1. Die Ausbildung der Demokratie. ↩
a) Die Stände.
Um die Entwicklung der Verfassung zu verstehen, müssen wir bis auf die Urzeit zurückgehen und versuchen, uns über ihre Verfassung ein Bild zu machen.
[1] Beloch a. a. O. I, S. 84.
[2] Büchsenschütz, Besitz und Erwerb im griechischen Altertum, zit. bei Kulischer, a. a. O. S. 319. Vgl. Beloch, a. a. O. I, S. 212.
[3] Goldschmidt, Gesch. d. Handelsrechts, zit. bei Kulischer.
[4] Beloch, I. 1, S. 282.
[5] Wie bezeichnend ist es, daß der einzige fast reine „Seestaat“ der neuen Zeit, Großbritannien, immer noch nicht auf sein Kaperrecht verzichten will: das war eine der Hauptursachen des Weltkrieges.
[387]
Den Ausgangspunkt bildet überall, in der neuen wie der alten j Welt, der Stammesverband. Er ist, wie der Name aussagt, eine | Verbindung von Stämmen, die zustande gekommen ist teils durch Spaltung eines Stammes in mehrere, die dann in einem engeren oder loseren Zusammenhang, namentlich kultischer Art, blieben, teils durch Vereinigung früher getrennter Stämme, die vor allem durch die Exogamie zusammengeführt wurden. Die Stämme bestehen ihrerseits wieder aus Sippen, und diese aus Familien ; außerdem bestehen „Brüderschaften“ (Phratrien, von frater) : Wehr- und vor allem Kultgenossenschaften, die quer durch die Sippen hindurchgehen. Sie sind vielleicht totemistischen Ursprungs, hangen in anderen Fällen vielleicht auch mit den alten Männerbünden (coviria ist zu curia geworden) zusammen [1].
Bis zu diesem Stadium haben es die Jäger der Neuen Welt, wie wir wissen, in einer Anzahl von Fällen gebracht, von denen die fünf Nationen der Irokesen den bekanntesten und am höchsten entwickelten darstellen. Aber darüber hinaus, zum Staate, sind — außer in Peru und Mexiko — nur die altweltlichen Hirten und die aus ihnen hervorgegangenen Wikinge gelangt. Und zwar ist dieser Fortschritt nur dem Umstände zu danken, daß sich ihnen das politische Mittel, die Unterwerfung und Ausbeutung in Gestalt der Sklaverei, zuerst als das „kleinste Mittel“ der ökonomischen Bedürfnisbefriedigung darbot.
Wir haben gesehen, daß die Haltung unfreier Arbeiter zunächst die wirtschaftliche Differenzierung außerordentlich förderte. Es ist jetzt möglich, Herden von fast unbegrenzter Größe zu unterhalten. Damit sind die beiden Bedingungen einer auch die Freienschaft durchspaltenden Klassenbildung gegeben: die Größe des Besitzes und seine Dauer — ; denn wir wissen, daß aller Herdenreichtum sehr prekär ist, solange der ganze Bestand auf einer Fläche gehalten werden muß, wo er den Angriffen der Witterung wie der tierischen und menschlichen Feinde und der Vernichtung durch Seuchen ausgesetzt ist. So zerfallen, im Gegensatz zu den neuweltlichen Jägern, schon die ausgebildeten Hirten in wenigstens drei verschiedene Schichten: große Herdenbesitzer, kleine Freie und Weidesklaven.
Aus dieser Schichtung, die für die beiden freien Bestandteile in der ersten Zeit noch kaum eine Scheidung in Klassen bedeutet hat, wird aber allmählich eine wahre Klassenscheidung, und zwar aus mehreren Gründen: Erstens werden sich notwendigerweise die von außen her kommenden freien Elemente, vor allem die Flüchtlinge vor der Blutrache, von
[1] Vgl. Beloch, Griech. Gesch. I. 1, S. 86. Vgl. Weber, Wirtsch.Gesch. I. 52, 54. Busold, Die griech. Staats- u. Rechtsaltertümer, S. 21, 126, 207.
[388]
denen wir berichtet haben, den reichen Stammesgenossen anschließen [1]. Hier mag der oder wenigstens ein Ursprung der „Klientel“ zu suchen sein. Zweitens sinken kleine Gemeinfreie, wie wir wissen, oft durch den Verlust ihrer Herden in eine Art von Abhängigkeit, die dem späteren Lehnsmannensystem ähnlich, und vielleicht, wie z. B. Laveleye annimmt, sein Vorläufer gewesen ist. Diejenigen verarmten Freien, denen es nicht gelingt, sich wieder zu eigenem Herdenbesitz hinaufzuarbeiten, bilden einen Stand geringeren Rechts, geringerer Ehre, und verminderter Freiheit; sie gleichen in ihrer Stellung einigermaßen den Periöken der antiken Landstaaten und den Plebejern der antiken und mittelalterlichen Stadtstaaten.
Vor allem aber ist die Ausgestaltung eines hervorragenden Reichtums durch Ausnützung der Sklaverei Ursache und Ausgangspunkt einer tiefgreifenden Umwälzung der ganzen Gesellschaft in sozialer und, was hier, wie in jeder primitiven Gesellschaft, überaus wichtig ist, in religiös-kultischer Beziehung. Aus der Ungleichheit geht das Patriarchat hervor, das nun die Ungleichheit immer weiter vermehrt. Die spätsippschaftliche oder frühfamiliale Phase geht zuende, und die hochfamiliale Phase tritt an ihre Stelle [2]. Und damit wandelt sich der Stammesverband so grundstürzend, daß er von dem der neuweltlichen Jäger trotz der Gleichheit des Ausgangs und der äußerlichen Organisationsform im Wesen völlig verschieden wird.
Bisher war die Einzelfamilie nichts als eine, politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich wenig bedeutsame Abteilung der alles beherrschenden Sippe. Die Frau war gleich-, oft überberechtigt. Der Mann trat in die Sippe der Frau ein, hatte ihr zu dienen, die Kinder folgten der Frauenlinie, ihr Vormund war der Bruder der Mutter. Jetzt sind einzelne Männer reich genug, um der Sippe ihre Frauen abzukaufen. Diese Frauen treten umgekehrt in des Mannes Sippe ein, ihre Kinder folgen der Vaterlinie. Nun gibt Reichtum überall Klasse [3] :
[1] Vgl. Lippert, Kulturgeschichte der Menschheit II, S. 554: „Männer, welche nach sächsischem Volksrechte aus dem Friedensschutze ausgeschlossen worden waren, so daß ihnen bei jeder Begegnung ein ungerächter Tod drohte, ließ der Kaiser sich gleichsam schenken, damit er sie außerhalb Sachsens irgendwo in seinem Reiche oder „in der Mark“ samt Weib und Kind ansässig mache; in Sachsen sollte dann der Geächtete für tot gelten.“
[2] S. S. I, S. 1047ft.
[3] „Reichtum gibt auch hier Einfluß: die Haidah erkauften sich mit Geld gar die Gunst ihrer Medizinmänner. Mit Geld kann man Strafen abkaufen.“ (Ratzel, Völkerkunde I, S. 561). — Von dem merkwürdigen Steingeld der Ozeanier berichtet der gleiche Autor (I, S. 232), daß es einigen Besitzern fast etwas Heiliges, anderen den Einfluß von Plutokraten verleiht. Eine Familie, die es einbüßt, etwa um Verbrechen gegen Häuptlinge zu sühnen, „steigt eine Reihe von Stufen in der sozialen Leiter herab. Das Geld ist also . . . neben der religiösen Tradition die Grundlage des politischen Einflusses und der Maßstab der sozialen Stellung“.
[389 ]
diese Ehen und die aus ihnen hervorgehenden Kinder gelten als vornehmer. Es sind die „Vaterkinder“ (patricii) [1], der Keim allen künftigen „Adels“. Ihnen stehen gegenüber erstens die Mutterkinder [2], die Sprößlinge der jetzt als weniger vornehm geltenden Ehen der alten Art, die selbstverständlich nicht mit einem Schlage verschwinden, und später die Sprößlinge der Nebenfrauen, die sich natürlich gerade die reichen Besitzer halten, d. h. solcher Frauen, die nicht selbst aus Vaterehen stammen, nicht selbst adlig sind: das sind kriegsgefangene Sklavinnen oder Töchter der jetzt tief im Range gestürzten kleinen Gemeinfreien. Während bisher alle in dem Stamme Geborenen gleiche Rechte hatten, werden jetzt diese Kinder der Nebenfrauen vielfach — nicht immer und überall (wo das Patriarchat seine höchste Ausbildung erlangt, hat der Vater wohl auch die Macht, sie in seinen Stand zu erheben) — zu Bastarden: neben das „Kind“ tritt der „Kegel“. Und auch sie werden zu einer Schicht geringeren Rechtes und geringerer Ehre [3]. Hier mag eine zweite Quelle des Plebejats der späteren Stadt zu suchen sein. Noch in Athen waren die mit der offiziellen παλλακή, dem Kebsweibe, erzeugten νόδοι nur beschränkt erbberechtigt und gehörten nicht zur Phratrie. (Busold, S. 201/2.)
Diese Schichtung erhält nun ihre volle Ausprägung und wird starr und fast unabänderlich erst durch die mit dem Patriarchat eng verknüpfte Form des Kultus. Darauf hat, offenbar durch Vico angeregt, namentlich Fustel de Coulanges in seiner berühmten „Cité antique“ Nachdruck gelegt; er scheint uns nur insofern die Dinge nicht richtig zu sehen, als er den Ursprung dieses Kultus aus den sozialökonomischen Verhältnissen nicht ausreichend, oder gar nicht, in Rechnung stellt; als er überall den Kultus nicht als causa causata, sondern als prima causa auffaßt [4].
Die neue, so mächtig gewordene Familie schafft sich in Gestalt
[1] Über diese Ehen, namentlich die römische Confarreatio, vgl. Vinogradoff a. a. O. I, S. 252 f.
[2] Man denke an die von den „Partheniern“ (Jungfernkinder) in Sparta erregten Unruhen. Vgl. Röscher, Politik, S. 140; vgl. a. S. 163.
[3] Vgl. Weber, Wirtsch.Gesch. S. 58. Er betont mit Recht, daß es die Sippe der vornehmen Frau ist, die ihre und ihrer Kinder Vorzugsstellung durchsetzt. Ähnliches ist auch bei den Negern Afrikas der Fall. „Die Ständeordnung ist so scharf, wie es die Entstehung dieser Gesellschaften durch Einwanderung und Unterwerfung erwarten läßt. Die Mangbattu sind darin milder als die Sandeh, bei denen die kriegerischen, wenig arbeitenden, trinkenden und spielenden Adligen, unter denen viele als Fürstensöhne das Mata vor ihrem Namen tragen, eine wahre Aristokratie bilden. Aber auch dort baut sich auf verschiedenen Stufen, wie Sklaven, Leibeigenen, Unterworfenen, halb untertänigen Jägervölkern, eine Klasse der Herrschenden aus, die sehr viel auf echteAbstammung von väterlicher Seite gibt“ (Ratzel, Völkerkunde II, S. 314, vgl. auch I, S. 115).
[4] Vinogradoff (a. a. O. S. 156) bezeichnet Fustels „Deduktion aller Einzelheiten des bürgerlichen Lebens aus der Ahnenverehrung als eine handgreifliche Übertreibung.“
[390]
ihrer vom Charisma umwitterten Gründer, der vergotteten Ahnen [1], ihre eigenen Gottheiten und deren Kult [2]. Der Priester ist selbstverständlich der Älteste der ältesten Linie. Er wird zum „Fürsten des Stammhauses“, zum geistlichen und weltlichen Haupt der ganzen Familie, der „gens“. Damit steigt sein und seiner Linie Rang und Einfluß um ebensoviel, wie der der jüngeren Linien sinkt, die ihren Rang nur noch der Möglichkeit verdanken, daß die ältere Linie aussterben könnte : dann hätten sie den, für das Wohl der Verstorbenen im Jenseits und für den Bestand der Gesamtheit im Diesseits unerläßlichen, Gottesdienst zu versehen.
„Ein vergleichender Überblick über den Glauben und die Gesetze zeigt, daß eine primitive Religion die griechische und die römische Familie geschaffen, die Ehe und die väterliche Autorität begründet, die Verwandtschaftsordnung bestimmt und das Recht des Besitzes und der Erbfolge hervorgebracht hat. Die gleiche Religion hat dann eine größere Vergesellschaftung, den Stadtstaat (cité), gebildet und in ihm wie in der Familie geherrscht, nachdem sie zuvor die Familie selbst erweitert und ausgedehnt hatte; aus dieser Religion stammen alle Institutionen und alles Privatrecht der Alten, von ihr sind dem Stadtstaat seine Grundsätze, Regeln, Gebräuche und Beamtenschaften zugekommen“ [3].
Fustel schildert, wie der Glauben an ein Leben nach dem Tode, den ihm zufolge alle indogermanischen Völker hatten, den Kult des heiligen Herdfeuers hervorbrachte, einen „durchaus pnrtikularistisrhen Kult“, den nur die Glieder der Familie ihren Toten erweisen konnten und durften; jede Familie hat ihre eigenen Riten und Zeremonien, die vom Vater auf den Sohn vererbt werden. Und so ist die Familie ganz und gar auf diesen Totendienst gegründet: „Die antike Familie ist mehr ein Religionsverband als eine natürliche Bildung. Wir werden zeigen, daß die Frau nicht eher dazu gerechnet wird, als nachdem sie durch die geheiligte Zeremonie der Ehe in ihren Kult eingeführt worden ist; daß der Sohn nicht mehr dazu gehört, wenn er auf den Kult verzichtet hat oder von ihm losgesprochen ist ; daß im Gegensatz dazu der Adoptivsohn ein wahrer Sohn der Familie ist, weil er zwar nicht das Blut, aber etwas hat, was als mehr gilt, nämlich die Gemeinschaft
[1] Vgl. Beloch I. i, S. 311 über das genealogische Epos, namentlich die Frauenkataloge (Eoeen); „sie berichteten die Schicksale jener Heldenfrauen, bei denen Götter geruht hatten, und zählten deren Nachkommen auf, von denen die griechischen Adelsgeschlechter ihre Herkunft ableiteten.“
[2] Bei den Römern sind diese väterlichen Ahnen die Lares; die Manes, die luch verehrt wurden, waren gute Geister im allgemeinen, die Schutzgeister des Haushiltes im Ganzen (Vinogradoff, a. a. O. S. 227). [3] Fustel de Coulanges, a. a. O. S. 3/4.
[391]
des Kultus; daß der Erbe, der sich weigert, den Kult anzunehmen, sein Erbrecht verliert ; kurz, daß die Verwandtschaft und das Erbrecht sich nicht nach der Geburt, sondern nach dem Maße des Rechts der Teilnahme an dem Kult regeln, wie die Religion es festgesetzt hat . . . Die alte griechische Sprache hatte ein sehr bezeichnendes Wort für die Familie: έπίατιον, das heißt buchstäblich dasjenige, was sich um einen Herd gruppiert. Eine Familie war eine Gruppe von Personen, denen die Religion erlaubte, das gleiche Herdfeuer zu verehren und den gleichen Ahnen Totenopfer darzubringen“ (a. a. 0. S. 39ff.).
Es konnte nicht ausbleiben, daß diese Religion dem Patriarchen, dem Ober- und Opferpriester, dem einzigen Bewahrer der rituellen Geheimnisse, die die Lebenden der fortdauernden Gunst der toten Ahnen versichern, eine immer wachsende und zuletzt geradezu unumschränkte Macht geben mußte. Am höchsten war bekanntlich diese Macht in Rom gesteigert, wo der pater familias auch über seine freien Kinder, die liberi, das Recht über Leben und Tod und damit, wie Jellinek sagt [1], ein Stück staatlichen Rechtes besaß. In Hellas hat die Entwicklung dieses Extrem nicht erreicht'); hier hörte die Verfügung des Vaters über den Sohn mit dessen Mündigkeit auf und schloß nie das Recht der Tötung ein.
So ward aus der Familie allmählich die gens; „die gens ist die Familie, eine Familie, die die ihr von der Religion vorgeschriebene Einheit bewahrt und doch die volle Entwicklung erreicht hat, die ihr das antike Privatrecht erlaubte“ (121).
Diese Erweiterung und Entwicklung bestand hauptsächlich in der Eingliederung fremdbürtiger Glieder in die alte Ehefamilie. Fustel de Coulanges schildert die Vorgänge wie folgt (S. 127f.):
Mit dieser Ordnung ist der Begriff des freien Dienstes, des außer der Familie lebenden freien Dieners unverträglich: niemand hat zu dem Hause Zutritt als der zu dem Kult Zugelassene. Aber die Zulassung kostet ihn die Freiheit für das Leben und das, was ihm folgt. Selbst der freigelassene Sklave blieb durch den Kult gefesselt, gezwungen, die Autorität des Hauptes anzuerkennen und ihm nach Schuldigkeit zu dienen: und das galt auch für seine Kinder. Hierin sieht Fustel den Ursprung der zu allen Zeiten in Griechenland und Rom bestehenden Klientel, die ein heiliges, erbliches Verhältnis ist.
Der Fortgang soll nun nach der Ansicht unseres Autors, die wir nicht zu diskutieren haben - die Entscheidung ist der Ethnologie anheimgegeben und interessiert uns hier nicht, weil sie nichts für uns Wichtiges
[1] Allg. Staatslehre S. 313. Vgl. Vinogradoff, a. a. O. S. 234.
[2] Auch bei den Germanen hat die väterliche Gewalt jene extreme Ausgestaltung nicht erlangt.
[392]
trägt — derart verlaufen sein, daß mehrere solcher Familien sich zu Phratrien (Kurien), und mehrereKurien zu Stämmen zusammenschlössen, jedesmal unter dem Schutze einer der familialen ähnlichen Gottheit. Und zuletzt hätten sich die Stämme zur „cité“ verbündet. Damit haben wir bereits den Schritt über das Stadium des wandernden Hirtentums hinaus gemacht.
In dieser Gliederung in mehr oder weniger berechtigte und angesehene Schichten und Klassen kommt der Hirtenstamm zur Ansiedlung im eroberten Lande. Vollberechtigt sind eigentlich nur die Häupter der ältesten Linien der Familie (274) : ein altes Gesetz Athens bestimmt noch, daß man, um Bürger zu sein, einen eigenen Hausgott haben müsse; in anderen Griechenstädten war kein Sohn zu seines Vaters Lebzeiten Bürger, und nach dessen Ableben erhielt nur der älteste das Bürgerrecht. Um so weniger konnten es Sklaven und Klienten erhalten; die letzteren blieben immer nur Passivbürger, vertreten durch ihren Patron. Der Fremde stand ganz außerhalb der Bürgerrechte; das gilt für Zugewanderte, die Gastrecht genossen, und für die „Plebejer“.
Diese Schicht darf man nach Fustel nicht mit den Klienten zusammenwerfen. Sie sind ihm zufolge wahrscheinlich zum Teil aus den Angehörigen der unterworfenen Völkerschaften entstandenl) : immerhin ist zu bemerken, daß die Vollbürger den Plebejern nicht ihren Ursprung aus der besiegten Schicht vorwerfen, sondern: daß sie weder Religion noch Familie haben. Das spricht für unsere Vermutung, daß die Rechtsform des Plebejats schon in der Hirtenzeit entstanden ist, und zwar für die nicht aus vornehmen Ehen nach Vaterrecht stammenden Glieder des Stammes; und daß diejenigen Teile der unterworfenen Bevölkerung, die nicht zu Sklaven oder Hörigen oder halbhörigen Periöken herabgedrückt wurden, mit dieser alten Schicht verschmolzen;
[1] Röscher meint (Politik S. 70), die Plebejer würden in den hellenischen Kolonien durch nachrückende neue Ansiedler aus der Heimat gebildet. Ähnlich haben wir uns die Entstehung eines großen Teils des städtischen Plebejats im christlichen Mittelalter vorzustellen: wer im städtischen Weichbild kein echtes Eigen mehr erwerben konnte und zur Miete auf den Erbgrundstücken der ersten Ansiedler sitzen mußte, hatte gemindertes Bürgerrecht, namentlich wenn er nicht vollfreier Abstammung war. Geizer (a. a. O. S. 56) glaubt, daß die Herkunft der römischen Plebs am besten erklärt wird, wenn wir sie als ursprüngliche Klienten der Könige fassen, mit denen nach siegreichen Kriegen Stadt und Land besiedelt wurden, und die dann vermöge ihrer besonderen Stellung in freiere Verhältnisse traten und als Bürger, aber zunächst im Unterschied von den Patriziern nur als solche ohne politische Rechte, anerkannt wurden; „später seien dann auch die Klienten der Adligen zu Plebejern geworden“.
Uns erscheint als das Wahrscheinlichste, daß alle Schichten, die nicht des vollen patrizischen Bürgerrechts genossen: Klienten, Metöken, spätere Zuwandererschichten usw. zu der einen plebejischen Klasse verschmolzen.
[393]
dazu sind dann später diejenigen Elemente der siegenden Gruppe getreten, die, namentlich durch Armut, ihre Klasse verloren.
In allen antiken Städten finden sich Plebejer: „Eine griechische Stadt ist ein Doppeigebild; es besteht zunächst aus der „Stadt“ im eigentlichen Sinne, der πόλις, die gewöhnlich auf einem Hügel errichtet ist; sie ist unter religiösen Zeremonien erbaut worden und umschließt das Heiligtum der Stadtgottheiten. Am Fuße des Hügels befindet sich eine Anhäufung von Häusern, die ohne religiöse Zeremonien errichtet worden sind; sie ist von keiner geweihten Umwallung umgeben; hier haust die Plebs, die in der heiligen Stadt nicht wohnen darf“ (279). Eine solche Plebejersiedlung war in Rom der Palatin und das Asyl. Die Plebejer haben keinen Kult und keine Familie, d. h. keinen priesterlichen Ahnen. „Gentem non habent“; das will sagen, daß sie nur die natürliche Familie haben, die nicht rechnet. Erst in den letzten drei Jahrhunderten der römischen Republik kennt man plebejische gentes: eine Nachahmung des patrizischen Vorbildes.
Weil sie keine Familiengötter haben, können die Plebejer die feierlichen Eheriten nicht erfüllen; infolgedessen gilt ihre Ehe nicht für voll. Der Patrizier sagt: „Connubia promiscua habent modo ferarum“. Als Nichtbürger hat der Plebejer auch kein Eigentumsrecht, während der Klient durch Vermittlung des Patrons des Stadtrechts genießt. Der Vollbürger darf ungestraft den Plebejer prügeln; selbstverständlich hat dieser keinerlei politischen Rechte. Als das Tribunat geschaffen wurde, mußte ein Gesetz ergehen: „Niemand soll es sich einfallen lassen, einen Tribunen zu schlagen oder zu töten, wie er es einem Mann aus der Plebs tun würde“ (Fustel, S. 281). Der Plebejer steht eben völlig außerhalb der religiösen Ordnung, im Gegensatz zu dem Klienten und sogar dem Sklaven, die beide das Recht haben, dem Ahnengottesdienst beizuwohnen. Für uns ist besonders wichtig anzumerken, daß aus dieser Ordnung mit
Notwendigkeit die Ausbildung der Vollbürgergemeinde zur heute so genannten „Real-“ oder „Gerechtsamegemeinde“ folgen mußte: an dem Gemeindeland, z. B. dem ager romanus, also dem Weichbild der Stadt und allem später dazu eroberten Lande, hat ursprünglich nur das Patriziat Eigentum oder Nutzung. Denn nur die Familie kann Eigentum haben.
b) Die Stadt.
Die „cité“ ist ursprünglich nicht eine Stadt in unserem oder auch nur dem mittelalterlichen Sinne. Sondern sie bedeutet die Genossenschaft der Familien und Stämme, und die Siedlung ist nur der Sitz dieser Genossenschaft, die Stätte der Versammlungen, weil der Heiligtümer, und bei äußerer Bedrohung die Feste, in die sich die Umwohner „bergen“ :
[394]
die Burg [1]. „Die griechischen Staaten sind ursprünglich Bauerngemeinden; die politischen Rechte stufen sich nach dem Maße des Grundbesitzes ab, der Wohnsitz ist dabei völlig gleichgültig, und der städtische Handwerker ,ohne Ar und Halm' hat schlechteres Recht als der Bauer, der auf eigener Scholle sitzt. Abgesehen davon aber gibt es keinen rechtlichen Unterschied zwischen Bürger und Bauer. Das Verhältnis von Sparta und Argos zu ihren Periökenstädten ist analog dem Verhältnis zwischen Venedig und den Städten der Terraferma, Padua, Vicenza, Verona usw., keineswegs analog dem Verhältnis zwischen Verona und den Dörfern seines Gebietes“ [2].
Diesen Charakter der Stadt, nur Festung und Stätte der Stammesheiligtümer zu sein, den sie im Binnenlande lange bewahrt hat, hat sie an der Küste allmählich abgestreift und sich mehr und mehr zur Stadt in jedem modernen Sinne entwickelt: zum Sitz des Handels und der Gewerbe und des Marktverkehrs mit den umliegenden Dörfern einerseits und andererseits zur Gemeinde der Stadtinsassen mit eigenem politischem Leben. So entsteht in der Antike der Stadtstaat in seinem gewöhnlichen Sinne.
Auch die primitiven Eroberungsstaaten der Küstenlandschaften haben, bis der Handel sie umformt, den Charakter, den sie im Binnenlande noch sehr lange bewahren werden: sie sind überaus klein. „In Attika sollen einst 12 Staaten bestanden haben; ... es ist aber klar, daß die Zwölfzahl überhaupt nur fiktiv ist, und es mag in Wirklichkeit noch mehr solcher Staaten gegeben haben“ [3] (außer Athen lassen sich Eleusis, Brauron, Thorikos, Aphidna als Herrensitze der mykenischen Zeit nachweisen; andere werden genannt). Und diese Splitterung ist überhaupt das Kennzeichen der primitiven Eroberungsstaaten; wir finden sie auch außerhalb der griechisch-römischen Welt überall, z. B. im Palästina der Richterzeit, in der Polyarchie der Sachsen und Angeln im eroberten England, im ältesten Rußland. In Westhellas, wo sich die Urverhältnisse am längsten erhielten, bestanden in Ätolien, auf ehern Gebiete von 10000 qkm, elf Völkerschaften [4]. Jedes Tal mit semen Seitentälern, also bei größeren Tälern jede Talstufe, bildete einen Staat für sich. Der größte dieser Staaten, der der Athamanen, umfaßte reichlich 2000, der kleinste, die Doris, gegen 200 qkm (etwa vier Quadratmeilen). Auf Kreta gab es 50 oder mehr solcher selbständigen Kleinstaaten (in älterer Zeit werden es noch mehr gewesen sein), mit einem
[1] Vgl. Busold, a. a. O. S. 24: Allmählich ergreift der Begriff die Stadt und dann den Kanton.
[2] Beloch, Griech. Gesch. I. I, S. 203 Anm.
[3] Beloch, Griech. Gesch. I. 1, S. 206/7. Ganz Attika hat nur die ungefähre Größe von Anhalt, etwa 2500 qkm (Pohlenz, Staatsgedanke und Staatslehre der Griechen, S. 7).
[4] Beloch, a. a. O. S. 86.
[395]
Gebiet von durchschnittlich 170 qkm. Rhodos war in drei, Lesbos in sechs, Samos ursprünglich in zwei Staaten geteilt. Selbst auf so kleinen Inseln wie Keos (173 qkm) oder Amorgos (135 qkm) bestanden mehrere Staaten. In den Kolonien stand jede Stadt für sich [1].
Auf diese Kleinstaaten, soweit sie an brauchbaren Häfen der Küste liegen, wirkt nun mächtig das Meer. „Aus dem Volke der Hirten und Bauern wird ein Volk von Schiffern“ [2], und das heißt hier: Piraten und Wikinge. Das aber bedeutet, wie wir wissen, wieder auch : Händler. Die Häfen werden allmählich zu Handelshäfen; in ihnen entfaltet sich das Gewerbe, und die um den Fuß der Herrenburgen angesetzten Ansiedlungen beginnen, sich zu Städten auszuwachsen. „Bald wurde es nötig, sie durch Befestigungen gegen feindliche Angriffe zu schützen, was dann wieder zur Folge hatte, daß so mancher, eben um dieses Schutzes willen, in die Stadt zog, und namentlich die größeren Grundbesitzer, die bisher draußen auf ihren Gütern gelebt hatten, in der Stadt ihre Wohnung nahmen. So wurden die Griechen zum Stadtvolk“ [3]. Selbstverständlich nicht alle Griechen, sondern eben nur die an günstiger Küste wohnhaften: aber diese sind es vor allem, die die griechische Geschichte gemacht haben und uns als Repräsentanten des Hellenentums gelten : „Bis in die hellenistische Zeit hinein bleibt die antike Kultur Küstenkultur. Keine Stadt dieser älteren Periode liegt tiefer als eine Tagesreise im Binnenland ; hier dagegen hält sich der grundherrliche Häuptling mit seinen Hintersassen“ [4].
Da nun in dieser sich vergrößernden und immer reicher werdenden Stadt jetzt der König und der Adel wohnten, da infolgedessen die Rechtspflege hier ihren Sitz hatte, das politische Leben und aller Verkehr sich hier abspielten, „so gewann die Stadt dem Lande gegenüber eine weit überwiegende Wichtigkeit, und Stadt und Staat wurden den Griechen zu synonymen Begriffen“ [5]. Von da an „ist das Charakteristische der PuHs die unbedingte Konzentration alles staatlichen Lebens auf einen bestimmten räumlichen Mittelpunkt“ [6].
Die erfolgreichen Hafenstädte der Landschaften erringen jetzt die Hegemonie über die weiter landwärts gelegenen Kleinstaaten ; wo ein Hinterland von einiger Größe vorhanden ist, kommt es zur Entstehung größerer Staatsgebilde, teils durch friedlichen Zusammenschluß, wie in Attika, teils durch kriegerische Unterwerfung, wie in Sparta, teils durch eine Mischung von beiden, wie in Argos und später in Rom, das sich
[1] A. a. O. S. 210.
[2] A. a. O. S. 202.
[3] Beloch, a. a. O. S. 202/3.
[4] Weber, Wirtsch.Gesch. S. 63.
[5] Beloch, a. a. O. S. 203.
[6] Kaerst, Gesch. d. Hellenismus I, S. 2.
[396]
zuerst über Latium und dann über ganz Italien erhebt, oder wie früher in Jerusalem, das als eine Art von Wüstenhafen angesehen werden kann: aber das gehört mehr in die Schilderung des Oasenstaates. Wo keine günstigen Häfen vorhanden sind, kommt es nicht zu solcher Integration : Böotien und gar Thessalien, obgleich im Osten von Hellas gelegen und den großen Seemächten benachbart, haben die Einigung erst in makedonischer Zeit erlebt, und Arkadien ist immer eine Eidgenossenschaft kleinster Staaten geblieben, bis es zu einer Provinz Roms wurde.
In den Städten entwickelt sich nun eine ganz neue Art der Menschheit: das „Bürgertum“, der Schöpfer und Träger ganz neuer Institutionen, die dazu bestimmt sind, die Geschichte der Menschheit in ganz neue Bahnen zu lenken.
Unser moderner Begriff des Bürgertums hat, wie Max Weber [1] gezeigt hat, drei verschiedene Seiten: eine ökonomische, in der er eine bestimmte Klasse von Berufen zusammenfaßt: Groß- und Kleinbürger, Handwerker und Unternehmer; — eine politische: der Staatsbürger als Träger bestimmter politischer Rechte; — und schließlich, immer von Außenstehenden so zusammengefaßt, die Leute „von Besitz und Bildung“: ein ständischer Begriff.
„Der erste dieser Begriffe, der ökonomische, ist nur dem Occident eigentümlich. Es gibt und gab überall Handwerker, Unternehmer, aber niemals und nirgends wurden sie zu einer einheitlichen sozialen Klasse zusammengefaßt. Der (politische) Staatsbürgerbegriff hat seine Vorgänger in der antiken und mittelalterlichen Stadt. Hier gab es Bürger als Träger politischer Rechte, während uns außerhalb des Occidents nur Spuren derselben entgegentreten, wie im babylonischen Patriziat, in den Joscherim, den vollberechtigten Stadtbewohnern des Alten Testaments. Je weiter nach Osten, desto spärlicher werden diese Spuren: der „Staatsbürger“ ist der islamitischen Welt, Indien und China, unbekannt. Endlich ist die ständische Klassifikation als des Mannes von Besitz und Bildung oder von Besitz oder Bildung, die ihn einerseits dem Adel, andererseits dem Proletariat gegenüberstellt, ganz ebenso ein spezifisch modern-occidentaler Begriff wie derjenige der Bourgeoisie“.
Indem die antike Stadt allmählich zum Sitze dieses neuen Bürgertums wurde, hat sie selbst einen Charakter angenommen, den die „Städte“ der früheren Geschichte nicht hatten und aus Gründen, die wir in der Analyse des Landstaates darlegen werden, nicht haben konnten: sie ist nicht bloß Königs-, Burg-, Tempel- und Marktort, sondern auch und vor allem Gemeindeverband [2]. Das ist eine der wichtigsten
[1] A. a. O. S. 270/1.
[2] Weber, a. a. O. S. 273.
[397]
Gaben, die der Seestaat den auf seinen Trümmern entstandenen späteren Landstaaten des Westens als Erbschaft hinterließ, ist der Ausgangspunkt aller Entwicklung der Neuzeit im Guten wie im Bösen gewesen.
2. Die Umwälzung der Wirtschaft und der Verfassung. ↩
Die Staaten werden erhalten durch das gleiche Prinzip, aus dem sie entstanden. Eroberung von Land und Leuten ist die ratio essendi des Landstaates, und durch neue Eroberung von Land und Leuten für seine Oberklasse muß er wachsen, bis er seine natürliche Grenze an Gebirge, Wüste oder Meer oder seine soziologische Grenze an anderen Staatsgebilden findet, die zu unterwerfen er nicht stark genug ist. Der Seestaat aber ist entstanden aus Seeraub und Handel, und durch Seeraub und Handel muß seine Herrenklasse ihre Macht zu mehren versuchen. Zu dem Zwecke braucht aber ihr Staat nicht ein ausgedehntes Landgebiet in aller Form zu beherrschen. Er kann auch auf die Dauer in jedem der Gebiete seiner immer wachsenden „Interessenphäre“ mit jedem der ersten Stadien der Staatsbildung bis zum fünften einschließlich auslangen. So z. B. übte Athen seine Herrschaft über die „Bundesgenossen' seines ersten Seebundes in Form des dritten und fünften Stadiums aus: durch Bezug von Tribut und bei Gefährdung desselben durch Einsetzung von Residenten (Harmosten heißen sie bei den Spartanern, die in ihrer Herrschaft das Vorbild getreulich nachahmten. Wir kommen darauf zurück). Wo aber Abfall geschehen war, da trat das primitive erste Stadium des Plünderungsund Sklavenkrieges wieder in die Erscheinung. Nur seltener, und dann mehr gezwungen als freiwillig, schreitet der Seestaat zum sechsten Stadium vor, dem der vollen Intranationalität und Verschmelzung. Es genügt ihm im Grunde, wenn er andere Seenomaden und Handelsvölker fernhält, sich das Monopol des Raubes und des Handels sichert, die „Untertanen“ durch Burgen und Garnisonen in Räson hält, und nur wichtige Produktionsgebiete, namentlich Bergwerke, reiche Kornbreiten, Wälder mit dem für den Flottenbau der Zeit unentbehrlichen Bauholz, wichtige Fischplätze (Hansa in Schonen), wirklich „beherrscht“, d. h. durch die eigenen Beamten dauernd verwaltet, oder, was dasselbe sagt, durch die Unterworfenen bearbeiten läßt.
Der Geschmack aber an „Land und Leuten“, d. h. an Rittergütern für die Herrenklasse außerhalb der Grenzen des eigenen engeren Stadtgebietes, kommt erst später, wenn der Seestaat durch Eingliederung unterworfener Landstaaten eine Mischform geworden ist. Aber auch dann ist, im Gegensatz zu den Landstaaten, der Großgrundbesitz nur Geldrentenquelle und wird fast nur als Absenteebesitz durch Beamte verwaltet. So in Athen (z. B. ist Miltiades als Herrscher
[398]
des thrakischen Chersones ein großer Dynast [1], und auch Peisistratos hat Lehnsbesitz vom Perserkönig in Sigeion) in vereinzelten Fällen, die an das cyprische „Königreich“ der venetianischen Familie Cornaro erinnern; so in Karthago und vor allem im späteren Rom.
Die Interessen der Herrenklasse, die den Seestaat so gut wie jeden anderen Staat zu ihrem Vorteil regiert, sind eben andere als im Landstaate. Gibt dem feudalen Grundherrn die Macht den Reichtum, so gibt umgekehrt dem Patrizier der Reichtum die Macht. Wenn der Grundherr seinen Staat nur durch die von ihm unterhaltenen Krieger beherrschen kann, und wenn er, um deren Zahl auf das höchste zu steigern, seinen Landbesitz und die Zahl seiner hörigen Bauern soviel wie möglich vermehren muß : so kann der Patrizier seinen Staat nur durch seinen mobilen Reichtum beherrschen, mit dem er starke Fäuste mietet und schwache Seelen besticht: und diesen Reichtum gewinnt er leichter und reichlicher im Seeraub und Handel als im Landkriege und von Großgrundeigentum im fernen Lande. Auch müßte er seine Stadt verlassen, um solches Herreneigentum auszunützen, müßte darauf Wohnung nehmen und ein echter Landjunker werden: denn in einer noch nicht zur vollen Geldwirtschaft und ausgiebigen Arbeitsteilung zwischen Stadt und Land entwickelten Gesellschaft kann Großgrundeigentum nur in der Naturalwirtschaft ausgenützt werden, ist Absenteebesitz als Rentenquelle undenkbar. So weit aber hat uns unsere Betrachtung noch nicht geführt; noch hält unsere idealtypische Schilderung bei primitiven Verhältnissen. Und hier gewiß wird es einem Stadtadligen so leicht nicht einfallen, seine reiche lebhafte Heimatstadt zu verlassen, um sich in der Wildnis unter den Barbaren zu vergraben und damit ein für alle Male auf jede politische Rolle in seinem Staate Verzicht zu leisten. So drängen ihn also alle seine Interessen, die wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen, zu Schiffahrt und Seehandel. Nicht das Grundkapital, sondern das mobile Kapital ist seines Lebens Nerv.
Aus diesen Gründen haben die meisten selbst der wenigen Seestädte, denen die geographische Beschaffenheit ihres Hinterlandes die räumliche Ausdehnung ins Weite erlaubte, den Schwerpunkt ihrer Existenz immer mehr über See gesucht als auf dem Lande. Nur aus diesem Grunde „fehlt den Griechen in besonderem Maße der Sinn für die politische Bedeutung des Raumes“, wie Ratzel meinte. Kaerst, der die Stelle anführt [2], erklärt mit Recht die „wenig selbständige Entwicklung des territorialen Elements“, die in der Tat einer der Gründe für den politischen Niedergang der hellenischen Mächte gewesen ist, aus dem Wesen der Polis, deren „Einheit sich für die griechische Auf-
[1] Beloch, Griech. Gesch. IL i, S. 17, 20/1.
[2] A. a. O. S. 28ff.
[399]
fassung hauptsächlich in der Einheit der Gesellschaft, d. h. des herrschenden Bürgertums ausdrückt“. Diese aber „ist geneigt, in jeder Erweiterung ihres Kreises eine Verminderung ihres Anteils an der Herrschaftsgewalt des Staates ... zu erblicken“. Kaerst scheint aber nicht zu sehen, daß diese „Exklusivität“ in dem ganzen Wesen des Seestaates als einer ganz auf dem politischen Mittel, dem Seeraube und der Seeherrschaft, beruhenden Bildung wurzelt ; — daß sie die charakteristische Exklusivität aller Monopolisten ist. Mit vollem Recht nennt Max Weber die Polis eine „politische Zunft“ [1].
Wir werden darauf zurückkommen, wenn wir (im nächsten Abschnitt über die kapitalistische Sklavenwirtschaft) die Folgen zu betrachten haben werden, die sich für diese Staatswesen daraus ergeben mußten, daß sie sich ganz und gar auf das politische Mittel in seiner krassesten Gestalt aufgebaut hatten. Hier wollen wir aus dem verschlungenen Geflecht zunächst die Fäden zu isolieren versuchen, die das ökonomische Mittel in das Gewebe entsandt hat. Und da zeigte sich uns, daß schon die übrigen Gründe hinreichten, um das uns interessierende Faktum zu erklären.
Es findet sich denn auch bei allen echten Seestaaten; sogar für Karthago war sein riesiger Landbesitz nicht entfernt von der vitalen Wichtigkeit wie seine Seeinteressen. Es hat Sizilien und Korsika mehr aus dem Grunde erobert, weil es die hellenischen und etruskischen Konkurrenten schädigen wollte, als um des Landbesitzes willen; es hat seine Grenzen gegen die Libyer wesentlich um der polizeilichen Sicherheit seiner Landgrenze halber ausgedehnt, wie das jeder Staat tun muß, der an die Steppe mit ihren unbändigen Kriegervölkern grenzt; und wenn es Spanien eroberte, so war der erste Grund der Besitz der Bergwerke, und ein zweiter vielleicht die Notwendigkeit, sich zum letzten Kampfe auf Leben und Tod gegen Rom neue Hilfsvölker zu schaffen. Von irgendeinem fehlenden „Sinn“ kann hier überall so wenig die Rede sein wie etwa bei den Hansen, deren Politik ganz ähnlich war.
Die meisten der antiken Seestädte waren aber gar nicht in der Lage, ein großes Gebiet unter ihre Herrschaft zu bringen. Äußere geographische Bedingungen hätten es auch dann verhindert, wenn der Wille dazu bestanden hätte. Überall am Mittelmeer, mit Ausnahme weniger Stellen, wo dann auch größere Territorien sich zusammenschlössen, ist das Küstenland außerordentlich schwach entwickelt, ein schmaler Saum am Fuße hoher Gebirge. Das war die eine Ursache, die die meisten dieser um einen Hafen zentrierten Staaten daran verhinderte, eine für unsere Begriffe irgend bedeutende Größe zu erreichen,
[1] Wirtschaftsgesch. S. 283.
[400]
während in den breiten Landgebieten, in denen der Hirte herrschte, sehr früh große, ja ungeheure Reiche entstanden. Die zweite Ursache aber ist, daß in den Gebirgen des Hinterlandes, aber auch in den wenigen breiteren Ebenen des Mittelmeergebiets, fast überall sehr kriegerische Stämme hausten : Hirten oder primitive Eroberungsstaaten, oft von der gleichen Herren- und Kriegerrasse, die nicht so einfach zu unterwerfen waren, deren Unterwerfung jedenfalls unverhältnismäßige Opfer gefordert hätte. So in Hellas überall im Hinterlande, so auch vielfach in Italien.
Wenn Rom dieser Stämme allmählich Herr wurde und seine Faust auf die ganze Halbinsel legen konnte, so liegt das daran, daß es, ganz wie sein großer Nebenbuhler Makedonien, nie ein ganz rein gestalteter Seestaat gewesen ist; die Bedeutung der Hafenstadt für Latium war wohl groß genug, um die Hegemonie zu erreichen, aber gegen die drei großen Konkurrenten um die Seeherrschaft : die phönizischen Karthager, die Hellenen und die Etrusker, konnte der kleine Handelshafen als solcher nicht hoffen, emporzukommen. Wir haben Rom wie Makedonien [1] als die ersten großen Typen jener Landstaaten aufzufassen, die sich in der Berührung mit den Seestaaten deren Errungenschaften aneigneten, wobei sie sich freilich mit dem tödlichen Virus der kapitalistischen Sklavenwirtschaft infizierten: ein Schicksal, vor dem die später in Nordwest- und Mitteleuropa begründeten Staaten bewahrt blieben. Aus den geschilderten Gründen bleibt der Seestaat auch bei stärkerem Wachstum immer zentralisiert, ja, zentriert um den Handels-
[1] Makedonien ist ursprünglich ein echter feudaler Landstaat, zerfallend bis zum fünften, teilweise sogar bis zum vierten Jahrhundert in eine Anzahl selbständiger Fürstentümer, die in gewisser, jedenfalls sehr wechselnder Abhängigkeit vom makedonischen Königtum standen (Kaerst a. a. O. S. 162). Als Einheitsreich ist es, wie jeder Feudalstaat, vom Königtum geschaffen worden, und zwar durch Eroberung, ganz wie etwa das fränkische Reich oder der brandenburgisch-preußische Staat (163 und 1S0). Ein städtisches Leben fehlte ursprünglich völlig; selbst die Hauptstädte, wie Aegae und Pella, hatten kein politisches Leben, das dem hellenischen verwandt war (177). Die Masse der Bevölkerung bestand aus Hirten und Bauern, die in Dörfern wohnten, und zwar waren es vorwiegend Freie (181). Darüber stand ein Adel mit ausgedehntem Großgrundbesitz (182), der durch Eroberung ins Ungeheure wuchs (228). Es handelte sich hier um eine Art von Lehensystem mit der Verpflichtung zu Kriegsdiensten. Erst von Philipp an wurde das adlige Reiterheer in eine bäuerliche Landwehrinfanterie verwandelt (182). Das hängt auch hier, wie überall, mit dem Bündnis zusammen, das das Königtum mit dem Bauernstande gegen den Adel schloß, um den starken Einheitsstaat aufzurichten (195). All das charakterisiert Makedonien als einen echten Latd- staat, den Kaerst denn auch (240) als eine wesentlich territoriale Macht bezeichnet, als einen binnenländischen Staat, der erst allmählich die Küsten gewonnen hatte. Seme Entfaltung zur Großmacht erfolgte namentlich durch die Berührung mit der G&d- wirtschaft, die durch den Besitz des Königtums an reichen Goldbergwerken gefördert wurde.
[401]
hafen, während der autochthone Landstaat, der schon von Haus aus stark dezentralisiert ist, sich lange Zeit hindurch in dem Maße seiner Ausdehnung zu immer stärkerer Dezentralisation entwickelt. Erst die Durchdringung seiner losen Organisation mit der im Seestaat ausgebildeten Verwaltungskunst und mit seinen ökonomischen Errungenschaften, namentlich der Geldwirtschaft und dem Beamtentum, kann ihm, wie wir zeigen werden, die Kraft verleihen, sich die um einen Schwerpunkt sicher schwingende Gliederung zu geben, die unsere modernen Großstaaten auszeichnet, und die schon Rom sich weithin zu geben wußte. Das ist der erste große Gegensatz zwischen den beiden Formen des Staates.
Der zweite, nicht minder entscheidende Gegensatz, in dem der erste der Hauptsache nach wurzelt, ist der, daß der Landstaat sehr lange im Zustande der Naturalwirtschaft verharrt, während der Seestaat sehr schnell zur Geldwirtschaft gelangt. Auch dieser Gegensatz wächst aus den Grundbedingungen ihrer Existenz:
Im weit gedehnten Landstaat, der noch keine Gewerbsstädte mit regelmäßigem Verkehr auf Wochenmärkten entwickelt hat, ist Geld ein überflüssiger Luxus, so überflüssig, daß eine schon entfaltete Geldwirtschaft in die Natural-Tauschwirtschaft zurückfällt, wenn in politischen Wirren jene höhere Wirtschaftsform verschwand. Karl der Große hatte gut Münzen schlagen: die Wirtschaft stieß sie aus, denn Neustrien — von Austrasien gar nicht zu reden — war im Sturm der Völkerwanderung auf die Stufe der Naturalwirtschaft zurückgesunken. Das Edelmetall versteckte sich z. B. auch im Reiche der Achämeniden zum großen Teile in den Horten der Fürsten und ihrer Magnaten [1], wo es als Kriegsschatz gehalten wurde [2]. Der primitive, noch nicht von dem Seestaat umgeformte Landstaat braucht kein Geld als Wertmesser und Tauschmittel, weil er noch keinen entwickelten Tauschverkehr hat. Die Hintersassen steuern außer in Arbeit in Naturalien, die der Grundherr mit seinem Gefolge unmittelbar konsumiert; und diejenigen edleren Erzeugnisse, die seine Fronhofswirtschaft nicht hervorbringt, tauscht er von hausierenden Kaufleuten oder auf den Jahrmärkten gegen Sklaven, Herdentiere, Wolle, Wachs, Pelze und andere Erzeugnisse der kriegerischen Naturalwirtschaft ein. Das spärlich vorhandene Geld solcher Gesellschaften dient denn ursprünglich auch viel weniger dem Tausch als der Zahlung von Wergeldern und Gerichtsbußen.
Dagegen kann das Stadtleben unmöglich auf irgend höherer Entwicklungsstufe des Geldes als Tauschmittels und Wertmessers entbehren.
[1] Ebenso in Indien (M. Weber, Wirtsch.Gesch. S. 301).
[2] „Der persische Großkönig hat seine Dareiken als Leistungsmittel für seine hellenischen Söldner geprägt“ (M. Weber, Wirtsch.Gesch. S. 213). Oppenheimer, System der Soziologie. Band II.
[402]
Der freie städtische Handwerker kann nicht auf die Dauer seine Produkte unmittelbar gegen die der anderen Handwerker tauschen; schon der Kleinhandel mit Nahrungsmitteln, unentbehrlich von dem Augenblicke an, wo in der sich wachsenden Stadt nicht mehr jeder Einwohner eigene Landwirtschaft haben kann, fordert das Vorhandensein von Münzgeld. Und noch viel weniger kann der Handel im engeren Sinne, der Handel nicht zwischen Kaufmann und Konsumenten, sondern zwischen Kaufmann und Kaufmann, des Geldes entraten. So muß sich zuerst das „naturale Metallgeld“, und dann das geprägte, d. h. nach Schrot und Korn, nach Gewicht und Feingehalt gewährleistete Edelmetallgeld im engsten Sinne entwickeln.
So entsteht denn das Geld auch in der Tat erst in den ersten voll entwickelten Seestaaten, und zwar in Hellas, als staatlich geprägte Münze. Vorausgegangen ist die private Münze in Gestalt abgewogener und mit dem Stempel einer als zuverlässig bekannten Firma versehener Barren: der vorderasiatische Schekel (heut zirkuliert noch oder vielmehr wieder als Folge der ungeheuren Geldverfälschung der Regierungen der ebenfalls private chinesische Silbertael). „Die ältesten Münzstätten lagen in Lydien, vermutlich an der Küste, und entsprangen der Kooperation des lydischen Königs mit den griechischen Kolonien“ [1]. „Jedenfalls ist die Schöpfung der Münze hervorgegangen aus dem Bedürfnis des griechischen Handels, der ja in dieser Zeit allen Verkehr Lydiens mit dem Meere vermittelt, und die neue Erfindung (gemacht zu Anfang des VII. Jahrhunderts) hat sich in wenig mehr als einem Jahrhundert über den größten Teil der griechischen Welt hin verbreitet“ [2]. Und zwar geht die Ausbreitung völlig der kommerziellindustriellen Entwicklung parallel. Von Ionien aus, das in diesem Betracht dem Mutterlande weit voraus war, erreichte die Geldwirtschaft zuerst „die Handels- und Industriestädte am Euripos und dem saronischen Golfe; bei weitem die meisten griechischen Staaten fühlten noch während der ersten Jahrzehnte des VI. Jahrhunderts nicht das Bedürfnis nach einer eigenen Münze. Und auch in den wirtschaftlich vorgeschritteneren Gebieten ist die Geld Wirtschaft nur sehr langsam an die Stelle der Naturalwirtschaft getreten. So hat Solon seine Schatzungsklassen nicht etwa nach dem in Geld ausgedrückten Vermögen abgegrenzt, sondern nach der Zahl der Scheffel Korn, die jeder erntete“ [3]. Das wurde erst nach den Perserkriegen anders. Da „verschwand die alte Naturalwirtschaft oder erhielt sich doch nur in den abgelegeneren Teilen der griechischen Welt. In Athen sind die Sätze der so Ionischen Schätzung schon früh in Geld umgerechnet worden;
[1] Weber, Wirtsch.Gesch. S. 213. v. Poehlmann, a. a. O. I, S. 37.
[2] Beloch, a. a. O. S. I. 1, 288/9.
[3] Beloch, a. a. O. I. 1, S. 295.
[403]
als Pentakosiomedimne galt jetzt nicht mehr, wer jährlich 500 Scheffel Gerste erntete, sondern wer ein Talent (5482 Mark) im Vermögen hatte“ [1] In Thessalien freilich hat sich die Steuer in natura bis ins IV. Jahrhundert erhalten, auf Sizilien bis zum Ende der griechischen Selbständigkeit und darüber hinaus bis tief in die römischen Zeiten [2].
Diese Bemerkung über Sizilien ist vielleicht geeignet, ein Licht auf die auffällige Tatsache zu werfen, daß Karthago erst drei Jahrhunderte nach der Erfindung der Münze zu eigener Prägung überging, „und zwar auch dann nicht, um Tauschmittel, sondern lediglich, um Zahlungsmittel für seine Söldnerheere zu gewinnen. Überhaupt war der ganze phönikische Handel geldloser Verkehr“ [3]. Das muß so verstanden werden, daß die Phöniker sich des in ihrem Heimatsgebiete gebräuchlichen privaten Barrengeldes, der Schekel, bedient haben; nur die staatlich hergestellte Münze hat ihnen gefehlt. Für ihren Handelsverkehr im östlichen Teil des Mittelmeers wird das auch ausgereicht haben.
Man muß sich nämlich klar machen, daß in den Zeiten, von denen wir sprechen, ein sehr bedeutsamer Gegensatz zwischen den Gebieten des östlichen und westlichen Mittelmeers bestand. Im Osten trafen die Griechen an den wichtigsten Punkten auf gefestigte, zum Teil sehr mächtige Landstaaten, in denen das Gewerbe und der Landhandel, vor allem der wichtige Überlandhandel durch die Wüstenzone von Innerasien her, sehr weit entwickelt war. Die Märkte lagen hier vielfach weit im Innern, wohin Piratenfahrt nicht dringen konnte. Hier war also aus allen Gründen der friedliche Verkehr geboten, und dieser wurde durch die Einführung eines anerkannten Geldes sicherlich sehr erleichtert, wenn nicht in vielen Fällen erst ermöglicht. Im Westen aber, wo die sizilischen Griechen und Karthago ihre wichtigsten Interessen hatten, war die Bildung von Landstaaten in dieser Zeit noch nirgend über die allerersten Stadien hinausgediehen; hier war der Handel entweder Faktoreihandel, der sich leicht im Tauschverkehr vollzieht, ja, kaum anders vollziehen kann, wie wir noch heute an den europäischen Faktoreien in den Tropen betrachten können; oder er war Seeraub und gewaltsame Herrschaft, und die bedürfen erst recht keines Geldes.
Auf diese Weise mag es gekommen sein, daß die Karthager als Handelsmacht den Hellenen gegenüber ins Hintertreffen gerieten: „Gerade die technische Mehrleistung der Münze war es, welche die Überlegenheit des hellenischen Handels hat begründen helfen“ [4].
So sind denn die Hellenen die Erfinder des staatlichen Geldes gewesen, abgesehen vielleicht von Ostasien; dort ist, wie Weber sagt,
[1] Beloch, a. a. O. II. I, S. 89.
[2] Beloch, a. a. O. I. 1, S. 295.
[3] Max Weber, Wirtsch.Gesch. S. 213.
[4] Weber, a. a. O. S. 214. 2Ö»
[404]
vielleicht autochthone Entstehung der Münzprägung anzunehmen; aber in Indien kam sie erst zwischen 500 und 400 auf occidentale Anregung hin in Anwendung, und auch in Ägypten hat sie wahrscheinlich erst die Ρtolemäerherrschaff eingeführt. Bis dahin begnügte man sich mit unmittelbarem Tauschhandel und den auf die königlichen Lagerhäuser ausgestellten Anweisungsscheinen, die wie Papiergeld oder Schecks umliefen [1]. Wir kommen bei der Analyse des Oasenstaates darauf zurück.
Auch Rom hat sein staatliches Geld von den Hellenen übernommen. Bei seiner geringen Entwicklung als Handelsstadt und seiner Orientierung nach dem Westen des Mittelmeers ist es lange mit Kupfergeld für den städtischen Kleinverkehr ausgekommen; für den Großhandel begnügte man sich mit den zahlreich umlaufenden fremden Münzen; Edelmetall ließ Rom zuerst nur in Capua schlagen, erst 269 ging es zu eigener Silberprägung über. (Weber, a. a. O.)
Geldwirtschaft und Gewerbswirtschaft treiben sich gegenseitig immer schneller vorwärts. Neben den Handel tritt das Gewerbe für den Handel: Schiffbau, Seilerei usw. und das Exportgewerbe. Wie die Stadt sich vergrößert und reicher und üppiger wird, muß sich in gleichem Schritt auch das Lokalgewerbe für den eigenen Markt, muß sich das Geldwechsel- und Bankgeschäft, das Schank- und Beherbergungsgewerbe entfalten. Hier treibt immer ein Keil den anderen.
Auch hier sind die griechischen Verhältnisse typisch. Zuerst in Ionien, dann auch im Mutterlande entfaltet sich eine starke Industrie, vor allem das Textilgewerbe (Weberei und Färberei), das in den großen Schafherden seine Rohstoffgrundlage hat, und das Metallgewerbe; Kupfer und Eisen sind im Mutterlande und auf den Inseln reichlich vorhanden; das Eisen als Waffe hat zum großen Teil die militärische Überlegenheit der Hellenen entschieden. Neben die freie Handwerkerarbeit tritt hier sehr früh die Sklavenarbeit, die, wie Beloch richtig darstellt, nur in etwas größeren Betrieben wirtschaftlich möglich ist, sobald erst einmal reine Erwerbsgründe zur Sklavenhaltung führen. „Der kleine Handwerker wird nur selten das nötige Kapital besitzen, sich einen Sklaven anschaffen zu können; er wird noch weniger geneigt sein, das Risiko zu tragen, daß sein einziger Sklave entläuft oder stirbt oder auch nur durch Krankheit längere Zeit arbeitsunfähig wird. Es konnten also nur die kapitalkräftigsten und unternehmungslustigsten Handwerker sein, die das neue Produktionsmittel in ihrem Betriebe verwendeten. Hatte ein solcher Meister erst 5—6 Sklaven beisammen, so fiel das Risiko zum großen Teil weg [2]“, durch „Selbstversicherung“. Damit war der bekannten Entwicklung Raum gegeben, die die Nieder-
[1] Vgl. Neurath, a. a. O. S. 7, 52.
[2] Beloch, a. a. O. I. 1, S. 270/1
[405]
konkurrierung der kleinen Unternehmer durch die großen herbeiführt. Ein Stand besitzender, ja, reicher plebejischer Unternehmer kommt empor: der „dritte Stand“ erstarkt.
Das aber kann auf die Gestaltung der Verfassung nicht ohne Rückwirkung bleiben.
Schon die Psychologie des Städters [1] macht es unmöglich, daß die alte aristokratische Ordnung bestehen bleibe. Der Städter im allgemeinen und besonders der Einwohner einer reichen Seehandelsstadt ist ein ganz anderer Mensch als der Landbewohner. Sein Blick ist freier und weiterspannend, wenn er auch oft mehr an der Oberfläche haftet als der des sinnierenden und scharf beobachtenden Bauern. Mindestens die Klasse der Großhändler und Schiffer spricht zudem mehrere Sprachen, und das ist, wie wir zuerst gezeigt haben [2], ein gewaltiger Hebel der Rationalisierung, da sich dem Polyglotten das Wort vom Ding ablöst und so zum Begriff im strengsten Sinne wird. Schon dieser Umstand ist sehr dazu geeignet, die Geisterfurcht zu bannen und die Kraft der „tabuierenden“ Gesetze zu schwächen, die die Oberklasse den Untertanen auferlegt hat. Dazu kommt, da der Städter von der Natur mit ihren unberechenbaren Launen viel weiter entfernt und viel unabhängiger ist als der Landmann, daß ihm das ganze Leben als berechenbar, die Welt als ein Mechanismus erscheinen kann : ein Umstand, der wieder durch die „Rechenhaftigkeit“ seines Berufes verstärkt wird, wie er sie umgekehrt verstärkt. Ferner ist der Städter lebhafter, „nervöser“, weil er an einem Tage von mehr Reizen getroffen wird als der Bauer vielleicht in Jahren ; er ist an fortwährende Neuigkeiten und Neuerungen gewöhnt und daher immer „rerum novarum cupidus“: der lateinische Ausdruck für den revolutionär Gesinnten. Und weil er schließlich in dichten Massen zusammenhaust und daher sich zählen, seine in der Mehrheit liegende Macht deutlich erkennen kann, ist der Untertan hier trotziger und aufsässiger als der hörige Bauer, der in so großer Vereinzelung lebt, daß er sich seiner Masse nie bewußt werden kann, und daß der Herr mit seinem Gefolge in jedem Streit so gut wie immer die Überhand haben wird [3].
Schon das bedingt eine immer mehr vorschreitende Lockerung des starren Unterordnungsverhältnisses, das der primitive Eroberungsstaat auferlegt hatte. Nur die „Landstaaten“ von Hellas haben ihre Untertanen lange in der alten Knechtschaft gehalten: Sparta seine Heiloten, Thessalien seine Penesten usw. Überall in den See-, in den „Stadtstaaten“ aber finden wir schon früh die Plebs im Aufstiege, und ebenso in Rom.
[1] Vgl. S. S. I, S. 666/7.
[2] S. S. I, S. 700.
[3] Vgl. Aristoteles, Politik VI. 10, zit. nach Busolt, a. a. O. S. 39.
[406]
Denn unter diesen Umständen findet das naturgemäße Streben der wohlhabend oder reich gewordenen Plebejer nach dem vollen Bürgerrecht, nach der politisch-rechtlichen und vor allem: gesellschaftlichen Gleichheit (denn Prestige gilt mehr als Rechte) starke Bundesgenossen in der Kleinbürger Schaft. Dazu kommt verstärkend, daß auch die ursprünglich wirtschaftlichen Unterschiede zwischen oben und unten sich immer mehr verwischen, nicht nur in bezug auf den Reichtum, sondern auch auf die Beschäftigung.
Was das erste anlangt, so sind viele alte Adlige verarmt, teils durch Verschwendung, teils durch Unglücksfälle im Beruf, von denen die Gefangenschaft und der Freikauf, aber auch Schiffbruch, schlechte Handelskonjunktur usw. hervorgehoben werden mögen. Später, im fünften Jahrhundert in Hellas, führten die häufigen politischen Krisen, die Verfassungskämpfe und Kriege, die oft den Grundbesitz verheerten, zu weitreichender Verarmung des alten Adels. Wer aber seinen Besitz verlor, verlor auch bald seine Klasse, sank ins Plebejat hinab. Überhaupt muß man sich klar machen, daß der mobile Reichtum nicht entfernt die starre Stabilität des Grundeigentums hat: der Reichste kann durch eine Drehung von Fortunas Rade nach unten geschleudert werden, der Ärmste durch einen Glücksfall zum reichen Manne werden.
Aber auch beruflich haben sich die beiden Stände weit aneinander angenähert. Zu allererst lag die Schiffahrt und der Groß- und Fernhandel fast ausschließlich in den Händen der verstadtlichten Patrizier: „Dafür, daß diese Rittergeschlechter stadtsässig werden, ist durchaus die Möglichkeit der Teilnahme an Handelschancen maßgebend gewesen“ [1]. Zwar bezeichnen sie sich immer noch archaistisch als „Grundbesitzer“ (Geomoren) : aber sie sind Kapitalisten geworden, die auch ihren Grundbesitz fortan als Rentenquelle verwalten, wie wir noch genauer zu betrachten haben werden. Von den neuen Reichen unterscheidet sie also nichts mehr als ihr eigener Dünkel : denn auch jene sind Schiffbesitzer und Händler — und nebenbei Fabrikanten. Ihre militärische Übermacht ist geschwunden; das Tabu hat keine Wirkung mehr: sie müssen dem Drucke weichen, den die Plebejer unter Führung der nuova gente auf sie ausüben.
Die erste der großen Verfassungsänderungen bedeutet überall noch den Sieg des plutokratisch umgeformten Adels über die Notwendigkeiten einer politischen Verfassungsänderung: der Sturz des Königtums. Wie Fustel de Coulanges annimmt, und auch Beloch andeutet [2], war das Königtum, wie überall, ein Schutz der Volksmenge gegen allzu gröbliche Ausbeutung. Dieses schwache Geschlechts-
[1] Weber, Wirtsch.Gesch. S. 277.
[2] Griech. Gesch. I. 1, S. 307. Ebenso Mommsen, Röm. Gesch. I, S. 265 und Röscher (a. a. O. S. 45) in bezug auf das römische Königtum.
[407]
königtum, ursprünglich kaum mehr als das Recht der vornehmsten Gens des vornehmsten Stammes auf Vorsitz bei den Festen [1] und auf die Führung im Kriege, stürzt überall sehr bald nach der Umwälzung der wirtschaftlichen Verhältnisse, zuerst „wie natürlich in Ionien, dem wirtschaftlich und geistig fortgeschrittensten Teile der griechischen Welt“ [2], dann in den großen Handelsstädten des Mutterlandes, dort spätestens, hier frühestens im VIII. Jahrhundert; in Sparta kam es im VIII. Jahrhundert zu einem Kompromiß zwischen Adel und Königtum: dem alten Herrscherhause der Agiaden wurde das Geschlecht der Eurypontiden mit gleichen Rechten zur Seite gestellt, nachdem schon vorher das Ephorat, zunächst als Marktgericht, eingesetzt worden war; in den weniger entfalteten Teilen von Hellas hielt sich das Königtum länger, und in den „abgelegenen und lange in der Kultur zurückgebliebenen Teilen“ bis in späte Zeiten [3].
Zur Allmacht gelangt, mißbrauchte der Adel selbstverständlich wie jede herrschende Klasse seine Macht zur schonungslosen Ausbeutung und Unterdrückung des Volkes, um so ärger, weil es sich jetzt bereits um kapitalistische Interessen handelte, die schlechthin unersättlich sind. Wir werden diese Dinge, als Auswirkungen des politischen Mittels, im nächsten Abschnitt im Zusammenhang darstellen : hier, wo es sich uns wesentlich um die Schilderung der Kämpfe handelt, die das ökonomische Mittel zur Abwehr des Druckes zu führen hat, mag die Andeutung genügen, daß die reichen Plebejer sich vorzugsweise auf die Bauern stützen konnten, die unter dem Adelsregiment furchtbar litten und dicht daran waren, in Leibeigenschaft herabgedrückt zu werden. Es kommt zu offener Revolution; ehrgeizige Adlige stellen sich an die Spitze der Unzufriedenen, und die neue Monarchie entsteht in der Form der „Tyrannis“. Der Zusammenhang dieser Bewegung mit der sozial-wirtschaftlichen Entwicklung ist ebenso klar, wie der voraufgegangene Sturz des alten Königtums: „Sie ist durchaus beschränkt auf die wirtschaftlich und geistig fortgeschrittensten Teile der hellenischen Welt“ [4]; auch hier ist wahrscheinlich Ionien vorangegangen, Attika, Euboea, und die Städte am Isthmos sind gefolgt [5]. „Die Tyrannis hat überhaupt nur in den Städten Boden zu finden vermocht, in denen die Gewerbe in Blüte standen, ein Beweis, daß es eben die Gewerbetreibenden gewesen sind, von denen die Revolution ausgegangen ist, welche die Adelsherrschaft in Stücke schlug“ [6].
[1] Der König war vor allem „le chef du culte“. Fustel de Coulanges, a.a. O. S. 203ff.
[2] Beloch I. 1, S. 216.
[3] Beloch I. 1, S. 218.
[4] Beloch I. 1, S. 358.
[5] Beloch I. 1, S. 359.
[6] Beloch I. 1, S. 273.
[408]
Die neuen Herrscher fühlten und führten sich zuerst durchaus als Vertreter des ganzen Volkes gegen die ehemals allein berechtigten Stände; unter ihrer Regierung blühte Wirtschaft, Kunst und Leben mächtig auf. Aber auch sie unterlagen der unwiderstehlichen Versuchung, ihre Macht zu mißbrauchen; von unaufhörlichen Verschwörungen des depossedierten Adels bedroht, griffen sie notgedrungen zu gehässigen Mitteln der Aufsicht und Abwehr; Hippias z. B. richtete erst nach der Ermordung seines Bruders Hipparch das Regiment des Schreckens ein [1]: in jener Zeit erst erhält der Name „Tyrann“, der ursprünglich so etwas wie „Volkskommissar“ bedeutet haben wird, den üblen Beiklang, der ihm geblieben ist [2]. Auch sie fielen vor dem Ansturm der alten Stände und des jetzt mit ihnen verbündeten, nach voller Freiheit strebenden Volkes, und die Demokratie wurde erreicht, soweit sie in einem Staatswesen eben erreichbar war, das einen großen Teil seiner Einwohner, die Sklavenschaft, nicht nur von jedem Bürgerrecht, sondern sogar von fast jedem Menschenrecht ausschloß.
Schon vor der Tyrannenzeit war der Satz aufgekommen, daß „das Geld den Mann macht“; schon lange hatte nicht mehr das edle Blut, sondern der Besitz über die Zugehörigkeit zu der exklusiven regierenden Bürgerschaft entschieden: ein verarmter Adliger gehörte ihr nicht an, schon aus dem Grunde, weil er nicht mehr imstande war, die Pflichten seines Standes zu erfüllen. Noch war damals der Grundbesitz das entscheidende Kriterium [3]; aber allmählich tritt ihm der mobile Besitz ebenbürtig an die Seite, und jetzt gibt es kein Halten mehr: die politischen Vorrechte des Blutsadels werden eines nach dem anderen abgebaut; es bleiben ihm nur gewisse sakrale Funktionen, die man aus Geisterfurcht nicht wagt, ihren erblichen Trägern zu entziehen — wie ja auch die Adelsrevolution überall den abgesetzten Königsfamilien das Amt des Opferkönigs gelassen hatte — ; die neuen Reichen sind reich genug, um die mit den Ämtern verbundenen persönlichen und geldlichen Opfer leicht bringen zu können; damit fällt auch das letzte, rein faktische, nicht mehr rechtliche Privileg, das dem Patriziat noch geblieben war und ihm eine Zeit hindurch noch die meisten leitenden Amtsstellen gesichert hatte: in Athen z. B. ist der Adel seit dem letzten Versuch einer oligarchischen Restauration (404/3) ganz von der Leitung des Staates verdrängt. Seine legitimistischen Ansprüche, sein Adelsdünkel erscheint nur noch als komischer Zug: „Es gibt fortan in Athen nur noch den Gegensatz zwischen der besitzenden und der nichtbesitzenden Klasse, und dasselbe gilt überhaupt für die griechische
[1] Busolt, a. a. O. S. 157.
[2] Vgl. Pohlenz, a.a.O. S. 22. Er sagt dort, daß das Wort „Tyrann“ ein lydiscnes Lehnwort sei.
[3] Beloch I. 1, S. 353.
[409]
Welt, soweit sie demokratisch oder durch die Schule der Demokratie gegangen war“. (Wir fügen hinzu, daß es auch für die entsprechende Periode der römischen Geschichte gerade so gilt.) „Jeder gebildete und wohlhabende Mann hat nach dem Sprachgebrauch dieser Zeit auf den Namen eines „Gentleman“, (καλός καγα&ος) oder eines Vornehmen (γνώριμος) Anspruch. Die Demokratisierung der griechischen Gesellschaft war damit vollendet“ [1].
Vollkommen vollendet! Denn das ist die politische Umwälzung allerdings erst in dem Augenblicke, wo der neuen Plutokratie wie selbstverständlich alle die Ehrentitel und -zeichen zufallen, die vorher nur dem Blutsadel zustanden: die Anrede „Herr“ und „Frau“, „monsieur“ und „madame“ und die plurale Form der Anrede in der zweiten oder gar der dritten Person oder, noch mehr gesteigert, in der italienischen dritten Singularform, wo die „Eccellenza“ ergänzt wird. Diese und andere Ehrentitel verleiht die Masse, die keinen Unterschied zu machen weiß, ohne jede verfassungsmäßige Anordnung.
Aber selbstverständlich muß die neue faktische Ordnung auch in regelrechter Verfassungsänderung festgelegt werden. Das geschieht überall und hat überall als Hauptziel und Haupterfolg, daß die alte geschlechtermäßige Verfassung beseitigt wird. Am gründlichsten ist das vielleicht in Athen durch Kleisthenes geschehen. Bis dahin hatten die großen Adelsfamilien geschlossen je einem Stamme (Phyle) angehört, ganz gleichgültig, wo sie ihren Sitz hatten: jetzt werden die Phylen zu rein territorialen Bezirken gemacht, und jeder Mann, auch der Edle, gehört zu der Phyle, in der er zurzeit seinen Sitz hat. Dadurch werden die Gentes auseinandergerissen und verlieren den größten Teil ihrer politischen Macht, die auf dem Zusammenschluß in dem Selbstverwaltungskörper der alten Phyle beruht hatte. Um jede weitere partikularistische Bewegung unmöglich zu machen, werden jeder Phyle drei getrennte „Kreise“ (Trittyen) zugelegt: einer in der Hauptstadt und ihrer Umgebung, ein zweiter an der Küste und ein dritter im Innern, so daß die verschiedenen Interessen sich im Rat der Phyle ausbalanzieren müssen. Gleichzeitig werden auch die patrizischen Verbände der Phratrien umgebaut und Gemeinbürgern geöffnet, so daß auch hier der alte Verband zerstört wird [2]. Die ganze Reform erinnert in ihrer raffinierten politischen Klugheit an das neue Lehnssystem, das Wilhelm der Eroberer in seinem England einführte; er schuf aus seinen Vasallen große Grundherren und machte es ihnen doch durch weise räumliche Verteilung ihrer Güter unmöglich, nach dem Landesfürstentum auch nur zu streben. Selbst großer Lehnsträger der
[1] Beloch II. 1, S. 162ff.
[2] Busolt, a. a. O. S. 160, 207ff.
[410]
Könige von Frankreich, wußte er allzu genau, wo die Schwäche des Instituts lag, und wußte sie zu vermeiden: „Ich habe bittere Frucht gegessen und kenne den Baum, an dem sie wächst“, heißt es im Dschungel-Buch [1].
3. Die geistige Aufklärung und die Kultur. ↩
Wir haben bereits in der Darstellung der Staatstheorien uns flüchtig mit der griechischen Aufklärung und Kulturperiode zu beschäftigen gehabt. Hier ist die Stelle, um sie noch einmal in etwas größerer Ausführlichkeit darzustellen.
Es handelt sich hier wie in allen diesen Glanzzeiten der menschlichen Entwicklung um ein Neben-, Mit- und Durcheinander von Zügen einer Emporentwicklung und einer gleichzeitigen sozialpathologischen Entartung. Das bedingt bedeutende Schwierigkeiten der Auffassung und Darstellung. Es ist schon nicht immer leicht, von einem bestimmten Zuge zu sagen, ob er als progressiv oder regressiv zu bewerten ist. Noch größere Schwierigkeiten bedingt das folgende:
Die meisten Historiker fassen jene eben angedeutete innige Durchdringung vorwärts führender und degenerativer Erscheinungen als eine „immanente“ Verknüpfung auf; sie glauben, daß, wie menschliche Dinge einmal liegen, Blüte ohne gleichzeitigen oder doch unmittelbar folgenden Verfall unmöglich ist. Das ist nicht unsere Anschauung. Selbstverständlich zweifeln wir nicht im mindesten an der historischen Notwendigkeit dieser verhängnisvollen Verknüpfung: aber wir sind der Überzeugung, daß die kulturelle Emporentwicklung die Normalität, sozusagen die Gesundheit, einer Gesellschaft darstellt, die einmal einen gewissen Grad der Zivilisation erreicht hat; sobald städtisches Leben sich entfaltet, und so lange die Unterschiede der Klassenlage, des Vermögens und des Einkommens einen gewissen mäßigen Grad nicht übersteigen, ist schnelle und glänzende Entwicklung nicht nur der Zivilisation, sondern auch der Kultur gesichert.
Im bisherigen historischen Verlauf steigern sich allerdings die Gegensätze der Klassenlage, des Vermögens und Einkommens in solchen Zeiten so schnell und in so gewaltigen Ausmaßen, daß daran die Blüte schnell zugrunde gehen muß. Aber wir halten diese Koinzidenz nicht, wie fast alle Staatsphilosophen und Historiker vor uns, für eine im-
[1] Max Weber (Wirtschaftsgeschichte S. 282, vgl. S. 97) stellt diese Entwicklung glücklich und treffend der grundsätzlich gleichlaufenden der mittelalterlichen Städte entgegen. In der Antike beherrscht der Gegensatz von städtischem Gläubiger und bäuerlichem Schuldner, im Mittelalter von Kapital und freier Arbeit das Bild. Darum werden hier die Geschlechter gezwungen, in die Zünfte einzutreten, dort aber in Dörfer, tribus, Bezirke ländlicher Grundbesitzer, wo sie zu gleichem Recht wie die bäuerlichen Grundbesitzer sitzen. Sie werden verhandwerkert im Mittelalter, verbauert in der Antike.
[411]
manente Notwendigkeit, sondern eben nur für einen Zufall im Cournotschen Sinne. Es ist der Hauptinhalt dieses ganzen Werkes, nachzuweisen, daß das sogenannte Gesetz der ursprünglichen Akkumulation nicht existiert: und jene Überzeugung von der immanenten Notwendigkeit der Koinzidenz von Blüte undVerfall beruht auf gar nichts anderem als auf der axiomatisch angenommenen Geltung dieser „Wurzel aller soziologischen Übel“.
Wir können diese Thesen hier nicht beweisen. Den Beweis haben wir zu geben versucht in großer Überschau in unserer Allgemeinen Soziologie, namentlich in dem Kapitel von den „Mischformen der menschlichen Beziehung“; — und in einem ersten Versuch geschichtlicher Darstellung im zweiten, historischen, Teil unseres „Großgrundeigentum und soziale Frage“. Hier müssen wir uns damit begnügen, die von uns gewonnenen allgemeinen Gesichtspunkte auf die hellenische Geistesentwicklung kurz anzuwenden:
Überall, wo das politische Mittel zurücktritt, um dem ökonomischen Raum zu geben, tritt auch das jenem natürlich verbundene Recht des Schwertes und der Gewalt zurück, um durch das Recht der Gerechtigkeit, der Gleichheit der Personen und der Äquivalenz des Tausches ersetzt zu werden. Das war auch in Hellas der Fall. „Unter dem Einfluß des gesteigerten Verkehrs begannen jetzt friedliche Zustände an die Stelle des Krieges Aller gegen Alle zu treten. Die Raubzüge in das Gebiet der Nachbarn hörten mehr und mehr auf, und die Städte gewährleisteten sich durch förmliche Verträge gegenseitigen Schutz ihrer Bürger und Rechtsgleichheit bei Prozessen. Zur Wahrung dieser Interessen wurde, seit dem VI. Jahrhundert etwa, eine Art diplomatischer Vertretung im Ausland geschaffen. Die neue Einrichtung knüpfte an das altgeheiligte Gastrecht an; angesehene Bürger fremder Staaten wurden zu öffentlichen Gastfreunden ernannt, um denen, die selbst keinen Gastfreund hatten, „statt des Gastfreundes“ (als „Proxenos“) zu dienen [1]. Sie hatten also etwa die Funktionen der heutigen Konsuln. . . . Der Seeraub hörte auf, in der öffentlichen Meinung als ein anständiges Gewerbe zu gelten, wenigstens soweit er gegen Griechen gerichtet war“ [2].
„Mit dem Fortschritt auf geistigem Gebiete ging der ethische Fortschritt Hand in Hand. Während die Zeit Homers unter „Tugend“ (αρετή) jede Art geistiger oder körperlicher Vorzüge versteht, wie z. B. bei Frauen die Schönheit, beginnt das Wort seit dem VII. Jahrhundert die Bedeutung sittlicher Tüchtigkeit anzunehmen. . . . Demgemäß kann die αρετή nach der Anschauung dieser Zeit durch eigene Anstrengung erworben werden, wogegen sie nach dem Glauben der homerischen
[1] Busolt, a. a. S. O. 53.
[2] Vgl. Beloch I. 1, S. 281/2.
[412]
Zeit eine freie Gabe der Götter war. Und ebenso bezeichnend ist, daß unter allen Tugenden jetzt die Gerechtigkeit am höchsten gestellt wird. Daneben tritt die Tugend des Maßhaltens“ [1] : die, wie wir hinzufügen wollen, bürgerliche Tugend par excellence.
„Vielleicht den besten Gradmesser für das sittliche Niveau einer Zeit bildet ihr Kriegsrecht. Man beginnt jetzt das Leben des überwundenen Feindes zu schonen und gestattet den Gefangenen regelmäßig den Loskauf. Nach dem Siege werden die Leichen der gefallenen Feinde regelmäßig ihren Angehörigen ausgeliefert, und zur Bestattung ein Waffenstillstand gewährt. Über den Tod des Gegners in lauten Jubel auszubrechen oder seine Leiche zu schänden, gilt schon dem VII. Jahrhundert als unedel. . . . Wie der beständige Kriegszustand zwischen den Nachbarstaaten, tritt zwischen den Bürgern desselben Staates die Selbsthilfe mehr und mehr in den Hintergrund; die Blutrache verschwindet und wird durch die Kriminalgerichtsbarkeit des Staates ersetzt. Die rohe Anschauung, daß der Mord durch eine Geldstrafe gesühnt werden könne, wird aufgegeben. . . . Die Zahl der Verbrechen gegen die Person mußte infolgedessen sich vermindern, und der Grieche konnte im täglichen Leben das Schwert ablegen“ (I, S. 316) [2].
„Unter dem Einfluß dieser Umwälzung in den sittlichen Vorstellungen begannen auch die religiösen Ideen eine reinere Gestalt anzunehmen. . . . Dem alten Glauben waren die Götter im wesentlichen nur die mächtigen Herren der Welt, die Glück und Unglück den Sterblichen nach ihrem Belieben austeilen, und deren Gunst zu erlangen es nur einen Weg gibt: reichliche Opfer. Jetzt tritt neben diese Anschauung die Auffassung der Götter als Hüter des Rechts, als Rächer jeglichen Frevels, und der Glaube, daß ein tugendhaftes Leben auch ein gottgefälliges sei. Nicht das Opfer ist es, das die Gottheit ansieht, sondern die Gesinnung, in der es gebracht wird, nicht nur körperlich rein, sondern mit reinem Herzen soll man den Tempel betreten“ (317).
In solcher Atmosphäre erweichen auch die alten Vorstellungen des starren Erobererrechts der Ungleichheit. Zu den eleusinischen Mysterien erhielten Alle, die darum nachsuchten, die Weihen, Männer und Weiber, Freie und Sklaven: diese Religion erkannte im Gegensatz zu den altüberlieferten Kulten keine Privilegien an. Es war der Ausdruck der Umgestaltung der alten religiösen Vorstellungen in eine Religion der Vergeltung nach dem Tode und der Erlösung (429f.).
Diesem sittlich-religiösen Aufschwung, der sich insgesamt darstellt als gewaltige Schwächung der ursprünglichen, gegen alles Fremde
[1] Beloch, a. a. O. I. 1, S. 315. Auch die folgenden Zitate mit Ziffern in ( ) sind diesem Werke entnommen.
[2] Noch zur Zeit des Thukydides trugen viele Binnenstämme, z. B. die ozolischec Lokrer, die Ätoler usw. beständig Waffen (Busolt, a. a. O. S. 52).
[413]
gerichteten „Außenmoral“ der Gruppe und als die entsprechende Ausweitung der „Binnenmoral“ auf die bisher Außenstehenden, entspricht nun überall in der Welt, wo ein kraftvolles, noch nicht durch innere Zersetzung gespaltenes Bürgertum besteht, der wundervolle Aufschwung von Kunst, Wissenschaft und Philosophie, die reiche und reife Frucht der Abschwächung der alten Tabugebote, die jeden Kulturwandel verhinderten. Das war die Grundlage der herrlichen Zeiten in dem Italien der Renaissance, im Deutschland des hohen Mittelalters und vor allem in Hellas: es hieße, Eulen nach Athen tragen, wollten wir diese berühmte Periode der Menschheit ausführlich darstellen. Es ist auch überall der äußerlich gleiche Verlauf: die klassische Zeit der Saat und ersten Ernte, in der die großen reichen Bürgerschaften selbst die Auftraggeber und Mäzene sind, während die Bürger selbst noch in Bescheidenheit leben; an den großen Aufgaben erstarkt die Kunst immer mehr. Dann verarmen die Gemeinden; die Privaten und die Fürsten werden die Auftraggeber, und es kommt zu einer Nachblüte und zweiten Ernte, deren Erzeugnisse noch die ganze große Technik der klassischen Zeit zeigen, aber doch schon ihrer Substanz nach deutliche Spuren des Verfalls aufweisen. Es geht das sehr schnell: in Athen bezeichnet die Generation des Aischylos den noch etwas archaischen Aufstieg, die des Sophokles die Höhe, und Euripides den beginnenden Abstieg.
„Sophokles und Euripides haben nebeneinander für die attische Bühne geschrieben ; der Altersunterschied zwischen beiden betrug noch nicht zwanzig Jahre, und doch trennt sie ein Abgrund; der ältere wurzelt mit seinem ganzen Denken in der Vergangenheit, während der jüngere den Ideen Ausdruck gegeben hat, denen die Zukunft gehörte. Euripides' Dramen sind die poetische Verklärung der neuen Bildung; er hat alle die Probleme auf der Bühne behandelt, die in den Kreisen der Sophisten behandelt wurden“ (ib. II, S. 251). „Seine Personen sind Menschen aus des Dichters eigener Zeit, nicht mehr Typen, sondern Individuen, mit allen ihren Schwächen und Leidenschaften. Und die Konflikte, die sie durchkämpfen, . . . sind die Konflikte des wirklichen Lebens“ (222).
Hier mischen sich die Elemente des Fortschritts und der Entartung schon ununterscheidbar : die Loslösung von den alten Bindungen der Tabureligion mit den Problemen, die die soziale Zersetzung stellt. Und das gleiche gilt von der ganzen „neuen Bildung“ jener Zeit: der Aufklärung. Die alten Gottesbegriffe sind allmählich verblaßt; schon bei Anaxagoras „hatte sich der Gottesbegriff zur Weltseele verflüchtigt, die zwar den Weltplan entworfen hat, aber in den Verlauf der Dinge nicht eingreift“. Dann kam Protagoras zu dem Ausdruck der äußersten Skepsis, und Diagoras von Melos zog, zu Anfang des peloponnesischen
[414]
Krieges, die volle Konsequenz, die Existenz der Götter offen zu leugnen (245). Aber der neue Glaube, der dazu bestimmt war, an die Stelle jenes entschwindenden alten Glaubens zu treten und der individuellen Sittlichkeit als Tragfläche zu dienen: der Glaube an die immanente Vernunft der gesellschaftlich-staatlichen Entwicklung, schwand in der sozialen Zersetzung, die sich mit reißender Geschwindigkeit vollzog, ebenfalls: und nun sah sich das befreite Individuum vor dem sittlichen Nichts. Seine „Interessen und Gesichtspunkte werden zum entscheidenden Maßstab der Weltauffassung und Lebensgestaltung“ [1]. Bald erscheint dieser Generation, deren Sprachrohr die Sophisten sind, alle Religion, wie zwei Jahrtausende später in gleicher gesellschaftlicher Lagerung einem Voltaire, als schlaue Erfindung zur Verhütung von Verbrechen : die Lehre des Kritias in seinem Drama „Sisyphos“ (ib. S. 79). Damit verliert der Nomos jede verpflichtende Kraft [2], und es blieb nur die Einzelnatur, d. h. das Recht des starken, sich durchzusetzen befähigten Individuums übrig. Das Interesse des Mächtigen galt als das allein zur Herrschaft berechtigte Gesetz (80). Die Sophisten predigten nur die Ethik der „guten Gesellschaft“ von Athen (70). In Piatons „Gorgias“ trägt ein uns sonst unbekannter Sophist Kallikles dieses Credo der attischen „leisure class“ vor: „Das Recht erscheint danach nicht mehr als Mittel für die Vereinigung der wesentlich gleichen Interessen der den Staat bildenden Individuen, sondern von den Voraussetzungen einer von Natur zwischen den Menschen bestehenden Ungleichheit aus ist das wahre Recht die Übermacht des Starken. . . . Es konnte dann die gesetzliche Ordnung als eine im Interesse der Schwachen, eben der großen Masse, getroffene Einrichtung erscheinen, als eine Knechtung des zum Herrschen befähigten Individuums, das dadurch gehindert wird, seine Kraft zu entwickeln“ (77). Man sieht, daß die „Kinderfibel“ und die „Machttheorie“ sich überall prompt einstellen, wo es gilt, die faktischen Vorrechte einer verrotteten Plutokratie zu rechtfertigen.
Es tritt denn auch als Reaktion auf diese Aufklärung die geistige Gegenrevolution in Gestalt einer Art von Romantik auf. Ihr erster großer Exponent ist Euripides in seinem Alter: „Hier, an der Schwelle des Grabes, in seiner Tragödie: die Bakchen, wendet der Dichter von der ganzen Weltanschauung sich ab, deren wirksamster Vorkämpfer
[1] Kaerst, a. a. O. S. 55. Die nächsten Zitate in ( ) nach diesem Buch.
[2] In einer erst kürzlich in einem Papyrus aufgefundenen Schrift über die Wahrheit weist der Sophist Antiphon nach, daß die auf nichts als Vereinbarung beruhenden Gesetze unserem natürlichen Streben nach Lust und Vorteil, also unserem wahren Interesse feindlich sind. „Wer sich nach dem Gesetz auf Notwehr beschränkt, ungerechte Eltern ehrt, Meineid nicht mit Meineid erwidert, handelt gegen die Natur“. Archelaos hatte gesagt: „Gerechtigkeit una Sittlichkeit bestehen nur als Menschensatzung, nicht von Natur“ (Pohlenz, a. a. O. S. 38).
[415]
er bis dahin gewesen war. Das ganze Stück predigt die Lehre, daß menschliche Weisheit nichts ist gegenüber der von der Zeit geheiligten Überlieferung. . . . Das Wissen, wie es in den Schulen der Sophisten gelehrt wurde, konnte das Bedürfnis weiter Kreise nicht befriedigen: sie verlangten nach Glauben“ [1]. Hier haben wir das Stichwort der neuzeitlichen Romantik, dem Burke in dem berühmten Satze Ausdruck gegeben hat: „Nature is wisdom without reflection and above it“.
Von hier aus versteht man die allgemeine Begeisterung der besitzenden Schichten für spartanisches Wesen und spartanische Verfassung, die zur Ausgestaltung der Lykurgfabel und weiterhin zu den Idealstaaten Piatons und Aristoteles' führte; die jungen Stutzer äfften wenigstens die Äußerlichkeiten ihres Idols nach, da sie keine Neigung hatten, ernstlich die strengen Institutionen der Spaitiaten einzuführen. „Sie gefielen sich darin, mit langem Haar, mit schmutzigen Händen, im kurzen spartanischen Mantel und lakonischen Schuhen durch die Straßen zu laufen; als Sport betrieben sie wie die Spartaner den Faustkampf und waren auf ihre verhauenen und verquollenen Ohren nicht weniger stolz als unsere Korpsstudenten auf ihre Renommierschmisse“ [2]. Außerdem schwärmte man selbstverständlich für die gute alte Zeit der Marathonkämpfer; ja, selbst der erste Exponent der frühen Aufklärung, Perikles, erschien der folgenden Generation der Konservativen bereits im verklärten Lichte (283/4).
Unter diesen Umständen mußte auch die neue Religiosität entarten. Eleusis erlebte seine Glanzzeit, der Zudrang der Gläubigen war ungeheuer; aber auch alle möglichen exotischen Mysterienkulte des Orients drangen ein und fanden enormen Zulauf: der der Kabiren von Samothrake, der des ägyptischen Ammon, der der Kybele usw., eingeführt von den zahllosen fremden Kaufleuten und den massenhaft importierten Sklaven. „Bereits um die Zeit des peloponnesischen Krieges waren die meisten dieser orientalischen Kulte in Athen weit verbreitet. Alle Augenblicke zogen Prozessionen der Verehrer des Sabazios und der „großen Mutter“ unter wüstem Lärm durch die Straßen; am Adonisfeste hallte die Stadt wider von den Klageliedern der Weiber um den Gott. . . . Besonders drängte sich das Volk zu den Weihen, die mit den phrygisch-thrakischen Kulten verbunden waren“ [3], Zeremonien, die unter argen Orgien verliefen. Allmählich mischten sich diese verschiedenen Mysterien zu „jener Theokrasie, die auf die spätere Entwicklung der Religion des Altertums von so unermeßlichem Einfluß gewesen ist [4]“.
[1] Beloch, a. a. O. I. I, S. 263.
[2] Beloch, a. a. O. II. 1, S. 282. 3
[3] Beloch, a. a. O. I. 1, S. 266ft.
[4] ibd. S. 269.
[416]
Hier haben wir eine trübe Mischung der Übersättigung und des verständlichen Weltekels der Oberklasse mit der unbefriedigten Sehnsucht und den rohen Instinkten der immer tiefer sinkenden Unterklasse. Was aber die Psychologie auf die Dauer beherrschte und die Politik bestimmte, war doch das Interesse der Plutokratie. Kaerst sagt von dem hellenischen Landfriedensbunde, der letzten großen politischen Schöpfung Philipps von Makedonien: „Alle gewaltsamen Veränderungen des gegenwärtigen Besitzstandes sollten verhindert oder, wenn sie doch vorkamen, als Verletzung der gemeinsamen Bundesverträge von Bundes wegen bestraft werden. Insbesondere waren alle Unternehmungen, die darauf ausgingen, die bestehende Verfassung eines Staates umzustürzen, alle Versuche, den Verbannten die Rückkehr in ihren Heimatstaat zu erzwingen, öffentliche Einziehung des Privatvermögens, Aufteilung des Grundbesitzes, Befreiung von Sklaven . . . ausgeschlossen und unter Strafe gestellt. Es war also eine Politik, die vor allem den Interessen der Besitzenden diente; Ruhe und Sicherheit gegen umstürzende Neuerungen, gegen gewaltsame Änderungen der Besitzverhältnisse hatten diese vornehmlich begehrt. Jenes Ruhebedürfnis der Besitzenden war ja auch einer der Faktoren gewesen, die dem nordischen Königtum den Weg in das Innere der hellenischen Staatenwelt gebahnt hatte. Eine sozialreformatorische Bedeutung hatte die neue Einigung der Hellenen nicht“ (276).
IV. Der Untergang des Seestaates.
(Die kapitalistische Sklavenwirtschaft.) ↩
Wir erblicken, wie schon gesagt, in den bisher geschilderten Verfassungskämpfen den Kampf des „natürlichen Rechts“ der Gerechtigkeit, d. h. der Gleichheit, gegen die aus primitiver Eroberung stammende Verfassung der Ungleichheit, d. h. der Ungerechtigkeit. Jetzt wird es unsere Aufgabe sein, auch die anderen Fäden, die in das Gewebe dieser tragischen Geschehnisse eingeflossen sind, darzustellen, um das Schicksal aller dieser Staatsbildungen als die logische, unvermeidliche Folge der Grundlage zu erweisen, auf der sie errichtet sind : der Gewalt, des „politischen Mittels“ in seiner krassesten Gestalt, der Sklaverei.
1. Die Sklaverei. ↩
Der Begriff der Sklaverei deckt eine ganze Reihe verschiedener Verhältnisse von Mensch zu Mensch oder Stamm zu Stamm. „Man hat nie alle Abstufungen zwischen der echten Sklaverei des etwa zu einem Menschenopfer oder zum Wiederverkauf erfolgten Handels, der Arbeitsleibeigenschaft, der politischen Unterwerfung mit Tributverpf lich-
[417]
tung, endlich der Abhängigkeit der jagenden Stämme, der Schmiede und anderer unterschieden. Die echte Sklaverei, die die Europäer früher aus praktischen, dann aus idealen Gründen am meisten interessiert hat, ist der letzte Sproß dieser mannichfaltigen Verzweigung“ [1].
Der Mangel dieser Unterscheidung der verschiedenen Formen hat es zum Teil verschuldet, daß die Ansichten über die Verbreitung des Instituts auf den verschiedenen Stufen der Zivilisation voneinander abweichen. Lippert sagte noch, daß die Sklaverei den Rothäuten unbekannt sei [2]. Das ist ganz bestimmt, wie immer man den Begriff auslegen möge, ein Irrtum: denn die Seefischer des Nordwestens, am Vancouversund, haben echte Sklaverei aus dem von uns angeführten Grunde, daß sie die Unfreien als Ruderknechte gut gebrauchen können. Ratzel sagt sogar, daß „bei allen Indianern die Sklaverei üblich war. Aber nur Reiche besaßen Sklaven, vielleicht sogar nur die Edlen. Meist waren es Kriegsgefangene, doch kam es bei den Tschinuk vor, daß Männer ihre Freiheit verspielten. Der Sklave hatte das Haar geschoren, durfte seinen Kindern nicht den Kopf abplatten“ (eine Sitte, die sich häufiger findet ; manche legen sie in dem Sinne aus, daß die Eltern den Kindern die Kopfform einer als besonders edel betrachteten Rasse, einer Eroberer- und Herrenrasse, zu geben wünschen). „Er wurde zu Menschenopfern benutzt und nach dem Tode ins Meer oder den Wald geworfen. Grausame Behandlung war gewöhnlich, die Arbeit nicht erdrückend, und unter Umständen konnte er frei werden. Sklavinnen wurden Weißen als Prostituierte vermietet. . . . Bei eigentlichen Jägervölkern im nordöstlichen Amerika waren Sklaven selten“ [3].
Wir werden kaum fehl gehen, wenn wir sagen, daß dem Jäger die Sklaverei zum Zwecke der wirtschaftlichen Ausnutzung der Knechte im wesentlichen unbekannt ist. Er hält sich Sklaven zu Geschlechtsdiensten, zum Zwecke von Menschenopfern und vielleicht hier und da aus Laune, wie man sich ein Haustier hält. Daß der Knecht oder die Unfreie unter Umständen mehr Arbeit leistet, als ihre Ernährung kostet, ist offenbar noch nicht das Motiv der Versklavung, zumal aus Gründen, die wir oben angegeben haben, der wirkliche, noch reine Jäger, der seine Jagdbeute nicht „kapitalisieren“ kann, sich aus der Sklavenhaltung kaum einen wirtschaftlichen Vorteil herauskalkulieren kann. Die gleichen Motive berichtet Ratzel aus Afrika: „Hat man für Sklaven keine Arbeit, so sind doch Sklavinnen stets begehrt, und ihre Nachkommenschaft bildet eine tiefere Schicht in der Gesellschaft. Man kauft aber auch Sklaven zu Menschenopfern: in Zentralafrika ruft der
[1] Ratzel, Völkerkunde II, S. 38.
[2] A. a. O. II, S. 116.
[3] Ratzel, a. a. O. I, S. 562.
[418]
Tod eines Häuptlings immer eine starke Nachfrage hervor“ [1]. „Als der Vorgänger des heutigen Häuptlings der Mobeka, Makwata, starb, wurden ihm 300 Menschenopfer nachgesandt. Es besteht ein reger Verkehr mit Sklaven, um diesen Bedarf zu decken, und die Dörfer überbieten sich bei besonderen Gelegenheiten in der Stellung von Menschen zum Opfer, das der Häuptling bringt“ [2].
Es ist klar, daß diese Haltung menschlicher Opfertiere aus religiösen Gründen ebensowenig mit dem ökonomischen Institut zu tun hat, das wir als „Sklaverei“ zu bezeichnen pflegen, wie das Halten unfreier Kebsweiber [3]. Wo diese Motive nicht wirken, und zu gleicher Zeit die ökonomischen Gründe für die Einführung nicht bestehen, werden die Kriegsgefangenen entweder zu gleichen Rechten in den Stamm adoptiert, wie wir oben sagten, oder getötet. So verfahren von den Hirten noch die ostafrikanischen Masai, „die von Herden einer bestimmten Größe leben und weder Nahrung noch Arbeit genug für Sklaven haben“ : aber ihre ackerbautreibenden Nachbarn, die Wakamba, die Sklaven gebrauchen können, lassen sie am Leben, und ein drittes Nachbarvolk, die Wanjamwesi, unternehmen Sklavenjagden, um die Gefangenen den Arabern an der Küste auf den Markt zu liefern [4].
Es wird also bei dem bleiben, was wir oben sagten, daß erst der Hirt und der ihm gleichstehende Wiking die echte Sklaverei in ihrem eigentlichen Verstände erfunden haben; erst sie haben sie als das kleinste (politische) Mittel der ökonomischen Bedürfnisbefriedigung erkannt und angewendet, haben den Menschen als verknechteten Arbeitsmotor gebraucht [5].
Schon der Heilige Augustin hat sich über die furchtbaren Schäden der Institution, die ihm als einem Bürger der antiken Welt nicht verborgen bleiben konnten, damit getröstet, daß sie einen wesentlichen Kulturfortschritt darstelle, da sie der wahllosen Niedermetzelung der Gefangenen ein Ende bereitet habe [6]. Ihm ist Auguste Comte gefolgt: „Ohne eine solche Wandlung würde die blinde Kriegsleidenschaft der Vorzeit höchst wahrscheinlich die fast gänzliche Ausrottung unserer
[1] A. a. O. I, S. 115.
[2] A. a. O. II, S. 312.
[3] Auch zu kannibalischen Zwecken werden Sklaven zuweilen gehalten, z. B. in Melanesien.
[4] Ratzel, a. a. O. I, S. 115.
[5] Auch Nieboer kommt zu dem Ergebnis, daß die Sklaverei „von keiner Wirtschaftsstufe ausgeschlossen ist, freilich aber bei den Jägern und Fischern seltener als bei den Ackerbauern, und hier wieder auf primitiveren Stufen seltener als auf höheren ist“. (Vgl. Vierkandts Anzeige in Ztschr. f. Soz.Wiss. 1901 (IV) S. 14/5.)
[6] Vgl. Gumplowicz, Gesch. d. Staatsth. S. 106. Ebenso Sismondi, a. a. O. I, S. 93, 169.
[419]
Gattung herbeigeführt haben“ [1]. Spätere Autoren haben erkannt, daß, wie auch wir oben darlegten, erst die Sklaverei den Menschen an methodische Arbeit in unserem Sinne gewöhnen konnte, und daß alle weiterausgreifende Organisation der Arbeit zuerst auf keiner anderen Grundlage möglich war. Das ist ein Gesichtspunkt, den namentlich Julius Lippert mit großer Liebe herausgearbeitet hat [2] : mit Recht; wir werden bei der Betrachtung des Oasen-, des Bewässerungsstaates erkennen, daß die fast völlige Versklavung der Volksmasse und die ihr entsprechende Vergottung des Pharao im Alten Reiche nur derart erklärt werden kann. John Keils Ingram fügt noch hinzu, daß nur die Sklaverei „dem militärischen Geist den für das Eroberungssystem, welches dessen Bestimmung bildete, nötigen Grad von Stärke und Ausdauer“ geben konnte [3]. Da wir uns die Integration der zerstreuten Horden zu Völkern in der Tat kaum anders geschehend denken können als durch den Krieg und die Unterwerfung, so werden wir vom Standpunkt des Soziologen aus zuzustimmen haben. Dabei ist aber selbstverständlich — und damit treten wir einen Augenblick aus dem Kreise der rein kausalen Erklärung heraus — ausgeschlossen, daß das Institut vom heutigen Standpunkt der Gesellschaft und des wertenden Sozialphilosophen aus irgendeine Rechtfertigung erfahren könnte, wie sie immer wieder von gewissen unaussprechlichen Rassenphilosophen versucht wird, die nicht die Begabung besitzen, um jemals an ihrer eigenen Gottähnlichkeit bange zu werden.
Bevor die „auri sacra fames“ die Menschen in ihren Bann schlägt, ist die Sklaverei — man nennt sie auf dieser Stufe gemeinhin die „patriarchalische“ — ein für die Betroffenen nicht allzu hartes Verhältnis. Wohl sind sie Grausamkeiten ausgesetzt und ihnen gegenüber in der Regel völlig rechtlos: aber eine harte wirtschaftliche Ausbeutung besteht nicht, wie wir ja schon in einem Falle dieser präkapitalistischen Sklaverei, bei gewissen Nordindianern, soeben gehört haben. Über diese Tatsache sind sich die Ethnologen so sehr einig, daß sogar ein Mann von dem unzweifelhaft guten sozialen Wollen eines Ferdinand Toennies der patriarchalischen Form des Instituts das Wort zu reden wagt [4]. Müller-Lyer stellt einige Aussagen bekanntester Fachmänner über den Gegenstand zusammen [5] : Schurtz (afrikanisches Gewerbe, S. 98) sagt, daß die Sklaverei bei den Naturvölkern einen viel freieren
[1] Cours de phil. pos. Leçon 53.
[2] Kulturgesch. II, S. 116.
[3] Geschichte der Sklaverei und der Hörigkeit, S. 3.
[4] Gemeinschaft und Gesellschaft, 3. Aufl., S. 154. Sismondi (a. a. O. I, S. 169) setzt die patriarchalische Sklaverei scharf der „institution épouvantable“ der kapitalistischen entgegen. Ebenso Marquardt (Privatleben der Römer) S. 172, 175.
[5] Phasen der Kultur, S. 296; vgl. Ratzel, Völkerkunde I, S. 426 über Madagaskar.
[420]
und loseren Charakter trägt, als gewöhnlich angenommen wird; Livingstone (Neue Missionsreisen, Dtsch. v. Martin, I S. 293) vergleicht den afrikanischen Sklaven mit dem freien Proletarier Europas und zieht das Los des ersten weit vor: „Der afrikanische Herr verlangt weder die Pünktlichkeit, Gründlichkeit und Schnelligkeit noch so viel Anstrengung wie der europäische. In Europa ist man verlegen wegen des Mangels an Zeit, in Afrika weiß man nicht, was man mit ihr anfangen soll“. Ähnliches berichtet Forster in seiner Reise um die Welt über das Verhältnis der ozeanischen Herrenklasse zu ihren Knechten. Die jüdisch-israelitische Sklavengesetzgebung und -behandlung ist als vorbildlich human anerkannt: von ihr und aus dem Urchristentum übernahm der Islam die Institution und ihre menschliche Gestaltung. Im Koran heißt es: „Wünscht einer deiner Sklaven eine Freilassungsurkunde, so stelle sie ihm aus, wenn du ihn als gut kennst, und gib ihm einen Teil deines Reichtums, den Gott dir verliehen. Zwinge deine weiblichen Sklaven nicht zum Sündigen, falls sie ihre Tugend bewahren wollen; zwingst du sie aber, so wird Gott ihnen erbarmungsvoll vergeben“ [1]. Sogar in Hellas und Rom hatten die Haussklaven, im Gegensatz zu den Fabrik- und Feldsklaven, eine verhältnismäßig gute Behandlung und ziemlich viele Narrenfreiheit, wie wir aus den Figuren der Komödie erschließen können; und das gleiche gilt von den Haussklaven der südstaatlichen Pflanzer, die oft mit rührender Liebe und Treue an ihren Herren hingen und entsprechend von ihnen behandelt wurden.
Das ändert sich schmerzlich von dem Augenblicke an, wo der Sklave zum ausgesprochenen kapitalistischen „Produktionsmittel“ geworden ist. Erst dann wird er völlig zur „Sache“, wird er völlig des letzten Restes seiner Menschenwürde beraubt, schwindet dem Besitzer ihm gegenüber jedes Gefühl der Pflicht und jedes Bewußtsein vom Rechte des Unfreien [2].
Den psychologischen Übergang von der patriarchalischen zur kapitalistischen Sklavenwirtschaft zeigt sehr hübsch Schurtz: „Ein Häuptling aus Nyangwe am oberen Kongo entwickelte Cameron gegenüber seine Ansicht, daß es vernünftiger wäre, seinen Handelsgewinn in Sklaven als in Schmuckgeld anzulegen, in naiver aber treffender Weise. Wenn er eine Menge Kaurimuscheln nach Hause brächte, erklärte der vorsichtige Mann, so würden seine Frauen sie nehmen und sich damit schmücken, er aber hätte nichts; Sklaven dagegen wären sofort zu gebrauchen und blieben nicht müßig liegen“ [3].
Mit dieser Wandlung ins Kapitalistische nehmen Sklavenjagd
[1] Zit. nach Ingram, a. a. O. S. 150.
[2] „Dann wird den barbarischen Greueln der Sklaverei . . . der zivilisierte Greuel der Überarbeit aufgepfropft“ (Marx, Kapital I, S. 196/7).
[3] Entwicklungsgesch. d. Geldes, S. 24, zit. uaeh Müller-Lyer, Phasen der Kultur, S. 291.
[421]
und Sklavenhandel, die vorher nur embryonal vorhanden waren — denn der normale Sklave ist ein Kriegsgefangener, wie aus den Worten Mancipium, Heilot, Slave bereits hervorgeht — den Charakter regelrechter Gewerbe an und erreichen ungeheure Ausmaße. Beide sind aber an sich schon schwere Sozialkrankheiten, die jedes Volk verpesten und verderben, das sie unter sich duldet. Ratzel sagt ausdrücklich von den Afrikanern, daß „nichts Gewalttätigkeit und Grausamkeit so unter ihnen angefacht hat“ [1] wie diese furchtbare Zwillingsfrucht des politischen Mittels. Sie hat ganze Erdteile entvölkert, unendliches Unglück über unschuldige friedliche Menschen gebracht und seine Nutznießer tief demoralisiert. In der Neuzeit wurden in den letzten zwanzig Jahren des siebzehnten Jahrh. 300 000 Sklaven allein von den Engländern aus Afrika exportiert, und in den folgenden achtzig Jahren erreichte der Import bloß nach Jamaika die ungeheure Ziffer von über 600000 Menschen [2].
Ähnliche Ausmaße erreichten die beiden fluchwürdigen Gewerbe in der Antike, und zwar vor allem in Rom, wo sie „einen Aufschwung genommen hatten, deren gleichen man im Mittelmeergebiet noch nicht gekannt hatte, und welcher mit dem Aufblühen der Piraterie aufs engste zusammenhing. Galt er auch nicht gerade für anständig, so legten doch ehrenwerte Leute wie der alte Cato ihr Geld in dem Ankauf, der Abrichtung und dem Verkauf derselben an“ [3].
Auch wirtschaftlich und technisch ist die Sklaverei ein schwerer Schaden. Es ist ein alter Satz der Ökonomik, daß die Arbeit der Unfreien weniger produktiv ist als die der Freien. Das erklärt freilich Beloch für „abolitionistisches Geschwätz“ [4]. Aber er bringt für seine Meinung nicht Tatsachen bei, sondern nur Erwägungen: „Mit Hunger und Peitsche läßt sich eine größere Arbeitsleistung erreichen, als mit dem Hunger allein. Ein gut eingeschultes unfreies Fabrikpersonal leistete ohne Zweifel besseres als in Tagelohn genommene Handwerker, die jeden Augenblick die Arbeit niederlegen konnten, an den zahlreichen Festen feierten und, in Athen, an den Tagen der Volksversammlungen lieber auf die Pnyx gingen als in die Fabrik“ [5]. Aus diesen Erwägungen dürfte er allenfalls den Schluß ziehen, daß in den antiken Demokratien, wo der sehr „verbummelte“ freie Arbeiter für seinen Dienst als Bürger
[1] Völkerkunde I, S. 123.
[2] Kidd, Soziale Evolution, S. 278.
[3] Kulischer, Zur Entw.Gesch. d. Geldzinses (Conrads Jahrb. III, 18, S. 352). Nach Marquardt (a. a. O. S. 172) gestattete Cato der Ältere seinen Sklaven den Beischlaf nur gegen eine Geldabgabe! „Non olet“.
[4] Griech. Gesch. III. 1, S. 321.
[5] In Athen wurde regelmäßig alle neun Tage eine ordentliche Volksversammlung abgehalten, dazu noch die vielen außerordentlichen (Röscher, Politik S. 348).
[422]
ebensoviel Geld erhielt wie für seines Tages Arbeit, die allgemeine These von der Minderwertigkeit der unfreien Arbeit keine Geltung habe. Aber er verwirft jene allgemeine These als solche, im Grundsätzlichen. Und dann fährt er fort: „Vor allem, die Sklavenarbeit war billiger“. Das ist richtig: sie war billiger, trotzdem sie unproduktiver war; hier hat er eine Verwirrung begangen, die auch bei Fachökonomisten leider nicht selten ist, nämlich zwischen den Kategorien der Produktivität und der Rentabilität [1].
Trotz Beloch: an der Wahrheit jenes alten Lehrsatzes ist nicht zu zweifeln. Schon Montesquieu hat berichtet, daß die ungarischen Bergwerke, obgleich an sich nicht ergiebiger, dennoch stets mit geringeren Kosten und deshalb größerem Gewinne ausgebeutet wurden als die benachbarten türkischen. Letztere wurden durch Sklaven bearbeitet, und deren Arme waren die einzigen Maschinen, während die ungarischen von Freien bearbeitet wurden, die sich vieler arbeitsparender Maschinen bedienten [2]. Niemals hat man den unwilligen Händen der Sklaven unter der Vogtspeitsche feinere Werkzeuge anvertrauen dürfen : sie zerbrachen darin ; das ist neben der Billigkeit der Sklaven die Lösung des Rätsels, warum das Altertum keine Maschinen besaß; trotzdem die physikalischen Vorbedingungen und Kenntnisse dazu gegeben waren [3]. Smith selbst beruft sich auf „die Erfahrung bei allen Zeiten und Völkern“ dafür, daß die Arbeit des freien Mannes schließlich billiger zu stehen kommt als die des Sklaven „selbst in Boston, New York und Philadelphia, trotzdem der gewöhnliche Arbeitslohn dort so sehr hoch ist“ [4]. Freilich verwirft er die gewöhnliche Erklärung, daß der Herr zwar die Abnützung des Sklaven zu tragen habe, aber nicht die des freien Arbeiters, denn dessen Lohn schließe notwendiger weise ebenfalls die Amortisationsquote ein. Der Unterschied bestehe nur darin, daß der Sklave viel schneller abgenützt werde, weil sein Lebensfonds von seinem Herrn achtlos verwaltet werde, von dem freien Arbeiter aber in eigener Person sorgsam, so daß die Quote geringer sei. Smith hat hier nicht genügend an die Tatsache gedacht, die die antike wie die moderne Sklaverei in ihrem langen Bestände und ihrer wirtschaftlichen Bedeutung allein erklären kann: an die ungeheure Billigkeit des Menschenviehs in den Zeiten der Blüte der Institution, also in der Antike und der neuzeitlichen Plantagenwirtschaft: eine Preis-
[1] Vgl. S. S. III, S. 1047, 1074ff.
[2] Nach Adam Smith, Völkerwohlstand, übersetzt von Loewenthal, II, S. 198.
[3] Strabo erzählt, daß in Kleinasien schon zur Zeit des Mithridates Wassermühlen in Gebrauch waren, daß man aber trotzdem im Römerreiche fortfuhr, die quälende und verhaßte Arbeit durch Sklaven mittels der Handmühle ausführen zu lassen (Müller-Lyer, Phasen der Kultur, S. 93). [4] Ad. Smith, a. a. O. I, S. 86/7.
[423]
gestaltung, die nur so lange bestehen kann, wie immer neue Bezirke durch Sklavenjagden geleert werden können. Je geringer der Preis des Sklaven, um so geringer auch die Amortisationsquote, um so billiger die Arbeit! Nicht, weil sie produktiver war, zog der Unternehmer der Sklavenwirtschaft die unfreie Arbeit vor, sondern weil sie rentabler war: sie gleicht in dieser Beziehung der Gefängnis- und Klosterarbeit der Gegenwart, die auch nur aus diesem Grunde der freien Arbeit erfolgreiche Konkurrenz machen kann [1].
Wenn die Sklavenjagden besonders ergiebig, und die „Ware“ besonders billig war, war die Amortisationsquote auch noch aus dem anderen Grunde besonders niedrig, weil man unter solchen Umständen nach einer Vorschrift der landwirtschaftlichen Betriebslehre, die von dem Karthager Mago zuerst entwickelt und dann von Varrò und Columella, den römischen Autoritäten, übernommen wurde, den Sklaven in der gräßlichsten Bedeutung des Wortes so schnell wie möglich „amortisierte“, d. h. bei härtester Arbeit und schmälster Kost zuschanden schuftete. Man bedenke, was alle Humanität und alle Tierschutzvereine heute nützen würden, wenn ein Arbeitspferd für wenige Mark auf dem Markte zu kaufen wäre [2]?!
Das aber war in der Antike nicht selten die Konjunktur auf den großen Sklavenmärkten, wenn besonders erfolgreiche Kriege (und das heißt von einer bestimmten Zeit an: Sklavenjagden) stattgefunden hatten [3]. Auf dem Sklavenmarkt bei Hebron sollen die im jüdischen Kriege unter Hadrian gefangenen Juden so billig verkauft worden sein, daß vier Juden für einen Modius Gerste feil waren. Im Pontus, dem „Hauptproduktionsgebiet“ dieser Ware, kostete ein Sklave zu Lukulls Zeiten vier Drachmen [4]. Das waren selbstverständlich nur „Überproduktionspreise“ von extremer Billigkeit [5].
Das also allein ist der Grund, warum in der Antike der mit Sklaven wirtschaftende Kapitalist überall fast das freie Handwerk nieder-
[1] Als in der Kaiserzeit die Sklaven seltener und teurer wurden, stellte man in der Großlandwirtschaft viele Freie ein, weil sie mehr leisteten (Neurath, a.a.O. S.91).
[2] Vgl. Marx, Kapital I, S. 229. Bücher, Aufstände der unfreien Arbeiter, S. 42. Röscher sagt (Grundl. d.Nat.Ök. I, § 72): „Ob der Eigennutz der Herren zu milder Behandlung der Sklaven führt, ist wesentlich dadurch bestimmt, zu welchen Kosten man frische Sklaven erhalten kann.“
[3] Mommsen (I, S. 666) sagt vom Bojerkriege (193), nach der Schlacht von Mutina sei der Kampf kein Krieg mehr gewesen, sondern eine Sklavenhetze. Nach Beendigung des dritten makedonischen Krieges habe Paullus 150000 Epeiroten in die Sklaverei verkauft (I, 774).
[4] Kulischer, a. a. O. S. 352.
[5] Normale Preise und Rentabilitätsberechnung bei Beloch, a. a.O. II, S. 96/7, III S. 319f.
[424]
konkurrieren konnte [1], und nicht die überlegene Produktivität der Sklavenarbeit: das geht auch schon daraus hervor, daß viele Sklavenbesitzer ihre Sklaven gegen Kopfgeld für den freien Markt arbeiten ließen, um ihr Eigeninteresse anzustacheln [2]. Aus dem gleichen Grunde wurde ihnen nach Plinius oft die Testierfreiheit verliehen. Weber, der diese Dinge anführt, sagt ausdrücklich, daß sich nur bei ganz barbarischer Disziplin das Maß von Arbeit herauspressen ließ, das heute ein freier Arbeiter unter dem Akkordsystem spielend leistet. Er weist auf die von Tugan-Baranowski festgestellte Tatsache hin, daß russische Leibeigenenbetriebe sich nur so lange gegen die Konkurrenz freier Arbeit halten konnten, wie sie das Monopol ihres Marktes besaßen [3]. Er hätte auch auf die Erfahrungen mit der deutschen Leibeigenschaft verweisen können, die hauptsächlich aus dem Grunde fiel, weil die Grundbesitzer an der Unergiebigkeit der unfreien Arbeit weithin zugrunde gegangen waren, und einzelne Versuche gelehrt hatten, daß freie Mietsarbeiter das Vielfache leisteten und die Rentabilität wiederherstellten.
Die Bedingung dieser Billigkeit der Sklavenarbeit ist aber wieder, „daß Sklavenjagden stattfinden entweder im Krieg oder durch periodische Ausbeutung eines großen Sklavenjagdgebietes wie Afrika für den Negerhandel“ [4].
Und der letzte Beweis für diese unsere These ist, daß die Sklaverei sofort unwirtschaftlich wurde und aufgegeben werden mußte, sobald und wo diese Sklavenjagden nicht mehr stattfinden konnten oder durften oder ihre Ergiebigkeit verloren. Das ist einer der Gründe, weshalb die neuen keltogermanischen Staaten Europas dieser Pest entrannen:
Die Meinung ist weit verbreitet, daß das Christentum der Hebel der Abschaffung der Sklaverei gewesen ist. Das ist ein Irrtum [5]. Geistig überwunden hat das Institut schon die vorchristliche Philosophie des „weiten Raums“, vor allem der Stoizismus. Schon vorher hatte der Sophist Alkidamas, dessen Wirksamkeit in die erste Hälfte des vierten
[1] Beloch, Griech. Gesch. II. i, S. 99; III, S. 322, 347. Kaerst, a.a. O. S. 121 Rob. Weiß, a. a. O. S. 13, (für Palästina).
[2] „Aussi bien que les économistes modernes, les propriétaires d'esclaves .... savaient que l'esclave est une propriété chanceuse, de difficile exploitation, et que le meilleur parti à en tirer est de le constituer, en quelque sorte, fermier de sa propre personne. Dès le temps d'Auguste, cette pratique s'était multipliée au point qu'il crût nécessaire de retenir le torrent des émancipations“ (Proudhon, „De la justice“, Oeuvres, XXII. S. 296).
[3] Wirtsch.Gesch. S. 122.
[4] M. Weber, a. a. O. S. 82/3.
[5] Vgl. Barth, Soziologie als Phil. d. Gesch. S. 477/8. Jul. Wolf, Sozialismus usw., S. 28/9.
[425]
Jahrhunderts fällt, die Lehre verkündet: „Die Gottheit hat alle frei gelassen, die Natur keinen zum Sklaven gemacht“ [1]. Es war die Stoa, die die Agitation führte und durch die ihr nahestehenden Juristen die nötigen Milderungen durchsetzte, allerdings hierbei gefördert durch den Wegfall der Bedingungen, von denen wir soeben die Sklavenwirtschaft als durchaus abhängig erkannt haben. „Die Juristen dieser Periode sind in der Lehre von der natürlichen Gleichheit der Menschen einig“. Dig. 1. 5,4, § 1 heißt es: Servitus est constitutio juris gentium, qua quis dominio alieno contra naturam subjicitur [2].
Die Stoa hat drei Jahrhunderte hindurch an dem Problem praktisch gearbeitet, ehe die Kirche sich darum kümmerte. Ihr Reich war nicht von dieser Welt, alle sozialen Einrichtungen waren ihr gleichgültig. „Erst als sie zur Macht gelangt war, nahm sie die Tendenzen auf, die die Stoa so lange verfolgt hatte“ [3]. Ursprünglich forderte sie von dem Herrn nur humane Behandlung des Sklaven, der ja auch Gottes Kind war [4]. Noch Tertullian scheut sich nicht, wie Wolf (a. a. O.) mitteilt, „gerade aus der dem Herrn mit den Sklaven gemeinsamen Gotteskindschaft die Verwerflichkeit aller auf Befreiung der Sklaven zielenden Bewegungen abzuleiten. Er sieht in der Sklavenbefreiung eine Art von unbefugter Konkurrenz, von seltsamem Eingriff in die Rechte des himmlischen Herrn, der den Sklaven, nämlich den christlichen, längst die Freiheit beschert hat: wie kommt die Welt
[1] Kaerst, S. 84. Es ist also ein Irrtum, wenn Ingram (a. a. O. S. 42) den Ratgeber Trajans, Dio Chrysostomus, als den ersten griechischen Schriftsteller bezeichnet, der diesen Gedanken vorgetragen habe. „Le peu que contiennent les Evangiles et les Pères de la primitive Eglise sur le sujet de l'esclavage se trouve avec plus d'ampleur, de philosophie, avec un sentiment plus profond de la Justice, dans les lettres de Sénèque, par exemple“ (Proudhon, a. a. O. S. 296).
[2] Marquardt, a. a. O. S. 186.
[3] Barth, a.a.O. S. 477/8. Vgl- auch Wolf, a.a.O. S. 28/9 über Epiktet, der selbst ein freigelassener Sklave war. Ferner Ingram, a.a.O. S. 43 über Ulpian und Florentinus als Gegner der Sklaverei. Ferner vgl. über andere Vorläufer der Stoa Beloch II. 1, S. 246 (Hippias der Eleier) und III. 1, S.388 über Antisthenes. Röscher (Politik, S. 88) teilt mit, daß im Gebiet des Mönchtums die Sklaverei tatsächlich schon früh aufgehoben war : daher so viele Sklaven ins Kloster desertierten, was dann auch von den Kaisern, ja auch von den Bischöfen verboten werden mußte. In der Neuzeit liegt es ähnlich: „In Nordamerika wurden die Neger fast nur in den katholischen Kirchen ordentlich zugelassen. Der protestantische Geistliche, von den Weißen gewählt, mußte deren Vorurteile berücksichtigen; der katholische, vom Bischof ernannt, brauchte das nicht. In Südafrika sind die Eingeborenen lange Zeit gegen die Gewalttätigkeit der Boers nur durch die Missionare geschützt worden (ib. S. 170).
[4] „La religion ne discutera pas l'esclavage; elle l'accepte comme divin, ou, ce qui revient au même, comme d'institution naturelle, fatale . . . Seulement elle dira au maître de l'esclave ... : tu ne le maltraiteras point, tu ne le tueras pas sans motif, et tu le laisseras reposer un jour par semaine.“ (Proudhon, a. a. O. S. 306.)
[426]
doch dazu, einen Freien befreien zu wollen! Der Sklave sei also zufrieden, Christ zu sein [1].“
So ist denn auch in der christlichen Welt die Sklaverei niemals ganz ausgestorben. Aus Briefen des Papstes Gregor I. ist ersichtlich, daß schon im 6. Jahrhundert in Rom und Neapel öffentliche Sklavenmärkte abgehalten wurden [2]. Im 14. Jahrhundert nach der Zehntung der Bevölkerung durch den Schwarzen Tod, die überall einen großen Mangel an Arbeitern und starke Lohnsteigerung brachte, ist dieser Handel noch einmal gewaltig aufgeblüht. „Diese Sklaven und Sklavinnen kamen besonders von den Ufern des Schwarzen Meeres, . . . Genua besaß ein Kontor in Tanais, . . . wohin die gefangenen Cirkassierinnen, Georgierinnen, Armenierinnen, Russinnen und Tatarinnen, denn um solche handelte es sich meistens, zum Verkauf gebracht wurden. . . . Venedig hatte eine Steuer von fünf Dukaten auf jeden eingeführten Sklaven gelegt und zog aus dieser Quelle von 1414 bis 1423 eine jährliche Einnahme von 50000 Dukaten; es wurden also damals allein über Venedig jährlich 10000 Sklaven nach Italien eingeführt" [3]. Wir wissen ja auch aus unseren geistesgeschichtlichen Betrachtungen, daß fast alle Naturrechtler —, auch Morus, das Institut inbezug auf Kriegsgefangene und Verbrecher als gerechtfertigt ansahen [4].
Es handelt sich jedoch offenbar hier im wesentlichen um eine vorkapitalistische Sklaverei: um die Gewinnung von Hausangestellten und Haremsdirnen. Im „Dekamerone" des Boccaccio wird ein Zuhälter erwähnt, der eine ihm gehörige Sklavin vermietet. Für die kapitalistische Sklavenwirtschaft war im mittelalterlichen Europa kein Raum, und zwar hauptsächlich aus dem von uns betonten Grunde, weil es keine ergiebigen Sklaven Jagdgebiete mehr gab, bis Afrika als solches entdeckt wurde. Der Preis der Unfreien stieg, um so mehr, als der Bedarf nach ihnen bei den occidentalen Grundherrn mit der Ausdehnung der Neurodungen fortwährend wuchs. Darum mußte man sie pfleglich behandeln, zumal dieHerren, wie Max Weber betont [5], nicht Landwirte, sondern Krieger waren, die sich auf die geschäftliche Aufsicht und Ausbeutung nicht so gut verstanden. So stiegen die Unfreien vom 8. Jahrhundert an empor und trafen sich auf halbem Wege mit den
[1] Vgl. Neurath, a.a.O. S. 96 (Paulus an Titus II, 9). Von den christlichen Sekten, die die Sklaverei verwarfen, scheint die der Karpokratianer (Epiphanes) die erste gewesen zu sein. Sie ruhte auf stoischer Grundlage und war gnostisch und kommunistisch (Adler, Gesch. d. Sozialismus I, S. 77ff.).
[2] B. Schipper, a. a. O. S. 15.
[3] Karl Schneider, Der Sklavenhandel im mittelalterlichen Italien, Ztschr. f. Soz,- Wiss. X (1907), S. 236.
[4] Der erste Engländer, der die Sklaverei öffentlich angriff, war der Quäker Fox (Gooch, a. a. O. S. 153).
[5] Wirtsch.Gesch., S. 72.
[427]
heruntersteigenden kleinen Vollfreien, mit denen sie zu der Klasse der Grundholden verschmolzen. Dazu kommt, daß der Sklave im kalten Norden ganz andere Kosten für Unterkunft, Bekleidung und Ernährung erfordert als im Süden [1].
Die beiden Hindernisse waren nach Eröffnung des afrikanischen Sklavenhandels für die südstaatlichen Baumwollgebiete und die Zuckerplantagen der Antillen usw. nicht mehr vorhanden, und so entstand denn hier auch die Sklavenwirtschaft sofort wieder, trotz des frömmsten Christentums der Spanier, Portugiesen und Engländer. „Man kann schätzen, daß in den europäischen Sklavengebieten zu Anfang des 19. Jahrhunderts etwa 7 Millionen Sklaven lebten. Von 1807—1848 sind aus Afrika weitere 5 Millionen Sklaven importiert worden“ [2].
Dazu kamen in den Anfängen noch die zahlreichen weißen Sklaven : der in den Heimatländern gepreßte oder freiwillig zu Kontraktarbeit eingeströmte „Abschaum“ [3]. 1815 verbot der Wiener Kongreß den Sklavenhandel. England hatte nach dem Verlust der nordamerikanischen Kolonien kein so großes Interesse mehr daran, benützte aber das Verbot, um allen fremden Handel mit Sklaven zu unterdrücken und sich selbst an dem gewaltigsten Schmuggel zu bereichern. Die soeben erwähnten, noch nach dem Wiener Kongreß eingeführten fast 5 Millionen Sklaven wurden unter faktischer Duldung der englischen Regierung aus Afrika nach Amerika gebracht. Erst unter dem demokratisch-bürgerlichen Einfluß, der nach der Parlamentsreform von 1833 zur Herrschaft kam, ist der Handel wirklich unterdrückt worden [4]. Aber starke Reste der Sklaverei bestehen bekanntlich noch heute in den Südstaaten fort: unter dem Deckmantel der Gefangenenarbeit.
Dieses Institut hat sich überall dort, wo es zur Herrschaft kam, als eine verheerende Pest erwiesen. Sismondi nennt es „le chancre rongeur de l'antiquité“ und schiebt ihm die Schuld an Roms Untergange zu [5]. Das gleiche spricht Bücher für Hellas und Rom aus [6]; und Mommsen zieht das Schlußergebnis für alle Großmächte der Mittelmeerkultur mit den folgenden erschütternden Worten: „Überall, wo das Kapitalistenregiment im Sklavenstaat sich vollständig entwickelt, hat es Gottes schöne Welt in gleicher Weise verwüstet. Wie die Ströme in verschiedenen Farben spiegeln, die Kloake aber überall sich gleich sieht, so gleicht auch das Italien der ciceronianischen Epoche wesentlich dem HelLs des Polybios und bestimmter noch dem Karthago der
[1] Wirtsch.Gesch., S. 123—125.
[2] Wirtsch.Gesch., S. 257.
[3] S. S. III, S. 545.
[4] S. S. I, S. 975. Max Weber, a. a. O. S. 259.
[5] Etudes sur l'Economie politique I, S. 94.
[6] Aufstände der unfreien Arbeiter, S. 94.
[428]
hannibalischen Zeit, wo in ganz ähnlicher Weise das allmächtig regierende Kapital den Mittelstand zugrunde gerichtet, den Handel und die Gutswirtschaft zur höchsten Blüte gesteigert, und schließlich eine gleißend übertünchte sittliche und politische Verwesung der Nation herbeigeführt hatte“ [1].
Und kaum weniger vernichtend hat das gleiche Regiment in der kapitalistischen Sklavenwirtschaft der Neuzeit gewirkt, wenn auch, namentlich in den nordamerikanischen Südstaaten, die sehr verschiedene geographische und politische Lagerung der betroffenen Staaten die vollkommene Vernichtung verhinderte. Aber auf den Inseln trat der Völkertod mit grauenhafter Schnelligkeit ein. Die rote Rasse der Antillen verging unter dem furchtbaren Frondienst der „Mita“, und die nach ihrem Hinsterben eingeführte Neger Sklaverei war trotz der größeren Zähigkeit des „human chattel“ kaum besser. Max Weber berichtet [2], daß die Negersterblichkeit noch im 19. Jahrhundert (wo die Höhe der Preise schon eine pfleglichere Behandlung nahelegte) nicht weniger als 25% betrug, „vorher ein Mehrfaches davon“. Um nur ein einziges Beispiel anzuführen, so erklärte Dr. R. R. Madden noch 1840, „auf Cuba sei die Sklaverei lebensvernichtender, gesellschaftsgefährlicher, gesundheitsschädlicher, glückzerstörender, für den Herrn erniedrigender und für die Sklaven entwürdigender als sonstwo auf der bewohnten Erde“ [3].
Schon die Übereinstimmung der Zeugnisse beweist, daß es sich hier nicht um „abolitionistisches Geschwätz“ handeln kann. Sondern es handelt sich in der Tat um einen ungeheuren, nach strengen Gesetzen ablaufenden sozialen Krankheitsprozeß, der sich, wie es klinisch geboten ist, Symptom für Symptom aus der Einen causa morbi ableiten läßt, — bis zu dem Tode der befallenen Volkheit durch Völkerschwund in vernichtender „Kachexie“.
[1] Röm. Gesch. III, S. 532.
[2] Wirtschaftsgesch. S. 257. Vgl. Sombart, Der mod. Kapitalismus, 1. Aufl., S. 348. „Bekannt ist vor allem das rasche Verlöschen der roten Rasse unter dem Drucke der europäischen Herrschaft, ein Verlöschen, wie Peschel treffend bemerkt, welches dem Verdrängen von Tiergeschlechtern in der geologischen Zeit ziemlich nahe kommt'. Als die Spanier auf die Bahamainseln kamen, fanden sie sie dicht bevölkert. Als 1629 die Engländer sich auf Neu-Providence niederließen, waren keine Eingeborenen mehr vorhanden. 1503 siedelten die ersten Spanier sich auf Jamaika an, und schon 1558 waren sämtliche Indianer verschwunden. Espanola hatte 1508 (bei der Eroberung) 60000 Ureinwohner, 1548 nur noch 500. Auf Kuba war 1548 die einheimische Bevölkerung bereits erloschen. Peru hatte 1575 (also fast schon ein halbes Jahrhundert nach der Eroberung) immer noch ca. 1500000 Einwohner; 1793 nur mehr 600000. Ebenso ist in Mexiko die Bevölkerung zusammengeschmolzen.“ Vgl. ferner John Keils Ingram, Gesch. d. Sklaverei u. d. Hörigkeit S. 105 Anm.: „Wie Robertson mitteilt, verminderten die Spanier in den auf die Entdeckung Westindiens folgenden fünfzehn Jahren die Zahl der Eingeborenen Hispaniolas von einer Million auf sechzigtausend!“
[3] Nach Ingram, a. a. O. S. 143.
[429]
2. Der antike Kapitalismus. ↩
Wir haben die Geld- und Gewerbswirtschaft im Abschnitt von der Umwälzung der Wirtschaft und der Verfassung insoferne betrachtet, wie sich die Auswirkungen des ökonomischen Mittels, d. h. des Rechts der Gleichheit, der Gerechtigkeit, aus dem geschichtlichen Gewebe heraussondern ließen. Es ist jetzt unsere Aufgabe, die Auswirkungen des politischen Mittels, d. h. der Klassenscheidung und Klassenordnung, kurz: des Staates, in das Bild einzutragen.
Wir gehen bis zu dem Augenblick zurück, wo das alte Geschlechtskönigtum dem Adel erliegt. Schon das bedeutete einen ersten Sieg des politischen Mittels: denn das Königtum steht notwendigerweise überall und immer mit den von der plutokratischen Übermacht bedrohten Kleinen im Bündnis. Sie wurden durch die oligarchische Revolution dieses Bundesgenossen beraubt, und das war, wie gesagt, wahrscheinlich der Hauptzweck der Umwälzung. Mommsen sagt wenigstens von Rom: „Das Königsregiment hatte wahrscheinlich der Kapitalmacht prinzipiell keinen Vorschub getan und die Vermehrung der Bauernstellen nach Kräften gefördert; die neue Adelsregierung dagegen scheint von vornherein auf die Zerstörung der Mittelklassen, namentlich des mittleren und kleinen Grundbesitzes, und auf die Entwicklung einerseits einer Herrschaft der Grund- und Geldherren, andererseits eines ackerbauenden Proletariats ausgegangen zu sein“ [1].
a) Die Patrizier.
Mit dem Vordringen der Geldwirtschaft „verstaatlichen“ die Patrizier immer mehr. Auch die großen Grundbesitzer wohnen jetzt der Regel nach in der Stadt, beteiligen sich immer mehr an den Geld-, Handels- und Kreditgeschäften. Durch diesen „Absenteeismus“ verschlimmern sich die Dinge auf dem Lande, dem die geistigen Führer und die großen Konsumenten verloren gehen, während die Kaufkraft der reichen Herren der Hauptstadt zugute kommt, die Geld- und Kreditwirtschaft stärkt und ihren Wirkungsbereich auf immer weitere Landkreise hinaus erstreckt.
Die Folge ist eine scharfe Differenzierung innerhalb des Patriziats. Ein Teil wird immer reicher und mächtiger: es sind das die Familien, die durch mehrere Generationen hindurch die Weisheit hatten, immer nur einen Erben aufzuziehen und ihn mit Erbtöchtern zu verheiraten. Ferner sind es diejenigen Familien, deren Grundbesitz der schnell wachsenden Stadt nahe liegt: ihnen wächst schon bei Feldwirtschaft und noch viel mehr dann, wenn ihr Besitz in die städtische Bebauung
[1] Röm. Gesch. I, S. 265. Vgl. oben S. 406.
[430]
einbezogen werden muß, eine stattliche und immer wachsende „Differentialgrundrente“ zu. Andere vermehren ihren Besitz durch kluge Wirtschaft, durch Beteiligung an Seeraub und Handelsspekulationen, durch hochverzinsliche Kredite, durch Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. Ihr Reichtum prädestiniert sie zu den Beamten- und Generalstellen, und ihr größerer Anteil an der Beute läßt ihr Vermögen noch weiter anwachsen.
Auf der anderen Seite verarmen andere patrizische Familien durch Zersplitterung der Erbgüter bei zahlreicher Nachkommenschaft, durch Verschwendung, durch unglückliche Spekulationen und Expeditionen, durch kriegerische Verheerung ihrer weiter außen an den Grenzen gelegenen Erbgüter. Sie fallen in Verschuldung, in formelle oder doch faktische Abhängigkeit von ihren Standesgenossen oder gar von reichen Plebejern. Wie sehr das die plutokratische Macht stärken mußte, liegt auf der Hand: „Die nominellen Grundeigentümer waren gleichsam die Bittbesitzer ihrer Gläubiger, die Schuldner entweder ihren Gläubigern knechtisch Untertan, so daß die Geringeren von ihnen gleich den Freigelassenen in dem Gefolge derselben erschienen, die vornehmeren selbst im Senat nach dem Wink ihres Schuldherrn sprachen und stimmten“ [1]. Lag schon hierin eine furchtbare politische Gefahr, so entstand andererseits aus diesen verarmten Junkern, die ihre Klasse schon verloren hatten oder zu verlieren fürchten mußten, ein gefährliches Heer von „Malkontenten“, die entweder, wie Theognis, der durch verunglückte Spekulationen verarmte Patrizier, den Klassenkampf als agrarisch-reaktionäre Desperados bis zur Weißglut erhitzten, — oder (so fährt Mommsen an der oben zitierten Stelle fort) „im Begriff waren, dem Eigentum selbst den Krieg zu erklären und ihre Gläubiger entweder durch Drohungen zu terrorisieren oder gar sich ihrer durch Komplott und Bürgerkrieg zu entledigen. Auf diesen Verhältnissen ruhte die Macht des Crassus; aus ihnen entsprangen die Aufläufe, deren Signal das „freie Folium“ war, des Cinna, und bestimmter noch des Catilina, des Caelius, des Dolabella, vollkommen gleichartig jenen Schlachten zwischen Besitzenden und Nichtbesitzenden, die ein Jahrhundert zuvor die hellenische Welt bewegten“ [2]. Hier ist die Parallele mit der griechischen Entwicklung bereits gezogen; es genügt, als Parallele zu Catilina unter den unzähligen Putschisten Griechenlands Kinadon zu nennen.
Diese Zersetzung des Adels in eine immer kleinere plutokratische Oberschicht und ein immer wachsendes verarmtes hungriges Junkertum ist ein erster typischer Zug der Entwicklung, die wir zu schildern
[1] In Venedig lebte der verarmte große Haufe der Adligen gutenteils vom Stimmenhandel“ (Röscher, Politik, S. 149).
[2] Röm. Gesch. III, S. 527.
[431]
haben. Sie fand sich überall in der kapitalistischen Sklavenwirtschaft : in Karthago [1], in Etrurien [2], sogar in den auf Sklavenwirtschaft beruhenden Burenrepubliken Südafrikas [3]. Bruno Hildebrand kam zu folgendem Schlüsse: „Aus der ganzen Agrargeschichte des klassischen Altertums ergibt sich die inhaltsschwere Tatsache, daß ... in allen Staaten . . . die größere Unabhängigkeit der Grundbesitzer von der Staatsgewalt nach und nach zur Zentralisierung und Monopolisierung des Grundeigentums geführt hat, und die alte Welt endlich mit und an dieser Monopolisierung zugrunde gegangen ist“ [4].
Am krassesten war diese Differenzierung der Oberklasse in denjenigen Bezirken, in denen die eindringende Geldwirtschaft fast ausschließlich die Nutznießer des politischen Mittels förderte, ohne daß das ökonomische Mittel in Gestalt der Gewerbe stark mildernd gegengewirkt hätte. So z. B. in Palästina, und vor allem in Sparta. Schon um 400 „war etwa die Hälfte der Bürgerschaft so verarmt, daß sie ihre Beiträge zu den gemeinschaftlichen Mahlzeiten nicht mehr zu leisten vermochte und infolgedessen vom vollen Bürgerrechte ausgeschlossen war“ [5]. Da die ewigen Kriege die Männer fraßen, sollen sich zu Alexanders Zeit nicht weniger als zwei Fünftel des Bodens in der Hand von Frauen befunden haben. Schon um die Zeit der Schlacht bei Leuktra war die Zahl der vollberechtigten spartanischen Bürger auf etwa 1500 gesunken; dann büßte Sparta Messenien und damit ein Drittel seines Gebietes ein: fast die Hälfte der Spartiaten verlor damit ihr Grundeigentum [6]. Die Folge war die engherzigste Cliquenpolitik dieser „oberen Tausend“: ihre Schuld scheint es gewesen zu sein, daß die im peloponnesischen Kriege emanzipierten Periöken und Heiloten (Neodamoden) um das versprochene volle Bürgerrecht betrogen wurden — sogar das Ephorat, ursprünglich das Volkstribunat der kleinen Leute in Sparta, wurde von ihnen sozusagen plutokratisch denaturiert und zum Kampfe gegen das auch hier oft volksfreundliche Königtum mißbraucht.
[1] Einzelne Bürger hielten auf ihren Gütern bis zu zwanzigtausend in Fesseln arbeitende Ackersklaven (Mommsen, a. a. O. I, S. 488/9). Man hatte die freien Libyer mit Waffengewalt unterworfen und in Fellahs verwandelt.
[2] „Dieser Kampf gegen das politische und, was in Etrurien besonders hervortritt, gegen das priesterliche Monopol der Adelsgeschlechter muß Etrurien staatlich, ökonomisch und sittlich zugrunde gerichtet haben. Ungeheure Vermögen, namentlich an Grundbesitz, konzentrierten sich in den Händen von wenigen Adligen, während die Massen verarmten“ (Mommsen).
[3] Neuhaus, Die friderizianische Kolonisation, S. 208.
[4] Zit. nach Laveleye, Das Ureigentum, Dtsch. v. Bücher, S. 356, Anm. 1.
[5] Beloch, a. a. O. III, S. 26. Vgl. Kaerst S. 50.
[6] Beloch, a.a.O. S. 345/6. Vgl. Weber, Weltgesch. II, S. 739. Vgl. Busold, a.a. O. S. 99 über die „Hypomeiones“, die Xenophon erwähnt.
[432]
Schlimmer noch als diese Konzentration allen Vermögens und aller Macht in den Händen einer zusammenschrumpfenden Adelsclique war, daß ihr Grundeigentum auch auf Kosten des plebejischen Bauern wuchs. Damit kommen wir zu der gleichlaufenden Differenzierung, die das Plebejat spaltete.
b) Die Plebejer.
A. Die Bauernschaft.
In der Stadt kommen einzelne Plebejer (hier fassen wir die verschiedenen Schichten der ehemaligen Gemeinfreien, Beisassen, Klienten und Freigelassenen, die immer mehr zu einer homogenen Klasse verschmolzen, zusammen) durch Handel, Seeraub, Wucher, vielleicht auch gelegentlich durch wirtschaftliche Tüchtigkeit und Glück, zu einem Vermögen, das sie den reicheren Patriziern zur Seite stellt. Die Mehrzahl aber verarmt, wenn nicht absolut, so doch relativ.
Das gilt zunächst von den Bauern. Sie haben ihre kleine Hufe von jeher mit eigener Hand, vielleicht mit Hilfe eines oder weniger Knechte, bebaut. Sie können ihren Reinertrag, den sie zu Markte führen können, unmöglich in dem Maße vermehren, wie das dem Patrizier möglich ist, der sein feudales Gefolge entlassen und damit die Mitesser ausgeschaltet hat, und der außerdem bereits anfängt, von den an ihre Stelle getretenen Ackersklaven immer mehr Arbeit zu erpressen, während er sie immer schlechter unterhält und ernährt, um möglichst viel verkäufliches Produkt zu Markte zu bringen. Während ihm also ein verhältnismäßig großes Geldeinkommen zuwächst, bleibt das bäuerliche Reineinkommen klein. Die Folge ist eine fast sprunghafte Verschiebung in der beiderseitigen sozialen Stellung und Lebenshaltung. Der Patrizier wird plötzlich „reich“, und so empfindet er den Plebejer, und dieser sich selbst, ebenso plötzlich als „arm“. Mit anderen Worten: die soziale Kluft zwischen den beiden Klassen reißt mit einem Male viel tiefer auf.
Es bleibt aber nicht bei dieser relativen Verarmung. Die Klassenpolitik des herrschenden Patriziats sorgt dafür, daß der Plebejer auch absolut verpowere. Wie alle herrschenden Klassen wälzt es das Schwergewicht der öffentlichen Lasten auf die Unterklasse ab, während es sich selbst die Vorteile vorbehält.
Zunächst schließt sich das Patriziat überall als „Gerechtsame“ — oder „Realgemeinde“ ab, und das heißt, daß es den Plebejern den Zugang zur Gemeinen Mark ganz sperrt oder doch so viel wie möglich erschwert. Hier mag das alte Patriarchalrecht den Vorwand abgegeben haben: durfte doch ihm zufolge nur der Vollbürtige überhaupt Grund-
[433]
besitz haben [1]. Dieses monopolistische Streben scheint einer der Hauptgründe der Adelsrevolution gewesen zu sein, die das alte Geschlechtskönigtum stürzte. Das berichtet Beloch [2] ganz allgemein aus Griechenland, und Mommsen berichtet ausführlich darüber aus Rom [3]. Nach der Einführung der Republik wird der Satz wieder scharf betont, daß nur der Patrizier ein Recht auf die Nutzung des Ager publicus habe. Und wenn auch der Senat nach wie vor zugunsten der reichen, in ihm vertretenen plebejischen Häuser Ausnahmen zuließ, so wurden doch die kleinen plebejischen Ackerbesitzer und die Tagelöhner, die eben die Weide am nötigsten brauchten, beeinträchtigt: ein ungeheurer Schade, den wir aus der Neuzeit, namentlich aus der Wirkung der „Inclosures of Commons“ in England, gut beurteilen können: die Weide ist geradezu das Rückgrat der Kleinbauernwirtschaft. Später kam dann durch absichtliche Nachlässigkeit der patrizischen Finanzbehörden, der Quästoren, das alte Hutgeld in Vergessenheit und Wegfall, so daß zur Zeit der Grachen der ganze Ager publicus schon fast als das private Eigentum der Nutznießer betrachtet werden konnte.
Ebenso skrupellos wurden bis zum Aufkommen der volksfreundlichen Tyrannis, am skrupellosesten wieder in Rom, die neu eroberten öffentlichen Domänen, auf denen bis dahin die ärmeren Bürger und Beisassen angesetzt worden waren, monopolisiert. Hatte man bisher nur das für Ackerbau unbrauchbare Land zur Gemeinweide geschlagen, so wurden die Assignationen immer seltener, und an ihre Stelle trat das System der öffentlichen Verpachtung (Okkupation), von dem selbstverständlich fast nur die Patrizier Vorteil hatten. So staute sich die Kleinbauernbevölkerung auf allzu enger Scholle [4].
Diesen kleinen und sogar schwindenden Einnahmen der Bauernschaft stehen steigende Ausgaben gegenüber. Die öffentlichen Lasten sind durch den Übergang zur Stadt- und Geldwirtschaft sehr gewachsen. Die rein städtischen Bedürfnisse an Wasserleitungen, Kloaken, Rathäusern, Tempeln, Straßen, Beamten aller Art für Straßen-, Markt-, Feuer-, Sicherheitspolizei usw. sind in regelmäßigem Steigen und müssen in regelrechtem Etat durch Geldsteuern gedeckt werden, deren Hauptlast natürlich die Plebs aufzubringen hat. Die Geldeinnahmen des Kleinbauern sind schon in normalen Zeiten für diese Lasten sehr schmal; wenn ihn eine Mißernte, eine Überschwemmung, eine Viehseuche oder ein Brand, wenn ihn ein feindlicher Raubzug schädigt, ja, wenn er nur durch Krankheit in der Familie leidet, so mangeln ihm die Barmittel,
[1] So erklären Fustel de Coulanges (a. a. O. S. 63) und Lacombe (a. a. O. S. 338) das Vorgehen.
[2] Beloch, I, S. 213/4.
[3] Vgl. dazu auch Adler, Gesch. d. Soz. I, S. 9.
[4] Vgl. Mommsen, I, S. 266ff.
[434]
und er muß Schulden aufnehmen [1]. Überhaupt muß man sich klar machen, daß eine rein naturalwirtschaftlich geführte Bauernstelle ihrem Eigentümer zwar niemals ein gleich hohes Einkommen abwerfen kann wie eine geldwirtschaftlich betriebene unter günstigen Umständen, daß aber andererseits eine Natural-Bauernwirtschaft ganz anders gegen Konjunkturen gefeit ist. Der kleine Wirt, der seine urtümliche Selbstgenügsamkeit verloren hat, bleibt fortan auf die Versorgung durch den Markt angewiesen und muß bei schlimmem Glück in Verschuldung geraten.
Und hier kann er diesem Schicksal nicht entgehen. Mehr noch als durch ihre innere Steuer- und Landpolitik versetzt die herrschende Aristokratie den freien Bauern (und den städtischen Handwerker und Krämer, für die das gleiche gilt) durch ihre äußere Politik in die Notlage, sich zu verschulden, nämlich durch ihre kriegerische Expansionspolitik.
Schon der naturale Eroberungsstaat ist, wie wir wissen, aggressiv und expansiv: aus dem notwendigen Streben jeder Grundaristokratie nach Ausdehnung ihrer Herrschaft und ihrer Tributrechte; und wäre es einmal ein solcher Staat nicht, so würde ihm die Politik der Nachbarn das gleiche Verhalten vorschreiben, da man Hammer sein muß, wenn man nicht Ambos sein will. Dieses Bedürfnis wird durch den Übergang zur Geld Wirtschaft nur noch verstärkt. Denn jetzt handelt es sich nicht mehr nur um Vermehrung einer auf „Land und Leuten“ fundierten Hausmacht, sondern um das schlechthin unstillbare Streben nach Vermehrung der Geldrente aus möglichst erweiterten Latifundien ; ja, für den verarmten Patrizier um nicht weniger als die Erhaltung seiner gefährdeten Klassenstellung. Während derart der Trieb zu aggressiver Politik nach außen hin immer stärker wird, werden die entgegenstehenden Motive immer schwächer; denn jetzt hat nicht mehr ein feudaler Halbfürst von den Wechselfällen des Krieges die Verheerung seines Landes und den Verlust seiner Leute zu befahren, sondern ein reicher Privatmann schlimmstenfalls den Verlust einer Ernte und die Einbuße einiger leicht auf dem Sklavenmarkte ersetzbarer menschlicher Maschinen: Verluste, die er schon durch den Abschluß günstiger Lieferungen für seinen Staat zum Teil hereinbringen wird, die aber jedenfalls in keinem Verhältnis zu den Vorteilen stehen, die ihm ein glücklicher Feldzug eintragen wird.
So ist also die Außenpolitik der kapitalistischen Sklavenwirtschaft eine rastlose brutale Eroberungspolitik viel größeren Stils als in der Naturalperiode. In Athen galt ein Friedensschluß geradezu als Frevel :
[1] „Die Geldsteuern lasteten schwer auf Palästina“ a. a. O. S. 15. (Nehemia 5, 18). Neurath, a. a. O. S. 15.
[435]
man schloß nur befristete Waffenstillstände ab [1], und auch in Rom stand der Tempel des Janus fast immer offen. Und diese schärfere Eroberungspolitik unterscheidet sich von der voraufgegangenen Periode durch ihren Modus procedendi. Da es nicht mehr die Absicht ist, so viel Land und so viele Leute wie möglich zu erkämpfen, sondern so viel Land mit so wenig wie möglich Menschen darauf, d. h. mit nur so vielen Sklaven, wie bei äußerster Anspannung gerade erfordert sind, den Acker zu bestellen: so erhalten die Kriege einen Zug furchtbarer Brutalität. Sie laufen nicht mehr auf Unterwerfung, sondern auf Vernichtung des Gegners hinaus, und zwar nicht nur der feindlichen Adelsklasse, des eigentlichen Gegners, sondern auch auf die seiner Hintersassen. Die Kriege arten immer mehr in Mord und Sklavenhetzen aus [2].
Die Hauptlast dieser Kriege trägt selbstverständlich der plebejische Wehrmann, wenigstens von der Zeit an, — und die ist längst eingetreten —, wo auch der Mittelstand dank den Fortschritten der Metallurgie in der Lage ist, sich mit der schweren Rüstung auszustatten. Damit war der Vorsprung des Adels gebrochen, der bis dahin allein sich dieser kostspieligen Waffen hatte bedienen können; der Einzelkampf der Helden, der bisher die Schlachten entschieden hatte, hörte auf, wurde durch das Massenaufgebot der schwerbewaffneten Bürger ersetzt; der Streitwagen wird zum Sportgerät für Wettrennen [3].
Der Plebejer hat also fortan die Kriege vor allem auszufechten : die Patrizier aber teilen im günstigen Falle nach Löwenart. Sie schneiden sich riesige Rittergüter aus der Beute, sie erhalten als Offiziere und Generale einen größeren Anteil an den erbeuteten Sklaven und Gütern, während der Plebejer mit einem Trinkgeld abgefunden wird. Die Bilanz selbst eines glücklichen Feldzuges ist für ihn in der Regel ein schwerer Verlust : er hat seine teure Eisenrüstung, hat seinen Unterhalt im eigenen Lande aus eigenen Kosten bezahlen müssen; er hat seinen Acker nicht bestellen, seine Herde nicht schützen können, er findet bei seiner Rückkehr oft alles in Zerrüttung und muß zu den alten Schulden neue aufnehmen. Der Patrizier aber, der sein Heim in der für die Belagerungskunst der Zeit fast immer uneinnehmbaren Hauptstadt hat, der dort Einkünfte (aus Handel, Wucher, städtischer Grundrente von Mietsland und Mietshäusern, aus Militärlieferungen usw.) hat, die der Krieg nicht verminderte, vielleicht sogar vermehrte, hat selbst in einem weniger glücklichen Feldzuge wenig gelitten und in der Regel die Mittel, um die Schäden seines Landbesitzes wiederherzustellen.
[1] Max Weber, a. a. O. S. 121.
[2] Aemilius Paulus ließ im 2. Jahrh. v. Chr. „um einer verhältnismäßig unbedeutenden Ursache willen“ 150000 Epiroten in die Sklaverei verkaufen, und noch „der als milde anerkannte“ Kaiser Augustus ließ in Norditalien 36000 Salassern das gleiche Schicksal bereiten (Neurath, a. a. O. S. 69).
[3] Beloch, a. a. O. I, S. 348.
[436]
Den verschuldeten Plebejer aber trifft nun im Frieden die volle Härte einer Gesetzgebung und Justiz, die den ausgeprägten Charakter einer Klassengesetzgebung und Klassenjustiz hat. Die Schuldgesetze sind von furchtbarer Härte; vielleicht mit aus dem Grunde, den Fustel de Coulanges anführt: da der Boden, die väterliche Hufe, weil der Familie gehörig, nicht veräußerlich ist, muß der Schuldner mit seiner Person haften [1]. Und diesem Schicksal kann er kaum entrinnen, da der Zins von ungeheurer Höhe und gesetzlich nicht beschränkt ist. Und so muß sich denn der verschuldete Bauer noch glücklich preisen, wenn er als habloser Proletarier, aber als freier Mann in die Hauptstadt einwandern kann, wenn sein Gütchen in der Gant noch für Hauptsumme und Zinsen Deckung ergeben hatte: in vielen Fällen sinkt er als Schuldsklave in das Sklavenproletariat herab. In des Aristoteles „Verfassung von Athen“ heißt es: „Die damalige Verfassung war durchaus ein Regiment weniger Bevorzugter. Insbesondere mußten, während der gesamte Grund und Boden des Landes sich in den Händen weniger Besitzer befand, die Armen mit Weib und Kind den Reichen geradezu Frondienste leisten. Man nannte sie Sechstleute oder Hörige. Auf ein Sechstel belief sich nämlich ihr Anteil an dem Ertrage der Felder, die sie für die Reichen bearbeiten mußten. Für die richtige Ablieferung der übrigen fünf Sechstel hafteten sie und ihre Kinder mit ihrem Leibe. Denn bis auf Solon, der der erste war, der sich des Volkes annahm, waren die Schuldner den Gläubigern mit ihrer Person haftbar“ [2]. Er führt aus Solons Gedichten mehrere Stellen an, die sich auf diese Reform beziehen und die voraufgegangenen Zustände schildern:
[begin quote]
„Viele waren ja, da das Gesetz
Es heischte oder frevle Willkür es erzwang,
Verkauft als Sklaven, andere, von der Schulden Last
Erdrückt, in fernes Land entflohn, und hatten dort,
Bei fremden Menschen irrend, selbst der Muttersprache Laut Verlernt“ [3].
[end quote]
Aber es war nicht nur in Attika so arg, sondern Hesiods „Werke und Tage“ zeigen, daß es „in einem großen Teile Griechenlands nicht besser stand“ [4]: überall erhoben sich die Hypothekensteine auf den Äckern, überall wurden die Bauern von Hof und Haus gejagt, land-
[1] A. a. O. S. 75. In Sparta war die Hufe unteilbar, in den meisten griechischen Staaten aber wurde sie nach dem Tode des Vaters zu gleichen Teilen unter die Söhne verteilt. Daraus folgte sehr häufig Zersplitterung in Zwergwirtschaften, die sich nicht halten konnten. Vgl. Beloch I. 1, S. 306.
[2] Ausg. Reclam, S. 19.
[3] Ausg. Reclam, S. 31.
[4] Beloch, a. a. O. I. 1, S. 307.
[437]
flüchtig oder versklavt. Und in den anderen Ländern der Sklaven Wirtschaft war es nicht anders. In Palästina erklingen ganz die gleichen Klagen, die auch Hesiod erhebt, daß Dike, die Gerechtigkeit, klagend durch die Felder geht, daß Übermut, Willkür und Wucher die Herren sind, und der warnende Schrei des Propheten: „Wehe denen, die Land zu Land fügen und Hufe zu Hufe, bis Niemand mehr neben ihnen Platz hat und sie allein wohnen bleiben im Lande“ (Jesaja 5, 8)l). Und genau die gleichen Verhältnisse bestanden wieder in Rom [2], wo sie geradeso zur Secessio plebis und der daraus hervorgehenden Reform führten wie in Attika zur solonischen Schuldentlastung und Agrarreform. Aber wenn auch in Rom die Reformen für einige Zeit die Bauernschaft und den Staat retteten, so wütete doch das Übel weiter und erreichte in späteren Zeiten in den Provinzen eine ungeheure Höhe: „Die Güter in den überseeischen Gebieten, welche italischen Vornehmen gehörten, waren allem Elend der Verwalterwirtschaft ausgesetzt und sahen niemals ihren Herrn, ausgenommen etwa die Jagdparks, welche ... im transalpinischen Gallien mit einem Flächeninhalt bis fast zu einer deutschen Quadratmeile vorkommen. Die Wucherei florierte wie nie zuvor. Die kleinen Landeigentümer in Illyrikum, Asia, Ägypten wirtschafteten schon zu Varros Zeit großenteils tatsächlich als Schuldknechte ihrer römischen oder nichtrömischen Gläubiger, eben wie einst die Plebejer für ihre patrizischen Zinsherren“ [3]. Auch hier zeigt sich wieder, daß diejenigen Staaten, die das ökonomische Mittel in Gestalt der Gewerbe nicht recht zur Ausbildung kommen ließen: Sparta, und vor allem Rom, schwerer unter diesen Dingen litten als z. B. Athen, von dem Beloch berichtet, daß es noch im 4. Jahrhundert einen stattlichen gewerblichen und kommerziellen Mittelstand hatte [4].
„In Lakonien und Thessalien mit ihrer leibeigenen Landbevölkerung, herrschte der Großgrundbesitz vor. Das Eurotastal und fast ganz Messenien, ein Gebiet von gegen 5000 qkm, war mit Ausnahme der Staatsdomänen im Besitze von nur 1500 Eigentümern, der sog. spartanischen „Gleichen“ (δμοίοι); aber auch unter diesen stand neben
[1] Über Palästina vgl. Neurath, a. a. O. S. 15, 17 (Nehemia 5, 18 und Amos's, 6): Es fanden sich überall Männer, „die für Geld den Rechtschaffenen verkauften und den Dürftigen um eines Paars Schuhe willen“.
[2] Vgl. Mommsen, a. a. O. I, S. 267.
[3] Mommsen, a.a.O. III, S. 543; vgl. auch III, S. 225: „Aus derselben Schilderung ergibt sich, daß in Gallien auch außer den Kolonisten von Narbo römische Landwirte und Viehzüchter in großer Anzahl sich aufhielten; wobei übrigens nicht außer acht zu lassen ist, daß das meiste von Römern besessene Provinzialland, eben wie in frühester Zeit der größte Teil der englischen Besitzungen in Nordamerika, in den Händen des hohen in Italien lebenden Adels war, und jene Ackerbauer und Viehzüchter zum größten Teil aus deren Verwaltern, Sklaven oder Freigelassenen bestanden.“
[4] A. a. O. III. 1, S. 345.
[438]
den wenigen Latifundienbesitzern die große Mehrzahl derer, die nur die alte „lykurgische“ Hufe ihr Eigen nannten. Der Reichtum der thessalischen Adelsfamilien war sprichwörtlich ; es gab dort manchen Grundherrn, der es vermochte, aus eigenen Mitteln, ein ganzes Truppenkorps auszurüsten“ [1]. Auch in Böotien, Mazedonien und Sizilien lag es ähnlich, und ebenso in manchen Kolonien; in der Kyrene gewann Arkesilaos den Thron mit Hilfe zahlreicher Anhänger zurück, die er durch das Versprechen einer neuen Landverteilung geworben hatte. So lag es schon gleich nach den Perserkriegen. Dann aber griff, wie oben gezeigt, das Latifundiensystem in ungeheurem Maße um sich. So war denn schon um die Zeit der Schlacht bei Leuktra die Zahl der vollberechtigten spartanischen Bürger auf etwa 1500 herabgesunken [2].
Ganz ähnlich lag es in Palästina. Hier „hat die ökonomisch-soziale Entwicklung zum Großgrundbesitz eine Latifundienwirtschaft der Vornehmen ausgebildet“ [3]. Auch hier waren die ehemals freien Bauern in drückende finanzielle Abhängigkeit von dem Stadtpatriziat und den Großgrundbesitzern gelangt, wenn sie nicht Schutzsklaven oder Gêrim wurden [4].
Wie unwiderstehlich diese Entwicklung ist, wo Sklavenwirtschaft besteht, zeigt die Tatsache, „daß selbst eine ursprünglich so urdemokratische Kolonisation, wie die der Buren nördlich des Oranje- und Vaalflusses binnen wenigen Generationen zu latifundienmäßiger Anhäufung des Landes in Händen weniger einflußreicher Familien und dementsprechend zu partieller Depossedierung zahlreicher Volksgenossen führte, eine Entwicklung, die hier freilich durch die Möglichkeit extensiver Weidewirtschaft und das Institut der Negersklaverei, welches die erforderlichen Arbeitskräfte für die weiten Flächen lieferte, begünstigt wurde [5].
Das ist der eine der beiden großen Gegensätze, durch die die Geschichte der antiken Staaten vorwärtsgetrieben wird: der zwischen städtischem Gläubiger und ländlichem Schuldner, „zwischen stadtsässigem Patriziat und landsässigem Bauern, so in China, Indien, Rom; und die gleiche Auffassung beherrscht auch das Alte Testament“ [6].
Selbstverständlich verfällt mit dieser Entwicklung überall die Wehrkraft. Beloch hebt überall hervor, daß die Großgrundbesitzerländer nur wenige Hopliten aufzubringen imstande sind [7].
[1] Beloch II. 1, S. 102.
[2] Beloch III. 1, S. 346.
[3] Robert Weiß, a. a. O. S. 11.
[4] Ibd. S. 6.
[5] Neuhaus, Die friderizianische Kolonisation, S. 208.
[6] Max Weber, Wirtschaftsgeschichte, S. 235, vgl. S. 281/82. Über Palästina vgl. auch Georg Weber, Weltgeschichte I, S. 707.
[7] z. B. II. 1 S. 103; III, I S. 278. Die Sklaven waren militärfrei (vgl.Marquardt, a. a. O. S. 135). Es kam vor, daß Freie sich in die Sklaverei begaben, um dem Kriegsdienst zu entgehen.
[439]
Der zweite große Gegensatz war der zwischen dem Kapital und der, hier im Gegensatz zum christlichen Okzident, unfreien Arbeit.
Man muß sich die Bedingung und die Grenzen dieser verhängnisvollen Entwicklung sorgfältig klar machen, um ihre Mechanik zu verstehen. Die Bedingung ist die Verfügung über eine fast unbegrenzte Zahl von käuflichen billigen Sklaven, wie deren Bedingung wieder der unaufhörliche Raubkrieg ist. Ohne Sklaven ließen sich die kommassierten Güter nicht bewirtschaften : die ganze Aktion wäre also ökonomisch sinnlos und praktisch undenkbar. Nun beruht aber die militärische Aggressiv- und Expansionskraft dieser Räuberstaaten auf der Zahl, Zuverlässigkeit und Kraft der plebejischen Wehrmasse: man kann sie also nicht zugrunde gehen lassen. Und hier liegt die Grenze der Vernichtung des Plebejats, namentlich der Bauernschaft, die zwar fast immer überschritten worden ist: denn die Eigen- und Habsucht der Herrenklasse ist gemeinhin blind und findet ihre Grenze erst beim Untergang des Staates oder mindestens seiner Verfassung; die aber nicht überschritten werden durfte, ohne das Staatswesen aufs äußerste zu gefährden.
Und so liegt hier der Ausgangspunkt der Demokratisierung der Verfassung, die wir im vorigen Abschnitt dargestellt haben. Weiterblickende Patrizier traten für die nötigen Reformen ein, die Widerstrebenden wurden durch die Macht der Waffen gezwungen, durch ihre Anwendung oder durch die Drohung ihrer Anwendung. Seit man den Plebejern die Waffen in die Hand gegeben hatte, weil man sie für die Zwecke der „politischen Zunft“ nicht entbehren konnte, hatte man ihnen auch die Macht in die Hand gegeben [1].
Leider wurden sie, wie die Verhältnisse damals lagen, dadurch gleichzeitig selbst Mitglieder der politischen Zunft, des Räubermonopols der regierenden Stadtgemeinde — und daran mußten schließlich nicht nur die Staaten, sondern die Völker selbst zugrunde gehen, wie sich bald ergeben wird.
Die Führer dieser Verfassungskämpfe waren, wie gezeigt, die reichen Plebejer, eine echte „Übergangsklasse“, d.h. eine Klasse, die von unten her mehr empfängt als sie leistet, und nach oben hin mehr leistet als sie empfängt.
Das Programm der revolutionären Partei enthält aus diesem Grunde selbstverständlich immer Forderungen von zweierlei ganz verschiedener Art: politische Konzessionen zwecks der Demokratisierung des Staatswesens, namentlich in bezug auf das Ämterwesen und die soziale Rangierung (Konnubialrecht) für die Bourgeoisie einerseits . . . und
[1] Vgl. Max Weber, Wirtschaftsgesch. S. 278/9.
[440]
andererseits soziale, wirtschaftliche Reformen für das freie Proletariat [1]: Reformen, die bei dem noch immer vorwiegend agrarischen Charakter der Staatswirtschaft auf eine Landverteilung, auf Gesetze zur Beschränkung des Großgrundbesitzes und zum Schutz der freien Arbeiter, namentlich der freien Landarbeiter (die es jetzt in Massen gibt), gegen die Konkurrenz der Sklavenarbeit [2]; — und die selbstverständlich auf Schuldenregelung, unter Umständen sogar auf Schuldentlastung (Seisachthie) und Milderung der Schuldgesetze hinauslaufen [3].
Der Sieg wird errungen, das reiche Plebejat verschmilzt mit der Blutsaristokratie zu einer einzigen, versippten und verschwägerten „Nobilität“, ganz wie in den italischen Städten des Mittelalters zur nuova gente und in der Neuzeit zur Großbourgeoisie. Und von diesem Zeitpunkt an sieht sich das freie Proletariat seiner Führer und Schützer beraubt; es sieht sie, und auch das ist ein typisches, sich immer und überall wiederholendes Geschehen, — in dem Augenblick die Waffen rückwärts wenden, wo ihnen die Fäuste der Masse die Bresche in die Hochburg der alten Klassenherrschaft gebrochen haben. Von jetzt an ist die plebejische Bourgeoisie nicht mehr Übergangsklasse, sondern vollberechtigter Bestandteil der Herrenklasse; und sie nimmt nun sofort, wieder überall und zu allen Zeiten, die uns bekannte konservativ-legitimistische Klassenpsychologie an und betreibt mit den alten Gegnern im Bunde eine jetzt durch keine inneren Gegensätze zwischen dem „landed“ und dem „moneyed interest“ mehr gehemmte Klassenpolitik.
Diese Politik hat fortan eine etwas veränderte Richtung, seit die Herrenklasse nicht mehr bloß agrarische, sondern auch kommerziellkapitalistische Interessen in sich vereinigt.
Die Außenpolitik geht also nicht mehr bloß auf Erwerb von Latifundien samt den dazu erforderlichen Sklaven, sondern auch auf den von Plantagen und Bergwerken und, wenn möglich, auf die Ausrottung mächtiger Handelskonkurrenten. Die Handelspolitik gibt den Einschlag zu dem Gewebe, dessen Zettel die Agrarierpolitik bleibt mit ihrer nur noch hastiger und brutaler betriebenen Expansion.
Was die Innenpolitik anlangt, so erreicht noch immer eine wohlorganisierte Klassenjustiz, die die Gesetze nach Bedürfnis auslegt und im Notfall übertritt, daß die sozialpolitischen Reformen auf dem Papier bleiben, soweit sie den Interessen der Herrenklasse unbequem sind.
[1] Das große Beispiel ist das licinische Ackergesetz, das früher ins Jahr 367 verlegt wurde, das aber, wie Niese bewiesen hat, zu Anfang des zweiten Jahrhunderts erlassen worden ist (Adler, Gesch. d. Soz. I, S. 9).
[2] Mommsen, a. a. O. I, S. 441/2.
[3] Über die Seisachthie Nehemias vgl. Neurath, a. a. O. S. 18. Über Versuche in Rom ebendort S. 65.
[441]
Solange der Staat siegreich bleibt und immer neues leergemordetes Land erwirbt, setzt man ja die Ansiedlung von hablosen städtischen Proletariern auf Bauerngrundstücken so weit fort, wie unerläßlich scheint, um die militärische Kraft zu erhalten und die dringendsten Ansprüche der Veteranen zu befriedigen. Aber das geschieht nur so lange, wie das städtische Bürgertum noch wirklich selbst die Waffen trägt. Dieses aber, in die regierende Klasse eingerückt, zuweilen der einzige Inhaber der Souveränetät, findet es bald bequemer und gefahrloser, statt selbst die Waffen zu führen, Söldner mieten zu lassen: zu Demosthenes Zeit ließen die Athener alle Kriege durch Mietheere, meist sogar unter Miet-Generalen führen; Demosthenes sah es bereits als eine Verbesserung an, wenn doch wenigstens eine Anzahl von Bürgern mit ins Feld zog [1].
Ebenso verlieren die Bürger die Lust und die Kraft, als pflugführende Bauern, als Coloni oder Kleruchen, hart zu arbeiten und dazu noch die Annehmlichkeiten des großstädtischen Lebens preiszugeben: die athenischen Kleruchen saßen in späterer Zeit ruhig in ihrer Stadt und bezogen nur die Rente ihres verpachteten Loses [2]. Und von den römischen Plebejern heißt es: „Viele Arme waren sogar den Landanweisungen von Herzen abhold. Das städtische Bummlerleben brachte bei allem Elend doch wieder mancherlei Genüsse; sollten sie dieses nun mit einem Bauernleben voll Arbeit und Entbehrung vertauschen, sollten sie aus Stadtbürgern zu Dorfbewohnern herabsinken?“ [3]
Wir haben etwas vorgegriffen. Um zu unserer Darstellung zurückzukehren, so dehnt sich, trotz aller papierenen Gesetze, der Großgrundbesitz über alle ihm gesteckten Grenzen hinaus. Die Expropriation des freien Kleinbesitzes schreitet ungehindert fort, sei es durch Erbzersplitterung, sei es durch Auskauf, sei es durch Chikanen, die dem kleinen Manne das Leben verleiden, sei es schließlich durch Gesetzesbeugung oder offene Gewalt, durch „Legung des Bauern“. Die Latifundien mit ihrer verhältnismäßig äußerst dünnen Sklavenbevölkerung breiten sich über das Land aus wie ein Feldbrand in der Sommerdürre.
Die Dinge wurden in Rom noch durch gesetzgeberische Torheiten verstärkt. Kurz vor 536 d. St. erging das claudische Gesetz, „das die senatorischen Häuser von der Spekulation ausschloß, und dadurch deren ungeheuere Kapitalien künstlich zwang, vorzugsweise in Grund und Boden sich anzulegen, das heißt die alten Bauernstellen durch Meierhöfe und Viehweiden zu ersetzen“. Dazu kam die Förderung der Viehwirtschaft durch den Staat, namentlich infolge der Kornspenden.
[1] Röscher, Politik, S. 399.
[2] Beloch, a. a. O. II. 1, S. 156.
[3] Georg Weber, Weltgeschichte III, S. 593/94.
[442]
Es ließ sich, wie Mommsen sagt, ein Weidegut unbegrenzt ausdehnen und nahm den Eigentümer wenig in Anspruch, während ein Ackergut doch immerhin eine gewisse Aufsicht verlangte. Schließlich wirkte nach derselben Richtung hin die Gesetzgebung in bezug auf die Domänenokkupation: „Durch sie entstanden nicht bloß, da regelmäßig in größeren Stücken okkupiert ward, ausschließlich große Güter, sondern es scheuten sich auch die Besitzer, in diesen auf beliebigen Widerruf stehenden und rechtlich immer unsicheren Besitz bedeutende Bestellungskosten zu stecken, namentlich Reben- und Ölbäume zu pflanzen; wovon denn die Folge war, daß man diese Ländereien vorwiegend als Viehweide nutzte“ [1]. Noch zur Zeit der Pyrrhoskriege, ja noch im hannibalischen Kriege hatte Italien einen blühenden Bauernstand, auf dem die Wehrkraft des Reiches beruhte, der es geradezu rettete; dann breitete sich die Gutsherrschaft, die vielleicht von den Karthagern übernommen war, schnell aus, vernichtete die ältere auf dem Bittbesitz beruhende Klientel [2], die großenteils aus der Verschuldung ehemals freier Bauern entstanden war: und bei Beginn der Kaiserzeit gab es, außer in den Tälern der Abruzzen und des Apennin, kaum noch Bauernwirtschaften [3]. Und das trotz der immer wiederholten inneren Kolonisationen auf dem Gemeindelande !
B. Der gewerbliche Mittelstand.
Die derart von der Scholle gelösten Elemente wenden sich notgedrungen [4] der Hauptstadt zu, wo, wenn kein Brot, so doch Brosamen abfallen, wo kräftige und namentlich skrupellose Naturen doch noch einige Aussicht haben, emporzukommen.
Groß ist die Aussicht nicht. Denn auch in der Stadt macht die Sklavenarbeit dem an sich schon schwach besetzten Handwerk, der eigentlich städtischen Nahrung, eine von Tag zu Tage gefährlichere, für die meisten Berufe und ihre Träger unüberwindliche Konkurrenz.
Man darf diese Dinge nicht übertreiben, wie es Rodbertus und ihm folgend, in dem Bestreben, den idealtypischen Verlauf in die wirkliche Geschichte hineinzusehen, Carl Bücher getan haben. Die Antike war nicht eine Periode der ausschließlichen „Grossoikenwirtschaft“: das freie Handwerk, wozu wir immer auch den kleineren Krämer rechnen, hat stets einen Platz gehabt. Besonders in denjenigen Stadtstaaten, wo
[1] Mommsen I, S. 831.
[2] Mommsen, a. a. O. I, S. 441/2.
[3] Mommsen, a. a. O. III, S. 517.
[4] Auf dem Lande konnten sie nicht bleiben. Denn „fremde Arbeiter wurden für gewöhnlich nicht verwandt, außer in besonders ungesunden Gegenden, wo man es vorteilhaft fand, den Sklavenstand zu beschränken und dafür gemietete Leute zu verwenden, und zur Einbringung der Ernte“ (Mommsen a. a. O. I S. 831).
[443]
sich von vornherein das öffentliche Wesen stärker auf das Gewerbe gestützt hatte, erhielt sich dieses einen Teil seiner Stellung in einigermaßen befriedigender Weise; so in Athen. Aber freilich: „Athen war die wirtschaftlich blühendste Stadt Griechenlands, wo jeder, der arbeiten wollte, mit Leichtigkeit zu lohnendem Verdienste Gelegenheit fand, während die Regierung gleichzeitig darauf bedacht war, durch Aussendung von Kleruchien das bürgerliche Proletariat zu vermindern“ [1]. Anderswo, in weniger industriell entfalteten und kriegerisch weniger mächtigen Städten (die also nicht in der Lage waren, auf erobertem Lande Kolonien anzulegen) stand es schlimmer, wenn auch der freien Arbeit überall ein gewisser Spielraum geblieben sein wird.
Aber nicht darauf kommt es nationalökonomisch an, sondern nur darauf, wie sich das Verhältnis des Angebots der freien Arbeit zu der Nachfrage danach, zu ihrer Absatzmöglichkeit, zu ihrem Markte verhielt und weiter gestaltete. Und da kann kein Zweifel bestehen, daß dieses Verhältnis sich fast überall, in allen Stadtstaaten und in allen städtischen Gewerben, dauernd verschlechterte.
Es war noch ein Glück, daß der Entwicklung der Sklavenwirtschaft zum eigentlichen fabrikmäßigen Großbetrieb im Gewerbe starke Hindernisse entgegenstanden. „Das Ergasterion ist ein schwieriger und riskanter Betrieb“, wegen der „politischen Labilität des Sklavenkapitals“. „Der Herr nutzte daher den Sklaven lieber als Rentenquelle und nicht als Arbeitskraft“, d. h. ließ ihn gegen Beteiligung oder Kopfgeld für den freien Markt arbeiten. „Betrachtet man die antiken Sklavenvermögen genauer, so bemerkt man, daß in ihnen Sklaven der verschiedensten Branchen in einem Maße gemischt sind, daß ein moderner Werkstattbetrieb damit nicht geschaffen werden konnte“ [2]. Der Sklavenbesitzer verteilte sein Risiko, wie man heute sein Vermögen in verschiedenen Papieren anlegt.
Aber das half nicht viel gegenüber der Gesamtsituation der Gewerbe. Ihr Angebot wächst riesenmäßig, weil die Stadtbevölkerung aus „außerökonomischen“ Gründen gewaltig zunimmt: denn nicht nur die verpowerten Bauern werden in die Hauptstadt gedrängt, sondern auch die Handwerker und kleinen Krämer der Landstädte, die mit ihrer bäuerlichen Kundschaft ihre Existenz verloren haben. Wer Bauern schafft, schafft Städte; das beweist die Wirtschaftsgeschichte des westeuropäischen Mittelalters, wo jede Verbesserung in der Lage der Bauernschaft, weil sie ihre Kaufkraft stärkte, neue Städte ins Leben rief und die alten Städte volkreicher und wohlhabender machte; und das beweist die Siedlungsgeschichte des preußischen Ostens in den letzten Jahrhunderten, die gleichfalls die verödeten Städtchen auf-
[1] Beloch, a. a. O. III, S. 345.
[2] Max Weber, Wirtscbaftsgesch., S. 160.
[444]
blühen sah, sobald in ihrer Nachbarschaft durch Aufteilung ehemaligen Großgrundeigentums kaufkräftige Bauern entstanden waren. Denn der Bauer kauft in der Nachbarstadt, während der große Grundherr den größten Teil seines Bedarfs in der Hauptstadt seiner Provinz, des Landes oder gar in einer der großen Weltstädte außerhalb des Landes kauft, in denen allein Luxusprodukte für den verfeinerten Geschmack hergestellt werden können [1].
Dieser unzerreißbare Zusammenhang zwischen bäuerlicher Kaufkraft und städtischer Wohlfahrt, den leider die heutige Ökonomik trotz aller Evidenz der Daten nicht genügend beachten will, zeigt sich auch umgekehrt in der gleich evidenten Wahrheit: Wer Bauern zerstört, zerstört Städte. Ein einziger Blick auf den bäuerlich unterbauten Stand der Gewerbe und Städte im Westen Europas, und den großagrarisch unterbauten Stand der Städte und Gewerbe östlich der Elbe zeigt diesen Zusammenhang dem unbefangenen Blick sofort; schon auf einer kleinen geographischen Karte läßt er sich ablesen [2].
Der Rückschlag der Bauernzerstörung der Antike auf die kleineren Landstädte mußte noch viel größer sein, als wir ihn in der neueren Zeit beobachten konnten. Denn erstens war jene Zerstörung ungleich gewaltiger, als sie je in dem christlichen Okzident vorgekommen ist; — vor allem aber traten an die Stelle der abgestifteten Bauern hier nicht Landarbeiter, die zwar vielfach Unfreie, aber doch mit eigenem Haushalt und eigener Kleinwirtschaft ausgestattet waren, sondern Sklaven, die, mit einziger Ausnahme des Vogtes (villicus) weder Haushalt noch Familie hatten. Ihnen war auch nicht der kleinste Rest eigener Kaufkraft gelassen, von dem ein städtisches Gewerbe notdürftig hätte existieren können. Aber damit noch nicht genug! Auch das knappe Minimum an Lebensbedürfnissen, das selbst der agrarische Sklavenhalter seinen Knechten bewilligen muß, um sie am Leben und bei Arbeitsfähigkeit zu erhalten, kauft er in aller Regel nicht auf dem Markte, sondern läßt es in eigener Regie durch andere, ebenfalls auf dem Gute gehaltene Sklaven erzeugen, ebenso seine eigenen regelmäßigen Bedürfnisse [3]. Was er auf dem freien Markte ankauft, sind hochwertige
[1] Vgl. unsere „Siedlungsgenossenschaft“, S. 255 und „Großgrundeigentum und soziale Frage“, S. 298. Ferner S. S. III, S. 909, Soziale Frage und Sozialismus, S. 88ff. viele Daten. Vgl. ferner Neuhaus (a. a. O. S. 155) : In Driesen stieg als Folge der Ansiedlung von Bauern durch Friedrich II. die Zahl der Häuser von 172 auf 257, der Familien von 223 auf 382, der Seelen von 1478 auf 1907.
[2] Vgl. S. S. III, S. 912 die Schlußfolgerungen des Statistikers Rauchberg über diese Zusammenhänge.
[3] „Du mußt nicht glauben, daß er etwas kauft,“ heißt es bei Petron von einem reichen Emporkömmling. „Alles wird bei ihm erzeugt.“ Zit. nach Bücher, Entstehung der Volkswirtschaft, S. 68. Die Worte „nichts“ und „alles“ müssen natürlich cum grano salis gelesen werden.
[445]
Luxusartikel, die er selbstverständlich nur bei den Produzenten der Hauptstadt findet, sei es bei einzelnen hochqualifizierten Kunsthandwerkern, sei es wieder bei solchen gewerblichen Kapitalisten, die einen auf Sklavenarbeit beruhenden Großbetrieb unterhalten, sei es schließlich bei dem Handel, der die Erzeugnisse noch nicht vollkommen ruinierter Länder mit gut erhaltenem Kunsthandwerk importiert, namentlich aus dem Orient [1]. Wenn er aber etwa auf den eigenen Gewerbebetrieb für seine Sklavenschaft verzichtet, so kauft er dennoch fast alles in der Hauptstadt, und wieder vorwiegend bei den Großbetrieben, die dank der billigen Sklavenarbeit den kleinen Mann unterbieten können. Cato rät den Landwirten Campaniens, ihren Bedarf an Sklavenkleidung und Schuhzeug, an Pflügen, Fässern und Schlössern in Rom zu kaufen [2].
Dem Handwerker der Dörfer und der kleinen Ackerstädte schwindet also der Markt unter den Händen. Auch er muß sich dahin ziehen, wo nach qualifizierter Handwerksarbeit und nach Diensten aller Art, ehrenhaften und unehrenhaften, doch wenigstens noch einige Nachfrage ist: nach der Hauptstadt [3]. Oder er muß auswandern, um im Auslande als Kolonisator, Söldner oder hausierender Kaufmann sein Brot zu suchen.
Um zusammenzufassen, so wächst also das Angebot der freien Arbeit und ihrer Produkte in der Hauptstadt durch die massenhafte Einwanderung einerseits der gelegten Bauern, andererseits der dadurch existenzlos gewordenen Handwerker und Krämer der verödenden Kleinstädte, die sich nur noch dann halten können, wenn sie sich zu Villenvororten der Hauptstadt oder zu Sommerfrischen u. dgl. eignen. Diese ungeheure Konkurrenz wird noch vermehrt durch den Einstrom zahlreicher fremder Elemente, Abenteurer, Kaufleute, Glück-
[1] Das ist der Hauptgrund für das verhängnisvolle Abströmen des baren Geldes aus Rom nach dem Orient, das einige Historiker (z. B. Brooks-Adams und neuerlich Hans Delbrück) für die oder eine primäre Ursache des Verfalls halten. Es ist aber selbst Folge und nur sekundäre Ursache. Nach Plinius (cit. bei Bury, History of the later Roman Empire I, S. 54) soll der Goldexport aus Rom nach dem Osten im ersten Jahrhundert v. Chr. jährlich wenigstens eine Million Pfund Sterling (100000000 Serterzen) betragen haben, wovon die stärkere Hälfte nach Indien ging.
[2] Mommsen, a. a. O. I, S. 842.
[3] Vgl. Mommsen, Römische Geschichte, Bd. I, S. 797: „Den älteren latinischen Stadtgemeinden war die Freizügigkeit dem Recht nach geblieben; allein der massenhafte Zudrang ihrer Bürger nach Rom und die Klagen ihrer Behörden über die zunehmende Entvölkerung der Städte und die Unmöglichkeit, unter solchen Umständen das festgesetzte Kontingent zu leisten, veranlaßten die römische Regierung, auch diesen Latinern die Ausübung ihres Zugrechts nur dann zu gestatten, wenn der Übertretende leibliche Kinder in seiner Heimatsgemeinde zurücklasse; und diesem Grundsatze gemäß wurden polizeiliche Ausweisungen aus der Hauptstadt in großem Umfang veranstaltet (567, 577)“·
[446]
sucher aus aller Herren Ländern, die durch die Kriege und Sklavenjagden ruiniert sind, und durch die auf den freien Markt losgelassenen Sklaven und die Freigelassenen. Auf der Gegenseite sinkt die Nachfrage nach der freien Arbeit aus zwei starken Ursachen. Einmal, weil, wie wir zeigten, die gesamte Summe der Nachfrage nach Gewerbsprodukten mit der Ausdehnung der Sklavenplantagen immer mehr einschrumpft, und zweitens, weil ein immer wachsender Teil dieser sich vermindernden Nachfrage wieder von dem Sklavenkapitalismus befriedigt wird, der sich trotz seiner immanenten Hemmungen durchsetzt.
Am gewaltigsten war dieser Prozeß aus Gründen, die wir schon dargestellt haben, in Rom, während er in Athen niemals zu so krassen Ausmaßen gedieh. Was Mommsen sagt, wird vielleicht etwas zu stark aufgetragen sein, aber im allgemeinen ist es sicherlich richtig: „Es hat vielleicht nie eine Großstadt gegeben, die so durchaus nahrungslos war wie Rom; teils die Einfuhr, teils die häusliche Fabrikation durch Sklaven machten hier jede freie Industrie von vornherein unmöglich“ [1]. „Zur Entwicklung eines eigentlichen städtischen Mittelstandes, einer unabhängigen Handwerker- und Kaufmannschaft kam es in Rom nicht“ [2]. Freilich waren die Gewerbe an sich unentbehrlich, „und es zeigen sich auch wohl Spuren, daß sie in einem gewissen Grade sich in Rom konzentrierten“ : so jener Rat des Cato an den campanischen Landwirt. „Auch kann bei dem starken Verbrauch an Wollstoffen die Ausdehnung und Einträglichkeit der Tuchfabrikation nicht bezweifelt werden. Doch zeigen sich keine Versuche, die gewerbsmäßige Industrie, wie sie in Ägypten und Syrien bestand, nach Italien zu verpflanzen oder auch nur sie im Auslande mit italischem Kapital zu betreiben. Zwar wurde auch in Italien Flachs gebaut und Purpur bereitet, aber wenigstens diese letztere Industrie gehörte wesentlich dem griechischen Tarent, und überall überwog hier wohl schon jetzt die Einfuhr von ägyptischem Linnen oder syrischem Purpur die einheimische Fabrikation“ [3].
Aber dieses Gewerbe wurde nicht von einem unabhängigen Mittelstande getragen, sondern war beherrscht von dem kapitalistischen Sklavenbetrieb. „Der Geldverleiher und der Bankier richteten .... Nebenkontore und Zweigbanken unter Direktion ihrer Sklaven und Freigelassenen ein.“ Das gleiche taten die Gesellschaften, die vom Staate Hafenzölle gepachtet hatten; der Bauunternehmer kaufte sich Architektensklaven, der Unternehmer von Schau- oder Fechterspielen „erhandelte oder erzog sich eine spielkundige Sklaventruppe oder eine Bande zum Fechthandwerk abgerichteter Knechte“. Ebenso geschah
[1] A. a. O. III, S. 510/11.
[2] A. a. O. I, S. 445.
[3] A. a. O. I, S. 842.
[447]
der Seehandel und der Groß- und Kleinhandel der eingeführten Waren, geschah selbstverständlich der Betrieb der Bergwerke durch Sklaven und Freigelassene, letztere in den leitenden Stellen : „die rechte Pflanzschule dieser Emporkömmlinge aus dem Sklavenstand, welche durch Bediententugend und oft durch Bedientenlaster in die Reihen der römischen Bürger und nicht selten zu großem Wohlstand gelangten und sittlich, ökonomisch und politisch wenigstens ebensoviel wie die Sklaven selbst zum Ruin des römischen Gemeinwesens beigetragen haben“ [1].
Unter diesen Umständen sind die Aussichten für den kapitallosen Mann, der in die Hauptstadt abwandern muß, sehr ungünstig, am ungünstigsten natürlich für den Bauern, der ja im Sinne der städtischen Ansprüche „unqualifiziert“ ist. Nur wenige finden den sicheren Port einer produktiven Tätigkeit im Handwerk; die Mehrzahl sucht Unterschlupf als kleine Beamte, als Schankwirte, als Bordellhalter, oder sinkt zu halb beschäftigten „Gelegenheitsarbeitern“ oder gänzlich zu „Lumpenproletariern“ herab, die nur noch von Prostitution und Verbrechen existieren können, wenn sie nicht in der Lage sind, vom Verkauf ihrer Stimme als Gesetzgeber oder Schöffen zu leben.
Die kräftigeren und edleren Naturen zogen es vor, der Heimat den Rücken zu kehren. Solange noch erfolgreiche Kriege die Möglichkeit gaben, die überquellende städtische Unterklasse auf neu erobertem Boden anzusetzen, und solange die Verderbnis noch nicht dazu geführt hatte, daß das städtische Lumpenproletariat der ehrlichen Arbeit des Kolonisten das faule Lotterleben vorzog, wirkte die innere Kolonisation als gewaltige Drainage, die die Verwandlung der Städte in „Kloaken“ verhinderte. Als diese Möglichkeit schwand, zogen ungeheure Mengen einzeln hinaus, als hausierende Kaufleute [2] und als Söldner.
Auch dieser Zug ist für alle Stadtstaaten der Antike typisch. Man hat die ungeheure Anzahl der jüdischen Händler, die schon vor der Zerstörung Jerusalems über das ganze weite Gebiet der alten Kultur und ihrer Hinterländer verbreitet waren, auf einen spezifischen „Handelsgeist“ der Israeliten oder der Semiten im allgemeinen [3] zurückführen
[1] Mommsen, a.a.O. I, S.843. Vgl. II, S. 392: „Überall legte sich bei jeder größeren Unternehmung die Sklavenwirtschaft ins Mittel; wie denn z. B. die Anlage der marcischen Wasserleitung in der Art erfolgte, daß die Regierung mit dreitausend Meistern zugleich Bau- und Lieferungsverträge abschloß, von denen dann jeder mit seiner Sklavenschar die übernommene Arbeit beschaffte.“
[2] Mommsen (a. a. O. II, S. 395/96) spiicht von der „maßlosen Ausdehnung der kaufmännischen Emigration, die einen großen Teil der italischen Jugend während ihrer kräftigsten Jahre im Ausland zu verweilen veranlaßte“.
[3] Manche nehmen an, daß die ehemaligen phönizischen Gemeinden der Diaspora, die auf einmal aus den geschichtlichen Dokumenten verschwinden, mit den stamm- und sprachverwandten Gemeinden der Juden verschmolzen sind.
[448]
wollen. Wir haben an anderer Stelle gezeigt, daß hier nichts Besseres vorliegt als die Setzung einer „Qualitas occulta“. Erst wird aus der Tatsache des Handels der Handelsgeist abgeleitet und dann aus diesem wieder der Handel. „Wo solche Geister spuken, verhüllt die Wissenschaft ihr Haupt.“ Die Tatsachen zeigen, daß auch die Griechen und in späterer Zeit auch die Römer mindestens ebensoweit und ebenso zahlreich als Kaufleute und Hausierer verbreitet waren. Mag die Angabe, daß Mithridates an dem einen Bluttage von Ephesus 80 000 Römer in seinen Staaten habe abschlachten lassen, noch so ungeheuerlich übertrieben sein: sie beweist jedenfalls, daß sehr große Mengen von Römern sich im kleinasiatischen Hinterlande aufgehalten haben müssen, selbstverständlich der Hauptmenge nach als Kaufleute. Der Handel war eben, bis der Kriegsdienst zum Gewerbe wurde, für alle freien Elemente in der kapitalistischen Sklavenwirtschaft der einzige Notausgang, da Ackerbau und Gewerbe die Bevölkerung von sich stießen. Beloch sagt von Griechenland nach dem peloponnesischen Kriege: „Wovon sollten die Söhne des kleinen Grundbesitzers leben, die auf der väterlichen Scholle keinen genügenden Unterhalt finden konnten, wenn der große Grundherr Sklaven in Dienst nahm statt freie Tagelöhner? Sollten die Leute in die Stadt ziehen ? Auch da fanden sie die Konkurrenz der billigen Sklavenarbeit ... Es sind dies Umstände, die das Söldnerwesen groß gezogen haben“ [1]. Damals schlugen griechische Söldner die Schlachten aller Kriege der Welt : in Persien, in Karthago, in Ägypten, in Thrakien. „Während Massen von Barbaren zur Arbeit in den Fabiiken, in den Bergwerken, auf den Landgütern nach Hellas gebracht wurden, zogen die Söhne des Landes zu Zehntausenden als Mietlinge in die Fremde“.
Selbstverständlich trieb nicht alle diese Leute die pure Not. Wie unsere Schweizer, so sind viele der griechischen Landsknechte aus kriegerischem Übermut und Beutesucht hinausgezogen; namentlich das den Schweizern auch sonst ähnliche Bergvolk der Arkadier [2] und die kriegerischen Söhne des übrigen hellenischen Hinterlandes im Norden der Halbinsel waren vielfach solche Reisläufer von Neigung und Beruf; aber Beloch bezeugt ausdrücklich, „daß die große Mehrzahl doch nur aus Not in die Fremde getrieben wurde“. Die Dinge liegen etwa so wie im heutigen England, wo der „Tommy“ in aller Regel ein erwerbsloser Proletarier war, der nur noch diesen letzten Notausgang vor sich sah, oder wie bei der französischen Fremdenlegion, der anderen großen Landsknechtstruppe der Gegenwart.
[1] Beloch, a. a. O., III. 1, S. 347.
[2] Vgl. Beloch, III. 1, S. 279. Grote (Gesch. Griechenlands), S. 743.
[449]
C. Der Gradient.
Dieser ganze Prozeß stellt sich von der sozialwirtschaftlichen Seite her dar als ein reißendes Zusammenschmelzen aller Mittelstände in Stadt und Land. Er kulminiert in einer geradezu wahnwitzigen Verteilung der Einkommen und Vermögen. Eine täglich mehr zusammenschrumpfende winzige Minderheit zieht nahezu das ganze Erträgnis des ökonomischen Mittels, d. h. der produktiven Arbeit einer im Raubbau mit äußerster Härte und Skrupellosigkeit bewirtschafteten und ausgebeuteten unfreien Arbeiterschaft an sich. Sie erhält durch Staatsalmosen aus diesem Rieseneinkommen ein fast ebenso zahlreiches freies Lumpenproletariat halbwegs bei Laune, dem der eherne Gang der Entwicklung die formellen Rechte der Souveränetät zugeworfen hat, ohne daß es einen anderen Gebrauch davon machen könnte — weil es wirtschaftlich expropriiert ist —, noch auch nur machen wollte, — weil es in der erzwungenen Faulheit verkommen ist — als sie an den Meistbietenden zu verkaufen. Der soziologische Gradient [1] ist also maximal; die Isobare des höchsten Drucks liegt, da die Mittelstände verschwunden sind, dicht an der des geringsten Drucks; die vom Maximum zum Minimum reichende Trichterwand ist von extremer Steile: und so muß die geringste Erschütterung der politischen Atmosphäre hinreichen, um einen Taifun losbrechen zu lassen.
Wir kennen diese Verhältnisse aus dem israelitischen Palästina durch die schweren Anklagen der Propheten. Aus Griechenland klingt im 4. Jahrhundert „in den klagereichen Reden aller über ihre Zeit nachdenkenden Männer keine häufiger als die . . . über die Verarmung der Massen, welche in den Scharen herumziehender Bettler und heimatloser Reisläufer ihren beredtesten Ausdruck fand. Zugleich weisen diese Redner immer wieder mahnend auf die Ansammlung des Gutes in wenigen einflußreichen Händen hin, auf das Schwinden des Gemeingeistes und der patriotischen Opferfreudigkeit bei den Reichen, die Begehrlichkeit der Armen, die Zügellosigkeit der Sklaven, auf das Überhandnehmen eines unhellenischen Privatluxus und sinnloser Genußsucht in allen Schichten der Bevölkerung“ [2].
Ihren Gipfel erreichte diese Zerstörung natürlich in Rom, das ja nicht bloß einen beschränkten Bezirk, sondern den ganzen Völkerkreis des Mittelmeers auszubeuten imstande war. In der Zeit der ausgehenden Republik gab es nach Lucius Marcius Philippus kaum noch 2000 vermögende Familien in Rom [3]. Fünfzig Jahre später war es nicht besser geworden, aber die Ansprüche an ein „Vermögen“ waren ins ungeheure
[1] S. S. I, S. 774/5.
[2] Bücher, Aufstände usw. S. 82 ff.
[3] Mommsen, II, S. 132.
[450]
gewachsen. Zur Zeit des Marius galt als reicher Mann, wer zwei Millionen Sesterzen besaß, nach heutigem Gelde rund 450000 Mark. Jetzt aber konnte der „schwerreiche Lucius Domitius Ahenobarbus 20000 Soldaten je vier Jugera Landes aus eigenem Grundbesitz versprechen. Das Vermögen des Pompejus belief sich auf 70 Millionen Sesterzen, das des Schauspielers Äsopus auf 20; Marcus Crassus, der Reichste der Reichen, besaß am Anfang seiner Laufbahn 7, am Ausgang derselben, nach Verspendung ungeheurer Summen an das Volk, 170 Millionen Sesterzen“ [1]. Ihm galt nur der als reich, der aus seinen Zinsen ein Kriegsheer unterhalten konnte [2]. Wer das vermochte, der war freilich ebensowenig noch ein einfacher Bürger, wie, nach Mommsen, der gallische Häuptling, der mit Tausenden bewaffneter Knechte auf dem Landtage erschien, oder wie etwa heute einer der großen Weltbankiers, die hinter den Kulissen der Politik über Krieg und Frieden, über Not und Wohlfahrt der Nationen entscheiden. „Die wohltätige Brücke, welche ein mittlerer Vermögensstand bildet, war bei den Alten ohnehin nie sonderlich fest. Wie aus der Erde gewachsen stand plötzlich das elendeste Proletariat in furchtbarer Massenhaftigkeit neben dem riesenhaften Reichtum Weniger“ [3].
Die Psychologie der Gesellschaft entsprach durchaus dieser verrückten Verteilung der wirtschaftlichen Güter. Alle sozialen Regulationen waren niedergebrochen, jene Demoralisation eingetreten, „in der der Prinz mit dem Bettler sich begegnet“ [4].
Die Herrenschicht zeigt in Reinkultur die schon dem Aristoteles wohlbekannten Charaktereigenschaften jeder übermächtigen Aristokratie: αΐκία και μοιχεία, Übermut und geschlechtliche Gier. „Als eine römische Dame von hohem Adel, die Schwester eines der zahlreichen Bürgeradmirale, die im ersten punischen Krieg die Flotten der Gemeinde zugrunde gerichtet hatten, eines Tages auf dem römischen Markt ins Gedränge geriet, sprach sie es laut vor den Umstehenden aus, daß es hohe Zeit sei, ihren Bruder wieder an die Spitze einer Flotte zu stellen und durch einen neuen Aderlaß der Bürgerschaft auf dem Markte Luft zu machen“ [5]. „In Teanum, einer der angesehensten Bundesstädte, hatte der Konsul den Bürgermeister der Stadt an dem Schandpfahl auf dem Markt mit Ruten stäupen lassen, weil seiner Gemahlin, die in dem Männerbad zu baden verlangte, die Munizipalbeamten nicht schleunig genug die Badenden ausgetrieben hatten, und ihr das Bad nicht sauber genug erschienen war“ [6].
[1] Mommsen, III, S. 522/3.
[2] Mommsen, III, S. 14.
[3] Bücher, a. a. O. S. 9.
[4] Mommsen, II, S. 249.
[5] Mommsen, I, S. 355/6.
[6] Mommsen, II, S. 219.
[451]
Was das zweite typische Aristokratenlaster anlangt, so haben wir für Palästina jene oft zitierte charakteristische Äußerung des Propheten: „Jehova spricht: Darum, daß so hoffärtig sind die Töchter Zions und einhergehen mit gerecktem Halse und frech die Augen werfend hin und hergehen und trippeln und mit ihren Fußspangen klirren, so wird der Herr ihren Scheitel kahl machen und ihre Scham entblößen. An jenem Tag nimmt Jehova weg den Schmuck der Fußspangen und die Netze und die kleinen Monde, die Ohrgehänge, die Armkettchen und die Schleier, die Kopfbunde und die Fußkettchen und die Gürtel und die Riechfläschchen und die Amulette, die Fingerringe und die Nasenringe, die Feierkleider und die Röcke und die Mäntel und die Taschen, die Spiegel und die Hemdchen samt den Turbanen und den Florgewändern.“
Von Rom berichtet Mommsen: „Die Bande der Familie lockerten sich mit grauenvoller Geschwindigkeit. Pestartig griff die Grisetten- und Buhlknabenwirtschaft um sich . . .; die hohe Steuer, die Cato als Zensor auf diese abscheulichste Gattung der Luxussklaven legte, wollte nicht viel bedeuten . . . Die Ehelosigkeit . . . und die Ehescheidungen nahmen natürlich im Verhältnis zu. Im Schöße der vornehmen Familien kamen grauenvolle Verbrechen vor“ [1]. Seneca konnte sagen: „Die Damen Roms zählen ihre Lebensjahre nach der Zahl ihrer Ehegatten“. Dadurch „entstanden die scheußlichen sittlichen Verhältnisse dieser Zeit; die Ehe wird schließlich zum Konkubinat. Hiermit hängt zusammen die fürchterliche Unfruchtbarkeit der Ehen“ [2].
Ein dritter Zug ist die ungeheure Korruption in Geldangelegenheiten, die grauenhafte Bestechlichkeit. Beloch kann sich nicht genug daran tun, das immer wieder für die Hellenen zu betonen ; merkwürdigerweise spricht er die Vermutung aus, daß dieser Zug den Griechen von ihren unhellenischen, hoffentlich sogar unarischen Vorgängern im Lande, mit denen sie sich gemischt hätten, zugekommen sei [3]. Er hat keinen
[1] A. a. O. I, S. 870/71. Vgl. Marquardt (a. a. O.), S. 64, 78.
[2] Francis Galton (Hereditary Genius, S. 331) sagt von Athen: „Die soziale Sittlichkeit wurde ungemein lax, Verheiratung war nicht mehr Mode und wurde vermieden; viele von den ehrgeizigeren und talentvollsten Frauen waren offenkundig Courtisanen und daher unfruchtbar, und die Mütter der zukünftigen Bevölkerung waren von einer heterogenen Klasse“. Ebenso war es in Rom. Lecky sagt: „Die Courtisanen wurden in der öffentlichen Meinung auf eine beispiellose Höhe erhoben, und die Abneigung gegen die Ehe wurde ganz allgemein“ (zitiert nach Benjamin Kidd, Soziale Evolution, S. 269). Mommsen berichtet (a. a. O. II, S. 403): „Selbst ein Mann wie Metellus Macedonicus, der durch seine ehrenwerte Häuslichkeit und durch seine zahlreiche Kinderschar die Bewunderung seiner Zeitgenossen war, schärfte als Censor 623 den Bürgern die Pflicht im Ehestande zu leben in der Art ein, daß er denselben bezeichnete als eine drückende, aber von den Patrioten pflichtmäßig zu übernehmende öffentliche Last“. Vgl. auch Treitschke, Politik I, S. 243.
[3] I, S. 95.
[452]
andern Grund für diese Annahme, als seine eigene persönliche Gleichung, d. h. das in die Untersuchung eingebrachte Vorurteil, daß „wir Arier“ [1] die Edelrasse kat' exochen seien, deren Charakter derartige Gemeinheiten notwendig fremd sein müssen. Sie sind aber leicht genug aus dem Raubcharakter dieser Stadtstaaten und ihrer ganzen Gliederung zu verstehen, wenn man nur eben den Mut zur Unbefangenheit aufbringt. Beloch sagt von Aristeides, er sei als Feldherr wie als Politiker ohne besondere Begabung gewesen und habe seine Stellung im Staate hauptsächlich dem Rufe seiner unerschütterlichen Rechtschaffenheit verdankt, „einer Eigenschaft, die seine Mitbürger um so höher schätzten, je seltener sie bei ihnen zu finden war. In dieser Beziehung stand er hoch über Themistokles, den die öffentliche Meinung in Geldsachen zu allem fähig hielt“ [2].
Über die Athener im allgemeinen fällt Beloch das grimmige Urteil : „Wenn arme Leute auf der Richterbank saßen, lag die Gefahr der Bestechung sehr nahe ; nicht, weil die Armen an sich bestechlicher gewesen wären als die Reichen, sondern weil sie natürlich für eine viel geringere Summe zu haben waren“. Das war der Grund, warum man die Gerichtshöfe mit Hunderten von Geschworenen besetzte [3].
In dem gleichen Stadium der Zersetzung war es in Rom nicht anders oder besser: „Seit dem zweiten mazedonischen Kriege fingen die Römer an, sich auch in dieser Hinsicht zu hellenisieren . . . Man stahl womöglich nicht geradezu ; aber alle krummen Wege, zu schnellem Reichtum zu gelangen, schienen erlaubt: Plünderung und Bettel, Lieferantenbetrug und Spekulantenschwindel, Zins- und Kornwucher [4], selbst die ökonomische Ausnutzung rein sittlicher Verhältnisse, wie der Freundschaft und der Ehe. Vor allem die letztere wurde auf beiden Seiten Gegenstand der Spekulation; Geldheiraten waren gewöhnlich, und es zeigte sich nötig, den Schenkungen, welche sich die Ehegatten untereinander machten, die rechtliche Gültigkeit abzuerkennen“ [5].
Die Skandale verpesteten die Luft. In der Affäre des Jugurtha „waren alle Schäden des Regiments in unverhüllter Nacktheit zutage gekommen; es war jetzt nicht bloß notorisch, sondern sozusagen gerichtlich konstatiert, daß den regierenden Herren in Rom alles feil war, der Friedensvertrag wie das Interzessionsrecht, der Lagerwall und das Leben der Soldaten; der Afrikaner hatte nicht mehr gesagt als die einfache Wahrheit, als er bei seiner Abreise von Rom äußerte,
[1] I, S. 66.
[2] A. a. O. II, S. 31.
[3] A. a. O. II, 1, S. 277. Man war gezwungen, die Steuern zu verpachten, weil die Beamten allzuviel veruntreut hätten (Beloch, III, i. S. 443).
[4] „Wer Geld hatte, wucherte“, sagt Marquardt lakonisch (a. a. O. S. 162).
[5] Mommsen, I, S. 870/1.
[453]
wenn er nur Geld genug hätte, mache er sich anheischig, die Stadt selber zu kaufen. Allein das ganze innere und äußere Regiment dieser Zeit trug den gleichen Stempel teuflischer Erbärmlichkeit“ [1]. In der Tat konnte Mithridates für gutes Geld Großphrygien von den Machthabern kaufen, als das Reich der Attaliden aufgelöst wurde [2]. Als einmal eine Sendung von Fässern voller Gold und Silber auf der Reise nach Rom von Räubern der schwachen Bedeckung abgenommen wurde und spurlos verschwand, munkelte und schmunzelte man in Rom, der Anstifter und Nutznießer des Raubes sei der Konsul selbst mit seinem Stabe gewesen [3]. Das zeigt jedenfalls, was man den höchsten Beamten zutraute. In der Tat waren die wenigen anständigen Männer der Zeit in Rom ebenso sprichwörtlich wie in Hellas ein Aristeides und Thukydides [4]. Paulus „war einer der wenigen Römer jener Zeit, denen man kein Geld bieten konnte“ [5].
Man kann sich schon aus dem Gesagten ein Bild davon machen, wie groß die Gemeinnützigkeit der Gesinnung bei diesen Plutokraten gewesen sein muß. Das Kapital und der Mehrwert über alles! Wenn bei einer der Razzien in dem von Räuberbanden schwer heimgesuchten Sizilien, das durch das römische Raubsystem aus einem lachenden Garten Gottes in eine Wüstenei und Hölle verwandelt worden war, Räuber gefangen wurden, die sämtlich entlaufene Sklaven der großen Latifundienbesitzer waren, so wurden sie „in der Regel von den Behörden ihren Herren zu gutfindender Bestrafung abgegeben. Und diese Herren waren sparsame Leute, welche ihren Hirtenknechten, wenn sie Kleidung begehrten, mit Prügeln antworteten und mit der Frage, ob denn die Reisenden nackt durch das Land zögen. Die Folge solcher Konnivenz war, daß nach Bewältigung des großen Sklavenaufstandes der Konsul alles, was lebend in seine Hände kam, es heißt über 20000 Menschen, ans Kreuz schlagen ließ. Es war freilich nicht länger möglich, das Kapital zu schonen“ [6]. Und so waren denn auch die römischen Kaufleute mit den großen Piratenkapitänen, den bedeutendsten Großhändlern des Sklavenmarktes, Hand und Handschuh [7].
Das Kapital und die bevorrechtete Stellung über alles! Immer wieder hören wir, daß bedrängte Aristokratien den Landesfeind zu
[1] Mommsen, II, S. 156.
[2] Mommsen, II, S. 55. Aristobulos, der Judenfürst, besticht den römischen Beamten mit ca. 1200 Talenten (5 1/2 Million Mark). (Friedländer, Sittengeschichte Roms S. 7).
[3] Mommsen, II, S. 175.
[4] Beloch, a. a. O. II, S. 185.
[5] Mommsen, a. a. O. I, S. 766.
[6] Mommsen, a. a. O. II, S. 79.
[7] Mommsen, a. a. O. II, S. 64.
[454]
Hilfe rufen: so unzählige Male Griechen den Perserkönig, so die etruskischen Herren die Römer (in Arretium 453, in Volsinii 488) [1]. Als Mantineia zerstört wurde, und die Einwohner gezwungen wurden, sich in fünf offenen Gaugemeinden anzusiedeln, da, so berichtet Xenophon, „waren die Bürger anfangs darüber ungehalten; als aber die Vermögenden ... in einer aristokratischen Verfassung leben durften und von den lästigen Volksführern befreit waren, da fanden sie bald Gefallen an dem Geschehenen und zogen unter lakedämonischer Führung freudiger ins Feld denn zuvor“.
Betrachten wir nun den Gegenspieler, das freie Proletariat [2]. Hablos, ohne Halt im Leben, demoralisiert durch das Beispiel der Herren, die die ärgste Prostitution in jedem Sinne des Wortes nach unten hin verbreiten, noch mehr durch das Staatsalmosen [3], den Stimmenkauf und die faule Armut [4], ist es das „klassische“ Vorbild einer folla delinquente. Kein Wort ist stark genug, um den Abgrund seiner Verkommenheit zu schildern.
Die Wurzel aller Übel ist, daß das Volk als berechtigter Teilhaber in die „politische Zunft“ hatte aufgenommen werden müssen. Das heißt, daß die regierende Klasse ihm einen Anteil an dem durch Eroberung und Versklavung geschaffenen Monopol hatte einräumen müssen, auf dem als seiner Existenzbasis der Seestaat durchaus beruhte. Dieser Staat war wie jeder andere ein gewinnbringendes Unternehmen: das politische Mittel in seiner Entfaltung. Das Plebejat verlangte logischcrwcisc, an der Dividende beteiligt zu werden, um so mehr, als es gleichzeitig durch die wirtschaftliche Entwicklung, die wir geschildert haben, nämlich durch die auf der Grundlage jenes Monopols stattfindende „beschränkte Konkurrenz“ [5] immer mehr verarmte
[1] Mommsen, a. a. O. I, S. 337. Die dreißig Tyrannen nahmen eine lakedämonische Besatzung in die Akropolis auf. (Beloch, a. a. O. III, S. 6).
[2] Plato (zitiert bei Pohlenz, a. a. O. S. 77/78) schildert den Bürger jener Zeit in folgender bissiger Form: „Der richtige Demokrat bindet sich nicht an eine bestimmte Tätigkeit, um sie gründlich zu betreiben, sondern folgt jeder Laune. Heute betrinkt er sich und morgen ist er abstinent, bald treibt er gymnastische Übungen, bald Studien, bald gar nichts. Einmal ist er Soldat, ein andermal legt er sich auf Geldgeschäfte, dann wieder spielt er den Politiker, springt auf die Rednerbühne und sagt und tut, was ihm gerade einfällt. Ordnung und Zwang kennt er in seinem Dasein nicht. Das nennt er sein lustiges, freies, seliges Leben. So bringt er alle Tage hin. Und so ist auch die Demokratie selber eine lustige, bunte, jeder Herrschaft ledige Verfassung, die gleiches Recht unterschiedslos an Gleiche und Ungleiche verteilt.“ (Ganz wie Gottfr. Kellers „Leute von Seldwyla“!)
[3] Nach Marquardt waren in späterer Zeit die „Sportulae“ (25 as = ca. 1,30 M.), die der Patronus als Ablösung der früher gebräuchlichen Einladung zur Mahlzeit zahlte, häufig die einzigen Einnahmen (a. a. O. S. 202).
[4] Marquardt (ib. 201) konstatiert das Charakteristikum aller Sklavenwirtschaft, die „entschiedene Abneigung gegen den kleinen ehrlichen Erwerb auch bei den Römern“.
[5] S. S. III, S. 504.
[455]
und kaum noch einen Weg vor sich sah, um sich durch Arbeit anständig zu ernähren, selbst wenn es dieses Mittel hätte wählen wollen, das ja unzweifelhaft das „größere Mittel“ der Bedürfnisbefriedigung gewesen wäre, zu dem der Mensch nun einmal nicht greift.
Wie jede monopolistische Zunft sperrte sich auch das athenische Volk gegen neue Mitzehrer. Während Athen früher mit seinem Bürgerrecht sehr freigebig gewesen war — noch Kleisthenes hatte bei seiner Verfassungsreform vielen Fremden, ja sogar Sklaven und Freigelassenen das Bürgerrecht gegeben — „dachte nach den Perserkriegen die Demokratie exklusiver . . .; war doch das Bürgerrecht zum wertvollen Privileg geworden, das große materielle Vorteile bot, und diese wollte man natürlich mit möglichst wenigen Anwärtern teilen“ [1]. Darum brachte Perikles i. J. 450/1 das Gesetz durch, demzufolge nur noch derjenige als Bürger gelten solle, der von Vater und Mutter her athenischer Bürgersohn sei. Das Gesetz war auch politisch verhängnisvoll, da es die Bildung eines wahrhaften Reiches aus dem athenischen Seebund hinderte; die Bundesgenossen konnten nicht gleichberechtigte Bürger des Großstaates werden, blieben immer Bürger zweiter Klasse, wenn ihre Stellung überhaupt noch als die von Bürgern bezeichnet werden kann. Sie waren damit dazu verurteilt, Objekte der Gesetzgebung und wirtschaftlichen Ausbeutung durch die regierende Bürgerschaft der Hauptstadt zu sein, und das vor allem hat den Untergang der hellenischen Großmächte bewirkt, — denn auch Sparta folgte auf diesem unheilvollen Wege —, während die römische und noch viel mehr die mazedonische Politik in dieser Beziehung klüger und gerechter war [2]. Davon sofort mehr!
Athen hatte namentlich von dem Zeitpunkt an, wo auch die wichtigeren Prozesse aus den Bundesstaaten vor die athenischen Gerichte gezogen wurden, wo also eine sehr große Zahl von Schöffen dauernd in Dienst gehalten werden mußte, angefangen, ihnen Diäten in der Höhe eines ordentlichen Tagelohns zu zahlen : eine notwendige Konsequenz der Demokratisierung des Gerichtswesens, da sonst die ärmeren Klassen von diesem Dienst ausgeschlossen gewesen wären. „Von hier bis zu der Forderung, daß der Staat überhaupt für den Unterhalt seiner Bürger zu sorgen habe, war es nicht mehr weit“ [3]. Zu dem Zwecke
[1] Beloch, a. a. O. II, S. 190.
[2] Fustel de Coulanges in seinem Bestreben, alle Erscheinungen auf primäre religiöse Ursachen zurückzuführen, glaubt, daß das Unvermögen der Hellenen, wirkliche Bundesstaaten mit überall gleichem Bürgerrecht zu schaffen, auf der Verschiedenheit des Kultus beruht habe: die Stadtgötter seien verschieden gewesen, und darum hätten die Stadtfremden nicht in das volle Bürgerrecht aufgenommen werden können (a. a. O. S. 236ff.). Derartige Vorstellungen können auf höherer Stufe die monopolistischen Bestrebungen allenfalls nur verstärkt haben.
[3] Beloch, a. a. O. II. 1, S. 156.
[456]
wurden nicht nur große Bauten ausgeführt, um den Arbeitswilligen Arbeit zu schaffen, sondern es wurden schon unter Perikles öfter Getreidespenden verteilt; aber damit nicht genug: das Volk wollte nicht nur ernährt, sondern auch amüsiert werden. In der gleichen Zeit wurden die öffentlichen Schaustellungen, die schon von den Tyrannen eingeführt worden waren, immer prächtiger und großartiger — und man zahlte auch noch Geldspenden dazu aus. Damit traten die Schaugelder (Theorika) in die Welt: der Krebsschaden der athenischen Finanzen, ein Institut von äußerster Macht der Demoralisation und Zerrüttung [1].
Kaerst sieht die Dinge wirklich mit übertriebenem Optimismus an, wenn er schreibt: „Es ist doch wohl das Größte in Perikles' Staatsleitung, daß er bestrebt war, mit den Mitteln des Staates das Bewußtsein einheitlicher Kultur im athenischen Volk zu wecken und zu stärken. Was anders bedeutet die Gewährung von Schaugeldern an die Bürger als den Versuch, für die souveräne Gewalt des Demos einen inneren Rechtstitel und eine tiefere Grundlage in der geistigen Kulturgemeinschaft ... zu schaffen?“ [2] Gerade so gut könnte man die angeblichen Motive eines Gesetzvorschlages, wie sie in den Zeitungen der interessierten Partei ausgedrückt werden, für die wirklichen Motive halten!
Schon die Gewährung von Diäten für das Schöffenamt hatte die Folge gehabt, „daß ein großer Teil der Bürgerschaft sich der produktiven Arbeit entwöhnte und begann, in dem Richtersolde seine hauptsächlichste Subsistenzquelle zu sehen“ [3]. Später mußte auch für den Besuch der Volksversammlung Geld bezahlt werden, um auch den ärmeren Bürgern ihren Besuch zu ermöglichen [4]. Eine solche Politik konnte natürlich nur so lange fortgesetzt werden, wie das Gemeinwesen siegreich blieb und andere Volkswirtschaften ergiebig ausplündern konnte; wo das nicht mehr anging, mußte das ganze System sofort zusammenbrechen, und es war dann unvermeidlich, daß sich die Ansprüche des verwöhnten und der Arbeit entwöhnten Pöbels gegen ihre eigenen Reichen richteten.
Wenn man sich vollkommen klar macht, daß der antike Seestaat eine politische Zunft war, eine Erwerbsgesellschaft zur Ausbeutung der Sklavenschaft und der unterworfenen Gebiete außerhalb des Stadtbezirks, dann versteht man auch das viel besprochene und bewunderte Staatsbewußtsein dieser Zeit. Die Bürger leben für den Staat, weil sie von dem Staat leben [5]. Demades hat einmal treffend die Schaugelder
1) Beloch, a. a. O. III. 1, S. 343/4 „Sie verschlangen schließlich alle Überschüsse der Verwaltung“. Busolt, a. a. O. S. 171.
[2] A. a. O. S. 25.
[3] Beloch, a. a. O. II. 1, S. 156.
[4] Beloch, a. a. O. III. 1, S. 82.
[5] Vgl. Busolt (a. a. O. S. 4), der die Sklaverei als die notwendige Voraussetzung der Polis erklärt. Historiker und Staatslehrer (z. B. Aristoteles) rechnen den Krieg zu den Erwerbsarten (Pol. I. 3, 8). Der Kriegserwerb stellte für einen Teil der Völker eine regelmäßige Einnahme dar. (Neurath S. 61/62.) (Vgl. a. 67.)
[457]
für den Kitt der Demokratie erklärt1). Daher der Schein der Staatsallmacht [2], daher der glühende Patriotismus, der die guten Zeiten auszeichnet und selbst in schlimmen gelegentlich wieder prächtig durchbricht. Hier ist das ganze wirtschaftliche Leben mit dem politischen so eng und untrennbar verwoben, daß das Bürgerrecht auch gleichzeitig die bürgerliche Existenz einschließt. Darum allein ist der Begriff der „Freiheit“ in der Antike in dieser eigentümlichen Weise ausgeschliffen worden: als das Recht, amtsfähig zu sein und an der Gesetzgebung Anteil zu haben.
Es ist im letzten Grunde kein Unterschied zwischen Sparta auf der einen, und Athen und Rom auf der anderen Seite zu entdecken. Sparta ist nur archaischer in seiner Verfassung; weil es keinen guten Hafen hat, bewahrt es sich die agrarische Grundlage länger, und die von ihm Ausgebeuteten sind vorwiegend hörige Bauern. Athen und Rom sind von dem Zeitpunkt an, wo auch das Plebejat volles Bürgerrecht hat, auch wesentlich Kriegslager, deren Insassen von unterworfener Arbeit und kriegerischer Ausbeutung leben: nur daß die Ausgebeuteten Sklaven sind, die im Inneren des gleichen geographischen Bezirks wohnen, oder zu Tributen mit gewaffneter Hand gezwungene „Bundesgenossen“.
In Rom verlief die Entwicklung in den Hauptlinien ganz gleichartig, nur daß sie auch hier eine Art von schrecklicher Großartigkeit erreichte. Die von ihren vornehmen Herren ganz abhängigen Klienten drangen massenhaft, sei es auf gesetzliche, sei es auf ungesetzliche Art, in die Volksversammlungen ein ; sie dienten dem Herrscherstande dazu, die Komitien zu beherrschen, „und der Ausfall der Wahlen zeigt es
[1] Beloch, a. a. O. III. 1, S. 344.
[2] Einer der Hauptvertreter dieser Ansicht ist Fustel de Coulanges (a. a. O. S. 265ft.). Gegen die Auffassung, die selbstverständlich den Fanatikern der modernen Staatsomnipotenz sehr gelegen kam, ist u. a. Jellinek (Allg. Staatslehre, S. 292ff.) zu Felde gezogen. Es sei nicht wahr, daß der antike Staat dem Individuum überhaupt keine staatsfreie Sphäre gelassen habe. Der Unterschied zwischen dem modernen und dem antiken Individuum bestehe nur darin, daß die Freiheit des letzteren innerhalb der Gesetze vom Staate ausdrücklich anerkannt sei, während sie beim ersteren als schlechthin selbstverständlich nie einen gesetzgeberischen Ausdruck gefunden habe (S. 310). Jener Schein kommt zum Teile daher, daß die Polis auch Kirche ist (300); das griechische Individuum hat den Kampf um seine Emanzipation gegen eine mächtige Kirche ebenso wenig zu kämpfen gehabt wie gegen einen absoluten Monarchen (307). Der Grieche wie auch der Römer waren Rechtssubjekte nicht nur um des Staates, sondern auch um ihrer selbst willen. Jene Stahl-Constant-Mohlsche Lehre von der Nichtanerkennung der individuellen Persönlichkeit möge endlich aus der Literatur verschwinden (310).
[458]
deutlich, welche mächtige Konkurrenz der abhängige Pöbel bereits in dieser Zeit (um 550 der Stadt) dem selbständigen Mittelstand machte“l). Wie ungeheuer die Zahl dieser Hablosen war, kann man aus der Tatsache erkennen, daß die Zahl der öffentlichen Empfänger von freiem Brotkorn zu einer Zeit bis auf 320000 gestiegen war; nach Ausscheidung aller wohlhabenden oder anderweit versorgten Individuen blieben immer noch 150000 auf der Liste [2].
Und wie auch hier die armen Teilhaber der politischen Zunft die Forderung stellten, daß ihr Staat sie zu ernähren habe, so verlangten sie, gleich den Athenern, auch ihr Amüsement. „Die alte Verpflichtung der Beamten, namentlich der Ädilen, für billige Kornpreise zu sorgen und die Spiele zu beaufsichtigen, fing an, in das auszuarten, woraus endlich die entsetzliche Parole des kaiserlichen Stadtpöbels hervorging : Brot umsonst, und ewiges Volksfest (Panem et circenses). Es sei kein Wunder, meint Cato, daß die Bürgerschaft nicht mehr auf guten Rat höre, der Bauch habe eben keine Ohren“ [3]. Schließlich wurde die Ausrichtung einer Volkslustbarkeit zur Qualifikation für die Bekleidung des höchsten Gemeindeamtes; deren Kosten wuchsen in der Konkurrenz ins Unglaubliche, zumal außer dieser quasi gesetzlichen Leistung noch ein Fechterspiel als „freiwillige“ Leistung (munus) zur Übung wurde. „Die Nobilität hatte freilich schwer zu zahlen, — ein anständiges Fechterspiel kostete 720000 Sesterzen (150000 Mark); — allein sie zahlte gern, da sie ja damit den unvermögenden Leuten die politische Laufbahn verschloß“ (a. a. 0.).
Wenig später begann man, wie das um 595 d. St. erlassene Verbot bezeugt, die Stimmen der Wähler geradezu mit Geld zu kaufen. „Vielleicht die schlimmste Folge des dauernden Buhlens der regierenden Aristokratie um die Gunst der Menge war die Unvereinbarkeit dieser Bettler- und Schmeichlerrolle mit derjenigen Stellung, welche der Regierung den Regierten gegenüber von Rechtswegen zukommt. Das Regiment ward dadurch aus einem Segen für das Volk zum Fluch. Man wagte es nicht mehr, über Gut und Blut der Bürger zum Besten des Vaterlandes nach Bedürfnis zu verfügen“ [4]. Man wagte nicht mehr, direkte Steuern zu erheben: seit dem Krieg gegen Perseus ist kein Schoß mehr von der Gemeinde gefordert worden; man ließ das Heerwesen verfallen, weil man nicht den Mut aufbrachte, den Pöbel unter die Waffen zu rufen, vielleicht auch, weil man von seiner Disziplinlosigkeit das schlimmste zu befürchten hatte : Mommsen berichtet über
[1] Mommsen, a. a. O. I, S. 807f. Über die römische Klientel vgl. Marquardt, a. a. O. 196. Über die Freigelassenen S. 161.
[2] Mommsen, a. a. O. III, S. 506.
[3] Mommsen, a. a. O. I, S. 807ft.
[4] Mommsen, a. a. O. II, S. 72.
[459]
eine derartige Meuterei einer hauptsächlich aus großstädtischem Pöbel bestehenden Legionarabteilung, die sich gegen den jüngeren Cato richtete; als dieser bald darauf in einem Gefechte fiel, wurden seine eigenen Offiziere, ob mit Recht oder Unrecht, der Urheberschaft beschuldigt [1]. Damit war die Bahn eröffnet, die zur Anwerbung von immer mehr barbarischen Soldknechten und zuletzt zu ihrer Herrschaft im Staate und zum Ende des Reichs führen mußte [2].
Bei alledem tat das offizielle Rom noch alles, was nötig war, um dieses Lumpenproletariat der Hauptstadt aufs äußerste zu vermehren: „Die Getreideverteilungen luden das gesamte nahrungslose und arbeitslose Bürgerproletariat offiziell ein, seinen Sitz in der Hauptstadt aufzuschlagen. Es war eine arge Saat und die Ernte entsprach ihr“ [3]. „Statt zu arbeiten gaffte der römische Plebejer lieber im Theater; die Schenken und Bordelle hatten solchen Zuspruch, daß die Demagogen ihre Rechnung dabei fanden, vorwiegend die Besitzer derartiger Etablissements in ihr Interesse zu ziehen“ [4]. „Nirgend war man seines Lebens weniger sicher als in der Hauptstadt: der gewerbsmäßig betriebene Banditenmord war das einzige derselben eigene Handwerk; es war nur die Einleitung zur Ermordung, daß das Schlachtopfer nach Rom gelockt ward; niemand wagte sich ohne bewaffnetes Gefolge in die Umgebung der Hauptstadt. Auch die äußere Beschaffenheit derselben entsprach dieser inneren Zerrüttung und schien eine lebendige Satyre auf das aristokratische Regiment“ [5].
In den Provinzen stand es kaum besser. In Sizilien, dem unglücklichsten aller Länder, die unter der Raubwirtschaft des Römerstaates zu leiden hatten, wo „die Übermacht des Kapitals die kleinen Bauern von Haus und Hof gebracht und in die Städte zusammengedrängt hatte, wo sie, ein jammervolles besitz- und erwerbsloses Proletariat, täglich den blendenden Glanz und den trägen Genuß des Reichtums vor Augen hatten“ [6], —- in „Sizilien nahm das Räuberunwesen bald eine Ausdehnung an, die aller obrigkeitlichen Autorität spottete, und gegen welche einfache Polizeimaßregeln nicht mehr genügten. Wer hätte den an Geist und Körper verwilderten Hirten auch wehren sollen ? Ihre gewöhnlichen Aufseher, die Oberhirten, waren selbst Sklaven und fanden es in ihrem Interesse, mit den Untergebenen gemeinsame Sache zu machen . . . Mancher freie Mann, den die Konkurrenz des Kapitals oder selbst gewaltsame Mittel von Haus und Hof gebracht
[1] Mommsen, a. a. O. II, S. 248.
[2] Vgl. Bury, a. a. O. I, S. 38ft.
[3] Mommsen, a. a. O. III, S. 512.
[4] Mommsen, a. a. O. III, S. 522.
[5] Mommsen, a. a. O. III, S. 512.
[6] Bücher, a. a. O. S. 40/1.
[4б0]
hatten, und dem die Billigkeit der Sklavenarbeit eine ehrliche Hantierung als Tagelöhner abschnitt, mochte lieber durch die Beute, die er mit dem Knüttel in der Faust erzielte, sein Leben fristen, als mit Weib und Kind hungern und betteln. Oder sollte er etwa abwarten, bis einer der vornehmen Herren sich seiner Blöße erbarmte, ihn aufgreifen und bei der Sklavenherde eines großen Gutes unterstecken ließ, wo er am Ende in Ketten und unter Schlägen sein früheres Eigentum bebauen mußte ? „Wie Kriegsheere, heißt es bei Diodor, waren die Räuber über die Insel ausgebreitet“ [1].
Die beiden freien Klassen, die Teilhaber des Monopols der politischen Zunft, stehen sich in tückischer Feindschaft und gegenseitiger, wohl verdienter Verachtung gegenüber. Einig sind sie im Grunde nur in einem: in der Verachtung der produktiven Arbeit. Arbeit ist Sklavensache; sie entehrt [2]. Des freien Mannes würdig ist einzig die Politik, und das heißt : Kaufen und Sich-kaufen lassen, oder unter Umständen auch: sich an Plünderungen und Erpressungen Beteiligen. In Solons Verfassung befand sich das Verbot, jemanden seines Gewerbes wegen zu beschimpfen oder zu verachten [3]. In Rom war es nicht anders. „Nirgend wohl ist der Kernsatz des Sklavenstaats, daß der reiche Mann, der von der Tätigkeit seiner Sklaven lebt, notwendig respektabel, der arme Mann, der von seiner Hände Arbeit lebt, notwendig gemein ist, mit so grauenvoller Sicherheit als der unwidersprechliche Grundgedanke des ganzen öffentlichen und privaten Verkehrs anerkannt worden“ [4].
Das ist die Psychologie der beiden freien Stände. Was nun das unfreie Proletariat anlangt, die Sklaven, so waren sie keinesfalls schlimmer als ihre Herren — was ja auch nicht wohl möglich war. Sie scheinen im Gegenteil vielfach tüchtiger gewesen zu sein, als das freie Lumpenproletariat : das beweisen viele Züge der häufigen Sklavenaufstände, in denen sie Disziplin und Bravour zeigten. Des verhängnisvollen Einflusses der Freigelassenen haben wir bereits Erwähnung getan.
[1] Bücher, a. a. O. S. 46.
[2] Das ist überall der Fall, auch in der patriarchalischen Sklavenwirtschaft, und deren schlimmster Zug. Vgl. Ratzel, Völkerkunde I, S. 426 über Madagaskar.
[3] Röscher sagt: „Nicht nur die Sklaven sind faul, sondern auch ihre Herren, zumal in Sklavenländern ganz besonders jede Arbeit für schimpflich gilt. Welch eine Volkswirtschaft, wo die eine Hälfte der Menschen aus Bosheit, die andere aus Hochmut nichts Ordentliches tun mag“ (zit. n. Müller-Lyer, Phasen der Kultur, S. 93, Anm.). Auch in den südstaatlichen Sklavenländern erlagen die Armen, die „poor white“, dieser unwiderstehlichen Psychologie (vgl. Ingram, a. a. O. S. 129 Anm.). Der Neger ist an sich ein fleißiger Bauer: aber „bei aristokratischen, sklavenreichen Negervölkern ist die Arbeit an und für sich bei den Besitzenden verpönt“ (Ratzel, Völkerkunde, II, S. 9). Derselbe berichtet aus Madagaskar, daß die Arbeit der freien Leute durch die Sklaverei in ihrer vollen Entfaltung gehemmt wird (a. a. O. I, S. 423).
[4] Mommsen, a. a. O. III, S. 520/1.
[461]
3. Der Zusammenbruch. ↩
a) Die Politik.
Diese Lagerung der Massen und die durch sie bedingte Psychologie der Massen entscheidet über die Politik dieser Staatsgebilde.
Sprechen wir zuerst von der inneren Politik. Das Lumpenproletariat, der souveräne Pöbel, hat bei jedem Wechsel der Dinge nur zu gewinnen und nichts zu verlieren: er ist daher immer „nach neuen Dingen begehrlich“ : revolutionär. Ferner fühlt er sich natürlich durch jede neue Regierung enttäuscht und betrogen, weil jeder Kandidat und Prätendent ihm vor der Wahl oder der Revolte das goldene Zeitalter versprochen hat, ohne es nachher herbeiführen zu können oder auch nur zu wollen. Dazu kommt der dumpfe Haß, den jeder herabgekommene Stand gegen die Emporgekommenen empfindet, und nicht zuletzt die dumpfe Bosheit eines ganz und gar unnützen Geschlechts verkommener Tagediebe, die überall zum Terrorismus und Anarchismus in seiner bösen Bedeutung neigen. So haben es Demagogen aller Arten : der ehrgeizige Millionär, der politische Schieber, der verschuldete adlige Malkontente, der fanatische Mittelstandsapostel, — so hat es jeder, der den brutalen Instinkten des regierenden Pöbels schmeichelt und seinen Großmachtskitzel kajoliert, leicht, gesetzliche Umwälzungen und gewaltsame Revolutionen, Putsche, politische Morde usw. auszulösen.
Die Träger dieser Politik waren in Hellas wie in Rom die Hetärien oder Klubs, die sich zum ersten Male in Kerkyra zeigten. Bald sollten sie die ganze hellenische Welt verpesten. Thukydides hat uns ihre klassische Schilderung hinterlassen:
„In den Genossenschaften hieß Tollkühnheit: treugesinnter Heldenmut, vorsichtiges Zaudern: verkappte Feigheit, Mäßigung: ein Vorwand der Zaghaftigkeit; . . . aufbrausende Leidenschaft galt als mannhaftes Wesen. . . . Verwandtschaft stand hinter dem Verein zurück; denn dieser ging mit größerer Verwegenheit auf ein selbstsüchtiges Ziel los, ohne Rücksicht auf die bestehenden Gesetze und Einrichtungen. Die Treue befestigten die Hetärien nicht durch göttliche Gesetze, sondern durch gemeinsame Teilnahme an Verbrechen. Verträge und Eidschwüre schloß man in der Not mit dem Stärkeren ab, um im günstigen Augenblicke den Gegner, wenn er im Vertrauen auf den geschlossenen Frieden sich nicht vorsah, desto sicherer niederzuwerfen, was man dem offenen Kampfe vorzog, weil es gefahrloser war und für klüger galt. . . . Ohne Rücksicht auf die Wohlfahrt der Nation oder der Vaterstadt hatten sie nur den Sieg und die Herrschaft der eigenen Partei im Auge, suchten, die Oligarchen mit Hilfe der Spartaner, die Demokraten im Anschluß an Athen, über ihre Widersacher Meister zu werden. Stark durch ihre gegliederte Organisation, durch einträchtiges Handeln nach klaren
[462]
festen Zwecken, durch die Verbindung mit Gesinnungsgenossen anderer Staaten, brachten diese der Leitung geschickter und kühner Vorsteher unterstellten Hetärien allmählich die ganze Staatsgewalt in ihre Hände, so daß eine fieberhafte Aufregung die hellenische Welt durchzog, und im Gerichte, wie bei den Rats- und Volksversammlungen nicht das Recht und Gesamtwohl, sondern das Parteiinteresse den Ausschlag gab. Spione und Sykophanten ohne Ehre und Gewissen bedrohten unaufhörlich die Ruhe, die Sicherheit und das Glück jedes Bürgers, der nicht unbedingt der bestehenden Ordnung ergeben war“ [1].
In Rom war es nicht anders: „Die Politik dieser Zeit ward durchaus beherrscht von dem Koteriewesen in seiner schlimmsten Gestalt. „Es wurde zuerst 690 d. St. „durch gesetzliche Repressivmaßregeln weniger gehemmt als konstatiert. Alle Vornehmen, die popular gesinnten nicht minder wie die eigentliche Oligarchie, taten sich in Hetärien zusammen; die Masse der Bürgerschaft, soweit sie überhaupt an den politischen Vorgängen regelmäßig sich beteiligte, bildete nach den Stimmbezirken gleichfalls geschlossene und fast militärisch organisierte Vereine, die an den Vorstehern der Bezirke, den „Bezirksverteilern“ (divisores tribuum), ihre natürlichen Hauptleute und Mittelmänner fanden. Feil war diesen politischen Klubs alles: die Stimme des Wählers vor allem, aber auch die des Ratsmanns und des Richters, auch die Fäuste, die den Straßenkrawall machten, und die Rottenführer, die ihn lenkten — nur im Tarif unterschieden sich die Assoziationen der Vornehmen und der Geringen. Die Hetärie entschied die Wahlen, die Hetärie beschloß die Anklagen, die Hetärie leitete die Verteidigung; sie gewann den angesehenen Advokaten, sie akkordierte im Notfall mit einem der Spekulanten, die den einträglichen Handel mit Richterstimmen im großen betrieben. Die Hetärie beherrschte durch ihre geschlossenen Banden die Straßen der Hauptstadt und damit nur zu oft den Staat“ [2].
Ein besonders trauriges Kapitel der Innenpolitik ist die Finanzwirtschaft dieser Staaten. Der öffentliche Seckel mußte natürlich durch die täglich anschwellenden Ansprüche der Masse trotz aller Plünderungen immer geleert sein. Eine gesunde Besteuerung konnte man, wie wir schon zeigten, dem regierenden Pöbel nicht zumuten, und die Reichen entzogen sich selbstverständlich nach Kräften jeder Schätzung [3]. Die Steuererhebung in eigene Staatsregie zu nehmen, konnte man ebenfalls nicht wagen, da man damit, wie Beloch sagt, ungeheuerlichen
[1] Zit. n. Georg Weber, Weltgeschichte, II, S. 577. Vgl. Delbrück, a. a. O. S. 283f. Nach Pohlenz (a. a. O. S. 51) brachten die Klubs in Athen 411 die „Vierhundert“ und 404 die „Dreißig“ ans Ruder.
[2] Mommsen, a. a. O. III, S. 7. Man denkt an die entsprechenden modernen Erscheinungen: Camorra, Mafia, Ku-Klux-Clan, Organisation Consul usw.
[3] Mommsen, a. a. O. I, S. 798/9.
[463]
Unterschleifen Tür und Tor geöffnet hätte. Man mußte also die Gefälle, Steuern usw. verpachten und ließ auf diese Weise eine der schlimmsten Plagen aller Zeiten und Staaten auf die Betroffenen los. Die Träger dieses Geschäfts waren in Hellas große Monopolgesellschaften, die „zu einem wahren Krebsschaden der griechischen Finanzen wurden“ [1]. Von Rom sagt Mommsen, „daß der Name des Zöllners den östlichen Völkerschaften gleichbedeutend mit dem des Frevlers und des Räubers ward ; keine Belastung hat so wie diese dazu beigetragen, den römischen Namen besonders im Osten widerwärtig und gehässig zu machen“ [2]. Auch der reiche römische Staat litt oft an solcher Finanznot, daß die Getreideverteilung ins Stocken zu geraten drohte.
Diese traurigen Verhältnisse hatten noch eine besonders traurige Rückwirkung auf die Rechtspflege und durch sie auf die öffentliche Moral. Die chronische Finanznot der meisten griechischen Demokratien führte dahin, „das Defizit im Staatshaushalt durch Konfiskationen zu decken, für die politische Prozesse den Vorwand abgeben mußten. Seit der Zeit des peloponnesischen Krieges wurde es etwas ganz Gewöhnliches, daß der Ankläger die Geschworenen aufforderte, den Angeklagten schuldig zu sprechen, damit aus dem eingezogenen Vermögen der Richtersold bestritten werden könnte, für den sonst keine Mittel vorhanden seien. ,Es ist eine bekannte Sache, sagt ein attischer Redner, daß der Rat, wenn genug Geld in den Kassen ist, das Recht nicht verletzt; wenn der Staat sich aber in Finanznot befindet, dann kann der Rat nicht umhin, Denunziationen entgegenzunehmen, das Vermögen der Bürger zu konfiszieren und den Anträgen der verworfensten Redner Folge zu geben.' Solche Zustände zogen das Sykophantentum groß ... Es war ungefähr dasselbe, was heute die Revolverpresse ist, nur daß die Sache in viel größerem Maßstabe betrieben wurde, und ohne daß der Staat sich ernstlich ins Mittel gelegt hätte. Gewandte Advokaten machten ein Geschäft daraus, von reichen Leuten unter der Bedrohung mit einer Anklage Geld zu erpressen“ [3]. Unter der Regierung der dreißig Tyrannen wurden z. B. unzählige politische Gegner hingerichtet oder zur Flucht gezwungen. Ihr Vermögen wurde natürlich für den Staat eingezogen; „ja, mancher soll bloß wegen seines Reichtums auf die Proskriptionsliste gekommen sein . . . Auch eine Anzahl der reichsten Metöken wurde zum Tode geführt, und ihr Vermögen konfisziert, um die leeren Kassen zu füllen“ [4].
[1] Beloch, a. a. O. III, S. 335.
[2] A. a. O. II, S. 387.
[3] Beloch, a.a.O. II. 1, S. 279. Zuletzt kam es so weit, daß einzelne Städte, namentlich Athen und Theben, in ihrer Finanznot geradezu zum Räuberhandwerk griffen und die Nachbargemeinden ausplünderten (Mommsen, a. a. O. II, S. 42/43).
[4] Beloch, a. a. O. III. 1, S. 7. Mommsen sagt (a. a. O. III, S. 496): „Der Kriminalprozeß kann in keinem Sklavenstaat gesund sein, da das Verfahren gegen Sklaven, wenn nicht rechtlich, doch tatsächlich in der Hand des Herrn liegt.“ Das hatte schon Adam Smith bemerkt (a. a. O. II, S. 96/97): „Überall, wo die unglückselige Sklaverei herrscht, muß die Obrigkeit, wenn sie den Sklaven beschützen will, sich gewissermaßen in die Behandlung des Privateigentums von Seiten seines Herrn einmischen ; und in einem freien Lande, wo dieser Herr vielleicht Mitglied der Kolonialversammlung oder Wähler zu derselben ist, wagt sie nur mit der größten Vorsicht und Behutsamkeit so etwas zu tun . . . erst unter den Kaisern finden wir in der römischen Geschichte ein Einschreiten der Obrigkeit zum Schutze des Sklaven gegen die Gewalttätigkeit seines Herrn.“
[464]
Denselben Charakter trägt auch die Außenpolitik. Sie ist korrupt bis zum äußersten. Die Plutokratie saugt Bundesgenossen, abhängige Völker und Provinzen bis aufs letzte aus: durch die Steuerschraube, die, wir sagten es eben, von den raubsüchtigen Steuerpächtern bis zur Vernichtung der Pflichtigen angezogen wird, ohne daß der Staat allzuviel erhielte, durch ein System schamlosester Erpressung und Bestechlichkeit, das von den leitenden Beamten herunter bis zum kleinsten Polizisten die gesamte Beamtenschaft vergiftet.
Das edle Muster hatten schon die persischen Satrapen gegeben. Sie übten, um den Hof von Susa in seinem orientalischen Sultansluxus nachahmen zu können, „die furchtbarsten Bedrückungen und Erpressungen in Land und Städten aus“ [1]. Die Athener und später die Spartaner folgten ihrem Beispiel. Isokrates schreibt von den Untaten der Provinzgouverneure: „Wer vermöchte zu zählen die Vertreibungen und Aufstände, den Umsturz der Verfassungen und Gesetze, die Frevel an Weibern und Kindern, den Raub des Vermögens“. Und Xenophon wirft den Spartanern vor, daß sie, unter Preisgabe ihrer alten wohltätigen Gesetze, ihr Harmostenamt verewigen, um sich schmeicheln zu lassen und dadurch ihre Sitten verderben. Diese Harmosten, „beschränkte und brutale Krieger, ohne den sittlichen Halt, den nicht der bloße militärische Drill, sondern nur wahre Geistesbildung zu geben vermag, behandelten die Bündner, wie sie es zu Hause mit ihren Heiloten gewohnt waren“ [2].
Im Westen des Mittelmeerbeckens das gleiche traurige Bild. Wenn für solche Dinge ein Vorbild überhaupt nötig wäre, könnten die Römer ihr Verhalten gegenüber den Provinzialen von Karthago gelernt haben. „Das System, die heruntergekommenen Herren auf Kosten der Untertanen wieder zu Vermögen zu bringen, indem sie als Schatzungsbeamte und Fronvögte in die abhängigen Gemeinden ausgesendet werden, dieses unfehlbare Kennzeichen einer verrotteten städtischen Oligarchie fehlt auch in Karthago nicht“ [3].
Wir kennen dieses unheilvolle Raubsystem aus der Anklagerede
[1] Georg Weber, a. a. O. II, S. 405/6.
[2] Beloch, a. a. O. III. 1, S. 5.
[3] Mommsen, a. a. O. I, S. 496/7.
[465]
Ciceros gegen Verres. Mommsen schreibt dazu [1]: „Es war auf die Dauer nicht durchführbar, zugleich Republikaner und König zu sein. Das Landvogtspielen demoralisierte mit furchtbarer Geschwindigkeit den römischen Herrenstand. Hoffahrt und Übermut gegen die Provinzialen lagen so sehr in der Rolle, daß daraus dem einzelnen Beamten kaum ein Vorwurf gemacht werden darf. Aber schon war es selten, und um so seltener, als die Regierung mit Strenge an dem alten Grundsatz festhielt, die Gemeindebeamten nicht zu besolden, daß der Vogt ganz reine Hände aus der Provinz wieder mitbrachte; daß Paullus, der Sieger von Pydna, kein Geld nahm, wird bereits als etwas Besonderes angemerkt . . . Die heillose Regel stellte sich fest, daß bei geringeren Erpressungen und mäßiger Gewalttat der römische Beamte gewissermaßen in seiner Kompetenz und von Rechts wegen straffrei sei, die Beschädigten also zu schweigen hätten, woraus denn die Folgezeit die verhängnisvollen Konsequenzen zu ziehen nicht unterlassen hat“.
Diese Konsequenzen waren nicht nur sozialethisch, sondern vor allem auch politisch von der verderblichsten Art. Sie wurzeln darin, daß die antike Stadtgemeinde eine politische Zunft ist, und gipfeln darin, daß sie außerstande ist, ein wirkliches, standfestes Reich zu begründen.
Die Exklusivität, die alle Monopolisten kennzeichnet, zeigte sich uns bereits in der Sperrung der regierenden Bürgerschaft nach dem Siege der Demokratie, z. B. in Athen: die Metöken hatten vorher recht gute Aussichten gehabt, das volle Bürgerrecht zu erlangen, aber das Gesetz des Perikles von 450/1 beschränkte dieses „im Gegensatz zu den Traditionen einer weitherzigeren Bürgerrechtspolitik, wie sie unter Solon und Kleisthenes befolgt worden war“ [2] auf diejenigen, die von beiden Eltern her Bürgerkinder waren. Damit wurde eine ungeheure Zahl von Stadtinsassen der Mitwirkung an der politischen Entwicklung beraubt: bei Ausbruch des peloponnesischen Krieges betrug die Zahl der Metöken wenigstens 30000 Köpfe [3], und gerade sie waren vielfach die Träger der schaffenden Arbeit und als solche von bedeutender Tüchtigkeit und großem Wohlstande. Ihre Ausschließung bedeutete daher eine sehr empfindliche Schwächung des ökonomischen gegenüber dem politischen Mittel.
[1] Mommsen, a. a. O. I, S. 801/3. Wo Herrschaft besteht, besteht auch diese Art der Ausbeutung. Röscher berichtet (Politik, S. 131), daß die eidgenössischen Republiken ihre sog. gemeinen Herrschaften durch Landvögte regieren ließen, die im kleinen den römischen Prokonsuln vergleichbar sind: „Sie wurden geradesweges mit der Absicht eingesetzt, während ihrer Amtsdauer sich zu bereichern. Daher insbesondere die Bauernkantone ihre Landvogteien förmlich versteigerten: der Meistbietende mochte sich hintennach durch Geldstrafen, Sportein, Verkauf von Begnadigungen usw. schadlos halten.“
[2] Kaerst, a. a. O. S. 45. Vgl. Beloch, II. 1, S. 80.
[3] Beloch, a. a. O., S. 80; vgl. a. ib. III, S. 272, 274, 323.
[466]
Dieses Bestreben, die Vorteile der politischen Ausbeutung auf einen möglichst engen Kreis Vorberechtigter zu verteilen, führte nun erst recht zur Sperrung gegen die Bundesgenossen. Die Ausgleichung der Rechte aller Staatsbürger, die große Leistung des neuzeitlichen absoluten Staates, und damit die Schaffung der Vorbedingung für eine standfeste politische Organisation, konnte von dieser psychologischen Einstellung aus nicht gelingen. „Die größte politische Schöpfung, die das athenische Volk vollbracht hat, das attische Reich des 5. Jahrhunderts, krankt an dem inneren Widerspruch zwischen einem an kühner politischer Initiative reichen Machtstreben und dem abgeschlossenen Charakter der Polis, der Exklusivität des herrschenden Bürgertums gegenüber den stammverwandten Untertanen des Reiches“ [1]. Athen ließ die Institutionen des ersten Seebundes verfallen; schon die Überführung der Bundeskasse von Delos nach Athen, unter dem Vorwande der persischen Gefahr, sprach Bände. Später wurde die Herrschaft des athenischen Staates über die Bündner von seinen Staatsmännern ganz offen als „Tyrannis“ bezeichnet [2]. Auch der zweite Seebund hat trotz der schlimmen Erfahrungen, die man mit dem ersten gemacht hatte, und trotzdem seine Verfassung von vornherein auf größere Gleichheit der Bundesglieder abgestellt war, seinen Zweck nicht erreichen können: die Volksversammlung in Athen erwies sich doch als stärker denn das Synedrion der Bundesgenossen [3].
Als eine besonders gehässige und zerrüttende Maßregel hat sich auch die Einsetzung der athenischen Volksgerichte als oberste Appella tionsinstanz für alle Angelegenheiten der Bundesgenossen erwiesen ; es handelte sich ja nicht um ein aus erlesenen, unabhängig gestellten Juristen zusammengesetztes Reichsgericht, sondern um einfache Schöffengerichte, die schon durch die übergroße Zahl ihrer Mitglieder dazu neigen mußten, alle Charakterzüge der soziologischen „Masse“ [4] anzunehmen, und dazu um Männer, die ihrer ganzen Erziehung nach und nach dem Milieu, in dem sie ihre Richtersprüche abzugeben hatten, nicht die geringste Gewähr für unparteiische Haltung boten.
In Rom war es nicht ganz so arg. War es doch kein reiner Seestaat, hatte es doch schon früh die ganzen politischen Notwendigkeiten einer großen Landmacht zu fühlen bekommen! Dennoch ist auch Rom „in seiner republikanischen Zeit über das stadtstaatliche Fundament seiner Herrschaft nicht völlig hinausgewachsen. Aber es hat doch die abhängigen Gemeinden Italiens in mannichfachen Abstufungen dauernd mit sich verbunden, sie in den Organismus seines eigenen Staates auf-
[1] Kaerst, a. a. O. S. 42.
[2] Ib. S. 75.
[3] Kaerst, a. a. O. S. 132/3. Vgl. G. Weber, a. a. O. II, S. 849.
[4] S. S. I, S. 554ff-
[467]
genommen“ [1]. Doch auch hier siegte immer mehr das Monopol über den staatsmännischen Sinn: „Wie innerhalb der römischen Bürgerschaft der Herrenstand von dem Volke sich absonderte, den öffentlichen Lasten durchgängig sich entzog und die Ehren und Vorteile für sich nahm, so trat die Bürgerschaft ihrerseits der italischen Eidgenossenschaft gegenüber und schloß diese mehr und mehr von dem Mitgenuß der Herrschaft aus, während sie an den gemeinen Lasten doppelten und dreifachen Anteil überkam. Wie die Nobilität gegenüber den Plebejern, so lenkte die Bürgerschaft gegenüber den Mitbürgern zurück in die Abgeschlossenheit des verfallenden Patriziats; das Plebejat, das durch die Liberalität seiner Institutionen groß geworden war, schnürte jetzt sich selbst ein in die starren Satzungen des Junkertums“ [2].
So konnte auch hier kein Reich im modernen Sinne entstehen. Die Dinge lagen im spätrepublikanischen Rom fast so schlimm wie im athenischen und später im spartanischen Bunde: „Man drängte die Molotter in Epirus durch falschen Verdacht zum wirklichen Abfall [3]; die verbündeten Städte wurden, als wären sie erobert, mit Kriegskontributionen belegt, und, wenn sie auf den römischen Senat provozierten, die Bürger hingerichtet oder zu Sklaven verkauft — so in Abdera und ähnlich in Chalkis“ [4].
Wie durchaus unfähig diese Zeit war, den Gedanken des gleichen Rechtes aller Bürger eines nicht auf eine Stadt beschränkten Staates zu fassen, kann man an einem der größten, auch politischen Köpfe aller Zeiten, an Aristoteles, erkennen. „Für ihn ist immer noch die Einzelstadt (polis) mit ihrem Gebiete der Staat; er sieht nicht, wie diese Staatsform sich überlebt hat, wie überall Bundesstaaten entstehen, bei denen die Stadtsouveränetät zugunsten der Zentralgewalt beschränkt wird; er hat kein Auge für das Emporwachsen der mazedonischen Großmacht, der doch seine eigene Vaterstadt Stagiros angehörte, obgleich eben in den Jahren, in denen die „Politik“ ausgearbeitet wurde, ganz Hellas unter der makedonischen Oberherrschaft geeinigt war, und die geeinigte Nation ihre Waffen siegreich nach Asien trug“ [5]. Es kam denn auch trotz aller bösen Erfahrungen nur gelegentlich auf ganz beschränktem Räume zum „Synoikismos“ benachbarter Städte, und auf etwas größerem Räume zu Bundesstaaten [6], die aber immer noch viel zu klein und schwach waren, um sich gegen die großen Mächte, Makedonien und namentlich Rom, behaupten zu können. Makedonien,
[1] Kaerst, a. a. O. S. 47.
[2] Mommsen, a. a. O. I, S. 798/9.
[3] Vgl. Busolt, a. a. O. S. 78.
[4] Mommsen, a. a. O. I, S. 763.
[5] Beloch, III. 1, S. 425. Vgl. a. 516.
[6] Beloch, III. 1, S. 517ff.
[468]
der erste mit seestaatlichen Errungenschaften befruchtete Landstaat der Geschichte, geleitet von einem Könige, dessen private Interessen, wie die aller Monarchen in halbwegs normalen Verhältnissen mit den öffentlichen Interessen parallel gingen, nahm die eroberten Griechenstädte zu gleichen Rechten in seinen Untertanenverband auf, „verband sie dadurch unauflöslich seinem Reiche und verdoppelte dessen Kraft“ [1].
Eine solche Politik war den hellenischen politischen Zünften etwa so wenig möglich wie heute unserer Kapitalistenklasse die freiwillige Einführung eines sozialistischen Systems möglich wäre. Und so mußte sich Hellas mit der geistigen Nationaleinheit begnügen, die sich schon früh an den gemeinsamen Kultfesten in Delphi und Dodona, später in Olympia, entwickelt oder vielleicht erhalten hatte [2].
Was nun die eigentliche Außenpolitik, das Verhalten gegen selbständige Mächte, anlangt, so ist sie ebenso traurig. Sie hat den großartigen Zug eherner Folgerichtigkeit verloren, der ihre frühere Brutalität mit einem geradezu heroischen Schimmer umkleidete, hat die Besonnenheit verloren, die den Beginn, und die rücksichtslos bis zur Selbstopferung durchgreifende Kraft, die den Fortgang und die Beendigung einer Aktion kennzeichneten [3]. Sie ist jetzt ebenso aufbrausend und großsprecherisch in der ersten Leidenschaft wie schwächlich und ohne Nachhalt in der Ausführung, ebenso stark gegen Schwache wie schwach gegen Starke.
Kaerst kennzeichnet diese Art der Politik vortrefflich: „Das Volk, eifersüchtig auf seine Rechte, aber noch eifersüchtiger auf seine Tagegelder, bereit, die durch einzelne unternehmende Feldherren ihm in den Schoß geworfenen Gewinne einzuheimsen, aber nicht fähig und gewillt, die einmal beschlossenen und begonnenen Unternehmungen mit Aufbietung aller Mittel durchzuführen; . . . die Feldherren, zum Teil in merkwürdiger Mischung von Beauftragten des athenischen Volkes und abenteuernden Kondottieren, vor allem bedacht auf ihren eigenen Gewinn und Sicherung ihrer Beute, bisweilen geradezu durch Mangel an Mitteln gezwungen, die Bundesgenossen zu brandschatzen, . . . dies ist im wesentlichen das Bild der athenischen Politik und Kriegführung um die Mitte des 4. Jahrhunderts“ [4], „ein Leben vom Moment und für den Moment, keine über das Bedürfnis des Augenblicks hinausgehenden großen Gedanken und großen Entschlüsse“ [5].
[1] Beloch, III. I, S. 578.
[2] Vgl. Beloch, I. 1, S. 329.
[3] Wie großartig ist es z. B., daß Rom, als Hannibal vor den Toren stand, den Entschluß festhielt, ihn auch in Spanien zu bekämpfen: „Gewiß eine Hauptursache des schließlichen Sieges der Römer!“ (Röscher, a. a. O. S. 391).
[4] A. a. O. S. 134.
[5] A. a. O. S. 207. Vgl. a. S. 229.
[469]
Den gleichen Charakter hatte die Politik Roms in der Spätzeit der Republik, nur, daß sie hier nicht so gefährlich war, weil es keine Großmacht mehr gab, die dem Staatswesen hätte ein Ende machen können. Wenn die halb oder formell unabhängigen Könige der Hinterländer sich nur mit den herrschenden Politikern und Klubleuten gut zu stellen verstanden, und das war nur eine Geldfrage, konnten sie tun, was sie wollten : wir haben gezeigt, daß einem so gefährlichen Gesellen wie Mithridates Großphrygien verschachert wurde. Das mächtige Reich war nicht einmal imstande, die Seepolizei in seinem Heimatbereich, dem Mittelmeere, durchzuführen. Mommsen sagt mit Bitterkeit: „So blieb alles beim alten, die Piratenflotte die einzige ansehnliche Seemacht im Mittelmeere, der Menschenfang das einzige daselbst blühende Gewerbe“ [1]. Freilich waren die großen römischen Plutokraten die besten Geschäftsfreunde und wahrscheinlich oft die Geschäftsteilhaber der Piratenkapitäne und Sklavenjäger.
Solange die faktischen Staatsleiter, die kühl rechnenden Bankiers und Großkaufleute die Fäden fest in der Hand hielten, an denen der souveräne Pöbel hampelte, pflegte noch alles ohne allzu harte Nackenschläge abzulaufen. Wenn aber patriotische Fanatiker oder gewissenlose Demagogen im Dienste innerer Parteipolitik den nervösen, durch Alkohol und Ausschweifungen erhitzten großstädtischen Pflastertreter in siedende Leidenschaft versetzen, wenn sie diese entarteten Enkel durch Hinweis auf die Ruhmestaten der Ahnen zum Größenwahn stacheln, dann kann es in schwächeren Gemeinwesen zu den verhängnisvollsten Entschlüssen kommen [2]. Dann überfällt ein Pöbel von Tarent die römische Flotte mitten im Frieden ; oder die lumpigen Kleinstaatchen von Hellas trotzen den römischen Herren der Welt. Lykortas sagte einst in Gegenwart des Appius Claudius (i. J. 183), Rom habe kein Recht, sich in die Angelegenheiten der Achäer zu mischen; was würden die Römer sagen, wenn die Achäer von ihnen Rechenschaft über die Behandlung der Capuaner fordern würden? Als aber der Römer der Landsgemeinde, welche diese Rede mit großem Beifall begrüßt hatte, kurz bedeutete, sie möchten lieber jetzt freiwillig tun, was sie später gezwungen tun müßten, gab sie klein bei [3]. Aber nicht immer war ein kühler Römer anwesend, und nicht immer siegte die Vernunft über die Leidenschaft. Unter allen möglichen Vorspiegelungen hatte Kritolaos in Korinth das Volk zum Kriege gegen Sparta gehetzt, was den Bruch
[1] A. a. o. II, S. 64.
[2] „Auch Karthagos Fall ist durch die zügellose Unbesonnenheit der Massen wesentlich befördert worden. Vor Zama hätte der große Scipio viel mildere Bedingungen angeboten, auch Hannibal die meisten wohl zugestanden. Aber das Volk, das Letzteren für unüberwindlich hielt, beleidigte die Gesandten“ (Röscher, a. a. O. S. 392).
[3] Weber, Weltgesch. III, S. 511.
[470]
mit Rom bedeutete. „Wir wollen die Römer als Freunde, nicht als Herren“, die Worte wurden von der Volksmenge, einer echten „Masse“ im soziologischen Sinne, mit rasendem Beifall aufgenommen. „Mit Furcht und Zagen fügte sich die eingeschüchterte Minderheit der Wohlhabenden diesen Beschlüssen“ [1]. Jetzt hieß es: mitgefangen, mitgehangen! Ein Jahr später war Korinth nur noch ein Schutthügel. Wenn Athen trotz unendlicher Dummdreistigkeit diesem äußersten Schicksal entging, so verdankte es die Schonung weniger seinem alten Ruhme als Musensitz und „Universitätsstadt“ [2] — das mag für Philipp und Alexander mit bestimmend gewesen sein [3], die wie alle Kondottieri aller Zeiten durch die Pflege von Kunst und Wissenschaft erst eine Legitimität zu begründen und, vor allem, sich als echtblütige Hellenen zu erweisen hatten, — sondern vorwiegend der Tatsache, daß Athen zur Römerzeit keine überragende Bedeutung als Handelsstadt mehr hatte [4]. Sonst hätten die römischen Equités, die Bankokratie, gewiß sich nicht abhalten lassen, ihm das gleiche furchtbare Schicksal zu bereiten wie den beiden großen Konkurrenten Korinth und Karthago. Wären nichts als diese Tatsachen allein erhalten, so könnte ein historischer Kopf sofort erkennen, daß im Jahre 146 v. Chr. die Plutokratie das Römer reich beherrschte [5].
b) Die Kuliur.
In solchem Sumpfe kann nichts Gesundes wachsen. Mit dem öffentlichen Wesen verfällt die Kultur.
Solange das ökonomische das politische Mittel zurückgedrängt hatte, waren in diesen ersten wahrhaften Bürgergemeinden der bisherigen Geschichte Wissenschaft, Philosophie und Kunst in berauschendem Wachstum erblüht, wie nie zuvor auf der Erde. Mit dem gerechten Tausch an Stelle der gewaltsamen Beraubung, mit der Freiheit an Stelle der Knechtschaft, mit dem Rechte an Stelle der Gewalt, mit der Herstellung einer einigermaßen vernunftgemäßen Gleichheit in der Lebenshaltung ersteht jene herrliche Blüte, die wir noch heute neidvoll bewundern. Daß diese Deutung richtig ist, ergibt sich einerseits aus der
[1] Weber, Weltgesch. III, S. 527.
[2] Beloch, a. a. O. III. 1, S. 436.
[3] Kaerst, a. a. O. S. 265, 324. Vielleicht auch noch für Alarich (Bury a.a.O. S. 119).
[4] Vgl. Mommsen, Römische Geschichte, Bd. V, S. 255. „Zu Augustus Zeit war der Peiraeus ein geringes Dorf von wenigen Häusern, nur besucht wegen der Meisterwerke der Malerei in den Tempelhallen. Handel und Industrie gab es in Athen fast nicht mehr, oder für die Bürgerschaft insgemein wie für den einzelnen Bürger nur ein einziges blühendes Gewerbe, den Bettel“.
[5] Vgl. Delbrück, a. a. O. I, S. 451/2. „Es war der krasse Handelsneid der römischen Kaufmannschaft, der zu der Untat antrieb.“
[471]
Tatsache, daß alle Staaten von Hellas, die sich den Gewerben verschlossen: Sparta, Thessalien, auch Böotien, in dieser Beziehung „tote Glieder am Körper der Nation blieben“ [1]: die starre Adelsherrschaft, die Leibeigenschaft der ackerbauenden Klasse hinderten jeden höheren Aufschwung des Landes. Ähnliches gilt von Rom, das ja, wie wir mehrfach betont haben, den Landstaaten näher steht ; seine einzige originäre Schöpfung ist sein Recht : die Notwendigkeit einer ausgedehnten Geld Wirtschaft, die doch nicht eigentlich Produktivwirtschaft ist. Der zweite Beweis liegt darin, daß die wenigen, ihrer Kulturhöhe nach mit der Perikleischen Zeit vergleichbaren Perioden: die italische Renaissance und die große Stadtkultur des ausgehenden deutschen Mittelalters, ganz ähnliche Lagerung der Klassen und einen ganz analogen Fortschritt des ökonomischen gegen das politische Mittel aufweisen. Man darf sich nur nicht dadurch täuschen lassen, daß der wahren Blüte eine kurze Scheinblüte zu folgen pflegt, in der die alte Kraft und die alte Technik noch weiter wirken, etwa wie ein Fruchtbaum noch die herrlichsten Früchte tragen kann, wenn schon der Wurm an seinen Wurzeln nagt. So scheint es, als wäre die Blüte den „Mäzenen“ zu danken, den Fürsten, Kondottieri, Plutokraten usw. Aber sie lesen nur die letzte Ernte. In Wahrheit verdorrt unter ihren Händen, unter dem Pesthauch der wiedergekehrten Gewalt, alles, was sie berührt.
Solange die große, ihrer, Leistungen und ihrer Geschichte stolze Bürgergemeinde die Auftraggeberin der Künstler ist, d. h. solange Götterbilder, Rathäuser, Tempel, öffentliche Brunnen bestellt werden, solange ein Publikum von Bürgern im guten Sinne des Wortes die Reihen des Theaters füllt: solange ist große stilreine Kunst möglich. Solange allein stellen sich auch Wissenschaft und Philosophie die großen, die wirklichen Probleme. Wenn aber die Gemeinde verarmt, und an ihrer Stelle reiche Privatiers die Auftraggeber der Kunst sind, dann werden statt der Tempel Lusthäuser auf dem Lande, statt der Rathäuser Paläste in der Stadt, statt der Götterbilder laszive Gemälde, statt der Brunnen köstliche Ziergeräte bestellt; und mag auch der gebildete Geschmack der guten Zeit noch eine Weile die Künstlerschaft und sogar die Oberklasse beherrschen: allmählich kommt der Verfall doch. Eine völlig perverse „leisure class“ kauft schließlich doch nur Werke einer perversen Kunst; und auch die Künstler selbst können sich auf die Dauer der Wirkung der vergifteten Atmosphäre nicht entziehen. Ebenso muß das Drama entarten, wenn es die erschlafften Sinne eines Pöbels reizen soll, der durch die tägliche Kost der chronique scandaleuse übersättigt und vom Gericht und der Volksversammlung her an die allerschärfste Brühe gewöhnt ist. Und wie könnte in Zeiten,
[1] Beloch, a. a. O. I. i, S. 340.
[472]
wo alles nur dem Mammon Untertan ist, noch Wissenschaft und Philosophie gedeihen? Sie sind der Ausdruck einer Gemeinschaft: hier aber existiert keine Gemeinschaft mehr, sondern „die Völker sind zerspalten in zwei Völker, die sich gegenseitig nach dem Leben trachten“, wie Piaton bitter sagte [1]. Der entfesselte Individualismus des aus allen sozialen Bindungen gelösten, an allem Recht und aller Sittlichkeit verzweifelnden Menschen, der die freche Bosheit überall siegen, und die Tugend überall erliegen sieht, muß sich notwendig philosophisch in böser Sophistik oder weltfremder Utopistik, muß sich wissenschaftlich ebenso notwendig in ödem Spezialistentum auswachsen.
Beloch sagt von den griechischen Dramatikern des 4. Jahrhunderts: „Auf ihnen allen lastet der Fluch des Epigonentums“; und er zitiert einen Dichter der Zeit: „Die Flur der Musen ist abgeweidet“ [2]. Von der bildenden Kunst gilt das gleiche: „Man zehrte von den Errungenschaften der vorhergehenden Periode“ [3]. Demosthenes weist in einer seiner Reden auf den auffälligen Gegensatz der privaten und öffentlichen Gebäude in der alten und in der neuen Zeit hin. Damals wohnten, sagt er, die großen Männer, ein Aristeides, ein Themistokles, in den einfachsten Häuschen; man könne sie heut noch sehen. Aber dafür waren die Bauten der Stadt von überwältigender Größe und Schönheit. Jetzt sei es leider umgekehrt [4]. Mommsen stellt die gleiche charakteristische Erscheinung für Rom fest [5]. Die Privatgebäude werden immer prunkhafter, aber „das Staatsbauwesen stockte in der Geldklemme der letzten Zeit der Republik so gut wie ganz“ [6]. Und, was die übrige Kunst anlangt, so rechnet er „diese hellenistische Literatur des 6. Jahrhunderts (der Stadt), jene handwerksmäßige, jeder eigenen Produktivität bare Poesie, jene durchgängige Nachahmung eben der flachsten Kunstgattungen des Auslandes, jenes Übersetzungsrepertoire, jenen Wechselbalg von Epos, zu den Krankheitssymptomen dieser Epoche“ [7].
Die Sehnsucht der Zeit ergoß sich in Okkultismus, Mystizismus und sozialistische Utopien. Wie sehr das Sektenwesen blühte, wie reichliche Anhänger alle, auch die abgeschmacktesten orientalischen Kulte fanden, ist allzu bekannt, als daß wir hier näher darauf eingehen müßten. Taine schreibt einmal [8], man glaube sich, wenn man die sektirerischen Schriften jener Zeit lese, in ein Hospital versetzt, unter
[1] Politela S. 115, 270.
[2] A. a. O. III. 1, S. 364.
[3] A. a. O. III. 1, S. 368.
[4] Vgl. Beloch II, S. 209, III, S. 373.
[5] Mommsen, a. a. O. I, S. 938.
[6] A. a. O. III, S. 627.
[7] Ib. I, S. 931/2.
[8] Zit. nach Adler, Gesch. d. Soz., S. 71.
[473]
Halluzinierte, die mit glänzenden Augen ins Leere starren. Das ging bis ins Heer. Als Scipio (620 d. S.) das tief zerrüttete Heer zu reorganisieren hatte, mußte er zunächst den ungeheuren Troß, darunter an zweitausend Dirnen „und eine Unzahl von Wahrsagern und Pfaffen aller Sorten“ aus dem Lager treiben [1]. In dieser heillosen Welt suchte der Mensch, der nun einmal von Natur kein Sumpfgewächs ist, das Heil in irgendeinem Jenseits, einem himmlischen oder irdischen, in einer Religion oder einer Utopie. Kein Geringerer als der große Piaton stellte seine Sehnsucht nach einem reinlichen und menschenwürdigen Leben in zwei Idealstaaten, der „Politeia“ und den „Gesetzen“, dar; ihm folgten in Ernst und Scherz Unzählige; die Staatsromane wuchsen wild wie in der fast ebenso heillos zerrütteten Gesellschaft des ancien régime [2]. Und es ist freilich kennzeichnend für den trotz großer äußerer Ähnlichkeiten, die der Genosse dieser schweren Zeit mit Erschauern selbst erkannt haben wird, entscheidenden Unterschied zwischen jenem antiken und unserem modernen Kapitalismus, daß sein Schattenwurf, der Sozialismus, im Altertum immer mehr „von der Wissenschaft zur Utopie“ fortschritt, in unserer Zeit aber von der Utopie zur Wissenschaft.
In reinen Bauernländern freilich, wo jedem klarblickenden Auge die Ursache des Unheils offen lag, die das durch den Industriezentrismus geblendete Auge der heutigen Wissenschaft ebensowenig zu erkennen vermag, wie im Altertum der städtische Denker Piaton, forderte man schlicht und einfach das, was die russischen Bauern der Zarenzeit die „weiße Teilung“ genannt haben: die Aufteilung der Großgüter an die gesamte arbeitende Bevölkerung [3]. „Praktisch wurden diese kommunistischen Gedanken nur zweimal, in Sparta durch Agis und Kleomenes, und in Ätolien durch Skopas und Dorimachos. Der letztere Versuch
[1] Mommsen, a. a. O. II, S. 16.
[2] Vgl. Julius Beloch, Sozialismus und Kommunismus im Altertum (Ztschr. f. Soz. Wiss. IV (1901), S. 360): „Nur die soziale Utopie im Gewände der Dichtung hat die kommunistische Gesellschaftsordnung ausgemalt. Sie tritt uns zuerst entgegen in der attischen Komödie, namentlich in den Ekklesiazusen des Aristophanes, dann in den sozialen Romanen, wieder „heiligen Chronik“ des Euhemeros und namentlich dem „Sonnenstaat“ des Iambulos. Hier finden sich in der Hauptsache schon die Ideale unseres heutigen Sozialismus ausgesprochen. Es mag sein, daß der Roman des Iambulos das Vorbild gewesen ist, nach dem Aristonikos, der Prätendent auf den Thron von Pergamon nach dem Erlöschen des dortigen Herrscherhauses, seinen „Sonnenstaat“ einrichten wollte (um 130 v. Chr.) ; aber die römischen Legionen haben diesem Versuche bald ein blutiges Ende bereitet, und sonst hat, soviel wir sehen, keiner jener Romane eine politische Wirkung gehabt“.
[3] b τηι yijs αναδασμοί. Vgl. Pohlenz, a. a. O. S. 21, 59· Ρ· nennt das „Schlagworte“ und freut sich des griechischen „Wirklichkeitssinnes“, der sich derartiges nur „im MärchenJande gefallen ließ“ (59). Mit größerem Verständnis v. Poehlmann, a. a. O. I, S. 193ff.
[474]
scheiterte gleich im Beginn . . . Sparta schien durch die Schuldentilgung, die gewaltsame Einziehung und Neuverteilung des Grundbesitzes an eine durch Periöken vermehrte Bürgerschaft neu aufzublühen“ [1]. Aber ein Ausbruch wilden Kommunismus etwa nach Art der ersten bolschewistischen Anfänge, die Ermordung der Reichen, und eine ungeregelte Verteilung ihres Besitzes an den Pöbel, hat in Griechenland oft stattgefunden. So z. B. in Samos im Jahre 412 [2], so in Epidamnos (Durazzo) [3], in Kerkyra [4], in Pergamos [5]. In Leontinoi wurde 423 der Beschluß gefaßt, das gesamte Grundeigentum an alle Bürger aufzuteilen. Die Besitzenden holten sich Hilfe aus Syrakus, vertrieben die Reformer auf die Dauer und siedelten selbst nach Syrakus über, dem ihr Stadtgebiet zugeschlagen wurde [6]. Man sieht, daß damals die Plutokratie völlig ohne die Arbeit des freien Proletariats auslangen konnte: heute würde sich eine Kapitalistenklasse selbst ruinieren, die ihre Arbeiter austreiben wollte. Aber damals waren die Arbeiter eben Sklaven, und die Herren von Leontinoi nahmen nur die Unbequemlichkeit auf sich, etwas weiter von ihren Gütern zu wohnen. Der letzte große Pöbelaufstand mit anarchistisch-kommunistischem Grundton war die Revolution des „Wüterichs Nabis (206/192), der in Sparta und Argos die Reichen tötete, die Heiligtümer plünderte und Häuser, Äcker, Frauen und Kinder der Ermordeten an die zur Freiheit aufgerufenen Heiloten und ein aus allen Enden der Welt zusammengelaufenes Gesindel verteilte“ [7]. In dieser ganzen Zeit „hing die Möglichkeit einer Konfiskation ihres Eigentums beständig wie ein Damoklesschwert über den Häuptern der Besitzenden“ [8].
Beloch hält es nicht für unmöglich, daß bei den Vorgängen in Leontinoi, und vielleicht anderwärts ebenfalls, die Diskussionen über sozialistische Probleme, die damals alle Welt beschäftigten, verursachend mitgewirkt haben. „War die Gleichheit der politischen Rechte aller
[1] Vgl. Bücher, a. a. O. S. 89 ff.
[2] Beloch, a. a. O. II. 1, S. 280.
[3] Beloch, a. a. O. II. 1, S. 287.
[4] Ib. S. 321.
[5] Vgl. Bücher, Aufstände d. unfr. Arbeiter, S. 105. „Aristonikus bemächtigte sich der Bewegung, verhieß allen Sklaven, welche sich ihm anschließen würden, die Freiheit und sammelte zugleich große Scharen verarmter Freien um sich. Seinen Anhängern versprach er die Gründung eines neuen, auf Gleichheit und Freiheit Aller gegründeten Staates, dessen Bürger er „Sonnenstädter“ nannte“. Vgl. das oben über Arkesilaos von Kyrene Gesagte.
[6] Beloch II, S. 280, S. 355.
[7] Bücher, a. a. O. S. 91.
[8] Beloch, a. a. O. S. 280. Ähnliche Umwälzungen haben vielleicht viel früher in Ägypten und Sinear stattgefunden. (Vgl. Delbrück, a. a. O. S. 48ft., S. 75.)
[475]
Bürger einmal verfassungsmäßig anerkannt, war es dann nicht eine logische Konsequenz dieses Grundsatzes, daß alle Bürger auch an Besitz gleich sein sollten?“ Zumal ja nichts klarer sein kann, als das Gesetz, das so viele Jahrhunderte später in ähnlich böser heilloser Zeit Rousseau formulierte: daß kein Staatswesen Standfestigkeit haben kann, in dem einige reich genug sind, um andere kaufen zu können, und andere arm genug, um sich verkaufen zu müssen. Schon Phaleas von Chalkedon hat den Satz aufgestellt, daß Gleichheit des Vermögens unter den Bürgern unerläßlich ist, und Aristoteles, der ihn zitiert, billigt den Satz [1], wie ihn sein großer Meister Piaton gebilligt hatte. Von hier aber gab es, wie zur Zeit Baboeufs und Lenins, keinen anderen Weg als zum Kommunismus: solange man, industriezentrisch geblendet, an die Wahrheit des „Gesetzes der ursprünglichen Akkumulation“ glaubte.
In den Agrarstaaten, wo die Unfreiheit wesentlich in Leibeigenschaft bestand, hätte eine Neuverteilung des Grundeigentums nicht nur vorübergehend, wie Bücher (an der zuletzt zitierten Stelle) meint, sondern dauernd die Sozialkrankheit heilen und die Gesellschaft retten können [2]. In den Industriestaaten aber hätte man den Urgrund aller Übel, die Sklaverei, aufheben müssen. Diese Notwendigkeit wurde denn auch von einzelnen weiterblickenden Männern erkannt, wie wir oben dargestellt haben: aber praktisch war sie in diesem Gemeinwesen nicht durchzuführen. Wo aber das verderbliche Institut bestand, war die Gesellschaft in einen „Hexenkreis“ gebannt, aus dem es kein Entrinnen gab. Sie mußte gnadenlos an ihrer Erbsünde, dem politischen Mittel in seiner krassesten Gestalt, zugrundegehen.
c) Der Hexenkreis.
Die Sklaverei war nämlich einer der Gründe, aus denen es unmöglich war, eine Verfassungsänderung herbeizuführen, die dem so durchaus regierungsunfähigen, und dabei doch so überaus gefährlichen Pöbel die Macht entwunden hätte.
Der erste dieser Gründe ist, daß vor der Ausbildung des stehenden Heeres nirgend eine Macht existierte, um eine solche Revolution der Verfassung durchzusetzen, gegen die der Pöbel nicht nur aus seinem Souveränetäts-Größenwahn heraus, sondern mit der ganzen verzweifelten Kraft gekämpft hätte, die ein in der Wurzel seiner ökonomischen Existenz bedrohter Stand aufbringt. Ist doch seine Souveränetät der Rechtstitel, kraft dessen er sein ganzes Einkommen, seinen Anteil an
[1] Laveleye, Das Ureigentum, S. 343.
[2] Auch Delbrück (a. a. O. S. 571) sieht „in den Kolonisationen nicht eine große soziale Reform, sondern nur ein, allerdings unter Umständen sehr wirksames Linderungsmittel“. Vgl. a. 470.
[476]
dem nutzbaren Klassenmonopol, die Dividende der politischen Zunft, bezieht. Wird ihm das genommen, so bleibt ihm in diesem Staatswesen, in dem die freie Arbeit keinen Platz hat, nur der Hungertod oder die Sklaverei.
Wo aber etwa die Aristokratie es versucht, mit Hilfe fremder Soldtruppen die Verfassungsänderung durchzusetzen, da beschwört sie einen Sturm herauf, der fast mit absoluter Sicherheit den Zusammenbruch auch ihrer eigenen Existenz herbeiführen muß. Denn unterhalb des freien Lumpenproletariats besteht noch eine starke, häufig die stärkste Schicht der Bevölkerung, die Sklavenschaft. Walion schätzt für Lakedämon die Zahl der Heloten auf 220000, die der Spartaner auf 32000 [1]; Blair, der Verfasser der „Sklaverei bei den Römern“, schätzt die Zahl der Sklaven in Rom für die Zeit zwischen der Eroberung Griechenlands (146 v. Chr.) und der Herrschaft des Alexander Severus auf das Dreifache der freien Bevölkerung : es wären auf rund 7 Millionen Freie rund 21 Millionen Sklaven gekommen [2]. Der einzige Freigelassene Cäcilius hinterließ nach Plinius letztwillig 4116 Sklaven [3].
Es handelte sich hier vorwiegend um Männer im besten Lebensalter und um durch schwere Arbeit gehärtete und zum äußersten entschlossene Gesellen, die denn auch in jedem Konflikt sehr leicht geneigt waren, gegen ihre Herren aufzustehen. Wir finden sie in den zahllosen städtischen Revolutionen fast immer auf der Seite der armen Klassen, die sie zum Kampfe und zur Freiheit aufriefen, wie wir umgekehrt in den häufigen Sklavenaufständen das niedere Landvolk mindestens in wohlwollender Neutralität gegenüber den Sklavenscharen finden; so z. B. in dem gewaltigen Aufstand der sizilischen Sklaven; das Feldgeschrei der unfreien Knechte war schon damals: Krieg den Palästen, Friede den Hütten! Es war ein Verhältnis, vergleichbar etwa dem zwischen Kleinbauernschaft und Räubertum in der verrotteten Adelswirtschaft des neuzeitlichen Süditalien und des Kirchenstaates. In jeder politischen Krise drohte den Besitzenden nicht nur der Verlust ihres Kapitals durch massenhaftes Entlaufen der Sklaven, — das war einer der Gründe, warum sich kein eigentlicher Großkapitalismus im technischen Sinne ausbilden konnte —, sondern auch die Verstärkung der Gegner durch Massen halbwilder, in wütender Rachsucht fechtender Kämpfer. Während der Besetzung Attikas durch die Spartaner im
[1] Ingram, a a. O. S. 24. Vgl. über Wallon Beloch, Die Bevölkerung der griechischrömischen Welt, S. 36.
[2] Ingram, a. a. O. S. 30. Das ist nach Beloch (a. a. O. S. 4i3ff.) ungeheuerlich übertrieben. Er schätzt für 28 v. Chr. die italische Sklavenschaft auf höchstens zwei Millionen Köpfe.
[3] Ingram, a. a. O. S. 29. Nikias hatte nach Xenophon 1000 Sklaven (Pohlenz, S. 72). Es fanden sich aber in Rom Sklavenherden von 10000 und 20000 Köpfen (Marquardt, S. 156), die in Fesseln und oft, wie das Vieh, gebrandmarkt arbeiteten (ib. S. 177).
[477]
Anfang des peloponnesischen Krieges sollen an 20000 Sklaven entlaufen sein [1]. Bei der Belagerung von Chios durch die Athener (411) liefen ebenfalls die Sklaven in Massen zum Feinde über [2] : und so wird es vielfach geschehen sein. Ebenso im römischen Reiche ; von den zahlreichen Sklavenaufständen, die zuweilen nicht durch die in der Provinz stehenden prokonsularischen Truppen niedergeworfen werden konnten, sondern das Eingreifen der konsularischen Hauptmacht und außerdem noch die Beiziehung des „mit Gold beladenen Esels“ erforderten, dem sich nach dem berühmten Worte alle Tore öffnen, haben wir schon mehrfach gesprochen [3].
Man wußte in Rom, was man von den Sklaven zu erwarten hatte. Ein Sprichwort sagte: „So viel Sklaven, so viel Feinde“. „Es war ein ökonomischer Grundsatz, Spaltungen innerhalb der Sklavenschaft eher zu hegen als zu unterdrücken; in demselben Sinne warnten schon Piaton und Aristoteles und nicht minder das Orakel der Ackerwirte, der Karthager Mago, davor, Sklaven gleicher Nationalität zusammenzubringen, um nicht landsmannschaftliche Verbindungen und vielleicht Komplotte herbeizuführen“ [4]. So zog man sich sehenden Auges den Feind im Inneren des eigenen Staates heran; und es ist ja bekannt, wie sehr diese Sklavenbevölkerung dazu beigetragen hat, den militärischen Zusammenbruch des späteren Kaisertums zu vollenden, der schon durch die Heranziehung der Grenzbarbaren zu Solddiensten weit vorbereitet war [5]. Den ins Reich „einfallenden Goten schlössen sich jene Goten an, die von den Römern gefangen oder gekauft worden waren. Die gallischen Sklaven beteiligten sich fast vollzählig an dem Aufruhr der Bagauden, und bei der Belagerung Roms durch Alarich schlössen sich diesem vierzigtausend Sklaven an“ [6].
Ähnlich verhielt sich, wie wir schon einmal hervorhoben, die Sklavenschaft in denjenigen römischen Provinzen, die der Islam überrannte, zumal dieser anfangs allen Sklaven die Freiheit zusicherte, die zu Moslemim wurden. Nur auf diese Weise kann man es überhaupt verstehen, daß verhältnismäßig geringe Heere das mächtige römische Reich erobern konnten. Theodorich hatte zeitweilig nicht mehr als 6000 Krieger unter sich [7] ! Mohameds Lehre war die Schneeflocke, die über einen mäßigen Hang ballenden Schnees herabrollt und all-
[1] Beloch, Griech- Gesch. III, 1, S. 273, II, S. 367. Busolt, a. a. O. S. 194. Vgl. dazu Delbrück, a. a. O. S. 244, dem die Ziffer auch verdächtig ist.
[2] Beloch, a. a. O. II. 1, S. 380.
[3] Mommsen, a. a. O. III, S. 82/3. Bücher, Aufstände der unfr. Arbeiter.
[4] Mommsen, a. a. O. I, S. 832/3.
[5] Vgl. Bury, a. a. O. S. 38ff.
[6] Ingram, a. a. O. S. 36/7. Bury, a. a. O. S. 177, sagt, A's Heer sei durch diesen Zuwachs auf 40000 Mann gebracht worden.
[7] Röscher, Politik, S. 49.
[478]
mählich zur kleinen Lawine wird. Endete der Hang unten in eine flache Mulde, so zerstäubte sie machtlos. Er endete aber in eine steile Wand, auf der ungemessene Schneemassen gerade noch hafteten; diese warf sie durch ihren Anprall aus dem Gleichgewicht, und nun donnerte die Verheerung zu Tal [1].
Geradeso mußte jeder ernsthafte Zusammenstoß zwischen der Plutokratie und dem Pöbel diese gefährlichen Massen mobilisieren, und das war der Anfang vom Ende, wo es versucht wurde. Aber der Haß auf beiden Seiten mußte schon bis zur letzten Verblendung gestiegen sein, wenn es versucht wurde. Auch hier wieder kommen wir nur dann zum vollen Verständnis der Geschehnisse, wenn wir daran denken, daß die beiden freien Stände, trotz aller Verachtung von oben und aller dumpfen Empörung von unten, Verbündete sind, Anteilhaber desgleichen nutzbaren Klassenmonopols, Mitglieder der gleich en „politischen Zunft“ [2]. Sie sind, wenn auch in sehr ungleichem Maße, die gemeinsamen Nutznießer kraft des politischen Mittels an demjenigen Ertrage, den das ökonomische Mittel abwirft. Die plutokratische Nobilität braucht den freien Pöbel, um die Sklavenschaft niederzuhalten, und kann daher an eine Verfassungsänderung kaum denken, solange sie noch irgendein Mittel sieht, um jenen zu füttern und zu amüsieren. Denn sich auf ein Soldheer zu stützen, ist allzu teuer und vor allem allzu gefährlich. Nichts ist wahrscheinlicher, als daß sein Führer sich mit dem Pöbel vereinigen und auf Kosten der Reichen seinen Frieden schließen wird. So „bezeichnet der Heilige Krieg (356 oder 355) vor allem einen Versuch des auf sich selbst gestellten, Staats- und vaterlandslosen Söldnertums, die ausschlaggebende Macht in Griechenland zu werden“ [3]. Und schon lange vorher hatte Hellas die Tendenz der Kondottieri jener Zeit bemerken können, sich zu fürstlicher Stellung zu erheben [4]. Machiavelli, der seine politische Weisheit nicht weniger aus dem Studium der Alten erworben hatte als aus seiner Erfahrung als Staatsmann, schrieb in seinem „Principe“: „Wenn du deinen Thron auf Söldner stützest, wird er nie fest und sicher stehn; denn sie sind zwieträchtig, ehrgeizig, ohne Kriegszucht, stark gegen die Freunde, feig gegen den Feind; sie haben keine Furcht vor Gott, keine Treue gegen die Menschen; dein Sturz verzögert sich nur so lange, als sich ein Angriff verzögert; im Frieden wirst du durch sie, im Kriege durch die Feinde geplündert“.
Wenn man also nicht den Teufel durch Beelzebub vertreiben wollte, so konnte der Versuch einer Verfassungsänderung mit Hilfe
[1] S. S. 1, s. 775.
[2] „Man darf den athenischen Staat in dieser Ausbildung mit dem spartanischen vergleichen . . .: es ist die Demokratie eines Herrenstandes“ (Delbrück, a. a. O. S. 244).
[3] Kaerst, a. a. O. S. 216.
[4] Kaerst, a. a. O. S. 117. Vgl. Beloch III. 1, S. 219/20 über Charidemos.
[479]
von Landsknechten nicht gewagt werden, solange es nicht geradezu um das nackte Leben ging.
Man verstehe nicht falsch. Es handelt sich hier nur darum, daß die Plutokraten keine große Neigung haben konnten, Söldner zum Austrage innerer Streitigkeiten massenhaft in die Stadt zu ziehen. Für die äußeren Kriege stützte man sich seit dem Verfall immer ausschließlicher auf Söldner. Die athenische Landwehr ist seit Mantineia nicht mehr aufgeboten worden [1]. Ähnlich entwickelten sich die Dinge bekanntlich in Rom, wo sie zuletzt zu der brutalsten Herrschaft der Prätorianergarden führten. Man lese die tragikomischen Schilderungen Mommsens über den Verfall der Bürgerwehr, nicht nur des aus der Plebs gebildeten Fußvolks, sondern vor allem auch der hocharistokratischen „berittenen Nobelgarde“ der jungen Herrn von Adel: der Übergang vom Kriegs- zum Raubhandwerk schädigte die Kriegszucht und den kriegerischen Geist sehr schwer; im istrischen Kriege (576) kamen über ein geringes, vom Gerüchte lawinenhaft vergrößertes Scharmützel das Landheer und die Seemacht der Römer, ja, die Italiker daheim ins Weglaufen . . . Auch hier ging die vornehme Jugend voran“ [2].
Um den Faden wieder aufzunehmen, so schloß sich die Berufung von Söldnern und ihren Hauptleuten aus guten Gründen aus. Zuletzt aber muß man sich klar machen, daß ein solidarisches Interesse der gesamten Herrenklasse an einer Verfassungsänderung nicht gegeben war.
Mögen immerhin die wirtschaftlich expropriierten, die verarmten, verschuldeten Malkontenten wünschen, eine Restauration durchzuführen, die ihnen mit größerer Macht auf Gesetzgebung und Verwaltung neuen Reichtum und standesgemäßes Einkommen gewähren würde; — und mögen sie bei solchen Bestrebungen immerhin auf den Beistand der wenigen weiterblickenden und rechtschaffenen Standesgenossen rechnen können (es gab nicht nur Theoretiker, sondern auch fanatische Praktiker der Revolution, die, etwa wie die Carbonari und Garibaldi, überall dabei waren, wo um die Freiheit gestritten wurde; so nahm der Stoiker Blossius aus Cumae, der Freund des Tiberius Gracchus, zuerst an der gracchischen Bewegung und dann, glücklich entronnen, an der Rebellion des Aristonikos in Peigamon teil, wo er den Tod fand): aber gerade die Mächtigsten, d. h. die Reichsten der Herrenklasse haben an dem bestehenden Zustande wenig auszusetzen. Sie können durch die reichsten Festspiele und Fechterkämpfe, durch die größten Spenden den Pöbel gewinnen, können die mächtigste Mafia oder Camorra und mit ihr den volkstümlichsten Rabulisten und beliebtesten Gassen-
[1] Beloch, III, I, S. 611. Unter Valentinian III. wurde die längste obsolet gewordene Dienstpflicht der römischen Bürger ausdrücklich aufgehoben (Bury, a. a. O. S. 39),
[2] Mommsen, a. a. O. I, S. 810. Über die adlige „Nobelgarde“ ebendort S. 783ff.
[480]
helden mieten, und beherrschen auf diese Weise, als die Kammerdiener des Souveräns, Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung.
Man sieht, hier ist das innere Staatsleben in einen Hexenkreis gebannt, aus dem das Gemeinwesen aus eigener Kraft keinen Ausweg finden kann. Nur eine von außen kommende Gewalt, sei es ein fremder Machthaber wie Philipp [1], sei es ein Statthalter, der sich in einer der Provinzen eine eigene starke Militärmacht geschaffen hat, wie Caesar, kann durch wirtschaftliche und politische Reformen für eine gewisse Zeitspanne die Möglichkeit staatlichen und gesellschaftlichen Lebens neu schaffen. Auf die Dauer freilich hilft auch das nicht: das Grundübel, der „fressende Krebs“ der Sklavenwirtschaft muß das Gemeinwesen zerstören.
Und zwar in zwiefacher Hinsicht. Zunächst muß die Volkswirtschaft verfallen. Der antike Kapitalismus unterscheidet sich von dem der Neuzeit, der nicht unfreie, sondern freie Arbeit exploitiert, grundsätzlich auf das stärkste dadurch, daß dieser sich immer neue Märkte schafft, während jener seine alten Märkte durch die wildeste Raubwirtschaft zu zerstören gezwungen ist. In der europäisch-amerikanischen Internationalwirtschaft der Gegenwart bringt jeder neue Fortschritt der Industrie und der Verkehrstechnik eine neue Verbilligung der Gewerbsprodukte, und das heißt eine wenigstens relative, oft sogar für eine gewisse Zeit eine absolute Verteuerung der Agrarprodukte. Das führt zur Intensivierung der Landwirtschaft in den alten, und zur Extensivierung in neuen Gebieten, zur Entstehung neuer Agrarprovinzen des Wirtschaftskreises auf bisher jungfräulichem Acker- und Weideboden: Nordamsrika, Kanada, Argentinien, Australien, Sibirien. Und das sind dann eben neue Märkte für die alten Industrieländer.
Der antike Kapitalismus aber war, wie wir sagten, gezwungen, sogar seine alten Märkte zu zerstören, und durchaus nicht imstande, neue zu formen. Anstatt neuen Agrarbevölkerungen Lebensraum zu schaffen, vernichtete er die alten, die möglichen Kunden seiner Erzeugnisse, durch die Sklavenhetzen, die seine Existenzbedingung sind. Darum bleibt die Geld- und Gewerbswirtschaft ein dünner Firnis über der weit überwiegenden Naturalwirtschaft seines Hinterlandes, in dem die primitive Grundherrschaft des alten Eroberungsstaates weiterbesteht. „Die Kultur der Antike war Küstenkultur. Keine namhafte Stadt lag weiter als eine Tagereise von der Küste entfernt. Das Land hinter diesem dünnen Küstenstreif war zwar in die Marktwirtschaft einbezogen, aber es war kein kaufkräftiges Hinterland, weil es in der Natural-
[1] Wie sehnsüchtig hat z. B. Isokrates einen „Säbelheiland“ (Scherr) herbeigewünscht, vgl. Kaerst a. a. O. S. 142, 148. (Vgl. Pohlenz, S. 144/5) Ebenso Kallisthenes (Kaerst a. a. O. S. 153). Vgl. a. S. 479 und 487. Vgl. a. H. Delbrück, a. a. O. S. 312.
[481]
wirtschaft steckte“ [1]. Darum kann sich die entfaltete Marktwirtschaft hier auch nur so lange halten, wie die Sklavenjagd ergiebig bleibt. Nachdem einmal der Erdkreis, der dieser Raubwirtschaft zugänglich war, geleert war, mußte die antike Gesellschaft in die Naturalwirtschaft zurücksinken. Die Grundherren mußten sich vom Markte unabhängig machen; sie dehnten ihre Eigenwirtschaft weiter und weiter aus, bis dasjenige fertig war, was Rodbertus als „Oikenwirtschaft“ bezeichnete und irrtümlich für die alleinherrschende Betriebsform der ganzen Antike hielt; sie wurde aber in Wahrheit herrschend erst in der Spätzeit des römischen Kaisertums und ging von hier aus auf die germanischen Reiche bis zu den Karolingern über. Wir werden an seiner Stelle zu betrachten haben, wie die Sklaverei sich in das Kolonat, d. h. die Sklaven in „mancipia casata“ : angesessene, mit Familie ausgestattete Hörige verwandelten [2]. Damit hängt es zusammen, daß in jener Spätzeit, mit dem Schwinden der Geldwirtschaft und daher auch der Geldsteuern, die Kaiser sich gezwungen sahen, viele Zweige der Staatsverwaltung, darunter auch die Reederei, „leiturgisch“ zu organisieren, d. h. statt auf Steuern auf persönlich Dienstverpflichtete zu legen, auf eine Art von erblich verkasteten [3] Zünften, die für diese Leistungen das Monopol ihres Gewerbebetriebes erhielten [4]. Damit war selbstverständlich der schon an sich eingeschrumpften Geldwirtschaft ein weiteres großes Gebiet entzogen; der ganze Prozeß stellt sich dar als eine Rückbildung der Gesellschaftswirtschaft in längst überwundene Formen: der Seestaat endet, wo er begonnen hatte, in geldloser Naturalwirtschaft auf der Grundlage unfreier Ackerarbeit; Industrie und Handel sind auf ein Geringes eingeschrumpft.
In dem gleichen Hexenkreise bewegt sich und verkommt das politische Leben jener Staaten. Die Alten sahen diesen Zyklus, der von der Monarchie zur Aristokratie, zur Plutokratie, zur Demokratie, zur Ochlokratie (Pöbelherrschaft), und von hier wieder zur Monarchie in Gestalt einer Tyrannis oder einer fremden Eroberungsdynastie führt, für den normalen Gang des Staatslebens an, so naturnotwendig wie den Gang der Jahreszeiten oder den Ablauf der Lebensphasen von dem Kindesalter über Jugend, Mannesalter und Greisenalter zum Tode [5]. Der Gedanke eines Fortschritts in der Geschichte ist der Antike fremd; er ist erst durch das Christentum eingebracht worden, das, wie wir oben dargestellt haben, in der Geschichte die Verwirklichung des göttlichen Heilplanes, in ihren einzelnen Geschehnissen nichts als die Schachzüge sieht, die Gott in seinem säkularen Spiele gegen den Teufel ausführt.
[1] Max Weber, Wirtsch.-Gesch., S. 124.
[2] Vgl. Neurath, a. a. O. S. 83.
[3] Vgl. Delbrück, a. a. O. S. 670.
[4] Max Weber, Wirtsch.-Gesch., S. 181.
[5] Vgl. S. S. I, S. 755ff.
[482]
Wir haben in unserer allgemeinen Soziologie gezeigt, daß die antike Auffassung mit dem Entstehen des neuzeitlichen Kapitalismus und der mit ihm verbundenen wirtschaftlichen und ethischen Zersetzung wieder auftaucht und vor allem bei Machiavelli erneute kraftvolle Prägung und von hier aus weite Verbreitung findet: „So sinkt man stets vom Guten zum Übel und steigt vom Übel zum Guten. Denn die Tüchtigkeit (virtù) gebiert Ruhe, die Ruhe Müßiggang, der Müßiggang Unordnung, die Unordnung Verfall. Ebenso entsteht aus dem Verfall Ordnung, aus der Ordnung Tüchtigkeit, hieraus Ruhm und Glück“ [1]. Und politisch folgt daraus der ewige Kreislauf der Staatsformen, und zwar des principato, des stato popolare und des governo d'ottimati: „E questo è il cercchio nel quale girando tutte le republiche si sono governate“ [2].
Der Glaube an ein Naturgesetz dieser Art — ich habe vorgeschlagen, es als „das Gesetz der zyklischen Katastrophen“ zu benennen —, das alle Geschichte, nicht nur der Vergangenheit, sondern, eben als Naturgesetz, auch aller Zukunft beherrsche, ist noch heute sehr verbreitet. So weit dieser Glaube auf der Vorstellung beruht, daß eine Gesellschaft ein höherer Einzelorganismus ist — zu ihren Anhängern gehört z. B. der sehr einflußreiche Röscher [3] —, ist er durch die Erörterungen des dogmengeschichtlichen Teils dieser Arbeit als irrig nachgewiesen. Soweit er aber auf den Tatsachen der alten Geschichte beruht, indem er den Lebenszyklus der Stadtstaaten als den überhaupt typischen, notwendigen betrachtet, hoffen wir, ihn durch die Erörterungen dieses ganzen Abschnittes widerlegt zu haben. Seine Bekenner, zu denen Historiker und Soziologen von Rang, z. B. Lebon [4], Gervinus [5], Gumplowicz [6] gehören, haben nicht erkannt, daß es sich bei diesem Geschichtsverlauf um eine typische Sozialkrankheit handelt, die wir, wie wir es verhießen, Symptom für Symptom aus der einen causa morbi, der Sklavenwirtschaft, abzuleiten imstande waren.
Schon Quesnay hat darauf aufmerksam gemacht, daß dieser Fatalismus wenig begründet ist. Er sagt von den Anhängern der Auffassung: „Aber sie haben auch bemerken müssen, daß diese Ordnung sehr unregelmäßig ist, daß die einzelnen Stufen einander schneller oder
[1] Vgl. dazu Schmidt, Niccolò Machiavelli, S. 98.
[2] Polit. Betrachtungen, S. 13. Vgl. Gumplowicz, Die soziol. Staatsidee, S. 76.
[3] Vgl. Eisenhart, Gesch. d. Nationalökonomik, S. 137.
[4] S. S. I, S. 565.
[5] Vgl. Gumplowicz, Allg. Staatsrecht, S. 209. Gervinus nennt es „das Gesetz aller vollkommenen historischen Entwicklung“.
[6] Soziol. Essays, S. 137: „Unvermeidlicher Untergang“. Sozialphil, im Umriß, S. 49: „Die Staaten sind das Vergängliche“. Ib. S. 50/1: „Ewig sich wiederholender Kreislauf der Staaten, die . . . verfallen und zugrunde gehen“, vgl. a. ebendort S. 54/5, 57. Ebenso Grundriß d. Soziologie, S. 159.
[483]
langsamer, weder gleichartig noch gleichförmig folgen . . . und so hätten sie daraus wenigstens schließen sollen, daß die Fatalität der schlechten Regierungen nicht der natürlichen und unveränderlichen Ordnung angehört, nicht den Erztypus aller Regierungen darstellt“ [1].
Von einem verwandten Standpunkt hat Carey das Gesetz der zyklischen Katastrophen bekämpft: „Es gibt keinen natürlichen Grund, der eine Gesellschaft hindern könnte, von Jahr zu Jahr wohlhabender zu werden; und wo dies nicht geschehen ist, haben störende Ursachen eingewirkt, von denen man jede für sich allein untersuchen muß, um begreifen zu lernen, inwiefern sie zur Erzeugung des bestehenden Zustandes der Dinge mitgewirkt hat; allein ehe wir zu dieser Untersuchung schreiten, müssen wir eingesehen haben, welchen Verlauf die Dinge genommen hätten, wenn es keine derartigen Ursachen gegeben hätte“ [2].
Wir sind jetzt in der Lage, die Ursache der Sozialkrankheit genau zu bestimmen. Wo immer durch außerökonomische Gewalt rechtlich Ungleichheit, wirtschaftlich Ausbeutung, politisch Herrschaft, sozial Klassen entstehen, da ist in den Körper der Gemeinschaft das Gift, die Sünde wider den Heiligen Geist, die Ungerechtigkeit, die Verletzung der Gleichheit der Würde der Personen, eingedrungen und erzeugt eine Krankheit; und das heißt nichts anderes als: das Weiterleben der Gesellschaft unter veränderten Verhältnissen, so lange sie zu widerstehen vermag.
Auch in unserer Gesellschaft gärt dieses Gift und erzeugt schwere
[1] Oeuvres, S. 374.
[2] Grundlagen, S. 291/92. Derselben Auffassung ist Rümelin (Reden und Aufsätze von 1881, S. 133/34). Er leugnet die Notwendigkeit, daß Völker sterben müssen, und vergleicht ganz richtig ein Volk mit einem Walde. Beloch schreibt „Bevölkerung“ Seite 503: „Völker bleiben überhaupt ewig jung, nur menschliche Einrichtungen altern“. Auf der anderen Seite hält Ferdinand Toennies immer noch an der entgegengesetzten Auffassung fest. Er schreibt (Richtlinien für das Studium des Fortschritts und der sozialen Entwicklung, Jahrbuch für Soziologie I, 1925, S. 198): „Im Verlaufe einer Kulturentwicklung ist das „Altern“ eine schlechthin notwendige Erscheinung; sie ist Ausdruck des Lebens schlechthin, des Verschleißens. . . . Ein bedeutender Soziologe bestreitet heftig, daß es so etwas im Kulturleben gäbe (Oppenheimer, System, S. 33ff. und oft): Es handele sich immer nur um Krankheiten, und der . . . Gelehrte scheint zu leugnen, daß es auch unheilbare Krankheiten gäbe, und daß das Altern als solche verstanden werden kann“. Selbstverständlich kann man das Altern als eine unheilbare Krankheit ansehen: aber das Problem liegt an ganz anderer Stelle, als Toennies einsehen will. Wenn man von dem Altern einer Kultur oder eines Volkes spricht, so liegt die Unheilbarkeit im Begriff eingeschlossen und braucht nicht erst bewiesen zu werden — wenn man aber von Krankheit schlechtweg spricht, so muß erstens gezeigt werden, worin ihre Ursache und ihr Sitz besteht, und zweitens und vor allem, daß sie unheilbar ist. Ich wehre mich nicht gegen den Ausdruck, sondern gegen die, mit seiner Anwendung ohne weiteres verbundene petitio principii : das onus demonstrandi fällt meinenGegnern zu.
[484]
Erscheinungen einer Krankheit, der wir den Mut nicht haben, eine durchaus günstige Prognose zu stellen. Aber so viel dürfen wir doch sagen, daß das Virus, an dem wir leiden, „abgeschwächt“ ist. Wir haben die Sklaverei, das schlimmste Geschöpf des politischen Mittels, aus dem Körper unserer Gesellschaft ausgeschieden; unsere Sozialkrankheit hat eine andere Ursache, einen anderen Sitz und selbstverständlich einen anderen Verlauf. Das haben wir soeben an der ganz abweichenden Entwicklung der Märkte festgestellt, und das werden wir sofort in noch verstärktem Maße einsehen, wenn wir den letzten großen Charakterzug der Sklavenwirtschaft studieren werden: den Völkertod durch Völkerschwindsucht. Und so ist es unerlaubt, anzunehmen, daß auch unsere Gesellschaft ganz die gleichen Phasen der Krankheit durchlaufen und das gleiche Ende finden muß, wie die antike.
Dieses Gesetz der zyklischen Katastrophen ist wie das Gesetz der ursprünglichen Akkumulation und namentlich seine in die Zukunft gewandte Abart, der Malthusianismus, nichts anderes, als ein charakteristischer Bestandteil der Ideologie des Bürgertums, das sich zum soziologischen Pessimismus bekennen muß, um vor seinem eigenen Gewissen alle die Greuel und Schäden der kapitalistischen Wirtschaftsordnung zu rechtfertigen, deren Nutznießer es ist. Es schiebt überall der unverantwortlichen Natur und ihren unerbittlichen Gesetzen die Schuld zu. Jede Klasse glaubt heilig, was ihr nützt: das ist das Hauptgesetz der Soziologie.
d) Die Völkerschwindsucht.
Derjenige Zug, der den antiken am schärfsten vom neuzeitlichen Kapitalismus scheidet, ist die ungeheure Tatsache, daß die modernen Völker im einzelnen und vor allem ihr Verband im ganzen ein gewaltiges, in keiner Periode der Vorzeit je erhörtes Wachstum zeigen, während die Völker des Altertums, nicht die Staaten — das wäre unwichtig — nein, die Völker selbst als biologische Einheiten, bis zur fast völligen Vernichtung an Zahl zusammenschmelzen: ein Vorgang, der nur mit der Schwindsucht, in vielen Fällen sogar nur mit der „galoppierenden Schwindsucht“ des Einzelmenschen vergleichbar ist.
Die Ursachen sind im einzelnen klar gegeben.
Das Latifundiensystem entvölkert Plattland und Landstädte [1], wie wir zeigten, schon dann ungemein stark, wenn es beim Kornhau bleibt. Wenn aber gar, wie in Rom, das Geldinteresse der Grundherren sie dazu führt, massenhaft Kornland in Weide niederzulegen, weil die Hauptstadt Fleisch hoch bezahlt, Getreide aber unter den Selbstkostenpreis fällt, weil die regierende Clique den hungernden souveränen
[1] Vgl. Adler, Gesch. d. Soz., S. 70.
[485]
Pöbel mit Gratiskorn füttert, dann geht die Entvölkerung natürlich in noch ganz anderem Schrittmaß voran, und der letzte freie Bauer muß zum weißen Stabe greifen.
Diese verderbliche Politik hat in einem gewissen Maße schon Athen betrieben [1], das bei seinem geringen eigenen Landbesitz seine starke Bevölkerung unmöglich vom eigenen Ackerbau mit Korn versorgen konnte ; daher die große Bedeutung, die die Kontrolle der Meeresstraßen vom Pontus her immer für seine Politik hatte: Südrußland war schon damals eine Kornkammer der Mittelmeerländer. Aber in wirklich vernichtender Art hat erst Rom jene Methode eingeführt. Sie wurde, wie es scheint auf Veranstaltung Scipios, schon in den Jahren 551/4 mit der Abgabe spanischen und afrikanischen Korns zu wahren Spottpreisen inauguriert, trotz des Widerstandes, den Cato in voller Erkenntnis der unausbleiblichen Folgen leistete, aber „die beginnende Demagogie mischte sich hinein, und diese außerordentlichen, aber vermutlich sehr häufigen Austeilungen von Korn unter dem Marktpreise durch die Regierung oder einzelne Beamte sind der Keim der späteren Getreidegesetze geworden [2]. ... In fruchtbaren Jahren wurde in den italischen Häfen das sizilische und sardinische Korn um die Fracht losgeschlagen. In den reichsten Kornlandschaften der Halbinsel, in der heutigen Romagna und Lombardei . . . galt der preußische Scheffel Weizen einen halben Denar (3 % Groschen). Der letztere Durchschnittspreis, etwa der zwölfte Teil des sonstigen Normalpreises, zeigt mit unwidersprechlicher Deutlichkeit, daß es der italischen Getreideproduktion an Absatzquellen völlig mangelte, und infolgedessen das Korn wie das Kornland daselbst so gut wie entwertet war. . . . Ein Land wie Italien, wo die Industrie unbedeutend, die Landwirtschaft durchaus Hauptsache war, ward auf diesem Wege systematisch ruiniert, und den Interessen der wesentlich unproduktiven städtischen Bevölkerung . . . das Wohl des Ganzen auf die schmählichste Weise geopfert. . . . Und das geschah bereits in der ,sog. goldenen Zeit der Republik'“ [3].
Dieser verderbliche Prozeß mußte sich noch beschleunigen, wenn mit abnehmender Ergiebigkeit der Sklavenjagden der Preis der Unfreien sich empfindlich hob. Denn Weidewirtschaft fordert sehr viel weniger Arbeitskräfte auf die gegebene Fläche; es ist ganz derselbe Grund der privatwirtschaftlichen Rentabilität, der vom 14. Jahrhundert an die englischen Grundherren dazu führte, die Weidewirtschaft auf Kosten des Ackerbaus maßlos auszudehnen [4]. Und so kam
[1] Vgl. Beloch, a. a. O. II. 1, S. 87.
[2] Vgl. dazu Beloch, Bevölkerung S. 393, S. 397f.
[3] Mommsen, a. a. O. I, S. 835ft. Vgl. Beloch, Bevölkerung S. 393ft.
[4] In Megara richtete sich die Wut der Ackerproletarier (640) gegen die Schafzucht der reichen Grundbesitzer; auch hier „fraßen die Schafe die Menschen“, wie im England des Morus (v. Poehlmann I, S. 195).
[486]
es zu der entsetzlichen Latifundienwirtschaft, der ein Plinius die Zerstörung der römischen Macht zuschrieb, zu der noch heute bestehenden greulichen Entvölkerung und Verwüstung der reichsten italischen Landschaften: vor allem des ganzen Südens von der Campagna an bis zu Sizilien einschließlich, das noch heute den ihm oft beigelegten Namen „Halbafrika“ verdient, und dessen Bevölkerung, abgesehen von einer dünnen Oberschicht, nach Niceforo noch in einem vorzivilisatorischen Seelenzustande verharrt.
Die kräftigeren Naturen, die als Söldner oder hausierende Kaufleute über alle Länder des Weltkreises auswandern, um sich ein Schicksal zu schmieden, gehen, besonders die ersteren, der Heimat und ihrer Wehr- und Steuerkraft so gut wie immer verloren; und das Lumpenproletariat der Hauptstadt würde in wenigen Generationen ausgestorben sein, wenn der Zufluß vom Lande und von den Provinzen her es nicht immer wieder neu rekrutierte. Zusammengepfercht in engen, lichtlosen Gassen [1], in verbrecherisch gestümperten Mietskasernen zu ungeheurem Mietszinse [2] zusammengehudelt, von Alkohol vergiftet, durch Ausschweifungen entnervt, ohne gesunde Tätigkeit, ohne eigentlichen Halt und Zweck im Leben, wurden sie massenhaft dahingerafft, auch außerhalb der gewaltigen Epidemien, die jene, noch nicht an die „Wohnparasiten“ ihrer Häuser und ihres Bodens angepaßten Bevölkerungen der Städte, wie auch noch in unserem Mittelalter, mit einer Wucht trafen, von der wir uns heute kaum eine Vorstellung machen können: man denke an die von Thukydides beschriebene Pest, die Athen während des peloponnesischen Krieges, oder an die Seuche, die Rom unter Antonin verheerte. Namentlich die Kindersterblichkeit war in den zumeist ohne alle öffentliche Hygiene bestehenden Städten, bei schlechtem Wasser, gefälschter Milch und verseuchtem Wohnboden eine furchtbare. Dazu kam die „Kontraselektion“ der ewigen Kriege, die gerade die jüngsten, tüchtigsten, gesundesten Männer verschlangen [3].
[1] Beloch Griech. Gesch. II. 1, S. 105 über Athen.
[2] Mommsen, a.a.O. III, S.524: „Die Mietpreise scheinen in Rom durchschnittlich vierfach höher als in den Landstädten sich gestellt zu haben“. Eine solche Mietskaserne wurde einmal für fast 3,5 Mill. M. verkauft. Vgl. Neurath S. 75 über die hohen Mieten. Marquardt (S. 216/7) berichtet, daß diese Mietskasernen unter Augustus 70, unter Trajanus nur noch 60 Fuß hoch sein durften: also vier- bis fünfstöckigen Häusern unserer Tage vergleichbar. Wie Beloch (Bevölkerung S. 408) gezeigt hat, bedeutet „insula“ nicht das Mietshaus, sondern eine Mietswohnung, ein „flat“. Vgl. a. Delbrück, a. a. O. S. 470, S. 499.
[3] Mit der kapitalistischen Zersetzung bildete sich „ein neues barbarisches Kriegsrecht“. In unzähligen Fällen wurden von den Vororten Bundesgenossen und Nichtbundesgenossen nach dem Siege massenhaft hingerichtet. Das geschah z. B. in Skione i. J. 421 (Beloch, Griech. Gesch. II. 1, S. 351) in Melos (ib. S. 353). Nach der Schlacht bei Ägospotamoi ließ Lysander dreitausend gefangene Athener hinrichten. Die dreißig Tyrannen sollen 1500 Bürger haben hinrichten lassen (Beloch III. 1, S. 7); die Thebaner ließen (363) Orchomenos zerstören, die Bürger als Verräter hinrichten, die Weiber und Kinder in die Sklaverei verkaufen (ib. S. 201). Wenn auch die eigentlichen Kriegsverluste bei den Feldschlachten angesichts der Kleinheit der Heere nicht allzu groß gewesen sein werden (bei den Seeschlachten waren sie bedeutender) (ib. S. 264/65), so war doch die wirtschaftliche Verheerung jedes Feldzuges grauenhaft. Jedesmal „wurde die Ernte vernichtet, die Weinstöcke ausgerissen, die Fruchtbäume umgehauen, die Dörfer niedergebrannt“ (ib. S. 314): das muß die Bevölkerungsvermehrung sehr stark zurückgehalten haben. Auch die makedonische Herrschaft ist noch dem bösen Beispiel gefolgt. Philipp hat die Bewohner des von ihm zerstörten Olynth ebenfalls zu Sklaven gemacht, wie noch kurz vorher der athenische Feldherr Chares nach der Eroberung von Sestos die männliche Bevölkerung getötet, die übrige in Sklaverei verkauft hatte (Kaerst, S. 227). Das gleiche Schicksal traf unter Alexander das hochberühmte Theben (ib. S. 323) und drei Jahre später das noch berühmtere Tyros (ib. 373).
[487]
Die Herrenschicht vergeht mit reißender Schnelligkeit an Ausschweifungen; das Hagestolzentum greift gewaltig um sich, und die Verheirateten setzen nur wenig Kinder in die Welt, teils weil die verweichlichten Frauen dieser Schicht die Last und Gefahr der Mutterschaft scheuen, teils, weil die Klasse verloren gehen würde, wenn das Vermögen sich unter mehrere Kinder teilte. Denn, wir sagten es schon, von Generation zu Generation muß der Besitz größer sein, um seinen Inhaber in die Oberschicht einzurangieren [1].
Und was schließlich die Sklavenschaft anlangt, die ja in den wichtigsten dieser Staatswesen, vor allem in Rom und Athen, den Hauptstamm der Bevölkerung ausmacht, so sind schon die Methoden ihrer „Produktion“ bevölkerungsverwüstend. Wir kennen die mit den Sklavenjagden verbundenen Massenmorde und die ungeheuren Verluste auf dem Transporte leider sehr genau aus der Geschichte der europäisch-amerikanischen „Traite“; freilich werden auf den relativ kurzen Seetransporten im Mittelmeerbecken nicht die kolossalen Verluste sich ereignet haben wie in der Neuzeit auf den Ozeanseglern. Dafür aber muß bei der Billigkeit des Materials und der daraus folgenden rücksichtslosen Raubwirtschaft, die sich auf die Autorität der bedeutendsten landwirtschaftlichen Sachverständigen berufen konnte, die Sterblichkeit im Dienste sehr hoch gewesen sein, wahrscheinlich mindestens ebenso hoch wie bei den Plantagensklaven der Südstaaten und der Antillen, wo sie, wie wir erfahren haben, noch in der letzten Zeit der offiziellen Sklaverei, als der Preis des Menschenviehs schon hoch stand.
[1] Verhinderung der Konzeption, Abtreibung und Kindermord griffen grauenhaft um sich und wurden vergeblich durch Gesetze der Kaiserzeit bekämpft. Die Entvölkerung griff immer weiter um sich, bis sie das ganze Mittelmeergebiet verheerte (Neurath, a. a. O. S. 70). Rom hatte im 6. Jahrh. nur noch 50000 Einwohner (ib. S. 97).
[488]
sich auf 25 % belief. Und die antiken Sklaven hatten, im Gegensatz zu denen der modernen Sklavenwirtschaft, nur sehr ausnahmsweise eigene Familie und Nachwuchs.
Es stimmen denn auch alle Historiker, die wir kennen, mit sehr wenigen Ausnahmen in der Feststellung überein, daß die antiken Völker in reißender Schnelligkeit ausstarben. Dazu gehört Beloch, und zwar für eine beschränkte Periode der hellenischen Geschichte, während er für Rom die herrschende Meinung annimmt [1]. Er meint, „daß die Bevölkerung Griechenlands auch im 4. Jahrhundert noch im Fortschreiten war“ [2]. Wenn man aber die im übrigen sehr sorgfältigen und dankenswerten Berechnungen studiert, die er über alle von Hellenen bewohnten Landschaften der Zeit anstellt, so findet man, daß er zwar die Volkszahl gegen Schluß des Jahrhunderts vielfach, wenn auch mit vielen Konjekturen feststellt, aber kaum irgendwo Material beibringt, das eine Vergleichung mit der früheren Zeit erlaubte. Wir wollen gern glauben, daß Athen und einige andere Industriestädte ihre Verluste durch Einwanderung von Metöken und Import von Sklaven gutgemacht haben, wie Beloch (III. S. 273) mitteilt : das ist wichtig genug für die Einschätzung ihrer politischen und militärischen Macht, die Beloch an dieser Stelle besonders interessiert. Für uns aber handelt es sich nicht um die Volkszahl der Hauptstadt und ihrer nächsten Umgebung, sondern um die Gesamtbevölkerung eines Gesamtbezirks, die selbstverständlich durch innere Verschiebungen nicht verändert wird.
Beloch beruft sich darauf, daß „die politischen Theoretiker dieser Zeit, Isokrates ebenso wie Piaton und Aristoteles, sich nur mit der Gefahr der Übervölkerung beschäftigen und zum Teil sehr radikale Maßregeln zu ihrer Abwendung in Vorschlag bringen“ (267). Hier ist der Historiker der Verwirrung zum Opfer gefallen, die in der Ökonomik über den Begriff der „Übervölkerung“ besteht. Ein Land ist übervölkert, wenn es seinen Insassen und ihrem normalen Nachwuchs keine selbständige Existenz bieten kann; das aber hängt viel mehr als von natürlichen von gesellschaftlichen Bedingungen, und hängt vor allem von der Verteilung des Bodeneigentums ab. Dieser Grundsatz, der seit den Untersuchungen von v. d. Goltz' [3] Gemeingut aller Nationalökonomen — sein sollte, ist Beloch offenbar ebenso unbekannt, wie z. B., um den größten Namen zu nennen, Friedrich Ratzel. Einige deutsche Landbezirke im Osten Deutschlands, die von sehr großem Grundeigentum eingenommen sind, sind schon bei einer Bevölkerungsdichtigkeit von 4 Seelen auf den Quadratkilometer „über-
[1] Bevölkerung S. 373, 413, 422, 442/3.
[2] Griech. Gesch. III, 1, S. 267, Bevölkerung S. 496. — „Erst im II. Jahrhundert beginnt eine fühlbare Abnahme der Bevölkerung“ (498/9).
[3] Die ländliche Arbeiterklasse und der preußische Staat, Danzig 1874.
[489]
völkert“, d. h. haben eine relativ ungeheure Auswanderung, während reine Bauernbezirke im Westen mit hundert Köpfen und mehr auf den Quadratkilometer bei gleicher natürlicher Beschaffenheit des Bodens nicht „übervölkert“, sondern imstande sind, ihren Nachwuchs in der Ackerwirtschaft und den Nachbarstädten festzuhalten.
Wenn also in Hellas im 4. Jahrhundert viel von Übervölkerung die Rede war, so beweist das durchaus nicht, daß eine Volkszahl von bestimmter absoluter Größe, berechnet auf die Fläche, vorhanden war, sondern nur, daß die Bevölkerung aus irgendwelchen Gründen „gegen ihren Spielraum preßte“ — und wir sind durchaus berechtigt anzunehmen, daß es viel mehr gesellschaftliche als natürliche Gründe waren.
Denn die Übereinstimmung der sonst überlieferten Daten ist ebenso groß, wie sie erschütternd ist.
In Sparta gab es Mitte des 3. Jahrhunderts nur noch 700 vollberechtigte Bürger, von denen die meisten verarmt waren; nur noch etwa hundert Familien waren im Besitz des ganzen Landes [1], davon zu Alexanders Zeit zwei Fünftel im Eigentum von Erbtöchtern. Ursprünglich hatte es 9000 gleichberechtigte und fast gleichbegüterte Kriegsedelinge gegeben [2]. Schon um 400 reichte aber ihre Zahl kaum noch hin, um dem vorwiegend aus freigelassenen Heiloten (Neodamoden) bestehenden Heere die Offiziere zu stellen [3]. Zur Zeit des Nabis konnte die einst so blühende Landschaft, die ganz Hellas mit ihren Kriegern beherrscht hatte, kaum noch 200 Bewaffnete auf die Beine bringen. Und ebenso traurig stand es um das ganze Griechenland: „Schon mehr als ein Jahrhundert vor der aktischen Schlacht hatte Polybios ausgesprochen, daß über ganz Griechenland in seiner Zeit Unfruchtbarkeit der Ehen und Einschwinden der Bevölkerung gekommen sei, ohne daß Seuchen oder schwere Kriege das Land betroffen hätten. Nun hatten diese Geißeln in furchtbarer Weise sich eingestellt; und Griechenland blieb verödet für alle Folgezeit. Im ganzen Römerreich, meint Plutarch, sei infolge der verwüstenden Kriege die Bevölkerung zurückgegangen, am meisten aber in Griechenland, das jetzt nicht imstande sei, aus den besseren Kreisen der Bürgerschaften die 3000 Hopliten zu stellen, mit denen einst die kleinste der griechischen Landschaften, Megara, bei Platää gestritten hätte“ [4]. „Der Ackerbau
[1] Georg Weber, Weltgesch. III, S. 322/3. Beloch, a. a. O. III, S. 282, 346.
[2] Grote (a. a. O. S. 707), gibt nach Herodot 8000, Busolt (a. a. O. S. 96) 6000 an, denen König Polydoros weitere 3000 hinzugefügt hätte (nach Plutarch). Der Heerbann war zur Zeit der Perserkriege 6000 Mann stark, davon 1000 (jüngste und älteste Jahrgänge) als Besatzung Spartas (ib. S. 711). Vgl. dazu Beloch, Bevölkerung S. 8. Zur Zeit des Agis waren nur noch 700 όμοιοι vorhanden, davon nur 100 Reiche (Grote, a. a. O.). Vgl. Busolt, a. a. O. S. 114/5.
[3] Beloch, Griech. Gesch. III, 1, S. 27.
[4] Mommsen, a. a. O. V, S. 245/6. Die Ziffer erregt Beloch „die stärksten Bedenken“ (Bevölkerung S. 9).
[490]
siechte immer mehr dahin, und bald war Griechenland eine große Einöde, wo zwischen den Resten alten Städteglanzes die Heerden weideten, und in den Tempeltrümmern wilde Tiere ihre Zuflucht suchten“ [1]. Damals riet Plutarch seinen Landsleuten, ihre Sklaven zu verkaufen, damit sie die Gier der Wucherer nicht selbst zu Sklaven mache, die Arbeit zu ehren, als Lehrer, Türsteher, Matrosen ihr Brot zu suchen. Die Erkenntnis von der Ursache aller Übel war also eingetreten, aber zu spät.
In diesen Verfall wurde selbstverständlich auch die Gesellschaftswirtschaft einbezogen. Mommsen sagt von Athen, zu Augustus' Zeit habe es dort kaum noch Handel und Industrie gegeben, das einzige blühende Gewerbe für die Bürgerschaft insgemein wie für den einzelnen Bürger sei der Bettel gewesen. Ja, die Verarmung war so arg, daß einzelne noch etwas volkreichere Städte über ihre schwächeren Nachbarn herfielen, um sie auszuplündern; so Athen und Theben [2]. Nichts kann deutlicher als dieses traurige Ende der Seestaaten beweisen, daß sie von Anfang an „politische Zünfte“ gewesen sind, Ausbeuter kraft Kriegsrechts, Nutznießer des politischen Mittels in seiner unverhüllten Gestalt. Sie kehren jetzt zu ihrem Ausgangspunkte zurück, zum nackten Raube, aber mit dem ungeheuren Unterschiede, daß die primitive Eroberung von rohen Kriegerstämmen mit dem besten Gewissen gegen Fremde geführt wurde, die kein Recht hatten, an denen man also kein Unrecht begehen konnte; — daß diese späten Räubereien aber gegen Volksgenossen ausgeübt wurden mit schlechtem Gewissen, als gemeine Verbrechen.
Dafür gab es in allen Staaten Griechenlands riesenhaft reiche Einzelne. „Die ungeheuren Latifundien, die Herodes in dem armen Attika besaß, die zu Grabzwecken seiner Lustknaben verwendeten weiten Flächen erregten den Unwillen selbst der römischen Statthalter. Derartig mächtige Familien gab es vermutlich in den meisten Landschaften von Hellas“ [3].
„In Arkadien fand Strabon, der zur Zeit des Kaisers Augustus Griechenland bereiste, nur noch eine einzige Stadt von mäßiger Bevölkerung, Tegea, alle übrigen hochberühmten Orte lagen in Schutt und Trümmern; in Böotien standen noch Tanagra und Thespiä aufrecht, von Theben war nur noch die Burg, die Wohnstätte einiger Menschenhaufen, vorhanden. Im zweiten Jahrhundert unserer Zeitrechnung lagen auf Euböa zwei Drittel des Bodens unbebaut aus Mangel an Menschenhänden“ [4].
[1] Laveleye, a. a. O. S. 343. Bücher, Aufstände d. unfr. Arb. S. 99.
[2] Mommsen, a. a. O. II, S. 42/3. Georg Weber, a. a. O. III, S. 525.
[3] Mommsen, a. a. O. V, S. 260.
[4] Georg Weber, a. a. O. III, 530/1. Ganz ähnlich lag es in Latium, (Beloch, Bevölkerung S. 422) und namentlich in Etrurien, einem Hauptsitz des unheilvollen Latifundien-Unwesens und der Groß-Sklavenhaltung. Strabon nennt Caere und Populonia verlassen (ib. S. 423/4).
[491]
Wir haben schon gehört, daß die Entvölkerung das ganze Römerreich, Griechenland nur in besonders gräßlicher Weise heimsuchte. Wir werden sofort die Ursachen darstellen, die in Rom den Krankheitsprozeß sozusagen chronisch gestalteten, ihn über Jahrhunderte ausdehnten, während er in den griechischen Staaten und z. B. auch Palästina geradezu „foudroyant“, als galoppierende Völkerschwindsucht, in etwa drei Generationen jedesmal, verlief, gerechnet von dem Zeitpunkte, wo die Geldwirtschaft mit voller Kraft einsetzte. Zunächst die Daten: „Cato und Polybios stimmen darin überein, daß Italien am Ende des sechsten Jahrhunderts“ (Mommsen zählt immer von Gründung der Stadt) „weit schwächer als am Ende des fünften bevölkert und keineswegs mehr imstande war, Heermassen aufzubringen wie im ersten punischen Kriege. Die steigende Schwierigkeit der Aushebung, die Notwendigkeit, die Qualifikation zum Dienst in den Legionen herabzusetzen, die Klagen der Bundesgenossen über die Höhe der von ihnen zu stellenden Kontingente bestätigen diese Angaben; und was die römische Bürgerschaft anlangt, so reden die Zahlen. Sie zählte im Jahre 502, kurz nach Regulus' Zug nach Afrika, 298000 waffenfähige Männer; dreißig Jahre später, kurz vor dem Anfang des hannibalischen Krieges (524) war sie auf 270000 Köpfe, also um ein Zehntel, wieder zwanzig Jahre später, kurz vor dem Ende desselben Krieges (550) auf 214000 Köpfe, also um ein Viertel gesunken; und ein Menschenalter später, während dessen keine außerordentlichen Verluste eingetreten waren, wohl aber die Anlage besonders der großen Bürgerkolonien in der norditalischen Ebene einen fühlbaren außerordentlichen Zuwachs gebracht hatten, war dennoch kaum die Ziffer wieder erreicht, auf der die Bürgerschaft zu Anfang dieser Periode gestanden hatte. Hätten wir ähnliche Ziffern für die italische Bevölkerung überhaupt, so würden sie ohne allen Zweifel ein verhältnismäßig noch bedeutend größeres Defizit aufweisen“ [1].
„Vom Ende des hannibalischen Krieges bis zum Jahre 595 ist die Bürgerzahl in stetigem Steigen, wovon die Ursache wesentlich zu suchen ist in den fortdauernden und ansehnlichen Verteilungen von Domanialland ; nach 595, wo die Zählung 328000 waffenfähige Bürger ergab, zeigt sich dagegen ein regelmäßiges Sinken, indem sich die Liste im Jahre 600 auf 324000, im Jahre 607 auf 322000, im Jahre 623 auf 319000 waffenfähige Bürger stellt —ein erschreckendes Ergebnis für eine Zeit tiefen inneren und äußeren Friedens“ [2].
[1] Mommsen, a. a. O. I, S. 854/5.
[2] Mommsen, a. a. O. II, S. 81.
[492]
In diese Entwicklung versuchten die Gracchen einzugreifen. Damals lebte nach Cato auf einem Landbezirk, der zur Zeit der Kleinwirtschaft hundert bis hundertundfünfzig Bauernfamilien ernährt hatte, ein einziger reicher Gutsbesitzer mit fünfzig größtenteils unverheirateten Sklaven [1]. Max Weber meint, die gracchische Reform habe im wesentlichen militärische Absichten verfolgt, wie die antike Stadt überhaupt „keine Nahrungspolitik nach Art der mittelalterlichen, sondern nur eine militärische Politik der Erhaltung des κλήρος, des fundus, gekannt habe, von dem ein Mann leben und sich voll als Soldat ausrüsten konnte“ [2]. So hätten auch die Gracchen nur den letzten Versuch unternommen, das Bürgerheer zu erhalten und das Soldheer zu vermeiden; es sei durchaus keine Klassenkampfmaßregel gewesen. Es will uns scheinen, daß hier ein richtiger Gedanke einigermaßen überbetont ist: auch der preußische Kriegsminister, der bekanntlich in den dreißiger Jahren, erschreckt durch den rapiden Rückgang der Militärtauglichkeit im industriell sich entfaltenden Westfalen, das erste Arbeiterschutzgesetz durchdrückte, hatte gewiß keine „klassenkämpferischen“ Absichten: und doch führt der militärpolitische Zwang zu sozialpolitischen Ideen und Handlungen. Ähnlich standen die Gracchen, aus deren Reden und Handlungen übrigens klar hervorgeht, daß sie, mag auch ihr Ausgangspunkt nur die Sorge um die militärische Kraft des Staates gewesen sein, die furchtbaren Grundschäden der Verfassung nicht nur erkannten, sondern im tiefsten beklagten und aus echter sozialpolitischer Einstellung zu heilen bestrebt waren.
Die Gracchen fielen; die von ihnen durchgesetzten Reformen blieben zum größten Teile auf dem Papier, wenigstens insofern, wie sie Besserungen zugunsten der armen Klasse enthielten. (Die der Plutokratie gemachten Gegenkonzessionen, namentlich in bezug auf das Besitzrecht am ager publicus, wurden prompt ausgeführt und gar noch weit über das gesetzliche Maß ausgedehnt.) Und so „mußte schon wenige Jahre nach des zweiten Gracchus Untergang Lucius Marcius Philippus, wiewohl selbst ein Vertreter der Nobilität, auf dem Forum eingestehen, es gäbe im Staat nicht 2000 Personen, die ein nennenswertes Vermögen besäßen [3]. . . . Bereits 107 v. Chr. wurde von Marius die Neuerung eingeführt, daß die Truppen aus dem besitzlosen Proletariat angeworben wurden, womit ein Heer geschaffen war, das schließlich unter siegreichen Führern dem Staate die Herren geben mußte“ [4]. In der Periode der
[1] G. Weber, a. a. O. III, S. 592/3. Vgl. Mommsen I, S. 853, der darauf aufmerksam macht, daß sehr oft mehrere Güter einem Großbesitzer gehörten, so daß nicht auf jedes Gut eine freie Familie entfällt.
[2] A. a. O. S. 282.
[3] Vgl. Mommsen II, S. 132.
[4] Georg Adler, Urchristentum und Kommunismus, Ztschr. f. Soz.-Wiss. II (1899) S. 241/2.
[493]
Bürgerkriege ist dann der Stand der freien Bevölkerung ohne Zweifel im ganzen zurückgegangen, und zwar, wie Mommsen ausdrücklich feststellt, weniger durch die blutigen Opfer dieser Wirren, die „nach allgemein gehaltenen und freilich wenig zuverlässigen Angaben 100 bis 150000 Köpfe von der römischen Bürgerschaft, 300000 von der italischen Bevölkerung überhaupt hingerafft haben sollen“, sondern infolge „des ökonomischen Ruins des Bürgerstandes und der maßlosen Ausdehnung der kaufmännischen Emigration, die einen großen Teil der italischen Jugend während ihrer kräftigsten Jahre im Ausland zu verweilen veranlaßte“ [1].
Wieder verschwanden die Bauerstellen, auch die auf erobertem Lande neu angelegten, „wie Tropfen im Meere, seit die Aristokratie das Aufkaufen der Kleinbesitzer sich gesetzlich hatte erlauben lassen und in ihrem neuen Übermut das Austreiben derselben immer häufiger sich selbst erlaubte“ [2].
Es ist klar, daß es nur ein einziges Mittel geben kann, diesen Prozeß des Unheils zwar nicht zu heilen, wohl aber aufzuhalten: die Bauernkolonisation im größten Umfang. Und das ist denn auch die Antwort auf die Frage, die wir uns soeben stellten, warum in Rom der gleiche Krankheitsvorgang, der die Griechenstädte, Karthago und die Staaten Palästinas mit so grauenhafter Schnelligkeit, in wenigen Generationen, zerstörte, so „chronisch“ verlief, warum er fast ein Jahrtausend, und, wenn man Ostrom dazu rechnet, fast zwei Jahrtausende gedauert hat.
Einer der Staaten der kapitalistischen Sklavenwirtschaft im Gebiete des Mittelmeeres mußte als letzter auf dem Kampfplatze bleiben. Denn der aus der Grundverfassung mit Notwendigkeit hervorgehende allseitige Drang nach rücksichtslosester Expansion konnte ein „politisches Gleichgewicht“ wie im aristokratischen Europa des 19. Jahrhunderts oder gar ein Bundesverhältnis auf der Grundlage völliger Gleichheit wie im demokratischen Amerika und Australien unmöglich aufkommen lassen. Einer dieser Staaten mußte zuletzt alle anderen fressen, und dieser eine war Rom.
Man pflegt den Sieg Roms auf eine besondere Rassentugend [3] seines Volkes, auf eine besonders hohe „staatsbildende Kraft“ zurück-
[1] Mommsen, a. a. O. II, S. 395/6.
[2] Mommsen, a. a. O. II, S. 132.
[3] Fries (Politik, S. 46) spricht von den „sehr wenigen glücklichen Völkerstämmen, welche schwer werden beweisen können, daß sie ihr Glück vorherrschend der günstigen Naturanlage und nicht ebensoviel geschichtlichem Glück zu verdanken haben“. Ähnlich Delbrück in einer kleinen Polemik gegen Mommsen: „Der Volkscharakter, wenn er auch am Ausgangspunkt, für uns unerkennbar, vorhanden gewesen sein muß, steht im Licht der Geschichte am Endpunkt, er ist wohl Anlage, aber auch in hohem Maße Produkt der Verfassung und der Geschichte“ (a. a. O. S. 363), Delbrück weist die Rassentheorie auch sonst grundsätzlich mit Energie ab (z. B. S. 23).
[494]
zuführen. Das ist die typische Setzung einer qualitas occulta, das Herumjubilieren auf dem „Gedankenkarussell“. Denn man hat diese „Kraft“ selbstverständlich erst aus dem Siege erschlossen. Wir verstehen die Tatsachen gut, wenn wir uns klar machen, daß Rom ursprünglich ein Landstaat mit einem nur sehr schwachen und kleinen Seehafen und Handel war; es war, neben Makedonien, der erste Landstaat, der von seestaatlichen Errungenschaften befruchtet wurde [1]. Schon von Anfang an war sein Hinterland groß genug, um bei der für uns kaum noch verständlichen Kleinheit der politischen Verhältnisse einer relativ bedeutenden Macht als Basis zu dienen, und die Ausdehnung dieser Basis war in Italien mit seinen sanften Hügelketten und weiten Tälern verhältnismäßig leicht, bis die Alpengrenze mit der Besiegung der cisalpinischen Gallier erreicht war. Und da schon war Rom an Größe und Heereskraft eine gegenüber den möglichen Gegnern unüberwindliche Macht geworden.
Wie dem auch sein mag, Rom war ein Jahrtausend hindurch immer Sieger und blieb als letzter auf dem Felde. Und darum muß unsere „idealtypische“ Darstellung sich auch, wenigstens was die Schlußphasen des Prozesses anbetrifft, allein mit ihm beschäftigen. Denn natürlich verliert in dieser Art der Staatswirtschaft ein endgültig niedergeworfenes Gemeinwesen ein für alle Male seine politische Existenz. Im besten Falle sinkt seine Hauptstadt zu einer Provinzstadt mit lediglich munizipalen Befugnissen herab, deren altes Patriziat, durch die eigene Schwäche und notfalls durch eine Garnison im Schach gehalten, bestenfalls noch die Stellung als Honoratioren behält — die reichsten mögen sich das römische Bürgerrecht erkriechen und erkaufen — und froh sein muß, wenn ihm sein Privateigentum einigermaßen ungeschmälert gelassen wird. Aber als Zentrum eigenen politischen Lebens und selbständiger sozialökonomischer Entfaltung hat die Stadt mit dem Verlust ihrer politischen Autonomie zu existieren aufgehört. In schlimmeren Fällen aber wurde das besiegte Gemeinwesen, Stadt und Volk, mit Stumpf und Stiel ausgerottet, wie in Griechenland Olynth und Theben, wie durch Rom Korinth und Karthago.
In beiden Fällen, und ebenso in den dazwischen liegenden, haben Geschichtsphilosophie und Soziologie an ihnen nichts mehr zu studieren. Sie interessieren sich vor allem für den immer wachsenden, durch kriegerische Eroberung aus immer mehr, ursprünglich selbständigen Staatsgebilden zusammengeschweißten Staatsorganismus, der auf immer höherer Stufenleiter den immer gleichen erschütternden Krankheitsprozeß durchläuft.
[1] „Der Unterschied ist, daß Karthago nur Stadt ist, Rom zugleich Stadtstaat und Bauernschaft“ (Delbrück, a. a. O. S. 410). Vgl. a. 384: „Rom ist sozusagen Athen und Sparta zugleich“.
[495]
Diese kriegerische Integration erreicht mit der Unterwerfung der übrigen Großmächte des Mittelmeerbeckens, Karthagos und der Diadochenstaaten, im Rom des ersten vorchristlichen Jahrhunderts ihren höchsten, damals möglichen Gipfelpunkt. Und das bedingt einerseits, daß alle Erscheinungen der kapitalistischen Sklavenwirtschaft, politische, soziale, ökonomische und psychologische, nirgend in so äußerster Ausprägung auftreten wie in Rom — und es ist andererseits die Ursache, warum die Schlußkatastrophe so erstaunlich lange auf sich warten ließ. Denn nur der Sieger hat jenes zwar nicht rettende, aber doch mildernde und hinauszögernde Mittel zur Verfügung: die Bauernkolonisation.
Jahrhundertelang hat Rom das hablose Proletariat in den leergemordeten Landschaften Italiens als Kolonisten angesiedelt, hat dadurch die Hauptstadt immer wieder politisch saniert und Wehr- und Finanzkraft des Landes immer noch um mehr gestärkt, als das Unwesen der Sklaverei und der Latifundien zerstören konnte. „Da die glückliche Wendung der äußeren Politik es mit sich brachte, daß länger als ein Jahrhundert die Reichen Spielraum für sich fanden, ohne den Mittelstand unterdrücken zu müssen, so hat das römische Volk in seinem Senat längere Zeit, als es einem Volk verstattet zu sein pflegt, das großartigste aller Menschenwerke durchzuführen vermocht, eine weise und glückliche Selbstregierung“ [1]. Noch zwischen dem ersten und dem zweiten punischen Kriege haben solche Landverteilungen im größten Maßstabe stattgefunden; „die wichtigsten darunter sind die Aufteilung der pizenischen Possessionen durch Gajus Flaminius (522), die Anlage von acht neuen Seekolonien (560) und vor allem die umfassende Kolonisation der Landschaft zwischen dem Apennin und dem Po durch die Anlage der latinischen Pflanzstädte Placentia, Cremona, Bononia und Aquileja und der Bürgerkolonien Potentia, Pisaurum, Mutina, Parma und Luna in den Jahren 536 und 565— 577“ [2]. Dann folgte die Besiedelung der heutigen Lombardei zwischen Po und Alpen.
Dann stockte das große Werk, weil eben Italien bis zur natürlichen Grenze erobert war, und sofort trat die Entvölkerung und politische Zersetzung zutage. Die Grachen sollen dann dem Staat 80000 neue italische Bauern gegeben haben, indem sie die Aufteilung fast des ganzen Domaniallandes durchsetzten [3]; Sulla siedelte 120000 Kolonisten in Italien an und ergänzte so wenigstens einen Teil der von der Revolution und von ihm selbst in die Reihen der italischen Bauernschaft gerissenen Lücken [4]. Der Erfolg zeigte sich schlagend in den Bürgerlisten. Die Zahl der waffenfähigen Bürger stieg in sechs Jahren (623—629) von 319000 auf 395000, also um 76000, um fast ein volles Viertel.
[1] Mommsen, a. a. O. I, S. 318.
[2] Mommsen, a. a. O. I, S. 814/15.
[3] Beloch (Bevölkerung) hat starke Zweifel an dieser Ziffer.
[4] Mommsen, a. a. O. II, S. 391/2.
[496]
Aber wieder brach nach kurzer Frist der Verfall herein. Die Gracchen ebensowohl wie Sulla hatten sich bemüht, dem Unheil in einer Art von „Homestead“-Gesetz einen Damm für immer entgegenzusetzen: die Kolonistengrundstücke sollten mit einem Erbzins belastet und unveräußerlich sein. Die Beschränkung, die der kurzsichtigen Raffsucht der Großen im Wege stand, wurde bald wieder aufgehoben [1]. Ebenso erging es den viel milderen Vorschriften, die Caesar für die von ihm begründeten Siedelungen erlassen hatte: zwanzigjähriges Veräußerungsverbot [2]. Der gewaltige Staatsmann nahm auch diese Aufgabe mit seiner gewöhnlichen Energie in Angriff. Da das Staatsland nicht ausreichte, wurde Privatbesitz angekauft; der Pompejussche Kriegsschatz mußte dazu verwendet werden. Nach Sueton wies er 20000 armen Familienvätern Land an, später wurden in den überseeischen Provinzen noch etwa 80000 Kolonisten seßhaft gemacht [3]. Sein Tod machte auch dieser segensvollen Reformtätigkeit ein Ende, die er, wie Mommsen annimmt, die Absicht gehabt haben wird, dauernd fortzusetzen, wie er ja auch durch die Beschaffenheit des Reiches dazu imstande gewesen sei [4].
Dann haben die Kaiser häufig die gleiche Sisyphusarbeit unternommen und jedes Mal dadurch, wie durch eine Bluttransfusion, dem hinsiechenden Körper des Staates und des Volkes neues Leben für eine leider nur zu beschränkte Zeit eingeflößt. Augustus schickte Ansiedler nach allen Provinzen und gründete in Italien 28 Kolonien. In dem einzigen Jahre 30 v. Chr. erhielten 120000 Veteranen Land. Auch Nero befolgte diese Politik, wie viele seiner Nachfolger. Aber immer wieder überflutete das Grundübel der Gesellschaft, das auf der Raubsklavenwirtschaft beruhende Latifundiensystem, die schwachen Deiche, und das Unheil schritt weiter, bis die Grenzbarbaren, zum Teil gerufen [6], zum Teil gewaltsam eindringend, das in seiner Wehr- und Finanzkraft erschöpfte Reich überrannten.
Dieses heroische Mittel konnte nur Rom in genügendem Maße anwenden. Palästina, das rings von Wüsten und Gebirgen und dahinter von weit überlegenen Großmächten eingeschlossene Ländchen, konnte es nicht. Die griechischen Seestaaten — und das beweist, daß keine besondere „Staatsbegabung“ dazu gehörte, um das Mittel zu
[1] Handwb. d. Stw. II. Supplementband, Art. Kolonisation, römische, S. 546. Mommsen III, S. 94.
[2] Mommsen III, S. 539.
[3] Laveleye, a. a. O. S. 252/3.
[4] III, S. 514.
[5] „In immer steigendem Maße wurden die auf dem flachen Lande angesiedelten Barbaren die eigentliche Armee . . . Das Ende war eine wüste Herrschaft der unbotmäßigen Truppen . . . Das Volk war schließlich seiner Armee ausgeliefert, Rom den Barbaren“ (Neurath, S. 90). Vgl. Bury, a. a. O. S. 38ÌÌ., S. 98/9.
[497]
entdecken — haben es auf der Höhe ihrer Macht versucht, vor allem Athen, aber auch Sparta. Athen sandte seit Perikles Kleruchie über Kleruchie hinaus, gleich den Römern durch vorwiegend militärpolitische Erwägungen zu diesem sozialpolitischen Werke getrieben, da die angesetzten Theten durch ihren Besitz aus der letzten Steuerklasse in die dritte aufrückten, deren Zugehörige als Schwerbewaffnete Dienst zu tun hatten. Die Zahl der attischen Kleruchen kann bei Ausbruch des peloponnesischen Krieges auf io ooo veranschlagt werden. Aber hinter dieser Aktion stand nicht die überwältigende Macht des römischen Staates; auch fehlte hier, wo die Kolonien auf den Inseln und den ferneren Gegenden der kontinentalen Meeresküste angesetzt werden mußten, der enge, kraftvermehrende Zusammenhang der Kolonien mit der Mutterstadt, der eine alles niederwerfende Konzentration der Kräfte ermöglichte. Darum schlug diese Bewegung mehr zur Schwächung als zur Stärkung der Mutterstadt aus: die Bundesgenossen, die zum Teil nach Meutereien einen Teil ihres Gebietes gezwungen hatten abtreten müssen, zum Teil sozusagen friedlich zum Verkauf gegen Entgelt, d. h. gegen Ermäßigung ihrer Tribute veranlaßt worden waren, haßten das System und seine Träger, die sie jedenfalls den Hochmut der politischen Herren besonders hart haben fühlen lassen, und so war die Aktion einer der Gründe für den Zerfall des ersten Seebundes [1]. Schließlich ist Athen daran verblutet, daß es seinen Versuch nicht durchzuführen vermochte, in Sizilien neues Siedelland in großartigem Umfang zu gewinnen.
Sogar das konservative heimselige Sparta hat auf der Höhe seiner Macht das gleiche Mittel versucht. Im Jahre 426 wurde am Nordausgang der Thermopylen die Kolonie Herakleia angelegt [2] : der rein militärische Charakter liegt hier offen zutage ; fünf Jahre später wurden in Lepreon Neodamoden angesetzt, und Lysandros eröffnete die Bahn der überseeischen Siedlungen mit der Einsetzung ausgedienter Flottensoldaten in Sestos am Hellespont, einem der wichtigsten strategischen Punkte, an Stelle der ausgetriebenen Einwohner und der dort neben ihnen angesetzten attischen Kleruchen [3].
Vom peloponnesischen Kriege an stockte die Kolonisation so gut wie vollständig: „Bis auf Alexanders Zeit sind Kolonien fast gar nicht mehr begründet worden, ja es ging in Italien ein nicht unbedeutendes Stück griechischen Landes an die Barbaren verloren“ [4]. Solange aber die Kleruchien ausgesendet werden konnten, haben sie auch in Athen
[1] Vgl. Art. Kolonisation, griechische, Handw. d. Stw. II. Supplementband, S. 539.
[2] Beloch, Griech. Gesch. II, S. 325.
[3] Beloch, a. a. O. III, S. 3.
[4] Beloch, a. a. O. III, S. 347.
[498]
sanierend gewirkt und stark dazu beigetragen, daß die Stadt relativ lange dem Übel widerstand [1].
Das ist der ungeheure Krankheitsprozeß, an dem nicht nur diese machtvollen Staaten, sondern diese hochbegabten Völker haben gnadenlos zugrunde gehen müssen. Wahrlich: die Weltgeschichte ist das Weltgericht! Nicht für die Einzelnen, wohl aber für die Gesellschaften. Für sie gilt das Wort: „Wer sich des Schwertes bedient, wird durch das Schwert umkommen“. Und gilt die Warnung, daß die Sünden der Väter an den Kindern heimgesucht werden sollen. Es gibt nur eine einzige standfeste Grundlage für die menschliche Gemeinschaft: die Gerechtigkeit, die der Staaten Fundament ist. Man kann wenig aus der Geschichte lernen: aber das predigt sie auf jeder Seite ihrer mit Blut geschriebenen Bücher, und wehe der Nation, die diese eindringliche Warnung nicht lesen kann oder nicht lesen will!
Neue Völker mußten auf neuem Lande mit neuen Mitteln in mühsamem Aufstieg aus der Tiefe der Barbarei den Weg zu neuen Zielen suchen, nachdem der Weltgeist zornig diesen seinen Versuch in Scherben geschlagen hatte. Alle die Stätten der alten Geschichte wurden zu traurigen Wüsteneien, in denen eine kleine rassenlose Mischbevölkerung als Untertanen der neuen Weltherren ein jämmerliches Dasein führte. Auch diese neuen Herren sind in die alte Schuld verstrickt, und wir sind ihre unglücklichen Erben. Discite moniti! —.
Exkurs : Hans Delbrücks Theorie vom Untergang Roms. ↩
Wir haben in diesem Abschnitt die allgemeine Auffassung von den Gründen dargestellt, die zum Untergang der antiken Stadtstaaten und namentlich des römischen Reiches geführt haben. Dieser Auffassung tritt Hans Delbrück neuerdings mit großem Nachdruck entgegen [2]. Es wird geboten sein, sich mit dem verdienten Historiker auseinanderzusetzen.
Delbrück selbst stellt fest, daß sein Angriff einer tief eingewurzelten, kaum bestrittenen Überzeugung gilt: „Die durch die Jahrtausende geglaubte Überlieferung ist, daß die Zeit greisenhaft geworden, und dieser römische Staat und die antike Kulturwelt an ihrer eigenen inneren Schwäche gestorben sei. Die Menschen dieser letzten Jahrhunderte der Antike haben selber ihr Dasein in dieser Art angesehen, und die Nachwelt hat sich ihrem Urteil angeschlossen und es nachgesprochen.
[1] Beloch, a. a. O. III, S. 345.
[2] Weltgeschichte I. Teil: Das Altertum, Berlin 1923. Die folgenden Ziffern in ( ) beziehen aich auf dieses Werk.
[499]
Von immer weiter um sich greifendem sittlichen Verfall, Rückgang der Bevölkerung, Niedergang der Gesellschaft wird uns berichtet, die führenden Männer der Epoche wie Tacitus sind von Pessimismus erfüllt. . . . Aus einem ganz entgegengesetzten Lager, aus den Schriften der christlichen Kirchenväter hören wir die Bestätigung. . . . Wenn so alle Parteien in der Beurteilung ihrer Zeit übereinstimmen, muß man sich da nicht anschließen? Diese Frage ist mit einem uneingeschränkten „Nein“ zu beantworten, und dieses Nein ist von größter prinzipieller Bedeutung“ (S. 638/39).
Delbrück bestreitet die Wahrheit der überlieferten Tatsachen über den Rückgang der Bevölkerung und den Niedergang der Wirtschaft. Die immer angeführten Gesetze des Augustus hätten sich nur auf die vornehme Gesellschaft Roms bezogen. Er behauptet im Gegenteil, „unanfechtbare Zeugnisse zu haben, daß Bevölkerung und Wohlstand im Wachsen begriffen waren“. Wohl habe ein Mangel an ländlichen Arbeitern bestanden, aber ein solcher „Mangel, und infolgedessen Verödung agrarischer Landschaften ist kein Beweis für den Bevölkerungsrückgang, sondern kann gerade mit wirtschaftlicher Blüte zusammenhängen, die die ländliche Bevölkerung in die Städte zieht. So hatte das gewaltig aufblühende Deutschland vor 1914 einen großen Mangel an ländlichen Arbeitern“ (641). Die Parallele ist unzulässig, denn erstens: wo findet sich im zeitgenössischen Deutschland die „Verödung agrarischer Landschaften“ ?! Und vor allem: wo war denn in Rom die ungeheuer aufblühende Großindustrie, die die Massen vom Land in die Städte saugte ? ! Die Großindustrie, die dieses Aufschwungs nur fähig war, weil sie einen gewaltig wachsenden Markt außerhalb der eigenen Landesgrenzen, einen Weltmarkt zu versorgen hatte ? ! Wir haben oben gezeigt, daß die antike kapitalistische Sklavenwirtschaft im Gegensatz zur modernen kapitalistischen Verkehrswirtschaft ihre Märkte nicht entwickeln kann, sondern geradezu zerstören mußte. Hier saugte nicht die Stadt, sondern das Land stieß aus!
Was nun zweitens den von Delbrück bestrittenen Niedergang der Wirtschaft betrifft, so beruft er sich auf das großartige Straßenbauwesen und auf die Pracht der Bauten Roms und der Provinzialstädte. Aber beides ist durchaus kein Beweis für eine blühende Wirtschaft. Daß ein weitgedehnter Militärstaat wie Rom zum Zweck der raschen Truppenverschiebung gute Straßen anlegte, beweist nur, daß die Militärbehörden über die erforderlichen Mittel an menschlichen Arbeitskräften oder an Geld verfügten, um solche Arbeitskräfte zu mieten. Aber die Tatsache läßt nicht den geringsten Schluß darauf zu, ob die Aufbringung dieser Mittel der Volkswirtschaft ein leichtes Spiel oder eine erdrückende Last gewesen ist; ob die Straßen von zu Tode geschundenen Sklaven und Fronbauern oder von gut bezahlten freien Arbeitern hergestellt
[500]
worden sind, wie etwa in der Neuzeit die Eisenbahnen oder die gewaltigen Straßenbauten durch die europäischen Gebirge. Ebensowenig läßt sich aus dem Vorhandensein der Prachtbauten in Rom und den Provinzialstädten ein gültiger Schluß auf die Lage der gesamten Volkswirtschaft jener Zeit ziehen. Sie sind ein Beweis für den Reichtum der Herrscher und der Ober-, vielleicht auch noch der oberen Mittelklasse: und solcher Reichtum ist nach dem Zeugnis der Geschichte mit der bitterlichsten Armut der Volksmasse und dem schwersten Rückgang der Volkswirtschaft durchaus verträglich. Die Prachtbauten der Pharaonen, der Herrscher Irans, Ludwigs XIV. und seiner deutschen Nachäffer, und etwa, um noch ein anderes Beispiel zu nennen, der Habsburger und des böhmischen Hochadels auf dem Hradschin sind durchaus nicht aufzufassen als die natürlich gereifte Frucht einer reichen Gesellschattswirtschaft: man hatte, um im Vergleich zu bleiben, den Fruchtbaum frevelhaft bis ins Mark angebohrt und mästete sich an dem ausströmenden Lebenssaft.
Delbrück beruft sich für seine Meinung auf einige dissentierende Stimmen aus dem Altertum: auf Aristides von Smyrna (645) und Tertullian (646). Aber erstens könnte mindestens Aristides ein Interesse daran gehabt haben, den römischen Machthabern Annehmlichkeiten zu sagen, und zweitens zeigt eine genaue Betrachtung seiner von Delbrück zitierten Worte, daß er nur den Frieden und die Rechtssicherheit, die pax romana preist. Und so mag auch Tertullian die Zeit, in der er lebt, mit der noch viel ärgeren Zeit der politischen Verwirrung während der großen revolutionären Zuckungen vergleichen, die der Geburt des Kaisertums vorangingen und noch die ersten zwei Jahrhunderte unserer Zeitrechnung erfüllten. Eine Gesellschaft, die an fortwährende Revolutionen, Bürgerkriege, Proskriptionen, Konfiskationen und Massenhinrichtungen, an Militärrevolten, Raub und Brand gewöhnt war, mochte wohl aufatmen, wenn einmal eine Zeit der Ruhe eintrat. In solcher Zeit der Ruhe mag auch die Bevölkerung wieder etwas gewachsen sein: aber für eine Blüte der Volkswirtschaft gibt das alles nicht den geringsten Beweis.
Eine der Grundsäulen der Delbrückschen Anschauung ist die Auffassung, „das soziale Grund übel der alten Welt bestehe darin, daß der kleine Bauer nicht selbständig bestehen konnte, sondern notwendig früher oder später in kapitalistische Abhängigkeit geriet“ (470). Ganz offenbar wird hier nicht der richtigen Meinung Ausdruck gegeben, daß die politische Konstellation der Antike und vor allem die Sklavenhaltung die Lage des kleinen Bauern unhaltbar macht, sondern es besteht die grundsätzliche Auffassung, daß der kleine Bauer an sich überhaupt lebensunfähig sei: „Wir haben die Agrarverfassung sozusagen von Anfang der Weltgeschichte an, als eine besonders schwierige unter
[501]
den der Menschheit gestellten Aufgaben kennen gelernt. Der kleine freie Besitzer, der seine Scholle mit seiner Familie bebaut, ist unfähig, sich in den Wechselfällen des Lebens zu behaupten, und verfällt früher oder später dem Wucher“ (643). Diese Anschauung, die zum eisernen Bestand der konservativ-agrarischen Ideologie gehört und sich z. B. auch bei François Quesnay findet, ist vollkommen unhaltbar. Nichts in den Bedingungen seiner Wirtschaft und seines Betriebes ist geeignet, den kleinen selbstversorgenden Bauern mit seinem Familienbetrieb auch nur zu erschüttern; nur wenn die „außerökonomische Gewalt“ auf ihn wirkt, wankt er und kann unter schlimmen Umständen massenhaft vernichtet werden. Das kann unmittelbare Gewalt sein: Krieg oder Expropriation seitens der herrschenden Oberklasse; oder es kann mittelbare entfaltete Gewalt sein: so im Altertum die Sklavenwirtschaft und in der Neuzeit die Bodensperre. Der neuzeitliche Bauer erliegt immer nur (selbstverständlich abgesehen von einzelnen Fällen persönlicher Verfehlung durch Trunksucht usw.) der Verschuldung : und die ist eine unmittelbare Folge der Sperrung des Bodens in der Rechtsform des massenhaften Großgrundeigentums [1].
Von diesem seinem Standpunkt aus muß Delbrück die Entstehung des römischen Kolonats mit seiner Schollenbindung der Landbevölkerung für einen entschiedenen Fortschritt der Volkswirtschaft halten!
Daraus erklärt sich zum Teil seine Anschauung über die Blüte der Wirtschaft; und daraus erklärt sich ferner seine Meinung, daß von einem Bevölkerungsrückgang ernstlich nicht die Rede sein könne. Er muß zugeben, daß die Lage der Kolonen sehr gedrückt war, aber er ist doch der Meinung, daß sie sich reichlich vermehrt hätten: „Rostowzew ... ist deshalb sicher im Unrecht, wenn er im Zusammenhang mit. der schlechten Lage der Kolonen von Niedergang und Entvölkerung des Reiches spricht. Im Gegenteil, eine kleine bäuerliche Bevölkerung, auch wenn es ihr sehr schlecht geht, kann doch in der Kinderaufzucht immer noch stark sein und war es im römischen Reich, soweit der Vergleich mit den früheren Ackersklaven in Betracht kommt, sicherlich“ (644). Man sieht, er stützt sich hier nirgends auf Tatsachen, sondern lediglich auf theoretische Überzeugung. Nun wird man ihm zwar zugeben dürfen, daß die kleinbäuerliche Bevölkerung im Vergleich zu den früheren Ackersklaven in der Kinderaufzucht stark war : aber das beweist nicht das Mindeste für ihn. Denn die Ackersklaven hatten so gut wie gar keinen Nachwuchs und starben reißend aus. So läßt sich theoretisch mangels von Tatsachen gerade so gut annehmen, daß die Kolonenbevölkerung immer noch einen ungenügenden Nachwuchs hatte, und nur etwas langsamer ausstarb. Die zugrundeliegende Theorie,
[1] S. S. III, S. 602ff.
[502]
daß jede kleinbäuerliche Bevölkerung in jeder denkbaren Lage einen starken Zuwachs aufweist, läßt sich nun außerdem durch Tatsachen widerlegen: Hanssen berichtet aus Schleswig-Holstein, daß die leibeigene Bevölkerung bei nur geringer ehelicher Fruchtbarkeit eine enorme Kindersterblichkeit aufwies: „So bewirkte die Leibeigenschaft gerade das, was sie verhindern sollte, einen Mangel an Arbeitskräften [1].
Worauf beruht denn nun der große Pessimismus der Zeitgenossen ? „Der Schluß aus dem in der Literatur vorwaltenden Pessimismus auf eine niedergehende Zeit ist unrichtig. Pessimismus entsteht, wo kein Ziel mehr erstrebt wird. . . . Dieser römische Staat hatte kein Ziel, keine Aufgabe mehr, gerade weil er alles erreicht hatte. Wirtschaftliche Verelendung und Rückgang der Bevölkerung haben wir bereits abgelehnt und das Gegenteil festgestellt. Ebensowenig darf von moralischem Marasmus und Armut an starken und tüchtigen Persönlichkeiten die Rede sein“ (654).
Was war nun dieses „alles“ was der römische Staat erreicht hatte?: „Nicht Entartung oder Niedergang, sondern gerade der größte Fortschritt, die größte Leistung des Kaisertums, die Heranziehung aller unterworfenen barbarischen Völker in die hellenisch-römische Kultur führte zur Lockerung und Auflösung des Reichsverbandes“ (655).
Die Vorstellung ist die, daß die Provinzen, die bis dahin unselbständige Glieder des großen Ganzen gebildet hatten, sozusagen unmündige Mündel der großen Erzieherin Rom, zu ihrer Reife gelangt sind und sich nun vom Mutterstaat lösen, etwa wie sich in unserer Zeit die amerikanischen Freistaaten von England gewaltsam gelöst haben, und wie sich heute die friedliche allmähliche Verselbständigung der Dominions vom Mutterland vollzieht.
„Im 3. Jahrhundert war Gallien kulturell so fortgeschritten, daß sein Bildungswesen selbst das römische schon übertraf. Man konnte Roms jetzt entbehren, und im Besitz des gleichen Bürgerrechts fühlte man sich der Hauptstadt ebenbürtig und gleichberechtigt“ (655). Aber ist denn wirklich die Auflösung des Reiches in dieser Weise erfolgt, oder nicht viel mehr derart, daß eine der Provinzen nach der anderen: Britannien, Gallien, Spanien, Mösien, Dazien usw. usw. von kleinen Scharen barbarischer Krieger überrannt wurden, denen diese angeblich so volkreichen und wirtschaftlich blühenden Gebiete weder Männer noch Waffen entgegenzusetzen hatten, und denen das angeblich so volkreiche und wirtschaftlich blühende Mutterland weder mit Männern noch mit Waffen zu Hilfe kommen konnte ? ! Hätte sich die Auflösung des Reiches so vollzogen, wie Delbrück es darzustellen sucht, so hätte Rom nur aufgehört, Weltmacht zu sein, wäre aber eine
[1] S. S. III, S. 639.
[503]
führende Großmacht unter Großmächten geblieben. So aber wurde auch das Mutterland selbst früh die wehrlose Beute der nördlichen Barbaren, weil es eben weder Mittel noch Menschen zur Verteidigung gab. Was an militärischer Macht noch da war, waren gedungene Söldner, „nicht mehr die gehorsamen, in der Scheu vor den Göttern und der heiligen Roma lebenden Legionen, sondern zuchtlose, wilde, zum großen Teil barbarische Kriegsbanden“ (658). Wir können wirklich nicht verstehen, wie Hans Delbrück, der große Schöpfer der Kriegsgeschichte, zu der Vorstellung gelangen konnte, daß in einem volkreichen und wohlhabenden Bauernland die Soldateska eine derartige Rolle spielen kann, wie er sie hier (Seite 656ff.) darstellt. Heute vielleicht könnte eine relativ kleine Kriegertruppe im Besitz der ungeheuer überlegenen Waffen (Geschütze, Tanks, Giftgase, Flugzeuge usw.) längere Zeit auch ein starkes Volk so lange niederhalten, wie der Waffennachschub gesichert ist: aber in jener Zeit, wo doch auch der Berufskrieger nur mit Schwert und Lanze bewaffnet war, würde eine zahlreiche und wohlhabende Bauernschaft eine solche Soldateska notfalls mit Dreschflegeln erschlagen haben, wie die freien niedersächsischen Bauern, die Löns im „Werwolf“ schildert.
Diese Mißwirtschaft der militärischen Banden ist nach Delbrück die eine Ursache des Falls von Rom. Wenn hier vielleicht noch darüber gestritten werden könnte, ob die Erscheinung mit der Delbrückschen Grundauffassung von jener Zeit vereinbar ist oder nicht, so ist jeder Zweifel ausgeschlossen bei der zweiten und Delbrück wichtigsten Tatsache, die den Niedergang und schließlichen Sturz herbeigeführt haben soll : der Verarmung des Reiches an Edelmetall. Hier trägt Delbrück, der Eduard Meyers nationalökonomische Anschauungen als eine seiner „schwachen Seiten“ kennzeichnet (427), selbst eine Lehre vor, die vom Standpunkt des Nationalökonomen aus nur als völlig unhaltbar zu bezeichnen ist.
Er stellt mit Recht fest, daß Rom einen ungeheuren jährlichen Zufluß nicht nur von unbezahlten Gütern aller Art, sondern auch von barem Gelde hatte. Es floß ein als Tribut, Steuer, Erpressungsgut und Grundrente oder Kapitalprofit der in Rom wohnenden Reichen. Trotzdem war die Zahlungsbilanz des Reiches und namentlich Italiens in einem ungeheuren Maße passiv. Wir haben schon oben von der Tatsache des riesigen Abstroms von Edelmetallen nach Indien und China, „für die Seide und Gewürze, die man aus diesen Gegenden bezog“ (659) gesprochen. Delbrück meint nun, daß für diese Zwecke das bare Geld dauernd hin und her geschoben werden mußte; „bei der Langsamkeit des Verkehrs aber war der Bedarf an Barmitteln ungeheuer und wuchs mit dem wachsenden Wohlstand“ (658/59). Hierin erblickt er den wichtigsten Faktor für die auch von ihm anerkannte Tatsache, daß
[504]
das Kaiserreich mit einem wachsenden Mangel an Geld zu kämpfen hatte. Es sei ein immer wachsender Teil des Geldvorrates sozusagen immer in natura auf der Reise gewesen und habe demzufolge für seine eigentliche Funktion als Wertmesser und Tauschvermittler gefehlt.
Wir wollen nicht darüber streiten, ob diese Dinge richtig gesehen sind. Wir wollen hier Delbrücks Meinung per inconcessum anerkennen. Aber dann ergibt sich daraus ein für ihn nur um so vernichtenderer Schluß : wenn Rom in der Tat eine blühende Wirtschaft gehabt hätte, so hätte von diesem Hin- und Herschieben des Edelmetalls gar keine Rede sein können. Die Volkswirtschaften tauschen nicht Geld, sondern Waren, gemessen an der Geldelle: wenn Rom als Gegenwert für die indischen Gewürze und die chinesische Seide etwas anzubieten gehabt hätte, so hätte es kein Geld hinausgeben müssen. Die Tatsache des Geldabstroms allein beweist mit voller Klarheit erstens, daß im Römerreich und namentlich in Italien keine Gütererzeugung von irgend welcher Bedeutung bestanden haben kann, und zweitens, daß eine überreiche Klasse von gesellschaftlichen Drohnen, ganz rücksichtslos gegen die immer steigenden Preise der fremden Luxuswaren, aus ihrem der Volksmasse abgepreßten Rieseneinkommen jene Waren immer weiter importieren konnten und durften.
Wenn aus irgendwelchen Gründen der Vorrat an gemünztem Edelmetall im Verhältnis zu dem Umlaufsbedarf der Gesamtwirtschaft empfindlich kleiner geworden wäre, sei es durch Intensivierung des Verkehrs innerhalb der vorhandenen Wirtschaftsgesellschaft, sei es durch Anschluß neuer Wirtschaftsgesellschaften, hier also, wie Delbrück annimmt, der der Naturalwirtschaft entwachsenen Provinzen, sei es schließlich, weil für den natürlichen Verschleiß und Verlust kein Ersatz in neuen Minen beschafft werden konnte (659) : so wäre entweder das Edelmetall teurer, das heißt alle Waren wesentlich billiger geworden, oder es hätte sich das Erschließen neuer Fundstätten gelohnt, oder es hätten sich beide Folgen kombiniert. Aber niemals hätten sich bei der sehr langen Zeit, die diese Entwicklung offenbar gebraucht haben würde, daraus die bösen Erscheinungen ergeben, die in der Tat den Zusammenbruch des Römerreichs mitverschuldet haben: die Geldverschlechterung, der Staatsbankerott, der untragbare Steuerdruck: und dennoch die Unmöglichkeit, Geldsteuern in einem Maße aufzutreiben, das für die Bedürfnisse des Reiches ausreichte; ferner als die Folge davon die Abwälzung des größten Teils der Staatsaufgaben „liturgisch“ auf erbliche, fast verkastete Berufsgenossenschaften; schießlich sogar die Unmöglichkeit, die Söldner zu bezahlen, und der Zwang, sie als Militärbauern anzusetzen, was zu dem finanziellwirtschaftlichen Zusammenbruch auch noch den militärischen fügte. Das alles zusammengenommen bedeutete den Rückfall aus der Geld-
[505]
Wirtschaft in die in Rom seit über einem Jahrtausend völlig überwundene Naturalwirtschaft.
Alle diese Erscheinungen lassen sich unmöglich auf die Weise erklären, wie Delbrück es hier versucht. Gerade so gut könnte man von einem zweifellos an Verblutung gestorbenen Menschen behaupten wollen, er habe keine Wunde gehabt. Jene Tatsachen beweisen dem national-ökonomisch geschulten Soziologen mit vollkommenster Evidenz, daß das spätere Römerreich ein an Menschenzahl und wirtschaftlicher Kraft immer mehr verarmendes und zuletzt zur vollen Ohnmacht herabgesunkenes Staatsgebilde dargestellt hat. Und die Ursache war, wie in Griechenland, der Völkerschwund als Folge der kapitalistischen Sklavenwirtschaft. Ihr „gegenüber hat alles andere nur sekundäre Bedeutung“ [1].
[1] Beloch, Bevölkerung, S. 505.
[506]
Fünfter Abschnitt.
Der Landstaat. ↩
I. Der Feudalstaat. ↩
Wir kehren jetzt plangemäß zu jenem Punkte zurück, wo der primitive Eroberungsstaat den Nebenast des Seestaates aussandte, um nunmehr dem Hauptaste, der Entwicklung des Landstaates, zu folgen.
Daß diese beiden Typen des Staates weit voneinander verschieden sind, ist eine alte Feststellung. „Der Stadtstaat und der Flächenstaat sind zwei Grundtypen der politischen Organisation geworden“, sagt Jellinek[1]. Er macht mit Recht darauf aufmerksam, daß die Bezeichnung des Staates als Land-terre, terra, im schärfsten Gegensatz zur antiken Auffassung steht[2]. Und er sieht ebenso richtig, worauf diese tiefe Wesensverschiedenheit beruht: auf der Bedeutung, die Grund und Boden für die Entfaltung politischer Macht hatten[3]. Wie er auch richtig sieht, daß — wir haben es mehrfach vordeutend gesagt — das Schicksal der Landstaaten wesentlich dadurch bestimmt wird, daß sie die vom Seestaate ausgebildeten Errungenschaften und Ideen in sich aufnehmen, vor allem „die antike Idee der Staatseinheit: das nie vergessene Vorbild des römischen Reiches mit seiner festen Organisation und Zentralisation, mit seiner Konzentrierung der Staatsgewalt“[3]. Und schließlich: die Notwendigkeit dieser Konzentration brachte es mit sich, daß der mittelalterliche wie der Landstaat überhaupt monarchisch war und bis zur Neuzeit blieb.
1. Die Entstehung des Großgrundeigentums. ↩
Wir haben oben (S. 365) gesagt, daß die polare Verschiedenheit des See- und des Landstaates bedingt ist durch die polare Verschiedenheit der ökonomischen Machtmittel, an denen sich das „Gesetz der Agglomeration um vorhandene Vermögenskerne“ bestätigt. Dort ist
[1] Allg. Staatslehre, S. 76.
[2] S. 131. Auch Frobenius (a. a. O.) sieht den Unterschied zwischen „chthonischer“ und „tellurischer“ Kultur, den er allerdings nach ganz anderer Richtung auszuwerten versucht.
[3] A. a. O. S. 17.
[507]
es der mobile, hier der immobile Reichtum, dort das Handelskapital, hier das Grundeigentum, das sich in immer wenigeren Händen anhäuft und dadurch die Klassengliederung und mit ihr das ganze Staatswesen grundstürzend umwälzt.
Es wird daher unsere erste Aufgabe sein, die Ballung des Grundeigentums zu studieren.
Wir kennen die Differenzierung, die sich bereits im Hirtenstamme vollzog von dem Zeitpunkte an, wo das politische Mittel in Gestalt des Raubkrieges und vor allem der Sklaverei ins Spiel tritt. Schon sahen wir den Stamm sich spalten in Edelinge und Gemeinfreie, unter denen als dritter Stand der rechtlose Sklave sich ordnet. Dazwischen besteht noch eine schmale Klasse von persönlich abhängigen Leuten, Flüchtlingen, Verarmten usw., die wir im Seestaate in der Gestalt der „Klienten“ kennen gelernt haben.
Diese in den primitiven Eroberungsstaat eingebrachte Verschiedenheit des Vermögens und damit des sozialen Ranges verschärft sich nun außerordentlich mit der Seßhaftigkeit, durch die das private Grundeigentum geschaffen wird. Starke Unterschiede des Bodenbesitzes müssen bereits bei der ersten Entstehung des primitiven Eroberungsstaates entstehen, wenn die Gliederung der siegreichen Hirtengruppe in große Sklaven- und Hirtenfürsten schon stark ausgebildet war, wie es nach Meitzens und anderer Ansicht z. B. bei den Germanen der Fall gewesen ist[1]. Die Fürsten okkupieren mehr Land als die Kleinen.
Das geschieht zunächst ganz harmlos und ohne das Bewußtsein davon, daß das große Grundeigentum das Mittel einer bedeutenden Mehrung der sozialen Macht und des Reichtums sein wird. Davon kann keine Rede sein; auch hätten die Gemeinfreien in diesem Stadium in der Regel noch die Macht gehabt, die Bildung des Großgrundeigentums zu verhindern — wenn sie geahnt hätten, daß es seine Spitze einst gegen sie selbst kehren würde. Aber niemand konnte das ahnen : Land hat in dem Zustande, den wir jetzt beobachten, keinen Wert. Darum war auch nicht das Land an sich der Preis und das Ziel des Kampfes, sondern „Land und Leute“ : das Land samt den unterworfenen, an die Scholle gefesselten — zur Fronarbeit gezwungenen Bauern, Arbeitssubstrat und Arbeitsmotor, aus deren Vereinigung erst das Ergebnis des politischen Mittels erwächst: die Grundrente.
Nun ist der große Unterschied zwischen der Entwicklung des primitiven Eroberungsstaates im engen Raum an der Seeküste einerseits und im grenzenlosen Gebiet der weitgedehnten Ebenen andererseits der, daß hier noch unendlich viel unbebauten Landes vorhanden ist. Und davon mag sich jeder nehmen, so viel er braucht und bebauen
[1] Vgl. Schmoller, Die soziale Frage, S. 92.
[5θ8]
will und kann. Man denkt so wenig daran, den Einzelnen aus diesem scheinbar unerschöpflichen Vorrat zuzumessen wie aus dem Vorrat an Wasser im Bache oder aus der Atemluft.
Die Herdenfürsten werden der Regel nach schon von Anfang an mehr von dem bebauten Lande und seinen ehemaligen Eigentümern erhalten als die Gemeinfreien[1]. Das ist ihr Fürstenrecht als Patriarchen, Feldherren und Soldherren ihres kriegsgeübten Gefolges aus Halbfreien, Knechten und Schutzhörigen: wie sie von der beweglichen Beute einen größeren Anteil erhalten, so auch von der unbeweglichen. Schon das mag einen bedeutenden Unterschied in der Größe des primitiven Grundeigentums bedeuten. Aber das ist nicht alles und nicht das wesentliche. Die Fürsten brauchen auch von dem bisher unbebauten Lande „ohne Leute“ eine größere Fläche als die Gemeinfreien. Denn sie bringen Knechte, Sklaven mit, die nicht rechtsfähig sind und daher nach allmenschlichem Volksrecht kein Grundeigentum haben dürfen: aber Land müssen sie doch besitzen, um existieren zu können, und so nimmt es selbstverständlich ihr Herr an ihrer Statt, um sie darauf anzusetzen. Je reicher der Hirtenfürst war, um so größer wird der Grundherr.
Wir erkennen daß auch hier die Differenzierung der Vermögen ganz und gar von der vorhergehenden Differenzierung der Klassen abhängt, und nicht umgekehrt, wie die „Kinderfibel“ behauptet.
Mit der Seßhaftigkeit und der Bildung privaten Grundeigentums ist nun zunächst der Reichtum und mit ihm der soziale Rang ungleich fester und dauerhafter errichtet als im Hirtenstande. Denn, wie wir wissen, die größte Herde kann verloren gehen, aber Grundeigen ist unzerstörbar, und arbeitsfähige Menschen, die ihm Ertrag abgewinnen und Grundrente daraus steuern, wachsen auch nach den furchtbarsten Gemetzeln schnell genug nach, wenn sie nicht durch Sklavenjagden im erwachsenen Zustande neu beschafft werden können.
Aber um diesen festen Reichtumskern agglomeriert sich jetzt das Vermögen mit ganz anderer Geschwindigkeit als im Hirtenstande. So harmlos die erste Okkupation war, so muß sich doch sehr bald die Erkenntnis einstellen, daß man um so mehr Renten ziehen kann, je mehr Sklaven man hat, um sie auf noch unbebautem Lande anzusetzen. Da sich nun dem kriegerischen Erwerbsstreben des Adels im Binnenlande nicht die unbegrenzte Weite des Meeres eröffnet, dessen Küsten er plündern kann, so richtet es sich fortan nicht mehr nur auf Land und Leute, sondern auch auf Leute ohne Land, d. h. auf Menschen, die man von ihrem Boden und Besitz losreißt, um sie als Sklaven heimzuführen und auf neuem Boden als Fronknechte anzusetzen. Wenn der ganze
[1] So z. B. in Lakonien (nach Pohlenz) oder im angelsächsischen England (Brodnitz).
[509]
Stamm, der jetzt zum Staate geworden ist, den Feldzug unternimmt, so erhalten die Edelinge den Löwenanteil; sehr oft aber ziehen sie auf eigene Faust, nur mit ihrem Gefolge aus freien Abenteurern, Klienten und Sklaven aus, und der daheimgebliebene Gemeinfreie erhält keinen Anteil an der Beute. Und nun geht's im Zirkel immer schneller voran mit der Massierung des adligen Grundeigentums: je mehr Sklaven der Edeling hat, um so größer ist sein Einkommen aus (naturaler) Grundrente; um so mehr kriegerische Gefolgsleute kann er unterhalten, und um so mehr Sklaven kann er mit ihrer Hilfe erbeuten und zur Vergrößerung seiner Rente ansiedeln.
Dieser Prozeß vollzieht sich auch dort, wo eine Zentralgewalt besteht, der nach allgemeinem Volksrecht die Verfügung über das unbebaute Land sozusagen als Treuhänder der ganzen Siegergruppe zusteht[1], und zwar nicht etwa nur unter ihrer passiven Duldung, sondern sehr häufig, ja, im Anfang regelmäßig unter ihrer ausdrücklichen Billigung. So lange nämlich der primitive Grundherr zu schwach ist, um der Zentralgewalt gefährlich zu werden, liegt es in ihrem Interesse, ihn recht stark zu machen, seine Kriegsmacht zu fördern, die er als seine Staatspflicht unter die Fahne des Herrschers zu stellen hat. Dieser Zusammenhang ist uns aus der Geschichte der westeuropäischen Feudalstaaten bereits sehr vertraut: um zu zeigen, daß er auch unter ganz verschiedenen Umständen zur Erscheinung kommen muß, sei eine einzige Stelle angeführt: „Die Hauptleistung auf Fidschi lag im Kriegsdienst, der bei siegreichem Ausgang zu neuer Schenkung von Land samt den darauf Wohnenden als Sklaven und damit zur Übernahme neuer Verpflichtungen führte“[2].
Diese Anhäufung des Grundeigentums in immer gewaltigerem Ausmaße in den Händen des Grundadels führt nun den primitiven Eroberungsstaat zum entfalteten Feudalstaat, d. h. einem Staatswesen mit ausgebildeter hierarchischer Staffelung.
Es handelt sich hier um einen geradeso typischen, weil aus den Grundbedingungen der sozialökonomischen Ordnung mit logischer Notwendigkeit hervorgehenden Prozeß, wie es der der kapitalistischen Sklavenwirtschaft ist : einen Prozeß, der sich in Japan ebenso abgespielt hat wie in den meisten europäischen Staaten und uns daher wohl-
[1] Vgl. Richard Lasch, Die Landwirtschaft der Naturvölker, Zeitschr. f. Sozialw., 7. Jahrg. 1904, S. 256. „In allen primitiven Ackerbaurechten tritt der Grundsatz zutage, daß ein individueller Anspruch auf Grund und Boden bzw. auf die Nutznießung desselben nur so lange aufrecht bleibt, als das in Rede stehende Land unter Kultur bleibt. Wird der Anbau aber wieder aufgelassen, so verliert der Nutznießer sein Anrecht, und das Land fällt wieder an die Gemeinde zurück“. Über das Obereigentumsrecht des germanischen Volkskönigs als des Treuhänders vgl. Jellinek, Allg. Staatslehre, S. 672. Die Vorstellung ist noch heute in England lebendig.
[2] Ratzel, Völkerkunde I, S. 263.
[510]
bekannt ist. Wir werden ihn, um diese Zwangsläufigkeit zu illustrieren, vorwiegend an weniger bekanntem Material darstellen und dabei die ethnographischen Daten mehr als die eigentlich geschichtlichen heranziehen. Dabei wird sich als wertvolles Nebenergebnis zeigen, daß die sog. „materialistische Geschichtsauffassung“ unmöglich die volle Wahrheit geben kann: denn die wirtschaftlich-technische Grundlage der verschiedenen Feudalstaaten ist sehr verschieden; so z. B. hat Japan nicht Pflug- sondern Hackbau als Grundlage, die Rinderhaltung fehlt so gut wie ganz : und dennoch hat sich das Feudalsystem hier bis in die Einzelheiten dem europäischen gleich entwickelt. Ebensowenig spielt die Rasse eine Rolle: die Japaner sind Mongolo-Malayen.
Der Prozeß, den wir darzustellen haben, ist eine allmählich sich vollziehende grundstürzende Umwälzung der politischen und sozialen Gliederung des primitiven Eroberungsstaates: die Zentralgewalt verliert ihre Macht an den Grundadel, der Gemeinfreie sinkt, und der „Untertan“ steigt.
Wir haben also eine recht komplizierte Entwicklung vor uns: zwei der Faktoren, die den primitiven Staat zusammensetzen, sinken hinab, zwei andere steigen empor. Wir werden versuchen, die verschlungenen Fäden so gut wie möglich voneinander zu lösen und betrachten zu diesem Zwecke zuerst die Zentralgewalt.
2. Die Zentralgewalt im primitiven Eroberungsstaat. ↩
Der Patriarch des Hirtenstammes hat bei allem Ansehen, das ihm sein Oberpriester- und Heerführeramt gewährt, doch gemeinhin keine despotische Gewalt gegenüber den nicht zu seiner engeren „Familie“ gehörigen freien Genossen. Und noch der „König“ der kleinen, eben seßhaft gewordenen Völkerschaft hat ganz allgemein nur sehr beschränkte Macht. So berichtet Ed. Meyer von den semitischen Stämmen der Urzeit, sie hätten durchweg unter Herrschern oder Königen gestanden, wenn auch offenbar immer „mit sehr bescheidener, durch den Rat der Ältesten eingeschränkter Gewalt“[1], und Jellinek sagt von dem germanischen Königstum, es habe sich wesentlich aus zwei Elementen zusammengesetzt, der persönlichen Herrschergewalt und dem Obereigentum an allem Grund und Boden, das wir soeben als Inhalt aller Volksrechte bezeichnet haben: der König ist sozusagen der Treuhänder dieses Erbteils der ganzen Nation. „Beide Rechte sind von Haus aus nicht unbeschränkt. Neben dem Königsgericht bleibt das Volksgericht bestehen, dem königlichen Obereigentum steht auf mannichfache Weise begründetes Privateigentum als der königlichen Verfügungsgewalt unantastbar gegenüber. Das germanische Königtum
[1] Gesch. d. Altertums 1, S. 396.
[511]
wird daher als eingeschränkte Macht geboren. Damit ist aber von vornherein ein Dualismus zwischen Königsrecht und Volksrecht gesetzt, den das Mittelalter niemals überwunden hat“. Damit haben wir einen ferneren Unterschied zwischen dem See- und dem Landstaat aufgefunden: „Der mittelalterliche Staat ist dualistisch geartet, während der antike Staat seinem innersten Wesen nach monistisch war und geblieben ist“[1]. So hatten auch bei den Marotse nach Richter (S. 135) die freien Krieger ursprünglich bedeutende Rechte, von denen auch später noch der Volksversammlung (Pitse) ein starker Teil verblieb, die unter dem Vorsitz des Reichskanzlers (Gambella) tagte.
Dagegen pflegt die Zusammenfassung zahlreicher Hirtenstämme durch kriegerische Genies zumeist in despotischen Formen zu erfolgen : „Gerade der Nomadismus ist ausgezeichnet durch die Leichtigkeit, mit der er aus dem patriarchalischen Zusammenhang despotische Gewalten von weitreichendster Macht entwickelt“[2]. Auch das ist ein typischer Zug: überall ordnet sich auch das unbändigste Volk im Kriege willig der unbeschränkten Gewalt eines Einzelnen unter, aus klar erkannter Notwendigkeit, die „selbst dem Trotzigsten einleuchtet“[3]. Der freie primitive Jäger, der „praktische Anarchist“, leistet seinem Häuptling auf dem Kriegspfade unbedingten Gehorsam; die freien Kosaken der Ukraine, die in Friedenszeiten keinerlei Autorität anerkannten, räumten ihrem für den Krieg gewählten Hetman die volle Gewalt über Leben und Tod ein[4]. „Bei den Turkmenen entschied die Gemeinde als Ganzes die gemeinschaftlichen Angelegenheiten, nur für die Dauer der großen Raubzüge, der Alamans, wurden Führer mit absoluter Gewalt gewählt“[5].
Wie an der Spitze der großen Nomadenzüge allmächtige Despoten stehen: Omar, Attila, Dschinghis Khan, Timur, Mosilikatse, Tschaka, Ketschwäyo — so pflegt auch in den primitiven Großstaaten, die aus der kriegerischen Zusammenschweißung mehrerer primitiver Kleinstaaten
[1] A. a. o. S. 318/9.
[2] Ratzel, a. a. O. II, S. 388/9.
[3] Röscher, Politik, S. 21. Er erinnert daran, daß die freiheitstrunkenen Römer in Zeiten der Kriegsnot keine Bedenken trugen, in der Diktatur die Königsmacht wiederherzustellen.
[4] Gogol schildert in seinem herrlichen „Taras Bulba“ sehr eindrucksvoll, wie vor der Wahl zum Hetman der Kandidat gesenkten unbedeckten Hauptes im Kreise der Krieger steht, die die Mützen tragen, wie aber nach der Wahl der Hetman allein das Haupt bedeckt hat, während alle anderen barhäuptig in demütiger Haltung der Befehle des nun Allmächtigen harren. Das erinnert an die berühmte Stelle aus Caesar, De bello gallico VI, 23: „Im Kriegsfalle werden Heerführer mit voller Gewalt über Leben und Tod erwählt. Im Frieden aber gibt es keinen gemeinsamen Beamten, sondern die Häuptlinge der Landschaften und Gaue sprechen unter den Ihrigen Recht und schlichten Streitigkeiten“.
[5] Junge, Problem der Europäisierung, S. 122.
[512 ]
entstanden sind, im ersten Anfang eine starke Zentralgewalt zu bestehen. Als Beispiele seien Sargon, Cyrus, Chlodwig, Karl der Große, Boleslaw der Rote genannt. Zuweilen, namentlich wenn der Kriegszustand lange andauert, weil der Staat seine (soziologische oder geographische) Grenze noch nicht erreicht hat, wird die Zentralgewalt in den Händen kräftiger Monarchen immer stärker und kann bis zum tollsten Despotismus und Cäsarenwahnsinn ausarten: namentlich das Zweistromland und die bekannten Negerstaaten Afrikas, Dahomey und Ashanti, bieten dafür charakteristische Beispiele. Kambyses ist ja für diese Art der geistigen Erkrankung fast noch typischer geworden als Nero und Caracalla.
Wir können im allgemeinen sagen, daß die Ausbildung der despotischen Regierungsform davon abhängt, welche religiöse Stellung der Harrscher neben seinem Feldherrnamt einnimmt, und ob er das Handelsmonopol besitzt oder nicht.
Die „Theokratie“ — das Wort stammt nach Jellinek von Josephus — hat zwei Grundtypen. In dem einen ist der Herrscher beschränkt durch die Priesterschaft, in dem anderen ist er selbst Gott oder doch Gottes Sprachrohr und Werkzeug. Im ersten Typ ist die Staatsgewalt von äußerster Schwäche, im zweiten von „unwiderstehlicher Stärke“[1].
Der „Cäsaropapismus“, wie die Verbindung von weltlicher und geistlicher Gewalt in einer Hand gewöhnlich genannt wird, neigt überall dazu, die krasseren Formen des Despotismus auszubilden, während bei Teilung der Gewalten ihre Träger sich gegenseitig hemmen und mäßigen.
An und für sich scheint das primitive Königtum recht schwach zu sein. Das zeigt sich namentlich in der Geringfügigkeit und Unsicherheit seiner Einkünfte. Meray hat darüber einiges Material gesammelt[2]. „In primitiven Verhältnissen hat der Häuptling, der oft ganz in den Hintergrund tritt, meist nur geringe oder gar keine Ansprüche auf besondere Einkünfte. Allenfalls fällt ihm ein ausgesuchtes Stück der Jagdbaute zu, und man sorgt allgemein für seinen Unterhalt“ (nach Schurtz, Grundriß einer Entstehungsgeschichte des Geldes). In Nordafrika werden vielfach nur freiwillige Gaben gesammelt, wenn der Häuptling es braucht (Pantitschke, Ethnogr. Nordafrikas). Bei den Indianern Brasiliens erhalten die Häuptlinge weder Abgaben noch Geschenke, sondern nur einen größeren Anteil an der Beute (Martins, Rechtszustand). In Dahomeh (nach Ellis) macht der Fürst Plünderzüge im eigenen Lande oder hat Diebe im Gefolge, die auf seine Rechnung stehlen (Hutton, Die Ashantis). Die Steuererhebung des Babulafürsten ist dagegen kaum mehr als eine organisierte Bettelei. Später lebt die
[1] Allg. Staatslehre, S. 289t.
[2] Neue biologische Grundlagen der Soziologie, Pol.-Anthrop. Revue 1908.
[513]
Zentrale hauptsächlich von den Geldstrafen, „die in diesem Sinne auch der Anfang oder doch der Anstoß zur eigentlichen Besteuerung sind“ (Schurtz).
So ist auch das Königtum der Stämme arischer Sprache überall da sehr schwach, wo keine großen Eroberungen vorangegangen sind. Röscher trägt eine ganze Reihe von Beispielen dafür zusammen, daß germanische Volkskönige wegen eines Unglücks im Kriege, ja wegen einer Mißernte, abgesetzt oder gar getötet worden sind[1]. Sie sind dem Stamme eben für die Gunst der Götter, deren Dienst sie sozusagen monopolisieren, verantwortlich. So trifft z. B. auch den „Wasserhäuptling“ der Kuku, eines Nilotenstammes am weißen Nil, die Todesstrafe, wenn Dürre eintritt[2].
In aller Regel stehen neben dem primitiven Volkskönige die Häupter der Familien, die Patriarchen, als sehr mächtiger Rat; in der Odyssee heißen sie zuweilen selbst noch „Könige“[3]. Daß die semitischen Stämme in gleicher Weise organisiert waren, haben wir soeben nach Ed. Meyer berichtet; und ganz das gleiche finden wir im afrikanischen und ostasiatischen Kulturkreise. Bei den Marotse wird der Gambella, der Reichskanzler, von den Großen präsentiert, und auch auf die endgültige Wahl wirken sie ein. Er steht sehr stark neben dem Könige[4]. Und gerade so liegen die Dinge in den Malayenstaaten Insulindiens, echten „Seestaaten“, deren Entstehung ein genaues Gegenstück zu denen des Mittelmeers bildet. Auch hier ist der Fürst im allgemeinen machtlos; die Gauhäupter (in Sulu die Datto, in Atschin die Panglima) haben die Gewalt.
Wo aber der Cäsaropapismus einspielt, „wo, wie in Tobah dem Herrscher noch religiöse Motive die Stellung eines kleinen Papstes einräumen, da wendet sich das Blatt. Die Panglima hängen dann ganz vom Radscha ab, sind nur Beamte“[5].
Man kann hieraus entnehmen, wie sehr es kräftigen Herrschern angelegen sein mußte, das Oberpriesteramt, wenn es in der Hand einer unabhängigen Priesterschaft lag, an sich zu bringen. So ist es Chammurapi gelungen, der Priesterschaft das Gerichtswesen zu entziehen und an Schöffen und königliche Richterkollegien zu übertragen[6]; Saul ist daran gescheitert[7].
[1] Politik, S. 57.
[2] J. van den Plaas, Die Kuku, Coll. de monographies ethnographiques, Bruxelles 1910.
[3] Über Hellas vgl. Beloch I. 1, S. 214. Über die epeirotischen Molosser, Kaerst, S. 179.
[4] Richter, Die Marotse, S. 134.
[5] Ratzel, Völkerkunde I, S. 408; vgl. a. I, S. 124/5.
[6] Gesch. d. Altertums I. 2, S. 639.
[7] Robert Weiß, a. a. O. S. 20/1.
[514]
Umgekehrt ließ sich auch das Königtum nicht so ohne weiteres abschaffen: es war oft allzu tief in der religiösen Anschauung des Volkes verwurzelt. Noch bis in die Neuzeit hinein hat der englische König unzählige Male die Sitte des Handauflegens üben müssen, um skrofulöse Kinder magisch zu heilen. An den Träger eines solchen Charisma wagt man nicht so leichthin zu rühren. Mindestens muß den Göttern der vertraute Diener gelassen werden: darum haben die Gauhäupter von Athen und Rom, als sie das alte Königtum abschafften, doch wenigstens den alten Titel einem sonst machtlosen Mitinhaber der Gewalt aus dem alten Herrscherhause gelassen. Aus demselben Grunde bleibt häufig der Nachkomme der alten Stammkönige als im übrigen ganz ohnmächtiger Würdenträger erhalten, wenn schon längst die eigentliche Regierungsgewalt auf einen Kriegshäuptling übergegangen ist. Auch dafür haben wir Beispiele aus allen Kulturkreisen : wie im späteren Merowingerreich der karolingische Majordomus neben dem „rex crinitus“ aus dem alten Hause Merowechs, so steht in Japan der Shogun bis ins ig. Jahrhundert neben dem Mikado[1], im Inkareiche der Heerführer neben dem mehr und mehr auf die priesterlichen Funktionen beschränkten Huillcauma, und in Ägypten neben dem frommen Amenhotep IV. der Hausmeier Haremheb, der „die höchsten kriegerischen und Verwaltungsstellen auf seinem Haupte zu vereinigen wußte, bis er die Machtfülle eines Reichsverwesers besaß“[2].
Außer durch das Oberpriesteramt hat die Macht des Königs oft eine sehr bedeutende Vermehrung durch das Handelsmonopol erlangt.
Das fällt ihm auf primitivster Stufe naturgemäß zu: ist er doch als der große Zauberer des Stammes der Einzige, der es wagen darf, Fremden gegenüberzutreten. Darum hat er neben seiner Funktion als Leiter der Arbeits- und Sachgüterverteilung zumeist die zweite „der Vertretung der Gemeinschaft nach außen, vor allem den Güteraustausch mit der Außenwelt. So ist der Häuptling vielfach zugleich der Handelsmann der Gemeinschaft und unter primitiven Verhältnissen, wie z. B. bei vielen brasilianischen Waldindianern, auch zugleich der einzige Handelsmann seiner Gemeinschaft“[3]. Max Weber schreibt: „Die Regulierung des Außenhandels liegt ursprünglich völlig in der Hand des Häuptlings, der sie zunächst im Interesse der Stammesgenossen handhaben muß. Er macht sie sich zur Einnahmequelle, indem er Zölle erhebt, die ursprünglich nichts anderes sind als ein Entgelt für den Schutz, den er stammfremden Kaufleuten gewährt, indem er — selbst-
[1] Vgl. Tokugo Fukuda, Die gesellschaftlich-wirtschaftliche Entwicklung in Japan, zit. n. der Anzeige in „Année sociologique“ 1900/1.
[2] Schneider, Kultur und Denken der alten Ägypter, Leipzig 1907, S. 22.
[3] Max Schmidt, Grundriß der ethnologischen Volkswirtschaftslehre, S. 62/3.
[515]
verständlich immer gegen Entgelt — Marktkonzessionen verleiht und den Marktverkehr schützt. Häufig geht dann der Häuptling zum Eigenhandel über, den er zum Monopol gestaltet“[1].
Die Negerhäuptlinge sind in der Regel „Monopolisten des Handels“[2]. So auch der Sulukönig[3]. Bei den Mabunda ist der König „streng nach dem Rechte der einzige Kaufmann seines Landes“[4]. Ebenso bei den Marotse, deren Fürst Sepopa den europäischen Handel mit Gummi, Elfenbein, Gewehren monopolisierte[5]. Bei den Ashanti betrieb vor der englischen Eroberung der König einen schwunghaften Handel durch seine Häuptlinge, denen er Vorschüsse in Goldstaub einhändigte: sie waren am Gewinn beteiligt[6].
Auch die Galla, die keine Neger sind, haben dieses Handelsmonopol ihres Oberhäuptlings, soweit er als solches anerkannt ist. „Keiner der Untertanen darf direkt mit den Fremden handeln“[7].
Ratzel würdigt die Bedeutung dieser Institution treffend wie folgt: „Mit der Zauberkraft verbindet sich zur Steigerung der Macht des Häuptlings das Monopol des Handels. Indem der Häuptling der Vermittler des Handels ist, bringt er alles in seine Hand, was seinen Untertanen begehrenswert ist, und wird der Spender guter Gaben, der Erfüller der heißesten Wünsche. In diesem System liegt sicherlich eine Quelle großer Macht“[8]. Wenn sich im primitiven Großstaat, im Eroberungsgebiete, wo die Regierungsgewalt des Kriegsfürsten ohnehin schon bedeutend zu sein pflegt, auch dieses Machtmittel dazu gesellt, kann das Königtum sehr mächtig werden.
Das aber ist bis auf sehr hohe Stufen hinauf oft der Fall. Salomo hatte ein solches Monopol[9], ebenso die ägyptischen Pharaonen, „die als Schiffsbesitzer Export und Import trieben, später die Dogen von Venedig in den ersten Zeiten ihrer Stadt, endlich die Fürsten zahlreicher Patrimonialstaaten Asiens und Europas, so die Habsburger bis tief in das 18. Jahrhundert hinein“[10].
[1] Max Weber, Wirtschaftsgeschichte, S. 62/3.
[2] Ratzel, Völkerkunde II, S. 66. Vgl. derselbe, Anthropog. I, S. 161.
[3] Ratzel, Völkerkunde II, S. 118.
[4] Ratzel, Völkerkunde II, S. 218.
[5] Richter, Die Marotse, S. 27, 139.
[6] Casely Hayford, Gold Coast Native Institutions. Als die Engländer die an die Küste kommenden Sklaven freiließen, hörte dieser blühende Handel auf, weil die Häuptlinge keine Rückfracht mehr nehmen konnten. Die befreiten Sklaven sollen zumeist zugrunde gegangen sein; ihre „Freiheit“ habe keinen Vorteil gegenüber der sehr milden Sklaverei der Ashanti bedeutet.
[7] Ratzel, a. a. O. II, S. 167.
[8] Ratzel, a. a. O. I, S. 125.
[9] Frants Buhl, a. a. O. S. 17.
[10] Max Weber, Wirtschaftsgesch., S. 176/7. Über das Monopol der byzantinischen Kaiser an allen eigentlichen Massenwaren vgl. Schipper, a. a. O. S. 9. Die Türken in Konstantinopel und Ägypten folgten dem Beispiel. (Vgl. Kulischer, a. a. O. S. 374/5, der zahlreiche Fälle aus Völkerkunde und Geschichte zusammenträgt.)
[516]
Als nämlich der absolute Staat sich bildete, erhoben vielfach die Fürsten wieder den Anspruch auf dieses Monopol. „So wurde in Frankreich 1577 geradezu erklärt, aller Handel, und 1588, aller Gewerbefleiß sei droit domanial: alle Kaufleute und Gewerbetreibende sollten sich deshalb in Gilden vereinigen und für die Erlaubnis, ihr Geschäft fortzusetzen, ansehnliche Geldsummen bezahlen. Die englische Elisabeth hielt sich für berechtigt, jeden Handelszweig zu monopolisieren, wobei denn oft genug die früheren Betreiber elend zugrunde gingen“[1]. Elisabeth folgte hier nur einer alten englischen Tradition: die fürstliche Monopolkonzessionierung war in England früh „in größtem Umfang und am systematischsten von den Stuarts entwickelt worden, dort aber auch unter dem Protest des Parlaments am frühesten zusammengebrochen“[2]. Man wird hier einen, und nicht den geringsten Grund für den Sturz der Dynastie zu suchen haben: hier liegt einer der empfindlichsten Punkte des dritten Standes ; der Zornesschrei des beleidigten Kapitals klingt deutlich aus Lockes uns bekannter Kampfschrift. Wie überhaupt die Verhältnisse und Einrichtungen der stammverwandten normannischen Herrscher in Sizilien oft das Vorbild der Engländer gewesen sind — wir werden davon ausführlich zu sprechen haben — so mag auch diese Einrichtung jenes ersten modernen Staates Europas als Modell gedient haben: schon im 12. Jahrhundert hatte dort das Königtum den Grundherrn das Bergregal abgewonnen[3], und Friedrich II versuchte bekanntlich, ein Getreidehandelsmonopol durchzusetzen[4].
Das also sind die Hauptfaktoren, die die Entstehung einer rein despotischen Regierung befördern. Im übrigen scheint die Regel zu sein, daß selbst in den äußerlich krassesten Fällen von Despotismus doch kein monarchischer Absolutismus besteht. Der Herrscher darf ungestraft gegen seine Untertanen wüten, namentlich gegen die Unterklasse, aber er ist dennoch in der Regel durch feudale Mitregierung stark beschränkt. Ratzel bemerkt dazu im allgemeinen: „Der sog. .Hofstaat' afrikanischer oder altamerikanischer Fürsten ist wohl immer der Rat. . . . Die Willkürherrschaft, deren Spuren wir dennoch überall bei Völkern auf niederer Stufe begegnen, auch wo die Regierungsform republikanisch ist, hat ihren Grund nicht in der Stärke des Staates oder Häuptlings, sondern in der moralischen Schwäche des Einzelnen, der fast widerstandslos der über ihm waltenden Macht anheimfällt“[5]. [Das
[1] Röscher, Politik, S. 232.
[2] Weber, Wirtscbaftsgesch., S. 246.
[3] Weber, Wirtschaftsgesch., S. 166.
[4] Weber, Wirtsch.-Gesch. S. 246.
[5] Ratzel, Völkerkunde I, S. 124. Durkheim (Division du travail social, S 172) führt das Entstehen dieses Despotismus in ähnlicher Weise darauf zurück, daß in primitiven Gesellschaften der Einzelne in einem für uns fast unvorstellbaren Maße durch den religiös gesicherten Normenapparat der Gruppe gebunden ist. Sie unterwerfen sich ebenso bedingungslos demjenigen, der die Gruppe repräsentiert (vgl. S. 156). „Der Despotismus, soweit er nicht nur das Zeichen eines Verfalls oder persönlicher Geisteskrankheit ist, ist nichts anderes als ein umgewandelter Kommunismus“ (S. 173).
[517]
Königtum der Sulu ist ein beschränkter Despotismus: sehr mächtige Minister (Induna), bei anderen Kaffernstämmen ein Rat, der häufig Volk und Fürsten beherrscht, stehen ihm zur Seite[1]. Trotzdem wurde „unter Tschaka jedes Niesen und Räuspern in Gegenwart des Tyrannen und jedes trockene Auge beim Tode eines Anverwandten des Königshauses mit dem Tode bestraft“[2]. Ganz dasselbe gilt von den durch ihre furchtbare Blutwirtschaft berüchtigten Negerreichen Dahomey und Ashanti: „Trotz der Verwüstung der Menschenleben in Kriegen, Sklavenhandel und Menschenopfern herrschte nirgends unbeschränkter Despotismus . . . Bowditch hebt die Ähnlichkeit des in Ashanti bestehenden ständischen Systems mit dem persischen hervor, wie Herodot es beschreibt“[3].
Wir müssen uns also wohl hüten, Despotismus und Absolutismus gleichzusetzen. Auch in den westeuropäischen Feudalstaaten war des Herrschers Gewalt über Leben und Tod häufig ganz unbeschränkt, und dennoch war er ohnmächtig, wenn die „Großen“ gegen ihn waren. Solange er die Klassengliederung und Klassenrechte nicht antastet, mag er seiner Grausamkeit die Zügel schießen lassen und wohl sogar einmal einen der großen Herren opfern: aber wehe ihm, wenn er es wagen wollte, die sozialen und ökonomischen Rechte seiner Großen anzutasten. Sehr charakteristisch ist diese, nach der einen Seite (rechtlich) ganz freie, nach der anderen (politisch) engbegrenzte Macht in den großen ostafrikanischen Kaiserreichen zu studieren gewesen. „Die Regierung der Waganda und Wanyoro ist so, daß der Theorie nach der König das ganze Land beherrscht, doch ist dies nicht viel mehr als eine Scheinregierung, denn in Wahrheit gehört das Land den obersten Häuptlingen des Reiches. Zu Mtesas Zeit verkörperten sie den Widerstand des Volkes gegen fremde Einflüsse, und Muanga fürchtet sich vor ihnen, wenn er Neues einführen möchte. Wenn nun auch das Königtum in Wirklichkeit beschränkt ist, so kommt ihm doch eine imposante Stellung im Äußerlichen, im Formalen zu. Der Masse des Volkes steht der Herrscher als unbeschränkter Gebieter gegenüber, denn er verfügt frei über Leben und Tod und fühlt sich nur im engsten Kreise seiner obersten Höflinge gebunden“[4].
Um nun auch noch den letzten der großen Kulturkreise zu nennen,
[1] Ratzel, a. a. O. S. 118.
[2] Ratzel, a. a. O. I, S. 125.
[3] Ratzel, a. a. O. I, S. 346.
[4] Ratzel, a. a. O. II, S. 245.
[518]
so gilt das gleiche auch von den Ozeaniern: „Nirgends fehlt ganz eine repräsentative Vermittlung zwischen Fürst und Volk . . . Das aristokratische Prinzip korrigiert . . . das patriarchalische. Daher beruht der hochgesteigerte Despotismus mehr auf Klassen- und Kastendruck als auf dem übermächtigen Willen eines Einzelnen“[1].
3. Die Zersetzung des primitiven Eroberungsstaates. ↩
a) Die politische Zersetzung.
Die Verschiedenheiten in der Macht der Zentralgewalt, die sich in zahllosen Abschattungen finden, sind juristisch und ethnologisch, aber nicht auch soziologisch von hohem Interesse. So groß diese Macht nämlich anfangs auch sein mag : ein unvermeidbares Geschick zersplittert sie dennoch sehr schnell, und zwar um so schneller, je größer sie war, d.h. je weiter das Gebiet des primitiven Eroberungsstaates sich dehnte.
Schon die Machtvermehrung der einzelnen Adligen durch den geschilderten Prozeß der immer vermehrten Okkupation und Besiedlung bisher ungenützten Landes kann sie mächtiger machen, als der Zentralgewalt lieb ist. Dann muß sie die Hilfe der großen Herren, die sie bisher befehlen konnte, erkaufen und schwächt sich dadurch ebensoviel, wie sie die aufkommenden selbständigen Gewalten stärkt. Das war z. B. in den Landschaften des alten Hellas der Fall, wo das einst so mächtige Königtum, dessen Größe von seinen Burg- und Grabbauten bezeugt wird, schnell verfiel: „Die Burgherren wurden jetzt selbst zu Königen, die, auf ihren ausgedehnten Grundbesitz und ihre bewaffneten Gefolgsmänner gestützt, ihre kleinen Staaten beherrschten“[2]. Die Macht des Königtums hatte beruht auf dem ausgedehnten Kronland, der befestigten Burg und dem in ihr aufbewahrten Schatze. Aber das Kronland und der Schatz schwanden durch Geschenke und Belehnungen an die Gefolgsmannen dahin, und wenigstens jenes konnte durch glückliche Beutezüge nicht wieder ersetzt werden, „um so weniger, als es galt, auch die jüngeren Söhne mit Landgütern auszustatten“. So verging z. B. Mykenes gewaltige Königsmacht[3]. Im engen Gebiet der griechischen Gebirgslandschaften konnte dieses adlige Großgrundeigentum keine absolut ungeheuren Ausmaße erreichen: aber entsprechend klein war auch aus demselben Grunde das Gebiet und die Macht des Königs. Im Landstaate aber ist dem Riesenwachstum des Grundherrn kaum eine Grenze gesteckt, und entsprechend wächst seine politische und militärische Macht und Selbständigkeit. „Wenn in einem Clan“, berichtet Mommsen von den Kelten, „ein einziger Adliger mit 10000 Knechten,
[1] Ratzel, a. a. O. I, S. 267/8.
[2] Beloch, a. a. O. I. 1, S. 124,
[3] Beloch, a. a. O. I. 1, S. 212.
[519]
ungerechnet die Hörigen und die Schuldner, auf dem Landtage erscheinen konnte, so ist es einleuchtend, daß ein solcher mehr ein unabhängiger Dynast war als ein Bürger seines Clans“[1]. Und Ähnliches mag für den „Heiu“ der Somali gelten, den „großen Grundbesitzer, der Hunderte von Familien auf seinem Boden in Abhängigkeit erhält, so daß man sich bei den Somal an unsere mittelalterlichen Feudalzustände erinnert finden könnte“[2].
Wenn solche Übermacht einzelner Grundherren schon im primitiven Eroberungsstaate niederer Stufe auftreten kann, so erreicht sie doch ihren höchsten Grad erst im primitiven Großstaat, und zwar durch die Machtvermehrung, die der Grundherr durch die Amtsgewalt erhält.
Je mehr sich der Staat dehnt, um so weniger kann er noch von einer Stelle aus regiert werden ; die Zentrale muß notwendig in den verschiedenen Provinzen Machthaber einsetzen, vor allem in den durch Krieg und Aufstände am meisten bedrohten Grenzbezirken, den „Marken“. Ein solcher Beamter muß die höchste Militärgewalt mit der höchsten Zivilgewalt und, wie die Dinge einmal liegen, auch mit sehr hoher Richtergewalt vereinigen, wenn diese letzte auch zu Anfang noch durch die Möglichkeit der Appellation an die Krone beschränkt sein wird. Zu alledem müssen ihm Mittel zur Verfügung gestellt werden. Wie sollen sie aufgebracht werden? Steuern, die zur Zentralstelle zusammenfließen, um wieder über das Land verteilt zu werden, kennt (mit einer einzigen Ausnahme, von der unten zu sprechen sein wird: Ägypten) nur der geldwirtschaftlich entfaltete Staat. Von Geldwirtschaft aber und Geldsteuern kann hier, im naturalwirtschattlichen Landstaate, noch nicht die Rede sein.
Darum bleibt der Zentrale nichts anderes übrig als den Grafen oder Kastellan oder Satrapen usw. auf die Naturaleinkünfte seines Amtsbezirkes anzuweisen. Er zieht die Abgaben der Untertanen an sich, verfügt über ihre Fronden, erhält die Sportein und Bußen in Vieh oder Geld (das für solche Leistungen lange vor dem Durchbruch der Geldwirtschaft gefordert wird), — und hat dafür die wenigen Zivilbeamten und die starke Heeresmacht zu unterhalten, bestimmte Truppenkontingente zur Verfügung der Zentrale zu stellen, Straßen-, Burgen- und Brückenbauten auszuführen, den Herrscher samt Gefolge oder seine „Königsboten“ zu verpflegen, und schließlich eine Abgabe bestimmter Mindesthöhe in hochwertigen oder sonst leicht transportabeln Gütern, die sein Bezirk erzeugt, an den Hof zu liefern.
Offenbar zwingt die politische Klugheit dazu, in aller Regel den größten oder doch einen der größten Besitzer des Bezirks mit diesem
[1] Rom. Gesch. III, S. 234/5.
[2] Ratzel, a. a. O., S. 167.
[520]
Amte zu betrauen, um nicht von vornherein die ärgsten Reibungen herauszufordern. Aber selbst wenn das nicht geschieht, wenn z. B. ein Prinz mit der Statthalterschaft betraut wird, wird der Beamte der größte und weitaus mächtigste Grundherr seines Bezirks. Selbstverständlich wird er als solcher, ganz wie seine nicht beamteten Standesgenossen, immer neues Land mit immer neuen erbeuteten Hörigen besetzen, nur freilich in viel größerem Maßstabe, da ihm die staatlichen Machtmittel zur Verfügung stehen. Und die Zentrale muß das sogar wünschen und fördern, denn um so größer wird seine Kriegsmacht, die in diesem Stadium noch unbedingt zu ihrer Verfügung steht. Das ist das Verhängnis dieser Staaten, daß sie selbst die örtlichen Gewalten großfüttern müssen, die sie verschlingen werden.
Es kommen immer Gelegenheiten, wo der Beamte Bedingungen stellen kann, wenn man seiner politischen oder militärischen Hilfe bedarf, namentlich in den Erbfolgestreitigkeiten, die hier nie fehlen und nicht fehlen können. Denn es sind fast immer Prinzen verschiedener mütterlicher Abstammung vorhanden, und es gibt kein allgemein anerkanntes Gesetz, wer der Berechtigte ist: der älteste Sohn schlechthin, oder der älteste Sohn, der dem Herrscher geboren wurde, als er bereits den Purpur trug, oder der älteste Sohn, der ihm von einer Freien oder gar von einer ebenbürtigen Gattin geschenkt worden ist, oder der von dem Herrscher letztwillig eingesetzte Sohn, — mit den hier, wie man sieht, möglichen zahlreichen Kombinationen und Permutationen. Die Bücher der Geschichte erzählen von zahllosen ehrgeizigen Favoritinnen, die es verstanden, dem von ihnen geborenen Spätling die Krone zu verschaffen. Wenn das nicht durch das verbreitete und hier in der Tat als Staatsräson kaum vermeidliche Mittel des Abschlachtens sämtlicher Konkurrenten geschehen kann[1], so kommt es zu Streitigkeiten und
[1] Wir tragen ein paar von überall her aufgegriffene Daten zusammen. Von Chlodwig heißt es, daß er zur Regierung gekommen sei, „nachdem er viele andere Könige und seine nächsten Verwandten hatte ermorden lassen, damit sie ihm die Herrschaft nicht nähmen“. Die späteren Greuel im Merowinger-Hause sind ja allbekannt (vgl. Röscher, a. a. O. S. 51). „Die Geschichte der ostgotischen Amalasunta, der longobardischen Theudelinde, auch der burgundischen Gemahlin Chlodwigs, ja noch Heinrichs I. von England bieten Ähnliches“, ebenso, wie die gräßlichen Vorkommnisse, die in der alten Pelopiden-, Atriden- und Labdakidensage ihre Spiegelung finden. „Seit dem zweiten Viertel des zwölften bis tief ins vierzehnte Jahrhundert hinein ist in Schweden die Mehrzahl der Könige abgesetzt oder ermordet: von den sieben Herrschern der Folkungcr fünf entthront und im Kerker oder in der Verbannung gestorben. Auch in Dänemark haben von den sechszehn Nachfolgern Knuts des Großen neun einen widernatürlichen Tod gefunden“ (ib. S. 63). Im Orient ist die Abschlachtung der sämtlichen königlichen Verwandten allgemeine Praxis. Als z. B. Ochus-Artaxerxes zur Regierung kam, ließ er eine große Anzahl seiner Verwandten hinrichten und zwar „in selten gründlicher Weise“ (Beloch III. 1, S. 242). Ochus selbst starb wahrscheinlich an Gift; sein Minister Bagoas, dem man die Schuld zuschreibt, ließ auch die älteren Söhne des Königs hinrichten und erhob den jüngsten Sohn Arses auf den Thron (ib. S. 603). Gleiches berichtet Beloch vom Hofe der thrakischen Odryserkönige (ib. S. 222) und vom Hofe von Salamis auf Kypros (ib. S. 526).
Eine einzige Kette von solchen Familienmetzeleien ist die Geschichte Makedoniens. Nach dem Tode des Perdikkas (413) ließ der Regent Archelaos, ein Bastard, die legitimen Erben ermorden. Bald darauf fiel er selbst zum Opfer (ib. S. 25). Sein Sohn Orestes wurde wieder von seinem Vormund Aëropos, und dessen Sohn Pausanias nach nur einjähriger Regierung von einem Bastard des Archelaos ermordet. Dessen Witwe Eurydike ließ den König Alexandres, ihren eigenen Sohn, umbringen ; der Mörder Ptolemäus fiel unter der Hand des jungen Perdikkas; und schließlich fiel der große Philipp unter der Hand eines anderen Pausanias; damals wurde sofort der Verdacht laut, daß seine Gemahlin Olympias den Mörder gedungen habe, und daß auch Alexander der Sache nicht fern stehe (ib. S. 606). Jedenfalls hat Alexander der Große wenig später seine sämtlichen Stiefbrüder töten lassen (ib. S. 613). Nach seinem Tode kam es zu den Diadochen- kämpfen, obgleich zwei Söhne vorhanden waren. Sie wurden wie seine ganze Familie: Frauen, Mutter, Bruder und Schwester, ermordet. (Delbrück, a. a. O. S. 332/3.) Auch Caesars Sohn von der Kleopatra, Caesarion, wurde durch Octavian getötet (ib. S. 563). Tiberius ließ den leiblichen Enkel des Augustus, Agrippa Postumus, „der ihm, der nur Adoptivsohn war. hätte gefährlich werden können, ermorden“ (ib. S. 593).
[521]
Fehden, in denen der Entscheid oder die Streitmacht der Großen den Ausschlag gibt. Selbstverständlich wird der Helfer von dem Sieger reich belohnt: ein zarterer Ausdruck für die ebenso selbstverständliche Tatsache, daß diese Belohnung vorher sorgfältig festgelegt war. Der wichtigste Gewinn ist die Gewährung der Vererblichkeit des Dienstlehens, das auf diese Weise dem privaten Großgrundeigentum völlig gleichgestellt wird: denn auch über dieses hat ja nach dem Buchstaben des Gesetzes der Herrscher ein formales Obereigentumsrecht. So werden die Großen immer größer und mächtiger, und die Krone, die ihr Land und ihren Schatz vergaben muß, immer ohnmächtiger.
Das gilt am stärksten für die dem Sitze der Zentralgewalt am fernsten liegenden Teile des Staates; nichts kann deutlicher als diese ganz allgemeine Tatsache zeigen, wo die unheilbare Schwäche dieser primitiven Großstaaten liegt : in dem Mangel einer Geldsteuerwirtschaft und in dem unentwickelten Zustande des Verkehrswesens. Man kann beinahe sagen, daß die Unabhängigkeit der großen Grundherren und Statthalter wächst wie das Quadrat ihrer Entfernung von dem Sitze der Zentralgewalt. Einige charakteristische Beispiele: „Das Lundareich ist ein absoluter Lehnsstaat. Die Häuptlinge (Muata, Mona, Muene) können in allen inneren Angelegenheiten selbständig handeln, solange es dem Muata Jamvo gefällt. Gewöhnlich schicken die großen und fernerwohnenden Häuptlinge einmal im Jahre ihre Tributkarawanen in die Mussumba; aber weitab wohnende unterlassen wohl für längere Zeit jede Tributzahlung, während die klei-
[522]
neren Häuptlinge in der Nähe der Residenz sogar mehrmals im Jahre Tribut senden“[1].
Sogar aus England, das aus den verschiedensten Gründen — wir werden sie darstellen — diesen Typus in abgeschwächtester Form vertritt, berichtet Brodnitz: „Die Feudalherren benutzen . . . jede schwache Situation der Krone, um alte Vorrechte auszudehnen. Für sie sind die Pfalzgrafschaften an den Landesgrenzen (Durham gegen Schottland, Chester, Shrewsbury und Hereford gegen Wales) die Vorbilder, denen sie nachstreben“[2]. Hier „fanden immer noch überschüssige Feudalgelüste ein Betätigungsfeld, wo das Schwert allein einen Rechtstitel verlieh“[3]. Sogar das gewaltige, doch wesentlich auf spiritueller Macht auferbaute Weltreich der Päpste hat sich diesem Gesetz nicht entziehen können[4].
So muß die Krone die Dienste der großen Herren, die immer mehr zu wahren Landesfürsten werden, immer teurer erkaufen, muß ihnen eines der gesamtstaatlichen Hoheitsrechte nach dem anderen formell übertragen oder es dulden, wenn sie es sich nehmen: nach der Erblichkeit der Lehen das Straßen- und Handelsrecht, auf höherer Stufe auch das Münzrecht, die Gerichtshoheit, die staatlichen Fronrechte und die Verfügung über den Kriegsdienst der Freien im Lande.
So gelangen die Großen, namentlich die Grenzgewaltigen, allmählich zu immer größerer, zuletzt zu voller tatsächlicher Selbständigkeit, wenn auch das formelle Band der Lehnshoheit die neu entstandenen Fürstentümer noch lange zusammenhalten mag. Dann ist die „staatsrechtliche Monstrosität“ fertig, als welche Monzambanus- Pufendorf das Heilige römische Reich seiner Zeit bezeichnete: ein Gebilde, das weder Staatenbund noch Bundesstaat ist und doch etwas von beidem hat, und von dem niemand zu sagen weiß, wo denn die „Souveränetät“ stecke, die doch jeder Staat haben muß, der diesen Namen beansprucht.
Dem Leser drängen sich die historischen Belege für diesen typischen Vorgang auf. Die ganze mittelalterliche Geschichte ist eine einzige Kette davon. So zerfielen das Reich Marbods[5], das Merowinger- und das Karolingerreich ; Deutschland hat den Prozeß nicht einmal, sondern mehrmals durchgemacht, nicht minder die übrigen europäischen Feudal-
[1] Ratzel, a. a. O. II, S. 229.
[2] Engl. Wirtschaftsgesch., S. 50.
[3] Ib. S. 56.
[4] Vgl. Ranke, Gesch. d. Päpste I, S. 26ff. Mitscherlich, Nationalismus, S. 99. Comte, Cours V, S. 370.
[5] Gumplowicz, Allg. Staatsrecht, S. 484/5.
[523]
reiche: Frankreich, Italien, Spanien, Polen, Ungarn, Böhmen, Rußland. Und ebenso China[1] und Japan[2].
Ebenso im sog. Zweistromlande : die Großstaaten, die hier einander ablösen, bersten immer wieder auseinander, um sich immer wieder zusammenzuballen. Dem Zerfall der Dynastie von Akkad[3], die zur Verselbständigung von Elam führte (ib. S. 560) folgten unzählige Geschehnisse gleicher Art: „Das Reich von Sumer und Akkad umfaßt ein Jahrhundert der Blüte unter kräftigen Herrschern und mehr als zwei Jahrhunderte der Zersetzung und langsamen Dahinsiechens, verbunden mit verheerenden Invasionen von außen. Das ist charakteristisch für die Entwicklung Sinears: niemals ist es hier gelungen, wie im Pharaonenreich, eine längere Epoche festgeordneten Régiments und innerer Einigung des Landes zu schaffen, und alle Staaten, die hier entstanden sind, tragen immer nur einen ephemeren Charakter“ (ib. S. 568). „Das ist bis zuletzt, bis zum Chal- däerreich Nebukadnezars, so geblieben“ (ib. S. 647).
Es ist noch länger so geblieben. Vom Perserreich heißt es: „Einzelne Staaten und Provinzen erlangen durch glücklichen Abfall auf längere oder kürzere Zeit die Freiheit, und der „Großkönig“ in Susa hatte nicht immer die Macht, sie zum Gehorsam zurückzuführen; in anderen herrschten Satrapen oder kriegerische Häuptlinge willkürlich, treulos und gewalttätig entweder auf eigene Hand oder als zinspflichtige Teilfürsten oder Unterkönige des Großherrschers[4]. Eine Anhäufung von Staaten und Landschaften ohne gemeinsames Recht, ohne geregelte Verwaltung, ohne gleichmäßiges Gerichtswesen, ohne Ordnung und Gesetzeskraft, ging das persische Weltreich unrettbar seiner Auflösung entgegen“[5]. Es war eben doch trotz aller Großartigkeit der äußeren Aufmachung nichts als ein Raubstaat allergrößten Formats: Alexander soll in Susa 40—50000, in Persepolis 120000 Talente Silbers erbeutet haben[6]; „kein gemeinsames Interesse irgendeiner Art verband die unzähligen Völker des Reiches, und die Perserherrschaft hat es nicht vermocht, ja sie hat nicht einmal den Versuch gemacht, diese Völker zu einem Ganzen zu verschmelzen“ [7]. Ebenso erging es dem Diadochen-
[1] Ratzel, a.a.O. I, S. 128. Wells, A short history, S. 97: Im 6. Jahrh. ν. Chr. gab es 5—6000 praktisch unabhängige Staaten in China.
[2] Tokugo Fukuda, a. a. O.
[3] Ed. Meyer, Alte Gesch. I, S. 537.
[4] Kriege zwischen den Satrapen waren gewöhnlich (Beloch III. 1, S. 30; vgl. S. 46). Ebenso der Satrapen gegen den Großkönig (S. 198, 202/3). Sie verbünden sich mit dem Reichsfeinde (S. 527).
[5] G. Weber, Weltgesch. II, S. 743, III, S. 163. Vgl. Ranke, zit. bei Jellinek, Allg. Staatslehre, S. 289 Anm.
[6] Beloch, Griech. Gesch. II, S. 3. Kaerst, a. a. O., S. 495.
[7] Beloch, Griech. Gesch. II, S. 4, III, S. 599. Kaerst, a. a. O.
[524]
reich der Seleukiden[1] : „Eine Dynastie, die mit einem Söldnerheer politisch völlig stumpfe Volksmassen als Staat zusammenhielt“[2].
Dem Nachbarn am Nil ging es nicht ganz so schlimm, wohl vor allem aus dem Grunde, den Meyer betont, weil hier die großen ethnischen Gegensätze der Bevölkerung nicht vorhanden waren (S. 647), und weil es, wie schon angedeutet, zeitweise einen Ersatz der Geldwirtschaft entwickelt hatte (davon später) : aber entgangen ist er dem unvermeidlichen Schicksal nicht. Schon unter der zweiten Dynastie „war die Reichseinheit zeitweilig zerrissen“ [3] ; das gleiche scheint in der dritten Dynastie der Fall gewesen zu sein (ib. S. 172), ebenso in der vierten (S. 180), und schließlich beginnt um die Mitte der fünften Dynastie die Entwicklung des Feudal Staates, d. h. die „auf dem Anwachsen des Grundbesitzes der großen Beamtenfamilien beruhende soziale Verschiebung“ (S. 223). Auch die Pharaonen haben die hohen Beamten und Günstlinge, die Prinzen und angeseheneren Frauen des Harem ganz wie die Könige der romanischen und germanischen Staaten des Mittelalters und im gleichen Umfang mit Land und Leuten ausgestattet (196). Auch hier hat sich wie in Europa der ursprünglich weit zerstreute Besitz allmählich abgerundet und konsolidiert (197), und ist auch derjenige Teil desselben, der nicht als vererblicher Privatbesitz, sondern als eine Art von Erbpacht verliehen wurde, erblich geworden. Auch hier werden die lokalen Beamten allmächtig (237), schrumpft das Kronland zusammen (239); „tatsächlich hat sich Ägypten etwa in derselben Weise in zahlreiche selbständige Fürstentümer aufgelöst wie das Karolingerreich im 9. Jahrhundert und das Deutsche Reich nochmals seit dem Niedergang der Staufer“ (239) [4].
Später zerfällt auch die glorreiche zwölfte Dynastie (301); dann, von der dreizehnten an, kommen an Stelle der von der zwölften ausgerotteten Gaufürsten Beamte und Offiziere in die Höhe, die noch einmal, unter der siebzehnten und achtzehnten, zu wirklichen Fürsten erwachsen (311), „selbst nach der Königswürde greifen und in wildem Ehrgeiz einer dem anderen den Siegespreis abjagen, ohne daß es auch nur einem von ihnen gelungen wäre, eine feste Stellung zu erringen und eine dauerhafte Dynastie zu begründen“. Ganz kurz vor dem endgültigen Verlust der ägyptischen Unabhängigkeit hat dann um 650 Psammetich noch einmal mit Hilfe griechischer Söldner die übrigen
[1] Walter Otto, Aus der Gesellschaftsgeschichte des Altertums, Ztschr. f. Soz.- Wiss. Vili, S. 791.
[2] Delbrück, a. a. O. S. 446.
[3] Ed. Meyer, Gesch. d. Altertums I, S. 144. Die folgenden Ziffern in () aus demselben Werk. Vgl. Thurnwald, Staat und Wirtschaft im alten Ägypten, Ztschr. f. Soz.- Wiss. IV (1901). Schneider, Kultur und Denken der alten Ägypter, S. 38.
[4] Vgl. Inama-Sternegg, a. a. O. I, S. 140/1.
[525]
Teilfürsten besiegt und das wieder in viele Stücke zerfallene Reich geeint[1].
Aber selbstverständlich ist auch dieser Vorgang nicht auf die sog. „geschichtlichen Völker“ beschränkt. Er hat Indien ebenso verheert: „Auch außerhalb Radschistans“, sagt Ratzel von den dortigen Feudalstaaten, „erfreuten sich die Adligen oft eines großen Maßes von Unabhängigkeit, so daß selbst in Haiderabad, nachdem der Nizam sich die Alleinherrschaft angeeignet hatte, die Umara oder Nabobs eigene Truppen, unabhängig von der Armee des Nizam hielten. Den in neuerer Zeit höher gesteigerten Anforderungen in der Verwaltung indischer Staaten sind seltener noch als die großen Fürsten diese kleineren nachgekommen“[2].
Und gar in Afrika kommen und vergehen diese Großreiche wie Blasen, die im Strome des ewig gleichen Geschehens aufsteigen und wieder zerplatzen. Das gewaltige Ashantireich ist binnen anderthalb Jahrhunderten auf ein Fünftel seines Gebiets eingeschrumpft[3], und viele der Staaten, mit denen die Portugiesen zusammenstießen, sind seitdem spurlos verschwunden. Und doch waren auch das starke Feudalreiche gewesen: „Pomphafte und grausame Negerreiche, wie Benin, Dahomey oder Ashanti bilden in ihrer Umgebung politisch desorganisierter Stämme manche Vergleichspunkte mit dem alten Peru oder Mexiko. Der streng gesonderte Erbadel der Mfumu, dem hauptsächlich die Distriktsverwaltung oblag, und daneben der vergänglichere Standesadel bildeten in Loango starke Säulen des Herrschertums“[4].
Auch das Makololoreich zerfiel sehr bald nach dem Tode seines Gründers Sebituana, und zwar hauptsächlich daran, daß sein Nachfolger das bis dahin im Standquartier zusammengehaltene Heer dislozierte und die Krieger zu Häuptlingen machte[5].
Am ärgsten und schnellsten schreitet die Zersetzung voran, wo die Großen das Recht gewonnen haben, den König zu wählen. Dann wählen die Kürenden gern den schwächsten Bewerber, und dann geht der Kampf an zwischen der werdenden und der bestehenden Hausmacht, wie etwa in Deutschland zwischen Weifen und Staufern[6]. Darum nennt K. L. von Haller die Wahlmonarchien halbvollendete Revolutionen, widernatürliche Zwitterstaaten, die unmöglich lange bestehen können. Argenson hat die Erblichkeit der Krone gepriesen als die „méthode uni-
[1] Beloch, a. a. O. I. 1, S. 262.
[2] Ratzel, Völkerkunde II, S. 599.
[3] Ratzel, Völkerkunde II, S. 263.
[4] Ratzel, a. a. O. II, S. 344.
[5] Richter, Die Marotse, S. 21 ff. Auch im Reich der Marotse selbst kam es zum Sturze Sepopas und zur Einsetzung einer Adelsherrschaft (31 ff.).
[6] v. Below, Der deutsche Staat des Mittelalters, S. 351.
[526]
versellement adoptée pour éviter les horribles inconvénients du droit d'élection“. In Deutschland haben es die geistlichen Fürsten durchgesetzt, daß hundert Jahre lang kein Sohn oder sonst naher Verwandter dem Kaiser auf dem Throne folgte. Erst unter den Luxemburgern und Habsburgern ließ man die Erblichkeit wieder zu, als es zu spät war[1].
Andere Beispiele bieten Polen seit dem Aussterben des jagellonischen Mannesstammes und Dänemark im späteren Mittelalter. Die „Wahlkapitulationen“ waren überall das Gift, das die Zentralgewalt langsam tötete: bei der Wahl Christiern I. bedang sich der Bischof von Roeskilde die Abtretung Kopenhagens an sein Stift aus, obwohl diese Stadt, solange die skandinavische Union dauerte, als Hauptstadt vollkommen unentbehrlich war[2]. Diese Wahlkapitulationen vor allem haben Deutschland und Polen in Stücke zerrissen. Die Rolle, die sie nicht nur im Deutschen Reiche, sondern auch in den Territorien, vor allem den geistlichen, und auch in anderen Staaten gespielt haben, hat Kurt Wolzendorff ausführlich dargestellt[3]. In dieser Beziehung ging es Frankreich besser. Die Erblichkeit der capetingischen Monarchie war von ihrem Beginn an festgelegt[4]; freilich hatten die Franzosen auch das Glück, daß ihr Herrscherhaus nicht ausstarb wie die Sachsen, Salier und Staufen[5]. Das ist einer der Gründe, warum es später den französischen Königen glückte, den Aufstieg ihrer mächtigen Vasallen zum Landesfürstentum zu verhindern, obgleich ihr Königtum im II. Jahrhundert das ohnmächtigste, und seine Vasallen die mächtigsten waren: ein Herzog der Normandie erobert England, ein Graf von Burgund stiftet das Königreich Portugal, ein Graf von Champagne will Aachen und Italien erobern[6].
Wenn auf diese Weise das ehemalige Großreich in Stücke zerfallen ist, in Teilstaaten, die staatsrechtlich oder auch nur tatsächlich voneinander unabhängig sind — dann beginnt der alte Prozeß von neuem. Der Große frißt die Kleinen, bis ein neues Großreich errichtet ist. Ein solches Beispiel ist in Sinear das auf den Trümmern des Sumererreiches durch Sargon errichtete Reich von Akkad[7], für Ägypten die Wiedervereinigung des ganzen Landes durch Menhutotep von der elften Dynastie[8], und später Amenemhet von der zwölften“[9], der die großen
[1] Röscher, Politik, S. 24.
[2] Röscher, Politik, S. 23.
[3] Staatsrecht und Naturrecht usw., S. 141 ff. Hier fand das „Widerstandsrecht der Stände und später des Volkes eine seiner gesetzlichen Wurzeln, Althusius ist zum Teil von hier ausgegangen“ (ib. S. 211).
[4] Röscher, Politik, S. 24.
[5] v. Below, a. a. O. S. 351.
[6] Röscher, Politik, S. 76. Caro, Wirtscbaftsgesch. d. Juden, S. 353.
[7] Ed. Meyer, a. a. O S. 531.
[8] Ed. Meyer, a. a. O. S. 257.
[9] Ed. Meyer, a. a. O. S. 265.
[517]
Barone seine starke Hand fühlen ließ“. Von Deutschland sagt Meitzen lakonisch: „Die größten Grundherren werden später Kaiser“[1]. Aber auch diese große Hausmacht verflüchtigt sich an der Notwendigkeit, das Krongut an die Vasallen zu vergaben. „Die Könige selbst hatten sich dabei verschenkt, ihr großer Grundbesitz im Delta war zerronnen“, sagt Schneider von den Pharaonen der sechsten Dynastie[2]. Und das war auch das Schicksal aller der großen Hausmächte, die nacheinander in Deutschland zum Kaisertum gelangten, der Sachsen nicht minder wie der Staufer. Wir brauchen keine weiteren Belege anzuführen, sie sind in jedermanns Besitz.
b) Die soziale Zersetzung.
Diese politische Umwälzung bedeutet auch eine soziale Revolution, die die Klassenverhältnisse grundstürzend verändert.
A. Die Gemeinfreien.
Mit furchtbarer Gewalt trifft sie überall die untere Schicht der Herrengruppe, die Gemeinfreien: sie versinken in Hörigkeit. Es ist ja klar, daß ihr Verfall mit der der Krone parallel gehen muß, denn beide, gleichmäßig von der um sich greifenden Macht der großen Grundherren bedroht, sind natürliche Verbündete. Die Krone hält den Grundherren so lange fest in der Hand, wie das Aufgebot der freien Krieger seines Bezirks seiner Garde, seinem „Gefolge“, überlegen ist. Aber die verhängnisvolle Notwendigkeit, die wir geschildert haben, zwingt die Krone, die Hausmacht des Grundherrn unaufhörlich wachsen zu lassen, und auf der anderen Seite sinkt die militärische Bedeutung der Freienschaft aus mehreren Gründen.
Zunächst nehmen sie mit der Seßhaftigkeit und der Bauernschaft auch die Bauernpsychologie an, die wir kennen: sie verlieren die Lust und vielfach auch die Tüchtigkeit zum Kriegshandwerk. Röscher erzählt von Deutschland: „Schon unter Karl d. Gr. waren die vielen Heerbannszüge, bald an die spanische, bald an die dänische oder ungarische Grenze, der Mehrzahl der Gemeinfreien äußerst lästig gewesen. Auf jedem Dorf e aber gibt es Leute, welchen der Krieg Vergnügen macht. . . . Was war natürlicher, nach dem Gesetz der Arbeitsteilung, als daß nun die Friedlichen zusammentraten, den Kriegslustigen zu ihrem Stellvertreter wählten, und ihn durch Beköstigung, Ausrüstung, Bearbeitung seines Hofes zu entschädigen suchten ? (Das war der erste Keim zahlreicher späterer Fronden und Naturallieferungen.) . . . Die Meisten verlernten hierdurch das Waffenhandwerk, und wenn ihr Stell-
[1] Siedlungen usw. S. 633.
[2] A. a. O. S. 38.
[528]
Vertreter nun in das Gefolge des Grafen überging, so standen sie diesem ganz schutzlos gegenüber“[1].
Diese militärische Umschichtung wurde nun noch sehr gefördert durch eine technische Neugestaltung, die das Fußvolk immer mehr zurücktreten ließ und an seiner Stelle die Reiterei zur Hauptwaffe der Heere machte. Und das hatte wieder mehrere Gründe. Erstens war die Ausdehnung der Großreiche über das Maß hinausgewachsen, das die Kriegführung mit Infanterie noch als möglich erscheinen ließ, zumal diese technisch und geldwirtschaftlich unentwickelten Staaten das große Mittel des Römerreichs, den Bau ausgezeichneter Heerstraßen, nicht anwenden konnten. In Persien brauchte man mehrere Jahre, um die für einen größeren Heereszug erforderlichen Truppen auch nur zu versammeln! Ähnliche Gründe erzwangen auch für das beträchtlich kleinere, aber doch absolut schon sehr gedehnte Deutsche Reich des frühen Mittelalters die Aufstellung einer beweglicheren Heeresmacht. Die Hauptsache aber war, daß diese Reiche immer gegen die beweglichen Hirten der benachbarten Steppen und die ebenso beweglichen Seenomaden, die Wikinge, zu kämpfen hatten: den ersteren konnte man überhaupt nur mit der berittenen Waffe entgegentreten[2], wie die von Heinrich I. durchgeführte Heeresreform und durch sie erreichte Rettung Deutschlands von der Magyarennot zeigt; und um die Küsten vor den Einbrüchen der Normannen und Sarazenen zu schützen, brauchte man ebenfalls eine leicht bewegliche Macht. „Schon unter Arnulf überwog der Reiterdienst, in den Kriegen der Ottonen ist fast nur von Reitern die Rede. . . . Unter den Reitern ragen dann hervor die Schwerbewaffneten, die Armati oder Loricati. . , , Das Lehnwesen hat sich entschieden ausgebildet in einem gewissen Parallelismus zur Bedeutung der Reiterei zuerst in Italien und Südfrankreich, später in Burgund und Lothringen. ... In Deutschland herrschen die Ritter erst seit den Kreuzzügen, in der Hohenstaufenzeit, entschieden vor“[3]. Wie sehr diese Dinge an der Entstehung des Adels und dem Niedergang der Gemeinfreiheit mitgewirkt haben, läßt sich sehr deutlich an Dänemark erkennen. Hier gab es ursprünglich überhaupt keinen Adel, „kein höheres Wergeid gewisser Klassen, keine Übertragung von Gerichtsbarkeit und Gerichtsgeldern, keine Ämter, die eine höhere Abkunft erheischten als die bäuerliche. . . . Der dänische Adel ist nach Dahlmann . . . aus einzelnen Bauern hervorgegangen, die Roßdienst leisteten und dafür von Steuern befreit wurden. Später entschied vornehmlich die adelige oder bäuerliche Lebensweise“ [4]. In England, wo der Kampf
[1] Politik, S. 73.
[2] Das gilt schon für das spätere Römerreich. Vgl. Bury, a. a. O. S. 41/2, 92.
[3] Röscher, a. a. O. S. 73. v. Below, a. a. O. S. 337.
[4] Roscher, a. a. O. S. 77.
[529]
nicht gegen Hirten, sondern gegen seßhafte Bauernvölker zu führen war: Walliser und Schotten, die zu Fuße fochten, hat denn auch der freie Bauer nicht ganz so arg zu leiden gehabt wie auf dem Kontinent[1].
Noch eine zweite Folge der weiten Ausdehnung dieser Großreiche ist von Bedeutung. Es wurde immer mehr unmöglich, die Volksversammlung einzuberufen; an ihre Stelle traten „Versammlungen von hohen Staats- und Kirchenbeamten, die allmählich zu einer förmlichen Repräsentation, d. h., da keine Wahl der Vertreter stattfand, zu einer Beherrschung des Volkes wurden“[2].
Wir sehen, die Dinge lagen anfangs ähnlich wie in der ersten Periode der Seestaaten, wo die Gewerbs- und Geldwirtschaft noch erst schwach entfaltet war. Auch dort spielte der Heeresdienst und die Kostbarkeit der Rüstung eine bedeutende Rolle in der Entwicklung der Standesverhältnisse.
Auch die Mittel, durch die die freien Bauern niedergedrückt wurden, sind die des ersten Anfangs der Seestaaten: außer dem ruinösen Kriegsdienst im einseitigen Interesse der Herrengruppe der Wucher. Auch im Landstaat müssen sich die Bauern verschulden und verfallen dann der Abhängigkeit, zwar nicht der vollen Sklaverei, die hier kaum eine Rolle spielt, wohl aber einer der vielen Formen der Hörigkeit. Brodnitz[3] berichtet z. B. aus England, daß die finanziellen Lasten der Dänenkriege vor der Eroberung durch die Normannen die Gemeinfreien niederwarfen; dazu kam dann noch unmittelbare Bewucherung durch die Grundherren: der schwere Boden Englands bedarf einer großen Bespannung, man pflügt vielfach am besten mit acht Ochsen ; wenn der Grundherr Spannvieh ausleiht, folgt Verschuldung und schließlich Abhängigkeit.
Aber das alles bedeutet wenig gegenüber dem Hauptmittel der Entrechtung der Gemeinfreien, dem Mißbrauch der Amtsgewalt: eine Erscheinung, die in dieser Form dem Seestaat den eigenen Bürgern gegenüber fremd ist. Hier treibt wohl die ganze Oberklasse als solche die skrupelloseste Klassenpolitik, aber es ist unmöglich, daß Einzelne ihre Amtsgewalt zur Errichtung eines Staates im Staate mißbrauchen; hier geht es immer um die Herrschaft über den ganzen Staat.
Sobald aber im Landstaat die Garde des lokalen Beamten stärker geworden ist als das Aufgebot der Freienschaft seines Bezirks, ist der Bauer geliefert. Alle die starken Mittel der Staatsgewalt, die jetzt dem Machthaber für seine persönlichen Zwecke zur Verfügung stehen, werden gegen ihn gebraucht. Man ruiniert ihn durch den Dienst im
[1] Röscher, a. a. O. S. 76. Vgl. Brodnitz, Engl. Wirtsch.Gesch., S. 26.
[2] Röscher, a. a. O. S. 73.
[3] Engl. Wirtsch.Gesch., S. 7.
[530]
Heerbann, der um so häufiger geworden ist, je mehr das dynastische Interesse der neuen Landesherren nach neuem Lande und neuen Leuten strebt, und je mehr der Bezirk dadurch in innere Fehden und äußere Kriege gerissen wird; man mißbraucht die Fronpflicht, man mißbraucht die Justiz, man erdrückt den Bauern durch Sportein, Bußen und Steuern.
Um die Zusammenhänge ganz zu verstehen, müssen wir die im vorigen Abschnitt nur kurz angedeutete Revolution der politischen Verfassung etwas näher betrachten. Wir wählen als unseren Ausgangspunkt das Deutsche Reich, weil es einerseits als das mächtigste und angesehenste der mittelalterlichen Reiche, als Träger des Kaisertums, den anderen Staaten Modell und Muster war, und weil es andererseits die politische Zersetzung bis zu einem Grade durchgemacht und vollendet hat, wie kaum einer jener Staaten.
Der ältere Fürstenstand des Reiches ist durchaus Amtsadel, nicht Lehnsadel; „das Lehnsverhältnis bestimmt die Zugehörigkeit zum Reichsfürstentum durchaus nicht“[1]. Reichsfürsten sind die Reichsbischöfe, die Reichsäbte und Reichsäbtissinnen, der Reichskanzler, der Probst von Aachen, die Herzöge, Markgrafen und Grafen. Bis zum Jahre 1180 wird die Stellung der Großen, der Fürsten, als solcher noch nicht lehnsrechtlich sondern amtsrechtlich aufgefaßt (234). Diejenigen Lehnsleute also, die kein Reichsamt zu Lehen haben, sind nicht Große, nicht Fürsten.
Der Rechtszustand des jüngeren Fürstentums nähert sich aber immer mehr dem des Lehenswesens: ein „starker Fortschritt zur Feu- dalisierung der Verfassung“. Der Eid der Großen wird zum Lehnseid, der Fürstenstand zum Lehnsadel. Dieser Prozeß ergreift auch die geistlichen Fürsten. „Wer ein Amt, mindestens ein Grafenamt, unmittelbar vom König zu Lehen trägt und keines Fürsten (abgesehen von den Pfaffenfürsten) Dienstmann ist“, gehört zum Fürstenstande. Aus diesem Kreise bildet sich das spätere Landesfürstentum durch den Erwerb und die Verselbständigung öffentlicher Gerichtsbezirke (243). Seit etwa dem 13. Jahrhundert ist es nicht mehr der Königsdienst, der in den höheren Stand versetzt, sondern der Erwerb eines öffentlichen Gerichtsbezirks überhaupt. Es gibt Landesherren (Grafen), welche gar keine Gerichtsbarkeit vom König haben und doch zum hohen Adel gehören (247). „Seit dem Fortfall der königlichen Bannleihe erhielt der Gerichtsherr die gesamte Amtsgewalt von dem, der ihn mit der . . . Gerichtsbarkeit belehnte. Das Lehen siegte über das Amt“ (249).
Vorbereitet war dieser Verlust des wichtigsten Kronrechtes, der Gerichtshoheit, schon durch die „Immunitäten“, „das älteste und in
[1] v. Below, Der deutsche Staat des Mittelalters, S. 233. Die folgenden Seitenzahlen in Klammern beziehen sich auf dieses grundlegende Werk.
[531]
der ersten Zeit zweifellos auch das stärkste Element in diesem großen Vorgang“ (252ff.). Sie war ursprünglich ein Privileg der kirchlichen Institute und bedeutete nur das Verbot an die königlichen Beamten, in amtlicher Eigenschaft das Immunitätsgebiet zu betreten. Aber von hier aus kam es zunächst zur selbständigen Erhebung dei staatlichen Steuern durch den Immunitätsherrn und zur selbständigen Gerichtsbarkeit über seine Hintersassen, so weit es sich um Prozesse zwischen ihnen, und etwas später, mindestens seit dem 8. Jahrhundert, gegen sie handelte, zuerst nur für Zivil-, ein Jahrhundert später auch für Kriminalsachen. Dieser sachlichen geht eine räumliche Ausdehnung parallel: die Immunität wird über die Grenzen der Grundherrschaft auf einen weiteren Bezirk erstreckt, offenbar zuerst aus dem Grunde, weil die Grafschaft sozusagen ausgehöhlt war, nicht mehr genug Gerichtsinsassen hatte, um einen Grafen zu beschäftigen und zu unterhalten. „Ein solcher Bezirk stand einer Grafschaft (oder, worum es sich nun häufig genug handelte, dem Rest einer Grafschaft) durchaus parallel. Der Vogt dieser eximierten Immunitätsbezirke übte dieselben Befugnisse aus wie der Graf. Der Bezirk war ebenso ein öffentlicher Gerichtsbezirk wie die Grafschaft“.
Die Immunität konnte mit dem Lehnswesen eine Verbindung eingehen, und dieses hat sich in der Tat in beträchtlichem Umfang der Immunitäten bemächtigt. Es geschah insbesondere in der Art, daß der Vogt sein Vogtamt zum Lehen zu machen wußte, wie der Graf sein Grafenamt in ein Lehen verwandelt hatte“ (260).
So wurde der Lehnsstaat allmählich zum ausgebildeten Feudalstaat in dem Sinne, wie Below den Begriff bestimmt: „Feudalstaat ist der weitere Begriff; er hat sein vornehmstes Charakteristikum in der Veräußerung der Hoheitsrechte im allgemeinen, in der relativen Selbständigkeit der lokalen Gewalten, in dem Dasein von „Staaten im Staate“, in der Privilegierung der lokalen Gewalten, die wieder zum großen oder größeren Teile auf der Veräußerung öffentlicher Rechte beruht“ (280). Als diese Verfassung, die das Reich faktisch in einen Staatenbund auflöste, sich zuerst deutlich durchzusetzen begann, im 13. Jahrhundert, war die klassische Zeit des Lehnswesens schon überschritten (323).
Wir haben, um die wichtige Entwicklung in ihrem Zusammenhange zu zeichnen, geschichtlich ziemlich weit vorgreifen müssen. Wir kehren jetzt zu unserem Ausgangspunkte zurück: der Zeit, in der die königliche Gewalt, insbesondere die Gerichtshoheit, zu verfallen begann. Die Ausbildung der lokalen Gewalten und der Verfall der dem Königtum unmittelbar unterstehenden Amtsverfassung griff früh und mit reißender Geschwindigkeit um sich. Das erkennt man am besten aus der offiziellen Einführung des Grundsatzes: „nulle terre sans
[532]
seigneur“, der uns so leicht als ein Musterbeispiel aristokratischen Übermuts erscheint. Schon 847 faßten die drei Söhne Karls des Großen den Beschluß, daß jeder Freie des Reiches sich einen Senior zu wählen habe[1]. Im angelsächsischen England wird seit Alfred dem Großen der Mann, der keinem Lord untersteht, als Outlaw angesehen[2]. Das ist das deutlichste Zeichen dafür, daß die unmittelbare Reichsverfassung schon allzuweit verfallen ist, als daß sie noch unmittelbar die Beziehungen zwischen Staat und Staatsbürgern aufrechterhalten könnte. Und so bleibt der Königsgewalt gar kein anderes Mittel, als die Konsequenz zu ziehen und die Gemeinfreien, so viele noch übrig sind, offiziell den örtlichen Gewalthabern zu überlassen oder, wenn man will, auszuliefern.
Viele haben sicherlich dem auf sie ausgeübten Drucke halbfreiwillig nachgegeben: um sich der Heerbannpflicht zu entziehen und aus ähnlichen Gründen. Wer widersteht, wird gezwungen: die staatlichen Rechte des Gerichts- und Grundherren geben ihm Handhaben genug. Um ein Baispiel anzuführen, das einenTypus darstellt, so hat in England vor der normannischen Eroberung die leiturgische Leistung der „trinoda necessita“ (expeditionis profectio, pontis constructio, arcis munitio) häufig Grund für die Herabdrückung in Hörigkeit gegeben: „Wer Rente zahlt; ist frei, wer Arbeitsleistungen schuldet, ist hörig“[3]. Analog wurde im ostelbischen Deutschland und in Rumänien in der Neuzeit die staatliche, sehr harmlose Fronpflicht für jene beim Mangel einer ausreichenden Geldsteuerwirtschaft selbstverständlichen, aber wenig drückenden Dienste der Anwohner in der ungeheuerlichsten Weise von den Grund- und Garichtsherrn für ihre Privatzwecke ausgebeutet.
Die Wenigen, die zu widerstehen vermochten, sahen sich schließlich vollkommen isoliert: ohne Rechtsschutz und Rechtsgenossen, und mußten sich zuletzt auch fügen, nachdem der letzte Reichsbeamte als solcher aus den Bezirk verschwunden war. Nur in Gegenden von besonderer Gunst der strategisch-geographischen Lage, in einigen Alpentälern, wo sich kein so gewaltiges Grundeigentum hatte bilden können, und im Schutze sumpfiger Marschen, in Friesland und Dithmarschen, hielten sich ein paar verlorene freie Dörfer bis ins späte Mittelalter hinein.
Dennoch hätten sich die Gemeinfreien noch besser gehalten, trotz des Mißbrauchs der Amtsgewalt und der Gesetzwidrigkeiten, die ihn häufig ergänzten[4], wenn nicht ein Letztes und Entscheidendes dazu
[1] Röscher, Politik, S. 72.
[2] Brodnitz, a. a. O. S. 8.
[3] Brodnitz, a. a. O. S. 20.
[4] Vgl. z. B. bei Brodnitz, a. a. O. S. 17 über „die zahllosen Gewaltakte“ gegen die Gemeinfreien nach der normannischen Eroberung.
[533]
getreten wäre: die Sperrung des gesamten noch freien Bodens durch die Grundherren.
Die Usurpation dieses wichtigsten Kronregals ist der letzte Nagel zum Sarge der Gemeinfreiheit. Wir haben mehrfach angemerkt, daß das unbebaute Land, die Bodenreserve, nach allmenschlichem Volksrecht dem Volke zur gesamten Hand gehört, und daß der König als sein Treuhänder die Verfügung darüber hat. Auch dieses Kronrecht geht mit den anderen in die Gewalt der Grundherren über — und damit haben sie das Mittel erlangt, um den Rest der Freien zu erdrosseln. Sie erklären die gemeinen Wälder und vielfach auch die Marken als ihr Eigentum, sperren das Land gegen die freie Siedlung und lassen nur noch denen den Zugang frei, die sich zum Entgelt in irgendeine Form der Abhängigkeit, der Hörigkeit begeben.
Bisher war die Gleichheit in der Vermögenslage so weit gewährleistet, wie das rationellerweise verlangt werden kann. Und wenn der Bauer zwölf Söhne hatte, so blieb dennoch die Hufe, das Erbgut, un- zersplittert : denn eilf rodeten sich neue Hufen in der Gemeinen Mark oder dem noch nicht an Dorf- oder Markgenossenschaften verteilten Volkslande. Dieser Weg ist fortan verschlossen. Die Hufen zersplittern, wo viele Kinder aufgezogen wurden, andere werden zusammengeschlagen, wo ein Erbsohn mit einer Erbtochter die Ehe schließt; das ist jetzt erst wirtschaftlich möglich : denn jetzt gibt es zum ersten Male freie Arbeiter, eben jene Viertel- und Achtelhufner und die ganz landlosen Bauernsöhne. So wird die freie Dorfgemeinde in Reiche und Arme zerklüftet; schon das löst das Band, das bisher das Bündel von Pfeilen unzerbrechlich machte. Wenn dann aber noch, was gar nicht ausbleiben kann, unfreie Elemente ins Dorf eindringen, entweder, weil einer der Genossen, allzu arg geplagt oder von geringerer Widerstandskraft, sich dem Herrn „kommendierte“, oder weil der Herr einen durch Tod oder Überschuldung erledigten Hof mit einem seiner Hörigen zu besetzen die Macht hatte: dann ist die gewachsene „Gemeinschaft“ gänzlich zerrissen, der naturwüchsige Zusammenhang gelöst, die durch Klassen- und Interessengegensätze zerspellte Bauernschaft dem Machthaber wehrlos preisgegeben. Auch für diese Dinge braucht man kaum Beispiele anzuführen. In Deutschland hat die freie Bauernschaft den Vorgang der Enteignung und Deklassierung wenigstens dreimal durchgemacht. Einmal — im Westen — in der keltischen Vorzeit [1]. Das zweite Mal traf der Niedergang die freien Bauern des Stammlandes in der fränkischen Zeit, namentlich im 9. und 10. Jahrhundert; und zum dritten Male die Bauern des Stammlandes vom 15. Jahrhundert an — die Bauernkriege waren das
[1] Mommsen, Rom. Gesch. V, S. 84.
[534]
blutige Schlußkapitel einer langen Leidensgeschichte — und die des Kolonisationsgebietes im Osten von Saale und Elbe um dieselbe Zeit, aber mit noch viel ungeheuerlicherer Wucht.
Am schlimmsten erging es den Bauern dort, wo überhaupt keine monarchische Autorität bestand, deren natürliche Interessensolidarität mit den Untertanen doch fast überall, wenigstens auf die äußere Form der Unterdrückung, mildernd einwirkte. Das waren die sog. „Adelsrepubliken“.
Wir können hier an die „Landstaaten“ von Hellas denken: an Sparta, Thessalien, auch an Böotien. In Westeuropa stellen die keltischen Gaustaaten zu Caesars Zeit eines der frühesten Beispiele dar. Hier „vereinigten die großen Familien in ihrer Hand die ökonomische, kriegerische und politische Übermacht. Sie monopolisierten die Pachtungen der nutzbaren Rechte des Staates. Sie nötigten die Gemeinfreien, die die Steuerlast erdrückte, bei ihnen zu borgen und zuerst tatsächlich als Schuldner, dann rechtlich als Hörige sich ihrer Freiheit zu begeben. Sie entwickelten bei sich das Gefolgswesen, d. h. das Vorrecht des Adels, sich mit einer Anzahl gelöhnter reisiger Knechte, sog. Ambakten, zu umgeben und damit einen Staat im Staate zu bilden; und gestützt auf diese ihre eigenen Leute trotzten sie den gesetzlichen Behörden und sprengten tatsächlich das Gemeinwesen. Schutz fand nur noch der hörige Mann bei seinem Herrn, den Pflicht und Interesse nötigten, die seinem Klienten angetane Unbill zu ahnden; die Freien zu bsschützen hatte der Staat die Gewalt nicht mehr, weshalb diese sich zahlreich einem Mächtigen als Hörige zu eigen gaben“[1]. Ganz die gleichen Verhältnisse finden wir anderthalb Jahrtausende später in Kurland, Liv- und Estland, Schwedisch-Pommern, Ostholstein, Mecklenburg und namentlich in Polen[2].
„Die Weltgeschichte ist einförmig und voller Wiederholungen“, sagt Ratzel: der gleiche Prozeß hat auch den ägyptischen Bauern be-
[1] Mommsen, a. a. O. III, S. 234/5. Vgl. Weber, Weltgesch. III, S. 759/60: „Durch gemeinsames Interesse, durch Verwandtschaft und Wechselheirat, oft auch durch Verträge zu gegenseitigem Beistande miteinander verbunden, bildeten die Adelsfamilien eine geschlossene Klasse, welche, im Besitze großer Güter und Einkünfte, bald auch alle Staatsgewalt an sich brachte“. Er schildert dann die Entwicklung ganz wie Mommsen, nach der gleichen Quelle, Caesar: „Das gemeine Volk sieht man als Knechte an, es kann für sich nichts unternehmen und wird zu keiner Beratung gezogen. Die meisten aus seiner Mitte, von Schulden, übergroßen Abgaben oder durch Mächtigere bedrückt, begeben sich in Dienstbarkeit des Adels, der gegen sie die nämlichen Rechte hat wie der Herr gegen die Sklaven“. Weber fügt hinzu: „Die Gauverfassung mit der freien Landgemeinde wich somit im offenen Lande einer ritterlichen Feudalherrschaft, einer erblichen Familienaristokratie, in welcher die Fürstengeschlechter aufgingen“.
[2] Vgl. Jan von Jordan-Rozwadowski, Jahrb. f. Nat.ök. und Stat. III. Folge, Bd. 20, S. 514. Vgl. Röscher, Politik, S. 152, 187/8 über die landesverräterische Außenpolitik dieser Machthaber.
[535]
troffen. Auch im Pharaonenlande ist der Adel ursprünglich Amtsadel, aber auch hier werden, wie wir wissen, die Gaubeamten (Nomarchen) zu Landesherren, die die Erblichkeit ihres Amtslehens durchzusetzen verstehen, und „damit ist die Umwandlung des Beamtenstaats des Alten Reichs in einen Feudalstaat vollendet . . . die Gaufürsten rühmen sich, ganz im Gegensatz zu den Anschauungen des Alten Reichs, ihres angeborenen Adels“[1]. Damit ist zunächst ein Aufstieg der im Alten Reiche gänzlich staatshörigen Bauern verbunden: die Gaufürsten bedürfen der Stütze an ihren Untertanen (240).
„Die alten Pächter des Pharaonenlandes sind jetzt, entsprechend der Erblichkeit des Grundadels, zu erblichen Grundbesitzern geworden“ (238). Aber „die nach einem kriegerischen Zwischenspiel folgende Periode des mittleren Reichs bringt auch den Bauern des Südens eine Verschlechterung ihrer Lage. Die Zahl der freien Herren sinkt, während ihr Landbesitz und ihre Macht steigt. Die Abgaben der Bauern werden auf dem Wege einer genauen Qualifikation der Güter durch eine Art von Kataster streng festgesetzt. Unter diesem Drucke strömen viele Bauern wohl den Fronhöfen und Städten der Gaufürsten zu, um sich dort als Knechte, Handwerker oder selbst als Beamte dem Wirtschaftsorganismus der Höfe einzuordnen. So tragen sie im Verein mit etwaigen Kriegsgefangenen dazu bei, die fürstliche Domanialverwaltung zu erweitern und das Verjagen der Bauern, wie es damals üblich gewesen sein dürfte, zu fördern“[2].
Nichts kann klarer für die Unvermeidlichkeit dieses Prozesses zeugen als das Beispiel des Römerreichs. Hier ist der Begriff der Hörigkeit bereits verschollen, als es zum ersten Male, in voller „Neuzeit“, die Bühne betritt; nur die Sklaverei ist bekannt. Und dennoch versinken anderthalb Jahrtausende später die freien Bauern wieder in echte Hörigkeit, nachdem Rom zu einem übermäßig gedehnten Landstaate geworden ist, dessen Grenzbezirke sich mehr und mehr vom Zentrum gelöst haben, seit mit dem Schwund der Bevölkerung die Macht des Zusammenhalts verloren wurde. „Dies war der Fall im römischen Reich, als in der Kaiserzeit die Kultur von der Meeresküste in das Binnenland hineinrückte, und das Reich aus einem Verband von vorwiegend maritimen Städten ein Binnenstaat wurde. Das Binnenland kannte nur die naturalwirtschaftliche Grundherrschaft. In ihren Bereich werden jetzt Steuererhebung und Rekrutenstellung einbezogen. Damit werden die Großgrundbesitzer, die Possessoren, bis auf Justinian der führende Stand[3]. . . . Verwaltungstechnisch ist dieser Zustand dadurch gekennzeichnet, daß neben die municipia die territoria treten,
[1] Ed. Meyer, a. a. O. S. 227.
[2] Thurnwald, a. a. O. S. 771.
[3] Vgl. Bury, a. a. O. S. 47f., 55f.
[536]
an deren Spitze der Grundherr steht, der für Steuern und Rekruten dem Staat gegenüber haftet. Auf dieser Entwicklung beruht die Entwicklung des Kolonats im Okzident, während er im Orient so alt ist wie die Idia[1]. Durch Diokletian wird dieser zugrundeliegende Gedanke auf das ganze Reich übertragen: jedermann gehört jetzt einem Steuerbezirk an, den er eigenmächtig nicht verlassen darf; der Chef desselben ist meist ein Grundherr“[2].
Selbstverständlich konnte sich diese Verwaltungsreform nicht vollziehen, ohne die Stellung der ehemals freien Kolonen schwer zu schädigen. Die großen Grundbesitzer, denen die niedere Gerichtsbarkeit und die Polizeiverwaltung auf ihren Gütern übertragen ist, haben „ihre Hintersassen, auch wenn sie ursprünglich freie Eigentümer von ager privatus vectigalis waren, in eine hofrechtliche Stellung gebracht, haben in einei Art von Immunität die faktische glebae adscriptio entwickelt“[3]. Die einwandernden Germanen konnten diese Feudalordnung in Gallien und anderen Provinzen fertig übernehmen.
Wie sie zustande kam, schildert Neurath anschaulich: „Die beginnende Landflucht, das Sinken der Sklavenzahl infolge der langen Friedensjahre und manches andere drängt in einigen Gebieten die Großgrundbesitzer dazu, ihre Gebiete in kleinere intensive Betriebe zu zerlegen (Plinius, Briefe III, 19), welche zum Teil dem Wein-, Obst- und ölbau gewidmet wurden. Sie wurden zum Teil Sklaven, zum Teil freien Angestellten anvertraut, denen man eine gewisse Selbständigkeit geben mußte“. So dehnte sich die arg zusammengeschrumpfte Hauswirtschaft wieder aus. Man mußte den Pächter jetzt schonen, den man früher rücksichtslos ausgetrieben hatte; man übernahm einen Teil des Risikos, indem man auf einen Anteil an der Ernte abschloß. Ende des 2. Jahrhunderts wurde verfügt, wer unbebautes Land okkupiere, könne es durch die Bebauung zum Eigentum mit zehnjähriger Steuerfreiheit erwerben (Herodian, Kaisergeschichte II, [4]. Um das Fortziehen zu verhindern, band man die Bodenbesteller an die Scholle, auch freie Männer, die als Veteranen Boden erhalten hatten, und selbstverständlich die angesiedelten Sklaven, Freigelassenen und Kriegsgefangenen
[1] „Die Fürstenhörigkeit der Landbevölkerung drückt sich in der Fronpflicht sämtlicher Untertanen und der Solidarhaft des Dorfes für die diesem auferlegten Leistungen, endlich in dem daraus folgenden, unter den Ptolemäern als Idia bezeichneten Prinzip aus: der einzelne Bauer ist dabei nicht nur an seine Scholle, sondern an sein Dorf gebunden und gilt, wenn er seine Idia nicht nachweisen kann, als vogelfrei. Dieses System herrscht nicht nur in Ägypten, sondern auch in Mesopotamien und ebenso in Japan, wo wir vom 7.—-10. Jahrhundert das Ku-Bundensystem antreffen; im einen wie im anderen Fall ähnelt dabei die Lage des Bauern durchaus derjenigen im russischen Mir“ (Max Weber, Wirtsch.Gesch., S. 65).
[2] M. Weber, a. a. O. S. 68.
[3] Meitzen, a. a. O. I, S. 362ff. Vgl. Schmoller, Die soziale Frage, S. 539.
[537]
und außerdem eine Anzahl von Elementen, die sich freiwillig schon ganz feudalistisch dem Grundbesitzer „kommendierten“.
B. Die Unterworfenen.
Diesem katastrophalen Niedergang der Gemeinfreien, die überall in politische und wirtschaftliche Abhängigkeit von den großen Grundherren verfallen, verläuft ein anderer, nicht minder bedeutsamer Vorgang parallel, aber in umgekehrter Richtung: die bei der Staatsbildung unterworfene Gruppe steigt empor.
Ein Beispiel dafür können wir sofort an die soeben dargestellte Umwälzung im römischen Reiche anschließen: die ehemaligen Ackersklaven erleben eine gewaltige Besserung ihrer Stellung. Sie werden mit Familien versehen und auf mansus serviles angesetzt[1].
Marquardt (a. a. O. S. 185/86) berichtet, der Sklave sei unter dem Kaiserreich schon im 1. und 2., noch mehr im 3. und 4. Jahrhundert zur Anerkennung seiner natürlichen Rechte gelangt und aus einer Sache zu einer Person geworden. Ehe, Verwandtschaftsrecht, Eigentum, Fähigkeit zu testieren und in eine Korporation einzutreten, werden ihm in gewissem Umfange zugestanden, die Freilassung mehr und mehr erleichtert. Zugleich wird ihm verstärkter Rechtsschutz gewährt, bis unter Constantin die absichtliche Tötung eines Sklaven dem Homi- cidium gleichgestellt wird.
So ist der ehemals so ungeheuere rechtliche und soziale Unterschied zwischen ihnen und den freien Kolonen verschwunden : sie bilden zuletzt eine rechtlich und sozial ganz einheitliche Klasse.
Ganz dasselbe ist in den germanischen Staaten der Fall. Die herabsteigenden Gemeinfreien treffen sich mit den aufsteigenden Hörigen auf halbem Wege und verschmelzen zuletzt zu einer einheitlichen Klasse, den „Grundholden“[2]. Und wieder das gleiche ereignet sich auf dem neuen Eroberungslande im Kolonisationsgebiet auf Slawenboden. „Die deutschen Bauern saßen ursprünglich zu sehr günstigem Besitzrecht: dem Erbzinsrecht, auf ihrem Boden; dagegen war das Besitzrecht der slawischen ganz unsicher. Das hatte zur Folge, daß auch für die Deutschen da, wo die Slawen die Mehrheit bildeten, sich das Besitzrecht verschlechterte. So kam es, daß im Osten die Masse der Bauern im 18. Jahrhundert zu lassitischem Recht saß; der Bauer war Pertinenz des Gutes geworden“[3].
[1] M. Weber, a. a. O. S. 84.
[2] Inama Sternegg, Dtsch. Wirtsch.-Gsch. I, 373, 386, M.Weber S. 74. Für Frankreich berichtet ganz das gleiche Thierry (a. a. O. S. 7/8); die Sklaven (eine bewegliche Sache) werden zu Kolonen (unbewegliche Sache), und diese verschmelzen mit den Liten und den herabgekommenen Freien. Die Sklaverei verschwand im 10. Jahrhundert (S.9).
[3] Max Weber, a. a. O. S. 91.
[538]
Diese Hebung der Untergruppe folgt mit der gleichen Logik wie der Niedergang der Freien aus der Grundvoraussetzung, auf der diese ganze Staatsordnung beruht: der Agglomeration des Grundvermögens in immer wenigeren Händen.
Die Untergruppe ist der natürliche Gegner der Zentralgewalt : denn diese ist ihr Besieger und Besteuerer; und ebenso der Gemeinfreien: denn sie wird von ihnen sozial verachtet, wirtschaftlich zurückgedrängt und politisch unterdrückt. Der große Magnat ist ebenfalls der geborene Gegner der Zentrale : denn sie ist das Hindernis auf seinem Wege zu staatlicher Selbständigkeit — und ist ebenso der geborene Gegner der Gemeinfreien, die nicht nur die Stützen der Krone bilden, sondern auch mit ihrem Besitz räumlich die Ausdehnung seiner Herrschaft hindern und mit ihrem Anspruch auf Gleichheit des Rechts und der sozialen Stellung seinem Fürstenstolze unbequem sind.
Diese vollkommene Übereinstimmung der Interessen auf allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens muß die aufkommenden Landesherren und die Untergruppe zu Bundesgenossen machen; jene können nur zur vollen Unabhängigkeit kommen, wenn sie bei ihren Machtkämpfen gegen Krone und Gemeinfreie über zuverlässige Krieger und willige Steuerzahler verfügen — wir haben soeben ein Beispiel dafür aus Ägypten mitgeteilt —. Die Untergruppe aber kann nur dann wirtschaftlich, rechtlich und sozial aus ihrer Pariastellung erlöst werden, wenn die verhaßten übermütigen Freien niedergerissen werden.
Es ist die Solidarität zwischen Fürst und Volk, der wir immer wieder begegnen. Sie veranlaßt den Halbfürsten, seine hörigen Hintersassen mit ebenso großer Milde zu behandeln wie die Freien seines Gebietes mit Härte: um so williger werden sie für ihn fechten und steuern, und um so leichter werden die geplackten Freien seinem Druck nachgeben, namentlich, wenn erst einmal ihre Teilsouveränetät mit dem Verfall der Zentralgewalt nur der Schatten eines Wortes geworden ist. Oft, so z.B. im Deutschland des io. Jahrhunderts, übte man das milde Regiment mit voller Absicht, um die Untertanen benachbarter Machthaber zu sich herüberzuziehen und sich selbst dadurch an militärischer und steuerlicher Kraft um ebensoviel zu stärken, wie jene, die natürlichen Gegner, zu schwächen. Namentlich die klugen Kirchenfürsten[1] haben sehr oft dafür Sorge getragen, daß es „sich gut unterm Krummstab hausen ließ“. Zu dem Zwecke verschafften sie sich wohl auch Privilegien, die ihre Hintersassen steuerlich besser stellten als die Freien: „Wie noch heute in Buchara verstiftete man sehr häufig sein Land dem Waqf (Tote Hand der Kirche), um es für sich und seine
[1] Vgl. Thierry, a. a. O. S. 8: „Eine Abtei war nicht nur eine Stätte des Gebets und der Meditation, sondern auch ein Asyl gegen alle Übergriffe der Barbarei in allen ihren Gestalten.“
[539]
Erben zurück zu pachten, wobei man viel weniger Abgaben von der Ernte zu zahlen hatte als sonst“[1]. „Nicht zuletzt ist die große Ausdehnung des Waqf in Turkestan, wie wahrscheinlich überall im Orient, auf diesen Umstand zurückzuführen“[2].
Derart erhält die Untergruppe formell oder nur faktisch mehr und mehr Rechte, besseres Besitzrecht, wohl auch Selbstverwaltung und eigene Gerichtsbarkeit in Gemeindeangelegenheiten (Hofrecht), und steigt derart in gleichem Schrittmaß aufwärts wie die Gemeinfreien abwärts, bis beide sich unterwegs treffen und zu einer rechtlich und wirtschaftlich im großen und ganzen gleichen Schicht verschmelzen. Halb Hörige, halb Staatsuntertanen, stellen sie eine charakteristische Bildung des Feudalstaates dar, der keine klare Scheidung zwischen Privat- und Staatsrecht ausgebildet hat: eine unmittelbare Folge aus seiner historischen Entstehung, die staatliche Herrschaft um wirtschaftlicher Privatrechte halber setzte.
4. Die ethnische Verschmelzung. ↩
Diese rechtliche und gesellschaftliche Verschmelzung der gesunkenen Freien und der gehobenen Unfreien wird nun selbstverständlich auch zur ethnischen Durchdringung[3]. Wenn zuerst den Unterworfenen das Commercium und Connubium streng verweigert wurde, so findet die Mischung jetzt kein Hindernis mehr: im Dorf e entscheidet nicht mehr das Herrenblut, sondern der Besitz über die soziale Klasse. Und oft genug mag der reinblütige Nachkomme der Hirtenkrieger bei einem ebenso reinblütigen Nachkommen der alten Unterworfenen den gemeinen Ackerknecht spielen müssen. Die soziale Gruppe der Untertanen des Feudalstaates ist zusammengesetzt aus einem Teil der alten ethnischen Herrengruppe und einem Teil der alten ethnischen Knechtsgruppe.
Nur aus einem Teil der Knechtsgruppe! Denn ihr anderer
[1] Junge, a. a. O. S. 193.
[2] Junge, a. a. O. S. no.
[3] Vgl. Gumplowicz, Allgemeines Staatsrecht, S. 488 (Anmerkung) nach Jirececk, Geschichte der Bulgaren, S. 130: „Das regierende Volk (der Bulgaren) selbst, stark durch seine Tapferkeit, schwach an Zahl, entsagte bald dem Nomadenleben und ging, seßhaft geworden, unter den slawischen Untertanen vollkommen auf; nach wenigen Jahrhunderten gab es nicht mehr zwei verschieden sprechende Völker, Slawen und Bulgaren, sondern nur Bulgaren mit slawischer Sprache. ... In Bulgarien begegnen wir also einer ethnographischen (sollte richtiger heißen: soziologischen) Erscheinung, welche sich etwa 2 Jahrhunderte später unter den russischen Slawen wiederholte. Dort hat eine kleine Schar skandinavischer Waräger den uneinigen und zersprengten Stämmen eine feste Staatsordnung und einen Nationalnamen gebracht, worauf sie selbst unter ihnen unterging“ (S. 138). Ebenso in Deutschland und in Frankreich (Thierry, a.a.O. S. 10, 16).
[540]
Teil ist jetzt ebenfalls mit dem anderen Teil der alten ethnischen Herrengruppe zu einer einheitlichen sozialen Gruppe verschmolzen. Mit anderen Worten: dieser Teil der einstigen Unterworfenen ist nicht nur bis zu dem Punkte aufgestiegen, bis zu dem die Gemeinfreien absanken, sondern weit darüber hinaus, bis er die volle Rezeption in die jetzt ebenso ungeheuer gehobene wie an Zahl verminderte neue Herrenschicht erlangt hatte.
Auch das ist ein universalgeschichtlich typischer Zusammenhang, weil er überall mit gleicher Notwendigkeit aus den Bedingungen des Eroberungsstaates folgt.
Der Primus unter pares, der, sei es als Inhaber der Zentralgewalt, sei es als örtlicher Landesherr, die Fürstenstellung inne hat, braucht für seine Herrschaft gefügigere Werkzeuge, als seine „Pairs“ es sind. Sie vertreten eine Klasse, die er herabdrücken muß, wenn er selbst steigen will — und das will jeder, muß jeder wollen, denn hier wie im Leben des historischen Klassenstaates überhaupt ist Machtstreben identisch mit Selbsterhaltungsstreben: das ist die unabänderliche „Räson“ aller dieser Staaten und ihrer Leiter.
In diesem Streben stehen ihm die widerhaarigen, steifnackigen Vettern und Edelinge der anderen großen Familien im Wege — und darum finden wir an jeder Hofhaltung, vom Großkönig des mächtigsten Reiches herab bis zum Inhaber einer fast nur privaten „Oikenwirt- schaft“, Männer dunkler Herkunft als vertraute Beamte neben den Vertretern der Herrengruppe, die häufig unter der Maske fürstlicher Beamter doch nur „Ephoren“ sind, Mitinhaber der souveränen Gewalt als Bevollmächtigte ihrer Sondergruppen, der Stämme oder Familien. Wir erinnern an die Induna am Hofe der Bantukönige.
Kein Wunder, wenn der Fürst sich, lieber als diesen lästigen und anspruchsvollen Ratsherren, Männern anvertraut, die ganz seine Geschöpfe sind, deren ganze Stellung unlösbar mit der seinen verbunden ist, die sein Sturz ins sichere Verderben reißen wird.
Auch hier wieder sind historische Belege fast überflüssig. Jedermann weiß aus dem XXV. Kapitel in Tacitus' Germania, daß die deutschen Urkönige im schroffen Gegensatz zu allen nicht monarchisch regierten Staaten die libertini wohl über die ingenui und nobiles haben emporsteigen lassen. Das ist durch den ganzen Verlauf der Geschichte germanischer Königreiche immer so geblieben, daß schwertgewandte Plebejer[1] und (vor allem geistliche) Schriftgelehrte niederer Herkunft neben die edlen Verwandten des Königs und freien Vasallen in die höchsten Staatsstellungen einrückten. Zu den Antrustionen Karls des Großen z. B. stellten alle Rassen und Völker des Reiches ihr Kontingent,
[1] Das ist auch ein Hauptgrund des raschen glänzenden Aufstiegs der unfreien Ministerialen in Okzident. Wir sprechen bald in anderem Zusammenhang davon.
[541]
und auch in der Dietrichssage spiegelt sich dieser Aufstieg tapferer Söhne fremder oder unterworfener Völker: Heime und Studo. Wir bringen auch hier einige weniger bekannte Belege:
Ed. Meyer erzählt, daß die Magier auf primitiver Stufe öfter ihre geheimen Kenntnisse und damit ihre ungeheure Macht über die Seelen des Stammes nicht ihren Söhnen, sondern vertrauten Knechten übermitteln[1]. In der Heldensage der nordafrikanischen Reiter- und Herrenvölker spielt nach der ihnen von Frobenius gegebenen Fassung eine Art von Hildebrand-Gestalt, ein „Waffenmeister“ aus niederem Geschlecht eine nicht unbedeutende Rolle. Unter Sepopa kamen viele Männer aus niederem Stande gegen den Marotse-Adel in die höchsten Ämter [2]. Der Einzige, der Sepopa die Treue hält, ist der von ihm erhöhte Fürst der Masubia[3]. Lewanika macht, nachdem er den Adel der Marotse ausgerottet hat, ehemalige Leibsklaven zu seinen Beamten[4]. Ratzel berichtet vom Bornu-Reich: „Die Freien haben das Bewußtsein ihrer freien Herkunft den Sklaven des Scheichs gegenüber nicht verloren, aber die Herrscher hegen zu den Sklaven mehr Vertrauen als zu ihren eigenen Verwandten und freien Stammesgenossen und rechnen auf ihre Ergebenheit. Nicht nur Hofämter, sondern auch die Verteidigung des Landes wurde von altersher Sklaven anvertraut. Die Brüder des Fürsten wie auch die ehrgeizigeren und tatkräftigeren Söhne werden mit Argwohn betrachtet; während man die wichtigsten Hofämter in den Händen von Sklaven findet, sind die Posten fern vom Regierungssitz in denen der Prinzen“[5]. Bei den Fulbe „spielen die Sklaven der Könige eine große Rolle, die Soldaten und Beamte sind und auf die höchsten Stellen im Staate Anspruch machen dürfen“[6].
Im Pharaonenlande fand sich, wie wir wissen, im alten Reiche „eine für die einzelnen Regierungsfunktionen bestimmte Hofbeamtenschaft, die aus der Zahl der an den Höfen der Herrenfürsten eingestellten Dienerschaft — Kriegsgefangenen, Flüchtlingen usw. — hervorgegangen ist“[7]. Noch die Josefssage zeigt als eine diesem Zeitalter geläufige Vorstellung das Aufsteigen eines Sklaven zum allmächtigen Minister. Und bis auf die letzte Vergangenheit hinauf war solche Laufbahn an den orientalischen Höfen, in Persien, der Türkei, Marokko usw. durchaus nichts Ungewöhnliches. Der alte Derfflinger mag aus einer viel späteren Zeit als ein Beispiel genannt werden, dem unzählige tapfere Haudegen an die Seite zu stellen sind.
[1] Elemente der Anthrop. S. 93.
[2] Richter, Die Marotse, S. 29.
[3] Richter, Die Marotse, S. 30.
[4] Richter, Die Marotse, S. 38, 148.
[5] Ratzel, Völkerkunde II, S. 503.
[6] Ratzel, Völkerkunde II, S. 518.
[7] Thurnwald, a. a. O. S. 706.
[542]
Aber es sind nicht nur Schwertgewaltige, die derart aufsteigen, sondern auch staatsmännisch Begabte, wie wieder die Josephsage zeigt. Das französische Königtum stützte sich in seinem Kampfe gegen die Stände mit Vorliebe auf den „Halbadel“[1] der Justiz- und Finanzbeamten, die noblesse de la robe, die eine Zeit hindurch geradezu leiden schaftlich für den Absolutismus[2] fochten. Noch der Kardinal Richelieu schickte mit Vorliebe Plebejer als Intendanten in die Provinzen, „weil auf sie am meisten Verlaß ist“[3]. Aus ganz dem gleichen Grunde bevorzugten die ersten deutschen Könige die Geistlichkeit bei der Verleihung der Lehen, schon die Karolinger[4], dann vor allem die Sachsenkaiser[5], die von ihnen die Tradition übernahmen, in den Prälaten die Bundesgenossen gegen die weltlichen Großen zu sehen[6]. Die Krone mußte erst die Erfahrung machen, daß die neuen Besitzer sich doch auch gegen den König wenden könnten[7]. Aus ähnlichen Gründen mögen die Pharaonen des Alten Reichs die ungeheuren Schenkungen von Land an die Priesterschaft gemacht haben: sie machten die gleiche traurige politische Erfahrung wie die deutschen Kaiser[8].
Ja, man könnte auf den Gedanken kommen, daß der merkwürdige Eifer, mit dem die Großfürsten heidnischer Staaten sich eine der berühmten Religionen verschrieben, die meisten im Mittelalter das Christentum, aber, wie wir wissen, der Chazarenkhan das Judentum, auf dem gleichen Grundgedanken beruht, in den fremden Priestern eine feste Stütze zu finden, da diese im Lande selbst keinen anderen festen Anhalt als eben den Fürsten selbst hatten.
Ganz zweifellos sind zwei Tatsachen: erstens, daß überall starke Fürsten den alten Blutsadel entweder auszurotten oder in einen ungefährlichen Amtsadel umzuformen bestrebt waren; wir sind diesem Streben, so in Ägypten, mehrfach begegnet. Die Franken haben den alten Geschlechtsadel der Herzogtümer ausgerottet, die russischen Tzaren haben ihn erfolgreich in einen Amtsadel zu verwandeln verstanden[9]. Ebenso das französische Königtum in einen Hofadel. Und
[1] Röscher, Politik, S. 160.
[2] Vgl. dazu Mitscherlich, Nationalismus 141, 156.
[3] Treitschke, Politik II, S. 111.
[4] Röscher, a. a. O. S. 59, Anm.
[5] Röscher, a. a. O. S. 63: Otto der Große gibt die Lehen am liebsten an Kleriker, weil sie nicht vererblich waren. Ebenso Otto III. (a. a. O. S. 75), weil die Bistümer und Reichsabteien ganz unter dem Ernennungs- und Absetzungsrecht der Krone blieben.
[6] v. Below, Der deutsche Staat des Mittelalters, S. 364. Vgl. S. 255, 258/9.
[7] A. a. O. S. 259.
[8] Meyer, Gesch. d. Altertums I, S. 199, 207, 228.
[9] Hoetzsch, Rußland, S. 37. Vgl. Treitschke, Politik I, S. 313: „Der Despotismus ist der natürliche Feind der Geburtsaristokratie“. Er verweist auf China, wo die Einführung einer vom Staat anerkannten Hierarchie völlig gelungen ist, und auf Rußland, auf das er (II, S. 124) noch einmal zurückkommt.
[543]
die zweite Tatsache ist, daß umgekehrt aller Amtsadel die Tendenz hatte, und sehr oft zu seinem Ziele gelangte, zum Blutsadel zu werden. Auch das haben wir mehrfach dargestellt. Er stellt dann im entfalteten Feudalstaat den Hohen Adel dar und pflegt seinen Rang selbst dann zu bewahren, wenn er durch Verschlucken seitens eines mächtigeren Nachbarn mediatisiert worden ist. Der fränkische Hofadel enthält sicher solche Elemente aus der Unterklasse[1]; da aber aus seinem Stamme der Hochadel des ganzen europäischen Kulturkreises zum großen Teile hervorgegangen ist, mindestens mittelbar durch Verschwägerung, so finden wir die ethnische Verschmelzung auch in der höchsten Schicht der Herrengruppe, in den Herrscherhäusern.
Aber nicht minder ist der spätere niedere Adel ebenso ethnisch gemischt. Der gleiche Prozeß ergreift auch die jetzige Unterschicht der Herrenklasse, die Beamten und Offiziere der großen Lehenträger. Zuerst besteht noch ein starker sozialer Unterschied zwischen den freien Vasallen, die der große Grundherr mit Unterlehen begabt hat: Verwandten, jüngeren Söhnen anderer adliger Familien, verarmten ritterbürtigen Bezirksgenossen, einzelnen freigeborenen Bauernsöhnen, freien Flüchtlingen und berufsmäßigen Raufbolden freier Abstammung, — und den sozusagen subalternen Offizieren der Garde, die aus der Unterschicht stammen. Aber die Unfreiheit steigt, und die Freiheit sinkt im Werte, und auch hier vertraut der Fürst eher auf seine Kreaturen als auf seine Pairs. Und so kommt es auch hier früher oder später zu voller ethnischer Verschmelzung. In Deutschland steht der hörige Hofadel noch 1085 im Range zwischen servi et litones, aber hundert Jahre später bereits bei den liberi et nobiles[2]. Im Laufe des 13. Jahrhunderts verwächst er völlig mit der freien Vasallität zum ritterschaftlichen Adel, dem er inzwischen wirtschaftlich gleichgestellt ist: beide haben Unterlehen, Dienstlehen, gegen Verpflichtung zur Heeresfolge; und die Dienstlehen der Hörigen, der „Ministerialen“, sind inzwischen ebenso erblich geworden, wie die der freien Vasallen, und wie es die Erbgüter der wenigen, noch aufrechten, der Umklammerung durch das Landesfürstentum noch nicht verfallenen, kleineren Grundherrn des alten Adels von jeher waren.
Ganz analog ist der Prozeß in allen anderen Feudalstaaten Westeuropas verlaufen, und sein genaues Gegenstück findet sich im äußersten Osten der eurasischen Landmasse, in Japan. Die Daimio sind der Hochadel, die Samurai die Ritterschaft, der Schwertadel.
[1] „Bei Erlaß der lex salica ist der alte Geschlechtsadel bereits zu Gemeinfreien herabgedrückt oder vernichtet“ (Meitzen, a. a. O. I, S. 579).
[2] Inama-Sternegg, a. a. O. II, S. 61. Vgl. Spangenberg, Vom Lehnsstaat zum Ständestaat, S. 31/2.
[544]
5. Der entfaltete Feudalstaat. ↩
Damit ist der Feudalstaat völlig zur Entwicklung gelangt, in jenem strengsten Sinne, den v. Below dem Begriffe gibt. Er unterscheidet Lehnsstaat und Feudalstaat und stellt fest, daß die Höhepunkte der beiden z. B. in Deutschland nicht zusammenfallen. „Wir würden die klassische Zeit des Feudalstaates vom Ende des 12. Jahrhunderts, den Höhepunkt des Lehnsstaates einschließend, bis zur zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts begrenzen“[1]. Er kennzeichnet ihn folgendermaßen; „Neben der radikalen Durchbrechung des Untertanenverbandes steht die Durchbrechung der Gleichheit von Rechten und Pflichten der übrigen Untertanen . . . Wenn der eine ein größeres, der andere ein geringeres Maß von Gerichtsbarkeit besitzt, wenn eine Stelle (ein kirchliches Institut oder eine städtische Gemeinde) das Wahlrecht hat, eine andere etwa nur das Recht der Präsentation, so geht dies zurück auf entsprechende Unterschiede in der Veräußerung staatlicher Rechte“ (S. 284). Er zitiert einen Satz von Hans Delbrück: „Feudalismus bedeutet Zerlegung der höchsten souveränen Gewalt in mehrere Stufen, die jede für sich eine gewisse Selbständigkeit haben und nach eigenem Ermessen, nicht nach vorgeschriebenem kontrollierbaren Maße für den Staatszweck zusammenwirken“ (S. 303, Anm. 7).
Der voll entfaltete Feudalstaat stellt sich politisch-sozial dar als eine Hierarchie von zahlreichen Schichten, von denen immer die untere der nächst oberen leistungsverpflichtet, die obere der nächst unteren schutzverpftichtet ist. Die Grundlage unten bildet das arbeitende Volk, immer noch zum Hauptteil aus Bauern bestehend; der Überschuß ihrer Arbeit, die Grundrente, der gesamte „Mehrwert“ des ökonomischen Mittels, dient dem Unterhalt der oberen Schichten. Diese Grundrente fließt von der Mehrzahl der Grundstücke, so weit sie nicht mehr unmittelbarer, unverlehnter Besitz des Landesherren oder des Kronenträgers sind, an die kleinen Lehensträger; diese haben dafür ihre vertragsmäßige Heeresfolge zu leisten und darüber hinaus in gewissen Fällen wirtschaftliche Leistungen zu erfüllen; der größere Lehensträger ist in gleicher Weise dem großen, dieser wenigstens formell-rechtlich dem Träger der Zentralgewalt verpflichtet; und der Kaiser, König, Sultan, Schah, Pharao gilt wieder als Vasall des Stammesgottes: so steigt vom Ackerboden, dessen Bebauer alles trägt und nährt, bis zum „Himmelskönig“ eine kunstvoll gestaffelte Rangordnung auf, die das ganze Staatsleben so umklammert, daß der Sitte und dem Rechte nach kein Stück Land und kein Mensch sich ihr entziehen kann. Sind doch, wie wir sahen, alle ursprünglich für die Gemeinfreien geschaffenen Rechte verfallen oder durch den Sieg des Landesfürstentums umge-
[1] Der deutsche Staat des Mittelalters, S. 280.
[545]
bogen worden : wer nicht im Lehnswesen steht, ist in der Tat vogelfrei, ohne Schutz und ohne Recht, d. h. ohne die Macht, die allein Recht zu schaffen vermag. Wir haben bereits gesehen, daß auf dieser Grundlage der Rechtssatz „nulle terre sans seigneur“ mit Notwendigkeit erwachsen mußte.
Was haben nicht die Verfechter der Rassenlehre als des geschichts- philosophischen Hauptschlüssels für kühne Schlüsse aus der angeblichen Tatsache gezogen, daß nur die Nordeuropäer kraft ihrer überlegenen „Staatsbegabung“ den kunstvollen Bau des Vollreifen Feudalstaates zustande gebracht haben! Das Argument hat schon viel an Gewicht verloren, seit man sich davon überzeugen mußte, daß auch die mongolische Rasse in Japan ganz das gleiche geleistet hatte. Vielleicht hätte der Neger es selbst dann nicht so weit gebracht, wenn ihm nicht der Einbruch stärkerer Zivilisationen den Weg abgeschnitten hätte: obgleich sich z. B. Uganda nicht gar so sehr von dem Reiche der Karolinger oder des roten Boleslaw unterscheidet, mit Ausnahme der „Traditionswerte“ aus der Kultur der mittelländischen Seestaaten; und die waren nicht ein Verdienst der nordeuropäischen Rasse, sondern ein Geschenk, das sie von einer einzigartigen Konstellation der Geschichte als Mitgift erhielt.
Aber lassen wir den Neger beiseite ! Auch der Hamit hat vor Jahrtausenden ganz das gleiche Feudalsystem aufgebaut. Klingt es nicht wie eine Schilderung aus der Stauferzeit, wenn Thurnwald berichtet: „Wer sich in die Gefolgschaft eines Machthabers begab, stellte sich dadurch unter dessen Schutz, wie unter den eines Familienhauptes. Dieses Verhältnis . . . bezeichnet ein der Vasallität ähnliches Treueverhältnis. Dieses Schutz- gegen Treueverhältnis wird zur Basis der gesamten Gesellschaftsorganisation Ägyptens. Es liegt ebenso den Beziehungen des Feudalherren zu seinen Dienstmannen oder Bauern wie des Pharao zu seinen Beamten zugrunde. Auf dieser Form beruht der Zusammenschluß der Einzelnen zu Gruppen unter gemeinsame Schutzherren bis hinauf zum Gipfel der Gesellschaftspyramide, zum König, der selbst als .Platzhalter seiner Väter', als Vasall der Götter auf Erden gilt. . . . Wer außerhalb dieser sozialen Klammerung lebt, der .Mann ohne Meister' (= Schutzherr) ist schutzlos und daher rechtlos[1].
Wir haben bisher die Hypothese einer besonderen Rassenbegabung nicht gebraucht und werden sie auch in Zukunft nicht brauchen[2].
Die vielfache Staffelung der Stände in einer einzigen Pyramide gegenseitiger Abhängigkeit ist das erste Kennzeichen des vollentfal-
[1] Thurnwald, a. a. O. S. 705. Ludwig von Gerlach schrieb, „die Monarchen hätten ihre Kronen dem König aller Könige, Christo, zu Lehen aufgetragen und dadurch . . . dem Reiche Gottes gehuldigt“ (von Martin, a. a. O. S. 381).
[2] S. S. I, S. 624ff., namentlich 638/39 Anmerkung, 639ff.
[546]
teten Feudalstaates. Die Verschmelzung der ursprünglich gesonderten ethnischen Gruppen zu einem einzigen Volkstum ist sein zweites Kennzeichen.
Das Bewußtsein der einstigen Rasse η Verschiedenheit ist völlig verschwunden. Nichts bleibt als die Klassen Verschiedenheit.
Fortan haben wir es nicht mehr mit ethnischen Gruppen, sondern mit gesellschaftlichen Klassen zu tun. Der soziale Gegensatz allein beherrscht das Leben des Staates. Und entsprechend wandelt sich das ethnische Gruppenbewußtsein zum Klassenbewußtsein, die Gruppentheorie zur Klassentheorie. Sie ändert ihr Wesen dabei nicht im mindesten. Die neuen Herrenklassen sind genau so legitimistisch-rassen-stolz wie die alte Herrengruppe es war; auch der neue Schwertadel versteht es, seinen Ursprung aus der besiegten Gruppe schnell und gründlich zu vergessen. Auf der anderen Seite schwören von einer gewissen Entwicklung der geistigen Aufklärung an der deklassierte Freie und der gesunkene Edeling genau so auf das „Naturrecht“, wie früher nur die Unterworfenen.
Und ebenso ist der entfaltete Feudalstaat noch immer grundsätzlich ganz das gleiche Wesen, das er bereits im zweiten Stadium der primitiven Staatsbildung war. Seine Form ist die Herrschaft, sein Wesen ist die politische Ausbeutung des ökonomischen Mittels, begrenzt durch ein Staatsrecht, das dem Berechtigten des politischen Mittels die Schutzpflicht auferlegt und das Recht der Verpflichteten auf Erhaltung bei der Prästationsfähigkeit gewährleistet. Am Wesen der Herrschaft hat sich nichts geändert, sie ist nur vielfältiger abgestuft ; und das gleiche gilt für die Ausbeutung oder das, was die ökonomische Theorie als „Verteilung“ bezeichnet: die Verteilung der Produktionsfaktoren (d. h, des Eigentums), des Gesamterzeugnisses und der Arbeitslast.
Nach wie vor kreist die Innenpolitik des Staates in derjenigen Bahn, die ihm das Parallelogramm aus der zentrifugalen Kraft des jetzt zum Klassenkampf gewandelten Gruppenkampfes — und aus der zentripetalen Kraft des Gemein-, des Staatsinteresses vorschreibt. Und nach wie vor wird seine Außenpolitik bestimmt durch das Streben seiner Herrenklasse nach neuem Land und Leuten: ein Streben auf Erweiterung, das gleichzeitig noch immer Trieb der Selbsterhaltung ist.
Viel feiner differenziert, viel mächtiger integriert, ist der entfaltete Feudalstaat mithin nichts anderes als der zu seiner Reife gelangte primitive Eroberungsstaat.
II. Die weiter entwickelnden Kräfte.↩
Wenn wir den Begriff der Ausgänge wieder fassen als eine organische, aus inneren Kräften bedingte Weiterentwicklung des entfalteten Feudalstaates nach vor- oder rückwärts, nicht aber als ein von äußeren
[547]
Kräften bedingtes, mechanisch herbeigeführtes Ende — dann kann man aussprechen, daß seine Ausgänge vor allem durch die selbständige Entwicklung der vom ökonomischen Mittel begründeten gesellschaftlichen Institutionen bestimmt werden.
Solche Einflüsse können auch von außen, aus fremden Staaten kommen, die, dank einer weiter gediehenen wirtschaftlichen Entwicklung, straffere Zentralisation, bessere militärische Gliederung und größere Stoßkraft besitzen. Wir haben solche Fälle schon gestreift: die selbständige Entwicklung der Eroberungsstaaten des Mittelmeerbereiches wurde durch ihren Zusammenstoß mit den ökonomisch viel reicheren, straff zentralisierten Seestaaten: Karthago, und vor allem Rom, abgeschnitten. Auch die Zerstörung des Perserreiches durch Alexander darf hier angezogen werden, da Makedonien damals bereits, wie wir fanden, die Errungenschaften der hellenischen Seestaaten sich angeeignet hatte. Das beste Beispiel aber für solche Fremdeinflüsse bietet wieder die neueste Zeit in Japan, dessen Entwicklung durch die kriegerischen und friedlichen Einwirkungen des westeuropäischen Kulturkreises in fast unglaublicher Weise abgekürzt wurde. In kaum einem Menschenalter hat es den Weg vom entfalteten Feudalstaat zum voll ausgebildeten modernen Verfassungsstaat zurückgelegt.
Uns will scheinen, als handele es sich hier eben nur um eine Abkürzung des Prozesses. Soweit wir zu sehen vermögen, — denn jetzt werden die historischen Belege sehr selten, und die Ethnographie bietet uns überhaupt keine mehr —, müssen innere Kräfte auch ohne starke fremde Einflüsse den entfalteten Feudalstaat mit strenger Folgerichtigkeit immer denselben Weg zum gleichen Ausgang führen.
Die Schöpfungen des ökonomischen Mittels, die diesen Gang beherrschen, sind das Städtewesen und die in den Städten entwickelte Geldwirtschaft, die die Naturalwirtschaft allmählich verdrängt und damit die Achse, um die das ganze Staatsleben kreist, an eine ganz andere Stelle verlegt: an die Stelle des Grundvermögens rückt mehr und mehr das mobile Kapital.
1. Die Emanzipation der Bauernschaft. ↩
All das folgt mit Notwendigkeit aus den Grundvoraussetzungen des feudalen Naturalstaates. Je mehr sich das Großgrundeigentum zum Landesfürstentum auswächst, um so mehr muß im gleichen Schrittmaß die feudale Naturalwirtschaft zerfallen:
Solange das Großgrundeigentum noch verhältnismäßig klein und geschlossen ist, läßt sich der primitive Imkergrundsatz, der den Bauern gerade die Lebensnotdurft läßt, durchführen: wenn es sich aber räumlich ins Gewaltige dehnt und, wie regelmäßig der Fall, durch Fehdegang,
[548]
Kommendation kleiner Grundherrn, Erbschaft und Ehepolitik einen weit um den eigentlichen Kern herumliegenden Streubesitz einschließt, dann läßt sich die Imkerpolitik nicht mehr durchführen. Wenn der Grundherr nicht eine Unzahl von Aufsichtsbeamten besolden will — und das ist teuer und politisch gefährlich: denn sie werden allmählich zu Herren des Grundeigentums werden — so muß er den Bauern eine irgendwie begrenzte Abgabe, halb Rente, halb Steuer auferlegen. So kommt also die wirtschaftliche Notwendigkeit einer Verwaltungsreform der von uns oben geschilderten politischen Notwendigkeit, die „Plebs“ zu heben, entgegen.
Je mehr nun der Grundherr aufhört, privatwirtschaftliches Subjekt zu sein, je ausschließlicher er öffentlich-rechtliches Subjekt, Landesfürst, wird: um so mehr setzt sich die von uns immer wieder aufgefundene Solidarität zwischen Fürst und Volk durch. Wir sahen, daß die einzelnen Magnaten schon in der Übergangszeit vom Großgrnndeigentum zum Fürstentum das größte Interesse daran hatten, eine milde Regierung zu führen, nicht nur, um die eigenen Untertanen zu kräftigem Staatsbewußtsein zu erziehen, sondern auch, um den noch aufrechten Gemeinfreien den Übertritt in die Abhängigkeit zu erleichtern und den Nachbarn und Nebenbuhlern das kostbare Menschenmaterial zu entziehen. Dieses Interesse muß dem zur vollen faktischen Selbständigkeit gelangten Landesfürsten das Verharren auf dem einmal eingeschlagenen Wege dringend anempfehlen. Vor allem aber wird er, wenn er nun wieder selbst Land und Leute an seine Beamte und Offiziere verlehnt, das stärkste politische Interesse daran haben, ihnen seine Untertanen nicht mit Haut und Haaren auszuliefern, wie wir das im Beispiel Wilhelms des Eroberers klar bewußt vermieden sahen. Darum beschränkt der Fürst das Rentenrecht der Ritter auf bestimmte Leistungen in Naturalien und Fronden, während er andere, im Landesinteresse nötige, namentlich die trinoda nécessitas und die Geldsteuer, dem Staate und sich vorbehält. Wir werden sofort erkennen, wie sehr es für den späteren Aufstieg des Bauern entschieden hat, daß er im entfalteten Feudalstaat mindestens an zwei Herren zu leisten hatte.
Aus allen diesen Gründen muß im entfalteten Feudalstaat der Bauer auf irgendwie begrenzte Abgaben gestellt werden. Das aber heißt umgekehrt, daß von jetzt an aller Überschuß ihm selbst zur freien Verfügung gehört. Damit aber ist der Charakter des Großgrundeigentums völlig umgeschlagen: gehörte dem Eigentümer bisher von Rechts wegen der gesamte Ertrag, abzüglich des notdürftigen Unterhalts des Bebauers, so gehört jetzt der gesamte Ertrag von Rechts wegen dem Bebauer abzüglich einer festen Rente für den Eigentümer: aus dem Großgrundbesitz ist die „Grundherrschaft“ geworden.
Das ist der zweite große Schritt, den die Menschheit
[549]
zu ihrem Ziele tut. Der erste war der Übergang vom Bären- zum Imkerstadium, der die Sklaverei erfand; dieser hebt sie aut. Der arbeitende Mensch, bisher nur Objekt des Rechtes, ist jetzt zum ersten Male Rechts Subjekt gworden: er hat das Eigentum an seiner Person und an seiner Scholle wenigstens zum Teile zurückerlangt; der rechtlose Arbeitsmotor seines Herrn, der nur auf Leib und Leben eine notdürftige Gewähr besaß, ist jetzt steuerpflichtiger Untertan eines Fürsten geworden.
Nun spannt das ökonomische Mittel, zum ersten Male seines Erfolges sicher, ganz anders seine Kräfte an. Der Bauer, durch sein „Hofrecht“ und seine „Urbare“ in seinem Erwerbe geschützt, arbeitet mit unvergleichlich mehr Eifer und Sorgfalt und erzielt Überschüsse: und damit ist die „Stadt“ im strengen ökonomischen Sinne geschaffen, die Gewerbsstadt. Bäuerliche Überschüsse bedeuten Nachfrage nach Gütern, die die bäuerliche Wirtschaft nicht selbst erzeugen kann oder will; und Intensivierung des bäuerlichen Betriebes bedeutet Verminderung der gewerblichen Güter, die bisher der bäuerliche Hausfleiß selbst nebenher erzeugte: denn der Bodenbau und die Viehzucht absorbieren mehr und mehr von der Arbeitskraft der bäuerlichen Familie. Die sekundäre Arbeitsteilung zwischen der Urproduktion und dem Gewerbe wird möglich und notwendig; das Dorf wird vorwiegend der Sitz der ersteren, die Gewerbsstadt entsteht als Sitz der letztgenannten. Wir haben schon einmal den gewichtigen Kernsatz aller praktischen Ökonomik kennen gelernt: „Wer Bauern schafft, schafft Städte.“
2. Die Entstehung der Gewerbsstadt. ↩
Man verstehe nicht falsch: nicht die Stadt entsteht, sondern die Gewerbsstadt. Die reale historische Stadt besteht längst, sie fehlt keinem entfalteten Feudalstaat. Sie ist entstanden entweder aus dem reinen politischen Mittel als Burg oder aus dem Zusammenwirken des politischen mit dem ökonomischen Mittel als Meßplatz oder aus dem religiösen Bedürfnis als Tempelbezirk. Wo solche Städte im historischen Sinne in der Nachbarstadt der befreiten Bauernschaften bestehen, gliedert sich ihnen selbstverständlich die neuerwachsende Gewerbsstadt an; sonst entsteht sie spontan aus der jetzt sich entfaltenden volkswirtschaftlichen Arbeitsteilung und wird in der Regel sich nun ebenfalls als Burg und Kultstätte ausbauen.
Ein Beispiel für die erste Art der Entstehung: „Die größeren Heerlager der römischen Rheinarmee erhielten teils durch die Handelsleute, die dem Heere sich anschlössen, teils und vor allem durch die Veteranen, die in ihren gewohnten Quartieren auch nach Entlassung verblieben, einen städtischen Anhang, eine von den eigentlichen Militärquartieren
[550]
gesonderte Budenstadt (canabae); überall und namentlich in Germanien sind aus diesen bei den Legionslagern und besonders den Hauptquartieren mit der Zeit eigentliche Städte erwachsen“[1].
Was den zweiten Fall anlangt, so haben wir die Märkte und Messen oben in ihrer Entstehung und Anlage betrachtet. Ihre „Weiterentwicklung konnte in doppelter Richtung geschehen; die Märkte wurden entweder aus dem neutralen Gebiete in das Weichbild der Ansiedlung verlegt, oder sie behielten ihre Stelle, und um sie herum bildeten sich neue Ortschaften“[2].
Um ein Beispiel für den dritten Fall zu nennen, so ist Mekka ein solcher zur Stadt herangewachsener Kultort, in einem gewissen Sinne auch das mittelalterliche Rom und das heutige Jerusalem oder Bethlehem. Der Typus ist weit verbreitet : „Zu den Verehrungsstätten kommen immer Priesterwohnungen, Schulen, Pilgerherbergen“[3]. Natürlich wird jeder große Wallfahrtsort Mittelpunkt eines starken Marktverkehrs. Nicht umsonst heißen unsere nordeuropäischen Großhandelsmärkte noch heute nach der religiösen Eröffnungszeremonie „Messen“.
So weit diese Städte nicht schon zu Gewerbsstädten, d. h. zu Organen der volkswirtschaftlichen Arbeitsteilung erwachsen sind, kann man sie unter dem Namen „Kaufstädte“ oder „bloß zehrende Städte“ zusammenfassen, den Friedrich List[4] ihnen im Gegensatz zu den „Manufakturstädten“ gegeben hat. Vorwiegend „bloß zehrende Städte“ sind diejenigen Siedlungen, in denen heute Rentner und Pensionäre massenhaft leben; so bezeichnet man häufig Wiesbaden und Görlitz als Pensionopolis.
Aber das sind zufällige historische Beimengungen. Im streng ökonomischen Sinne bedeutet „Stadt“ den Ort des ökonomischen Mittels, des äquivalenten Tauschverkehrs zwischen Urerzeugung und Gewerbe. Dem entspricht auch der Sprachgebrauch: eine reine, wenn auch noch so große Festung, eine noch so große Anhäufung von Tempeln, Klöstern und Wallfahrtsstätten (Berg Athos), wenn sie ohne Markt möglich wären, würde man immer nur nach ihren äußeren Merkmalen als „stadtähnlich“ oder „stadtartig“ bezeichnen.
So wenig sich an dem Äußeren der historischen Stadt geändert haben mag, so gewaltig ist doch die innere Umwälzung, die mit dem Entstehen der Gewerbsstadt einsetzt.
Die Gewerbsstadt ist der Gegenpol und Widerpart des Staates;
[1] Mommsen, Römische Geschichte V, S. 153.
[2] Lasch, Marktwesen, S. 713.
[3] Ratzel, Völkerkunde II, S. 575.
[4] Nationales System der politischen Ökonomie, Ausgabe Eheberg, S. 176/77. Er ist also Werner Sombart voran gegangen, der diesen Gegensatz entdeckt zu haben glaubt. Vgl. auch Sismondi, Nouveaux études II, S. 13 über Rom.
[551]
wie er das entfaltete politische, so ist sie das entfaltete ökonomische Mittel[1]: „Nicht hoch genug können . . . die sittlichen und rechtlichen Ideen angeschlagen werden, welche aus dem Marktverkehr sich ergeben und von dort aus Gemeingut des Volksbewußtseins werden. Die Begriffe des Friedens, der Gastfreundschaft und Humanität gegen Fremde würden ohne das Handels- und speziell das Marktleben niemals geschaffen, erfaßt und in Handlungen umgesetzt worden sein. Die Geschichte des Marktwesens ist gleichzeitig ein wichtiges Kapitel in der Geschichte der sittlichen Entwicklung der Menschheit“[2].
Der große Kampf, der die Weltgeschichte erfüllt, ja bedeutet, der ihren „Sinn“ ausmacht, spielt hinfort zwischen städtischem und staatlichem Wesen: „Wenn die Städte überall die Träger der Gesittung sind, so faßte vor allem der Antagonismus der Orientalen und Okzidentalen in seiner ganzen Schärfe sich zusammen in dem Gegensatz der orientalischen militärisch-despotischen Lehenshierarchie und des hellenisch-italischen, Gewerbe und Handel treibenden städtischen Gemeinwesens“[2].
In diesen Worten Mommsens kommt zum Ausdruck, daß die orientalische Stadt sich doch in einem wichtigen Punkte von der okzidentalischen unterscheidet. Wir verdanken die Herausarbeitung des Gegensatzes wesentlich Max Weber, aus dessen „Wirtschaftsgeschichte“ wir im folgenden die wichtigsten hierher gehörigen Daten zusammenstellen :
Gewerbsstädte im rein ökonomischen Sinne gibt es überall, überall stehen Handwerker, Kaufleute und Unternehmer in sekundärer volkswirtschaftlicher Arbeitsteilung und -Vereinigung mit der Bauernschaft des platten Landes: „aber niemals und nirgends wurden sie zu einer einheitlichen sozialen Klasse zusammengefaßt. Der Staatsbürger begriff hat seine Vorgänger in der antiken und mittelalterlichen Stadt. Hier gab es Bürger als Träger politischer Rechte, während uns außerhalb des Okzidents nur Spuren davon entgegentreten“ (271). Das liegt wesentlich daran, daß es „außerhalb des Okzidents die Stadt als Gemeindeverband nicht gegeben hat. Entscheidend für diesen ihren Charakter war im Mittelalter eigenes Recht und Gericht und der Besitz eigener autonomer Behörden in irgendeinem Umfang. Der Bürger des Mittelalters war Bürger, weil und soweit er an diesem Gericht und der Wahl dieser Behörde teilhatte“ (273).
Weshalb hat es im Orient Städte in diesem Sinne nicht gegeben ? Es waren weder wirtschaftliche Gründe, noch der „spezifisch germanische Geist, der die Einung geschaffen hat, denn China und Indien haben viel stärkere Einungen gekannt als der Okzident, während dort
[1] Vgl. Thierry, a. a. O. S. 9.
[2] Lasch, Marktwesen, S. 782.
[3] Mommsen, Römische Geschichte III, S. 153.
[552]
trotzdem der Stadtverband fehlt“ (274). Weber erblickt die Ursache in dem revolutionären Charakter der okzidentalen Stadt, die durch einen Verbrüderungsakt entsteht, durch den συνοικισμός in der Antike, die conjuratio im Mittelalter, „die bewaffnete Verbrüderung zu gegenseitigem Schutz und Trutz und damit die Usurpation politischer Gewalt“ (274). Diese Entwicklung war nur im Okzident möglich, und zwar aus zwei Gründen : einmal aus dem hier gegenüber dem Orient bestehenden „Unterschied in der Wehrverfassung. Die okzidentale Stadt in ihren Anfängen ist zunächst Wehrverband, Vereinigung der ökonomisch Wehrhaften, die imstande sind, sich selbst auszurüsten und ausbilden zu lassen“ (275). In den orientalischen Landstaaten ist überall das Heer des Fürsten älter als die Stadt, ist von ihm ausgerüstet und von seinen Offizieren befehligt. Und das hängt wieder mit der gewaltigen Ausweitung der Fürstenmacht zusammen, die in allen Be- wässerungs- (Oasen-) Staaten notwendig eintreten muß, wie wir bei der Schilderung dieser Staatswesen darzustellen haben werden.
Das zweite Hindernis für die Entstehung der Stadt als eines Gemeindeverbandes im Orient erblickt Weber in der Magie. Nur im Orient bestand das priesterliche Monopol des Verkehrs mit den Göttern, „während diesen Verkehr in der okzidentalischen Antike die Stadtbeamten besorgten, und die daraus entspringende Herrschaft der Polis über Göttervermögen und Priesterpfründen zuletzt dahin führte, diese Priesterstellen durch Versteigerung zu besetzen, weil keine magischen Schranken im Wege standen wie in Indien. Für den späteren Okzident wurden drei große Tatsachen entscheidend: die jüdische Prophétie, welche die Magie innerhalb des Judentums vernichtete . . ., das Pfingstwunder, die Verbrüderung im christlichen Pneuma . . ., endlich der Tag von Antiochien, wo Paulus (im Gegensatz zu Petrus) kultische Gemeinschaft mit Nichtbeschnittenen pflegte. Die magischen Schranken zwischen Sippen, Stämmen und Völkern, die doch auch die antike Polis zum Teil noch gekannt hatte, wurden dadurch beseitigt, und die Möglichkeit der Entstehung der okzidentalen Stadt war gegeben“ (277).
Wir wollen hinzufügen, daß diese Entwicklung des Christentums, und im Christentum, nur möglich war unter den politischen, sozialen und ökonomischen Bedingungen des durch die Alexanderzüge und die spätere römische Weltherrschaft geschaffenen „weiten Raumes“: eine Bedingung, die Weber uns nicht genügend zu berücksichtigen scheint, wie wir schon einmal angedeutet haben[1].
[1] Schon die kynische Sittlichkeit trug bereits kosmopolitischen Charakter (Kaerst, S. 87) Kyniker und Kyrenaiker stimmen, trotz der Verschiedenheit ihrer Ausgangspunkte und Ziele, darin überein, daß das denkende und sittlich handelnde wie das genießende Individuum nicht an die Schranken der einzelnen Staaten gebunden, nicht mit einem historisch gegebenen heimischen Boden verwachsen ist. Auch der neue Begriff der Freiheit ist den beiden Schulen ein analoger. Es ist nicht der Begriff eines bestimmten Anteils an einer durch den Staat verkörperten Herrschaftsgewalt, sondern der einer persönlichen Unabhängigkeit von jeder besonderen Staatsordnung (ib. 88) . . . Das Individuum bildete sich eine eigene Welt gegenüber der Welt der Polis, suchte sich zum Teil bereits eine neue Heimat in der allgemeinen Welt (no). Im Alexanderreich gehen die Entfaltung des absoluten Charakters des Regiments und die Kosmopolitisierung des Reiches Hand in Hand (492). „Der Kosmopolitismus des Diogenes, daß die wahre Politik allein die in der (allgemeinen) Welt sei, und der Alexanders, der die „Welt“ zu seinem Reiche machen wollte, sind nicht bloß zeitlich parallel, sondern stehen trotz der völligen Verschiedenheiten ihrer Erscheinungsformen in einer gewissen inneren Beziehung zueinander“: es ist der gemeinsame Gegensatz gegen die eng begrenzte Polis (ib. 500).
[553]
Antike und mittelalterliche Stadt haben in ihren Anfängen eine sehr ähnliche Entwicklung. Auch in dieser steht ursprünglich ein minderberechtigtes Plebejat dem mehrberechtigten Patriziat gegenüber, und auch hier erzwingt die Notwendigkeit, es zu Heeresdiensten heranzuziehen, allmählich die Demokratisierung der Verfassung; daneben spielte auch die Geldmacht ihre Rolle (279). Wie in Hellas und Rom „wissen sich die popolani reich, haben die großen Kriege der Stadt mit durchgekämpft, sind bewaffnet, fühlen sich aber zurückgesetzt und wollen sich die ständische Verachtung . . . nicht länger gefallen lassen.“
Dann aber schlägt die Entwicklung verschiedene Bahnen ein, und zwar lassen sich die dafür nach Webers Anschauung maßgebenden Gründe unserer Meinung nach sämtlich darauf zurückführen, daß die mittelalterliche Stadt die Sklavenwirtschaft, nicht kennt. Das allein ist der Grund, warum es hier zur starken Entwicklung der Zünfte kommt, der Genossenschaften der plebejischen Handwerker und Händler, deren Macht das Patriziat in den meisten Städten erliegt, und warum es hier zu dem Gegensatz kommen muß, der die spätere Geschichte dieser Städte entscheidet: dem zwischen Unternehmertum (Kapitalismus) und freier Arbeit, während, wie wir fanden, in der Antike ein anderer und zwar doppelter Gegensatz den Rhythmus der Entwicklung beherrscht: der zwischen stadtsässigem Patriziat und bäuerlicher Landbevölkerung einerseits, und zwischen der freien Stadtbevölkerung als einem Ganzen und der Sklavenschaft andererseits. Und damit ist gesagt, daß die mittelalterliche Stadt den Charakter als politische ZuVift nicht besitzt, der die antike Stadt kennzeichnet. Weber will diese Unterschiede mehr auf die verschiedene militärische Technik der beiden Epochen beziehen: dem gepanzerten Ritterheere sei nichts anderes gewachsen gewesen, und so hätten die Zunftheere nur eine defensive Rolle spielen und die erwerbszünftlerische Funktion der antiken Hopliten- und Legionsheere nicht ausüben können. Er sagt aber selbst, daß in der Schlacht von Courtray (1302) die Zünftler die Ritter schlugen: wären
[554]
sie, wie die antiken Stadtbürger, sozusagen im Hauptamte Krieger gewesen, so hätten sie kaum Schwierigkeiten gehabt, ihre militärische Technik zur Übermacht auszubilden: der entscheidene Gegensatz liegt eben darin, daß sie nur im Nebenamt, nur gezwungen, Krieger, im Hauptamt aber Gewerbetreibende, Nutznießer nicht des politischen, sondern des ökonomischen Mittels waren.
Weber macht dann noch darauf aufmerksam, daß die Entwicklung der mittelalterlichen Stadt im Süden, namentlich in Italien, anders verlief als im Norden. Dort war die Ritterschaft meist in der Stadt ansässig, hier auf dem Lande; hier „enthalten Stadtprivilegien die Bestimmung, daß die Stadt sich den ferneren Aufenthalt von Ministerialen oder Rittern verbitten darf“ (285). Weber sieht den Grund dieser abweichenden Entwicklung darin, daß die Entstehung der Stadt dort und hier in verschiedene Zeiten fiel. „Als die italienischen Kommunen ihren Aufstieg begannen, stand die ritterliche Militärtechnik auf ihrer Höhe. Die Stadt mußte daher Ritter in Sold nehmen oder sich mit ihnen verbünden“. Auch hier scheint uns eine sekundäre Tatsache allzusehr in den Vordergrund gerückt zu sein : wir erblicken den letzten und tiefsten Grund darin, daß die nordischen Städte sich in Landstaaten reinsten Gepräges, die südlichen aber in solchen Staaten entwickelten, in denen die Institutionen des Seestaates, namentlich die Geldwirtschaft, nie ganz verschwunden waren. Der mittelalterliche Feudalismus fand im Süden ein Städtewesen relativ hoher Entfaltung mit Geldwirtschaft usw. vor, hat es nie ganz zerstört, und darum hat sich die Ritterschaft niemals zu so reinen Landjunkern ausgebildet wie im Norden, wo sehr schwach entwickeltes Städtewesen und fast ungemischte Naturalwirtschaft dem Grundherren eine ganz andere Art des typischen Verhaltens vorschrieben als im Süden, wo er sich früh an Handel und Kreditgeschäften beteiligen konnte. Hier walten die gleichen Beweggründe vor, die wir schon als Hauptgrund der Verstädterung des antiken Grundadels kennen lernten (oben S. 394, 406).
Dem sei nun wie ihm wolle: jedenfalls ist die mittelalterliche Stadtgemeinde, ist die Gewerbsstadt der geborene Widerpart der feudalen Adelsgewalt. Sie greift den Feudalismus mit wirtschaftlichen ebensowohl wie mit politischen Waffen an; mit jenen entwindet, mit diesen entlockt sie der feudalen Herrenklasse die Macht.
Auf dem politischen Felde vollzieht sich dieser Prozeß dadurch, daß die Stadt als Zentrum eigener militärischer und finanzieller Macht in das Kräftespiel eingreift, das den entfalteten Feudalstaat bewegt : zwischen der Zentralgewalt und den örtlichen Machthabern einerseits, zwischen beiden und den Untertanen andererseits. Als Festungen und Wohnstätten kriegerischer, wohlbewaffneter und gut gedrillter Männer, als Lagerstätten der für die Kriegsführung erforderlichen Güter :
[555]
Waffen, später Geschütz und Munition, und schließlich als Zentren der Geld Wirtschaft und Finanzmacht[1], sind sie in den Kämpfen der Krongewalt mit den werdenden Landesfürsten und zwischen diesen untereinander wichtige Bundesgenossen und Stützpunkte und können bei kluger und glücklicher Politik bedeutende Rechte erwerben.
Zumeist stehen die Städte in diesen Kämpfen auf seifen der Zentralgewalt gegen die feudalen Junker: aus sozialen, politischen und wirtschaftlichen Gründen. Aus sozialen Gründen: weil der Landedelmann schon dem städtischen Patrizier und um so mehr dem Plebejer die gesellschaftliche Gleichstellung verweigert, auf die der um so viel Reichere und Gebildetere den vollen Anspruch zu haben sich bewußt ist. — Aus politischen Gründen: weil die Zentralgewalt, kraft der Solidarität zwischen Fürst und Volk, doch das Gemeininteresse viel mehr im Auge behält als der nur seinen Privatinteressen dienende Großgrundbesitzer. — Und schließlich aus wirtschaftlichen Gründen: weil die Gewerbsstadt nur bei Frieden und Sicherheit gedeihen kann. Das Faust- und Fehderecht und der Stegreif sind mit dem ökonomischen Mittel nicht vereinbar: wir haben schon gesehen, daß die Heldensage in Athen früh die Richtung gegen die Straßenräuber genommen hat — darum stehen die Städte in der Regel in Treue zu dem Friedens- und Rechtsschützer, zuerst zu dem Träger der Zentralgewalt, später zu den souveränen Landesherren; und wenn die bewaffnete Bürgerschaft ein Raubnest bricht und ausräuchert, so spiegelt sich im Tropfen nur der gleiche grundlegende Gegensatz der beiden Mittel und der von ihnen geschaffenen Institutionen wie im Weltmeer der Geschichte.
Solange die Zentralgewalt stark ist, genügt im allgemeinen der sakrale „Königsschutz“, der ursprünglich, wie wir wissen, „nur auf die örtlichkeit des Marktplatzes beschränkt war, sich aber allmählich auf die ständig mit dem Handel sich beschäftigenden Personen“[2] und, wie wir hinzufügen wollen, auf die zu den Märkten führenden Straßen übertrug. Wenn die Zentralgewalt schwächer wird, müssen die Städter oder ihre Organisation, die Städte, mit den Potentaten des betreffenden Gebietes Geleitsverträge abschließen. So in Oberitalien während des frühen Mittelalters. „Später haben hier die Bürger die Ritter, welche den Handel bedrohten, genötigt, in die Stadt zu ziehen, indem sie ihre Burgen brachen, und teilweise den Schutz der Kaufleute selbst in die Hand genommen. Die Geleitgelder waren dabei eine der Haupteinnahmen der Straßenanlieger, wie z. B. in der Schweiz“[3].
Um ihre politische Rolle mit Erfolg spielen zu können, muß die
[1] „Ermangelte es den Fürsten in dem Kampfe gegen den Adel an Geld, so sprangen die Städte bei“ (Mitscherlich, Nationalismus, S. 138).
[2] Lasch, Marktwesen, S. 779.
[3] Weber, Wirtschaftsgeschichte, S. 189.
[556]
Stadt möglichst viele Bürger heranziehen: ein Bestreben, das auch durch rein wirtschaftliche Erwägungen geboten wird. Denn nach dem Hauptgesetz der „Beschaffung“ wachsen Arbeitsteilung und Reichtum mit der Bürgerzahl[1]. Darum fördert die Stadt die Einwanderung mit allen Kräften und zeigt auch hierdurch wieder die Polarität ihres Wesensgegensatzes gegen den ländlichen Grundherrn. Denn die neuen Bürger, die sie heranzieht, entzieht sie den Feudalgütern, die sie dadurch an Steuer und Wehrkraft um ebenso viel schwächt, wie sie selbst sich stärkt. Die Stadt tritt als mächtiger Mitbieter in jene Auktion ein, in der der hörige Bauer sich an den Meistbietenden, d. h. an denjenigen versteigert, der ihm die besten Rechte bietet. Die Stadt bietet ihm die volle Freiheit[2], zuweilen auch noch wirtschaftliche Vorteile von Bedeutung, wie Steuerfreiheit auf eine Reihe von Jahren, ein Grundstück, Baumaterialien. Der Grundsatz „Stadtluft macht frei“ wird durchgekämpft, und die Zentralgewalt, die froh ist, die Städte zu stärken und den aufsässigen Adel zu schwächen, setzt gemeinhin gern ihr Siegel unter das neuentstandene Recht, wie sie ja überhaupt auf das Bündnis mit den emporsteigenden Volkskräften angewiesen ist.
Der dritte große Fortschritt der Weltgeschichte! Die Ehre der freien Arbeit ist entdeckt, oder besser wieder entdeckt; sie war verschollen seit jenen fernen Zeiten, in denen der freie Jäger und der nicht unterworfene Hackbauer den vollen Ertrag ihrer Arbeit genossen. Noch trägt der Bauer das Pariazeichen des Unfreien, und noch ist sein Recht schwach: aber in der mauerumgürteten wehrhaften Stadt trägt der Bürger das Haupt hoch, als ein Freier in jedem rechtlichen Sinne. Das Christentum hat dazu beigetragen, der Arbeit ihre lang verlorene Ehre wiederzugeben[3]. Zwar gibt es noch Rangstufen der politischen Berechtigung innerhalb der Stadtmauer. Die Alteingesessenen, die Ritterbürtigen, die Altfreien, die reichen Grundbesitzer weigern dem Zugezogenen, dem unfrei Geborenen, dem armen Handwerker und Höker das Mitregiment. Aber wie wir es soeben erfuhren, geradeso wie in der Seestadt, können sich auch hier solche Rangstufen in der Stadtluft nicht erhalten. Die intelligente, von keinem religiösen Tabu mehr gehemmte, in ihren Zunftbataillonen straff gegliederte und stoßkräftig zusammengefaßte Mehrheit erzwingt fast überall die Gleichberechtigung, mit Ausnahme nur einiger fast reiner Handelsstädte. Nur dauert der Kampf im entfalteten Feudalstaat gemeinhin länger, weil hier die Parteien ihre Sache nicht unter sich allein
[1] S. S. III, S. 306.
[2] Thierry, a. a. O. S. 14. „L'idée d'une autre liberté, conforme au droit naturel, accessible à tous, égale pour tous, à laquelle on aurait pu donner, d'après son origine, le nom de liberté romaine“.
[3] Vgl. Mitscherlich, Der Nationalismus Westeuropas, S. 80.
[557]
abzumachen haben; die großen Grundherren der Nachbarschaft, häufig mit den Patriziern versippt und verschwägert, und die Fürsten greifen hemmend in das Kräftespiel ein. Dieser tertius gaudens existierte nicht in den Seestaaten der Antike, wo außerhalb der Stadt kein mächtiges Feudalherrentum und keine über weite Gebiete gedehnte Zentralgewalt bestand. Wo eine solche im Keime bestand, wie in den athenischen Seebünden oder in der spartanischen Hegemonie oder andeutungsweise auch in den kleinasiatischen Griechenstädten, die im persischen Machtbereiche lagen, wurden die Streitigkeiten zwischen den Plebejern und Patriziern regelmäßig gleichfalls für die politischen Intrigen der Großmächte ausgenützt.
Das sind die politischen Waffen der Stadt im Kampfe gegen den Feudalstaat: Bundesgenossenschaft mit der Krone, unmittelbare Offensive und Fortlocken der Hintersassen in die freie Stadtluft.
3. Die Einflüsse der Geldwirtschaft. ↩
Nicht minder wirksam aber ist ihre ökonomische Waffe : die vom städtischen Wesen unzertrennliche Geldwirtschaft, die den Natural- und damit den Feudalstaat völlig zerstört.
Der soziologische Prozeß, den die Geldwirtschaft auslöst, ist so bekannt und in seiner Mechanik so allgemein anerkannt, daß es uns erlaubt ist, uns kurz zu fassen:
Stärkung der Zentralgewalt bis zur Allmacht und Schwächung der Lokalgewalten bis zur Ohnmacht: das ist auch hier wie in den Seestaaten die Folge der eindringenden Geldwirtschaft.
Die Herrschaft ist nicht das letzte Ziel, sondern das Mittel der Herren zu ihrem letzten eigentlichen Ziele : der gesellschaftlichen Hochgeltung[1] durch Verfügung über möglichst viele Dienste und kostbare Genußgüter und deren Genuß in der Öffentlichkeit. Im Naturalstaat ist die Herrschaft das einzige Mittel dazu: dem Markgrafen und Landesherrn gibt seine politische Macht den Reichtum, und das heißt die Verfügung über Menschen[2]. Je mehr Bauern ihm dienen und fronden, um so größer ist seine Streitmacht, um so mehr erweitert er seinen Herrschaftsbezirk und vergrößert er seine Einkünfte. Wenn aber erst ein reicher Markt die Erzeugnisse der Landwirtschaft mit verlockenden Gütern bezahlt, so ist es für jedes noch vorwiegend privatwirtschaftliche Subjekt viel rationeller, sein Geldeinkommen ad maximum zu vermehren. Und das geschieht auch regelmäßig, und zwar hängt es von der Beschaffenheit des Grundeigentums ab, in welcher Form es geschieht :
[1] S. S. I, S. 896.
[2] S. S. I, S. 1111, vgl. auch S. 286/87, ferner S. S. III, S. 80, 420.
[558]
Wo, wie im Westen Europas die Regel, das Rittereigentum weit zerstreut, und infolgedessen Eigenbetrieb unmöglich ist, wird die von dem Bauern zu zahlende Rente mehr und mehr, bis zur letzten äußersten Möglichkeit erhöht, so daß ihm kaum das Existenzminimum bleibt. Damit entsteht natürlich ein überaus gefährlicher sozialer Gegensatz zwischen Adel und Bauernschaft, den wir überall, in der Jacquerie, der Lollhardenbewegung, den deutschen Bauernkriegen, explodieren sehen.
Wo aber der Ritterbesitz zentriert, und Ausdehnung auf Kosten des Bauernlandes möglich ist, da ist der gegebene Weg zum gleichen Ziele, die Zahl der Bauern nach Möglichkeit zu vermindern, d. h. möglichst viele zu „legen“ und nur so viele übrig zu lassen, wie mit äußerster Anstrengung dem auf diese Weise vermehrten Herrenacker möglichst viel verkäufliches Produkt entreißen können, während man ihnen von eben diesem Produkt möglichst wenig zum eigenen Verzehr überläßt. Diese Situation besteht fast überall auf dem ehemaligen Slawengebiet östlich von Saale und Elbe. Hier ist, wie Knapp feststellt, in der Großgutswirtschaft der erste kapitalistische Betrieb der Neuzeit entstanden[1]; der agrarische Kapitalismus, man halte es wohl fest, ist älter als der industrielle.
Solche vorwiegend privatwirtschaftlichen Subjekte sind jetzt alle, noch nicht (ganz oder fast ganz) zum Landesfürstentum aufgestiegenen Grundherren, vor allem die kleineren, und hier wieder der Schwertadel, der Adel zweiter Stufe, die Ritterschaft. Sic führen das gewaltig vermehrte „produit net“ ihres Grundeigentums von jetzt an, und wieder ganz rationell, entsprechend ihrer neuen Lagerung, zu Markte und tauschen es gegen Geld ein. Es wird im Osten wie im Westen nicht mehr dazu verwendet, eine streitbare Garde zu unterhalten, sondern das Gefolge wird aufgelöst[2]: der Ritter ist zum Rittergutsbesitzer geworden. Er hat sich aus einem öffentlich-rechtlichen in ein privatwirtschaftliches Subjekt verwandelt; er ist nicht mehr in eine politische, sondern in eine ökonomische Kategorie einzuordnen.
In dem Maße, wie sich diese Umwälzung vollzieht, zuweilen, wie in Dänemark, mit einem einzigen Schlage, wird die Zentralgewalt (Reichskönig oder Landesherr) der Rivalen ledig, steigt mehr und mehr zur politischen Allmacht empor.
Seit Adam Smith pflegt man diese grundstürzende Umwälzung
[1] Sismondi (a. a. O. I, S. 215) sagt von dem berüchtigten „Clearing of Estates“ der Herzogin von Sutherland: „Da der Besitzer (der Marquis von Stafford, der Gemahl der Erbin) keinen Kriegsdienst von seinen Hintersassen mehr verlangte, war ihm ihre Zahl noch immer viel zu groß“.
[2] Die spanischen Granden z. B. ließen ihre Haustruppen verfallen (Röscher, a. a. O. S. 255).
[559]
derart darzustellen, daß der dumme Junker sein Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht verkauft habe, indem er die Herrschaft um törichte Luxuswaren verschacherte[1]. Nichts kann falscher sein. Der Einzelne irrt häufig in der Wahrung seiner Interessen: eine Klasse irrt niemals auf die Dauer! Es kann nur sein, daß sie sich, wie die antike Bürgerschaft, in einem „Hexenkreis“ befindet, aus dem mit den Mitteln ihrer Zeit kein Ausweg zu gewinnen ist.
Die Wahrheit ist, daß die Geldwirtschaft unmittelbar, auch ohne das Dazwischentreten der agrarischen Umwälzung, die Zentralgewalt politisch so sehr stärkt, daß aller Widerstand des Grundadels gegen den aufkommenden Absolutismus sinnlos wird. Wie schon die Geschichte des Altertums beweist, ist das Heer einer finanziell starken Zentralgewalt dem feudalen Aufgebot immer überlegen. Mit Geld kann man Bauernjungen vortrefflich bewaffnen und zu Berufssoldaten drillen, deren geschlossener Masse der lockere Verband des Ritterheeres ebensowenig gewachsen ist, wie ihre primitive Taktik des Dreinschlagens (noch dazu nach Standesregeln) der Strategie geübter Berufsgenerale widerstehen kann, die sich jetzt hier gerade so herausbilden wie in der Zeit der Söldnerheere der Antike.
Vor allem kann der Fürst in diesem Stadium in aller Regel noch auf die wehrhaften Bataillone der städtischen Zünfte rechnen. Die Feuerwaffe tat in Westeuropa das Übrige: auch sie ein Produkt, das nur in der arbeitsteiligen Wirtschaft der Gewerbsstadt entstehen konnte.
Aus diesen militärtechnischen Gründen muß selbst derjenige Feudalherr, der den Luxus nicht achtet und den dringenden Wunsch hat, seine relative Selbständigkeit zu erhalten und womöglich zu steigern, und gerade der, seinen Besitz der gleichen agrarischen Umwälzung unterwerfen: denn, um politisch stark zu sein, braucht auch er jetzt vor allem Geld, das nunmehr zu dem „nervus rerum“, der Sehne der Politik, geworden ist, um Waffen zu kaufen und Berufssoldaten samt ihren Berufsführern zu dingen. Die geldwirtschaftliche Umwälzung hat den zweiten kapitalistischen Großbetrieb erschaffen: neben die Großlandwirtschaft tritt die Großunternehmung des Krieges: die Kondottieri erscheinen wieder auf der Bühne der Geschichte. Söldnermaterial ist ja jetzt genug auf dem Markte, um Heere zusammen zu bringen : die entlassenen Feudalgardisten und die expropriierten Bauern.
Auf diese Weise kann wohl einmal ein Junker als Kondottiere noch zum Landesfürstentum empor gelangen, wie es in Italien öfters der Fall war, und wie es Albrecht Wallenstein als Herzog von Mecklenburg bereits erreicht hatte. Aber das ist individuelles Schicksal, das am
[1] Vgl. Oncken, Geschichte der Nationalökonomie I, S. 82. Vor Smith hat schon Hume den gleichen Gedanken geäußert. Vgl. List, a. a. O. S. 33.
[560]
Schlußergebnis nichts ändert, Die lokalen Mächte verschwinden als selbständige Machtzentren aus dem politischen Kräftespiel ; sie behalten nur so lange noch ein Restchen ihres ehemaligen Einflusses, wie sie dem Fürsten als Finanzquelle nötig sind: der Ständestaat.
III. Der Ständestaat.↩
Nach dem soeben Gesagten ist also der sog. „Ständestaat“ aufzufassen als ein notwendigerweise relativ kurzes Intermezzo zwischen dem entfalteten Feudalstaat und dem Absolutismus. Es ist aus zwei Gründen nicht leicht, seinen Aufbau und seine Verfassung zu schildern. Erstens stellt er ein Gebilde dar, in dem das Kräfteverhältnis der beiden Parteien, der Krone und der feudalen Lokalmächte, sich fortwährend stark und schnell nach nur einer Richtung verschiebt, derart, daß die geschriebene Ordnung der Verfassung immer nur kürzeste Zeit der wirklichen Ordnung entspricht; und zweitens hängt der letzte Ausgang sehr stark davon ab, wieweit die Entfaltung des Feudalstaates aus dem Eroberungs- und Lehensstaate schon gediehen war, als die Einflüsse der Geldwirtschaft sich durchzusetzen begannen. Es wird daher nicht mehr möglich sein, wie bisher mit einer einzigen „idealtypischen“ Darstellung auszulangen, sondern wir werden mehrere Abwandlungen des gleichen Grundtypus zu zeichnen haben.
1. Die Verfassung. ↩
Der Ausgangspunkt ist überall ein ähnlicher: der geringen Macht der Zentrale entspricht eine bedeutende Macht der Lokalgewalten, zu denen jetzt außer den Grundadligen eine Reihe von größeren und besonders bevorrechteten Städten gehören. Diese „Stände“ (ordines) besitzen faktisch und formell als Rechtsnachfolger der einstigen Volksund Heeresversammlung einen bedeutenden Teil der staatlichen Sou- veränetät, deren anderen, und im Anfang in der Regel geringeren Teil der Träger der Zentralgewalt inne hat. Jellinek sagt geradezu, daß die Geschichte der mittelalterlichen Staaten zugleich eine Geschichte der Versuche ist, diese Zersplitterung zu überwinden, und daß die Form, in der diese Versuche sich vollziehen, die des ständischen Staates ist. „Zurückweisend auf die altgermanische Institution, daß wichtige, die ganze Volksgemeinde betreffende Angelegenheiten nicht ohne Zustimmung des Volksheeres vorgenommen werden sollen, faßt der ständische Staat die verschiedenen politischen Untergewalten zu einer Einheit zusammen, die dem König- oder Fürstentum geschlossen gegenübertritt. Der ständische Staat ist der typische Ausdruck der dualistischen Gestaltung des germanischen Staatswesens[1]. . . . Die
[1] Jellinek, Allg. Staatslehre, S. 320/1. J. fügt hinzu, daß dort, wo „kraft der historischen Kontinuität romanistische Gedanken lebendig geblieben sind, wie vor allem in Italien und im byzantinischen Reiche, es niemals zu ständischen Institutionen gekommen sei“. Wir möchten unsererseits ergänzend hinzufügen, daß hier die Geldwirtschaft und daher die Zentralisation nie so völlig gefehlt hat, wie in den nordeuropäischen Feudalstaaten, und daß wohl hauptsächlich aus diesem Grunde die Gedanken des römischen Staatsrechts lebendig bleiben konnten.
[561]
Stände stehen überall als selbständige Körperschaften dem Könige oder Landesherren gegenüber. Daß sie und der Fürst beide nur Glieder eines und desselben einheitlich zu denkenden Staates sind, das wird zwar in der, auf antiken Traditionen beruhenden, dem wirklichen Leben indes abgewandten Theorie behauptet, hat aber in den politischen Überzeugungen keine Stätte. In ihnen treten vielmehr rex und regnum als zwei scharf voneinander geschiedene Rechtssubjekte hervor, von denen keines die Superiorität des anderen anerkennen will. Wie ein Doppelstaat erscheint unserem heutigen Denken der ständische Staat in seiner extremsten Ausbildung, in der Fürsten und Stände ihre besonderen Gerichte, Beamten, Kassen, ja selbst Heere und Gesandten haben“[1].
Auch Treitschke, dem natürlich dieser zerfahrene und machtlose Staat im tiefsten unsympathisch ist, hebt den Dualismus der Staatsgewalt hervor: „In dieser ständischen Monarchie gibt es gar kein öffentliches Recht mehr; jeder Stand hat seine besonderen „habenden Freiheiten“, die zu verteidigen seine Lebensaufgabe ist. Man sucht die Freiheit vom Staate, man betrachtet den Staat als den natürlichen Feind der Freiheit des Einzelnen, den man im Käfig zu halten hat, dem man keinen Schritt über die vereinbarten Grenzen hinaus gestatten darf. Die Untertanen fühlen sich nicht als Untertanen, sondern als Kontrahenten. Das zeigt besonders die Form der Huldigungen. Der neue Herr muß einen Freiheitsbrief beschwören, eine joyeuse entrée, und jeder Thronwechsel wird womöglich benutzt, die Freiheitsrechte zu erweitern. Die deutschen Reichsstände übten in den Wahlkapitulationen dies Recht im großen Stil. Auf solche Freiheitsrechte wird geschworen, und die Verpflichtung des Schwörenden reicht nicht weiter, als Brief und Siegel reichen. Die Vorstellung einer ipso jure bestehenden allgemeinen Untertanenpflicht ist nicht vorhanden. Damit hängt zusammen das Recht des Widerstandes, welches förmlich verbürgt oder tatsächlich von den Ständen ausgeübt wird. Die aragonischen Stände schwören ihrem König: Wenn du dieses Feuros hältst, werden wir gehorchen, wenn nicht, nicht. In Deutschland finden wir verbürgtes
[1] Jellinek, a. a. O. S. 320. Vgl. a. S. 571, 696ff. Über die doppelte Staatskasse vgl. Röscher, a.a.O. S. 231. —„Landesherr und Land wurden zu zwei nebeneinanderstehenden Trägern staatlichen Rechtes, die in ihrer Vereinigung den deutschen Staat darstellen, wie er aus dem Abschluß des Mittelalters hervorging“ (Gierke, zit. nach v. Below, a. a. O. S. 35).
[562]
Widerstandsrecht in verschiedenen kleineren Staaten, in Bayern z. B. und Lüneburg“[1].
Auch Spangenberg bezeichnet als das Charakteristikum des Ständestaates den Dualismus der Gewalten[2].
„Im Jahre 1619 stellten die Stände des Herzogtums Österreich fest, daß das Herzogtum mit ,Regalien also versehen sei, daß es solche zum Teil für sich Selbsten hat, zum Teil mit dem Landesfürsten und reciproce, zum Teil hat der Landesfürst seine Regalia für sich Selbsten, zum Teil communia mit dem Landt'. Einfacher und anschaulicher läßt sich die Charakteristik des ständischen Staates nicht geben, in dem, wie Gierke sagt, Landesherr und Landstände einander gegenüberstehen ,als zwei noch nicht zu einer höheren und organischen Einheit verbundene, voneinander relativ unabhängige und selbständige Träger staatlichen Rechtes und staatlicher Macht'. In diesem Dualismus liegt . . . das eigentliche Wesen des ständischen Staates. Alle anderen Eigenschaften bilden keine ihm ausschließlich zukommenden Charakteristika : weder der Repräsentativcharakter der Stände, noch ihre unbedingten Vollmachten und das Mehrheitsprinzip, weder die Periodizität ihres Zusammentretens noch die Prekarietät ihrer Rechtsstellung, nicht einmal die ständische Basis ihrer Zusammensetzung“[3]. Dieser Dualismus hat die verfassungsrechtliche Grundlage für die Staatslehre des Althusius gebildet, für „ein vollständiges rechtliches Bild der Verfassung der ständischen Monarchie“[4]. Es handelt sich also, wie etwas später Keckermann richtig sah, „um eine Unterart der — selbst wieder eine Unterart der respublica imperfecta bildenden — gemischten Staatsform (respublica mixta), nämlich das Temperatum Monarchiae cum Aristocratia. . . . Das Wesen des ständischen Staates sieht er darin, daß dieser Status aus zwei Teilen besteht, der eine ist der Fürst, den anderen bilden die Stände“[5].
[1] Politik II, S. 81. Vgl. schon Frantz (Naturlehre, S. 268): „In unserem Sachsenspiegel steht es selbst als ein ausdrückliches Recht, daß der König abgesetzt und gerichtet werden kann. Allbekannt ist das Recht der alten Stände von Arragonien, ihrem Könige den Gehorsam aufzukündigen, wenn er die Verfassung verletzen sollte, tatsächlich aber galt Ähnliches in allen altständischen Verfassungen. Oft selbst ausdrücklich anerkannt, wie z. B. auch in dem ehemaligen Herzogtum Pommern, was heute fast unglaublich klingen möchte, wenn es nicht urkundlich verbürgt wäre. Von einem unbedingten Gehorsam wußte man nirgends, noch weniger von der knechtischen Unterwürfigkeit gegen Könige und Fürsten, wie sie seit dem 17. Jahrhundert aufkam. Das war die politische Denkweise des finsteren Mittelalters“.
[2] Vom Lehnsstaat zum Ständestaat, S. 36. Die Theorie sei „heute fast allgemein anerkannt“ (Anm. daselbst).
[3] Wolzendorff, a. a. O. S. 165. Vgl. S. 167.
[4] Ib. S. 211. Die Stände „stellen nach den Begriffen unserer Zeit einen Staat im Staate dar“ (Jellinek, a. a. O. S. 696/7).
[5] A. a. O. S. 237.
[563]
Der Kern der ständischen Rechte ist das Recht der Steuerbewilligung, eine Hinterlassenschaft aus der Zeit, wo der spätere Landesherr noch etwa wie ein Primus inter Pares unter den anderen Gewaltigen stand, nur ausgezeichnet durch die Verfügung über einen ehemals staatlichen Gerichtsbezirk[1]. Damals mußten Umlagen für besondere Zwecke von den Insassen des Bezirks eigens bewilligt werden. „Der in dem Steuerbewilligungsrecht der Landstände liegende Angelpunkt der landständischen Macht ist ihr Ausgang. Sobald die Landstände den Fürsten in der Erhebung von Steuern von sich abhängig gemacht haben, nutzen sie diese Macht aus, einerseits um sie rechtlich zu fixieren, andererseits um sich weitere Zugeständnisse machen zu lassen. Um sich diese unter keinen Umständen entreißen zu lassen, verpflichten sie sich gegenseitig, sich gegen Eingriffe des Landesherrn zu verteidigen und lassen sich von jenem ausdrücklich die Berechtigung dieser gegenseitigen Hilfe anerkennen“[2]. Hier wurzelt vor allem das „Widerstandsrecht“, von dem wir in dem Kapitel von den Theorien ausreichend gehandelt haben: hier ist das alte ungeschriebene Volks- oder Naturrecht (im nichttechnischen Sinne) zu geschriebenem und gelebtem positivem Recht geworden.
Es sind außer diesem wichtigsten aller Rechte, dem auf Steuerbewilligung, nur wenige, eng damit zusammenhängende Rechtssätze, die die Verfassung dieses dualistischen Staatswesens bilden: einige Rechte auf Kontrolle der landesherrlichen Verwaltung (Einfluß der Stände auf die Zusammensetzung des fürstlichen Rates, Verbot, Fremde mit öffentlichen Ämtern zu betrauen), Garantien für Rechtsschutz, gegen Mißbrauch der fürstlichen Münzgewalt, Verbot der Veräußerung oder Verpfändung von Landesteilen (durch die der Fürst sich Geld ohne Bewilligung der Stände beschaffen könnte) und schließlich das Verbot, ohne Zustimmung der Stände einen Krieg zu beginnen[3].
Mit diesen Rechten ausgestattet, sind die Stände zwar nicht im mindesten eine Repräsentativvertretung des ganzen Volkes im modernen Sinne, sondern ausgesprochenermaßen und streng rechtlich nur die Vertreter ihrer eigenen Interessen. Dennoch fühlen sie sich in gewissem Sinne als Vertreter auch ihrer Hintersassen und somit des ganzen Volkes[4] gegenüber Ausschreitungen der fürstlichen Macht und lassen sich in manchen Verfassungen diese Vertretungsbefugnis ausdrücklich bestätigen[5]. Man wird auch annehmen dürfen, daß bei dem Wider -
[1] „Noch in der ersten Hälfte des 13. Jahrh. hatten die Fürsten auf Landesversammlungen (Landdingen, placita) mit dem Lehnsadel und der hohen Geistlichkeit die Regierung geführt“ (Spangenberg, a. a. O. S. 37/8; vgl. S. 7/8).
[2] A. a. O. S. 53.
[3] A. a. O. S. 61. Vgl. Jellinek, a. a. O. S. 696ff.
[4] Spangenberg, a. a. O. S. 76, 114.
[5] A. a. O. S. 74. Vgl. Jellinek, a. a. O. S. 698.
[564]
streit der Interessen zwischen dem Adel einerseits und den Städten andererseits, und innerhalb des Adels zwischen den großen und den kleinen Lehnsträgern, die ständische Politik häufig das Gesamtinteresse gewahrt haben wird, wie ja auch überhaupt ein Teil der Rechte auf Kontrolle und Beschränkung der Fürstenmacht, z. B. das Verbot der Münzverschlechterung und der einseitigen Kriegserklärung, auch der Veräußerung oder Verpfändung von Landesteilen, geradezu vom Staatsoder Gemeininteresse geboten waren. So hat denn auch Calvin in der berühmten Stelle der Institutio religionis christianae die Stände als die Vertreter des allgemeinen Volksinteresses bezeichnet[1]. Das war die positiv-rechtliche Grundlage der monarchomachischen Lehre.
Für den Übergang vom Lehns- und Feudalstaat zum Ständestaat ist typisch der Wandel in der Form der Absetzung zweier englischer Könige. Die Edwards II. im Jahre 1327 wurde in der alten lehnsrecht- lichen Form der Aufkündigung lehnsrechtlicher Treue durch die Vasallen vorgenommen, die Richards II. aber im Jahre 1399 vollzieht sich jetzt, da der Ständestaat vollständig ausgebildet ist, in ständischer Form durch Annahme der Verzichtsurkunde seitens des Parlaments. Genau so haben auch in den kontinentalen Staaten die Rechtsverhältnisse ihre Gestalt verändert[2].
Der Gegensatz zwischen Lehns- und Ständestaat zeigt sich weiter in der Wandlung, welche das Verhältnis des Vasallen zum Lehnsheiren erfuhr. „Das Wesen des Vasallen ist die Pflicht gegenüber dem Herrn, ihn in seinen staatlichen Aufgaben zu unterstützen. Das Wesen des Standes aber ist sein Anspruch gegenüber dem Landesherrn, an seinen staatlichen Rechten teilzunehmen, mitzuwirken an der Leitung des Staates“[3].
2. Die Ausgänge. ↩
Das ist überall, im Osten wie im Westen, die ungefähre Rechtslage. Zu welchem Ausgang sie sich entwickelt, das hängt, wie gesagt, vorwiegend ab von der Entwicklung des Feudalstaates in dem Augenblick, in dem die Geldwirtschaft stark einzuwirken begann. Wo das Feudalsystem bereits zu seiner vollen hierarchischen Ausbildung gelangt war, wie im kontinentalen Westeuropa überall, gelangen die Magnaten eine Zeitlang zu überwältigender Macht, und sinkt das Königtum, resp. in Deutschland das Kaisertum, zu beträchtlicher, zuweilen vollkommener Ohnmacht herab. Hier sind zwei Ausgänge möglich. Der eine ist der, daß die Magnaten es erreichen, die Zentrale politisch vollkommen zu enteignen: dann entsteht das staatsrechtliche
[1] A. a. O. S. 95/96. Vgl. Jellinek, a. a. O. S. 571.
[2] A. a. O. S. 47 nach Hatschek (Englische Verfassungsgeschichte).
[3] A. a. O. S. 49.
[565]
„Monstrum“, wie Pufendorf es nannte, eines „Reichs“, d. h. ein Haufwerk souveräner Einzelstaaten, die nur noch formell und in einzelnen Beziehungen, etwa der Rechtsprechung, durch eine Scheingewalt zusammengehalten werden. Oder die Zentralgewalt erlangt dennoch unter günstigen Umständen die absolute Herrschaft: das war der Fall in Spanien[1], in Frankreich und z. B. in Dänemark.
Wo aber infolge besonderer Konstellation das Lehenssystem nicht zu seiner vollen Ausbildung als Feudalsystem gelangt war, ist der Ausgang wieder verschieden je nach den Umständen, die diese Entwicklung verhinderten.
Der eine typische, ja in Europa einzige, Fall ist England. Hier hatte, wie wir schon einmal vordeutend bemerkten, William der Eroberer seinen Lehensstaat weislich, durch eigene Erfahrungen gewitzigt, so eingerichtet, daß die Entwicklung zum Feudalsystem mindestens außerordentlich gehemmt war. Wir werden sofort zeigen, daß daneben die eigentümliche, auf seiner insularen Lage beruhende Struktur des Staates es wirksam verhinderte, daß die immerhin auch hier starke Tendenz zum entfalteten Feudalstaat sich durchsetzen konnte.
Für den zweiten Fall typisch ist Polen. Hier setzt die Geldwirtschaft ein, bevor noch die Staffelung des Lehensstaates zum Feudalstaat weit vorschreiten konnte. Hier fehlt infolgedessen die oben bereits als bedeutsam hervorgehobene Konkurrenz mehrerer Machthaber um den gleichen Bauern, die sich gegenseitig daran verhindern, ihn sozusagen mit Haut und Haar zu fressen[2]. Hier und ebenso in den übrigen „Adelsrepubliken“ des ostelbischen Europa sind gemeinhin Grundherr, Gerichtsherr, Obermärker und Vogt (wo von diesen beiden letzten Titeln überhaupt die Rede sein kann) in Personalunion vereinigt. Hier gewinnt das privatwirtschaftliche Subjekt in dem Magnaten die Oberhand über das öffentlich-rechtliche, der Großgrundbesitzer über den werdenden Landesherrn. So kommt es hier zwar gleichfalls zu einer Obmacht der Stände über die Zentralgewalt, die hier aus den gleichen Gründen nicht die Möglichkeit hat, sich auf die Bürgerschaft starker Städte zu stützen: aber es kommt doch nicht zu der Ausbildung eines geschlossenen starken Landesfürstentums. Sondern diese Staaten zerfallen in vollkommener Anarchie und werden die Beute eines fremden Machthabers, sei es nun der eigene, im Ausland regierende König, wie in Ostholstein, oder ein fremder Potentat oder eine Gruppe von solchen: das erste Schicksal traf Schwedisch-Pommern, das von Brandenburg erobert wurde, das zweite Polen, das der Koalition der drei östlichen Großmächte zum Opfer fiel. So kommt es auch hier zuletzt zum Absolutismus.
[1] Vgl. Mitscherlich, a. a. O. S. 136. Hier war es der Kampf der Städte mit den Granden (1520—-1524), der beide schwächte und den Absolutismus auslieferte.
[2] Vgl. Max Weber, Wirtsch.Gesch., S. 41.
[566]
Wir wollen, um das Bild lebendiger zu gestalten, diese verschiedenen Typen in ihren Hauptvertretern kurz darstellen.
a) England.
Wir beginnen mit England. Das Land ist durch seine insulare Lage von allen größeren Staaten des nördlichen Europa als das einzige geradezu dazu bestimmt, sich mit seestaatlichen Errungenschaften zu befruchten. Brodnitz schreibt, daß das Prinzip der naturalwirtschaftlichen Bedarfsdeckung in England früher und stärker durchbrochen wurde als in der kontinentalen Grundherrschaft. Sehr früh werden ganz regelmäßig die benachbarten Märkte mit Getreide usw. beschickt[1]. Schon in angelsächsischer Zeit unterstehen Maß und Gewicht dem Gesetz nach der königlichen Aufsicht. Der normannische Staat macht Ernst damit, wenn er es auch nicht sofort durchsetzen kann. Die Londoner Maße und Gewichte, die von alters her den Vorrang vor den anderen lokalen Maßen hatten, wurden schon sehr früh (1197) als Landesmaß proklamiert und später in der Magna charta noch einmal als Reichsmaße eingeführt (122). Nach der Eroberung entstanden, namentlich im 12. Jahrhundert, viele neue Städte, die der Zufuhr bedurften: in dieser Zeit entstanden die großen englischen Messen. Im 13. Jahrhundert sind rund 3300 Märkte, im folgenden 1560, und bis 1482 weitere hundert Märkte privilegiert worden. [Esbedurf te immer der besonderen Verleihung durch den König und in Mediatstädten durch den Grundherrn (168)].
Diese reiche Entwicklung hängt damit zusammen, daß die bedeutenderen englischen Städte fast ausnahmslos zur See oder auf den damals noch schiffbaren Flüssen[2], erreichbar sind, und das wieder hat, wie in den antiken Seestaaten, eine schnelle Entwicklung der Geldwirtschaft und die mit ihr verbundene modern-kapitalistische Auflockerung der Grundbesitzverhältnisse zur Folge. Schon Heinrich II. untergräbt die militärische Macht der Magnaten, indem er ihnen gestattet, an Stelle der Heerespflicht Geldabgaben zu leisten: während er durch die Schildgelder (Scutagia) und die mit ihnen geworbenen Söldner seine eigene Stellung sichert, mindert er die Gefahr, die ihm aus einem widerspenstigen Feudalaufgebot drohen konnte (49).
Die Gefahr war an und für sich nicht so groß wie auf dem Kontinent. Der vorwiegende Charakter dieses von Wikingen gegründeten Staates als Seestaat zeigte sich schon in der angelsächsischen Zeit. Wir entnehmen einer Studie von Piercquin[3] die folgenden Daten:
1x) Englische Wirtschaftsgeschichte I, S. 44 ff. Die folgenden Ziffern in () eben - falls aus diesem Werke.
[2] Brodnitz, a. a. O. S. 57. Auch die Römerstraßen waren bis ins 13./14. Jahrb. in gutem Zustande.
[3] Les institutions et coutumes des Anglo-Saxons, Paris 1913.
[567]
Das Grundeigentum war der wichtigste, fast der einzige Faktor. Die Geburt allein gab kein erbliches politisches Recht : nur der Grundadel allein rechnet. Und zwar ist dieser Adel jedermann zugänglich. „Durch Gottes Gnade kann ein Thrael aus der Knechtschaft zum Thegn (Than) emporsteigen; ein Ceorl kann Eorl werden, gerade wie ein Sänger Priester, und ein bocere (Schreiber, écrivain) Bischof werden kann“.
Unter Ethelstan wird ein Ceorl, der fünf Hufen Landes, einen Giebel (pignon) und eine Küche besitzt und im Hause des Königs ein Amt bekleidet, von Rechts wegen Thegn; ein Thegn wird lediglich dadurch, daß sein Grundbesitz sich vergrößert, zum Eorl, und ein Kaufmann, der mit eigener Ladung drei Seefahrten gemacht hat, kann Thegn werden[1]. Alle politischen Rechte hangen nur von dem Grundbesitz ab: wer nicht ein bestimmtes Minimum besitzt, hat kein Recht zur Teilnahme an dem witena-gemot (Versammlung der Weisen). Ein Ceorl, der kein Grundeigen mehr besitzt, hat seinen Adel verloren, wenn er auch Helm, Harnisch und das Schwert mit dem goldenen Griff behält.
Wir erkennen deutlich, daß Handel, Piraterie und Geldwirtschaft hier weithin die gleichen sozialen und politischen Wirkungen ausgeübt haben, die uns bereits aus der Geschichte der antiken Seestaaten bekannt sind. Diese politische und juristische Organisation fand die normannische Eroberung vor, und mehr als das: ihre sozial-ökonomische Grundlage. Auf ihr baute William der Eroberer zielbewußt auf und konnte das um so leichter, als in seiner eigenen Normandie, bei ähnlich günstiger Lage zum Handel und ähnlicher Entstehung des Staatswesens aus einer Eroberung durch Wikinge, die Verhältnisse ganz ähnlich lagen; auch sie war schon sehr stark nach der seestaatlichen Seite hin entwickelt. Wir wissen z. B„ daß die normandischen Klöster schon im 10. Jahrhundert in recht großem Stil das Kreditgeschäft, namentlich in der älteren, später vom Papst Alexander III. verbotenen Gestalt des Mort-Gage betrieben, bei dem das Grundstück bis zur Rückzahlung der Schuld, die innerhalb dreißig Jahren erfolgen konnte, in den Händen des Gläubigers verblieb[2]. Nach Brodnitz (235) stand die Normandie schon im 10. Jahrhundert in lebhaftem Verkehr mit England und Norwegen und galt schon im 11. für ein reiches Land. Dieser wirtschaftlichen Entwicklung entsprach die politische. Hier hatte, im
[1] „In angelsächsischer Zeit verschafften drei Mittelmeerfahrten das Thanen- recht“ (Brodnitz, a. a. O. S. 385). Von der späteren Zeit heißt es: „Nicht auf Herkunft oder Beruf kommt es an, sondern nur auf den Besitz, den ja jeder erwerben kann, auch jeder Handwerker. Ist er erfolgreich, so wird er sicher in den Kreis der merkantilen Oligarchie aufgenommen werden“ (475).
[2] R. Génestal, Rôle des Monastères comme établissements de crédit, étudié en Normandie du XI. à la fin du XlIIme siècle, Paris 1901.
[568]
Gegensatz zu dem übrigen Frankreich, „der Herzog seine zentrale Stellung nicht nur formell behauptet, sondern er hatte auch jede materielle Schwächung seiner Stellung dadurch verhindert, daß er die wenigen großen, zusammenhängenden Herrschaften, die in seinem Gebiete entstanden waren, für immer der herzoglichen Familie vorbehielt“[1]. Dieser Politik folgte auch William. Unter seinen sächsischen Vorgängern war man mit dem Krongut durch Verlehnung recht unvorsichtig umgegangen, so daß der König im Vergleich zu den Earls nicht übermäßig reich und mächtig dastand. William erkennt keine selbständigen Herzöge unter sich an, läßt keinen konkurrierenden Großgrundbesitz aufkommen. Und so läßt auch später die Krone sich die Macht der Dynasten nicht über den Kopf wachsen und hat die Bildung großer zusammenhängender Güterkomplexe zu verhindern gewußt (15/6).
Bevor wir diese Politik der Lehensverteilung schildern, ist noch eines anderen Einflusses zu gedenken, der in gleicher Richtung auf die Organisation des normannischen Staates in England wirkte. Die englischen Herrscher standen in naher verwandtschaftlicher Beziehung zu den Herrschern des ersten halbwegs modern eingerichteten Staates Europas, auch eines „Seestaates“: Siziliens. Brodnitz hält es im Anschluß an Haskins nicht für unmöglich, daß byzantinisch-sarazenische Einrichtungen Siziliens[2] Einfluß auf die englische Entwicklung gehabt haben (4, Anm. 2). „Die gleichen Erfolge wie unter Eduard I. in England sind in Sizilien gegenüber der Feudalgerichtsbarkeit bereits unter Wilhelm I. und II. erreicht worden“ (nach Niese, S. 54). „Eine direkte Einwirkung muhammedanischer Tradition auch auf den englischen Exchequer ist dadurch nahegelegt, daß unter Heinrich II. in dieser Behörde dem Magister Thomas Brown eine besondere Vertrauensstellung eingeräumt wurde, der vorher Mitglied des sizilischen Diwan gewesen war“ (295, Anm. [6]. „Ganz unzweifelhaft aber erscheint es, daß Eduard I. bei seinem Kampfe gegen das Feudalrecht von den Vorgängen gelernt hatte, die er in Sizilien schon in ihren Erfolgen beobachten konnte. Durch die Gesetzgebung von 1278—90 hat Eduard die Neuerwerbung feudaler Rechte unmöglich gemacht, hat eine Erweiterung des Feudalnexus durch Afterbelehnung ausgeschlossen und das Land, die Basis der Feudalität, kommerzialisiert“ (311).
In dieser Beziehung hatte, wie schon gesagt, William kräftig vorgearbeitet. Er gab seinen Gefolgsleuten den versprochenen, ungeheuren Grundbesitz : aber er hütete sich wohl, ihn ihnen an der gleichen Stelle zu geben. Die Güter jedes Magnaten waren über das ganze Land ver-
[1] Brodnitz, a. a. O. S. 14.
[2] Gleichen Einfluß vermutet Spangenberg (a. a. O. S. 22) auf die deutschen Landesherren, die Friedrich II. mehrfach nach Italien entbot.
[569]
teilt[1]. Man durfte wohl mehrere Manors zu einer Herrschaft (Honor) zusammenfassen und hier fürstlichen Prunk treiben, aber eine wirkliche Konsolidation der Besitzungen machte die Krone durch ein strenges, oft mit geschmälerter Rückgabe verbundenes Rückfallsrecht unmöglich[2] (16).
„England kennt keine Lehnshöfe im französischen Stile, keine Dynasten deutscher Art“ (Brodnitz S. 16/7). „Anders als auf dem Kontinent verhinderte der König es, daß das Gericht des Grundherrn zu einer cour de baronie französischer Art wurde. Erleichtert wurde diese Schwächung der grundherrlichen Jurisdiktion durch die zerstreute Lage der einzelnen Güter; jede Klage über Rechtsverweigerung oder über ungehörige Besetzung des Gerichts — beides Dinge, die auf abgelegenen Gütern nicht ungewöhnlich — brachten die Sache ohne weiteres an das königliche Gericht“ (24). Der Übergang der Rechtsprechung in die Hände von gelehrten Juristen unterstützte diese Bewegung, und die Könige verliehen bei Neubelehnungen die Gerichtsbarkeit nur in immer beschränkterem Maße (24/5). Wenn wir uns daran erinnern, welche Rolle die Verleihung der staatlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland für die Ausbildung des Landesfürstentums gespielt hat, werden wir die Bedeutung dieser Tatsache zu würdigen wissen. Simmel[3] glaubt, daß diese für einen mittelalterlichen Staat unerhörte Gerichtsgewalt der Könige darin wurzelt, daß ursprünglich Sachsen und Normannen verschiedenes Volksrecht hatten, so daß der König sich durch die Einheitlichkeit seines Interesses zwischen beide schieben und beide Rechte annullieren konnte. Hier erblickt er den Stützpunkt des Absolutismus, der denn auch stetig gesunken sei, sobald die beiden Nationalitäten wirklich zu einer einzigen verschmolzen.
Diese Einheit der Gerichtsgewalt war nicht nur die Folge der von Anfang an bestehenden Zentralisation des Staates zur Einheit, sondern auch eine mächtige Ursache dafür, daß diese Einheit auf die Dauer erhalten blieb, während umgekehrt in Deutschland die Zersplitterung der Gerichtsgewalt aus dem Mangel der Zentralisation folgte und dann wieder als schweres Hindernis ihrer Herstellung im Wege stand. Auch für Endand gilt, was Stintzing[4] von Rom sagt: „Auch die römische
[1] Vgl. Jellinek, a. a. O. S. 700. Vgl. Röscher (a. a. O. S. 72): die mächtigsten Vasallen waren in 17, 19, 20, 21 verschiedenen Shires angesessen.
[2] Lacombe geht so weit, zu sagen, daß diese Besitzungen keine Lehen waren. „Der König behält sich die militärische Macht vor, seine Barone sind seine subordinierten Militärs, er hat einen Sherif in allen Grafschaften, die Justiz ist zentralisiert, die Untertanen! der Barone haben den Treueid dem Könige zu leisten, die Barone haben die Steuer zu befahlen, es ist ihnen untersagt, untereinander Fehden zu führen“. Politisch gesehen, hat er Recht, daß das keine Lehen im kontinentalen Sinne waren (a. a. O. S. 347).
[3] Soziologie, S. 117.
[4] A. a. O. I, S. 41.
[570]
Nation mit ihrer eigentümlichen Begabung zur Rechtsbildung würde es darin zur Vollendung nicht gebracht haben, wenn dieselbe nicht von vornherein zur Einheit zusammengefaßt worden wäre. Rom war und blieb der Mittelpunkt, in welchem sich die rechtsbildende Kraft konzentrierte; hier gelangte zum Ausdruck, was im weiten Leben des Staats und der ganzen Nation als Bedürfnis oder Überzeugung sich regte. Die Kraft der ganzen Nation wirkte zusammen und ward in einen Brennpunkt gesammelt, während der deutsche Geist sich in bunter Mannigfaltigkeit zersplitterte“.
Die Einheit der Gerichtsgewalt ist aber auch eine mächtige Wurzel der englischen Bürgerfreiheit gewesen, wie Lacombe hervorhebt[1]. „Die Barone sind untereinander in einer vernünftigen Weise gleichgestellt ; es gibt hier nicht die französische Feudalität, die ebenso mächtige Lehensträger wie den König selbst zählt, ferner kleine Landesherren, kleine Seigneurs, Landjunker usw. Ein Zustand, der durchaus einer Verständigung ungünstig war, namentlich weil die ganz großen Herren da waren. Im Gegensatz dazu sind die englischen Barone nicht nur in vernunftgemäßer Weise gleich, sie sind sich auch Nachbarn, die untereinander häufige Beziehungen pflegen. . . . Zwischen den Mitgliedern dieser Klasse ist ein Einvernehmen nicht schwierig herzustellen, um so mehr, weil keiner von ihnen stark genug ist, wie es in Frankreich der Fall ist, um die Hoffnung zu haben, daß er allein wirksam Widerstand leisten könnte. Man unterdrückt sie in Wirklichkeit, sie verbünden sich und empören sich. Sie sind die erste sichere Erscheinung der englischen Freiheit. Sie setzen mich nicht in Erstaunen. Ich kann nicht einsehen, daß die Intervention eines besonderen Rassengenies dazu erforderlich gewesen sei“.
Wir möchten bei dieser Gelegenheit daran erinnern, daß auch die kontinentale Bürgerfreiheit den Adelsgenossenschaften viel verdankt: „Wenn unsere modernen Gesetzgebungen nicht dulden, daß der Polizeidiener ohne weiteres den Frieden des Privathauses brechen, wenn er ohne richterlichen Befehl Verhaftungen nicht vornehmen darf, so besagt dies nichts anderes, als daß der Burgfrieden zu dem allgemeinen Frieden des Hauses erweitert werden soll, wie sich die Burg als sozialer Begriff erweitert hat zu Stadt und Dorf. Es gibt wenig liberale politische Grundsätze, die nicht aristokratischen Ursprungs wären“[2]. Nicht umsonst lautet der englische Grundsatz: „My house is my castle“. Es hat denn auch der absolute Staat (Karl V. in seiner Wahlkapitulation) die Bündnisse der Reichsritterschaft auf gleiche Stufe der Staatsgefährlichkeit gestellt mit den Geheimbünden der unzufriedenen Bauern (ib. S. 156). Und Riehl meint (138), daß auch der Verfolgung
[1] A. a. O. S. 348.
[2] Riehl, Die bürgerliche Gesellschaft, S. 152.
[571]
der Tempelherren neben anderen Motiven „die dunkle Ahnung von der Gefährlichkeit einer Adelsgenossenschaft zugrunde gelegen habe“. Man machte ihnen unter anderem auch den Vorwurf, die Herstellung einer allgemeinen europäischen Adelsrepublik beabsichtigt zu haben.
Um nach dieser Abschweifung zu der Ordnung des englischen Staates zurückzukehren, so führten Williams Nachfolger seine kluge Politik weiter. Von der Ablösung der Heerespflicht durch Geld haben wir schon gesprochen. Eduard I. gestattet durch das Statut „Quia Emptores“ von 1290 den unbeschränkten Verkauf jeglichen Landes, wofern nur der Erwerber alle auf dem Grundstück ruhenden Lasten auf seine Person übernimmt. „Darin lag ein überaus geschickter Schachzug des Königs. Er machte damit ein für alle Male dem weiteren Ausbau des Lehnswesens ein Ende. Es ist nun nicht mehr möglich, den feudalen Personalzusammenhang durch Weiterbelehnung und Einführung neuer Glieder noch komplizierter zu gestalten. Statt dessen wird das Land kommerzialisiert, es wird eine Ware mit freier Veräußerlichkeit, bei der der Erwerber nur die darauf ruhenden Lasten mitzuübernehmen hat. Damit ergreift der Kapitalismus das Land, die eigentliche Basis des Feudalstaates“ (55)[1]. Die Käufer sind die vorwärtsstrebenden modernen Elemente; auch der nicht Ritterbürtige kann jederzeit Ritterland erwerben (59). Dieses Land wird aber von vornherein zum Zwecke des Marktproduktion erworben.
So greift denn die Geldwirtschaft schnell um sich. Seit Heinrich II. ist die Münzautorität des Herrschers gegenüber den Baronen und Städten wie später auch gegenüber dem Parlament endgültig festgelegt (125). Während in Deutschland unter der Einwirkung der Münzverschlechterung durch die aufkommenden Landesherrn das wohlgeordnete Münzwesen der Karolingerzeit von 1150 an verfällt, bessern sich in England die Verhältnisse in dieser Zeit, so daß die steigende Verkehrswirtschaft sich auf ein verhältnismäßig geordnetes Münzwesen stützen kann.
Diesem ausgesprochen seestaatlichen Zuge entsprechen auch andere. Schon unter Wilhelm dem Eroberer bestand eine im übrigen Europa nicht vorhandene große Sicherheit der Straßen (234). Die feudalen Lasten werden eine nach der anderen durch Geldsteuern abgelöst; dem Schildgeld für die Heeresverpflichtung folgen Geldabgaben für die von dem Vasallen dem Lehnsherrn geschuldete „Gastung“ (193). Seit Mitte des 13. Jahrhunderts gibt es bereits Steuern auf das bewegliche Vermögen (200).
Die geldwirtschaftliche Tradition hatte der Eroberer bereits aus der Normandie mitgebracht. So verfügte er schon über eine gut geordnete
[1] Wir weisen auch hier wieder mit allem Nachdruck auf die Tatsache hin, daß überall in der Neuzeit der agrarische Kapitalismus vor dem industriellen auf der Bühne erscheint.
[572]
Finanzverwaltung (211). Die Eroberung stärkte die Geldwirtschaft, da die Feudalität die nötigen Gelder für die Rüstung durch die Mobilisierung ihres Grundbesitzes aufbringen mußte: eine Bewegung, die im übrigen Europa erst ein Jahrhundert später mit den Kreuzzügen einsetzte (235).
Cunningham sagt von dem Eroberer, er habe seine Regierung bewußt auf Geldbasis stellen wollen und zu dem Zwecke einige Juden mitgebracht (253). Dieser Kommerzialisierung entsprach die frühe Emanzipation der Hörigen. „Je näher ein Gut dem Zentrum des Verkehrs lag, einen um so größeren Anteil nahmen die Geldzahlungen auf ihm ein. . . . Auf Beau- champ (Essex) ist in der Erhebung von 1086 kein freier Bauer erwähnt, 1181 sind aber 18, 1222 sogar 34 Freibauern auf dem Gute“ (69/70).
Diese Geldwirtschaft konnte sich natürlich nur auf der Grundlage einer reichen städtischen Entwicklung entfalten. Wie groß sie quantitativ war, haben wir bereits mitgeteilt. Hier ist Einiges über die verfassungsmäßige Stellung der englischen Städte nachzuholen. Man kann von ihr sagen, daß sie dem Typus der reinen Gewerbsstadt viel näher stand als die kontinentale Stadt des Nordens[1] und Südens und natürlich die „politische Zunft“ der antiken Stadt. Weber sagt von der englischen Stadt, sie habe niemals einen Stadtstaat gebildet und niemals, mit seltenen Ausnahmen, versucht oder vermocht, das platte Land zu beherrschen, ihr Bannrecht dorthin auszudehnen. „Sie besaß dazu weder die militärische Macht noch den Willen. Ihre Selbständigkeit geht darauf zurück, daß sie die Steuer vom König pachtete, und nur, wer an der Pacht oder an den Steuern teilhatte, . . . war Bürger Die Sonderstellung der englischen Stadt erklärt sich einmal aus der außerordentlichen Konzentration der Staatsgewalt in England seit Wilhelm dem Eroberer, dann daraus, daß seit dem 13. Jahrhundert die englischen Kommunen, im Parlament zusammengeschlossen, und die Ritter, wenn sie gegen die Krone etwas ausrichten wollten, pekuniär auf sie angewiesen waren, wie freilich andererseits die Städte militärisch auf sie. Seit der Vertretung im Parlament fiel für die einzelne Stadt Anlaß und Möglichkeit einer Sonderpolitik hinweg. Der Gegensatz zwischen Stadt und Land verschwand früh. Die Stadt nahm massenhaft Landgentlemen in ihr Bürgerrecht auf. Das städtische Bürgertum errang zuletzt die Oberhand, obwohl der Adel bis in die neueste Zeit formal die Leitung der Geschäfte behielt“[2].
[1] Vgl. über die politische Stellung der deutschen Städte v. Below, a. a. O. S. 93. 274,286: „Die Gemeinde hat dem Staat gerichtliche, militärische, finanzielle Rechte, oft bis zur Rivalität, abgenommen“. Vgl. ferner Jellinek, a. a. O. S. 105.
[2] Max Weber, Wirtschaftsgeschichte, S. 285/6. Brodnitz (a. a. O. S. 238, Anm.) sagte: „In England bestand niemals die systematische Feindschaft der Feudalen gegen den Kaufmann“.
[573]
Brodnitz stellt die Verhältnisse folgendermaßen dar: „In Deutschland ist die Stadtwirtschaft der Ausdruck eines Gegensatzes zum Lande, in England ist sie die besondere Form einer staatlich organisierten Verkehrswirtschaft. . . . Die schroffe Trennung von Stadt und Land kann sich in England nicht entwickeln, weil die starke Zentralgewalt das Entstehen wirtschaftlich-politischer Zwergbildungen zu verhindern vermag. Sie braucht sich nicht zu entwickeln, weil die besonderen wirtschaftlichen Verkehrsbedingungen der Stadt hier der Fürsorge des Staates unterliegen; Maß- und Münzwesen sind in England staatliche Einrichtungen. . . . Der Staat als das verbindende Ganze verhindert auch den sozialen Antagonismus zwischen Feudalität und Munizipalität, Stadt und Land gehen unmerklich ineinander über. ,,. .. Der vollkommenen Absonderung der Städte stehen auch die Verkehrsverhältnisse entgegen. . . . Die englischen Städte sind nicht geschlossene Wirtschaftsgebiete, nicht autarkische Gebilde, sondern stehen untereinander und mit fremden Städten in dauerndem Güteraustausch. Würde es sich sonst erklären, daß die größeren Städte schon im 12. Jahrhundert Gewicht darauf legen, neben ihrer Kaufgilde eine Hanse zu besitzen?“ (185/6). „Das Bild der mittelalterlichen Entwicklung ist in England weit weniger farbenreich als in Deutschland, die Einung spielt dort eine ungleich geringere Rolle. Staat und Stadt wirken zusammen. Deshalb muß sich das städtische Leben ruhiger und organischer fortentwickeln“ (191). Die Staatsautorität läßt es nicht zu, daß sich die Stadt zum Staat im Staate entwickelt. Sich aus eigenem Recht nach Belieben abzuschließen, andere nach ihrem Ermessen in ihren Verkehrsnexus hineinzuzwingen, ist ihr niemals konzediert worden. . . . Prinzipiell stand das gemeine Recht unentwegt auf dem Boden der Gleichheit von Stadt und Land, auf dem Boden der Gewerbefreiheit, die durchbrochen werden darf nur mit Einwilligung des Staates, durch staatliches Privilegium. Alle Vorrechte der Stadt beschränken sich auf ihre Grenzen. Schon im 14. Jahrhundert sehen wir auf dem Lande ungehindert kleine Industriezentren entstehen. Und später entstehen neben den verknöchernden alten Städten die neuen, die sie überflügeln, wie Birmingham, Leeds und Manchester. Selbst London steht Jahre hindurch unter Eduard I. unter königlicher Verwaltung, zu einer Zeit, wo in Deutschland die einheitliche Städtepolitik schon lange untergegangen war (186/7).
Echt seestaatlich[1] ist auch die Fremdenpolitik der Könige. In Shrewsbury finden wir in der Gilde 1209: 56 Ortsfremde, 1252 schon 234: „ein sprechender Beweis für den zunehmenden Verkehr des 13. Jahrhunderts“ (149). Diese Bewegung wird von den Herrschern mit allen x) Ebenso die Umformung des alten, geschäftsfremden englischen Rechts durch die Kleriker des Chancery-Court im Sinne der Billigkeit (equity); nicht mehr der Wortlaut, sondern der Vertragswille entscheidet (320, 322).
[574]
Kräften gefördert. Die Carta Mercatoria Eduards I. von 1303 bewilligt allen fremden Kaufleuten ohne Unterschied freien Aufenthalt ohne jede zeitliche und örtliche Beschränkung. „Sie sind zum Handeln en gros mit jedermann befugt, vom Detailhandel werden ihnen die wichtigsten Artikel, Gewürze und Schnittwaren, freigegeben. Der König verzichtet auf Preistaxen, verpflichtet sich, für einheitliches Maß und Gewicht zu sorgen, und setzt für Rechtsstreitigkeiten zwischen Engländern und Fremden Juries ein, die zur Hälfte aus Heimatgenossen des Ausländers bestehen. Schließlich befreit er die Fremden von allen städtischen Mauer-, Brücken- und Pflastergeldern“ (245). Die weitsichtige Auffassung der englischen Könige hat sich nach einem Kampfe, der fünfzig Jahre dauerte, durchgesetzt, dem Fremdhandel ist freie Bahn im Lande gewährt (247).
Auf alle diese Weisen wurden die feudalen Machthaber politisch außerordentlich geschwächt, während sie privatwirtschaftlich zu großem Reichtum kamen. „Das Parlament bringt Gentry und städtische Bürgerschaft zusammen in die Front“, also die beiden rein privatwirtschaftlich orientierten Klassen. „Am Ende des 13. Jahrhunderts liegt bei ihnen das Schwergewicht der politischen Entscheidung“ (50).
Diese Entwicklung wurde noch durch die dynastischen Kämpfe befördert, die in den Rosenkriegen ausbrachen. „Sie erheben durch den Wechsel der Dynastien und die Ungewißheit über die Person des jeweiligen Königs die Reichsstände zum unzweifelhaften Gewaltenträger des Staates, dem schließlich die letzte Entscheidung darüber zufällt, wer als König anzuerkennen sei. Endlich ist das Parlament die Spitze der Gerichts- und Verwaltungsorganisation des Reiches, und damit dringt auch die Überzeugung von seiner Organnatur frühe durch. Nicht nur die Organstellung der Krone, auch die des Parlaments ist zuerst in England erkannt und in der juristischen Theorie ausgeprägt worden“[1].
Aus allen diesen Gründen ist die Entwicklung der politischen Verhältnisse, die auf dem Kontinent zentrifugal gerichtet ist, in England zentripetal gerichtet. „So entsteht eine nach innen starke Zentralgewalt, die ungleich früher als bei uns die wichtigsten Voraussetzungen der Verkehrswirtschaft — Rechts-, Maß- und Gewichtswesen — für das ganze Land einheitlich festsetzen kann. Nach außen ist die Regierung durch die insulare Lage geschützt. ... So kann Vinogradoff mit Recht sagen, daß England durch seine politischen Verhältnisse auch in wirtschaftlicher Hinsicht vor anderen Staaten einen Vor - sprung von nahezu zwei Jahrhunderten hat“ (46).
Dieser politischen und sozialen Umwälzung entspricht auch hier, wie im Seestaat, die psychologische, namentlich seit den schweren Er-
[1] Jellinek, Allg. Staatslehre, S. 700.
[575]
schütterungen, die der schwarze Tod von 1350/51 erzeugte. „An die Stelle der grundherrlichen Abhängigkeit wird der freie Arbeitsvertrag gesetzt, die fromme Überlieferung muß dem Skeptizismus und Subjektivismus weichen — die Bahn ist frei für das kapitalistische England“ (99). Wir haben schon oben (S. 34) die verschiedene Einstellung sogar der Geistlichkeit in England (Occam gegen Thomas) im Gegensatz zu der kontinentalen betont (vgl. a. Brodnitz S. 421, 301).
So konnte denn das englische Staatswesen, zumal die Rosenkriege den größten Teil des alten Adels vernichtet hatten, fast ohne Widerstand in den Absolutismus einmünden, von dem Augenblick an, wo die Loslösung vom Papsttum und die mit dem Aufkommen des dritten Standes notwendig verbundene Entwicklung zum Nationalismus und Nationalstaat sich durchsetzte.
Wir haben der englischen Entwicklung sehr breiten Raum gegeben, aus zwei Gründen : erstens, weil sie von der kontinentalen außerordentlich stark abweicht, und dann, weil wir annehmen, daß unsere allgemeine Scheidung der Staaten in See- und Landstaaten dadurch eine Stütze erhalten haben dürfte. Bei den übrigen Staaten werden wir uns kürzer fassen, um so mehr, als die Darstellung ihrer politischen Entwicklung in den kommenden Bänden dieses Systems eine ausführliche Würdigung erfahren soll.
b) Frankreich.
Frankreich hatte vor Deutschland einen bedeutenden Vorsprung in der Zentralisierung der königlichen Macht namentlich dadurch, daß hier, wie wir bereits fanden, die Erblichkeit der Krone[1] schon seit Beginn der capetingischen Monarchie durchgesetzt war, und daß diese Dynastie durch lange Jahrhunderte hindurch bestand, während Deutschland das Unglück hatte, die Karolinger, Sachsen, Franken und Staufer nach verhältnismäßig kurzem Bestände aussterben zu sehen. Nach deren Untergange hatten es die geistlichen Kurfürsten sogar durchgesetzt, daß hundert Jahre lang kein Sohn oder sonst naher Verwandter dem Kaiser auf dem Throne folgte ; erst unter den Luxemburgern und Habsburgern ließ man die Erblichkeit wieder zu. Die Folge war, daß Deutsch-
[1] Vgl. Treitschke, Politik II, S. 95: „Nur wenn er im erblichen Besitz seiner Würde ist, kann der König über den Parteien und den sozialen Gegensätzen seines Volkes stehen. In der Wahlmonarchie dagegen ist jeder König schon als Familienvater der natürliche Feind der Verfassung. Je mächtiger er ist, desto mehr wird er versucht sein, die bestehende Verfassung zu umgehen oder ganz zu vernichten. Und dabei ist die Wahl eines Einheimischen hier ebenso gefährlich wie die eines Fremden. Fremde Könige verwickeln das Land in auswärtige Kämpfe, die seinen Interessen ursprünglich fern liegen ; ein Eingeborener aber wird niemals von allen als der wirkliche Herr anerkannt werden. Es fehlt ihm gegenüber die dynastische Gesinnung; er muß daher entweder durch demagogische Mächte wirken, sich auf die Masse stützen, oder das Werkzeug einer Adelspartei werden“.
[576]
land alle die Schäden eines Wahlreichs, die Schwächung der Zentrale und die Stärkung der Stände erfuhr, die Frankreich erspart blieben.
Ein weiterer Grund der Stärkung der Königsmacht in Frankreich ist der, daß ihm das Pandorageschenk der Kaiserwürde nicht zugefallen war. Das hatte zur Folge erstens, daß das Bestreben der Dynastie von vornherein auf die Errichtung eines Nationalstaats ausging und derart mit dem vollen Strome der Zeit fuhr, während die durch ihre Träume von der Weltmonarchie irregeleiteten deutschen Kaiser gegen den Strom arbeiten mußten, der sie doch zuletzt fortriß. Die zweite Folge war, daß Frankreich nicht wie das Kaisertum um der italischen Besitzungen willen mit dem Papste in unlösbaren Konflikt geriet; im Gegenteil war das französische Königtum in diesem Kampfe der tertius gaudens, den der Papst auch dort zu schonen hatte, wo sich das nationale Interesse des Landes und der Dynastie mehr als erwünscht gegen das internationale Interesse des Papsttums und der Kirche durchsetzte.
So konnten die Capetinger in dem verhältnismäßig engen Gebiete, in dem sie wirklich, und nicht nur nominell die Oberherren waren, wertvolle Kronrechte erhalten oder neu erwerben: vor allem gelang es ihnen, die königlichen Hausgüter zu vermehren, weil sie sich, wieder im Gegensatz zu den deutschen Kaisern, nicht hatten die Pflicht auferlegen lassen, heimgefallene Reichslehen binnen Jahr und Tag wieder auszutun[1].
Wir können hier die einzelnen Schritte nicht schildern, die vielfachen Peripetien nicht verfolgen, durch die sich in Krieg und Frieden, in Glück und Unglück, Frankreichs Schicksal vollzog. Es genügt zu sagen, daß schon Philipp IV. (1285—1314) der wirklich unbeschränkten Monarchie sehr nahe gekommen ist. „Er hat das Papsttum mit dessen Übersiedlung nach Avignon zu völliger Unterwerfung gezwungen, den mächtigsten Ritterorden vernichtet und beraubt, ein der römischen Kaiserzeit nachgebildetes Beamtentum (Legisten) geschaffen und durch Einberufung des dritten Standes zum Reichstage die Opposition der höheren Stände mehr geschwächt als gestärkt“[2]. Jellinek sagt in gleichem Sinne: „So wirken denn Theorie und Praxis zusammen, um das Königtum und damit den Staat unabhängig zu stellen von den Hoheitsrechten des Seigneurs. Unter demselben König, der dem Papsttum den tiefen Fall der avignonschen Zeit bereitete, ist auch bereits im Prinzip der Sieg der königlichen Gewalt nach innen entschieden und damit das wichtige Resultat gewonnen, daß Frankreich dauernd vor der Zersplitterung behütet wurde, der Deutschland damals schon unrettbar verfallen war. Nach kurzer Schwächung der Staatsgewalt während des hundertjährigen Krieges mit England nimmt Ludwig XI die Tra-
[1] Vgl. Jellinek, a. a. O. S. 447.
[2] Röscher, Politik, S. 264.
[577]
ditionen der Capetinger wieder auf“[1]. Mit ihm ersteigen die Valois ungefähr die gleiche Höhe der Macht, wie sie die Capetinger unter Philipp IV. besessen hatten; seiner klugen Politik gelingt es, den mächtigsten der Vasallen, den Burgunderherzog, zu stürzen, nachdem schon vorher England endgültig vom Kontinent vertrieben worden war. Gerade dieser lange Krieg hatte die Grundlagen der ständischen Macht außerordentlich erschüttert und die Hausmacht und den politischen Einfluß des Königtums um ebenso viel vermehrt[2]. Unter Franz I. war die Krone im Inneren so gut wie allgewaltig. „Sein Konkordat von 1515 machte den König zum beinahe unbeschränkten Herrn der Geistlichkeit. Die Reichsstände wurden mehr und mehr durch abhängige Notabein ersetzt, die ziemlich selbständigen Parlamente bedeutend eingeschränkt“[3]. Nach kurzer Zeit der Schwächung der Zentralgewalt durch die konfessionellen Kriege konnte Heinrich IV., unterstützt durch die treffliche Wirtschaftspolitik Sullys, wieder zu fast unbeschränkter Macht aufsteigen: das Königtum war so gefestigt, daß die Revolte der mit dem hugenottischen Bürgertum verbündeten evangelischen Magnaten, die ebenso wie gewisse mächtige Glieder der katholischen Liga gar zu gern dem Beispiel der zu eigenem Landesfürstentum aufgestiegenen deutschen Standesgenossen gefolgt wären[4], ebensowenig zum Ziele führen konnte wie etwas später die Fronde unter Ludwig XIII. und Richelieu und Mazarin. „Als die von der Reformation entfesselten Stürme Frankreich durchtobten, war die unerschütterliche Herrschaft der absoluten Staatsgewalt entschieden“[5]. So konnte denn unter Ludwig XIV., dem für unsere Begriffe typischen Vertreter des höfischen Absolutismus, der Minister Colbert den Landständen mitteilen, „das einzige Mittel, Sr. Majestät Gnade zu verdienen, bestehe in völliger Unterwerfung unter seinen Willen“. Die trotzigen Vasallen, die den Schattenkönig zittern machten, haben sich in geschmeidige Höflinge verwandelt[6], die den Roi Soleil umschranzen: jetzt sind sie auf ihn angewiesen, denn nur die militärische Macht, die jetzt er allein in der Hand hat, das stehende Heer, der „miles perpetuus“, kann sie davor schützen, daß die bis aufs äußerste ausgebeuteten und gedrückten, zum äußersten getriebenen Hintersassen ihr Joch abwerfen. Wir haben oben gesehen, welchen Eindruck die Jacquerie, die Lollhardenbewegung, die deutschen Bauernkriege und die Wiedertäuferrevolution von
[1] Jellinek, a. a. O. S. 449.
[2] Das gilt auch von den deutschen Teiritorialstaaten, deren Stände durch den 30jährigen Krieg in Ohnmacht verfielen.
[3] Röscher, a. a. O. S. 265.
[4] Vgl. Meinecke, Staatsräson, S. 68. Vgl. a. S. 236.
[5] Jellinek, a. a. O. S. 449.
[6] Ähnliche Entwicklung in dem zur Großmacht gewordenen Makedonien (vgl. Kaerst, a. a. O. S. 197).
[578]
Münster, und ein Jahrhundert später die Hinrichtung Karls I. in ganz Europa machten.
Damit nimmt die Politik des Königtums eine neue Richtung ein. Stand es früher fast immer in festem Bündnis mit den Städten gegen den Adel, so schließt es jetzt den Bund mit dem Adel gegen die Städte, die allmählich ebenfalls ihrer Sonderrechte beraubt werden. Und damit ist dann der Absolutismus vollendet.
c) Deutschland.
In Deutschland siegt der Absolutismus nicht im Reiche, sondern in den Einzelstaaten. Wir haben im vorstehenden schon so viel von dieser Entwicklung gesprochen, die wir immer wieder der englischen und französischen kontrastierend gegenüberzustellen hatten, daß uns nicht mehr viel zu sagen bleibt. Der Charakter als Wahlmonarchie und der durch die ottonische Italienpolitik heraufbeschworene scharfe Gegensatz zum Papsttum, das die Umklammerung durch die kaiserlichen Besitzungen und den Anspruch des Kaisers auf die Oberherrlichkeit abzuwehren hatte und darum unter Gregor VII. und Innozenz III. die Fürsten als seine Bundesgenossen gegen die Kaiser stärkte[1] ; vor allem aber auch die naturalwirtschaftliche Rückständigkeit des Reiches gegenüber Frankreich und namentlich England, die räumliche Größe des Reiches, eines reinen Landstaates, der (wir werden das sofort näher betrachten) nur durch geldwirtschaftlich besoldete Beamte zusammengehalten werden kann[2]: all das und anderes, das hier nicht betrachtet werden kann, mußte unwiderstehlich zum Zerfall der Zentralgewalt und zur Ausbildung des souveränen Landesfürstentums führen. „Es fand zwischen dem Kaiser und den Fürsten gleichsam ein Wettrennen statt um die Beute der Staatsräson, und der Westfälische Friede, der die Landeshoheit der Territorialgewalten emphatisch bestätigte und sie gerade dadurch noch steigerte, daß er ihren Inhalt nicht genau festlegte, entschied zugunsten der Fürsten“[3].
Der Prozeß, der zu diesem Ziele führte, ist für eine universalgeschichtliche Betrachtung aus dem Grunde besonders interessant, weil hier die beiden möglichen äußersten Ausgänge gleichzeitig eintreten: Sieg der Stände im Reiche — und Niederlage der Stände in den Landesfürstentümern. Wir wollen daher die Vorgänge an der Hand des vor-
[1] v. Below, a. a. O. S. 365· Röscher, a. a. O. S. 124.
[2] Jellinek, a. a. O. S. 76 : „Die Entwicklung des englischen Staates mit seiner frühen Zentralisation ist wesentlich mit bedingt durch die verhältnismäßige Kleinheit seines Gebietes, noch nicht doppelt so groß wie Bayern, während das gewaltige Deutsche Reich schon bei dem unausgebildeten Verkehrswesen des frühen Mittelalters politischer Übermacht seiner Glieder Raum geben mußte“.
[3] Meinecke, Staatsräson, S. 169.
[579]
trefflichen Buches von Spangenberg etwas genauer darstellen, wobei wir uns, wie überhaupt, auf strittige Einzelfragen nicht einlassen werden: der große Gang der Entwicklung, der allein uns interessiert, ist klar genug.
Das alte germanische Volksrecht kannte bereits, wie wir schon gefunden haben, eine dem Königtum nebengeordnete Gewalt in der Versammlung der freien Volksgenossen, der die Königs-, Herzogs- und Beamtenwahl und der Beschluß über Krieg und Frieden zustand, und die zugleich als oberstes Gericht fungierte (2). In der feudalen Zeit hat die Lehnskurie, die Versammlung der Großen des Landes, dem Könige beratend und beschließend zur Seite gestanden.
Mit der Ausbildung des Feudalsystems zu seiner vollen hierarchischen Staffelung zeigte es sich, daß dieser äußerlich so imponierende, scheinbar für die Ewigkeit getürmte Bau doch auf schwanker Grundlage errichtet war. Es bestanden innere Gegensätze, die zum Austrag drängten und sich zu diesem Zwecke der weiterfördernden Kräfte bedienten, die wir im vorigen Abschnitt geschildert haben.
Das Kaisertum hatte von dem Aufschwung des Territorialfürstentums alles zu fürchten und fand in dem Bestreben, es niederzuhalten, seine natürlichen Bundesgenossen in den freien Vasallen und den noch aufrechten Freien, die in die Territorien und Immunitäten eingesprengt waren. Die Landesfürsten ihrerseits stützten sich nach dem allgemeinen soziologischen Gesetz, das wir kennen gelernt haben, auf die aufstrebenden, noch minderberechtigten Schichten: die unfreien Dienstmannen (Ministerialen), und die Städte. Ein ungefähres, zeitweilig bestehendes Gleichgewicht war im Jahre 1231 erreicht, als vor König Heinrich „an dem gleichen Tage, an dem die Landesherrlichkeit durch das statutum in favorem principum reichsgesetzliche Anerkennung fand“, auch das Urteil des Reichsgerichts erging, demzufolge die Fürsten Verfassungsänderungen und neue Rechte nicht ohne Zustimmung „meliorum et majorum terre“ einführen dürfen (11/2).
Die Ministerialen waren, wie schon dargestellt, in der diesem Gesetz vorhergehenden Zeit gewaltig in die Höhe gekommen. Seit der Mitte des 13. Jahrhunderts bilden die Ministerialen bzw. Ritter ganz überwiegend die regelmäßige Umgebung des Landesherrn (17), der in ihnen ein brauchbares Beamtentum fand (19). Ihre Stellung wurde noch dadurch gehoben, daß viele alte Adelsgeschlechter in den immerwährenden Kriegen, besonders den Kreuzzügen, ausstarben; der Glanz des neuen Ritterstandes, der sich als riesiger internationaler Verband über die ganze Christenheit ausdehnte, war so groß, daß viele Freie und sogar Edle sich ihm freiwillig anschlössen (30).
Die guten Dienste der Ritter konnten die Fürsten im Naturalstaat wieder nur mit Land und Leuten bezahlen, und so wuchs ihnen in dem
[580]
jetzt zu einer einheitlichen Klasse verschmolzenen Grundadel allmählich aus einem Diener und Verbündeten ein starker Gegner heran : „Innerhalb der Territorien entstanden mehr oder minder geschlossene Herrschaftsbezirke“ (35): die Fürsten sahen sich von dem gleichen Schicksal der Zersplitterung bedroht, das die Zentralgewalt bereits erreicht hatte.
Ebenso erging es ihnen mit dem zweiten Bundesgenossen ihres ersten Aufstiegs, den Städten.
„Das Bürgertum, die wichtigste ständische Bildung der neueren Zeit, entfaltete sich auf herrschaftlichem Boden“ (25). Aber es entwuchs der Herrschaft bald. Die erste Stufe war die Erringung der Selbstregierung, als der herrschaftliche Stadtherr durch den städtischen Rat ersetzt wurde. Der wichtigste Schritt aber war die Gewinnung der eigenen Gerichtsbarkeit, die mit dem Erwerb der Halsgerichtsbarkeit ihren Abschluß fand (26/7). (Welch ein Unterschied gegenüber der englischen Entwicklung!) So bildet die deutsche Stadt „einen eigenen Friedens- und Rechtskreis, einen geschlossenen, vom Lande scharf gesonderten Gerichtsbezirk“ (26). „Die größeren, durch Reichtum und politische Selbständigkeit ausgezeichneten Städte blieben ihrem Ziele nicht fern, ein Staat im Staate zu werden“ (29).
Wie von den Ministerialen in der Verwaltung und militärisch, werden die Landesfürsten mehr und mehr von den Städten finanziell abhängig (55, vgl. a. 28, 44). Wo das Städtewesen und die Gewerbe hoch entfaltet sind, haben die Bürgerschaften oft den überwiegenden Einfluß im fürstlichen Rat (62, 67).
Die beiden aufstrebenden Klassen haben nun Gelegenheit, den Landesfürsten ihre Bedingungen zu diktieren. Diese sind schon Ende des 13. Jahrhunderts schwer verschuldet, und um die Wende des Jahrhunderts ist die Krise völlig ausgebrochen (46). Die in der Naturalwirtschaft unvermeidliche Vergebung des Krongutes hat auch hier, wie im alten Hellas, wie im Reiche, den fürstlichen Finanzen die Basis des eigenen gedehnten Großbesitzes zum großen Teile entzogen; die neuen Bedürfnisse haben demgegenüber den regelmäßigen Etat vermehrt, und die unselige Politik der Zeit, das Fürstentum rein privatwirtschaftlich aufzufassen: die Verpfändungen von Landesteilen und die noch unseligeren Erbteilungen, haben das alles noch weit verschlimmert (76/77).
Man muß in dieser Finanznot die Eingesessenen des Territorium um besondere Steuern ersuchen. Sie gewähren sie nur gegen Konzessionen, von denen die wichtigste der Verzicht des Fürsten auf die regelmäßige Steuer (Bede) ist (46); nur für bestimmte Fälle: Gefangenschaft des Fürsten, Heirat einer Prinzessin, Schwertleite eines Prinzen und Landesnot, sollten noch Steuern erhoben werden, für die ersten Fälle in bestimmter Höhe, für den letzten Fall nach Verein-
[581]
barung mit den Führern der Steuerzahler, die sich zu dem Zwecke in einer „Einung“ verschworen hatten, die, samt dem Widerstandsrecht, sie sich feierlich verbriefen ließen. Diese Verträge beabsichtigten nicht, den Ständen ein Steuerbewilligungsrecht zu schaffen, sondern zielten höher: auf die Befreiung von regelmäßiger Steuer, auf Depossedierung -der Fürsten von diesem ihrem wichtigsten Staatsrecht überhaupt ; und nur nebenbei ergab sich für andere, außergewöhnliche Steuern das Bewilligungsrecht (55). Hier liegen die Ansätze der ständischen Verfassung (56).
Die Einungen dehnten sich immer weiter; dem hohen Adel folgte die Ritterschaft, und folgten die Städte : das alles griff weit über die Territorien hinaus und drohte sie zu sprengen (79). Haben sich zuerst die Einungen nur für einen bestimmten Zweck gebildet und nach dessen Erreichung wieder aufgelöst, so werden sie allmählich stabil und, vor allem, werden zu dauernden Einungen der verschiedenen Stände miteinander. Seit Mitte des 14. Jahrhunderts erweitern sich die Tagungen der Ritterschaft bzw. des Domkapitels durch Angliederung anderer Stände zu ständischen Versammlungen; diese Zusammenkünfte führten aber meist erst im 15. Jahrhundert zu einem wirklichen korporativen Zusammenschluß (94). Zuerst traten die Städte, später die Geistlichen den Versammlungen bei (96/7) ; diese hatten sich lange zurückgehalten, weil sie nicht als landsässig erscheinen wollten, jetzt werden sie durch den Rückgang der katholischen Hierarchie, den Kampf der Staatsgewalt mit dem Klerus genötigt, die Stütze ihres irdischen Regiments in engerem Anschluß an die weltlichen Gewalten des Territorium zu suchen (97). In Bayern erscheinen alle drei Stände 1394 zum ersten Male geeint (103), und die Einung blieb trotz der entschiedenen Mißbilligung des Kaisers bestehen (107).
„Die Blütezeit der Einungen, die den dualistischen Charakter des älteren deutschen Territorialstaats in voller Schärfe hervortreten ließen, reichte bis etwa 1460“, um nach einer kurzen Nachblüte gegen die Wende des 15. Jh. allmählich zur bedeutungslosen Form herabzusinken (113).
Damit hat auch der ständische Staat seine Höhe erreicht. Von jetzt an beginnt der absolutistische Fürstenstaat seinen Aufstieg und formt zunächst diese, durch Einung gegen sein Interesse entstandenen, Stände in eine fürstliche Behörde um.
Die Anarchie hatte mit der Zersplitterung der fürstlichen Macht eine unerträgliche Höhe erstiegen. Wie in Hellas zur Zeit des Makedonien, bestand eine allgemeine Sehnsucht nach einer obrigkeitlichen Gewalt, die Recht und Ordnung wiederherstellen könnte; das kündigte sich bereits um die Mitte des 14. Jahrhunderts an (93), und gerade die Erkenntnis dieser Gefahr wirkte mit, um die Einungen in die Welt zu stellen. Der große Kampf begann und wurde zuletzt im wesentlichen
[582]
durch die neue Feuerwaffe, das Geschütz, entschieden, dem die Burgen nicht widerstehen konnten (118). Unterstützt fernerhin von dem römischen Recht, bauten die Fürsten langsam und mühselig den zerschlagenen Staat wieder auf. Aus der Landesherrlichkeit wird die Landeshoheit (120); sie bedeutet „den die verschiedenen erworbenen Rechte umfassenden Kollektivbegriff, die ihrem Wesen nach einheitliche, Land und Leute zur organischen Einheit zusammenfassende, unteilbare und unveräußerliche obrigkeitliche Gewalt“ (121/2). Die Staatsidee erhebt sich wieder, die privatrechtliche Auffassung des Fürstentums verschwindet allmählich, die Teilungen hören auf. „So beginnt um die Mitte des 14. Jahrhunderts auch eine politische Renaissance in Deutschland“ (123).
Die Datierung ist von hoher Wichtigkeit. Wir haben immer wieder gefunden, daß der absolute rationale Staat und der Kapitalismus Zwillingsbrüder sind. Genau um die gleiche Zeit, um etwa 1360, entsteht in Deutschland der Kapitalismus mit der Sperrung des Bodens gegen die Bauernschaften, der proletarischen Masseneinwanderung in die Städte und der damit zusammenhängenden Degeneration der Zunft aus einer „harmonischen“ in eine „disharmonische“ Genossenschaft[1].
Die Landesherren bringen Ritter und Städte in Räson, brechen die Raubburgen und zwingen, wie es Friedrich II. in Berlin tat (1442), die Bürgerschaften, die Bünde und Hansen abzuschwören und auf ihre Gerichtshoheit zu verzichten (130). Auch die Geistlichkeit muß sich beugen: der päpstliche Stuhl sichert sich im Kampf mit den Selbständigkeitsbestrebungen des Episkopats und den konziliaren Tendenzen die Hilfe des territorialen Fürstentums durch Verleihung wichtiger Privilegien; die Anfänge eines landesherrlichen Kirchenregiments bestanden schon vor der Reformation (128).
Bei alledem geht der Aufstieg sehr langsam: die Finanznot ist ein schweres Hindernis, und es müssen den Ständen, wie wir sahen, auch schwere Opfer gebracht, es muß ihnen vor allem das eigentliche Fundament aller Staatskraft, der Bauer, geopfert werden. Aber, dank der Uneinigkeit der Stände, die sich, Zünfte und Ritterschaft, kastenartig abschließen (89), dank der dadurch entstandenen Zerklüftung zwischen Stadt und Land, macht das Fürstentum einen Schritt nach dem anderen vorwärts zu seinem Ziele.
Als Hebel dazu diente ihm die embryonale, auf freier Einung beruhende Ständeordnung, die sich ihm zum Trutz ausgebildet hatte. Die Finanznot der neuen Staaten, die für das Soldheer, für die gelehrten Juristen usw. bedeutende neue Ausgaben hatten, zwang zu einer Regelung der Steuerfrage auf neuem Wege; man kann nicht mehr mit allen
[1] Vgl. S. S. III, S. 957ff. um Großgrundeigentum und soziale Frage. Zweiter (historischer) Teil, zweites und drittes Kapitel.
[583]
Gruppen einzeln verhandeln, der Fürst selbst ruft fortan die gesamten Stände ein und bestreitet und entreißt ihnen zuletzt das Recht der Selbstversammlung. Die Stände des gesamten Landes! Das verlangt schon die steuerliche Gerechtigkeit, die Gleichmäßigkeit der Verteilung der Lasten (135). „Einst . . . hatten sich die Stände in freier Einung verbunden, um Bede und andere Lasten von sich abzuschütteln; jetzt einte das Fürstentum die Stände, um sich von Landtagen die unentbehrlichen Steuern bewilligen zu lassen“ (140). Die Fürsten setzten ferner das Majoritätsprinzip durch, so daß ein Beschluß auch die Minorität band, und nicht minder die Vertretungsbefugnis, durch die auch die nichtvertretenen Insassen des Landes gebunden wurden (142 ff.).
„Die landständische Korporation als rechtlich anerkannte Vertretung des Landes ist somit nicht eine gewillkürte Genossenschaft, sondern eine Zwangsgemeinschaft, nicht ein Werk der in freier Einung verbundenen Stände, sondern eine Schöpfung der Landesobrigkeit gewesen“ (147). Sie war ein Erfolg des Fürstentums (191).
Wie man sieht, faßt Spangenberg den Begriff des Ständestaats wesentlich enger, als es vor ihm geschehen ist ; alles, was an ständischen Bildungen und Erfolgen vor der Ausbildung der vollentfalteten landständischen Verfassung erschienen ist, gehört ihm zufolge nur zur „Vorgeschichte“ der Institution. Das ist wesentlich vom Standpunkt des Staatsjuristen aus gesehen, für den eine Institution eigentlich erst existiert, wenn sie im positiven Rechte formell anerkannt ist. Den Soziologen mit seiner ganz anderen Einstellung zu den Dingen kann diese Entscheidung nicht binden: sie ist für ihn rein terminologisch; es ist ihm gleichgültig, wo der Historiker in den gleichmäßigen Strom der Geschehnisse seine künstlichen Grenzlinien zieht. Wir fassen den „Ständestaat“ als einen Übergang vom Feudal- zum absoluten Staate auf, und nicht nur als eine erste Stufe des Absolutismus. Trotz aller juristischen Unvollkommenheiten der Institution ist sie doch schon im 13. und 14. Jahrhundert soziologisch klar vorhanden.
Der Niedergang der ständischen Macht in Deutschland vollzog sich immer schneller und zu immer größeren Tiefen. Es erging ihr nicht anders als in den großen Nationalstaaten des Westens: „In Österreich war durch lange Kämpfe die Macht der alten Landtage gänzlich vernichtet. Ihre ganze Tätigkeit spielte sich jedes Mal in drei Tagen ab: Auffahrt der Herren Stände in ihren Staatskarossen ; einstimmige Annahme der landesherrlichen Postulate. Abfahrt der Herren Stände in ihren Staatskarossen“[1]. Genau wie Ludwig XIV. durch Colbert ließ der große Kurfürst durch seine Minister die Stände wissen, daß sie binnen vierzehn Tagen fertig zu sein hätten; was sie weniger bewilligten, würde dessen ungeachtet dennoch militärisch beigetrieben werden[2].
[1] Treitschke, Politik II, S. 82/3.
[2] Röscher, Politik, S. 209.
[584]
Derart entstand aus dem alten Deutschen Kaiserstaat das „Reich“, dessen staatsrechtliche Einordnung den Juristen so unendlich viel Kopfzerbrechen gemacht hat. Uns ist die Erscheinung nichts Neues: wir haben immer wieder gesehen, wie ein primitives Großreich auf der naturalwirtschaftlichen Stufe in ein Haufwerk von Einzelstaaten zerfiel, die nur noch rein formell durch das Band einer Scheingewalt zusammengehalten werden. Dieser Prozeß hatte sich auch hier auf etwas höherer Stufe der Entwicklung vollzogen.
Was neu war, war nur der Stand der Staatstheorie. Am Bilde der modernen nationalen Einheitsstaaten geschult, hatte Bodin das Wesen des Staates in der Souveränetät gefunden. Wo aber, bei wem war in diesem Staatsgebilde die Souveränetät ? Beim Kaiser oder bei den Landesherren ? Oder bei beiden ? Oder bei keinem von beiden ganz ? So kam Pufendorf zu der Erkenntnis, daß es neben den von Aristoteles gezeichneten regulären Staatsformen der Monarchie, Aristokratie und Demokratie, jede mit ihrer „Ausschreitung“ (Parekbasis) : der Tyrannis oder Despotie, der Oligarchie und der Pöbelherrschaft, noch „irreguläre Systemata“ gebe[1].
Bodin selbst hatte die Maj estas des deutschen Kaisers nicht zugegeben, sondern sie bei den Reichsständen gefunden und das Imperium Romano-Germanicum für eine Aristokratie erklärt[2]. Ihm war Vultejus gefolgt (ib. 39) ; dem trat Antonius und, diesem folgend, der berühmte Reinking entgegen, während Arumäus und seine Schule auf Grund der spitzfindigen Unterscheidung von der Maj estas personalis und realis eine Zwischenstellung einzunehmen versuchten. Es war ein prächtiges Thema für Doktordissertationen und Disputationen (40 ff.). Dann griff Chemnitz unter dem Pseudonym Hippolithus a Lapide im Dienste Schwedens mit seiner gewaltigen antihabsburgischen Streitschrift in die Debatte ein (50 ff.)[3]. Pufendorff nannte das Gebilde anfangs ein „monstre simile“, ein Ausdruck, den Koser schon bei Bartolo im 14. Jahrhundert nachgewiesen hat; er milderte ihn in späteren Auflagen in ein „tantum non monstre simile“[4]. Noch heute zerbrechen sich Juristen und juristisch eingestellte Historiker den Kopf darüber, in welche der geläufigen Kategorien dieses Staatsgebilde einzureihen sei[5]. Das ganze Problem existiert nur für die juristische und nicht für die soziologische Staatslehre.
Was uns interessiert, ist lediglich die Verteilung der politischen
[1] Bresslau, in der Einführung zu Pufendorffs: „Über die Ve. fassung des Deutschen Reiches“, S. 30/1.
[2] Stintzing, a. a. O. II, S. 35.
[3] Vgl. Meinecke, Staatsräson, S. i68ff.
[4] Meinecke, a. a. O. S. 282.
[5] Vgl. v. Below, a. a. O. S. 325.
[585]
Kräfte und ihre Auswirkung auf das gesellschaftliche Leben. Stintzing weiß der Staatsform nichts besseres nachzusagen, als daß sie zwar die Lockerung des Staatsverbandes zur bedauernswerten Folge hatte, aber in höherem Grade die Befreiung des Staats von der Suprematie der Kirche bedeutete[1]. Aber er muß doch sagen, daß die „Entstehungsgeschichte der Carolina uns in ihrem Verlaufe wie in ihrem Abschlüsse ein trauriges Bild der Ohnmacht deutscher Reichsgesetzgebung bietet“[2].
In dieser Weise hat das Urteil immer geschwankt. Wie Moser hat auch der junge Hegel diesem bunten Durcheinander des alten Reiches, dieser „Anarchie“ — obzwar er sie ja in ihren Extremen aufs heftigste beklagte — schließlich doch wieder die beste Seite abgewonnen: „Das Deutsche Reich ist ein Reich, wie das Reich der Natur ist in seinen Produktionen, unergründlich im Großen und unerschöpflich im Kleinen“[3]. Und doch erkannte er, daß das Ganze zerfallen, der Staat nicht mehr sei. Die Deutschen aber seien so unredlich, „nichts zu gestehen wie es ist — sie bleiben ihren Begriffen, den Rechten und den Gesetzen getreu, aber die Begebenheiten pflegen nicht damit übereinzustimmen“ [4]. Und so ist auch Constantin Frantz, der geschworene Föderalist, trotz alledem ein Schwärmer für das Reich mit seiner Freiheit gewesen: „Deutschland ist ein föderativer Körper, aber muß es um deswillen ein Staatenbund oder ein Bundesstaat sein? . . . Das ganze Gerede ... ist also leeres Geschnatter gewesen, und wohl uns, wäre es ohne Wirkung geblieben“[5].
Der Niedergang der Stände vollzog sich derart überall, mit Ausnahme der Adelsrepubliken, in denen der Absolutismus sich erst auf dem Wege der Unterwerfung unter einen auswärtigen absoluten Herrscher durchsetzen mußte: das Schicksal namentlich Polens, aber auch der baltischen Ritterrepubliken. „Die Institutionen des alten ständischen Staates wurden nicht aufgehoben, sondern schliefen allmählich ein. Durch die Einführung des stehenden Heeres und der stehenden Steuer verloren die alten Stände ihren Sinn und ihre Macht. . . . Die alten ständischen Traditionen blieben trotzdem in Deutschland lebendig. In unseren sog. ersten Kammern haben sie sich noch nach 1815 mit einzelnen Modifikationen erhalten“[6]. In Frankreich waren die Generalstände das letzte Mal im Jahre 1614 zusammengetreten; in Preußen ist seit 1643, in Bayern seit 1669 kein Landtag mehr berufen worden;
[1] A. a. o. 1, S. 60.
[2] A. a. O. I, S. 626.
[3] Metzger, a. a. O. S. 340ff.
[4] Heller, a. a. O. S. 35.
[5] A. a. O. S. 432.
[6] Treitschke, a. a. O. II, S. 93.
[586]
in Osterreich wurde die Bedeutung der Landstände schon durch Ferdinand II. erschüttert; in Dänemark wurde im Jahre 1660 die absolute Monarchie mit Beseitigung der Stände eingeführt. „Die Bauern und die Bürger sahen diesem Untergange der landständischen Verfassung teilnahmslos zu. Sie hofften noch eher von der neuen unbeschränkten Staatspolizei der Fürsten Schutz gegen die willkürliche Gewalt der kleinen Herren und Förderung der neuen Kulturbedürfnisse“[1].
Dennoch war in Frankreich „die ständische Selbständigkeit auch im 18. Jahrhundert noch so groß, daß man den Absolutismus der französischen Könige nicht etwa mit dem Napoleonischen vergleichen darf. Für einen Monarchisten wie Bonald gehören Monarchie und intermediäre Gewalten zusammen“[2].
Wie die einzelnen Beurteiler das Institut im ganzen bewerten, hängt selbstverständlich von ihrer gesamten Einstellung ab. Treitschke behandelt es mit Haß und Hohn: „Der Begriff des gemeinen Wohls, die Idee der Nationalität, einer Volksgemeinschaft, das alles fehlt dem ständischen Staate. Daher sind Revolutionen in solchen Staaten nicht Kämpfe um politische Prinzipien, sondern recht eigentlich Zivilprozesse in Waffen“[3]. Wir wissen bereits, daß diese Anschauung nach beiden Seiten hin übertrieben ist : die Stände haben, wenn auch nur gelegentlich und sozusagen im Nebenamt, die Interessen der Allgemeinheit wahrgenommen, und auch im nationalen Machtstaate geht der Kampf der Parteien nicht so ausschließlich um Prinzipien, wie Treitschke annahm. Dagegen muß man ihm darin Recht geben, daß die ständischen Landtage „recht eigentlich eine Brutstätte des Partikularismus gewesen sind. Bekanntlich hat erst Friedrich der Große ein gemeinsames preußisches Indigenat geschaffen; bis dahin sollte der Märker nicht in Cleve angestellt werden, der Rheinländer nicht im Osten der Monarchie“[4]. Gerade aus diesem Grunde sagt ein überzeugter Föderalist wie Frantz dem Ständestaat alles mögliche Gute, und dem absoluten Staat alles mögliche Böse nach. Romantisch angehaucht, hält er mit Recht den absoluten Staat für ein Erzeugnis der Aufklärung und haßt ihn dementsprechend: „Man hielt dabei die Privilegien und Sonderrechte für das Wesen der Stände selbst, deren Existenz doch vielmehr auf sozialen Tatsachen beruht, wovon aber die Theorie des sog. Rechtsstaates keine
[1] Bluntschli, a. a. O. S. 185/6. Wolzendorff (240) sagt, im ganzen sei im 17. Jahrhundert jene Macht der Stände, die den Beurkundungen ihres Widerstandsrechts die Bedeutung eines wirklich geltenden Rechts geben konnte, längst vorbei.
[2] Schmitt-Dorotic, Die Diktatur, S. 101. Jellinek, a. a. O. S. 627: Es gab noch im 17. und 18. Jahrhundert neben den Pays d'élection eine ganze Reihe von Pays d'Etats mit Provinzialständen.
[3] Politik II, S. 84.
[4] Treitschke, a. a. O. S. 91: Er sagt, die ständische Monarchie sei in Wahrheit Polyaichie, „konstituierte Zuchtlosigkeit“ (II, S. 377); vgl. a. II, 69/70.
[587]
Notiz nimmt, weil man einmal die Fiktion gemacht hat, daß alle bürgerliche und politische Ordnung ein Produkt des reinen Rechtes sei, das Recht aber lediglich aus der Gesetzgebung folge“[1]. Auch hier mischt sich offenbar Falsches und Wahres. Man kann Föderalist sein und dennoch erkennen, daß in der Tat im Ständestaat die Privilegien und Sonderrechte das Wesen des Instituts ausmachten. Der neue Ständestaat, dem Frantz sehnsüchtig entgegenharrt, wird gewiß grundsätzlich anders aufgebaut sein als der alte, von dem Schmitt-Dorotic mit Recht sagt, daß seine Vertreter, die Monarchomachen und auch Locke, wenn sie vom „Volk“ sprachen, nicht die „plebs“ meinten, nicht die „in- condita et confusa turba“, sondern nur das in der ständischen Organisation repräsentierte Volk [2]. Auf der anderen Seite hat Frantz wieder Recht, wenn er die ungeheure Demoralisation beklagt und anklagt, die die völlig unbeschränkte Machtfülle des Absolutismus den Machthabern und über die Völker gebracht hat. „Alles Mögliche ließ sich nun als salus publica deduzieren“ (Staatsräson!) „zumal der übei dem Gesetz stehende Princeps, dessen Wille allein Gesetz ist, allein zu entscheiden hatte, was die salus publica erforderte. Unaufhaltsam schritt seitdem der Absolutismus fort und mit ihm die Demoralisation der Gewalthaber. Als römische Principes über allen Widerspruch erhaben, durften sie ihrerseits sich alles erlauben, der geringste Tadel wäre ein crimen laesae majestatis gewesen“[3]. Wie aus diesen Sätzen hervorgeht, schiebt Frantz den Umschwung zum großen Teile auf die Einführung des römischen Rechtes: auch das erscheint uns als eine recht arge Übertreibung; denn dessen Einführung und Durchsetzung ist offenbar in dieser Gestalt und Zuspitzung selbst erst eine Folge der stattgehabten Machtverschiebung. Daß dann das römische Recht in seiner Handhabung durch die Kronjuristen in Frankreich, Deutschland und anderwärts stark dazu beigetragen hat, die Entwicklung zum Absolutismus zu beschleunigen und auf die Spitze zu treiben, ist selbstverständlich nicht zu leugnen : es gab der Gewalt den Schein des Rechts, wandelte sie in „Macht“ in unserem Sinne.
3. Die Kräfte der Zersetzung. ↩
Wir, die wir hier nicht zu werten, sondern lediglich zu verstehen haben, die wir jede Entwicklung als Ausdruck einer, zwar nicht immanenten, wohl aber historischen Notwendigkeit begreifen, haben uns zu fragen, woran diese, zu ihrer Zeit so überaus starke, Form des Staates überall in so kurzer Zeit zugrunde gegangen ist.
[1] Frantz, Naturlehre, S. 152.
[2] Die Diktatur, S. 25.
[3] A. a. O. S. 416/7.
[588]
Den Hauptgrund haben wir bereits bezeichnet: den Durchbruch der Geldwirtschaft, der die lokalen Machthaber dazu verlockte oder zwang, ihre militärische Kraft aus den Händen zu geben und sich gleichzeitig ihre Hintersassen nicht nur zu entfremden, sondern zu bitteren Feinden zu machen; derselbe Durchbruch der Geldwirtschaft, der gleichzeitig der Zentralgewalt in dem stehenden Heere das große Mittel der Macht in die Hand gab. So standen die Stände ohne mögliche Bundesgenossen in einem Kampfe, in dem sie sich auf nichts stützen konnten als auf vergilbte Pergamente, auf „Fetzen Papiers“, die sich nie und nirgend in der Geschichte als brauchbare Waffen erwiesen haben.
Aber das allein genügt doch nicht, um den jähen Sturz der ständischen Macht zu erklären. Noch ein wichtiges Moment muß herangezogen werden: die innere Zersplitterung der Stände[1], die ihre Kraft vollkommen lähmte. Städte und Grundadel, und innerhalb des Adels[2] große und kleine Dynasten, fast vollkommen entwickelte Landesherren und große und kleine Grundherren, reichsunmittelbare und mittelbare Städte und Ritter: das war von inneren Interessengegensätzen allzusehr gespalten, als daß es jemals zu einem Stoßkörper von politischer Kraft hätte werden können. Überall in der Welt besteht, wie Röscher mit Recht bemerkt, die „Tendenz jeder lange Zeit haltbaren Aristokratie, sich oligarchisch zusammenzuziehen“. Als wichtigsten Beleg nennt er das alte deutsche Reich, das schon von Bodinus für eine Aristokratie erklärt worden war. Die Königswahl, ursprünglich ein Recht des Volkes, — die Großen hatten nur die Vorwahl — ging zuletzt auf die sieben Kurfürsten über. „Schon während der letzten Zeit Friedrich Barbarossas war eine wesentliche Beschränkung des Reichsfürstenbegriffs eingetreten. Früher hatten alle Großen und Mächtigen, die vom Reiche Amt oder Besitz in bedeutenderem Maße empfangen, zu den Reichsfürsten gezählt[3]. Jetzt aber konnte sich nur ein viel kleinerer Kreis in unmittelbarer Beziehung zum Reich behaupten. Die meisten Reichsstädte, die noch im 16. Jahrhundert einen wichtigen Platz auf dem Reichstage eingenommen hatten, kamen allmählich dahin, gar keinen eigentlichen Abgeordneten mehr zu schicken, sondern ließen sich ganz unwirksam durch Regensburger Spießbürger vertreten. Das Fürstenkollegium, das zur Zeit der katholischen Reaktion vielleicht der bedeutsamste Teil des Reichstages gewesen war, büßte nachher seine wichtigsten Mitglieder ein: Bayern und Hannover durch Erhebung zur
[1] Vgl. Spangenberg, a. a. O. S. 88.
[2] Mitscherlich, a. a. O. S. 138: Ein Teil des Adels war schon Hofabel und hielt dauernd zum Fürsten.
[3] Röscher, Politik, S. 150. Wir erinnern an die oben wiedergegebenen v. Below- schen Feststellungen, wonach später nur Inhaber der Gerichtsgewalt zu Landesfürsten wurden.
[589]
Kurwürde, Pfalz-Neuburg durch Erlangung der Pfalz, Magdeburg durch Verbindung mit Brandenburg, usw. Die Armut vieler Fürsten bewirkte, daß oft eine Menge von Stimmen, bis 12, in dieselbe Hand geriet. Deshalb ein immer entschiedeneres Vorherrschen der Kurfürsten“.
Gerade so stand es innerhalb der großen Territorialstaaten, und um so ärger, je weiter sie durch Erbschaft und Eheverträge über das Land zerstreut waren; so konnte sich der Große Kurfürst „bei der Unterdrückung seiner Landstände ganz vornehmlich schon auf ihre Zersplitterung stützen: Preußen, Cleve, endlich die vielen Parzellen der Mark“ [1]. Irgendein Gemeinsinn bestand unter den Ständen so wenig wie unter den anderen Klassen: der Zusammenhang war ausschließlich dynastisch.
Daß unter solchen Umständen nicht eigentlich eine wesentliche militärische Machtvermehrung des Fürsten nötig war, sondern daß der ganze Bau des Ständestaates so unsicher stand[2], daß er von selbst einstürzen mußte, wenn nur ein wenig Staatskunst und Politik des Divide et Impera angewendet wurde, — das beweist das Beispiel Dänemarks, wo ein völlig ohnmächtiges Königtum gegen einen völlig allmächtigen Adelstand ohne jeden Kampf zur vollen absolutistischen Gewalt aufstieg : ein Zusammenbruch etwa wie der des Zarismus oder des deutschen Kaisertums als Folge des Weltkrieges, ein In-Ruinen-Fallen nur durch das eigene Gewicht. „Ohne Blutvergießen, ohne Gewalttat, nur durch allmähliches Reifen und Abpflücken der Frucht, ohne Versuch einer Gegenrevolution, ist das dänische Königsgesetz zustande gekommen“[3]. In den Reihen des Adels wütete die Zwietracht „Da seit 1536 kein Reichstag mehr gehalten wurde, sondern der Reichsrat alle Herrschaft monopolisieren wollte, so hatte sich allmählich eine, selbst für den kleineren Adel drückende Oligarchie gebildet: und auch diese hielt nicht völlig mehr zusammen, als die Erhebung von Uhlefeld und Sehestedt zu Schwiegersöhnen des Königs den Neid der Übrigen erregt, und hernach Uhlefelds Sturz das ganze Gebäude erschüttert hatte. . . . So konnte denn ein kluger, volksfreundlicher, still konsequenter Monarch wie Friedrich HL, welcher zu warten und doch immer fortzuarbeiten verstand, allerdings Terrain gewinnen.“ In schwerer Kriegsund Finanznot, durch die Mißwirtschaft des Adels herbeigeführt, mußte man sich entschließen, den seit 124 Jahren nicht mehr berufenen Reichstag zusammenzurufen, und nun waren es die unadligen Stände, die das Wahlkönigtum abschafften, um dem Mißbrauch der Kapitulationen
[1] Röscher, a. a. O. S. 206. In Spanien waren die Granden steuerfrei (Röscher, a. a. O. S. 257).
[2] Kriegsnöte beförderten die Entwicklung, weil sie den Adel durch blutige Verluste schwächten und weil „inter arma silent leges“. Steuern und Abgaben mußten erhoben werden, ohne die Bewilligung der Stände abzuwarten (Mitscherlich, a. a. O. S. 135).
[3] Röscher, a. a. O. S. 200/1.
[590]
ein Ende zu machen, und den König als Erbfürsten einsetzten; da eine Einigung über die neue Verfassung angesichts der Wut und des Hasses der Nichtadligen gegen den Adel nicht möglich war, einigte man sich dahin, ihre Abfassung dem Könige anzuvertrauen: und so wurde der Absolutismus eingeführt, ohne daß man recht wußte, was und wie es geschah. In der Zeit bis zur Publikation der neuen Verfassung benützte der König seine diktatorische Vollmacht, um mit der Einführung einer Beamtenregierung und der Schaffung eines stehenden Heeres alle tatsächliche Macht an sich zu bringen, und dann gab es eben keine Möglichkeit eines Widerstandes mehr.
Schmitt-Dorotic hat gezeigt, ein wie gewaltiges Instrument bei der Niederwerfung der ständischen Rechte die fürstlichen „Kommissare“ mit diktatorischer Gewalt gespielt haben[1]. Kraft der plenitudo potestatis, einer „rechtlich prinzipiell unbegrenzten Machtbefugnis, die auch in die bestehende Rechtsordnung, die bestehenden Ämter und wohlerworbene Rechte eingreifen darf“, durfte der deutsche Kaiser nach altem Volksrecht im Not- und Ausnahmefall alles tun, was im Dienste des allgemeinen Wohls erforderlich war. „Das war der staatsrechtliche Begriff, mit dessen Hilfe der mittelalterliche Rechtsstaat und seine auf wohlerworbenen Rechten beruhende Ämterhierarchie aufgehoben werden konnten. Diesen Begriff haben namentlich Karl V. und Ferdinand II. zu benutzen verstanden, um sich gegen die deutschen Stände durchzusetzen“[2]. Ihr Werkzeug dabei waren die Kommissare, von denen uns Wallenstcin der bekannteste ist. Nun, Friedrich III. von Dänemark befand sich in der einzigen Lage, sein eigener Kommissar sein zu können.
So verging der Ständestaat, wie jede andere Staatsform der bisherigen Geschichte, an den Keimen der Zersetzung, die schon von seiner Entstehung an in ihm gewirkt hatten: an den durch das politische Mittel gesetzten groben Unterschieden des Reichtums, des Ranges, der Macht. Das gleiche Schicksal mußte mit eherner Notwendigkeit — denn die Weltgeschichte ist zwar nicht für die Individuen, wohl aber für die Gesamtheiten das Weltgericht — auch seinen Besieger und Nachfolger treffen: den absoluten Staat.
IV. Der absolute Staat. ↩
Wir haben bereits in der Geschichte der Staatstheorien darauf hingewiesen, wie jung die Staatsform ist, die uns so leicht als „der Staat“ schlechthin erscheint: der zentralisierte, bureaukratische Staat, in dem wir leben, der „rationale Staat“, wie Max Weber ihn treffend nennt. Er ist erst zu Beginn der Neuzeit „über den Europäer hereingebrochen“,
[1] Die Diktatur, S. 99.
[2] Die Diktatur, S. 17.
[591]
wie Rubinstein sagt[1] ; und auch Friedrich Meinecke spricht von dem „neuen Joch des absolutistischen Staates“, dem der mittelalterliche Mensch „in dumpfem Zorne widerstrebte“[2]. Denn der rationale Staat kam in Gestalt des Absolutismus.
Das muß richtig verstanden werden. Nicht die Bildung, wohl aber die Verwaltung und Regierung des absoluten Staates ist das Werk des Rationalismus. Chatterton Hill, der gleichfalls den Staat im modernen Sinne für „einen ganz neuen Begriff“ erklärt, macht mit Recht darauf aufmerksam, daß seine Bildung wesentlich das Produkt des Wollens, das nur in unbedeutendem Maße von Intelligenz geleitet war, gewesen ist“[3]. Weder geographische Gegebenheiten noch Sprachoder Rassenverwandtschaft waren die Gründe seiner Entstehung, sondern der Hauptsache nach dynastische Interessen. „Er entstand aus mehr oder weniger zufälligen Zusammenhängen, in denen Heiraten und Erbschaften eine große Rolle spielten, während konstruktive Gedanken verhältnismäßig wenig in Frage kamen“. Erst in den aller jüngsten Zeiten hat die Theorie Einfluß auf die Verfassung des Staates genommen.
Nicht hier liegt also der Rationalismus, von dem wir sprechen. Sondern in der Rationalisierung der gewonnenen politischen Macht, dem Bestreben allen rationalen Handelns, mit dem kleinsten Aufwände das größte Nutzergebnis zu erzielen[4].
Daß solche Rationalisierung nötig war, sollte das Leben der Gesellschaften nicht unter der Zersplitterung der Gewalten und ihren Kämpfen zugrunde gehen, sollte mindestens der neu aufkommende dritte Stand nicht in den Windeln erwürgt werden : darüber kann nach allem, was wir soeben über den Ständestaat erfahren haben, kein Zweifel bestehen. Und so hat sich denn die Rationalisierung auch außerhalb Westeuropas in solchen Staatswesen durchgesetzt, in denen sich aus der Eroberung eine Feudalität, und aus dieser der Ständestaat gebildet hatte, z.B. in Indien: „Im 15. Jahrhundert die Feudalität, die feindlichen Einfälle, die Banden von Reitern, die Fehden zwischen den Seigneurs, die volle Rüstung: Lanze, Bogen und Pfeile, eine naive und mystische Literatur, alle Bauern zu Hörigen herabgedrückt, die Städte eingeengt, die Industrie schwach entwickelt. Im 16. der große Aufschwung der Renaissance, die zentralisierte Monarchie, im Inneren Hindostans Frieden, an den Grenzen regelrechte Kriege, Kanonen, aber die Infanterie noch minderwertig und die Kavallerie noch in mittelalterlicher Rüstung; Philosophie, Poesie, Geschichte, Wissenschaften, Wißbegier, Kühnheit des Geistes; im 17. die despotische
[1] Romantischer Sozialismus.
[2] Staatsräson, S. 70.
[3] Die Völkerorganisation und der moderne Staat, S. 19/20.
[4] S. S. III, S. 28.
[592]
Monarchie, Ordnung, Ruhe, die Reiter sind geschulte Soldaten, und die Feudalherren Höflinge geworden, klassische Literatur, der Geist gesetzter und weniger aufs ganze gehend, wachsender Wohlstand, alle Zeichen einer Nation, die ihren Höhepunkt ersteigt ; im 18. der Verfall, durch Vergnügungen entnervte Herrscher, Aufstände, Kriege . . .“[1].
Wir wiederholen: die Rationalisierung der alten, völlig überlebten Staatsform war unbedingt nötig geworden: sie war längst aus Vernunft zu Unsinn, aus Wohltat zu Plage geworden. Gesetz und Rechte erbten sich wie eine ew'ge Krankheit fort: man mußte die Gesetze ändern und die Rechte brechen, um weiter leben zu können. Eine „zähe Kruste von Gewohnheits- und Privilegienrecht stand in Deutschland dem Aufstiege des modernen Staates entgegen. . . . Die neue Lehre von der Staatsräson bot den Fürsten einen Hammer, um jene Kruste aufzubrechen“[2]. Wenn dabei Unrecht geschah[3], wenn z. B. das Verfahren des großen Kurfürsten gegen seine Stände einem Röscher als „abstoßend“ erscheint[4], weil die Stände in ihrem positiven Rechte sind, und weil der Fürst ihnen unbedenklich alles mögliche verspricht, ohne es halten zu wollen, so spricht doch Röscher selbst von einem „der wichtigsten politischen Entwicklungsgesetze: Ausbildung der Staatsgewalt im Kampfe mit den kleinen juristischen Personen“[5]. „Staatswohl über Privatwohl, das war der harte und historisch fruchtbare Kern“ der neuen Lehre“[6]. Freilich unterschied man noch nicht sehr sorgfältig zwischen dem Wohl des Staates und dem Interesse seines Herrschers: es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Säkularisation der reichen Kirchengüter eine gewisse Rolle in dem Entschluß mancher Fürsten spielte, sich der Reformation anzuschließen. Heinrich VIII. von England soll auf diesem Wege sein Einkommen von 700000 Dukaten jährlich auf 1600000 gesteigert haben, während der gesamte hohe Adel von England, der freilich durch die Rosenkriege stark dezimiert war, nur auf 380000 Dukaten jährlich geschätzt wurde[7]. Und wenn Boccalini sagt: „Die Furcht vor der monströsen Macht Karls V. war die wahre Ursache der jetzigen Ketzereien“, so muß Meinecke zugestehen, trotz aller Mischung von Falschem und Wahrem „berühre die Einsicht in den Zusammenhang der Machtkämpfe gegen Karl V. mit dem Schicksal des Protestantismus doch wie eine blitzartige Erkenntnis“[8]. Aber
[1] De la Mazelière, a. a. O. S. 350ff.
[2] Meinecke, Staatsräson, S. 161.
[3] „Alle Macht ist böse“, sagt Schlosser. Zit. nach Burckhardt, Weltgeschichtl. Betrachtungen, S. 33/4.
[4] A. a. O. S. 207.
[5] A. a. O. S. 31.
[6] Meinecke, Staatsräson, S. 179.
[7] Röscher, Politik, S. 262.
[8] Meinecke, Staatsräson, S. 105.
[593]
das alles waren eben nur Nebenursachen: so konnte es nicht weiter gehen, wie das Schicksal Polens uns klar zeigt; hier war nicht mehr mit dem „medicamentum“ auszulangen: hier mußte das „ferrum“ heran. In gleicher Situation hatte auch schon in Griechenland jeder intelligente Patriot nach dem „Säbelheiland“ (Scherr) gerufen[1]. Die mittelalterliche Welt mußte revolutioniert werden; der erste Versuch dazu war der Absolutismus. „Aber diese Revolution hielt sich noch in sehr engen Grenzen; wohl brach der Absolutismus die politische Macht des Adels, wohl säkularisierte er die Politik und löste sie von den christlichen Werten. Aber er hütete sich sorglich, die ständische Gesellschaftsordnung in ihrem Kerne anzutasten“[2].
1. Die Vorbilder.↩
Die Grundlagen des absoluten Staates stammen fast durchaus aus Italien. Die päpstliche Politik und die kleinen Staaten der „Principini“ der Renaissanceperiode gaben die Modelle, die ihrerseits wieder durch die erste moderne Monarchie Europas, das sizilische Reich Friedrichs IL, angeregt worden sein könnten; dessen Einfluß auf die englische Entwicklung haben wir schon kennen gelernt: so könnten auf diese Weise auf dem Umwege über die sarazenischen Reiche alte römisch-byzantinische Regierungsgrundsätze nach Westeuropa gelangt sein. Hier bestand ein Staatswesen, das „einer Mischung von sarazenischem und spätrömischem Staate glich, d. h. einer durch eine despotische Beamtenschaft zusammengefaßten willenlosen Horde steuerpflichtiger, in ihrem Privatleben fühlbar kontrollierter Untertanen“[3].
Von Italien kamen auch die Theorien, die der Revolution den Rechtsanspruch gaben: die staatsrechtliche Theorie des Imperator als des Princeps und die Machiavellische Lehre von der Staatsräson; die dritte Lehre, die hier gewaltig einwirkte, die des Bodinus von der Souveränetät des Monarchen, stammte unmittelbar aus Frankreich, mittelbar aber, wie die der französischen Legisten und Kronjuristen, ebenfalls aus dem römischen Recht. Das soll jetzt im einzelnen näher betrachtet werden.
Es ist ein wunderbarer Zug der Geschichte, daß der erste mächtige Anstoß zur Bildung des rationellen Staates von der großen Organisation ausgegangen ist, der alle Antirationalisten der Neuzeit sich sehnsüchtig
[1] Vgl. Kaerst, S. 142 über Isokrates, S. 153 über Kallisthenes, die den Make- donier herbeisehnen, um aus der Zersplitterung und Ohnmacht herauszugelangen. „So wurde von den Vertretern tiefsten griechischen Geisteslebens das göttliche Recht wahrer Herrscherpersönlichkeit verkündet“ (S. 479). Der absolute Staat erschien den Hellenen als Rettung (487).
[2] Rohden, Weltanschauliche Grundlagen, S. 18.
[3] Jellinek, Allg. Staatsl., S. 317.
[594]
zuwendeten: der katholischen Kirche. Auch hier spielen Erinnerungen an das römische Staatsrecht und das Imperium mundi unzweifelhaft ihre Rolle: „Staatsrechtliche Betrachtung wird den Übergang vom Mittelalter zum Begriff des modernen Staates darin erblicken können, daß der Begriff der päpstlichen plenitudo potestatis zur Grundlage einer großen reformatio, einer Umgestaltung der gesamten kirchlichen Organisation wurde. Dieser Begriff wurde der rechtliche Ausdruck dafür, daß die souveräne Zentralgewalt ohne Rücksicht auf die für den mittelalterlichen Rechtsstaat charakteristischen wohlerworbenen Rechte und Privilegien am Amt, wie sie dem Amtsinhaber zustanden, eine neue Organisation schuf und das seltene Beispiel einer legitimen, auch von den Betroffenen selbst anerkannten Revolution gab, die von einem wohlkonstituierten (nicht erst durch die Revolution selbst sich konstituierenden) Organ durchgeführt wurde. Die päpstliche Souveränetät innerhalb der Kirche hat den mittelalterlichen Lehnsstaat bereits im 13. Jahrhundert überwunden. Das Wesentliche der päpstlichen Amtsgewalt liegt seit Innozenz III. darin, daß der Papst nicht mehr nur der oberste Lehnsherr der Kirche ist; ,er verfügt über ihre Einkünfte uneingeschränkt: er verteilt ihre Ämter und Benefizien nach reiner Willkür und Gnade, er ist nicht nur der oberste, er ist der alleinige Herr der Kirche. . . . Die Prälaten sind nicht mehr seine Vasallen, sondern seine Beamten, der Lehnseid ist, ohne daß seine Worte geändert wurden, zum Amtseid geworden und bleibt in der Hauptsache derselbe, ob ihn nun ein Erzbischof, ein päpstlicher Auditor oder ein Notar schwört' (Haller)“[1]. Die päpstlichen Legaten mit ihren verschiedenen Vollmachten werden die Musterbilder der späteren fürstlichen Kommissare[2], durch die, wie wir soeben gesehen haben, die Fürsten die alte Ämterhierarchie brechen und die Stände aufs Knie zwingen, kraft der plenitudo potestatis, die nun auch sie in Anspruch nehmen, voran der Kaiser, ihm folgend die Territorialgewalten.
Auf die weltliche Herrschaft übertragen wurde diese neue modernrationalistische Organisation zuerst wieder in Italien. Die selbständige Entwicklung der dortigen Städte, die wie alles Stadtwesen — wir haben es ausführlich dargestellt — sich dem magischen Tabu früh entwunden hatten, hat gewiß mitgewirkt; hier war besoldetes Beamtentum und
[1] Schmitt-Dorotic, Die Diktatur, S. 43. (Im Orig. nichts gesperrt.)
[2] „Wo der Legat war, verfügte er über die Ämter, ordinierte Bischöfe, visitierte und reformierte die Kirchen und die Diözesen, entschied in Sachen des Glaubens und der Disziplin und erließ allgemeine Statuten. Die rechtliche Grundlage dieser umfassenden Befugnisse wurde in der Weise konstruiert, daß alles, was der Legat tat, als vom Papste selbst vorgenommen betrachtet wuide, vorbehaltlich des päpstlichen Widerrufs (ib. S. 45).
[595]
rationelle Verwaltung schon entwickelt, als der Norden noch in der feudalen Naturalwirtschaft verharrte. Aber im eigentlich staatlichen Rahmen vollzog sich die grundstürzende Revolution doch erst in den Kondottieristaaten der Apenninenhalbinsel[1]. Man soll dabei nicht vergessen, daß diese Kleinstaaten vielfach von päpstlichen Nepoten begründet, oder daß ihre Fürsten durch Verschwägerung mit den päpstlichen Familien in unmittelbare fruchtbare Beziehung zu der Verwaltungskunst des Vatikans gesetzt worden waren. „Der neuere Beamtenstaat ist in vielen Ländern nach dem Muster der italienischen Tyrannis gebildet“[2]. Ein uns bekanntes historisches Gesetz wirkt sich aus, wenn dabei, wie wir erfahren, bei „vorzugsweise klugen Herrschern, wie Ludwig XL und Matthias Corvinus es Grundsatz war, die höchsten Beamten wo möglich aus niederem Stande oder aus dem Auslande zu nehmen“. Jellinek sagt: „Die ersten nachhaltigen Versuche, die Staatseinheit zu gewinnen, gehen im späteren Mittelalter von staatsähnlich organisierten Städten aus. Wiederum wird, in anderer Form freilich als der ursprünglichen, der Gedanke der Polis lebendig. In Italien hatte . . . der mittelalterliche Dualismus nie Wurzel gefaßt. Die italienischen Stadtrepubliken sind inmitten einer dualistisch gearteten Staatenwelt monistisch gestaltet. Die italienische Sfadttyrannis des 14. und 15. Jahrhunderts schafft das Bild einheitlicher, von einem machtvollen und rücksichtslosen Willen zusammengehaltener Gemeinwesen. Mit der Renaissance wird in Italien auf historisch dazu vorbereitetem Boden der moderne Staatsgedanke geboren. Der Staat, wie ihn Machiavelli sich denkt, trägt zwar viele Züge des antiken Staates, es ist aber in Wahrheit der neue Staat, der sich als schlechthin erhabene Macht über alle seine Glieder erweisen und behaupten will“[3].
2. Das neue Recht.↩
Den Rechtstitel zu dieser Umwälzung entnahm das Fürstentum, wie gesagt, dem alten römischen Staatsrecht. „Als unter Augustus und Tiberius die Staatsform sich ordnete, blieb es bei der Rechtsvorstellung, daß der Imperator seine ganze Gewalt von dem römischen Volke herleite. Die Macht des Cäsar beruht darauf, daß er in sich die ganze Staats- herrlichkeit und den Willen des Volkes vereint. . . . Das Cäsarentum ist also nie eine legitime erbliche Macht geworden; alles war im Grunde tatsächlich, wir haben hier keine Monarchie, sondern die Tyrannis“[4].
[1] Wo „das höfische Fürstentum wie eine Protuberanz in die Höhe getrieben wurde“ (Meinecke, a. a. O. S. 92).
[2] Röscher, Politik, S. 235. R. fügt ausdrücklich hinzu, daß auch die städtischen Beamten vielfach als Vorbild gedient haben.
[3] Jellinek, Allg. Staatsl., S. 322/3.
[4] Treitschke, Politik, S. 197. Vgl. Bury, a. a. O. S. 11/12.
[596]
Die diktatoriale Gewalt zur Regierung extra leges und unter Ausschaltung aller regelmäßigen Beamten, die sonst nur für Not- und Ausnahmezeiten erteilt worden war, war damit die regelmäßige Gewalt für alle Zeiten und die Regel geworden. Später hat die Erhebung des Christentums zur Staatsreligion die Abhängigkeit des Römers von der Staatsgewalt noch vermehrt. Damit trat zum ersten Male in der Geschichte der Gegensatz von Gläubigen, Ketzern und Ungläubigen in die Welt, von denen nur die ersteren volle Existenzberechtigung haben. „Wenn Prinzipat und Kaisertum die öffentlichen Rechte der Person auf ein Minimum reduziert hatten, so daß das Wesen des Bürgers schließlich beinahe nur in der Privatrechtsfähigkeit ruhte, so wird nun die bis dahin in religiösen Dingen . . . faktisch bestehende Freiheit völlig vernichtet. Der römische Staat seit Konstantin und das byzantinische Reich sind die Bildungen, auf welche allein der Satz paßt, daß das Individuum als selbständige Existenz dem Staate unbekannt ist. Niemals hat es in der Geschichte der abendländischen Völker eine Epoche gegeben, in der das Individuum mehr zerdrückt worden wäre als in dieser. ... Nur von einer, überdies kümmerlich geschützten Privatrechtssphäre umgeben, genoß der Einzelne weder Macht noch Freiheit von der Macht“[1].
Es ist klar, wie sehr dieses Recht, das zum ersten Male im Abendlande den „Untertan“ im stärksten Sinne des Wortes geschaffen hatte[2], den Fürsten der Neuzeit am Harzen liegen mußte, die ja auch, als egoistische Individuen und gleichzeitig als die unbewußten Vollstrecker unbeugsamer geschichtlicher Gesetze, gewillt und gezwungen waren, aus dem mittelalterlichen Menschen, dem eigenwüchsigsten Dinge der Welt, den sozusagen statistischen Untertanen, das namenlose, „fungible“ Baustück herzustellen, aus dem der rationelle Staat sich aufzubauen hatte[3]. Das wurde noch verstärkt durch den Wunsch oder das Bedürfnis, die Rechtsprechung den Händen der Schöffen, der Laienrichter, zu entziehen und in die Hände von Beamten zu legen: gelehrten Juristen, die man damals nur von italienischen Universitäten beziehen konnte, und die auch später ganz mit romanistischem Geiste getränkt waren. Als Beamte und werdender Adel, noblesse de la robe, waren sie den Fürsten willige Diener und Werkzeuge zur Niederwerfung des alten Adels, der noblesse de l'épée.
„Das 15. Jahrhundert ist erfüllt von dem Ringen der Sätze des
[1] Jellinek, a. a. O. S. 315/6.
[2] Vgl. Bury, a. a. O. S. 15/16.
[3] „Das Ziel der byzantinischen Bureaukratie war Gleichmachung und Uniformierung; das ganze Land sollte gleichmäßig verwaltet, alle Privilegien und Immunitäten sollten abgeschafft werden“ (Bury, a. a. O. S. 45.
[597]
Corpus juris mit der Spruchweisheit der Schöffen“[1]. „Der Juristenstand bildet sich und tritt an die Stelle der Schöffen. Allein das innere Wesen dieses Vorganges besteht nicht in dem Wechsel der Personen, sondern das Absterben des Schöffentums ist das Erlöschen des Prinzips autonomer Rechtsfindung. An die Stelle des nach subjektiver Überzeugung gefundenen Rechts tritt die formale Autorität des geschriebenen Rechts (50) . . . Vollendet hat sich dieser Übergang im Zusammenhange mit der Ausbildung des modernen Staates, die eine fundamentale Umwandlung der Gerichtsordnung zur Folge hat (51). Die längst im kanonischen Rechte durchgeführte Umwälzung, daß der Richter nicht mehr „das Recht nach seiner Überzeugung, sondern seine Überzeugung nach dem Rechte bildet“ (50), daß das Urteil die logische Subsumtion des einzelnen Falles unter die objektiv feststehende Rechtsregel ist, also dem gelehrten Juristen zuzufallen hat, erstreckt sich auch auf das weltliche Recht. Die Schöffen gewöhnen sich, den gelehrten Schultheiß (Centgraf, Vogt, Richter), d. h. den vom Landesherrn ernannten Vorsteher des Gerichts, der bisher nach altem Herkommen das Verfahren nur leitet, während die Schöffen das Recht zu finden haben, das Urteil geben zu lassen, und das Publikum gewöhnt sich von den Schöffengerichten fort und an die immer bereiten und zugänglichen Beamten hin, die zunächst als freigewählte Schiedsrichter fungieren (53/4). So verkümmert mit dem Schöffengericht das deutsche Recht, und das römische dringt immer weiter vor, das auch von den immer häufiger als Schiedsrichter und Gutachter angezogenen juristischen Fakultäten ihren Entscheidungen zugrunde gelegt wird. „Am schärfsten und klarsten zeigt sich die Ausbildung des gelehrten Richtertums in den höheren Instanzen, und zwar vollzieht sie sich mit der gleichzeitigen Ausbildung der Appellation. Ihre Durchführung ruht auf dem Gedanken eines Subordinationsverhältnisses unter den Gerichten, der in Rom ein Produkt des Prinzipats war und in Deutschland an der Hand der sich steigernden und sich konsolidierenden Fürstenmacht Raum und Eingang gefunden hat“ (54)[2]. Sie trat an die Stelle des alten Rechtszuges an die Oberhöfe und das 1495 geschaffene Reichskammergericht, deren „Stellung schwer mit den auf territoriale Absonderung und Unabhängigkeit gerichteten Strebungen der Fürstenmacht zu vereinigen war, die jeden Einfluß auswärtiger Autoritäten eifersüchtig fernzuhalten bemüht sein mußte“ (56). Seit Ende des 15. Jahrhunderts setzen die Landesherren eigene Appellationshöfe ein,
[1] Stintzing, a. a. O. I, S. 48. Auch die folgenden Ziffern in () sind Zitate aus diesem Werke.
[2] „Fürstengewalt wurde einseitig gehoben, die Richter wurden bloße Fürstendiener. So machte die fremde Sprache das Recht zum Geheimnis der Juristen; Richter und Gerichte wurden vom Volke losgerissen“ (Fries, Politik, S. 200).
[598]
die selbstverständlich mit romanistisch geschulten Juristen besetzt werden, und, gerade wie in Rom unter dem Einfluß des Prinzipats, „geht in Deutschland unter dem Ersterben altgermanischer Autonomie, dem Erstarken der Autorität des geschriebenen Rechts und der aufstrebenden Staatsgewalt, aus der Vereinigung des Richters und des Urteilers in eine Person der „Richter“ im heutigen Sinne des Wortes hervor“ (56). „Es ist also die Entstehung des modernen Staates eine Grundbedeutung dieses geschichtlichen Vorgangs, bei dem das römische Recht nicht als Ursache, wohl aber als wesentlich mitwirkender Faktor erscheint. Denn sein gefördertes Studium liefert den geschulten Beamtenstand; sein Vordringen in der Praxis gibt diesem das Übergewicht in der den Schöffen entwachsenen und verleideten Justiz; seine Grundsätze über die Rechte des Prin- zeps gewähren dem Landesherren die erwünschte Stütze und Förderung zur Ausbildung der neuen Staatsordnung“ (58). -Die Landesfürsten nehmen alsbald die Gesetzgebung ebenfalls in ihre Hand, reformieren sie nach den Bedürfnissen ihres gesonderten Staates (59) und brechen auch hier den Widerstand der partikulären Interessen.
Auch diese Usurpation war notwendig: die alten genossenschaftlichen Bindungen waren zerfallen; nicht mehr war es der mit allen Verhältnissen innig vertraute Genosse, der Recht und Urteil fand (70). Man durfte nicht, um mit Justus Moser zu sprechen, „dem ungenossen Richter eben die Macht, welche vordem die genossen hatten“, in die Hand geben. Daß dann auch dieses neue und notwendige Recht ein Werkzeug in der Hand des politischen Mittels wurde, um das Fürstentum und seine Verbündeten auf Kosten der übrigen Staatsinsassen zu erhöhen und zu bereichern, war im Klassenstaate unvermeidlich: in den Unruhen der Bauernkriege tauchte die Forderung auf, das fremde Recht und die gelehrten Juristen gänzlich zu beseitigen (69)[1]. Auch
[1] Max Weber schreibt dazu : „Man hat in der Rezeption des römischen Rechts den Grund . . . für den Untergang des Bauernstandes sehen wollen. Allerdings hat es Fälle gegeben, wo die Anwendung römisch-rechtlicher Grundsätze dem Bauern nachteilig war ; so z. B. bedeutete die Umdeutung der alten Markgenossenschaftsrechte in Servitute, daß, wer als Obermärker der Markgenossenschaft vorstand, als Eigentümer im römischen Sinne galt, und daß der Besitz der Markgenossen mit Servituten belastet wurde. Andererseits hat in Frankreich das Königtum gerade durch seine am römischen Recht geschulten Legisten den Grundherren das Bauernlegen außerordentlich schwer gemacht“ (Wirtsch.Gesch. S. 291/2). Und zwar geschah das, als man an den Steuerleistungen der Bauern Interesse gewann (ib. S. 76). Hier wirkt sich das uns bekannte Gesetz aus, daß den Bauern nur eines vor dem schlimmsten bewahren kann: die Konkurrenz mehrerer verschiedener Machtsubjekte um seine Leistung, ihr Interesse an der Erhaltung seiner Prästationsfähigkeit. Eine Rechtsänderung ist soziologisch niemals die primäre Ursache, sondern im Gegenteil die primäre Folge einer Verschiebung in der Macht der sozialen Schichten und Klassen. Vgl. unser „Großgrundeigentum“, S. 433.
[599]
hier siegte die Staatsräson, es schieden sich „die Gebiete des Glaubens und des Rechts, der ethischen Pflicht und der positiven Satzung“ (99).
Das war das neugeschaffene Recht, mit dem das Fürstentum die alte Ordnung angriff und unter dem Schein des Rechts aufhob. Aus der gleichen Quelle stammte die Staatstheorie, mit der es sich auch vor dem höchsten Tribunal, dem der Vernunft, der Wissenschaft, rechtfertigte.
Wir haben im Abschnitte von den Theorien gezeigt, daß das Natur- recht zuerst als reine Rechtstheorie auftrat, bevor es sich in eine Geschichts- und Wirtschaftstheorie wandelte. Sein erster Vertreter, Bodin, war französischer Jurist und an den romanistisch orientierten Schriften der Kronjuristen und Legisten des dort schon früh sehr mächtigen Königtums geschult. Wir kennen seine Lehre von der Souveränetät als dem eigentlichen Kennzeichen des Staates. Damit war auf der einen Seite die Einheit der Staatsgewalt als das allein der Vernunft entsprechende Postulat aufgestellt, im Geiste der Zeit, die aus der politischen Zersplitterung heraus wollte und mußte. Aber Bodin hatte andererseits, „verführt durch den Anblick des sich erhebenden Absolutismus, die Souveränetät des Staates überhaupt mit den souveränen Rechten seines höchsten Organs vermischt“[1] und auf diese Weise seine Lehre, die in ihrer Einheitstendenz wohl geeignet war, „ein Bindemittel großen Stils für den von der Auflösung bedrohten Staat“[2] zu sein, zu einer Waffe des Absolutismus gemacht. Nicht umsonst hat alsbald der berühmte französische Jurist Loyseau vom Standpunkt der „altfranzösischen feudalen Anschauung von der Gebietsherrschaft als Grundlage der Staatsgewalt“ Bodin korrigiert mit der Lehre, daß „die Souveränetät am Staate, näher gefaßt am Staatsgebiete hafte und dem jeweiligen Inhaber sich nur mitteile. So leitet er demnach die „souveraineté in concreto“ von der „souveraineté in abstracto“ ab“[3]. Die Bodinsche Lehre fand, wie wir wissen, weite Verbreitung und diente derart, dem Absolutismus entsprossen, kräftig seiner weiteren Verbreitung über die okzidentale Welt: „Der Staat wird zu einem Gemeinwesen, an dessen Spitze ein souveräner Herr steht“[4].
Und wieder aus Italien kam die letzte wissenschaftliche Stütze des Absolutismus, der Machiavellismus, zuerst mit Entrüstung offiziell abgelehnt und im Geheimen praktiziert, dann, in seiner gemilderten Form als Interessenlehre, zur Richtschnur aller Regierungskunst erhoben. Davon haben wir zur Genüge gehandelt.
[1] Meinecke, Staatsräson, S. 280/1.
[2] Meinecke, Staatsräson, S. 190.
[3] Jellinek, a. a. O. S. 460.
[4] Jellinek, a. a. O. S. 455
[600]
3. Der Verbündete: der dritte Stand. ↩
Wir zeigten oben, daß immer nur Kraft gegen Kraft, Gruppe gegen Gruppe obsiegen kann. Die Schicht oder Klasse, auf die sich das Fürstentum in seinem Kampfe gegen die Stände zuerst stützt und zuverlässig stützen kann, ist der von den Ständen ausgebeutete, politisch und gesellschaftlich zurückgedrängte und wirtschaftlich eingeengte und unerträglich gehemmte Dritte Stand.
Auch davon haben wir bereits ausführlich bei der Darstellung der Theorien gesprochen: es kann sich hier um kaum mehr handeln, als das dort Gesagte noch einmal kurz zusammenzufassen:
Dritter Stand und absoluter Staat sind Zwillinge der gesellschaftlichen Zersetzung und des aus ihr geborenen Rationalismus. „Durch das 15. Jahrhundert geht bedeutsam der Zug einer volkstümlichen Erhebung. Die unteren Stände hatten sich zur Geltung emporgearbeitet, die Städte ihre feste Stellung im Reiche, in ihnen selbst die Zünfte gegenüber dem Patriziat das gleiche politische Recht erworben. Die höfische ritterliche Poesie war zurückgetreten gegen die volksmäßige Dichtung; der Bildungsdrang bemächtigte sich der unteren Schichten. Während man die vornehme und zugleich unfruchtbare Gelehrsamkeit mit beißendem Spott verfolgt, erstrebt man die Hebung der Schulen für den Unterricht des Volks, und tüchtige Pädagogen legen den Grund zu einer allgemeinen bürgerlichen Bildung. Zugleich sehen wir, wie man seit der Mitte des Jahrhunderts wieder beginnt, deutsch zu schreiben und die Schätze der Bildung dem Volke in der Muttersprache zugänglich zu machen“[1].
Wir haben also hier eine Bewegung, die der Aufklärung zur Zeit des Altertums sehr ähnlich ist, aus den gleichen Wurzeln erwächst und leider auch den gleichen Keim der Zersetzung in sich trägt: das politische Mittel in Gestalt der Klassenordnung und der staatlichen Machtverhältnisse. Was sie dem christlichen Okzident neues bringt, ist eine Erscheinung, die dem Altertum nicht erst gebracht werden mußte : der Nationalismus, eine der Bourgeoisie typische Psychologie, die nicht mit dem älteren, guten und gesunden Nationalgefühl verwechselt werden darf, von dem sich der Nationalismus durch seine Exklusivität und seinen Angriffsgeist sehr stark unterscheidet[2]. Das Rittertum war ganz und gar international gewesen, in Sitten, genossenschaftlichem Zusammenschluß und nicht zuletzt in seiner Dichtung: jetzt kommt, gestachelt durch die Konkurrenz der nationalen Bourgeoisien um den damals noch sehr kleinen und schwachen Weltmarkt, der Nationalismus hoch; und schon dieser Zug macht den dritten Stand zum
[1] Stintzing, a. a. O. I, S. 82.
[2] Vgl. S. S. I, S. 645ff.
[601]
Bundesgenossen des Absolutismus, der ebenfalls „national“ sein muß: in den großen, geschlossenen Staaten einer Sprache und Rasse entwickelt sich der Nationalismus bereits früh in seinem modernen Sinne, während diese Verzerrung des natürlichen Heimats- und Gruppenbewußtseins in den „künstlichen“ Staaten, namentlich in in den kleinen Territorialfürstentümern vor allem Deutschlands, durch das Surrogat einer Anhänglichkeit an diesen Staat dieser Dynastie recht wirksam ersetzt werden kann. „Die ersten Fortschritte des Nationalgefühls und der Zentralisation schlugen vorzugsweise zur Stärkung der Krone aus“[1]. Es ist charakteristisch, daß der Staat zuerst versuchte, wie China aus den Humanisten seine Beamten zu bilden: hier zeigt sich der Zusammenhang mit der Aufklärung sehr deutlich. Der Versuch scheiterte, wie er mußte, und es blieben nur die Juristen übrig[2].
Was aber mehr als der gemeinsame Nationalismus die Bürgerschaft und den absoluten Staat zusammenbrachte und lange zusammenhielt, das waren wirtschaftliche Bedürfnisse beider Parteien.
Von seifen des Staates überwogen militärische Finanzbedürfnisse, und nicht bloß, wie Weber allein heraushebt, Bedürfnisse der dynastischen Außenpolitik: „Der Konkurrenzkampf der Nationalstaaten schuf dem neuzeitlich-abendländischen Kapitalismus die größten Chancen. Der einzelne Staat mußte um das freizügige Kapital konkurrieren, das ihm die Bedingungen vorschrieb, unter denen es ihm zur Macht verhelfen wollte“[3]. Auch für die Innenpolitik war der „miles perpetuus“ unentbehrlich, um einerseits die noch murrenden Stände, und vor allem, um die populace niederzuhalten. Und beide Bestrebungen des Staates waren zugleich wichtigste Interessen der Bourgeoisie, die vom Adel Gleichstellung forderte — daher auch die Bereitwilligkeit und sogar der heilige Eifer, den die Juristen im Kampfe gegen die Stände entfalteten („während des 17. Jahrhunderts haben in Preußen gerade die liberalen Bestandteile des Staates eine absolute Monarchie begründen helfen“)[4]; der gleichen Bourgeoisie, die, unkriegerisch und feig, vor den Aufruhrgelüsten des aufkommenden vierten Standes
[1] Röscher, Politik, S. 193.
[2] Max Weber, Wirtschaftsgesch., S. 293.
[3] A. a. O. S. 288/9.
[4] Röscher, a. a. O. S. 5. Vgl. Treitschke, Politik I, S. 160: „Daß in den Tagen des Großen Kurfürsten gerade der Absolutismus der Träger der Freiheit war, ist ganz unleugbar; alle Männer der Freiheit: Leibniz, Pufendorf, Thomasius, denen wir das Wiedererwachen Deutschlands verdanken, sie waren alle harte Absolutisten. Wer sind die Reaktionäre jener Zeit ? Es sind die Männer der sog. Freiheit, Konrad von Burgs- dorff und General Kalkstein, die Führer der ständischen Partei, welche den gemeinen Mann knechten wollten zum Vorteil der ständischen Interessen“.
[6θ2]
noch ängstlicher in die Arme des bewaffneten Staates flüchtete als der Adel.
Die Bourgeoisie bedurfte aber auch des neuen vom Staate geschaffenen Rechtes, wie Max Weber feinsinnig gezeigt hat. Handel und Verkehr brauchen, wie ein genau berechenbares Maß und Gewicht und ein zuverlässiges Geld, um genau kalkulieren und spekulieren zu können, so auch ein berechenbares, rationelles Recht: „rituelle und magische Gesichtspunkte dürfen keine Rolle spielen“[1]. Dieses neue, über das ganze Gebiet des Staates erstreckte, gleichmäßige und rationelle Recht konnte nur der Staat dem Bürgertum gegen die Rechtszersplitterung der Vorzeit schaffen und schaffte es ihm.
Schließlich brauchte aber auch, wie schon gesagt, die Bourgeoisie den Staat für ihre Handelspolitik, die kriegerische wie die „friedliche“ der Handelskriege, der Zollpolitik usw. Der Ausdruck dieses Bundes ist der Merkantilismus. Der Staat macht seine Großhändler und Manufakturisten reich, um Steuern von ihnen einziehen zu können, und vor allem, um das Geld ins Land zu ziehen, das vorhanden sein und zirkulieren muß, um die Naturalwirtschaft, die immer noch weithin herrscht, immer mehr abzubauen, die Geldwirtschaft bis in die Dörfer hinein zur Alleingeltung zu bringen, dadurch die fiskalische Steuerwirtschaft auf eine immer breitere und tragkräftigere Grundlage zu stellen und für Heer, Flotte und Hofluxus die Mittel zu gewinnen.
So macht denn alles die beiden Mächte, das aufkommende absolute Fürstentum und den Dritten Stand, zu Bundesgenossen: die gleiche Herkunft und die weiteste Übereinstimmung der Interessen. Und der absolute Staat ist erst zugrunde gegangen, als er, getrieben von seinem anderen Erbteil, das aus dem politischen Mittel stammt, das Bündnis löste und versuchte, den alten Alliierten zu fesseln und in seinem wirtschaftlichen Aufschwung zu lähmen.
Dazu mußte es aber früher oder später kommen. Zunächst wurden den Bürgern die politischen Rechte genommen, gerade das, was sie zu Bürgern im eigentlichen Sinne machte. Das war unvermeidlich: man konnte den Städten die Sonderrechte nicht lassen, die man dem Adel genommen hatte[2]. Die Egalisierung, Nivellierung und Normalisierung von Menschen zu Untertanen mußte, einmal begonnen, auch vollkommen durchgeführt werden. Zu dem Zwecke verbündete sich das Fürstentum mit dem ihm ohnehin urverwandten, aus der gleichen Wurzel entsprossenen Adel, dessen Rest, den trotzigeren, noch nicht zu Höflingen
[1] Weber, ib. S. 293.
[2] „Den Adel hat er gefressen schon / jetzt will er zu den Städten gon / Den setzt er auf ein neuen Zoll / Sag' an, du Wolf, wann bist du voll“ (Hütten, zit. nach Mitscherlich, a. a. O. S. 137).
[603]
gewordenen Teil, es dadurch zu sich herüberzieht. Es kommt zu einem Bündnisvertrag oder Friedensschluß, in dem der Adel als offizieller Mitinhaber der Staatsgewalt feierlich abdiziert, um die Mitregierung in anderer Form gewährleistet zu erhalten: als die nächste Umgebung und die hohe Beamtenschaft des Herrschers in Militär- und Zivilverwaltung.
In diesem Vertrage liefern sich Krone und Adel zunächst den Bauern gegenseitig aus, teilen ihn sozusagen in zwei ideelle Hälften: die Krone bestätigt dem Adel die bereits in der Ständezeit von ihm erpreßten Vorteile und räumt ihm womöglich noch neue ein; der Adel erhält auf diese Weise den größten Teil des Bauernlandes und den größten Teil der Arbeitskraft der nicht ausgetriebenen, noch auf ihrer Scholle seßhaften Bauern. Vielfach kommt es zur Neueinführung der längst verschollenen Leibeigenschaft. Dafür bewilligt der Adel der Krone die Rekrutenaushebung und das Recht der Besteuerung der Bauernschaften und der tief gehaßten Städte. Der Bauer, der bereits in der Freiheit stolz und reich geworden war, sinkt in Armut und Verachtung zurück[1].
Die Städte als politisch selbständige Machtfaktoren werden durch die nunmehr verbündeten feudalen Gewalten unter das Knie gebogen, wo sie nicht selbst schon, wie in Oberitalien und der Schweiz, Landesherren geworden sind. Auch dann verfallen sie zumeist noch der Herrschaft der Kondottieri. Die Angriffsmacht der Gegner ist größer, ihre eigene Widerstandskraft geringer geworden. Denn — wer Bauern zerstört, zerstört Städte! — mit der Kaufkraft der Bauern verfällt die „Gewerbsstadt“. Die kleinen Landstädte veröden und verarmen genau wie unter den gleichen Umständen im Römerreich, und verfallen um so mehr und leichter dem Absolutismus, als mit der kapitalistischen Zersetzung der „feindliche Wettbewerb“[2] wie zwischen den einzelnen Kapitalisten auch zwischen den Städten einsetzt, den alten „genossenschaftlichen Geist“ zerstört und die alten siegreichen Einungen und Hansen zur Auflösung bringt. Die größeren Städte, vor allem die Haupt- und Residenzstädte, werden mehr und mehr zu „Kaufstädten“, in denen Hof und Adel ihre Einkünfte aus Rente und Steuern verzehren So wird ihre Bürgerschaft an der Beute beteiligt und verliert die Lust, ihre alten politischen Rechte zu schützen, hätte auch jetzt nicht mehr die Kraft dazu: denn sie ist jetzt in einem ungeheuren Maße, wie nie zuvor, auch in der Zeit der Zunftkämpfe nicht, sozial zerklüftet. Denn die Masseneinwanderung, die sich jetzt in ihre Mauern ergießt: entlassene Gardisten, gelegte Bauern, verarmte Handwerker der Klein-
[1] „Manches Opfer mußte dabei auch den Ständen gebracht werden. Die Preisgabe des Bauernstandes wog vielleicht am schwersten“ (Spangenberg, a. a. O. S. 193).
[2] S. S. III, S. 948ff.
[604]
städte, ist eine proletarische. Zum ersten Male erscheint der „freie Arbeiter“ der Marxschen Terminologie massenhaft auf dem städtischen Arbeitsmarkt: und nun tritt wieder das „Gesetz der Agglomeration“ in Wirkung und zerklüftet die Bürgerschaft in schweren Klassenkämpfen, durch deren Ausnützung der Landesherr fast immer die Herrschaft erringt. Nur wenige echte Stadtstaaten, „Seestaaten“, können sich dieser Umklammerung durch das Fürstentum entziehen: in Deutschland die großen Handels-, namentlich die Seestädte.
Die Bürgerschaft ertrug ohne viel Murren, daß man ihren Städten geradeso die ständischen und sonstigen Sonderrechte nahm wie dem Adel: die einzige Freiheit, die sie wollte, war die des Geldverdienens. Riehl sagt spitzig: „Es ist eine beachtenswerte Erscheinung, daß der vormärzliche Polizeistaat, der gar keine Freiheit, und am wenigsten keine politische, gelten lassen wollte, die absolute Gewerbefreiheit ganz allein in seinen Schutz nahm“[1]. Er hat freilich auch recht, wenn er sagt, die zentralisierende Staatsgewalt „glaubte abstrakte Untertanen schaffen zu können, und schuf doch lediglich höchst konkrete Philister“[2].
4. Die Werkzeuge: die Beamtenschaft. ↩
Die Werkzeuge, deren sich das Fürstentum bediente, um den rationalen Staat zu schaffen, waren seine Beamten; und zwar nicht mehr die Amtsinhaber der alten Zeit, sondern Beamte im modernen Sinne: mit Geld besoldete, auf Beförderung angestellte, der Kündigung ausgesetzte und daher vom Staat und seinem Oberhaupt abhängige Beamte, vor allem anderen die Offiziere des stehenden Heeres, die nicht mehr Unternehmer eines militärischen Großbetriebs, nicht mehr Kondottieri und seine Unterangestellten sind, sondern in feste staatliche Stellung gelangen, — und zweitens die Juristen, die als Richter und Verwaltungsbeamte immer mehr die alten Funktionäre verdrängen.
Die Entstehung dieser neuen Bureaukratie ist eine Erscheinung von größter historischer Bedeutung. Wir haben oben den Hexenkreis dargestellt, den der naturalwirtschaftliche Feudalstaat ohne möglichen Ausweg zwischen Ballung und Zerfall durchlaufen mußte, solange er darauf angewiesen war, die Beamten mit „Land und Leuten“ auszustatten und dadurch zu selbständigen Machtfaktoren aufzufüttern. Diesen Hexenkreis hat die Geldwirtschaft durchbrochen. „Mit Hilfe des neueren liquideren Soldmittels konnte nunmehr ein neuer abhängigerer Kriegs- und Beamtenstand aufgestellt werden. Seine terminweise Auszahlung gestattete demselben nicht ferner, sich von dem gemeinsamen Soldherren unabhängig zu machen und selbst
[1] Die bürgerl. Gesellsch., S. 257.
[2] Die bürgerl. Gesellsch., S. 225; vgl. S. 230/1.
[605]
wider ihn zu kehren“[1]. Von jetzt an ist einer straff zentralisierten Regierung die Dauer ermöglicht, und Reiche entstehen, wie sie seit den geldwirtschaftlich entfalteten Landstaaten des Altertums nicht mehr existiert hatten, Großreiche von bedeutender Ausdehnung und Bevölkerungszahl, die zusammengefaßt blieben, auch nachdem der Absolutismus sein Ende gefunden hatte.
v. Below[2] ist der Ansicht, daß die Ausbildung der Geldwirtschaft allein diesen Wandel nicht erklären könne. Wir wollen die Mitwirkung anderer Faktoren auch durchaus nicht leugnen, glauben aber doch, diesen stärker betonen zu müssen, als v. Below zugeben zu wollen scheint. Er meint, um die Mitte des II. Jahrhunderts hätte der Kaiser bereits Geldsteuern haben können; wir fragen dagegen: überall im Reiche? Und vor allem: in genügender Menge? Wir glauben, daß daran gezweifelt werden darf. Allenfalls im äußersten Westen war damals schon städtisches Wesen ausreichend entwickelt, um die Steuern der Hauptsache nach auf Geld stellen zu können: und die von hier eingehenden Geldmittel hätten kaum hingereicht, um die Finanzbedürfnisse des riesenhaften Reiches zu decken[3].
Die Umwälzung der politischen Kräftekonstellation hat sich denn auch, soweit wir zu sehen vermögen, überall an die Ausbildung der Geldwirtschaft angeschlossen, mit einer einzigen Ausnahme, die uns aber die Regel in geradezu wunderbarer Weise zu bestätigen scheint: Ägypten. Hier ist, wie wir wissen, geprägtes Geld erst sehr spät, in hellenischer Zeit, zum Umlaufe gelangt; bis dahin leistet der Bauer Naturalzinse[4] ; vielleicht haben wie in Sinear private, schekelartige Gewichtsmünzen zirkuliert[5]. Dennoch finden wir schon früh, und völlig ausgebildet nach der Austreibung der Hyksos, den zentralisierten Beamtenstaat: „Die militärische Macht wird durch auswärtige Söldner gestützt, die Verwaltung durch ein in der Hand des Königs zentralisiertes Beamtentum geführt, die Lehensaristokratie ist verschwunden“[6].
Aber, wie gesagt, die Ausnahme bestätigt die Regel. Ägypten ist ein Land von einzigem geographischen Charakter. Schmal zwischen Wüste und Gabirge eingepreßt — das Kulturland beiderseits des Nil ist von Kairo bis Assuan nur 10 Kilometer breit[7] — wird es in seiner
[1] Eisenhart, Gesch. d. Nat.-Ök., S. 9.
[2] Deutscher Staat des Mittelalters, S. 338ff.
[3] Zur Anmerkung auf S. 442 möchten wir zu bedenken geben, daß Karl der Große damals noch Westfrancien und Italien mit nicht völlig verfallener Geldwirtschaft zur Verfügung hatte, Otto I. aber nicht.
[4] Thurnwald, a. a. O. S. 773.
[5] Vgl. Ed. Meyer, Gesch. d. Altertums, I S. 161.
[6] Thurnwald, a. a. O. S. 699.
[7] Ratzel, Anthropogeographie II, S. 63.
[606]
ganzen Länge von einer natürlichen Straße durchzogen, die dem Transport von Massengütern viel weniger Widerstand entgegenstellt als selbst die prächtigste Landstraße, ja, sogar als die Eisenbahn: der Nili Denn stromab, nach Norden, trägt die Strömung, stromauf aber, nach Süden, treiben die Schiffe die täglich wehenden kräftigen Winde, die die durch die Sonnenbestrahlung bewirkte tägliche Luftverdünnung über den Wüstenstrecken vom Mittelmeere her ansaugt.
Diese einzige Straße, die nicht nur trägt, sondern sogar bewegt, ermöglichte es dem Pharao, die Steuern der sämtlichen Gaue in seinen Magazinen, den „Häusern“[1], (von denen noch die Josephsage eine Erinnerung bewahrt hat) zu speichern und damit von hier aus Garnisonen nnd Zivilbeamte in naturalibus zu besolden. Im alten Reiche war das noch nicht geschehen: „Die Pharaonen des Alten Reichs haben im selben Umfang wie die Könige der romanischen und germanischen Staaten des Mittelalters die hohen Beamten und Günstlinge, die angeseheneren Frauen des Harems und die Prinzen mit Land und Leuten ausgestattet“[2]. Im neuen Reiche aber ist es anders: „Wir finden hier ein Magazinsystem, das aus den Naturalabgaben der Untertanen gespeist wird, und daneben weitgehende gewerbliche Spezialisierung des Handwerks für den Haus- und den politischen Bedarf des Königs. Der Beamte wird aus einem Magazin in Naturalien bezahlt, bekommt also ein bestimmtes Deputat, und die Anweisungen darauf laufen ebenso im Verkehr um wie etwa heute eine Staatsschuldenverschreibung“ [3].
So lange dieses Magazinsystem aufrecht stand, das selbstverständlich politischen Gefahren in ungleich höherem Grade ausgesetzt ist als eine tief ins Volksleben eingewurzelte Geldwirtschaft — ein Usurpator kann sich beispielsweise der in seinem Bezirk befindlichen Magazine bemächtigen und damit das ganze System zerbrechen oder doch schwer erschüttern —, so lange, und im wesentlichen bis zur neuen Fremdherrschaft der Perser, ist Ägypten ein zentralisierter Einheitsstaat geblieben. „Der Umstand, daß im Zustande der Naturalwirtschaft der Herrscher unmittelbar und ausschließlich über Genußgüter verfügt und von den genannten Einkünften nur eine solche Menge und solche Art von Gütern an seine Beamten abgibt, wie es ihm wünschenswert und nützlich erscheint, und die Verteilung der Luxusgüter ebenfalls fast ausschließlich in seiner Hand ruht, ist die Quelle seiner ungeheuren Machtfülle“[4].
Es ist übrigens geschichtlich interessant, daß sich im Reich der
[1] Thurnwald, a. a. O. S. 709.
[2] Ed. Meyer, a. a. O. S. 196.
[3] Max Weber, Wirtsch.-Gesch., S. 119.
[4] Thurnwald, a. a. O. S. 711.
[607]
Marotse, das an einem weitverzweigten Flußsystem lag, ähnliche Verhältnisse und Institutionen vorfinden. Die an den Flüssen wohnenden Untertanen liefern Nahrungsmittel, die fernerab wohnenden höherwertige Industrieprodukte, die einen geringeren „relativen Transportwiderstand“ leisten[1], und die tributpflichtigen Jägerstämme, die Wild zu liefern haben, müssen von den Grenzen ins Land ziehen, weil Wild, das sehr schnell verdirbt, allzu großen „aktiven Transportwiderstand“ leistet[2].
Mit der einen Ausnahme also Ägyptens, wo ein gewaltiger Strom die Aufgaben der „Zirkulation“ löste, hat wohl immer die Geldwirtschaft den Übergang vom Feudal- zum absoluten zentralisierten und standfesten Staate bewirkt, und zwar, um es zu wiederholen, durch die Möglichkeit, ein besoldetes und daher abhängiges Beamtentum zu schaffen.
Daß diese Neuschöpfung eine politische Notwendigkeit erster Ordnung, eine vitale Notwendigkeit war, haben wir bereits gefunden. Wo immer ein ehemaliger Landstaat sich mit geldwirtschaftlichen Insti- stitutionen durchdringt, mußte das geschehen. So z. B. schon im makedonischen Reiche. „Einem mit unbedingter Machtvollkommenheit und mit dem Bewußtsein souveräner Selbstherrlichkeit das staatliche Leben beherrschenden Bürgertum gegenüber erhob sich mit zunehmender Deutlichkeit und Bestimmtheit der Gedanke eines sachverständigen Beamtentums, das die Regierung des Staates übernehmen sollte. . . . Die Idee eines solchen, technisch für die Leitung des Staates vorgebildeten Beamtentums stand besonders in innerer Beziehung zum monarchischen Gedanken“[3].
So finden wir denn auch im Reiche Alexanders, im scharfen Gegensatz zu den orientalischen Vorgängern, von denen es in anderer Beziehung so vieles übernommen hatte, „einen wesentlichen Fortschritt der Reichsorganisation als solcher. Der innere Zusammenhang, den der große Herrscher seinem Reiche zu geben trachtet, spricht sich in einer strafferen Ausbildung der Verwaltung, einer energischeren Konzentration der Reichsgewalt aus. Die Verwaltung wird durch ein wirkliches Beamtentum repräsentiert, das, im Auftrage des Königs handelnd, ausschließlich dessen Herrschaftsrecht vertritt. Diese Beamten sind nichts anderes als Organe der zentralen königlichen Reichsgewalt“[4].
[1] S. S. III, S. 274.
[2] Richter, Die Marotse, S. 119ff. R. selbst kommt (S. 140) unseren allgemeinen Anschauungen recht nahe. Übrigens finden wir im Reiche Sepopas und Lewanikas zwar noch keine ausgesprochene Geldwirtschaft, aber doch schon eine starke Durchdringung mit europäischen Waren, und selbstverständlich das Handelsmonopol der Herrscher, namentlich mit Gewehren (ib. S. 140ff.).
[3] Kaerst, a. a. O. S. 117/8.
[4] Kaerst, a. a. O. S. 475.
[608]
Und so geht ja auch im späteren Römerreich die Militär ge wait ganz an Offiziere, und die Zivilgewalt ganz an Beamte über.
Der Versuch mußte in der Antike überall zuletzt scheitern, weil die Geldwirtschaft doch nur ein dünner Firnis über der im Inneren der Staaten überall noch ungebrochen herrschenden Grundherrschaft und Naturalwirtschaft war. Das haben wir vom Reiche der Seleukiden oben gehört, und das war auch das Schicksal des Römerreichs im späten Kaisertum. Aus demselben Grunde scheiterte Karl der Große mit seinem von tiefster staatsmännischer Einsicht zeugenden Versuch, sein ungeheures Reich auf geldwirtschaftliche Grundlagen zu stellen.
Im Okzident aber des Mittelalters ist nicht mehr bloße „Küstenkultur“ vorhanden, sondern die Geldwirtschaft hat mit der Entfaltung der auf der bäuerlichen Kundschaft aufgebauten Gewerbsstadt auch das Binnenland durchdrungen, und jetzt erst ist die Zentralisierung mit Hilfe einer besoldeten Beamtenschaft für alle Dauer möglich geworden, und ist in der Tat keine Kraft mehr erkennbar, der es gelingen könnte, die einmal zentralisierten Staaten wieder in Splitter zu zerschlagen. Sie werden sich durch alle Peripetien hindurch halten, — bis sie dereinst vielleicht die Gliedstaaten eines größeren Ganzen bilden werden.
Von jetzt an ruht der absolute Staat sicher auf seinen Beamten: den Offizieren des stehenden Heeres und den Juristen, dem neuen Stande, „der nicht mehr ein Werkzeug kirchlicher Macht, sondern Vertreter weltlicher Autorität, Diener und Beamter des Staates ist, der durch ihn zum festgefügten Organismus ausgebildet wird“[1]. „Im Organismus des Reichs und der Territorialstaaten haben die Juristen ihren festen Platz eingenommen; Justiz und Verwaltung liegen in ihren Händen, das Staatsleben bewegt sich in juristischen Formen“[2]. In den protestantischen Staaten tritt als dritter im Bunde neben den Offizier und den Juristen der Pfarrer, der gelehrte Theologe.
Nun bestand der dritte Stand im verarmten Deutschland nach dem dreißigjährigen Kriege fast ausschließlich aus diesen akademisch gebildeten Bsamten, da die Keime des großen Unternehmertums vernichtet waren und sich nur langsam neu entwickelten[3]. Es kann daher nicht wundernehmen, daß der dritte Stand in Deutschland (zu dem, gering an Zahl, aber bedeutend an Gewicht, auch noch die Juristen und Theologen der Universitäten und ihre Kollegen von den beiden anderen Fakultäten traten), und daß die von den Akademikern gelenkte öffentliche Meinung „den Siegeszug des fürstlichen Absolutismus begleitete — denn vorwiegend von Juristen, daneben von Theologen
[1] Stintzing, a. a. O. I, S. 60.
[2] Stintzing, a. a. O. I, S. 650.
[3] Vgl. S. S. I, S. 38/9.
[609]
und Schulmännern rührte sie her“[1]. Und so verstehen wir denn auch, daß der scheinbar gar nicht mehr zu übertrumpfende Absolutismus eines Hobbes denn doch durch einen deutschen Juristen, den fürstlich- Oettingenschen Hof rat Johann Elias Keßler, noch übertroffen wurde[2].
Je weiter der absolute Staat seine Macht dehnte, um so enger schlang er die Fessel um seine Funktionäre. In Frankreich wurde erst von Colbert und Letellier von 1661 an der Grundsatz durchgeführt, daß „alle Ämter direkt im Namen des Königs besetzt wurden, nicht von den Gouverneurs, Generalobersten usw.“[3].
Darüber hinaus ging überall das Bestreben der absoluten Monarchen dahin, den Adel aus einem Stande in einen bloßen Rang zu verwandeln, in einen Beamtenadel, ein Bestreben, das freilich nur in Rußland vollkommen geglückt ist[4]. Diesem Zwecke diente z. B. die Maxime, Offiziere nur dem Adel zu entnehmen, der bis auf die Niederlage von Jena das preußische Offizierkorps fast ausschließlich zusammensetzte und auch später noch, wie bekannt, in ihm die Hauptrolle spielte. Diesem Zwecke aber diente ferner und vor allem die Hebung der obersten Schichten des Bürgertums einer- und die Herabdrückung des Adels durch einen, wenigstens in seinem eigenen Sinne, Mißbrauch der Nobilitierungsbefugnis andererseits.
Das erstere geschah durch die bereitwillige Annahme „der in Italien ausgebildeten Theorie, daß die Doktoren der Rechte den Adel besäßen. Niemand bestritt, daß sie als milites legalis militiae“ (der Ausdruck allein spricht Bände) „der vornehmsten und privilegierten Klasse der Ritterbürtigen gleichständen“ [5]. Was aber die Praxis der Nobilitierung anlangt, so berichtet Riehl, der Romantiker, amüsante Tatsachen: „Die Fürsten selber, denen die Macht einer selbständigen Aristokratie im 16. Jahrhundert freilich noch lästig genug gewesen ist, unterstützen nach Kräften diese destruktive Auffassung, welche in dem Adel bloß den Rang erblickt. Ihre Nachfolger adelten demgemäß eine Menge von Personen, denen alle Qualität zum echten Aristokraten abging. Ein preußischer Tranchiermeister wird beispielsweise in den Grafenstand erhoben, weil er sich, wie es im Diplom heißt, „mit seinem sehr künstlichen Tranchieren aller Orten beliebt gemacht“. „Kammerdiener werden geadelt“[6]. Die Vorurteile des Bürgers gegen den Adel „datieren fast sämtlich aus dieser Periode, namentlich das oberste und gefährlichste dieser Vorurteile, daß der Adel gar keinen besonderen gesell-
[1] Meinecke, Staatsräson, S. 164.
[2] Meinecke, Staatsräson, S. 170.
[3] Röscher, Politik, S. 237.
[4] Röscher, Politik, S. 198/9. Vgl. über Byzanz Burg, a. a. O. S. 20.
[5] Stintzing, a. a. O. I, S. 61.
[6] Riehl, a. a. O. S. 168/9.
[610]
schaftlichen Beruf mehr habe, daß er einen bloßen Rang bezeichne“ (ib. S. 169). Man glaubt fast, hier Bonald zu hören, dessen Lieblingsidee war, reichgewordene Bürger in den Adel aufzunehmen, um dessen Standespflichten — Rechte erkennt er kaum an — zu übernehmen.
Wir wollen noch einmal daran erinnern, daß die besten Werkzeuge der Durchsetzung des Absolutismus gegen die ständischen Rechte die nach dem Muster der päpstlichen Legaten gebildeten außerordentlichen Kommissare waren. „Den politischen Sinn dieses Verfahrens hat der bedeutendste und konsequenteste Vertreter des modernen Staatsgedankens im deutschen 17. Jahrhundert, Wallenstein, mit aller Offenheit ausgesprochen, als er sagte, er sähe es ,vom Grund seines Herzens gern', wenn die Stände ,difficulteten' machten, ,denn dadurch verliehreten sie alle ihre privilegia'“[1]. Freilich konnte diese angemaßte Befugnis nur dort wirklich zum Recht werden, wo die Macht in Gestalt des Heeres hinter dem Anspruch stand. Diese Macht hatte in der Regel in Deutschland nur der Landesherr, nicht aber der Kaiser, der die militärische Aktion, die der Achterklärung zu folgen hatte, den Fürsten des Kreises übertragen mußte, dem der ungehorsame Stand angehörte. „Der Befehlshaber der Aktion hatte zwar auch eine commissio, blieb aber unabhängig und hielt sich an die Exekutionsordnung, die ihm eine eigene Politik und Rücksicht auf seinen Gegner und seine eigenen Interessen ermöglichte. Gerade das, was den Kommissar zu einem brauchbaren Instrument machte, fehlte ihm demnach . . . Als Wallenstein dem Kaiser ein eigenes Heer geschaffen hatte, war es möglich, auf der formalen Grundlage der Exekution der Reichsacht die Souveränetät des Kaisers im Reich zu begründen. Die Stände haben diese Gefahr erkannt und zu beseitigen gewußt. Dagegen hat der Kaiser in seinen Erblanden Böhmen und Österreich mit Hilfe einer Exekution seine absolute Macht durchgesetzt“[2] also ebenfalls nur als Landesherr. Wallenstein nannte Tilly verächtlich den ,Sklavo der bayrischen Commissarii' (ib. S. 72).
5. Formen und Ausgang. ↩
Röscher unterscheidet drei Hauptformen des neuzeitlichen Absolutismus, die ihm gleichzeitig als Entwicklungsstufen gelten: den konfessionellen, vom Anfang der Reformation bis zum Ausgang des dreißigjährigen Krieges, den höfischen, schließlich den aufgeklärten[3]. Als die typischen Vertreter des ersten nennt er Philipp von Spanien und Ferdinand IL, des zweiten Ludwig XIV. und Friedrich I. von Preußen, des dritten Friedrich II. und Joseph II.
[1] Schmitt-Dorotic, Die Diktatur, S. 59.
[2] Schmitt-Dorotic, a. a. O. S. 63/4.
[3] A. a. O. S. 251.
[611]
Treitschke hat vier Stufen, die in ihren letzten drei Gliedern mit den Roscherschen übereinstimmen: er setzt ihnen eine erste voran, „in welcher der Herrscher als Friedensstifter und Einheitsbringer, zumal in Frankreich auftritt“[1]. Ihr folgt die von ihm sog. „theokratische“ Stufe, vertreten vor allem „durch den Mönch-König Philipp II. in seinem Esconalkloster“, dann der, wie bei Röscher, als höfisch bezeichnete Absolutismus ebenfalls mit Ludwig XIV. als Hauptvertreter, und dann, diesem gegenüber, „in dem der edle Geist der absoluten Monarchie völlig entartet“ sei, der aufgeklärte Despotismus, die edelste Form, die einzige, die Preußen kennen gelernt habe: „denn in der Zeit, da theokratische Gedanken auch Brandenburg beherrschten, hatten wir keine absolute, sondern eine ständisch beschränkte Monarchie, in der die Fürstengewalt aufs äußerste beschränkt war“[2]. Wenn man selbst das letztere zugeben will, obgleich die Religionsverfolgungen offenbar vom Kurfürsten und nicht von den Ständen ausgingen, so ist doch die Tendenziosität der Darstellung dadurch gekennzeichnet, daß die Zeit Friedrichs I. übergangen ist. Es scheint doch, als wenn unsere Anschauung, daß die Geschichtsschreibung eine deskriptive Ideallehre ist, wenigstens für einige der bekannteren Historiker nicht ganz grundlos wäre.
Uns ist wichtiger als diese Versuche, die lebendige Bewegung in äußerlich gewonnene Kategorien einzupressen, die vom Gedanken der Entwicklung beherrschte Anschauung Meineckes, die wir schon in der Betrachtung der Staatstheorien wiedergegeben haben. Je mehr der Staat sich in die Breite dehnt und an Macht gegenüber den alten Gewalten innerhalb seiner Grenzen erstarkt, um so weniger braucht es noch der krassen Methoden der Staatsräson, die die kleinen und schwachen Stätchen der italienischen „Zaunkönige“ nicht hatten entbehren können, um der übermächtigen Granden im Inneren Herr zu werden. Je mehr ferner im Norden der dritte Stand erstarkte, und je mehr seine Bedeutung für die Finanzen und durch sie für die Macht des Staates im ganzen erkennbar wurde, um so mehr mußte sich und konnte sich das Staatswesen zum Wohlfahrtsstaat, und sein Herrscher zum „ersten Diener“ des Staates ausbilden. Je mehr sich endlich das Papsttum mit dem Verluste seines Einflusses auf das nördlich-germanische Europa abfand, je mehr es, angesichts des nationalen Zusammenschlusses und der gewaltigen Machtentfaltung der Großstaaten, auf seinen Traum der geistlich-weltlichen Weltherrschaft verzichtete, um so mehr konnte der Staat im Inneren religiöse Toleranz üben. Freilich wurde dieser Fortschritt mit einem schweren Preise bezahlt: alle Ansätze zu einer politischen Einigung Europas, die im Katholizismus gelegen hatten,
[1] Politik II, S. 112.
[2] Politik II, S. 116.
[612]
verkamen: „Die isolierten Machtstaaten, allein noch miteinander verknüpft durch ihre ineinander greifenden Ambitionen, dahin hatte es· die Entwicklung des europäischen Staatenlebens seit Ausgang des Mittelalters gebracht. Die gesamteuropäischen Ideen, mit denen Wilhelm von Oranien gewirkt hatte, waren durch die Sonderegoismen der einzelnen Staaten rasch ausgehöhlt worden. . . . Gerade Friedrichs Eingreifen hatte diesen Prozeß beschleunigt und die Ideologie eines europäischen Gesamtinteresses vollends um ihren Kredit gebracht“[1].
Damit wurde politisch, wie mit dem aus gleichen Wurzeln wachsenden aggressiven Merkantilismus ökonomisch, der Keim jener furchtbaren Krankheit in den Leib Europas eingebracht, die ihre vorläufige Höhe im Weltkriege erreicht hat und vielleicht seinen Untergang noch ganz herbeiführen könnte.
Aber das darf uns nicht abhalten, die großartigen Fortschritte anzuerkennen, die der absolute Staat gerade als Vertreter des Rationalismus den Völkern gebracht hat. Er hat, wenigstens in seinen Anfängen, die Wirtschaft und damit den Reichtum gewaltig vermehrt und damit die Bedingungen geschaffen, unter denen in einer hoffentlich nicht allzu fernen Zukunft ein wirkliches Staatsbürgertum entstehen kann, das die Gesamtheit der Staatsinsassen und nicht mehr bloß eine schmale Schicht umfaßt. Er hat diesem Staatsbürgertum der Zukunft die Hindernisse aus dem Wege geräumt, die als Reste der alten Gewalt- und Eroberungsstaaten noch bestanden — mit einer verhängnisvollen Ausnahme: der Bodensperre in der Rechtsform des massenhaften Großgrundeigentums. Davon werden wir noch sehr ausführlich zu handeln haben.
Diese letzten Schritte konnte der Absolutismus unmöglich tun. Zu tief wurzelte er in der primitiven Gewalt, die seine Rechtsvorgänger und ihn selbst geschaffen hatte. Auch der absolute Staat ist, gerade wie seine Vorstufen: der primitive Eroberungsstaat, der Lehens-, der Feudal- und der Ständestaat, ein Klassenstaat, d. h. eine Rechtseinrichtung, einer unterworfenen Schicht aufgezwungen durch eine Herrenschicht mit dem Zwecke, die Unterworfenen zugunsten der Oberen so hoch und so dauernd wie möglich zu besteuern. Auch in ihm wirkt die primitive Sünde der Verletzung der Gerechtigkeit, der Gleichheit der Würde der Person, als das Gift, das ihn zerstören muß: denn es wird immer dabei bleiben, daß die Gerechtigkeit der Staaten Grundbau sein muß, und das in einem weiteren Sinne als dem üblichen, der nur die Wahrung des positiven Rechts im Auge hat.
Kraft dieses seines Ursprungs aus der Gewalt hat der absolute Staat zunächst in der Außenpolitik Bahnen verfolgen müssen, die
[1] Meinecke, Staatsräson, S. 403.
[613]
ihn auf die Dauer als Staatsform zerstören mußten. Wo nichts mehr galt als das Interesse der regierenden Familien, das mit der salus publica naiv gleichgesetzt wurde, da konnte es selbstverständlich der dynastischen Kriege kein Ende geben: es beginnt die Epoche der „Erbfolgekriege“, zu denen sich die großen Kämpfe um den Kolonialbesitz gesellen. Sie stellen ungeheure Ansprüche an die Staatsfinanzen und somit an die Steuerkraft der nicht steuerlich privilegierten Klassen; und wenn auch der tiefgedrückte Bauer schweigend blutet und zahlt : die Bourgeoisie wird durch das System an ihren beiden empfindlichsten Punkten getroffen: am Beutel und am Prestige. Sie lehnt sich immer mehr gegen eine Staatsform auf, die den Adel und den Klerus praktisch steuerfrei läßt und alle die ungeheuren Lasten ihr allein zuschiebt, und die doch gleichzeitig alle Ehre und alle Vorteile dem Adel zuwendet.
Damit sind wir auf die Innenpolitik gekommen, die an dem gleichen Erbübel krankt. Alle Macht ist böse: diese Macht der Fürsten ist aber außerdem so ungeheuerlich unbeschränkt, daß keine normale menschliche Seelenkraft ihren Versuchungen widerstehen kann. Ein maßloser Hofluxus für Festen und Bauten, für Maitressen und Kreaturen aller Art ruiniert die Finanzen vollends, eine hemmungsfreie Willkürwirtschaft bereichert durch Pensionen und Geschenke die Hofkamarilla und schädigt und beleidigt das aufstrebende Bürgertum, das von dem übermütigen Adel zurückgestoßen und in jeder Weise gekränkt wird.
„Militarismus, Nationalismus, Kapitalismus heißen die drei Gewaltigen“, die den modernen Staat herbeigeführt und den absoluten Staat gestürzt haben, sagt Meinecke mit Recht[1]. Aber diese Trias ist aus einer Wurzel erwachsen. Zwar ist der ältere Militarismus so alt wie der Staat, aber der neue, der erst so recht die gewaltigen Machtkämpfe der Staaten ermöglicht, ist bereits ein Kind der kapitalistischen Revolution : der Staat des allgemeinen Aufgebotes, des Volksheeres. Von dem Augenblicke an, wo er nötig wurde, war auch in den noch absolutistischen Staaten die Beteiligung des ganzen Volkes an den politischen Rechten auf die Dauer so wenig mehr zu verhindern wie unter den gleichen Umständen in Athen und Rom.
Nationalismus und Kapitalismus aber sind im Grund eines: die Psychologie des ins Riesenhafte gewachsenen Dritten Standes, des Zwillings des absoluten Staates, gleich ihm gezeugt aus der unheimlichen Ehe von „Kratos und Ethos“. Wir wissen, daß Gruppe immer nur von Gruppe besiegt werden kann: diese Gruppe wurde immer gebildeter und vor allem reicher; beides bedeutet steigende Macht: und so mußte sie zuletzt das Gehäuse sprengen, das ihr zu eng geworden war, die Gängelbänder des Merkantilismus von sich werfen, die ihrer Kind-
[1] A. a. O. S. 522.
[614]
heit angepaßt waren, aber ihre erwachsene Kraft unerträglich hemmten, den rücksichtslosen Ausbeuter abschütteln, und sich das Gehäuse schaffen, dessen sie für sich bedurfte: den modernen Staat.
Es wird die Aufgabe der folgenden, geschichtlichen Bände dieses- Systems sein, die Ereignisse zu schildern und im einzelnen auf ihre Ursachen zurückzuführen, die zu den großen bürgerlichen Revolutionen von 1640 in England, von 1789 in Frankreich, von 1810 (Stein- sche Refoim) und dann von 1848 in Preußen-Deutschland, von 1905 in Rußland führten. Die Daten allein beweisen, daß der Aufschwung des Kapitalismus die Ursache, und das Großbürgertum der Träger der Bewegung gewesen ist.
Mit diesem Siege der Bourgeoisie hat sich wieder, wie in den Staaten der Antike, die Achse des Staatslebens auf eine andere Stelle verlegt. Statt um das Grundvermögen kreist es jetzt wieder um das Kapitalvermögen (denn auch das Großgrundeigentum ist ja längst zu Kapital geworden). Da entsteht die Frage, warum die Entwicklung nicht auch hier in die kapitalistische Sklavenwirtschaft einmündet.
Dafür sind hauptsächlich zwei Gründe maßgebend: ein innerer und ein äußerer. Der äußere ist, daß ergiebige Sklavenjagd kaum irgendwo noch möglich ist, wo fast alle Länder in erreichbarem Umkreise sich als starke Staaten organisiert haben. Wo sie möglich ist, wie in den amerikanischen Kolonien der Westeuropäer, bildet sich, trotz Humanität und Christentum, die Sklaverei sofort aus und erhält sich nach dem Untergang der roten Urbevölkerung noch lange durch die Sklavenjagden in Afrika.
Der innere Grund ist der, daß der Bauer hier, im Gegensatz zum Seestaat, nicht einem Berechtigten zinsbar ist, seinem städtischen Gläubiger, sondern mehreren: mindestens dem Grund- und dem Gerichts- oder Landesherren, bei voller Durchbildung des Feudalsystems oft auch dem Obermärker und dem Vogt. Diese Machthaber, die sozusagen eine G. m. b. H. zur Bewirtschaftung des Bauern darstellen, halten sich gegenseitig die Hände fest, um zu verhindern, daß dem Bauern von einem Einzigen unter ihnen der Rest der Prästationsfähigkeit genommen werde, von der sie alle leben[1]. Wir haben schon darauf vorgewiesen und gezeigt, daß starke Fürsten, wie die französischen Könige und die brandenburgisch-preußischen Kurfürsten und Könige, viel für die Erhaltung des Bauern getan haben. Aus diesem Grunde blieb der Bauer, wenngleich jämmerlich ausgebeutet, überall da persönlich frei und Rechtssubjekt, wo das Feudalsystem schon voll ausgebildet gewesen war, als die Geldwirtschaft ihren Durchbruch machte.
[1] Vgl. dazu Thierry, a. a. O. S. 16 über den Gegensatz des Bischofs und dei königlichen Beamten in den Städten des Frankenreichs.
[615]
Daß diese Deutung richtig ist, ergibt sich klar aus den Verhältnissen derjenigen Staaten, in denen die Geldwirtschaft einsetzte, ehe das Feudalsystem fertig gestaffelt war. Das ist auf der einen Seite England: hier ist der freie Bauernstand, die Yeomanry, bekanntlich fast vollkommen verschwunden, auch das ein seestaatlicher Zug! Der Bauer wurde wie im Altertum mit allen gesetzlichen und ungesetzlichen Mitteln „gelegt“, fortchikaniert, seiner Allmenden beraubt und dadurch ruiniert.
War es in England die kapitalistische Frühreife, so war es in Polen und den übrigen auf ehemaligem Slavenboden und in Ungarn erstandenen „Adelsrepubliken“, wie in Rußland und später, nach der Abwerf ung des Türkenjochs, auch in Rumänien, die feudale Unreife, die die gleiche Entwicklung herbeiführte. Hier hatte sich der Feudalstaat noch nicht so kunstvoll staffeln können, als mit dem Getreidehandel nach dem stark bevölkerten Westeuropa die Geldwirtschaft eindrang und die Psychologie des Ritters in die des Rittergutsbesitzers verwandelte. Hier war daher der Bauer in aller Regel erst nur einem einzigen Gewalthaber, dem Grundherrn, leistungspflichtig ; und darum wird er hier nicht nur bis zur letzten Grenze der Leistungsfähigkeit ausgebeutet (vielfach ging die Bevölkerung rasch zurück, und sank die Rassenkraft), sondern auch in neue Unfreiheit gepreßt, die hie und da bis zur vollen Sklaverei entartete:
„Heda, einen Hörigen her,
Schlitzt ihm auf den Leib!
Nun wärm' deine Füßchen im warmen Gedärm:
Das sind unsere Rechte, Weib!“
singt Detlev von Liliencron von jener Zeit der adeligen Allmacht. Und in Pommern soll es rechtens gewesen sein, daß bei der Teilung der Leibeigenen unter die Erben der „Rest“ einer nicht glatt aufgehenden Division mit dem Schwerte „geteilt“ wurde.
Hier konnte, wie gesagt, nur eine von außen kommende Gewalt die greuliche Anarchie brechen und den Absolutismus einführen.
Wo aber der Kapitalismus innerhalb des absoluten Staates zur vollen Entwicklung gelangt, da erzwingt die Bourgeoisie die Gleichberechtigung, indem sie, ganz wie in der Antike, die niedere Plebs revolutioniert und zum Sturme gegen die alte Herrschaftsordnung führt, selbstverständlich unter dem Banner des „Naturrechts“. Kaum aber ist der Sieg errungen, so wendet die Klasse des mobilen Kapitals, ganz wie im Altertum, die Waffen rückwärts, schließt mit dem überwundenen Gegner Frieden und bekämpft die Unterklasse mit den Argumenten des Legitimismus oder doch einer üblen Mischung legiti-
[616]
mistischer und Scheinliberaler Argumente. Davon haben wir in der Geschichte der Theorien ausführlich genug gesprochen.
So hat sich allmählich der Staat entfaltet: vom primitiven Raubstaat zum reifen Feudalstaat, zum Absolutismus, zum modernen Verfassungsstaat.
An dieser Stelle hat die vergleichende Historik den Griffel niederzulegen und anderen Disziplinen der Soziologie, vor allem der Ökonomik, den Platz zu räumen, die namentlich die Frage zu beantworten hat, wie der Kapitalismus entstand, was sein Wesen ist, worin er wurzelt, und welches die Tendenz seiner Entwicklung ist. Denn Kapitalismus und Gewerbswirtschaft sind nicht eines und dasselbe, wie die Meisten glauben.
Diese Aufgabe haben wir in dem dritten Teile dieses Systems zu lösen versucht, von dem wir ohne Unbescheidenheit sagen dürfen, daß es der erste Versuch ist, eine Ökonomik auf der Erkenntnis aufzubauen, daß die Geschichte nicht nur gewesen ist, sondern auch gewirkt hat : der erste Versuch, heißt das, der mit voller Konsequenz das „Gesetz der ursprünglichen Akkumulation“, aus seinen Voraussetzungen ausgemerzt hat, die Wurzel aller soziologischen Übel. -
Exkurs : Der Oasenstaat. ↩
Der Bewässerungsstaat müßte in einer geschichtlichen Darstellung „der“ Staaten den Anfang bilden: denn er ist älter als die „Seestaaten“, von denen unsere eigene Entwicklung ausgegangen ist; wir sind von der chronologischen Reihenfolge abgewichen, weil es uns scheint, daß dieser unser Lebensgang nicht entscheidend durch die Berührung mit jenen älteren Gebilden beeinflußt worden ist: die kriegerischen und friedlichen Beziehungen, in die Hellas und später Rom zu Ägypten und den vorderasiatischen Reichen getreten sind, haben ihre aus inneren Kräften erfolgende Entwicklung wohl kaum entscheidend abgelenkt, dem Inhalt nach, sondern nur insofern, wie sie ihr bestimmte Formen gaben[1]. Und so scheint es sich uns zu rechtfertigen, wenn wir bei der soziologischen Darstellung „des“ Staates zuerst die große ununterbrochene Reihe vom antiken Seestaat bis zum Emporstieg des modernen Staates darstellten: wir haben dabei die Kategorien gewonnen, die es uns ermöglichen werden, die uns vielfach fremdartige Erscheinung des Staates im Orient besser zu verstehen.
Aus dem gleichen Grunde dürfen wir uns auf eine Skizze beschränken, auf einen Versuch, der noch weniger als die vorstehende Schilderung den Anspruch erhebt, alle Einzelheiten bringen oder gar erklären
[1] Vgl. Bury a. a. O. S. 15/16- S. 92/93 über Rom und Byzanz.
[617]
zu wollen: ein Versuch, der um so mehr geboten ist, weil der Stand unserer Kenntnisse gerade über die entscheidende Periode, Urzeit, die noch sehr viel zu wünschen läßt.
Wir verstehen unter einem Oasenstaat eine in der Trockenzone belegene größere Rahmengruppe, die für ihre Lebensbedürfnisse an Bodenerzeugnissen auf bewässerte Bodenkultur angewiesen ist. Oasen- und Bewässerungsstaat sind also für uns gleichbedeutend. Innerhalb dieser Kategorie haben wir zu unterscheiden politisch selbständige Einzeloasen, ferner Oasengruppen, die einer einzigen Herrschaft Untertan sind, und Oasengroßreiche im Gebiete eines gewaltigen Stromes oder Doppelstromes, der gleichzeitig, im Gegensatz zu den von der Wüste oder Steppe rings umschlossenen Gebilden, das Land zum Meere hin öffnet. Diese drei Klassen zusammen bilden die reinen Oasenstaaten, denen als gemischte solche Großländer gegenüberstehen, die nicht zur Gänze in der Trockenzone belegen sind, in denen also die der Bewässerung bedürftigen Bezirke nur einen Teil des Staates ausmachen. Hierher gehören vor allem Indien, China, Sinear und die Türkei mit Anatolien.
Auf den Verlauf unserer eigenen Entwicklung haben Einzeloasen, so weit wir sehen können, keinen wesentlichen Einfluß ausgeübt; abgesehen von solchen Belanglosigkeiten wie dem Zuge Alexanders nach der Ammonoase sind diese kleinen und schwachen Gebilde wohl immer nur passiv von der vorderasiatischen Kultur betroffen worden, soweit sie in deren Aktionsbereich, namentlich also innerhalb der ägyptischen oder karthagischen und später römischen Schutzzone lagen, die jeder starke Staat in die Wüste vorschiebt.
Auch von den Oasengruppen wird unsere typisierende Auffassung im allgemeinen absehen dürfen: die uns wichtigsten bilden das Zentrum Irans und haben nur mittelbar, als Bestandteil des persischen Reiches und seiner Vorgänger und Nachfolger, also nur im Zusammenhang mit Sinear, dem Lande der vereinten „zwei Ströme“, des Euphrat und Tigris, in der vorderasiatisch-europäischen Geschichte eine wichtigere Rolle gespielt. Fast ganz ohne Bedeutung für diesen Geschichtsverlauf sind die Oasengruppen des mittleren und östlichen Asiens, Buchara, Turkestan usw. Nur wenig bedeutsamer sind im Altertum die Beziehungen zu den wieder etwas anders gelagerten anatolischen Oasen, die dann freilich in der Neuzeit als Kern des Türkenreichs mehr in den Vordergrund treten.
Wichtiger für uns, und in ihrer eigentümlichen Ausbildung auch wichtig für jede soziologische Theorie „des“ Staates, sind die beiden Oasengroßreiche: Ägypten und das Zweistromland.
Von der Urbesiedlung der beiden gewaltigen Stromtäler wissen wir nichts; wir müssen versuchen uns ein Bild davon zu konstruieren.
[618]
Irgendwann einmal steigen schweifende Menschen, vielleicht noch Jäger, vielleicht bereits Hirten, die aus der umgebenden Wüste kommen, von den Uferhöhen in das Tal hinab, Wie es dort ausgesehen hat, davon mag uns vielleicht dasTal des Mississippi zur Zeit der ersten europäischen Besiedlung ein schwaches Bild geben können, wenn es auch nicht durchaus in der Trockenzone liegt. Ein ungeheures Sumpfgebiet, zum großen Teile mit Urwald oder Dschungel bedeckt, den gewaltigsten Überschwemmungen ausgesetzt, ist es in dem größten Teile seiner Fläche ohne vorhergegangene starke Kulturarbeit, und das heißt : ohne kräftige geregelte Kooperation zahlreicher, gut geführter und mit wirksamen Werkzeugen bewaffneter Menschengruppen landwirtschaftlich unzugänglich. Die ersten Ansiedlungen müssen nach Carey's universal gültigem Gesetz[1] daher auf den baumfreien Abhängen des Ufers und auf Sandkuppen entstanden sein, die auch über Hochwasser hinausragten. Ed. Meyer schildert anschaulich die Dinge, wie sie noch heute im Zweistromlande bestehen, freilich gegen die Urzeit verschlimmert, da der Stromlauf sich durch neue Alluvion verlängert, und daher die Strömung verlangsamt hat: „In der Hochwasserzeit (Juni und Juli) verwandeln sich weite Flächen des Landes in große Seen, aus denen nur die erhöht liegenden Orte aufragen, wie in Ägypten zwei Monate später. . . . Der ungebändigte Fluß schadet bald durch Wildheit, bald durch Stagnation und Versumpfung ebenso viel wie er nützt : die Flußarme müssen eingedeicht, neue Kanäle gegraben und in Stand gehalten, ihre Verstopfung durch die Schlammassen gehindert werden“[2].
Vom Nillande heißt es[3] : „Im Naturzustande . . . kann das Land für Jäger- und Nomadenstämme keine große Anziehungskraft besessen haben. Es war von zahlreichen Flußarmen durchschnitten und in der Überschwemmungszeit monatelang in einen großen See verwandelt. . . . Eher mochten die Höhen an den Rändern zur Besiedlung reizen, die damals noch vielfach mit Bäumen und Graswuchs bedeckt waren und einen reichen Wildbestand nährten. . . . Von hier aus werden die Ahnen der Ägypter in das langgestreckte Flußtal und die Sümpfe des Delta eingedrungen sein“.
Wenn nun die Bevölkerung dichter und dichter, die Jagd und Viehzucht, die zuerst noch den Haupterwerb der Siedler gebildet haben mögen, immer weniger ergiebig wurden, dann wurde es nötig, die in der Nachbarschaft des, und im Kampfe mit dem, Strome erworbenen Kenntnisse, nicht viel mehr, als sie der Biber besitzt, gruppenmäßig zu verwerten; „da zwang denn das Land selbst zu energischer Tätigkeit, zur Eindämmung und Regulierung der Flußläufe, zur Umwandlung
[1] S. S. I, S. 830ff.
[2] Gesch. d. Altertums I. 2, S. 429.
[3] Ib. S. 57.
[619]
der Sümpfe und Dickichte in Ackerland, zur Anlage erhöhter Ortschaften, die dem Überschwemmungswasser nicht erreichbar waren und durch Deichwege . . . miteinander verbunden wurden — alles Aufgaben, die für den einzelnen oder den locker gefügten Verband eines Stammes nicht lösbar waren, sondern zu straffer staatlicher Organisation zwangen. So sind die Ägypter ein Bauernvolk unter einem kräftigen monarchischen Regiment geworden“ (57/8).
Als die Kerne des späteren einheitlichen Staatswesens haben wir uns gesonderte örtliche Bezirke vorzustellen, die im ganzen höher und geschützter lagen und durch eine noch relativ primitive Technik in Fruchtland verwandelt werden konnten. Hier entstanden Kleinstaaten, die schon dann als Deich- und Wasserbaugenossenschaften recht straff organisiert und zentralisiert gewesen sein müssen, wenn sie sich, was recht unwahrscheinlich ist, ohne Störung durch äußere, außerökonomische Gewalt, d. h. durch die wehrhaften Nomaden der benachbarten Wüsten und Steppen entwickelt haben. Selbst dann muß die Macht des priesterlichen Gruppenhauptes sehr groß gewesen sein: denn er hatte hier nicht nur alle die Aufgaben, die er in der Regenzone hat, sondern darüber hinaus auch die des Wasserbaus. Das verleiht ihm doppelte Sachverständigkeit: zu der als „Kulttechniker“ (Max Weber) kommt die als Wasserbautechniker, und zwar stehen die beiden Funktionen in engster Verbindung : denn die ganze Existenz der Gruppe hängt von der Ergiebigkeit der Wasserwirtschaft ab und wird auf dieser Stufe selbstverständlich durch Gebete und Opfer in bestimmtem Ritual gesichert[1], die nur der Priester-Techniker in einer den Göttern genehmen Form darzubringen versteht.
Aber damit nicht genug: der Priesterkönig muß hier auch die Macht haben, die Glieder der Gruppe zum Arbeitsdienst aufzubieten. Hier ist es nicht nur die harmlose, selten geforderte trinoda nécessitas, sondern ein durch das ganze Jahr hindurch notwendiger, Mann und Arbeitsvieh stark in Anspruch nehmender Arbeits- und Wachtdienst, der im Interesse der Allgemeinheit unbedingt geleistet werden muß. Wenn nun diese Siedlungen, wie es sehr wahrscheinlich ist, durch Eroberung unter die Botmäßigkeit eines Wüstenscheichs und seines Gefolges kommen, so ist die Fronpflicht der Urbevölkerung ohne weiteres gegeben.
Aus solchen vereinzelten Bezirken ist wahrscheinlich sowohl Sinear wie Ägypten zusammengeschweißt worden, und zwar sicherlich durch kriegerische Eroberung. „So sind die Gaue (Ägyptens) die ursprünglichen Bildungen, die der Entstehung größerer Staaten vorangegangen sind; sie entsprechen den Stadtstaaten im ältesten Babylonien und den
[1] Vgl. Meyer, a. a. O. S. 493ff.
[620]
Stammstaaten der Völker mit primitiver Organisation“[1]. „Wie in Ägypten die Gaue mit ihren Gaustädten, sind auch in Sinear diese Städte, wenngleich sie unter der Oberherrschaft eines Königs standen, immer die Grundlage der Religion und Kultur und die Sitze eines selbständigen historischen Lebens gewesen“[2].
Aber hier war die Integration der vereinzelten Gaue zu einem großen Staatswesen nicht bloß eine Angelegenheit der herrschenden Klasse, ein Mittel zur Vergrößerung ihres individuellen Reichtums und ihrer Macht, sondern eine vitale Notwendigkeit des Gemeinwesens. Man weiß, wie leicht schon zwei Müller sich in das Gehege und in Streit kommen, die an dem gleichen Bach hausen: um wieviel mehr zwei ganze Gaue, die auf das gleiche Wasser für ihre Existenz angewiesen sind. Meyer sagt ausdrücklich, daß „das willkürliche Durchstechen der Deiche verhindert werden muß durch die Anwohner, die das Wasser verschwenden und es den weiter abwärts Sitzenden entziehen“ (430). Dazu kommt, daß überall diese Bergströme, die ungeheure Massen von Erde und Geröll mit sich führen, und ebenso die Kanäle durch den Schlamm, ihr Bett sehr schnell erhöhen und dann ihren Lauf ändern: das kann nur durch den Bau neuer Parallelkanäle gutgemacht werden[3] und dazu braucht man sehr oft die Mitwirkung der Nachbarn oben und unten, um nicht selbst zu Schaden zu kommen oder jene in Schaden und sich selbst dadurch in Fehden zu bringen. Kurz: ein einheitliches Stromsystem braucht auch eine einheitliche Verwaltung, und diese kann in primitiven Zeiten, wo internationale Fluß- und Kanalverträge noch nicht bekannt sind, nur in einer einheitlichen Regierung wurzeln.
Da nun mit der Ausdehnung der Stromwirtschaft über immer größere geographische Räume die Technik immer vollendeter sein muß, so wird der Einfluß der Priester, der Techniker, naturgemäß immer größer, und die Lage des gemeinen Volkes immer knechtischer. Der Priesterkönig, der zuerst unter seinem Szepter die einzelnen Gaue einte, hat darum von vornherein eine im Verhältnis zu seinen Kollegen im Waldrodungslande ungeheure Macht. Nicht nur für „die Wirtschaft des Orients (China, Vorderasien, Ägypten) ist die Bewässerungskultur maßgebend gewesen, wie für die des Okzidents, wo die Niederlassungen durch Waldrodung entstehen, die Waldkultur“[4], sondern auch für die Psychologie ihrer Einwohner und ihr politisches Schicksal.
[1] Meyer, a. a. O. S. 74.
[2] Meyer, a. a. O. S. 433.
[3] Meyer, a. a. O. S. 430. Vgl. 446, 632. R. Junge berichtet, die Stromveilegung erfolge oft so rasch, daß Brücken schon nach zwei Jahren nicht mehr über dem Wasser, sondern mitten in der Ebene stünden. Man begreift, nebenbei, welches Hindernis diese Verhältnisse für den Verkehr darstellen, da die Anlage regelmäßiger fester Straßen unter diesen Umständen unmöglich ist (a. a. O. S. 29).
[4] Max Weber, a. a. O. S. 64.
[621]
In Ägypten, wo ein im wesentlichen einheitliches Volkstum das Land bewohnte, hat im allgemeinen, kurze Epochen ausgenommen, der Pharao als der oberste der Priester, als leibhaftiger Gott, die entscheidende Gewalt geübt. In Sinear, wo Völkerwelle sich über Welle schiebt, wo alle Rassen sich überlagern und kreuzen, wo oft genug rohe Eroberer ohne die geringste Kenntnis von dem Steppenklima und den Notwendigkeiten der Stromverwaltung zur Regierung kommen, ist der ruhende Pol in der Erscheinungen Flucht die Priesterschaft, die auch die stolzesten Erobererkönige in ihrer Stellung belassen müssen, wollen sie nicht ihre Beute, Land und Leute zugrunde gehen sehen[1]: „Die babylonische Kultur ist nicht wie die ägyptische dauernd mit dem Leben eines bestimmten Volkstums verknüpft. Sie ist zu einer vorwiegend priesterlichen Kultur geworden, die in den wechselnden Völkerfluten, ... in dem Wandel der staatlichen Herrschaft ihre einflußreiche Stellung behauptet hat . . . Getragen durch eine im Laufe der Jahrhunderte immer mehr festgewurzelte priesterliche Autorität . . . emanzipierte sich dieses theologisch-priesterliche System völlig von dem Zusammenhang mit einem besonderen Volke. Gerade hierdurch war es vorzüglich geeignet, zum Mittelpunkt einer universalen, einen großen Teil des vorderen Asien umfassenden Kultur zu werden“[2].
So wurden die beiden Länder zu wahrhaften absoluten Theokratien[3] ; namentlich in Ägypten, wo die Tradition kaum abriß, wenn auch die Dynastien wechselten, kam der Pharao zu einer, wie gesagt, geradezu gottähnlichen Stellung und Machtvollkommenheit. Schon im Alten Reich haben wir „einen völlig zentralisierten Beamtenstaat unter einem allmächtigen Pharao“[4]. Und wieder im Neuen Reiche ist der Pharao der Eigentümer des gesamten Bodens mit Ausnahme der Tempelgüter[5].
Von den Stadtfürsten (Patesi) Sinear s sagt Meyer (474/5), daß „die priesterlichen Funktionen bei den sumerischen Herrschern durchweg so stark in den Vordergrund treten, daß es wahrscheinlich wird, daß die weltliche Macht hier überhaupt aus dem Priestertum des Lokalgottes hervorgegangen ist, an das sich zunächst vielleicht richterliche Funktionen und daneben die Führung des Aufgebots des Stadtbezirks anschlössen“. Wie stark die Wasserwirtschaft auch hier mitwirkte, sagt folgende Stelle: „Auch die gemeinnützigen Unternehmungen, wie Kanalbauten und Wasserreservoirs, erscheinen als für die Götter und
[1] Vgl. Meyer, a. a. O. S. 547/8, über die verheerenden Folgen einer Unterbrechung der Wasserwirtschaft durch Eroberer (Gutaeer).
[2] Kaerst, a. a. O. S. 288/9.
[3] Vgl. Treitschke, Politik II, S. 18, 24.
[4] Ed. Meyer, a. a. O. S. 187.
[5] Weber, a. a. O. S. 13.
[622]
deren Nutzen ausgeführte Werke. Daß das tatsächlich eine unumschränkte Herrschaft der Priester bedeutete, liegt auf der Hand — auch die Truppen werden von den Priestern aufgeboten — ; und wie sehr diese ihre Stellung für ihren Vorteil auszunützen verstanden, werden wir alsbald hören“[1].
Kein Zweifel, daß diese diskretionäre Gewalt durch die kriegerische Zusammenschweißung des ganzen Stromgebietes noch ungeheuer vermehrt werden mußte. Dazu kommt, um die Lage der Urbevölkerung noch mehr zu drücken, der Import von massenhaften, durch kiiegerische Jagden gewonnenen Sklaven, die von erfolgreichen Herrschern benützt werden, um neue Kanäle zu bauen und neues Ackerland zu gewinnen[2]. Wir wissen ja, wie sehr die Sklavenwirtschaft die freie Bevölkerung wirtschaftlich und sozial niederbringt.
Wir haben hier also mindestens von Anfang der größeren Staatsbildungen an einen absoluten Staat, der durch den Cäsaropapismus noch unwiderstehlicher auf die Untertanen drückt als sein Nachfolger in der Neuzeit. „Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Masse der Ägypter schon in den ältesten Zeiten nicht aus freien Bauern mit eigenem Grundbesitz bestanden hat, sondern aus Knechten, die im Dienste großer Herren und vor allem der Häuptlinge (Könige) die Felder bestellten und die Herden weideten“[3].
Unter diesem Druck sind, wie überall im absoluten Staate, die gewachsenen Bindungen der Urzeit früh vernichtet worden: „Die Formen staatlichen Lebens, die wir sonst überall zu Anfang antreffen, und die auch bei den Stämmen der übrigen hamitischen Völker bestehen, sind in Ägypten spurlos verschwunden: wir treffen hier weder Stämme — nicht einmal einen Stammnamen —, so wenig wie die Ägypter insgesamt einen Volksnamen besitzen, noch Geschlechtsverbände noch Blutrache oder Geschlechtskulte“[4]. Ganz das gleiche gilt für Sinear: „Von einer Gliederung nach Blutsverbänden, Stämmen und Geschlechtern ist in Sinear so wenig eine Spur zu finden wie in Ägypten; diese Ordnungen sind mit der Seßhaftigkeit geschwunden“[5]. Hier liegt der Hauptgegensatz zu Indien und China, beides gemischten Oasenstaaten, in denen sich die Sippe erhalten hat, die namentlich in China eine beherrschende Rolle gespielt hat. Im Okzident ist die Sippe erst verschwunden, nachdem sie die wichtigsten Schößlinge getrieben hatte: vor allem die Stadt und den in ihr wurzelnden Rationalismus.
[1] Meyer, a. a. O. S. 493.
[2] Max Weber, a. a. O. S. 64: „So erklärt sich auch das Schicksal der Israeliten in Ägypten“. Vgl. über des Chammurapi Kanalbauten Meyer a. a. O. S. 628/9.
[3] Meyer, a. a. O. S. 70.
[4] Meyer, a. a. O. S. 71.
[5] Meyer, a. a. O. S. 444.
[623]
Wir wissen, daß die antike Stadt sich ursprünglich aus der Vereinigung nicht von Individuen, sondern von Sippen bildet[1]. Nur dadurch wird sie zur Gemeinde im westeuropäischen Sinne, zu einem selbständigen Wehr verbände mit politischen Ansprüchen und Handlungsantrieben und zu einem selbständigen Kult verbände. Hier, und so ist es auch noch im frühen Indien, wurzelt alles Bürgerrecht im Erbcharisma: man hat dies und das damit verbundene Recht auf Boden, weil man Mitglied einer Sippe ist. Das haben wir ausführlich dargestellt.
Diese Ansätze fehlen in den Oasenstaaten durchaus.
Sprechen wir zuerst von der Stadt als Wehrverband: „Überall außerhalb des Okzidents wurde die Entwicklung der Stadt dadurch gehemmt, daß das Heer des Fürsten älter ist als die Stadt. Die frühesten chinesischen Epen kennen nicht, wie die homerischen, den Helden, der auf eigenem Streitwagen in den Kampf fährt, sondern den Offizier als Führer der Mannschaft; ebenso tritt in Indien Alexander dem Großen ein von Offizieren geführtes Heer entgegen. Im Okzident ist das vom Kriegsherrn ausgerüstete Heer und die Trennung des Soldaten von den Kriegsbetriebsmitteln analog der des Arbeiters von den Produktionsmitteln erst ein Produkt der Neuzeit, während sie in Asien an der Spitze der geschichtlichen Entwicklung steht“[2]. Wir fügen hinzu, daß es dort wie hier der absolute Staat ist, der über das von Offizieren befehligte Soldheer verfügt ; dort steht er am Anfang, hier am Ende der Entwicklung. Weber deutet die Erscheinung in voller Übereinstimmung mit uns und Meyer, wie auch R. Junge. Er fährt fort : „Der Unterschied ist darin begründet, daß für die Kulturentwicklung in Ägypten, Vorderasien, Indien und China die Bewässerungsfrage bestimmend war; mit der Bewässerung war die Bureaukratie, die Untertanenfronde und die Abhängigkeit der Untertanen von der Bureaukratie des Königs in ihrer ganzen Existenz gegeben. Daß der König dann sein Monopol auch im Sinne eines Militärmonopols nutzbar machte, begründet den Unterschied in der Wehrverfassung zwischen Asien und dem Okzident“.
Wir wollen dazu bemerken, daß diese Gegensetzung nicht mit voller Schärfe für die gemischten Oasenstaaten gilt — Weber selbst schränkt sie für Indien und das frühe Mesopotamien ein (276).
Die okzidentale Stadt als Trägerin eigener Politik und geschichtlicher Bedeutung ist zweitens religiöse Verbrüderung der verbündeten Sippen. Auch dieser Ausgangspunkt ist demnach in den reinen Oasenstaaten nicht gegeben. „In Indien waren die Kasten außerstande, eine Kultgemeinschaft und damit einen Stadtverband zu schaffen, weil sie rituell einander fremd waren. Was den Okzident dazu befähigte, die Stadt zu schaffen, war in der Antike die weitgehende Priesterfreiheit,
[1] Weber, Wirtschaftsgesch. S. 55.
[2] Max Weber, a. a. O. S. 275.
[624]
das Fehlen eines priesterlichen Monopols auf Verkehr mit den Göttern. ... Die Stadt (im eigentlichen Sinne) ist etwas spezifisch Abendländisches“ (276/7).
Das ist nicht etwa so zu verstehen, als wenn die Oasenstaaten keine Städte im gewöhnlichen Sinne gekannt hätten. Im Gegenteil; „Das enge Zusammenleben der Menschen in einer Oase, die Notwendigkeit eines Oberhauptes der Bewässerung mit einem Stabe von Wasserbeamten, die Notwendigkeit, gemeinsam die Oase gegen feindliche Raubgelüste zu verteidigen, mußte schon in frühester Zeit zu Stadtbildungen führen. Es erwuchs so aus den klimatischen Verhältnissen heraus städtische Kultur und städtische Wirtschaftsweise“[1].
Diese Städte sind alles Mögliche : Burgen, Regierungssitze, Tempelstädte, und vor allem Gewerbsstädte, in denen sich der Austausch zwischen Gewerbe und Landwirtschaft vollzieht: aber es sind keine Gemeinden im politischen und genossenschaftlichen Sinne. Peking ist in jedem anderen Sinne gewiß eine Stadt und sogar eine Großstadt: aber es heißt offiziell „die fünf Orte“ und wird abschnittsweise in fünf großen Dörfern verwaltet, so daß es keinen „Bürger“ von Peking gibt[2]. Hier darf vielleicht daran erinnert werden, daß auch Großlondon offiziell aus vielen selbständigen Orten besteht, die erst in der neuesten Zeit durch das County-Council in organische Verbindung gebracht worden sind: hier spiegelt sich die verwandte Geschichte der im frühabsolutistischen England ganz anders als auf dem Kontinent erwachsenen Stadt.
Diese orientalische Stadt kann sich unmöglich in dem Maße von der magischen Superstition befreien wie die abendländische, da sie unter dem priesterlichen Monopol steht und bleibt. Dazu kommt, daß diese Städter wie der Bauer von unberechenbaren Naturgewalten in ihrer ganzen Existenz ganz anders abhängig sind als die Städter der Regenzone und nun gar der Seeküste. Wenn die Überschwemmung einmal ausbleibt, ist die Existenz nicht nur der Landwirte, sondern auch der Städter auf das gefährlichste bedroht, weil dann eine totale Mißernte eintritt, die Bauern das wenige, was da ist, selbstverständlich für sich verbrauchen, und Zufuhr von außen so gut wie unmöglich ist.
Aus diesen beiden Gründen kann sich der spezifisch städtische Rationalismus hier nicht ausbilden, zumal, worauf schon Buckle aufmerksam machte, ein extremes Klima die Gegenspielerin der kalten Vernunft, die Phantasie, mächtig anregen mußte.
[1] Junge, a. a. O. S. 55. Vgl. auch S. 249/50, 393 über die Bazare, die ebenfalls das Klima erzwingt — man kann nicht unter freiem Himmel Handel treiben —; das Handwerk schließt sich an: es entsteht ein Stadtkern. Der Islam mit der Abgeschlossenheit des Hauses hat das noch verstärkt. Vgl. Max Weber, a. a. O. S. 147.
[2] Weber, a. a. O. S. 272 Anm.
[625]
„Die Extreme, welche das Klima schafft, strenger Frost und glühende Hitze, leuchtende Farben unter einer südlichen Sonne und das Grau der sandgeschwängerten Atmosphäre, Hochfluten, die ganze Landstriche fortreißen und bitterster Wassermangel, diese Extreme regen überall im Orient gewaltig die Phantasie des Menschen an. Und der Umstand, daß der einzelne Mensch sich in jeder Beziehung so überaus machtlos fühlen muß, machtlos gegen Sandsturm und Hochflut und gegen den Durst, machtlos gegen das vom Klima erzeugte Fieber und die gleichfalls auf klimatischen Gründen beruhende politische Despotie, führt es herbei, daß der einzelne Mensch in jener beflügelten Phantasie die einzige Rettung seines Individuums vor den übergewaltigen Mächten des Lebens sucht. Führt es herbei, daß jeder Mensch im Orient innerlich ein ewiges Märchen lebt. Daß damit jeder zum Optimisten und zum Künstler wird“[1].
Mit dieser Charaktergestaltung, die uns die heute so viel berufene und gerühmte orientalische „Seele“ schon einigermaßen zum Verständnis bringt, mischt sich nun der Individualismus, den jeder Mensch ausbildet, der, aus seinen natürlichen, gewachsenen „gemeinschaftlichen“ Bindungen gelöst, sich isoliert und hilflos den Mächten •dieser Erde und der Überwelt ausgesetzt, auf nichts als auf seinen vereinzelten Verstand angewiesen findet.
Der Individualismus muß sich schon in der Gestaltung des Grund- •eigentums zeigen, da es hier keine Gemeinde gibt, die ein Ober eigentum besitzt. Das besitzt der Staat als ganzer, aber gerade das „muß aus rein technischen Gründen der Verwaltung stets viel mehr praktisches In- dividualeigen als Gesamteigen bilden. So erhalten wir das zunächst widerspruchsvoll erscheinende Ergebnis, daß der Sozietätsgedanke im großen, welcher der Despotie zugrunde liegt, praktisches Individual- eigen, der Individualitätsgedanke z. B. kleiner mitteleuropäischer und auch mittelmeerischer Gemeinden aber Gemeineigen erzeugt“[2].
Alle Ethik, alles Pflichtgefühl erwächst, wie wir wissen, in der gewachsenen Gemeinschaft, zuerst der Kleinfamilie, dann der Horde, dann der Nachbarschaft und der Sippe. All das fehlt hier. Junge hat den Gegensatz gegenüber der europäischen Psyche mit großer Kraft herausgearbeitet und dürfte, wenn auch seine persönliche Gleichung eine gewisse Rolle spielen dürfte, doch im großen das Rechte getroffen haben, wie der Vergleich mit dem rationalen Staat der Neuzeit, dem absoluten und dem modern-kapitalistischen, zeigt:
„In Turkestan wie im ganzen Orient der ansässigen Bevölkerung“ (von ihm unterstrichen: die Nomaden leben noch in ihren gewachsenen Gemeinschaften) „ermangelte das Gefühl der Pflicht in der heute bei
[1] Junge, a. a. O. S. 55/56.
[2] Junge, a. a. O. S. 181/2 Anm.
[626]
c uns bestehenden Form, d. h. der entsagenden Hingabe an eine beliebige, außer dem Ich stehende, abstrakte Idee, vollständig. Es fehlte die Anschauung der Allgemeinheit, die in den Einzelnen den inneren Zwang zu solcher Pflichtbetätigung irgendwelcher Art hineingelegt hätte. Und es fehlte alsdann die Aufstellung eines Gehorsam heischenden . . . abstrakten Faktors durch das Ich selbst und die restlose Beugung des Ich unter ihn. Der Gedanke hieran lag dem Orientalen fern, und er besaß dafür auch in seinen Sprachen kein erschöpfendes Wort. Empfindet doch der Moslem z. B. auch gegenüber den ethischen Forderungen seines religiösen Gesetzes keine Pflicht, sondern sieht in ihnen nur ein erstrebenswertes Ideal, dem sich der an sich viel zu schwache Mensch annähern mag, so gut er eben kann. Alles und jedes war im Orient der Ansässigen vielmehr auf eine rein individualistische triebhafte Note gestellt“[1]. Hier ist der Gegensatz zu dem rationellen, eben nicht triebhaften Individualismus der Zersetzungszeit der Europäergesellschaft mit Glück geprägt.
Der Gegensatz wurzelt auch nach Junges Meinung in dem Gegensatz der beiden Klimata und der daraus entspringenden Verschiedenheit der politischen Verfassungen. Die Bewässerung erzwang Großorganisation unter einer despotischen Gewalt; damit aber erhielt der Mensch „trotz der Knechtung eine weitgehende Freiheit gegenüber der Allgemeinheit. Mit dieser hatte er gar nichts zu schaffen. Er war mit seinem ganzen Gut und Leben Individuum. Der Orientale wurde zwar ständig mit großen Menschenmassen zusammengeführt, blieb aber unter ihnen für sich allein. Im Gegensatz dazu entstand in den Regengebieten besonders Europas, in denen kleine Menschengemeinschaften bereits eine hohe Kultur hervorbringen konnten, auf dem Fundamente der Verwandtschaft und Nachbarschaft eine politische Kleinorganisation, die Gemeindeindividualität. Der in Verwandtschaft und Nachbarschaft besonders stark liegende „Gedanke des Nebenmenschen“ übertrug sich damit auch auf die politische Organisation und damit das ganze Leben. Im Orient ging von jedem einzelnen Individuum getrennt sozusagen eine Kette für sich nach der despotischen Spitze. In Europa dagegen waren die Individuen untereinander verkettet und hingen in ihrer Gesamtheit durch ein einziges Band mit der Spitze der Regierung zusammen. So erwuchs in Europa erstens die Askese (deren Bedeutung für das Wachstum des Kapitalismus uns Weber kennen gelehrt hat) und vor allem der Begriff des Dienstes für einen abstrakten Begriff, bis zur „monomanen Übertreibung“.
Im Orient aber verwies die große Zentralisation des politischen Lebens den Menschen auf sein Ich. „Der Geist der Verwandtschaft
[1] Dies wie das folgende aus dem angezogenen Werke, S. 351 ff.
[627]
und Nachbarschaft, der in jedem Menschen liegende Gedanke des Nebenmenschen wurde nicht politisiert, nicht zur Staatsform und zum Stempel des öffentlichen Lebens, sondern blieb individuell ... Es fand sogar eine Politisierung des Egoismus statt. Der Interessenkampf zwischen je einem Unterdrücker und einem Bediückten, auch in den großen sozialen Arbeitszusammenfassungen, gab dem öffentlichen Leben seine Formen. So lag hier ein Nährboden nicht für den Pflichtbegriff, sondern für einen ausgeprägten, nur auf das Konkrete gestellten, der Entsagung dem nicht befohlenen Dienste gegenüber einer Außenmacht fremden, Egoismus, der nicht nach rechts und nicht nach links sah. Und gegenüber den Mitmenschen wurde er noch verstärkt durch das Gefühl . . . der gleichen, geradezu als naturgesetzmäßig angesehenen unentrinnbaren Abhängigkeit von einem knechtenden übergeordneten Willen, dem gegenüber sich eine Vorzugsstellung zu sichern, erstrebenswert sein mußte. Der Orient gab also im Gegensatz zu Europa einen Nährboden nicht für den Gedanken des Nebenmenschen und für Abstraktionen, sondern für Egoismus und Konkretisierung. . . . Der Orientale ließ sich leiten nur von persönlichen Motiven des Interesses, der Neigung oder Abneigung. Die europäische „Pflicht“ wurde ihm höchstens ein Deckmantel bequemer Art für irgendeinen Mangel, z. B. den der Verantwortungsfreudigkeit“.
Wenn wir diese Dinge bedenken, so verstehen wir die Unterschiede in der Entwicklung der orientalischen Großstaaten gegenüber denen Europas besser. Es ist namentlich das Fehlen der Stadt als Gemeindeverband und des in ihr entstehenden Rationalismus, die hier in Betracht kommen. Darauf und auf der irrsinnigen Steuerpolitik, die den Bauern, die Tragfläche der sozialen Pyramide, überall bis aufs äußerste aussaugt und ihm alle Neigung nimmt, mehr als das Notwendige zu erarbeiten, und die das ersparte Vermögen zwingt, sich ängstlich zu verstecken und jedenfalls eher im Handel als in produktiven Unternehmungen anzulegen, beruht einerseits die Schwäche dieser Reiche, die oft wie ein Kartenhaus beim ersten Anstoß zusammenbrechen, und andererseits die auffällige Statik ihrer Wirtschaft, der Mangel aller progressiven Tendenzen[1]. Und so haben zwar die Oasengroßstaaten das typische Schicksal der Großlandstaaten ebenfalls durchgemacht, wie wir an vielen Beispielen gesehen haben, aber sie haben es nie vermocht, sich der Errungenschaften der Seestaaten zu bemächtigen, und haben sich endlos in dem Hexenkreise gedreht, bis stärkere, seestaatlich erzogene Mächte, und nicht mehr bloß rohe Nomaden-Barbaren, ihrer staatlichen Selbständigkeit ein Ende bereitet haben.
[1] Vgl. Junge, a. a. O. S. 195 und vielfach.
[628]
Wir wollen, hauptsächlich in Anlehnung an das treffliche Buch von Victor Bérard, „L'Iran“, dieses typische Schicksal an einem großen Beispiel etwas ausführlicher darstellen:
Der Kern Persiens ist ein Hochplateau, das fast überall von noch höheren Bergketten umgeben ist. Bérard hat eine ebenso eindrucksvolle wie anschauliche Beschreibung von der geographischen Lage des Landes gegeben, die wir auszugsweise hierher setzen wollen:
Der Hauptcharakterzug des Landes ist die ungeheure Wüste seines Zentralplateaus, das von Weidehügeln und alpinen Gipfeln im Amphitheater umgeben ist; der Grundzug der Bevölkerung ist die unaufhörliche Wanderbewegung der Menschen und der Herden. Iran ist eines der schüsseiförmigen Hochplateaus, aus denen sich das Rückgrat des asiatischen Kontinents zusammensetzt, einer der ungeheuren Wirbelknochen, die vom Bosporus bis zur chinesischen Ebene reichen und das tropische mit dem polaren Asien verbinden. Anatolien, Iran, Turkestan, die Mongolei und Tibet: alle diese Bezirke Zentralasiens ähneln einander mit ihrem immer gleichen wüstenhaften Plateau und ihren immer gleichen hochüberragenden Randgebirgen; sie unterscheiden sich voneinander durch ihre Größe und Steile; sie werden immer größer und höher, je mehr man sich von Europa entfernt. . . .
Irans Zentralplateau hat im allgemeinen 1000—1200 m mittlerer Höhe mit Einsenkungen, die nicht unter 5—600 m heruntergehen. Sein 3—4fâcher Grenzwall, mit Hochgipfeln und Vulkanen gekrönt, reckt sich mehr als 3000 m über den fast ununterbrochenen Festungsgraben, der ihn umgibt, zusammengebildet aus Flußtälern und Meeresflächen. Das Kaspische Meer und die turkmenische Steppe im Norden, der Persische Golf und die See von Oman im Süden, die Täler des Tigris im Westen und des Indus im Osten umzirkeln es von allen Seiten mit der alleinigen Ausnahme der beiden Hörner im Nordwesten und Nordosten, wo die Bergknoten des Ararat und des Pamir es mit den benachbarten Bergländern verknüpfen.
700 Meilen (lieues)[1] der Länge nach vom Ararat bis Pamir; 400 Meilen der Breite nach vom Kaspischen Meer bis zur Omansee; im ganzen 2% Millionen qkm[2]: 5 mal die Oberfläche Frankreichs[3]. Iran, auf eine europäische Karte übertragen, würde das gesamte Mittelstück von Calais nach Moskau und von Hamburg nach Triest bedecken. Dieses Land beherbergt heute 3 Reiche: Persien, Afghanistan und
[1] Eine Heue gleich ca. 4500 m.
[2] Davon gehören 1654000 qkm zu dem Kaiserreich Persien. Der Rest entfällt auf Afghanistan und Beludschistan.
[3] Frankreich (und Deutschland) hatten vor dem Kriege je rund 540000 qkm Grundfläche. Rußland etwa 10mal so viel in seinem europ. Bestände vor dem Kriege.
[629]
Beludschistan, und 3 Herrscher : einen Schah von Teheran, einen Emir von Kabul und einen Khan von Kelat. . . .
Die Zentralwüsten mit ihrer Bergumgebung haben das iranische Reich geschaffen; aber es hat seine politische und moralische Einheit weniger den umschließenden Mauern als dem gewaltigen Loch in der Mitte verdankt, das 3/5, vielleicht 2/3 der Gesamtfläche einnimmt. Diese Zentralwüste war immer der kraftvollste Faktor in der geistigen und politischen Gestaltung der Iranier. Geradeso ist die politische Einheit des alten Hellas und die moralische Einheit des heutigen Griechentums auch nur das Werk gewesen eines „Lochs“, eines Binnenmeeres, des Archipels. Bérard führt die Analogie sehr weit: wie der Archipel, so ist auch das iranische Hochplateau nach Süden hin nicht völlig abgeschlossen. Hier senken sich die Berge von Beludschistan in großen Stufen ins Meer; und dieses zentrale Sandmeer Irans hat, gerade wie der Archipel, im nordöstlichen Winkel einen schmalen Ausgang : wie die Dardanellen in die Propontis und von dort in den Pontus führen, so führt eine gleich enge Straße im nordöstlichen Winkel von Iran durch den Engpaß von Herat nach Merw in die „Vorwüste“ der Turkmenen und von dort in das große Wüstenmeer Turans, Turkestans und der Mongolei. „Dieser Engpaß hat in der Geschichte Irans dieselbe Bedeutung wie die Dardanellen in der Geschichte des Hellenismus“ (S. 27). Die Inseln dieses Sandozeans sind die Oasen, und man kann auch hier Sporaden und Cykladen unterscheiden.
Diese geographische Lage hat durch die Jahrtausende hindurch Irans Schicksal bestimmt. Es ist „the highway of the nations“ wie die Engländer sagen. „Genau in der Mitte des Weges zwischen den atlantischen Küsten des äußersten Europas und der pazifischen Küste des äußersten Asiens, gleich weit von Kamtschatka und dem Kap der Guten Hoffnung entfernt, bildet das Iran den Schwerpunkt der alten Welt. Die genaue Mitte der unregelmäßigen Figur, die die drei Kontinente: Europa, Asien und Afrika darstellen, wäre ganz dicht bei Teheran, an der Küste oder in den südlichen Gewässern des Kaspischen Meeres. Hier schneiden sich die Diagonalen der alten Welt.“
So haben denn auch von jeher gewaltige Wanderungen über diese Heerstraßen der Völker stattgefunden, in nordsüdlicher und vor allem in ostwestlicher Richtung. Die Reitervölker des nördlichen Asiens sind auf ihr nach Süden gezogen, die Skythen und später die Türken gegen Mesopotamien, die Mongolen gegen Indien; aber wichtiger sind die ostwestlichen Wanderungen, weil auf ihnen die Völker von den Pyrenäen bis zum Himalaya unter ungefähr den gleichen klimatischen Bedingungen blieben. „Ein bequemer und einladender Weg, auf den hohen Abhängen seiner Gebirge, hoch über den Meeren und Sümpfen, die es von Nord und Süd bestürmen, liefert das Iranische Hochland
[630]
den Zügen der Menschen und der Herden einen trockenen Pfad; der Ring bewässerter Ländereien, der die Wüste umgibt, sichert Wasser und Lebensmittel; im Osten führen die Engpässe Beludschistans ins fruchtbare Pendschab; im Westen setzt das anatolische Hochland diese Heerstraße nach dem Bosporus, dem Balkan, dem mittleren Europa fort. Das ist die historische und prähistorische Heerstraße aller großen Eroberer, nach Westen begangen von den Cyrus, Darius, Xerxes, Tamerlan und den Osmanlis, und nach Osten hin nach Indien wieder von Darius, von Alexander dem Großen, von den Arabern und Nadir- Schah, die Heerstraße, die auch Napoleon studierte. Und schon säumen sie die Drähte der anglo-indischen Telegraphen. Früher oder später wird ihr ein „Drang nach Indien“ der Deutschen oder der Russen die Bedeutung wiedergeben, die sie seit den entferntesten Zeiten für die weiße Menschheit hatte. Denn es war wahrscheinlich diese Straße, auf der, von Ost nach West oder von West nach Ost, die ersten Arier zogen.“
Das Klima neigt im Norden und Süden zu Extremen. In der Gegend des Persischen Golfes ist der Sommer sehr heiß, im Nordwesten der Winter sehr kalt; dagegen ist das Klima im westlichen Zentrum im allgemeinen gemäßigt; so ist z. B. das Klima von Isfahan und Umgegend durch seine angenehme Gleichmäßigkeit berühmt.
Dieses Land wird schätzungsweise jetzt von 15 Millionen Menschen bewohnt, hat aber offenbar in früheren Zeiten einer viel größeren Bevölkerung breitere Existenzmöglichkeiten gegeben und kann auch in Zukunft wieder viel mehr ernähren. Es würde schon ausreichen, auch nur die alten, großartigen Wasserwerke wieder herzustellen : denn überall dort, wohin Wasser geführt wird, verwandelt sich die Wüste sofort in einen Fruchtgarten. Wasser aber ist, wie Bérard sagt, fast überall zu finden, wo man danach sucht, und es ist kaum auszudenken, was aus dem gewaltigen Gebiete gemacht werden könnte, wenn die moderne Technik der Stromverbauung, der Talsperren, in Verbindung mit einer rationellen Wiederaufforstung der Gebirge, die ungeheuren Wassermengen nutzbar machen würde, die heute nutzlos, ja, zum Schaden des Bodens abströmen, den sie vielfach in traurige Sümpfe verwandeln.
Vielleicht kommt eine Zeit, und hoffentlich kommt sie bald, in der die Menschen die reichste Natur Eurasiens entwickeln : bisher haben sie, wenigstens seit Jahrtausenden, kaum anderes getan, als sie zu zerstören. Die herrlichen Wälder der Randgebirge sind auf ungeheuren Flächen der Axt und dem Feuer der Nomaden zum Opfer gefallen, die das Waldland in Asche legen, um auf dem üppig aufschießenden Graswuchs ihre Herden zu weiden; und was sich an jungem Waldanflug neu ausbildet, fällt gnadenlos dem Zahn der Ziegen und Schafe und wieder dem Waldfeuer der Nomaden anheim. Die alten Wasserwerke
[631]
aber, die Nährbrüste des Landes und des Volkes, sind entweder verfallen oder gar absichtlich in den unzähligen Kriegen zerstört worden.
So kann es denn nicht wundernehmen, daß dieses weite Land, das fünfmal so groß ist als Frankreich oder Deutschland, nur etwa den dritten Teil der französischen und weniger als den vierten Teil der deutschen Bevölkerung ernährt. Die durchschnittliche Bevölkerungsdichtigkeit muß mit etwa 6 Kröpfen auf den Quadratkilometer angenommen werden. Nun ist allerdings die Wüste außerordentlich schwach bevölkert. Aber: selbst wenn man sie ganz außer Rechnung läßt und hoch auf die volle Hälfte der Gesamtfläche veranschlagt, kommt man doch erst auf eine durchschnittliche Dichtigkeit von 12 pro qkm — und das in einem Klima, das auf bewässertem Boden eine Volksdichtigkeit ähnlich derjenigen Ägyptens gestatten würde: hier aber lebt eine fast ausschließlich agrarische Bevölkerung von weit über 500 Köpfen auf den Quadratkilometer !
Die Erklärung für diesen betrübenden Tiefstand der Bevölkerung, der selbstverständlich gleichzeitig ein solcher des allgemeinen Wohlstandes, des Bildungszustandes und der Wehrkraft ist, und dadurch über das politische Schicksal des Reiches entschieden hat, liegt hauptsächlich in der Tatsache eingeschlossen, daß ein gewaltiger Teil der Bevölkerung, mindestens ein Drittel nach B^rard, noch aus Nomaden besteht. In den Gebirgen weiden die Älpler der verschiedenen Stämme iranischen und turanischen Blutes; in den Wüsten, „soweit der Dattelbaum wächst“, die semitischen Beduinen ihre ungeheuren Herden. Für sie hat die Geschichte stillgestanden; es sind noch dieselben Zelte, es ist noch ganz dieselbe soziale Organisation, und es ist auch noch ganz die gleiche Psychologie des Räuberkriegers, wie zur Zeit des Astyages und des Chammurapi.
Der Nomadismus entscheidet in zwiefacher Weise über die Dichtigkeit der Bevölkerung mit ihren Folgen für den Gesamtzustand des Landes. Erstens wirtschaftlich: der Nomade braucht unendlich viel mehr Land pro Kopf als der Ackerbauer selbst bei extensivster Ackernutzung, oder gar der Gärtner auf bewässertem Boden. Und zweitens politisch: wo der Nomadismus herrscht, kann der Bauer, die tragende Säule aller Volkskraft, nicht emporkommen. Es ist noch nicht das schlimmste, daß der Nomade ihm in regelmäßigen Zwischenräumen die Herden über seine Saaten treibt; schlimmer ist, daß überall der Nomade den Bauer politisch unterwirft, nachdem er ihn durch unendliche Raubzüge an den Bettelstab gebracht hat; und daß er seinen Untertanen mit der äußersten Rücksichtslosigkeit wirtschaftlich ausbeutet, derart ausbeutet, daß er seinen Fleiß und damit den stärksten Hebel des Volksreichtums zerbricht. Er plündert ihn aus als Staat, indem er ihn mit Steuern überlastet, und zum zweiten Male als privater Grundherr,
[632]
als Großgrundbesitzer, indem er ihm das äußerste an Grundrente abpreßt. Wie in allen von Nomaden gegründeten Feudalstaaten tragen auch im modernen Persien die Bauern, die „Raiat“ die ganze Last der Staatsverwaltung und des ausschweifenden Luxus der Herrenklasse. Ihr Los ist von dem ihrer Leidensgenossen in den mittelalterlichen Feudalstaaten Europas nur durch zwei Umstände, einen ungünstigen und einen günstigen, verschieden. Ungünstig sind ihnen die Bestimmungen des Korans, der im Grunde keine anderen Steuern kennt, als die Grundsteuer, den Zehnten, so daß in Persien nicht nur der reiche Großgrundbesitzer, sondern auch der großstädtische Kaufmann praktisch voller Steuerfreiheit genießt. Günstig aber ist ihnen auf der anderen Seite der ungeheure Überfluß an freiem Boden, an „Niemandsland“, der ihnen gestattet, sich einem allzu schamlosen Erpresserdruck durch Fortwanderung zu entziehen. Das gibt auch einem großen Teile der Bauernschaft den Charakter des Halbnomadismus, der Unstetheit; es verhindert die Verwurzelung des Menschen mit seiner Scholle, aus der sonst überall die schönsten Blüten der Vaterlandsliebe und der wirtschaftlichen Tüchtigkeit aufwachsen.
Wie es die Geschichte Irans, als des Hoch- und Heerweges aller Völker, selbstverständlich mit sich bringen mußte, ist die Bevölkerung rassenmäßig stark gemischt. Ihren Kern bilden noch heute weiße Menschen arischer Sprache — das Wort „Arier“ entstammt dem persischen Wortschatz — ; aber die Heerzüge aus dem Norden haben große Heerzüge gelber, turanischer Elemente entweder stammweise ins Land gebracht oder durch Blutkreuzung eingemischt. Und ebenso sind von Süden und Westen her, von Arabistan und über die alte Völkerstraße Bagdad-Kermanschah semitische Elemente eingedrungen, und nicht bloß immer reinblütige weiße Semiten ; die Sklaverei und die Haremswirtschaft haben auch in nicht unbeträchtlicher Menge afrikanisches Blut in die Mischung eingebracht. Relativ rein iranisch sind heute noch die Bergvölker Kurdistans, Luristans und Farsistans, also der westlichen und nordwestlichen Randgebirge, während im Osten und Nordosten, namentlich in Chorassan eine sehr starke Beimischung skythischer, turkotatarischer und mongolischer Elemente wohl schon in sehr alter Zeit stattgefunden hat; die Afghanen werden von einigen Bewunderern, vor allem von dem Grafen Gobineau, dem Rassenfanatiker, für sehr reine „Indogermanen“ gehalten, während alle Welt auf der anderen Seite darüber einig ist, daß die Beludschen ihre weltberüchtigte Häßlichkeit vor allem ihrem Mestizentum, ihrer aus allen Rassen gemischten Kreuzung zuzuschreiben haben.
Soviel vom anthropologisch-rassenmäßigen; historisch-soziologisch aber entscheidet die Kultur, die Sprache und die Tradition. Das allein sind die Elemente, die Nationen schaffen, und, von diesem Standpunkt
[633]
aus gesehen, gibt es in Iran trotz aller Heterogenität der Herkunft nur eine Nation, nur ein Volk, das persische. Soweit überhaupt von einem National- oder Staatsbewußtsein die Rede sein kann, wurzelt es hier. Seine Träger sind selbstverständlich nicht die nomadischen Stämme, die „Iliat“ die, wie alle Nomaden nur ihr Stammesbewußtsein besitzen, und ebensowenig die „Raiat“, die armseligen, steuerüberlasteten, fronenden Fellachen, die den Boden mit ihrem Schweiße düngen: aber die gesamte Städterschaft, Hof, Kaufleute und Bazarbevölkerung, mit ihrem gewaltigen Um und An abhängiger und parasitärer Elemente, ist persisch bis ins Mark und versteht es häufig genug, ihr sehr hoch gesteigertes Nationalgefühl auf die landfremden Metoeken zu übertragen, die neben ihnen in den Budenstädten der Bazare hausen: Armenier, Tataren, Juden usw. Diese Städter bilden zwar nur ein Fünftel der Gesamtbevölkerung, aber sie entscheiden hier, wie überall, über die Ideologien des Gesamtvolkes: „Verfallen oder in voller Blüte, in Persien wie in Afghanistan oder Beludschistan, bewahren alle diese Bazarstädte des Wüstenrandes die gleiche Sprache und die gleichen Sitten, die gleiche Tracht und die gleichen Gedanken, und so ist, über alle Grenzen der heutigen Staaten hinaus, der Kaufmann von Herat der rechte Vetter des Kaufmanns von Teheran.“
Die Geschichte Irans bietet dem Soziologen das interessante Bild eines in allen seinen Hauptzügen immer in gleicher Weise wiederkehrenden Geschichtsverlaufs, dessen Umschwünge wir seit nahezu drei Jahrtausenden zu beobachten in der glücklichen Lage sind.
Der Grundtypus ist der uns vertraute aller „primitiven Eroberungsstaaten größeren Umfangs“. Ein reisiger Stamm von Hirten unterwirft die Bauern seiner Nachbarschaft, setzt sich über sie als Adel fest und konstituiert derart seinen Staat. Dieser primitive Eroberungsstaat unterwirft Nachbarstaaten gleicher Ordnung und wächst derart, bis er seine natürliche Grenze in unüberschreitbaren geographischen Hindernissen oder seine „soziologische Grenze“ in gleichstarken Großstaaten findet.
Je größer der Staat durch diese Zusammenballung geworden ist, um so sicherer und schneller ist er zum Zerfall verurteilt. Denn die Zentralgewalt sieht sich gezwungen, bevor Wegewesen und Geldwirtschaft noch entwickelt sind, den leitenden Beamten der Grenzprovinzen die volle bürgerliche und militärische Gewalt in die Hände zu geben. Diese Markgrafen oder Kastellane oder Satrapen unterwerfen die freie Bauernschaft ihrer Bezirke und schwächen dadurch die Zentralgewalt um ebensoviel, wie sie selbst an Macht gewinnen, bis zuletzt das Reich in eine Vielzahl faktisch selbständiger, wenn auch zuweilen noch durch ein formelles Hoheitsband zusammengehaltener Staaten zerfallen ist. Dann beginnt der Prozeß der Zusammenballung von neuem, und dieses
[634]
Auf und Ab von der Großmacht zum Konglomerat und zurück zur Großmacht erreicht sein Ende erst, wenn nach der Durchführung der vollen Geldwirtschaft und des ohne sie nur schwer einzuführenden staatlichen Wegewesens auch die höchsten Beamten nicht mehr auf „Land und Leute“, sondern auf festes Gehalt gesetzt werden. Von da an sind und bleiben sie fest in der Hand der Krone.
Diesen typischen Verlauf aller naturalwirtschaftlichen, primitiven Großstaaten hat auch das iranische Reich immer wieder durchzumachen gehabt. Er hat sich aber hier in besonderer Weise vollzogen entsprechend dem oben dargestellten, ganz einzigen geographischen Charakter des Gebietes.
Fast überall sonst in der Welt ist „der Gegensatz von Ackerland und Weidesteppe“, auf den Friedrich Ratzel alle Staatenbildung und Geschichtsentwicklung zurückführt, sozusagen unilateral. Irgendwo in einer reichen Talniederung sitzt ein Stamm von wohlhabenden Hackbauern oder an einer Küste ein Volk von Städtern und Seefahrern, und nur eine der Landgrenzen wird von den wilden Hirten bestürmt, die Raub und Herrschaft suchen. In Iran aber sitzen die kriegerischen Nomaden rings in den Randgebirgen, die das gewaltige, nur zum Teil wüstenhafte „schüsseiförmige“ Hochland in der Mitte umgeben. Ihm droht also die Gefahr von allen Seiten, und nicht einmal nur von den, in den Gebirgen lebenden eigenen Sprach- und Stammesgenossen, sondern außerdem noch von Fremden aus Nord und Süd. Wir haben oben dargestellt, daß der Oasenkranz zwischen Randgebirge und Wüste seit unvordenklichen Zeiten die große Heerstraße gewesen ist, auf der die turanischen Hirtenstämme des nordischen Asiens gen Süden und die semitischen Beduinen Arabiens, Arabistans und des Iraq gen Norden auf Raub und Herrschaft auszogen.
Diese Lagerung des Gebiets bringt zweierlei mit sich: erstens ein gewisses stabiles Gleichgewicht in der Macht der nomadisierenden Bergstämme, und zweitens eine dauernde starke Bedrohung der Grenzen und des Bestandes von Gesamtiran durch auswärtige Mächte. Das sind die besonderen Bedingungen, unter denen sich hier jener typische Prozeß der Zusammenballung und des Zerfalls des Großreichs immer wieder abgespielt hat. Wir können auch hier uns wieder ziemlich eng an die Darstellung von Bérard anschließen, der die Soziologie Irans mit gleicher Meisterschaft auf die kürzeste Formel zu bannen verstanden hat wie seine Geographie.
Die Nomaden leben in Clans unter ihren Häuptlingen, den Khans. Aber die Clans ihrerseits sind ziemlich straff organisiert in Stämmen, die unter ihren Großkhanen, den Ilkhans stehen. Ohne die zusammenfassende Autorität eines solchen Stammesfürstentums würde der Stamm verloren sein. Er würde sich sehr schnell in den dann leicht zu Fehden
[635]
ausartenden Reibungen zwischen den einzelnen Clans oder in Zusammenstößen mit feindlichen Stämmen aufreiben, in denen er nur bestehen kann, wenn er zu einer militärischen Organisation von ausreichender Straffheit gegliedert ist. Als Heerführer, als Oberrichter, als Schiedsrichter und Diplomat in sozusagen auswärtigen Dingen ist der Ukhani unter so wilden und gesetzlosen Verhältnissen eine absolute Notwendigkeit. Nur „unter dem Schilde des sklavenhaltenden Patriarchats“, um wieder Ratzel zu zitieren, kann das Nomadenvolk bestehen.
Nun ist es klar, daß im Beharrungszustande die verschiedenen Hirtenstämme einander an Zahl und militärischer Macht ungefähr aufwiegen müssen; denn auch hier gilt das allgemeine Gesetz der wilden Natur, daß jede Art ihrer Umgebung völlig angepaßt ist, d. h. sich in Druck und Gegendruck behauptet.
Aber das gilt eben nur für den Beharrungszustand, für die Statik sozusagen. Im Hin und Her ihrer Geschichte aber können sich vorübergehend sehr große Verschiedenheiten ausbilden. Der eine Stamm kann in unglaublich kurzer Zeit durch Tierseuchen oder besonders harte Winter, die seinen Herdenbestand treffen und ihn in Hungersnot stürzen, oder durch unglückliche Fehden enorm an Zahl und Kraft verlieren; ein anderer kann unter besonders günstigen Umständen in wenigen Jahren gewaltig an Zahl und Kraft zunehmen. Gehört es doch nicht zu den Seltenheiten, daß ein solcher Berghirt, freilich nicht von einer Mutter, 100 lebendige Kinder zählt!
Ist erst einmal ein Stamm ernstlich geschwächt, so bedarf es kaum noch des Auftretens eines „Helden“, eines kriegerischen oder politischen Genies, bei einem der Nachbarstämme, um jenen dem Willen und der Führung eines benachbarten Ilkhanis zu unterwerfen. Ist das aber einmal geschehen, so ist ein Gravitationskern geschaffen, der binnen sehr kurzer Zeit die ganze Masse der kriegerischen, leicht beweglichen Bergstämme unter einem Szepter und Feldherrnstab vereinigt. Denn die zwei zusammengefaßten Tribus sind immer stärker als ein dritter — und eine Koalition der, durch die aufkommende Hegemonie bedrohten, noch unabhängigen Stämme kann infolge der unaufhörlichen Stammesfehden und der Eifersucht der Ilkhanis untereinander kaum jemals zustande kommen. Und so verfügt nach einiger Zeit der erste Sieger, Genie oder nicht, über eine formidable Armee geborener Krieger, die ihm überall gern dorthin folgt, wo Beute zu holen ist.
Der Vollständigkeit halber muß erwähnt werden, daß jene erste Überlegenheit eines Stammes über seinen Nachbarn, die den Anfang des Zyklus darstellt, auch durch denjenigen Vorgang erfolgen kann, den die moderne Soziologie als „Akkulturation“ bezeichnet. Wenn „ein Fürst des Stammhauses“, wie die Bibel sagt, ein Ilkhani, von höher zivili-
[636]
sierten Nachbarn bessere Methoden der Kriegsführung und vor allem bessere Waffen annimmt, hat er von vornherein den Sieg in der Hand. Man denke nur, was in solchen Stammeskämpfen der Besitz des Feuergewehrs gegenüber den primitiven Fernwaffen, dem Bogen und dem Wurfspieße, oder, was in neuerer Zeit der Besitz moderner weittragender Präzisionsgewehre oder gar einer wirksamen Artillerie zu bedeuten hat!
Wenn erst eine Reihe von Stämmen unter dem Stabe eines mächtigen Kriegsherrn zusammengefaßt sind, so winkt ihm der höchste Siegespreis: die Tiara des „Königs der Könige“, die Herrschaft über ganz Iran. Wer den größten Teil des Schüsselrandes besitzt, dem fällt die Schüssel selbst mit Notwendigkeit zu. Das Heer des Empörers steigt herab von seinen Bergen, es trifft in der Ebene auf die Truppen, die der bisherige Großkönig ihm entgegen gesendet hat, und in der Regel genügt eine einzige Schlacht, um das Geschick des ganzen Landes zu entscheiden. Der Sieger findet irgendwo den Schwächling, der die Tiara von stärkeren Ahnen ererbt hat, zwischen den zitternden Weibern seines Harems, und setzt sich selbst die dreifache Krone auf das Haupt.
Solange das neue Herrschergeschlecht in fester Verbindung mit seinem Stamme und dem Leben seines Stammes bleibt, bleibt ihm auch die Krone. Im Jäger- und Kriegerleben von frühester Jugend auf gehärtet und gestählt, bewahren die Fürsten die listige Verschlagenheit, die schnelle Kraft des Entschlusses und die erbarmungslose Härte, die in aller Welt die gekrönten Politiker der Hirtenvölker aus- und kennzeichnet. Und in den ersten Generationen pflegt der Nomade denn auch als Oberkönig noch Nomade zu bleiben. Der Thronerbe wird in der Regel in den Bergen des Stammes nach alter Väterart in harter Zucht erzogen, und der Schah selbst führt ein unstetes Leben, teils aus angeborener Neigung und Erziehung, teils aus wirtschaftlichem Zwang. Solange nicht die Steuern und Abgaben, wenigstens zum allergrößten Teile, in Geld erhoben werden können, und kein vorzügliches und weitverbreitetes Wegenetz besteht, kann er sich mit seinem ungeheuren Gefolge von Kriegern, Zivilbeamten, Priestern, Frauen und Parasiten aller Art garnicht anders „standesgemäß“ ernähren, als dadurch, daß er im Lande herumreist, um die Naturalabgaben der unterworfenen Raiat am Orte ihres Wachstums zu verzehren. Auch dies ein Zug, der uns aus allen naturalwirtschaftlichen Feudalstaaten, auch denen Westeuropas, wohlbekannt ist. So zogen Karl der Große, Boleslaw der Rote und der Großfürst von Kiew durch ihre Reiche.
Aber zu irgendeiner Zeit wird einer der Erben des Siegers dieses Wanderlebens überdrüssig. Er baut sich seine Kaiserstadt. Wir sagen ausdrücklich: er baut sich seine Kaiserstadt. Denn der Sitz der Zentralmacht hat fast ausnahmslos mit jeder Dynastie gewechselt. Hier
[637]
spielt nicht nur die Eitelkeit des neuen Herrn ihre Rolle, der ganz aus eigenem schaffen und wohnen will, sondern hier entscheiden vor allem politische und strategische Verhältnisse. Der Herrscher muß einerseits immer die Nachbarschaf t seines eigenen Stammes suchen, den er, und der ihn groß gemacht hat, und auf den allein er sich mit Sicherheit verlassen kann, mehr noch als auf seine Leibwache der „Freunde des Königs“, der „Schahsewenen“, die unzählige Male in der Geschichte Irans wiederkehren. Dadurch ist ihm die ungefähre Lage der neuen Kaiserstadt, im Westen oder Osten, Norden oder Süden, vorgeschrieben, und des genaueren wird sie bestimmt durch die Lage der Handelswege und vielleicht eines besonders gefährlichen Grenznachbars, den es aus strategischen Gründen gut ist, näher im Auge zu behalten.
An diesem Ort, der auch mit Wasser und Baumwuchs wohl ausgestattet und lieblich gelegen sein muß, entsteht wie durch einen Zauberschlag die neue Stadt. Ihr Baumaterial ist vergänglich: Holz und Luftziegel, aber sie ist verschwenderisch mit Gold und Emaille ausgestattet, und die Paläste, die Tempel oder Moscheen und die gewaltigen Stadtviertel der Bazare ragen stattlich über die niederen Wohnstraßen empor. Eine ungeheure Bevölkerung strömt sofort hier zusammen: der Hofhalt des Großkönigs samt seiner Garde und seiner Beamtenschaft und der Hofhalt seiner Großen umfassen schon allein viele Tausende von Menschen. Dann übersiedeln halb freiwillig, halb gezwungen, die Kaufleute und Handwerker der entthronten Hauptstadt, der entthronten Dynastie. Sie vermögen ja nur zu leben, wo der Luxusbedarf der Großen dieser Welt sie in Nahrung setzt. Und um diesen schon mächtigen Kern herum siedelt sich dann scharenweise das „menu peuple“ an: die Landwirte und Gärtner, die den neuen Riesenmarkt zu versorgen haben; das Gesindel von Gelegenheitsarbeitern, Nichtarbeitern, Prostituierten und Verbrechern, die sich um jeden großen Markt ansammeln, und in weitem Umkreise die Scharen der Bergnomaden mit ihren Herden, die sich hier zu einer Art von halber Ansässigkeit •entwickeln. Die entthronte Kaiserstadt aber fällt in Trümmer, wie vorher so viele ihrer geschichtsberühmten Schwestern, von dem biblischen Rhages, von Pasargades, Susa, Ekbatana und Persepolis bis auf das Schiras und Isfahan der neueren Zeit.
Dieser Übergang zur dauernden Seßhaftigkeit hat aber mit Notwendigkeit verhängnisvolle Folgen persönlicher, politischer und wirtschaftlicher Art für den Bestand der Dynastie.
In persönlicher Beziehung bedeutet sie auf die Dauer den körperlichen Verfall der einst so starken Rasse. Eingelullt in den Schatten seiner prachtvollen Fruchtgärten, seiner „Paradiese“ mit dem sanften Fall ihrer Springbrunnen, von der Glut des Tieflandes erschlafft, der er kaum in der heißen Sommerzeit sich entzieht, um ein paar Meilen
[638]
weiter talaufwärts die Kühle einer Sommerresidenz zu genießen, entwöhnt sich der König der Könige schnell des Sattels, des Bogens und des Schwertes. Den Müßigen und durch allzu reichliche Kost Überreizten entnerven die Haremsfreuden mit äußerster Schnelligkeit vollkommen. So wird denn bald „die frische Farbe der Entschließung von des Gedankens Blässe angekränkelt“; an die Stelle der schnellen und tatkräftigen Lösung der Fragen durch den Strick des Henkers oder das Schwert tritt die Palast- und Haremsintrigue, die bis zur Meisterschaft geübte Kunst des Hinhaltens, des Hinauszögerns, des „Fortwurstelns“. Je schwächer der Herrscher wird, um so mißtrauischer wird er, und er wagt in seinem tief eingewurzelten Mißtrauen gegen alles, was einen Hauch von Anspruch auf seinen Thron hat, nicht mehr, den Erben der Krone seinem Stamme zur Erziehung zu übergeben, sondern folgt willig den Bitten der verzärtelten Favoritin, die ihr Kind bei sich zu behalten wünscht; um so williger, als dem genüßlerischen und äußerlich verfeinerten Großstädtertum das rauhe Jäger- und Kriegerleben der Bergstämme jetzt als lächerliche Barbarei erscheint. Von da an wächst auch der Thronerbe, oder wachsen sämtliche möglichen Thronerben, in der schwülen, von allzu früher Sinnenlust, Weiber- und Eunuchenintrigen erfüllten Atmosphäre des Hofes auf ; sie sind als Jünglinge schon blasiert, pervers und körperlich wie seelisch verdorben; die allerärgsten Ausschweifungen in Bacho — auch unter dem Gesetze des Korans: der französische Reisende Chardin beschreibt gargantueske Orgien — und in Venere sind an der Tagesordnung; und, weit schlimmer als das, das früh blasierte Geschlecht ergibt sich auch daneben, oder ausschließlich von einem gewissen Alter an, den bösesten geschlechtlichen Lastern von der Päderastie abwärts. Auch dieser Zug ist typisch für alle feudalen Fürstenhöfe im erschlaffenden Klima der Subtropen und Tropen, auch Sardanapal wiederholt sich regelmäßig. Daß ein solches Herrschergeschlecht die Männer nicht aufbringen kann, die imstande sind, das Schiff des Reiches in Sturmzeiten durch den Klippengürtel zu steuern, bedarf keiner weiteren Ausführung. Und der letzte Rest der Kraft wird zerbrochen durch die gleichfalls überall vorhandenen typischen, uns bekannten Zerwürfnisse innerhalb der engsten Familie des Großkönigs. Wer ist der berechtigte Erbe der Krone ? Schon zu Lebzeiten des Herrschers spalten sich darüber Hof und Land in Parteien, deren gegenseitige Intrigen um so feiner und künstlicher sind, weil königliche Frauen an ihrer Lösung entscheidend interessiert sind, und mit dem Tode des Kronenträgers droht fast regelmäßig der Bürgerkrieg. Und der bedeutet, wenn er zwischen zwei ungefähr gleichen Prätendenten ausbricht, eine so beträchtliche Schwächung der königlichen Hausmacht, daß irgendein starker Mann mit seinem kühnen Reiterstamm hinter sich es leicht hat, sich zum Majordomus aufzuwerfen oder sofort die Tiara zu erringen.
[639]
Politisch bedeutet die dauernde Niederlassung des Hofs mit seiner Garde und Beamtenschaft eine ungeheure Erschwerung für den Zusammenhalt des gewaltigen Reiches. Solange der Herrscher „seinen Beruf im Umherziehen ausübte“, war er allen Provinzen gleich nah und fern, und kein Machthaber war vor seiner schweren Hand sicher. Jetzt setzt sich das schon oben angedeutete allgemeine soziologische Gesetz durch, daß die Abhängigkeit der örtlichen Gouverneure, altpersisch gesprochen: der Satrapen, im Quadrat der Entfernung abnimmt; ein z. B. im äußersten Nordwesten, in Täbris oder sogar in Teheran, dauernd sitzender Schah, der seine Garde dringend braucht, um die Aufstandsgelüste der benachbarten Bergstämme und die Eroberungsgelüste mächtiger Grenznachbarn abzuwehren, verfügt kaum über die nötigen Machtmittel, um in Balkh, im äußersten Nordosten, oder in Kandahar, im äußersten Südosten, einen widerspenstigen Markgrafen niederzuhalten, dem er ja selbst ein starkes stehendes Heer samt aller militärischen, zivilen und richterlichen Amtsgewalt in die Hand geben mußte, damit er seine Provinz gegen die Grenzfeinde zu schützen imstande wäre.
Was aber vor allem durchschlägt und den Hexenkreis schließt, aus dem es für die Dynastie keinen Ausweg gibt, sind die wirtschaftlichen, die staatsfinanziellen Folgen des Verzichts auf das Nomadenleben des Hofes: der Seßhaftwerdung in der Kaiser Stadt.
Dieses gewaltige Reich hat bereits unter den primitiven Verhältnissen früher Zivilisationsstufen einen viel höheren Bedarf an öffentlichen Mitteln als selbst gleich große Reiche Europas. Hier entscheidet die geographische Situation. Aller Reichtum und alle Wehrmacht ruht hier wie überall auf der Bauernschaft, aber über die Zahl der Bauernschaft entscheidet hier, in Iran, nicht wie im Okzident die vorhandene Fläche nutzbaren und durch Waldrodung pflugfähig zu machenden Bodens, sondern lediglich die Bewässerung. Wir sagten schon, daß sich die Wüste überall dort in Fruchtland verwandelt, wo man Wasser auf sie bringt, und daß man fast überall Wasser findet, wo man ernstlich danach sucht : aber es kostet schweres Geld, die Wasserwerke zu erbauen und zu erhalten, und darum haben in diesem halb steppenhaften Bezirke schon auf früher Zivilisationsstufe die Staaten einen Finanzbedarf, von dem ihresgleichen in der Regenzone nichts ahnen.
Dazu kommt ein zweites. Mögen auch kräftige Herrscher die Wüste durch großzügige Wasserwirtschaft noch so sehr eingeengt haben: ihrer vollständig Herr geworden ist keiner. Das kann, wenn es überhaupt möglich ist, nur den gewaltigen Mitteln der modernsten Technik des Stahles und des Dynamit, der Talsperren und Elektrizitätswerke gelingen, wenn es mit so großem Zuge durchgeführt wird, wie es die Amerikaner neuerdings in ihren regenlosen Gebieten unter-
[640]
nommen haben, wo sie angeblich für 80 Millionen Menschen Fruchtlana schaffen wollen[1]. Von derartigen Wundern der Technik konnte weder im alten, noch bisher im neuen Iran die Rede sein, wenn auch hier, wie im Peru der alten Inka, durch rücksichtsloseste Ausnutzung der schwach bewaffneten Menschenkraft Werke der Wasserführung entstanden sind, die heute noch die Bewunderung des modernen Ingenieurs erregen.
Trotzdem blieben zwischen den einzelnen Oasen der Wüste auch in den besten Zeiten ausgiebigster Wasserwirtschaft gewaltige Wegstrecken übrig, die der Staat im Interesse seiner strategischen Bereitschaft und seiner Steuerwirtschaft und vor allem des Handels mit einem brauchbaren und polizeilich gesicherten Wegenetz überbrücken mußte. Dazu kam und kommt das Wegenetz durch die Gebirge zum Verkehr mit den Randprovinzen und dem Auslande. Auch das bedingte einen sehr starken Finanzbedarf für die Anlage der Straßen mit ihren Rasthäusern, Wasserstellen und Polizeistationen und für ihre Unterhaltung in dem schwierigen Gelände der Hochgebirge, die die Straßen durch Schnee, Lawinen und Regenstürze schnell vernichten, und der Wüsten, die sie durch Sandstürme fast noch mehr bedrohen.
Solange der Schah auf seinen regelmäßigen Zügen durch das ganze Reich diese Straßen selbst benutzt, hat er, und haben die leitenden Beamten der Zentralbehörde und des Bezirkes selbst das lebendigste Interesse an ihrer gehörigen Unterhaltung. Sitzt aber der Hof erst einmal in seiner Prunkstadt fest, so wandern die Gelder der Straßenverwaltung und des Wegeschutzes zum größten Teil, wenn nicht ganz, in die Taschen der Beamten; der Handel geht zurück, der Aufschlag, den er nehmen muß, wächst durch Vermehrung der Transportkosten und die ungeheuerlich anschwellende Risikoprämie ins Phantastische: der Produzent erhält einen geringeren Preis, der oft seine Kosten nicht deckt, und der Konsument soll mehr bezahlen, als er aufbringen kann. So leiden Landwirtschaft und Gewerbe der Oasen stark, und die Bevölkerung muß notgedrungen abnehmen oder aus der schon gewonnenen Seßhaftigkeit zum Nomadenleben zurückkehren.
Schlimmer aber ist, daß von dem kritischen Zeitpunkt an die verfügbaren Mittel der Zentralgewalt für Wasserhaltung, Straßenbau und Wegeschutz in fast katastrophaler Weise einschrumpfen. Sobald der Hof mit seinem ungeheuren Bestände an Menschen und Tieren an einer Stelle festsitzt, bleibt der größte Teil der Naturalsteuern des ganzen Reiches „an den Rädern hängen“. Man kann Schwergüter wie Korn usw. nicht Tausende von Kilometern auf schlechten Wüsten- und Bergstraßen transportieren; man kann ihren Wert nur voll ausnützen, ja,
[1] Vgl. Smythe, The Conquest of arid America, New York 1905.
[641]
sie haben fast nur Wert überhaupt, wenn man sie an Ort und Stelle verzehrt.
Nun aber ist selbstverständlich der sozusagen private Bedarf des Hofes von dem Augenblick der Seßhaftwerdung an ein ungeheuer viel größerer als vorher. Bauen ist der teuerste Luxus, und eine Kaiserstadt zu bauen, die ihre berühmten Vorgängerinnen durch ihre Größe und die Pracht ihrer Paläste, Tempel, Karavansereien, Gärten und Springbrunnen womöglich noch übertrumpfen soll, überschreitet leicht die Finanzkraft selbst eines großen, reichen und willigen Volkes. Dazu kommen noch die Ausgaben für einen immer unmäßiger anschwellenden Harem mit seiner Unzahl von Bedienten und Parasiten, kommen die Ausgaben für Kunst und Wissenschaft, durch die der barbarische Emporkömmling sein Barbarentum vergessen zu machen sucht, und kommt vor allem die Weiber- und Günstlingswirtschaft des Hofes, der die Kraftquellen der Nation an Parasiten vergeudet. Die zwei historischen Prozesse vereinen sich also hier, die die reichsten Fürstengeschlechter und Völker der Geschichte an den Bettelstab gebracht haben: der Zwang, unter dem der Feudalkönig steht, seine Hausmacht an Land und Leuten an seine Würdenträger zu verlehnen oder zu verschenken, um die bedurften Leistungen, namentlich militärischer Art zu erlangen: das Schicksal z. B. der Hohenstauf en ; — und der ungeheuerliche Luxusbedarf des Hofes, der unter Ludwig XIV. und dem Regenten das reiche Frankreich zum Bankrott brachte.
Fassen wir noch einmal den Zustand der Reichsfinanzen vor und nach dem verhängnisvollen Entschluß zur festen Niederlassung in einer neu erbauten Reichshauptstadt zusammen. Vorher zwar schon ein barbarisch üppiger, aber doch im Verhältnis zur Tragkraft des Reiches erträglicher Luxus des Hofes, gutes Wegewesen, kraftvolle Wasserwirtschaft, kein Verlust an Transportspesen auf die Massengüter der Naturalsteuern, ausreichende Wegepolizei, straffe Aufsicht über alle lokalen Machthaber und daher restloser Eingang aller Steuern. — Nachher aber ungeheure Ausgaben für Bauten und andere Luxuszwecke der übermäßig vergrößerten Hofhaltung, kolossale Transportverluste, Verfall der Wasserwerke, der Straßen und des Straßenschutzes, Verselbständigung der entfernten Provinzen, Verminderung ihrer Steuereingänge auf das äußerste, und schließlich Verarmung der Hausmacht, des, modern ausgedrückt, Domanial- oder Kämmereibesitzes des Herrscherhauses, durch lüderliche Verwaltung und unmäßige Verausgabung.
Die verhängnisvolle Folge ist ein bis zur Unerträglichkeit wachsender Steuerdruck auf die einzigen ernstlichen Steuerzahler des Reiches, die Raiat, die Bauernschaft. Sie werden doppelt oder dreifach geschunden: von den Steuerpächtern des Staates, von den Grundherren, die der Schah über sie setzte, und schließlich auch noch von den lokalen
[642]
Beamten zu ihrem eigenen Vorteil. Unter diesem Druck geht die Bevölkerung, und noch stärker ihre Kaufkraft zurück. Die Bauern sterben aus oder fallen in den Nomadismus zurück, entziehen sich dem Druck der Steuerschraube durch fortwährende Wanderung, die selbstverständlich den Wohlstand des Landes schwer schädigt; und bei alledem langen die Einnahmen des Fiskus nirgends hin, um die wichtigsten, die vitalsten Bedürfnisse des Reiches zu decken. Die Wasserwerke verfallen, die Straßen verwahrlosen, die Wasserstellen vertrocknen, die Polizeitruppe, niemals besoldet, löst sich auf oder macht mit den immer raublustigen Hirtenstämmen gemeinsame Sache. Handel und Wandel gehen empfindlich zurück, das Steueraufkommen sinkt noch mehr: ein echter circulus vitiosus, in dem jede Folge zur Ursache der Verstärkung ihrer eigenen Ursache wird. Und zuletzt ist der Schah nicht mehr imstande, ein reguläres Heer zu unterhalten, stark genug, um seinen Thron gegen den Ansturm eines erfolgreichen Nomadenhäuptlings zu halten. Und dann kann der Zyklus von neuem beginnen. Bérard ist der Meinung, daß der· Finanzbedarf der iranischen Reiche für die geschilderten, unbedingt notwendigen Zwecke gar nicht anders befriedigt werden könne, als durch Ausplünderung eroberter Nachbarländer; und ist geneigt, die typische gewaltsame Expansion während der Regierungszeit der großen Kriegerschahs auf diese Staatsnotwendigkeit zu beziehen. Wir halten diese Auffassung für irrig. Die Expansion bis zur äußersten soziologischen oder natürlichen Grenze ist ein gemeinsamer Charakterzug aller feudalen Großreiche, auch derjenigen mit sehr geringem öffentlichen Finanzbedarf; und auf der anderen Seite ist es sicher, daß eine vernünftig verwaltete Bauernschaft, der die Früchte ihres Fleißes gesichert sind, Meliorationsarbeiten von einer Größe und Kostspieligkeit auszuführen und zu erhalten imstande ist, wie kein Großkapital sie je wagen kann. Sismondi hat in seinen „Nouvelles Etudes“ staunend den Fall einer derartigen Großmelioration in der Campagna beschrieben, (er gibt über den Begriff des Kapitals und die Möglichkeit der Kapitalbeschaffung Aufschlüsse, die mit der landläufigen Theorie — tant pis pour la théorie — durchaus nicht vereinbar sind[1]); und die Geschichte der Mormonen und ihrer grandiosen Bewässerungswerke zeugt noch deutlicher dafür, was eine kleine Gruppe gutgeleiteter gleicher und freier Bauern selbst in der Salzwüste zu schaffen fähig ist[2].
Immerhin mag es in früheren größeren Zeiten ein guter Start für den Begründer einer neuen Dynastie gewesen sein, wenn er mit einem vollen Staatsschatz[3], den ihm das besiegte Ausland geliefert hatte,
[1] s. s. III, s. 599.
[2] Vgl. unsere „Wege zur Gemeinschaft“, S. 501ff.
[3] Die Hohenzollern hätten es in der Mark ohne ihren großen, aus der Stadtwirtschaft eingebrachten Geldbesitz auch nicht geschafft, ebenso wenig Wilhelm I. in England.
[643]
seine Verwaltungsreformen und seine Prachtbauten bestreiten konnte. Wer ganz Indien ausgeplündert[1], oder, um den berühmtesten Fall unseres Altertums anzuführen, die Schätze des Krösus gewonnen hatte, konnte vieles leisten, ohne seine eigenen Untertanen allzu hart zu besteuern. Und so ist es wohl verständlich, daß zu den Aufgaben, die die persische Tradition einem großen Herrscher stellt, außer dem Schutz der Straßen, der Bändigung der Nomaden, der Bestrafung ungerechter Richter, der Jagd auf die großen Raubtiere, und schließlich außer der Pflege von Kunst und Wissenschaft, auch der in weiten Eroberungen gewonnene Kriegsruhm und Reichtum gehört.
In unseren modernen kleingewordenen Zeiten gibt es eine zweite, mit weniger Anstrengung und Gefahr verbundene Methode, um dem Staatsschatz fremde Gelder zuzuführen : die Methode der Staatsanleihe. Und wahrscheinlich wird das persische Reich nie wieder zu Macht und Glanz gelangen, wenn es nicht mit fremdem Kapital wenigstens den Anfang des unerläßlich Notwendigen an Wegen (Eisenbahnen) und Wasserwerken herstellt. Die Vollendung könnte dann unter einer sauberen und sparsamen Verwaltung aus den eigenen Kräften des Volkes geschehen. Es ist viel schwerer, die Masse erst einmal in Bewegung zu bringen als in ihr zu halten. Und hier wird jeder weitere Schritt leichter, in dem Maße, wie die ersten Schritte Volkszahl und Reichtum gehoben haben. Eine saubere und sparsame Verwaltung würde solche Anleihen auch zu erträglichen und immer mehr erleichterten Bedingungen erhalten und sich nicht gezwungen sehen, die Substanz des Volksreichtums selbst aus der Hand zu geben. Wenn aber eine unsaubere und verschwenderische Regierung hinter das bequeme Mittel der Pumpwirtschaft im großen kommt, dann ist die abschüssige Bahn betreten, die mit Notwendigkeit in kurzer Zeit wirtschaftlich zum Bankrotte und politisch zur Abhängigkeit von fremden Mächten führen muß; denn Persien ist schon lange nicht mehr mächtig genug, um sich einen fröhlichen Staatsbankerott leisten zu können.
Die letzten Kadscharen, von Nasr-ed-din Schah an, haben sich der zuletzt besprochenen Methode ausgiebig bedient. Mit den Europareisen des Schah-in Schah zu den Weltausstellungen fing das Unglück an. Der Geldwert steht in Europa sehr wesentlich tiefer als in Persien, und die Reisen selbst und noch mehr die Ankäufe jeden
[1] Nach Angabe Sir Jonas Hanways, eines englischen Kaufmanns, der von 1743—48 in Persien war und ein Buch: „Historical account of british trade over the Caspian“ geschrieben hat, betrug die Gesamtbeute Nadir Schahs 1750000000 M., wovon für 750000000 M. Barren (Gold und Silber) gewesen sein sollen. Der Wert der Juwelen, darunter die Juwelen des „Tâcht-i Taûs“ betrug mindestens 225000000 M. (Da diese Angaben aus dem deutschen Werke von F. Stoltze und F. C. Andreas: „Die Handelsverhältnisse Persiens“ stammen, wurde die Währung in Mark angegeben.)
[644]
erdenklichen europäischen Schundes kosteten Summen, mit denen der Schah in Teheran das Vielfache an wirklichem Genuß und wertvollen Gütern hätte häufen können; aber die Neugier und die kindische Spiellust des Barbaren waren stärker als alle staatsmännischen Erwägungen, und so haben denn er und seine beiden Nachfolger für Summen, die schon vor dem Weltkriege für europäische Begriffe winzig waren, die Macht Persiens an die Gläubiger verraten und seinen Reichtum verschachert. Von Norden her drang Rußland, von Süden und Südosten her England immer tiefer in gewaltsamer Eroberung und „friedlicher Penetration“ ins Land ein; im Süden beherrscht die Firma Lynch Strom- und Landstraßen; im Norden hatte Rußland die Eisenbahn bis Täbris und die Landstraße bis zur Hauptstadt Teheran in der Hand; die Kosaken, die den Wachtdienst auf dieser Straße vollzogen, waren ausgebildet und befehligt von russischen Offizieren, die ihren Sold aus der russischen Staatskasse empfingen. Daß alle Bergschätze des Landes, daß die Wälder und Telegraphenleitungen an ausländische Kapitalisten, hinter denen ihre Regierung stand, verschleudert wurden, ohne auf die Zukunft der eigenen Volkswirtschaft irgendeine Rücksicht zu nehmen, gehört zum Bilde; und ebenso, daß die beiden wetteifernden Weltmächte, die an dem Reiche der Kadscharen „interessiert“ waren, in gegenseitiger Eifersucht jede wirkliche Reform der Verwaltung verhinderten: Morgan Shuster mußte weichen, weil er allzu erfolgreich neue Quellen für den Staatsschatz anschlug; die belgische Zollverwaltung und die schwedische Gendarmerie desgleichen: sie arbeiteten zu gut und zu ehrlich. Die beiden mächtigen Gläubiger hatten nur das eine Interesse, das alle Güterschlächter und Viehwucherer haben: ihr Opfer durch immer neue Wucherkredite zu immer gröblicherer Mißwirtschaft zu treiben, um in dem schließlich unvermeidlich gewordenen Bankrott möglichst viel Profit herauszuschlagen. Darum schützten sie den Kad- scharen-Schah militärisch gerade genug, um ihn vor Rebellion seitens irgendeines Ilkhani zu bewahren, und verführten ihn gerade dadurch zu einer immer verrückteren Finanzwirtschaft, die für jeden Luxus der verkommenen Hofgesellschaft Mittel in Hülle und Fülle hatte, aber für Wehrzwecke, geschweige denn für Verwaltungsreformen und Landesverbesserungen nichts, sage und schreibe nichts, übrigließ.
[645]
Sechster Abschnitt.
Der moderne Verfassungsstaat.↩
I. Begriff. ↩
Wir haben zum Schlüsse des vorigen Abschnittes den Besieger, Nachfolger und (sine beneficio inventarli) Erben des absoluten Staates als den „modernen Verfassungsstaat“ bezeichnet und im Titel dieses Abschnitts die Bezeichnung beibehalten. Damit machen wir dem Sprachgebrauch eine Einräumung, der sich daran gewöhnt hat, die Staaten vorwiegend nach ihrer verfassungsrechtlichen Konstruktion zu betrachten und zu benennen; wie wir ja auch im vorstehenden uns regelmäßig der so orientierten Termini bedient haben.
Aber auch hier wird uns die rechtliche Form nur ganz nebenbei interessieren, insofern sie sich als der Ausdruck des inneren Wesens darstellt. Das ist aber durchaus nicht immer der Fall. Jellinek verlangt mit Recht, daß die „politische Anschauungsweise der Staaten streng von der juristischen getrennt werde“ [1], und zwar weist er die erste der „auf das reale geschichtliche Leben der Staaten gerichteten Betrachtung“ [2] zu, also der Staatssoziologie (seiner „Allgemeinen Staatslehre“), die wir hier betreiben, während die rechtliche Betrachtung der Staatsrechtslehre vorbehalten ist. Die rechtliche Verfassung gibt nämlich oft genug über das wirkliche Wesen des Staates keine genügende, und zuweilen sogar unmittelbar falsche Auskunft. „Auch geschriebene starre Verfassungen können nicht hindern, daß sich neben ihnen oder gegen sie ein ungeschriebenes Verfassungsrecht entwickelt, so daß auch in solchen Staaten neben der formellen Verfassung rein materielle Verfassungsrechtssätze sich bilden“ (536). So z. B. war „Athen zur Zeit des Perikles politisch Einherrschaft, Rußland stand unter Paul I. einige Zeit unter der Herrschaft des allmächtigen Kammerdieners des Kaisers, andere Monarchien wurden zeitweilig von Maîtressen oder Beichtvätern regiert“ (665). Politisch ist der Präsident der Vereinigten Staaten mächtiger als der König von England, aber rechtlich steht dieser viel mächtiger da, insofern ihm über jede Änderung der Rechtsordnung des Staates die höchste Entscheidung zusteht
[1] Jellinek, a. a. O. S. 744.
[2] Jellinek, a. a. O. S. 665.
[646]
(736). Ähnliches gilt auch für die Stellung von Staaten zueinander: ».Rechtliche Selbständigkeit ist nämlich selbst bei weitgehender politischer Abhängigkeit möglich“ (744). Ja, der Gegensatz der beiden „Verfassungen“ ist sogar so groß, daß gewisse ungeschriebene Verfassungsrechte gar nicht juristisch formuliert werden können, ohne die rechtliche Verfassung aufzuheben: wenn die in England faktisch bestehende Herrschaft des Parlaments über den Monarchen in den Buchstaben des Gesetzes aufgenommen würde, so wäre damit die monarchische Staatsform völlig zerstört (702/3).
Jellinek hätte hinzufügen können, daß diese Diskrepanz zwischen geschriebener und ungeschriebener Verfassung, die in den anderen Staatsformen als eine Abnormität auftritt, im modernen Verfassungsstaat geradezu essentiell ist. Es kann nicht anders sein in einem Staatswesen, dessen herrschende Klasse gewisse Vorrechte faktischer Art besitzt, aber sowohl durch ihre alte Ideologie wie auch durch ihr Klasseninteresse gehindert ist, diese Rechte verfassungsmäßig zu formellen Privilegien zu erheben. Denn sie bekennt und sie braucht Wirtschaftsfreiheit, freie Konkurrenz, — wie sie sie versteht. Davon später.
Diesen inneren Widerspruch hat Riehl sehr fein empfunden und herausgearbeitet: „Das politische Gebilde der konstitutionellen Monarchie ist hauptsächlich von dem Bürgertum herausgearbeitet und verfochten worden. . . . Der Konstitutionalismus ist die Machtfrage des Bürgertums. ... Er entspricht, als die Theorie der politischen Mitte, der bewegenden Mitte, dem Bürgerstande als dem Mittelstande. . . . Aber verhehlen wir uns nicht, daß der Konstitutionalismus dem politischen Philistertum ebenso nahe steht, als der Bürger dem sozialen Philister. . . . Der bürgerliche Konstitutionalismus wollte Fürsten, aber nicht von Gottes Gnaden. Konstitutionelle Monarchie, aber doch zugleich eine demokratische, „auf breitester demokratischer Grundlage“. Einen König, der herrscht, aber nicht regiert. Der freisinnige Bürger war froh, daß es nebenbei noch Fürsten gab, er erschrak aber, als der König von Preußen beim Kölner Dombaufeste laut sagte, es gebe noch Fürsten. Er wollte eine Kammer, die den Minister in die Tasche stecken könne, aber darum doch nicht selbst regiere. . . . Eine Republik in Frankreich, damit die deutschen Fürsten Respekt vor dem Konstitutionalismus behalten möchten. Deutsche Grundrechte, aber mit Ausnahmen. Religionsfreiheit, aber keine Jesuiten, Klöster und Freigemeindler. Volksbewegung, Volksforderungen, Sieg des Volkes, — aber keine Revolution. Bürgerwehr, aber keine allgemeine Volksbewaffnung. . . . Man wollte, wie der beliebte technische Ausdruck lautete, gleich weit entfernt bleiben von „der Anarchie wie von der Reaktion“. Dadurch verfiel man zuerst der Anarchie und dann der Reaktion. Durch den Drang, nach beiden Seiten gerecht zu sein, durch
[647]
die Konsequenz der Doktrin, wo doch die gegebenen Tatsachen keineswegs gleich konsequent blieben, ging alles Spiel verloren“ [1].
In dieser seltsamen Ubergangsform vom absoluten Staat, von dem sie die damals notwendige, heute verhängnisvolle Zentralisation, den Bureaukratismus, das stehende Heer, die Nivellierung aller Individualität zum „Staatsbürgertum“ und anderes übernommen hat, zu neuen noch unbekannten Formen des Gemeinlebens ist also die Diskrepanz zwischen geschriebener und ungeschriebener Verfassung kein Zufall, sondern ist das Wesen der Dinge selbst. Wir sind daher wohl legitimiert, wenn wir uns um die rechtliche Verfassung, die so krasse Unterschiede und Gegensätze verhüllen kann, wenig kümmern und uns auf die „rein materiellen Rechtssätze der ungeschriebenen Verfassung“ allein einstellen.
Oder vielmehr: auf deren Grund und Ursache, auf jene „bestimmende tätige Kraft, welche auf alle Gesetze, die in diesem Lande erlassen werden, derart einwirkt, daß sie in einem gewissen Umfange notwendig so und nicht anders werden wie sie sind, also auf die tatsächlichen Machtverhältnisse, die in einer gegebenen Gesellschaft bestehen“ [2]. „Ein König, dem das Heer gehorcht und die Kanonen — das ist ein Stück Verfassung“ (47) . . . „Ein Adel, der Einfluß bei Hof und König hat (47) .... die Herren Borsig und Egels, die großen Industriellen überhaupt (49) . . . die Bankiers Mendelssohn, Schickle, die Börse überhaupt — das ist ein Stück Verfassung“ (50).
Indem wir dergestalt nur auf die bestehenden Machtverhältnisse unser Augenmerk richten, ist es uns erlaubt, als den „modernen Verfassungsstaat“ alle jene Staaten zusammenzufassen, die in ihren Rechtsverfassungen die volle Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz ausgesprochen haben, oder die, mit anderen Worten, die rechtliche Ungleichheit der Stände in der Hauptsache beseitigt haben, mag auch vielleicht noch in Gestalt eines Ober- oder Herrenhauses oder einer Adelskammer ein anachronistischer Rest der alten Privilegien fortbestehen, oder mag in einem Zensuswahlrecht noch ein Rest der alten politischen Ungleichheit sich erhalten haben [3].
Kurz, wir verstehen unter dem modernen Verfassungsstaat den nachrevolutionären Staat schlechthin und fassen in dem Begriff die konstitutionelle und die parlamentarische Monarchie sowie die Republik zusammen. Wohin die Sowjets gehören, läßt sich im Augenblick nicht mit Sicherheit aussagen: faktisch ist ihr Staat zur Zeit dem primitiven Eroberungsstaat sehr ähnlich; er ist die mit Waffengewalt er-
[1] Die bürgerliche Gesellschaft, S. 245ff.
[2] Ferd. Lassalle, Über Verfassungswesen, Gesamtwerke, hrsgg. v. Blum, I, S. 45.
[3] „Der Staat der modernen Demokratie“ faßt Lamprecht (Staatsform und Politik im Lichte der Geschichte, Hdb. d. Pol. I, Aufl. I, S. 27) wie wir zusammen.
[648]
rungene und aufrecht erhaltene Herrschaft einer Gruppe über die anderen : der Absicht seiner Gründer zufolge soll er sich ja nach einem gewissen Übergangszustande in eine Gestalt verwandeln, die im historisch-soziologischen Sinne überhaupt nicht mehr „Staat“, sondern etwa unsere „Freibürgerschaft“ sein soll.
Wenn wir dieses noch in voller Bildung begriffene Gebilde zunächst aus unserer Betrachtung ausschließen, so entsteht die Frage, welches denn die „tatsächlichen Machtverhältnisse“ sind, aus denen immer die ungeschriebene, und oft auch die geschriebene Verfassung dieser Staaten hervorgeht.
Die Antwort gibt uns schon die geschichtliche Darstellung, mit der wir das vorige Kapitel beschlossen : überall war es das Interesse des neu aufgekommenen Standes der „Kapitalisten“, das den alten Staat des mit den Feudalgewalten verbündeten absoluten Königtums im offenen Kampfe zu Boden warf. Und so ist es denn für uns das gleiche, ob wir sagen: moderner Verfassungsstaat oder kapitalistischer Staat. Dieser Staat ist, wie Sombart einmal sagte, nichts als „das Gehäuse des Kapitalismus“.
II. Die Statik.
(Der Klassenstaat.) ↩
Dieser Staat möchte sich gar zu gerne als die „Gemeinschaft“ ausgeben. Das hat Nietzsche im „Zarathustra“ in prachtvollen Zornesworten angeprangert und gezeigt, daß gerade die Edelsten dieser Täuschung am leichtesten zum Opfer fallen: „Staat heißt das kälteste aller Ungeheuer, kalt lügt es auch; und diese Lüge kriecht aus seinem Munde: ,Ich, der Staat, bin das Volk'. Lüge ist's! Schaffende waren es, die schufen die Völker und hängten einen Glauben und eine Liebe über sie hin; so dienten sie dem Leben. Vernichter sind es, die stellen Fallen auf für Viele und heißen sie Staat: sie hängen ein Schwert und hundert Begierden über sie hin. . . . ,Auf der Erde ist nichts Größeres als ich: der ordnende Finger bin ich Gottes', also brüllt das Untier. Und nicht nur Langgeohrte und Kurzgeäugte sinken auf die Knie. Ach, auch in euch, ihr großen Seelen, raunt er seine düsteren Lügen! Ach, er errät die reichen Herzen, die gerne sich verschwenden. Ja, euch errät er, ihr Besieger des alten Gottes ! Müde wurdet ihr im Kampfe, und nun dient eure Müdigkeit noch dem neuen Götzen ! Helden und Ehrenhafte möchte er um sich aufstellen, der neue Götze! Gerne sonnt er sich im Sonnenschein guter Gewissen, das kalte Untier.“ Nein, auch dieser Staat, gerade dieser Staat, ist nicht „Gemeinschaft“, sondern „Gesellschaft“, wie auch Tönnies von ihm sagt [1]. Er
[1] Gemeinschaft und Gesellschaft, S. 202.
[649]
ist grundsätzlich noch immer dasselbe Wesen wie der primitive Eroberungsstaat und der Feudalstaat in seinen verschiedenen Entwicklungsstufen bis zum Absolutismus herauf. Trotz aller Anerkennung der Menschenrechte, trotz der formellen Beseitigung der wichtigeren ständischen Privilegien ist er noch immer dasselbe Wesen: seine Form ist die Herrschaft, sein Inhalt die Ausbeutung des ökonomischen Mittels; noch immer herrscht die gleiche Art der .Verteilung', die wir in den Vorstufen am Werke sahen: der Verteilung in ihrer dreifachen Ausgestaltung als Verteilung der Produktionsfaktoren, d. h. des Eigentums, der erzeugten Güter und der Arbeit. Noch immer schmachtet die große Masse der Bevölkerung in harter, verdumpfender und verdummender Fron, während eine schmale Oberschicht arbeitsfrei genießt und in diesem Genußleben einer drohnenhaften „leisure class“ oft genug ebenfalls physisch und geistig verkommt; noch immer ist diese Verteilung gewährleistet und geschützt durch eine Rechtsordnung und eine Staatsgewalt, die sich auf der anderen Seite bemüht, die Ausbeutung njcht ärger werden zu lassen, als mit der politischen Sicherheit dieserOrdnung und der „Prästationsfähigkeit“ der Unterklasse vereinbar ist. Noch immer kreist die Innenpolitik dieses Staates in der Bahn, die ihr durch das Parallelogramm aus der zentrifugalen Kraft des Klassenkampfes und der zentripetalen Kraft des Gemein-, des Staatsinteresses vorgeschrieben ist; und noch immer wird seine Außenpolitik bestimmt durch das Interesse der Oberklasse, die jetzt nicht nur die Kapitalisten im älteren Sinne, die Bankokraten und Großindustriellen, sondern auch die ehemals feudalen, jetzt vollkommen kommerzialisierten Großgrundbesitzer, weltliche wie geistliche, also neben dem „moneyed“ auch das „landed interest“ umfaßt.
Grundsätzlich sind nach wie vor nur zwei Klassen zu unterscheiden : eine herrschende, der vom gesamten Erzeugnis der Volksarbeit (des ökonomischen Mittels) mehr zufällt, als sie beigetragen hat, und eine beherrschte, der weniger zufällt, als sie beigetragen hat. Jede dieser Klassen zerfällt, je nach dem Grade der ökonomischen Entwicklung, in mehr oder weniger Unterklassen oder -schichten, die sich nach der Gunst und Ungunst des für sie geltenden Verteilungsschlüssels abstufen. Und zwar gilt im allgemeinen für diesen Verteilungsschlüssel das trübe Wort John Stuart Mills, daß das Einkommen um so größer ist, je geringere und angenehmere Arbeit die Schicht leistet, und um so geringer, je härter und lästiger die Arbeit ist, die geleistet wird, so daß die am meisten genießen, die gar nicht arbeiten, und die am meisten arbeiten, die am härtesten entbehren. In alledem unterscheidet sich der moderne Verfassungsstaat nicht von den höheren Entwicklungsformen der früheren, namentlich der antiken Staaten.
Die Grenze zwischen Ober- und Unterklasse ist nicht scharf ge-
[650]
zogen. Nicht in kinetischer Betrachtung, denn es treten fortwährend Individuen und sogar ganze Schichten aus der Oberklasse in die Unterklasse und umgekehrt über; — und ebensowenig in statischer Betrachtung: denn es gibt Schichten, die von unten unentgolten empfangen und nach oben unentgolten leisten, nach einem Schlüssel, der sich mit den politischen Machtverhältnissen fortwährend ändert. Wir wollen diese zwischen Himmel und Hölle schwebenden Schichten unter dem Sammelbegriff der „Übergangsklasse“ zusammenfassen.
Um ein Beispiel zu geben, so sind im modernen Deutschland in der Oberklasse mindestens drei Schichten vereint: die großen, altfeudalen Landmagnaten, die zugleich Bergherren und oft auch Großindustrielle, zumeist der auf ihrem Bergwerksbesitz erwachsenen Hüttenindustrie, sind, wie die Schaffgotsch, Arenberg, Ratibor; — zweitens die großen Industriellen und Bankherren plebejischer Abstammung, die in der Regel auch schon Großgrundbesitzer und Fideikommiß-herren sind und durch Nobilitierung in den Kreis des altfeudalen Herrentums rezipiert worden sind, wie zu Beginn der Neuzeit, in der ersten Periode des deutschen Kapitalismus, die jetzigen Fürsten Fugger, wie zu Anfang des 19. Jahrhunderts die jetzigen Grafen Donnersmarck, und später die Stumm, Krupp usw.; der dritte Bestandteil der Herrenklasse sind die reinen Großgrundbesitzer, bis herab zu den kleinen Landjunkern feudaler und nichtfeudaler Herkunft.
Die Unterklasse besteht aus dem größten Teile des alten Mittelstandes der Handwerksperiode : den meisten Klein- und vielen Mittelbauern, einem großen Teile der Handwerker, den Unterbeamten, und dem neuentstandenen Proletariat der Industrie und der Landwirtschaft. Die ökonomisch und intellektuell tiefste Schicht sind die Landarbeiter.
Die Übergangsklasse besteht aus den neuen „Mittelständen“: Großbauern und die übrigen Klein- und Mittelbauern, kleinere Industrielle, einige Handwerker, die sich im Aufstiege zum Unternehmertum befinden, das Gros der mittleren und höheren Beamten des Staates und der großen Unternehmungen in Stadt und Land. Dazu kommen diejenigen reichen Bourgeois, die noch nicht reich genug sind, um gewisse traditionelle Schwierigkeiten überwinden zu können, die sich ihrer vollen Aufnahme in die Herrenschicht entgegenstellen : die Juden. Sie bilden die fluktuierende Grenze nach oben, wie einige hochgehobene Schichten der Industriearbeiter nach unten. Die Mittelschichten leisten, wie gesagt, unentgolten nach oben und empfangen unentgolten von unten; es ist historisches Schicksal, was auf die Dauer überwiegt: danach bestimmt sich der Ausgang für das Individuum oder die Schicht im Ganzen: volle Rezeption nach oben, oder volles Versinken nach unten. Aszendent sind von den Übergangsschichten in Deutschland zur Zeit die Großbauern und Mittelkapitalisten in Gewerbe und Handel, deszendent
[651]
die Mehrzahl der Handwerker und Beamten; wir wollen hinzufügen, daß vielleicht dem kleinen Großgrundbesitz der Übertritt in die Übergangsschicht nahe bevorsteht.
III. Die Kinetik.
(Der Gruppenkampf.) ↩
Damit sind wir zur Kinetik der Klassen gelangt.
Das Interesse jeder Klasse und Schicht setzt eine reale Menge assoziierter Kräfte in Bewegung, die mit einer bestimmten Geschwindigkeit auf die Erreichung eines bestimmten Zieles hindrängen. Die Geschwindigkeit hängt ab weniger von der Stärke des Bedürfnisses, das sich aus der Lagerung der Gruppen ergibt, als von der Kraft, mit der dieses Bedürfnis der Gruppe zum Bewußtsein gekommen ist. Damit soll gesagt sein, daß die kinetische Bewegung und Veränderung nicht von der am stärksten gedrückten Schicht ausgehen muß, und sogar selten von ihr ausgeht: sondern es sind in der Regel die gehobensten Schichten der Unterklasse, die zuerst zum Bewußtsein ihrer Klassenlage erwachen und die tieferen Schichten revolutionieren und mit sich reißen. Das haben wir von der plebejischen Plutokratie im Seestaate und von der Unternehmerklasse, als sie selbst noch im absolutistischen Staate Unterklasse war, ausführlich betrachtet: und das gilt auch im modernen Verfassungsstaate, wo in aller Regel die höheren, intelligenteren und besser gestellten Schichten der gelernten Industriearbeiterschaft den Kampf beginnen, nicht aber die Ungelernten, und noch weniger die am tiefsten gedrückten und entwürdigten Landproletarier [1]. Diese Bewegung ruft auf der Seite der Ober- und oft auch der Mittelklasse Gegenbewegungen hervor, weckt auch hier das Gruppen- und Klassenbewußtsein; und aus Aktion und Gegenaktion ergibt sich nach dem Parallelogramm der Kräfte die Geschwindigkeit des Verlaufs, die zwischen Null, ja, sogat Minus, wenn die „Reaktion“ einmal stärker ist als die Angriffskraft. und fast Unendlich wechseln kann, namentlich wenn durch schwere Verwicklungen oder gar Mißerfolge in der äußeren Politik die Kraft der Herrenklasse zeitweilig auf Null gesunken ist.
1. Ziel und Mittel. ↩
Das Ziel dieses Gruppenkampfes ist für alle Gruppen das gleiche: Hochgeltung, Aufrechterhaltung oder Erwerbung des Prestige. Das
[1] Das gleiche sagt Riehl von den wandernden „Selbständigen“: Zinngießern, Kesselflickern usw., die schlimmer daran sind als die Fabrikarbeiter, aber kein Gemeinbewußtsein haben. Sie fassen ihre Not als persönliches, vereinzeltes Schicksal auf und weiden auch höchstens für sich persönlich rauben oder stehlen (a.a. O. S. 364); vgl. Fries, a. a. O. S. 263.
[652]
Mittel zu diesem Ziele ist fast immer die Aufrechterhaltung hier oder die Beseitigung dort der wirtschaftlichen Ausbeutung der einen Schicht durch die andere. Denn fast immer entscheidet ja über den Grad der Geltung innerhalb des Gemeinwesens die Höhe des Vermögens und Einkommens. Und so nimmt der Gruppenkampf für eine oberflächlichere Betrachtung den Charakter des nichts-als-ökonomischen Kampfes an. Aber man versteht ihn nicht recht und nicht ganz, wenn man ihn unter diesem Gesichtspunkt ausschließlich betrachtet. Nicht einmal der Klassenkampf des Proletariats ist rein ökonomisch orientiert: es fordert ja nicht bloß höhere Löhne und in letzter Instanz Aufhebung des Lohnverhältnisses überhaupt, sondern auch — Bildung! Und wahrlich nicht nur und allein zu dem schönen Zwecke, den einzelnen Arbeiter zur harmonischen Vollpersönlichkeit zu erheben, sondern sicherlich auch aus dem Grunde, um der Klasse als Ganzheit das Prestige zu geben, das die Bildung neben dem Besitze verleiht. Die soziale Frage ist nicht nur eine „Messer- und Gabelfrage“: sondern das Proletariat will auf dem Wege über seine ökonomische Emanzipation zur vollen Geltung als Bürger im besten Sinne, in der Bedeutung von Citoyen, nicht von Bourgeois, emporsteigen.
Noch deutlicher sieht man diese Zusammenhänge, wenn man das Verhalten ökonomisch höherer Schichten ins Auge faßt, denen aus irgendeinem Grunde die volle Berechtigung der höchsten Oberklassenschicht versagt ist. Das gilt namentlich von religiösen und nationalen Gruppen, die von der eigentlich politischen Herrschaft in ihrem Staate ausgeschlossen oder wenigstens im Verhältnis zu anderen Gruppen minder berechtigt und beteiligt sind. Der ökonomische Druck auf die preußisch-deutschen Katholiken hätte kaum hingereicht, sie zu einer eigenen politischen Gruppe zusammenzuschweißen: aber daß sie nicht „paritätisch“ bei der Besetzung der höheren, politisch ausschlaggebendenBeamtenstellungen berücksichtigt wurden, war einer der Gründe für den Zusammenhalt der Zentrumspartei; ihre Entstehung hatte andere Ursachen, von denen wir noch sprechen werden. Ebensowenig hatte der jüdische Kapitalist in Preußen-Deutschland sich über ökonomischen Druck zu beschweren; man ließ ihn nicht nur verdienen, so viel er konnte, sondern man bahnte ihm ebensogut die Wege dazu wie den christlichen Kapitalisten beider Konfessionen: wenn die Juden trotzdem in ihrer weit überwiegenden Mehrheit Mitglieder nicht der Gruppenvertretungen der Herrenklasse (konservative und freikonservative Partei), sondern derjenigen der Mittelklassen (der liberalen Parteien) und sogar vielfach der Unterklasse (Sozialdemokratie) waren und sind, so liegt es an nichts anderem als daran, daß man ihnen die Hochgeltung weigerte und noch weigert, auf die ihnen nach Lage der Dinge ihre wirtschaftliche Situation das Recht gegeben hätte.
[653]
Diese Zusammenhänge sind aus dem Grunde schwer durchschau- bar, weil in aller Regel die politische auch die ökonomische Minderberechtigung mit sich führt. Das gilt namentlich von den nationalen und konfessionellen Gruppen. Die Mehrheiten mißbrauchen fast überall und immer ihre Macht — denn Macht wird fast immer mißbraucht —, um die Minderheiten auch wirtschaftlich so viel wie nur möglich auszubeuten oder wenigstens in der Ausbeutung der Unterschichten zu beschränken. Man weigert ihnen nicht nur den Zugang zu denjenigen Staatsstellungen, die besonders hohes Prestige, wenn auch zuweilen keine besonderen ökonomischen Vorteile bieten, sondern setzt sie auch bei Staatsaufträgen zurück und greift darüber hinaus positiv in ihre Wirtschaftslage ein. Sie werden gesetzlich oder nebengesetzlich bei der Besteuerung und, wenn es sich so fügt, bei der Zoll- und sonstigen Wirtschaftsgesetzgebung benachteiligt, bei der Eisenbahn- und Schulpolitik geschädigt, zuweilen sogar durch unmittelbare Expropriation ihres Besitzes ruiniert [1]. Und so bilden denn diese Fälle ebenfalls Scheinbeweise für die ökonomistische Auffassung der Geschichte in ihrem gewöhnlichen Verstände, die den wirtschaftlichen Kampf als das Ziel, und nicht, was er in der Tat ist, als das wichtigste Mittel des Gruppenkampfes anschaut.
Nun, wie immer das sich verhalten möge, jedenfalls bildet der Gruppenkampf einen Hauptinhalt der bisherigen Staatengeschichte. Einen Hauptinhalt, nicht den ganzen Inhalt! Es ist eine zwiefache Einseitigkeit, wenn man die ganze bisherige Geschichte als ausschließlich von Klassenkämpfen beherrscht, als ausschließlich aus Klassenkämpfen bestehend auffaßt. Denn erstens sind die kämpfenden Gruppen nicht immer „Klassen“, und zweitens darf man die Einflüsse des „Gemeininteresses“, das sich als Gemein- oder Staatsbewußtsein [2] äußert, nicht außer Betracht lassen. Es ist ja verständlich, daß eine kämpfende Klasse, wie die Arbeiterschaft, diese Kraft übersieht oder leugnet : wird dieses Interesse doch ganz regelmäßig von ihren Gegnern vorgeschützt, um ihre Gruppeninteressen zu legitimieren und durchzusetzen; und ist es doch von der bisherigen Geschichtsschreibung und Geschichtsphilosophie mit allzugroßer Einseitigkeit in den Vordergrund der Betrachtung gerückt worden: aber die Gesichtspunkte der Wissenschaft sind andere als die der Agitation, und wir haben das Gemeininteresse als die
[1] Das ist zurzeit das Schicksal der Deutschen und namentlich der Juden im neuen Polenstaate. Die Zeitungen berichten von Schritten der Rabbiner gegen die Selbstmordepidemie ihrer zur Verzweiflung getriebenen Glaubensgenossen. Man denke auch an die çecho-slovakische Agrarreform, die am schwersten die deutschen Besitzer trifft.
[2] Der Ausdruck „Gemeinbewußtsein“ als klarer Gegensatz gegen das Bewußtsein der einzelnen Gesellschaftsgruppen findet sich schon bei Riehl, Die bürgerliche Gesellschaft, S. 58.
[654]
zentripetale Kraft des Staatenlebens neben der zentrifugalen des Gruppenkampfes immer in unsere Rechnung einzustellen.
Mit diesen Ausführungen wollen wir den berühmten und so viel angegriffenen Satz von Karl Marx, daß alle Geschichte die Geschichte von Klassenkämpfen ist, nicht bestreiten, sondern nur einschränken und näher bestimmen. Wahr daran bleibt erstens, daß die Gruppenkämpfe das eigentlich kinetische Element besonders in der Innenpolitik sind, und daß die Kämpfe jener Gruppen, die sich uns als „Klassen“ in unserem Sinne darstellen, d. h. derjenigen Gruppen, die unmittelbar oder mittelbar die Geschöpfe der staatenbildenden Gewalt sind: also in der Tat die Klassenkämpfe, den großen Rhythmus der geschichtlichen Bewegung und die Linie der Entwicklung in der Hauptsache bestimmen. Sie vor allem spannen den Rahmen, innerhalb dessen die großen Führerpersönlichkeiten sich und ihren Gruppen die Ziele setzen : die Propheten, die Eroberer, die Gesetzgeber, die Staatenlenker.
2. Die Parteien. ↩
a) Gruppen und Klassen.
Diese Klassenkämpfe treten geschichtlich in die Erscheinung als Parteienkämpfe.
Das darf nicht mißverstanden werden. Alle Klassenkämpfe sind Parteienkämpfe, aber nicht alle Parteienkämpfe sind Klassenkämpfe.
Die Partei nämlich ist die Organisation einer Gruppe zur Verfechtung ihrer Interessen im politischen Leben. Aber nicht jede Gruppe ist eine Klasse. Gruppe ist der Ober-, Klasse der Unterbegriff; also ist auch der Gruppenkampf der Ober-, und der Klassenkampf der Unterbegriff.
Wir müssen daher von dem Begriff der Gruppe ausgehen, um das Wesen der Partei richtig zu verstehen:
„Gruppen bilden sich um Interessen herum; oder, was das gleiche ist: eine Gruppe ist immer eine Interessengemeinschaft. Das Interesse ist oder schafft die „gemeinsame Bewußtseinslage“, aus der heraus die Mitglieder der Gruppe auf gemeinsam erlittene Reize gleichartig und gleichzeitig reagieren“ [1].
Auch das darf nicht mißverstanden werden. Wenn wir von „Interessen“ reden, so haben wir durchaus nicht ausschließlich die sog. „materiellen“ Interessen allein im Auge. Eine Gruppe kann sich gerade so gut um nichtmaterielle Interessen, z. B. um ethische oder religiöse oder wissenschaftliche oder philosophische oder ästhetische Interessen
[1] S. S. I, S. 466.
[655]
sammeln oder durch sie zusammengehalten werden. Das gemeinsame Interesse kann auch z. B. in dem Glauben der Gruppenglieder an die besondere Eignung einer bestimmten Person oder Familie für gewisse öffentliche Ämter und Funktionen bestehen, handle es sich nun um eine zweckrationale Überzeugung oder um einen nichtrationalen Glauben an ein bestimmtes, ererbtes oder individuelles „Charisma“.
Wenn nun die Lagerung einer Gruppe derart beschaffen ist, daß sie oder ihre Führer glauben, die Gruppenziele besser dadurch erreichen zu können, daß sie sich der mit gewissen Institutionen verbundenen tatsächlichen Macht bemächtigen, so organisieren sie sich als Parteien. Solche Parteien kann es in jedem Verein geben, wenn eine Gruppe sich des Vorsitzes und damit des Vereinsvermögens und des mit dem Vorsitz verbundenen Prestige versichern will. Hier spricht man in der Regel von „Parteiungen“ oder „Faktionen“. Schon wesentlich höher hinauf führen die „kirchlichen Parteien“, namentlich wenn es sich um eine einfluß- und besitzreiche kirchliche Organisation handelt, die Ämter und Pfründen und den damit verbundenen Einfluß zu vergeben hat : die Kämpfe der großen Parteien innerhalb der katholischen Kirche und ihres spirituellen Weltreichs wären sogar dann schon fast vollentfaltete politische Kämpfe gewesen, wenn sich die Parteien nicht fast immer mit den großen staatlichen Mächten verbündet hätten, um die Gegner zu besiegen.
Rein politische Parteien sind dann gegeben, wenn die Gruppen sich der mit der Institution des Staates verbundenen tatsächlichen Macht zu bemächtigen versuchen. Auch hier gibt es Unterschiede des Grades und des geschichtlichen Ranges: die sog. „Kirchturmspolitik“ kleinster Staatswesen und innerhalb größerer staatlicher Gebilde die Faktionspolitik mancher Gemeinden steht nicht besonders hoch über den Parteiungen innerhalb von rein privaten Vereinen.
Wir werden von diesen rudimentären Gebilden um so mehr absehen dürfen, als sich in solchen kleineren Kreisen in der Regel die Faktionen nach den Gruppierungen der größeren Kreise zu orientieren und anzuordnen pflegen. Wie sich im mittelalterlichen Italien alle Faktionen entweder zu den Ghibellinen oder den Guelfen schlugen, um ihre Sonderzwecke mit den großen Parteizwecken zugleich durchzusetzen, so ist das auch heute noch überall der Fall : die kleinen Rinnsale münden in die großen Ströme und werden von ihnen mitgetragen, wie umgekehrt der große Strom erst durch die vielen Rinnsale zu seiner Fülle und Kraft gelangt.
Wir sind daher wohl legitimiert, wenn wir in dieser Untersuchung nur von den größeren politischen Parteien handeln, da wir ja nicht eine vollkommene Soziologie des Parteiwesens zu geben beabsichtigen,
[656]
sondern die Parteien nur insofern berücksichtigen, wie sie für das Verständnis der Soziologie des Staates von Bedeutung sind.
Aber auch wenn wir unseren Gegenstand in dieser Weise einengen, ist es noch immer nicht erlaubt, Klasse und Partei, Klassen- und Parteienkampf zu identifizieren. „Partei und Klasse brauchen nicht zusammenzufallen. Eine Klasse kann sich in verschiedene Parteien spalten, eine Partei aus Angehörigen verschiedener Klassen bestehen“, sagt Karl Kautsky [1]. Die bloße Existenz einer so mächtigen Partei wie des deutschen Zentrum muß vor allzu hastigen Verallgemeinerungen warnen.
ir glauben daher der Wahrheit am nächsten zu kommen, wenn wir die politische Partei definieren als eine relativ zahlreiche und mächtige dauernde Gruppe, die mit anderen ähnlichen Gruppen im Kampfe um die mit der Institution des Staates verbundene Macht steht.
Die Partei und ihr oder ihre Gegner stellen logisch Korrelativbegriffe dar, wie etwa Ehemann und Eheweib, Eltern und Kinder: sie sind nicht ohne einander definierbar. Denn, wie wir aus der allgemeinen Soziologie wissen, kommt eine Gruppe nur dadurch zum Gruppen- Selbstbewußtsein, daß sie sich mit einer anderen kontrastiert. Wo eine Gruppe unangefochten den Staat beherrscht, da fehlt dieser Gruppengegensatz, und da bilden sich keine Parteien, sondern höchstens Faktionen zumeist persönlicher Note. Und wo ein alter Gruppengegensatz verschwindet, weil zwei Gruppen mit allen ihren vitalen und essentiellen Interessen eins werden, da verschwindet auch der politische Kampf zwischen ihnen. Entweder verschmelzen sie zu einer einzigen Partei, die ihren Kampf jetzt gegen andere Gruppen führt, oder die alten Gehäuse bleiben bestehen, aber der Kampf zwischen ihnen wird zum politischen Scheinkampf, bei dem es nur noch um persönliche Interessen geht. So erklärt sich, wie uns scheint, sehr einfach die Geschichte der beiden großen englischen Parteien. Zuerst vertraten Tories und Whigs die starken Klassengegensätze der feudalen Nutznießer des verflossenen absolutistischen Staates einerseits und der emporgekommenen Bourgeoisie andererseits; als aber im Laufe der Zeit die beiden Klassen vollkommen miteinander zu einer Oberklasse verschmolzen, deren Herrschaft Jahrhunderte hindurch von keiner anderen Klasse bestritten wurde, da wurden aus den beiden alten Parteien reine Faktionen der herrschenden Klasse, die sich ablösten und derart „kept the game going“. Ähnlich lag es lange in Ungarn, wo ebenfalls die Stadtbürgerschaft mit dem historischen Adel eine einzige regierende Klasse bildete, deren Flügel sich auf Grund völlig wesen- und gegenstandslos gewordener, einstmals lebendig gewesener Programmgegensätze ablösten, und „das Spiel im Gange erhielten“.
[1] Die Diktatur des Proletariats, S. 16.
[657]
Diese Betrachtungen haben uns ein weiteres Kennzeichen der politischen Partei gegeben: die Dauer. Wenn sie sich eine gewisse Zeit hindurch erhalten hat, so wird sie zu einer objektiven Institution [1], einem soziologischen Gebilde, das sich im Wechsel der Geschlechter erhält als eine „Form“, die immer neue „Inhalte“ in sich aufnehmen kann. Die einmal geschaffene und wirkende Organisation, die „Parteimaschine“, mit ihrem festen Anhängerkreise, ihren eingearbeiteten Parteifunktionären, auf höherer Stufe auch ihrer Presse, mit ihrem alteingebürgerten Einfluß auf Ämter und Parlamente, bleibt als „Gehäuse“, wenn auch der alte Geist allmählich völlig entwichen sein sollte, und lebt mit neuem Geiste, zuweilen auch ohne jeden „Geist“, weiter. Dabei wirkt die „Eigengesetzlichkeit der Idee“ noch lange fort: in der Ideologie der Partei, in ihren Sym- und Antipathien, in allem, was mit den durch die veränderte soziale Lagerung geschaffenen Gruppeninteressen nicht in offenem Widerstreit steht. Für diese Mechanik der Parteien sind die englischen und amerikanischen Verhältnisse die besten Beispiele, aber der Leser wird starke Annäherungen an den Typus auch von jedem ihm näher bekannten einigermaßen entwickelten Parteiwesen auch anderer Länder anzuführen imstande sein. Die alten Embleme und Idole wehen der Partei noch immer voran und begeistern ihre Anhänger noch immer, obgleich die ursprünglich damit verbundenen Gedankenassoziationen längst zum großen Teile oder\auch ganz verloren gegangen sind.
Unter dem Eindruck der englischen Parteiverhältnisse konnten Beobachter leicht zu dem Schlüsse gelangen, daß die Zugehörigkeit zu einer der beiden, sich in der Regierung ablösenden, Gruppen wesentlich vom Temperament bestimmt sei. Dieser Anschauung hat mit der größten Bestimmtheit Macaulay Ausdruck gegeben; aber auch Lecky und Spencer standen auf ähnlichem Standpunkt [2]. Treitschke wirft Macaulay vor, er habe „gesündigt mit der Behauptung, daß sich durch alle Parteiung der Geschichte immer der gleiche Gegensatz ziehe. Es gäbe immer Parteien, die für „Freiheit und Fortschritt“ einträten, und ihnen gegenüber solche, die von der Pietät für „Autorität und Altertum“ geleitet würden; so sei überall der gleiche Gegensatz von Whigs und Tories zu finden. . . . Aber nicht das idem sentire de re publica führt die Parteien zusammen, sondern das idem velie. Ihr Wesen besteht nicht darin, ob sie ändern und erhalten wollen, sondern was sie ändern und erhalten wollen. . . . Der Kampf der beiden großen altenglischen Parteien ist nie, wie Macaulay behauptet, ein Prinzipien-
[1] Vgl. S. S. I, S. 445ff.
[2] Vgl. Sulzbach, Grundlagen der politischen Parteibildung, S. 25ff. Oppenheimer, System der Soziologie. Band II. 42
[658]
kämpf gewesen, sondern drehte sich immer darum, wer die Herrschaft im Staate ausüben sollte“ [1].
Nun, im Schaukelspiel der beiden großen altenglischen Parteien hat es sich in der Tat im wesentlichen nur darum gehandelt, welche Personen im Staate die Herrschaft ausüben sollten. Aber sie bilden eine Ausnahme, wenigstens einen äußersten Grenzfall. In aller Regel streben die politischen Parteien doch wenigstens zum einen Teile aus dem Grunde zur Herrschaft im Staate, weil sie bestimmte Institutionen abzuschaffen, abzuändern oder neueinzuführen beabsichtigen: Institutionen, die als hemmend oder fördernd für das spezifische Interesse betrachtet werden, um das sich die Gruppe organisiert hat. Hier hat die „Herrschaft“ mehr als nur persönliche oder cliquenmäßige Bedeutung. Welche Interessen sind es, die die großen regelmäßigen politischen Parteien zusammenführen und -halten ?
b) Echte und unechte Parteien.
Wir werden unserem Ziele näherkommen, wenn wir uns mit der Unterscheidung in „echte“ oder „eigentliche“ und „unechte“ Parteien beschäftigen, die die meisten Autoren über den Gegenstand vornehmen.
Nach Max Weber ist die politische Partei die Schöpfung des Bürgertums der okzidentalen Stadt, jenes einzigen Gebildes, das wir oben nach ihm dargestellt und von den Städten der übrigen Zeitalter und Staatengebilde unterschieden haben. Hier allein gab es ihm zufolge ein „Bürgertum im ökonomischen Sinne“ als den Inbegriff „einer ökonomischen Interessenlage spezifischer Art“. Er sagt: „Kämpfe zwischen Cliquen, Adelsfraktionen, Amtsanwärtern finden wir überall in der Geschichte, nirgend aber außerhalb der okzidentalen Stadt die Partei im heutigen Sinne des Worts, und ebensowenig den Demagogen als Parteiführer und Anwärter auf Ministersessel“ [2]. Man sieht schon aus diesen kurzen Worten, daß hier zwischen eigentlichen und uneigentlichen Parteien unterschieden wird. Diese Unterscheidung ist allgemein. Jellinek spricht von „zufälligen Parteien“, „welche in Wahrheit keine Ziele der Staatsordnung selbst verfolgen, so z. B. wenn zwei Thronprätendenten Anhänger in allen Volksschichten finden, die monarchische Staatsordnung selbst aber und die anderen bestehenden Institutionen außer Frage stehen“. „Unechte“ Parteien nennt er z. B. die nationalen und religiösen Parteien, und zwar, „weil jede echte Partei ein bestimmtes umfassendes Programm für die Gestaltung des Staates haben muß, was weder vom Standpunkte einer bestimmten Nationalität noch von dem einer bestimmten Religion aus möglich ist.
[1] Politik I, S. 149/50.
[2] Wirtschaftsgeschichte, S. 270ff.
[659]
Fragmentarische Parteien verdienen die genannt zu werden, die nur eine Einzelfrage lösen wollen, aber durch keine Anschauung über die gesamte staatliche Politik zusammengehalten werden. Sie pflegen am häufigsten in Staaten mit großer Parteizersplitterung aufzutreten, namentlich dort, wo ein Volk von einseitiger Interessenpolitik beherrscht wird. Solcher Art sind z. B. Freihändler und Agrarier“ [1].
Treitschke bemerkt zu dem Gegenstande: „Man wird eine Parteibildung natürlich und notwendig nennen können dann, wenn gestritten wird über einen vorhandenen realen Gegensatz des wirtschaftlichen, des nationalen, des religiösen Lebens. Krankhaft ist die Parteibildung, wenn sie sich nährt von Reminiszenzen, von altem Haß und Groll“ [2].
Man sieht, daß die Anschauungen der beiden berühmten Staatslehrer über diesen Gegenstand nicht miteinander in Übereinstimmung stehen. Hier spricht für jeden Kenner der deutschen Politik jener Zeit sehr deutlich ihre „persönliche Gleichung“. Man kann klar erkennen, daß Jellinek ein Anhänger der liberalen Partei gewesen ist, die sich gutgläubig aber irrtümlicherweise für eine reine Weltanschauungspartei hielt, und Treitschke ein Anhänger der preußischen Konservativen resp. Freikonservativen, die mit besonderer Erbitterung auf Parteigebilde wie z. B. das der Weifen blickten, das sich „von altem Haß und Groll nährte“.
Auch Bluntschli nennt die religiösen Parteien „unrein“, weil sie unstaatliche Ziele verfolgten, und hält die nationalen für „keinesfalls normal“, da die Gefahr bestehe, daß sie sich verselbständigen könnten [3]. Sulzbach, dem wir die Stelle verdanken, versucht eine feinere Deutung: „Partei kommt von pars, pars heißt der Teil; ihrer Wortbedeutung nach sind Parteien also immer Teile eines Ganzen, und eine Partei ist deshalb ein ebenso widersinniger Begriff wie eine Hälfte oder ein Pol.“ (Das entspricht unserer oben dargestellten Meinung durchaus, daß eine Partei als ihren Korrelativbegriff immer eine andere gegnerische voraussetzt.) „Mithin trägt eine Gruppe von Menschen den Charakter einer Partei nur da, wo sie mit einer oder mehreren Gegenparteien in einem Verhältnis steht, das durch die Beziehung beider Seiten zu einer größeren, sie umschließenden Einheit bestimmt wird. Darin besteht nun in der Tat das Wesen der „echten“ Partei, daß sie nicht nur an sich selbst, sondern an eine größere Gruppe denkt, . . .; die nationalen Parteien aber sind darum „unechte“, weil sie ihre Zwecke
[1] Allg. Staatslehre, S. 116. Bei der Reichstagswahl vom 7. XII. 1924 traten 13 neue Parteien auf, die zusammen 594 910 Stimmen auf sich zogen (Beckmann, Die Partei der Arbeit, S. 15 Anm.). Im ganzen gibt es 27 Parteien in Deutschland (S. 11).
[2] Politik I, S. 155.
[3] Zit. nach Sulzbach, a. a. O. S. 102.
[660]
an der Gruppe, deren Namen sie tragen, und nicht an einer größeren verwirklichen wollen“.
Von hier aus hätte Sulzbach zu Ende kommen können, wenn er nicht einen höchst unglücklichen Grundbegriff hätte, den der „Politik“. Er definiert sie als die „zielbewußte Beeinflussung des sozialen Leben der Menschen“ (S. 42). Hier fehlt zunächst die in einer Definition der Politik unerläßliche Beziehung auf eine einzelne Rahmengruppe, um nicht zu sagen, auf einen einzelnen Staat. Auch außerdem ist sie noch viel zu weit. Wenn diese Definition „die Politik, die sich mit dem Substantiv Partei zu dem Begriff der politischen Partei verschmilzt“, treffen soll, dann ist jede Kirche und jedes Erziehungssystem, ja, jedes Moralsystem der Welt eine politische Partei; und Mr. Ford, der durch seine billigen Personenwagen und landwirtschaftlichen Zuggeräte „zielbewußt“ das soziale Leben der Menschen in allen Erdteilen nicht nur zu beeinflussen strebt, sondern wirklich durch eine Umwälzung der Verkehrsverhältnisse und vielleicht durch die von ihm beabsichtigte totale Umwälzung der Landwirtschaft (ihre Verwandlung in ein Saisongewerbe) beeinflußt, ist ein Politiker im Parteisinne.
Wenn Sulzbach anstatt dieser nichtssagenden Worte den von Max Weber herausgearbeiteten Begriff der Politik besessen oder angewendet hätte, wonach politisch alles ist, „was mit den Herrschaftsverhältnissen innerhalb des politischen Verbandes, des Staates, zu tun hat, deren Aufrechterhaltung, Verschiebung, Umsturz herbeiführen, oder hindern, oder fördern kann, im Gegensatz zu Personen, Vorgängen, Sachen, die nichts damit zu schaffen haben“ [1], — wenn Sulzbach diese richtige Definition besessen hätte, dann hätte er es leicht gehabt, die „echten“ von den „unechten“ Parteien noch schärfer zu unterscheiden, als es ihm gelungen ist. Er hat uns sagen können, warum religiöse und nationale Parteien nicht „echt“ sind; er konnte uns weiterhin sagen, daß echte Parteien sich auf das gleiche größere Ganze beziehen, aber nicht, wodurch sie sich denn nun eigentlich unterscheiden. Das aber geht aus der richtigen Weberschen Definition der „Politik“ mit aller Klarheit hervor: es sind diejenigen Gruppen der Staatsvölker, die im Herrschaftsverhältnis zueinander stehen, oder, mit dürren Worten: es sind die sozialen Klassen, deren organisierte Vertretungen allein als echte Parteien gelten.
Diese Einschätzung leuchtet dunkel auch durch die Auffassung von Jellinek, Bluntschli und Treitschke durch. Es bleibt bei dem, was wir soeben sagten: für den großen Gang der politischen Entwicklung sind nur diejenigen Parteien von entscheidender Bedeutung, die die Vorfechter der großen, dem historischen Staate als einer Schöpfung der
[1] Wirtschaft und Gesellschaft, S. 30. Vgl. S. S. I, S. 924.
[661 ]
erobernden Gewalt, als der Organisation der Herrschaft, immanenten Schichten, eben der Klassen, sind.
Jellinek beschreibt denn auch seine „echten“ Parteien wie folgt: „Überblickt man diese Gruppen in ihrem Verhältnisse zur sozialen Vorherrschaft und staatlichen Herrschaft, so findet man ehemals herrschende Gruppen, gegenwärtig herrschende Gruppen, Gruppen, die noch nicht geherrscht haben. Nun ist es das natürliche Streben einer jeden politischen Partei, zur Herrschaft zu gelangen oder sie zu behaupten. Die ehemals herrschenden, durch die Änderung der gesellschaftlichen Machtverhältnisse von der sozialen Vorherrschaft und der staatlichen Herrschaft abgedrängten Gruppen bilden die Grundlage der reaktionären Parteien, die Gruppen, bei denen staatliche und soziale Herrschaft sich decken, sind die konservativen Parteien, die noch nicht herrschenden, je nachdem sie näher oder weiter von der Herrschaft entfernt sind, die fortschrittlichen und die radikalen Parteien“.
Wenn man hier in den Begriff „soziale Vorherrschaft“ unseren Inhalt hineintut, wonach er zugleich wirtschaftliche Vorteile in der Verteilung und Ehrenvorrechte bedeutet, so ist alles vollkommen richtig.
Von hier aus ist es nun z. B. nicht mehr schwierig, die Entstehung der Zentrumspartei zu verstehen, die manchen Schriftstellern über das Parteiwesen so viele Schwierigkeiten gemacht hat, weil sie nicht in die Rubriken des Klassenkampfes paßt. Vor der Reformation stellte der „zweite Stand“ der katholischen Geistlichen einen sehr einflußreichen, oft fast allein ausschlaggebenden Bestandteil der herrschenden Klasse dar. In einigen Staaten ist er durch den Übertritt der Fürsten und großer Teile der Bevölkerung zum Protestantismus aus dieser herrschenden Stellung verdrängt worden, mußte also „natürlicherweise“ als „reaktionäre“ Gruppe ins Parteileben eintreten, um Jellineks Terminologie anzuwenden. Orientiert war die Partei „korrelativ“ an der herrschenden evangelischen Mehrheit, durch die sie materiell und an ihrem Prestige gekränkt wurde [1]; ihre weitere Entwicklung ist aus den Verschiebungen ihrer Lagerung und der Fortwirkung ihrer alten mächtigen Ideologien leicht zu verstehen. Ob man sie für eine „echte“ oder „unechte“ Partei halten soll, hängt lediglich davon ab, ob man die Konfessionentrennung für unwiderruflich hält oder nicht. Nur im ersten Falle kann man sagen, daß die katholische Partei, gleich etwa den Dänen oder Polen im Deutschen Reiche vor dem Weltkriege, „nur an sich selbst, aber nicht an die größere Gruppe denkt“. Uns aber scheint, daß der eigentlich katholische Gesichtspunkt der zweite ist, wenn auch die Verwirklichung des unverzichtbaren Strebens auf Alleingeltung in der christlichen Welt, ja, in der Welt überhaupt, in einer noch so fernen Zukunft erhofft werden mag.
[1] Ähnlich wie die katholische Partei Italiens an dem „freimaurerischen“ Liberalismus.
[662]
3. Die Interessen und die Ideen. ↩
Es kann also keinem Zweifel unterliegen, daß die Parteien die Vorfechter und Vertreter der Interessen gesellschaftlicher Gruppen, oft von Klassen, und nicht von Einzelnen aus allen sozialen Gruppen sind, die durch ein gemeinsames „Temperament“ zusammengeführt werden. Dabei ist aber nicht ausgeschlossen, daß Einzelne „aus ihrer Klasse springen“, sich aus irgendwelchen ideellen oder weniger ideellen Beweggründen einer anderen Klasse anschließen. Die wirklichen politischen Parteien sind immer Vertreter gewachsener „realer“, nicht aber „numerischer“ [1] Gruppen. Wenn Macaulay das ex professo leugnete (wir wollen nicht untersuchen, ob er seinen Standpunkt in seiner Geschichtsschreibung auch wirklich festgehalten und durchgeführt hat), so hat er sich zweifellos einer ungeheuerlichen Einseitigkeit schuldig gemacht. Denn daß reale Interessen der Klassen die bewegende Kraft der politischen Kämpfe sind, das hat man bereits im Altertum gewußt. Beard zitiert aus Lindsay: „Wenn wir zu des Aristoteles Analyse der bestehenden Verfassungsformen kommen, so finden wir, daß er sie nicht nur als unvollkommene Verwirklichungen des Idealstaates, sondern auch als das Ergebnis von Klassenkämpfen betrachtet. . . . Und jede Klasse, das ist die Vorstellung, will nicht ein Ideal ausdrücken, sondern kämpft um Macht im Interesse ihrer Stellung. . . . Seine Analyse der Tatsachen führt ihn dahin, die griechischen Staaten als die Schaubühne kämpfender Parteien zu betrachten. Die Ursachen der Revolutionen werden nicht als unmittelbare Änderungen in der Auffassung des allgemeinen Besten, sondern als Änderungen in der militärischen oder wirtschaftlichen Macht der verschiedenen Klassen im Staate verstanden“ [2]. Und Beard sagt selbst an anderer Stelle [3]: „Die große Tatsache hebt sich klar heraus, daß durch alle die Jahrhunderte bis auf unsere Zeit herab die Gruppeninteressen als die wahre Essenz der Politik in Theorie und Praxis anerkannt worden sind. Die Staatslenker sprachen von ihnen, verhandelten mit ihnen, versöhnten sie, brachten für sie Gesetze ein, und suchten zuweilen die Vorherrschaft der einen oder anderen oder das Gleichgewicht einiger gegen eine oder einige herbeizuführen.“
Es werden also in der Tat die Parteien von „Interessen“ regiert. Nur schließt das nicht aus, daß sie auch von „Ideen“ regiert werden. Das kommt einigermaßen in Jellineks vorsichtiger Definition der echten Parteien zum Ausdruck: „Politische Parteien sind ihrem Kern nach Gruppen, die, durch gemeinsame, auf bestimmte staatliche
[1] S. S. I, S. 738.
[2] The economical Basis of Politics, S. 19/20.
[3] A. a. Ο. S. 67.
[663 ]
Ziele gerichtete Überzeugungen geeinigt, diese Ziele zu verwirklichen trachten“ [1].
Wir haben das hier bestehende Problem in unserer „Allgemeinen Soziologie“ (S. 588 ff. und namentlich S. 951 ff.) ausführlich behandelt. Das Hauptergebnis war in äußerster Kürze das folgende:
Wenn die Gruppe nicht in ihrer Statik ruht, dann „strömt sie vom Orte höheren zum Orte niedrigeren Druckes auf der Linie des geringsten Widerstandes“. Diese Strömung ist jeweils einem „konkreten Gruppeninteresse“ zugewendet, das sie als nächstes Zwischenziel anstrebt. Und dieses Gruppeninteresse wird zur „Idee“. Das ist das Hauptgesetz aller Soziologie! Mit anderen Worten: alles, was die Strömung fördert, erscheint der Gruppe als gut und verständig, alles, was sie hemmt, als schlecht und töricht. Und diese gesellschaftlichen Wertungen, als soziale Imperative, als „Ideen“, werden zu fast unwiderstehlichen Faktoren in der Motivation jedes Gruppengliedes (957).
Man muß aber, um diese Sätze richtig zu verstehen, nicht glauben, daß die „Interessen“, von denen sie handeln, ausschließlich „materielle Interessen“ der wirtschaftlichen Lage oder sogar des Kampfes um die Hochgeltung sind. Sondern man darf nie vergessen, „daß das inhärente Gruppeninteresse nicht nur auf Machtverhältnisse aus ist, sondern als das wichtigste konkrete Interesse des inneren Haushaltes der Gruppe auch die Aufrechterhaltung des Consensus, der Reziprozität, der Gerechtigkeit, will und wollen muß. Denn das ist ein konkretes Gruppeninteresse, das in jedem einzelnen Mitgliede der Gesellschaft als mächtige, vielleicht sogar aprioristische „Idee“, als kategorischer Imperativ, vorhanden und wirksam ist und seine Spontaneität gewaltig mitbestimmt“ (952).
Es ist also immer eine „Idee“ als der Oberbau vorhanden, wo ein „Interesse“ gegeben ist. Und das, was im Bewußtsein der Gruppenglieder ihre Handlung bestimmt, ist nicht das Interesse, sondern die es überbauende und verbergende Idee. „Wir können es uns und anderen nicht tief genug einprägen, daß der Gegner gutgläubig ist, daß ihm unsere Gründe, die uns selbst so klar sind wie das Sonnenlicht, nicht einleuchten können, daß er unsere sittliche Überzeugung, die uns selbst über jeden Zweifel hinaus feststeht, nicht teilen kann, daß in jedem von uns unsere Gruppe denkt und wertet“ (959) [2].
[1] Allg. Staatslehre, S. 114/5.
[2] Vgl. Gumplowicz: Die soziologische Staatsidee, S. 214. „Die Selbsterhaltungsinteressen der verschiedenen sozialen Gruppen prallen aufeinander unter dem Vorwande, daß es sich um verschiedene „politische Grundsätze“ und „Lebensanschauungen“ handelt. Jede Gruppe hat ihr besonderes Interesse, für welches sie kämpft ; die Einzelnen aber glauben infolge sozialer Suggestion, daß sie für Ideen kämpfen; sie wissen nicht, daß diese Ideen erzeugt sind durch die Gruppeninteressen.
„So kämpfen die Einen vorgeblich für Freiheit und Fortschritt, die Anderen für Ordnung und Autorität. Das sind die von Interessen der Gruppen erzeugten und ihren Mitgliedern suggerierten Ideen, welche als Losungsworte im Kampfe dienen. Diese Ideen haben faszinierende Gewalt über die Einzelnen und bilden das Band, das den Einzelnen an seine Gruppe kettet. Der Einzelne glaubt, daß er freiwillig für diese Ideen kämpft: er ahnt es nicht, daß die Gruppe ihn mittels sozialer Suggestion gefesselt hat, damit er ihrem Selbsterhaltungsinteresse diene“. Vgl. Soziol. Essays S. 41.
[664]
Unter diesen Umständen hat es den Anschein, als wäre keine Möglichkeit gegeben, ein objektives Urteil über die verschiedenen Parteibestrebungen zu fällen. Wir selbst haben oben die Psychologie und die Theorien der Ober- und Untergruppe ganz gleichmäßig aus ihrer Lagerung abgeleitet: den „Legitimismus“ oben und das „Naturrecht“ unten. Subjektiv gesehen, sind die beiden Anschauungen gleich viel wert, verdient keine von ihnen den Vorrang. Sie sind beide psychische Spiegelungen der besonderen Klassenlage und nichts anderes.
Sulzbach schreibt dazu: „Auf dem Berliner Soziologentage 1912. fand Oppenheimer die Unsinnigkeiten bestimmter Rassetheorien in den Interessen der Herrenklasse begründet, von der sie vertreten wurden. Sombart erwiderte mit einem Hinweis darauf, daß Ideologien sich auch bei Unterdrückten finden können. Worauf Oppenheimer bemerkte, daß die Gegenüberstellung stereotyper Ideologien der Ausbeutenden und der Ausgebeuteten sogar von ihm selbst stamme, — aber er überging, daß er für die Ausgebeuteten außerdem die Logik vindizierte, um die doch allein ursprünglich der Streit ging“ [1].
Der Bericht ist nicht vollkommen korrekt. Ich habe in jenem Vortrage die Logik als Instanz nur angerufen, um die Widersprüche zwischen den einzelnen rassentheoretischen Geschichtsphilosophen und darüber hinaus innerhalb der einzelnen Theorien selbst spöttisch aufzuweisen. Aber ich habe nicht die Logik angerufen, um mich für die Ausgebeuteten zu entscheiden, sondern das Recht [2].
Sulzbach hat vollkommen recht, wenn er sagt, meine sämtlichen Schriften seien eingestellt auf die genaue Unterscheidung von Seiendem und Seinsollendem [3], aber er sieht nicht, oder will nicht sehen, daß das auf Grund einer Anschauung geschieht, die sich zum wenigsten auf eine große Autorität berufen kann: auf Immanuel Kant.
Ich habe in den vorstehenden Blättern und vorher in den anderen Bänden dieses Systems meinen Standpunkt in dieser wichtigsten aller praktischen Fragen immer wieder dargestellt und glaube bewiesen zu
[1] Betrachtungen über die Grundlagen der politischen Parteibildung, S. 117.
[2] In „Grundlagen“ S. 5 will Sulzbach allerdings unter dem „etwas vagen Begriffs des Logischen das Sittliche mitverstanden“ haben (1).
[3] Die Grundlagen der politischen Parteibildung, S. 13.
[665]
haben, daß der gesinnungslose Relativismus, der nur eine Art der „Politik“, nämlich die „Realpolitik“ kennt, die „philosophische Politik“ aber als unmöglich ablehnt, völlig versagt. Er ist außerstande, so wichtige Tatsachen zu erklären, wie die Jellinekschen „Konstanten des Rechts“, und muß sich in die lächerlichsten Widersprüche verwickeln, muß in der Tat immer zu einer „Rechtswissenschaft ohne Recht“ gelangen.
„Könnte man die Parteien wirklich in solche einteilen, die das Gute erhalten, und andere, die das bessere einführen wollen, dann wären natürlich alle Schwierigkeiten gelöst. Dazu aber müßte erst einmal feststehen, woran denn das Bessere erkannt werden kann — und eben dies ist . . . unmöglich“, sagt Sulzbach [1], und Sombart sprach bei jener Gelegenheit von dem „Sklavenaufstande in der Moral“: eine Wendung, bei der ihr großer Urheber wahrlich nicht an einen Aufstand ausgesucht gegen den Fettbürger gedacht hat.
Es steht vollkommen fest, was das bessere ist! Und wenn man die Beweise a priori nicht anerkennen will, die Kant und seine geistigen Erben beibringen; wenn man selbst die erschütternden Beweise a posteriori nicht anerkennen will, die die Geschichte, namentlich der Seestaaten, dafür erbringt, daß ein Staat sine justifia auch sine fundamentisist und gnadenlos zugrunde gehen muß — so gibt es doch ein argumentum ad hominem, mit dem wir uns anheischig machen, jeden Menschen (also alle Menschen, und das dürfte zum Beweise genügen) ad absurdum zu führen, dem es einfallen sollte, zu leugnen, daß es keine absolute Gerechtigkeit gibt, und daß daher die Auffassung der Ausgebeuteten nicht mehr wert ist als die der Ausbeuter. Sperrt einen solchen Menschen ohne Grund in die Bastille oder unter die Bleidächer Venedigs, laßt ihn hungern, dürsten und frieren, mißhandelt und beschimpft ihn — und seht, ob er diese Behandlung nur als ein Unglück empfindet, wie etwa die Verletzung durch einen Steinschlag im Hochgebirge oder durch ein wildes Tier — oder ob er sie als ein Unrecht empfindet. Wenn das letztere, wie selbstverständlich, der Fall ist, dann ist er durch seine sittliche Empörung ad absurdum geführt. Wenn gewisse Leute, die es lieben, sich in den Mantel des unendlich weltläufig-weisen, unendlich skeptischen Philosophen zu hüllen, das nicht sehen, so liegt es nur daran, daß sie nicht Phantasie genug haben, um sich in die Lage der Unterworfenen und Ausgebeuteten zu versetzen, um, dem Gesetze der Gerechtigkeit, dem kategorischen Imperative folgend, bei dem Konflikt ihrer Interessen mit denen der Unteren auch diese in ihre pflichtmäßige „Abwägung“ mit aufzunehmen. Damit ist diese böse Abart der modernen Sophistik für uns er-
[1] Grundlagen S. 30.
[666]
ledigt, die nichts weiter beweist, als bis zu welchem Grade die Blendung durch das Klassenvorurteil gehen kann. Es kümmert uns wenig, daß sie heute unter den Bevorzugten sehr viele Anhänger zählt [1], die nur zu glücklich sind, sich vor ihrem Gewissen auf Autoritäten berufen zu können. Wir wissen mit Kant, daß das Pflichtgesetz allein uns Nordstern und Kompaß sein kann, um unser Schifflein im wegelosen Ozean der Geschichte zum Hafen zu steuern.
4. Der Klassenkampf. ↩
Das Marxsche [2] Wort behält also insofern recht, daß „alle Geschichte die Geschichte von Klassenkämpfen ist“: das eigentlich entwickelnde Element des Geschehens sind in der Tat die Parteienkämpfe nur, insoweit sie Klassenkämpfe sind. Das gilt auch noch für den modernen Verfassungsstaat. Wo die Bestandteile einer alten Partei sich ihrer verschiedenen Klassenlage und Klasseninteressen bewußt werden, <la wird es immer schwieriger, sie zusammenzuhalten, namentlich, wenn der Druck der korrelativen, kontrastierenden Partei schwächer wird oder ganz aufhört. Das ist das Schicksal der jetzigen Zentrumspartei, die überall Bruchlinien in dem einst so fest gefügten Bau aufweist und bereits eine ihrer Gruppen, einen Teil des bayrischen Bauernstandes, verloren hat. Wie weit und wie lange es ihr gelingen wird, ihre Industriearbeiterschaft bei der Stange zu halten, wird mehr von der innenpolitischen Entwicklung Deutschlands, namentlich von der endgültigen Stellung der Sozialdemokratie zum theoretischen Kommunismus, abhängen als von der Politik der Zentrumsführer selbst. So wie sie heute dasteht, spielt sie zwar als das „Zünglein an der Wage“ eine entscheidende Rolle, aber doch fast ausschließlich als statische, nicht als kinetische Kraft, als Hemmung der von beiden kämpfenden Seiten zu befahrenden Ausschreitungen, also mehr negativ. Das ist in der heutigen Situation Deutschlands wahrscheinlich außerordentlich wichtig und heilsam, aber es ist eben keine positive, entwickelnde Politik ; eine solche kann die Partei bei ihrer Zusammensetzung aus den disparatesten Klassenelementen, vom westfälischen Grund- und Bergherrn bis zum Industrieproletarier, nicht treiben.
Wo nicht so starke ideologische Bindungen vorhanden sind wie in dieser durch mehr als tausendjährige Tradition und durch die vollkommendste „Parteimaschine“ der ganzen Geschichte zusammengehal-
[1] „Heute treten metaphysische Gesichtspunkte, besonders naturrechtlicher Att, hie und da in den Niederungen der Agitation noch auf“ (Sulzbach, Betrachtungen, S. 128). Das ist vor Ausbruch des Weltkrieges gedruckt worden! Wie erhaben fühlte sich damals der deutsche Machttheoretiker!
[2] Das kommunist. Manifest, S. 25.
[667]
tenen Partei, da zerfällt das alte Parteigebilde in der Regel sehr schnell in eine Anzahl neuer, junger Parteien, sobald die wirtschaftlich-soziale Entwicklung die ehemals einheitliche Gefolgschaft in verschiedene Gruppen spaltet, oder, sobald die Bestandteile sich ihrer verschiedenen Interessen bewußt werden. Ein Beispiel dafür ist die Abspaltung der mittelständischen und antisemitischen Parteien Deutschlands von dem deutschen Liberalismus, als Folge davon, daß jene deszendente, dieser aszendente Schichten vertreten: jene die alten, vom Kapitalismus bedrängten historischen Mittelstände in Handwerk und Kleinhandel, dieser die aus jenen Mittelständen emporsteigenden kapitalistisch erfolgreichen Elemente.
Wo umgekehrt ein alter Klassengegensatz durch die soziale Differenzierung zum Verschwinden gebracht wird, da verschmelzen in der Regel, wenn nur eben eine korrelative, kontrastierende Bildung vorhanden ist, die beiden alten Parteien zu einer neuen. Ein Beispiel dafür ist die fortschreitende Verschmelzung, die den ostelbischen Kleinjunker mit dem westelbischen Großbauern im „Bunde der Landwirte“ zusammenführt: da jener sinkt, und dieser steigt, treffen sie sich auf halbem Wege. Selbstverständlich können sich die beiden Prozesse auch kombinieren, derart, daß eine Gruppe sich von ihrer alten Partei trennt und einer jetzt verwandteren anderen anschließt. Der Leser wird derartige Fälle genug aus der Zeitgeschichte anzuführen imstande sein.
So beherrschen die Klassengegensätze auf die Dauer die Entwicklung auch derjenigen Parteien, die ursprünglich nicht Klassenparteien waren und es noch heute'nicht sind.
Alle Gruppenbildung dient den Gruppengliedern als Mittel zu ihren individuellen Sonderzwecken. (Damit sagen wir nicht, daß alle Gruppen zu diesem Zwecke bewußt geschaffen worden sind.) Daraus ergibt sich, daß das Ziel der Gruppenpolitik das Mittel der Individuen sein kann [1]. Als deren letztes Ziel haben wir das Prestige, die Hochgeltung erkannt ; da aber das Mittel dazu, wie die Dinge heute liegen, fast nur in der Wirtschaftspolitik besteht, so bildet der Wirtschaftskampf fast den einzigen Gegenstand der heutigen Klassenkämpfe, abgesehen nur von den relativ seltenen und geschichtlich wenig erheblichen Fällen, wo es sich unmittelbar um Prestigefragen handelt.
Das Ziel der Klassenkämpfe ist also mit jenen geringen Ausnahmen darin beschlossen, daß jede Partei der von ihr vertretenen Klasse einen möglichst großen Anteil an dem Erzeugnis der gesellschaftlichen Arbeit, des ökonomischen Mittels, zu verschaffen bestrebt ist. Mit anderen Worten: die bevorzugten Klassen wollen ihren Anteil mindestens auf der alten Höhe halten, womöglich noch vermehren bis auf ein Maximum,
[1] S. S. I, S. 910.
[668]
das den ausgebeuteten Klassen gerade noch die Prästationsfähigkeit läßt, ganz wie im primitiven Imkerstadium und in allen folgenden Epochen der Staatsentwicklung; —die Gruppe der ausgebeuteten Klassen will ihren Tribut womöglich auf Null reduzieren, das gesamte gesellschaftliche Erzeugnis selbst genießen; — und die Übergangsklassen wollen den Tribut nach oben soviel wie möglich vermindern, das unentgoltene Einkommen von unten her aber soviel wie möglich vermehren.
Das ist im wesentlichen das Ziel und der Inhalt des Klassenkampfes. Und seine Mittel sind noch immer die der Herrschaft. Die herrschende Klasse gibt die Gesetze, die ihren Zwecken dienen: Klassengesetzgebung ! Sie wendet sie derart an, daß die scharfe Schneide immer nach unten, der stumpfe Rücken aber nach oben gekehrt ist : Klassenjustiz ! Sie handhabt ihre Macht im Staate zwiefach im Interesse ihrer Angehörigen: indem sie erstens alle hervorragenden Stellungen, die Ehre, Einfluß und Gewinn bringen, ihnen vorbehält, und zweitens die Geschäfte durch diese ihre Kreaturen leitet: Klassenverwaltung und Klassenpolitik! Nach außen in Handelskriegen, Schutzzoll- und Kolonialpolitik, nach innen in Kirchen-, Schul-, Gewerbe- und Sozialpolitik, Wahlpolitik usw. Solange der Adel vorherrscht, beutet er den Staat wie ein Rittergut aus; sobald die Bourgeoisie allein am Ruder ist, exploitiert sie ihn wie eine Fabrik. Und die Klassenreligion und leider auch die Klassenwissenschaft decken alles mit ihren Tabus, solange wie es gehen will.
Viel feiner differenziert, viel mächtiger integriert, ist also auch der moderne Verfassungsstaat nach Form und Inhalt grundsätzlich ganz das gleiche wie seine Vorstufen: das entfaltete politische Mittel, das Gehäuse der Unterdrückung und Ausbeutung.
Der durch dieses Wesen hervorgerufene Klassenkampf würde schnell zur Zerstörung des Gemeinwesens führen, wenn ihm nicht das Gemein-, das Staatsbewußtsein als Hemmung entgegenwirkte. Es hält in nicht allzu schlimmen Verhältnissen sogar die reinen Klassenparteien von krasseren Ausschreitungen zurück, wirkt aber vor allem in den großen, aus verschiedenen Klassen gemischten Parteien, die ja das Staatsbewußtsein vor allem pflegen müssen, um ihre auseinanderstrebenden Elemente zusammenzuhalten, und in der Beamtenschaft.
Der aus Steuermitteln besoldete, fachmännisch ausgebildete Beamte ist ja eine Schöpfung des entfalteten ökonomischen Mittels, der Stadt und ihrer Geldwirtschaft [1]. Ihn übernahm der absolute Staat von den Städten und benützte ihn vor allem zu seiner großen gesellschaftlichen Leistung: der Durchsetzung des Gemeininteresses gegen die partikulären Interessen der Feudalgewalten. Und so ist er, „nach
[1] Vgl. Thierry, a. a. O. S. 34/5·
[669]
dem Gesetz, nach dem er angetreten“, auch im wesentlichen ein Anwalt des Gemeininteresses gegenüber den Sonderinteressen geblieben [1].
Grundsätzlich ist auch heute noch der Beamte, fest aus Staatsmitteln besoldet, dem ökonomischen Interessenkampf entrückt; daher gilt in jeder tüchtigen Beamtenschaft die Beteiligung an Erwerbsunternehmungen mit Recht als mit dem Amte unvereinbar. Wäre der Grundsatz völlig durchsetzbar, und brächte nicht auch der beste Beamte als seine „persönliche Gleichung“ die Staats- und Gesellschaftsauffassung der Klasse mit, der er entstammt, so wäre in der Beamtenschaft in der Tat jene schlichtende und ordnende Instanz oberhalb des Interessenkampfes gegeben, als die sie sich selbst gern betrachtet: eine Instanz, die den Staat neuen Zielen zuführen könnte. Sie wäre der Hebelpunkt des Archimedes, von dem aus die Welt des Staates bewegt werden könnte.
Aber leider ist weder der Grundsatz völlig durchsetzbar, noch sind die Beamten abstrakte Menschen ohne persönliche Gleichung. Ganz abgesehen davon, daß die Beteiligung an einer bestimmten Art der Gewerbsunternehmung, der Großlandwirtschaft, in fast allen Staaten, wo der Grundadel noch von starkem Einfluß ist, dem Beamten geradezu eine höhere Qualifikation verleiht, weil er „das Befehlen gelernt habe“, sind doch gerade die einflußreichsten Beamten aus der herrschenden Klasse hervorgegangen, bringen ihre Ideologie mit, und sind mit ihren Interessen unlösbar verknüpft. Väterliche und schwiegerväterliche Zuschüsse zum knappen Gehalt, ererbter Besitz und nahe Verwandtschaft mit Interessenten des landed oder moneyed interest verstärken diese aus der „guten Kinderstube“ mitgebrachte, durch Domestikation [2] un- verlöschbar eingeprägte Solidarität mit der herrschenden Klasse und machen die Beamten mehr oder weniger zu ihren gutgläubigen, ihrer persönlichen Gleichung unbewußten Werkzeugen. Und die Mentalität der Oberbeamten überträgt sich, selbstverständlich arg vergröbert, nach dem allgemeinen Gesetz der Sozialpsychologie, das wir kennen [3], auch auf die unteren Schichten der Beamtenschaft, die aus den ausgebeuteten Klassen stammen, aber aus ihnen herausgehoben sind.
Wo solche ökonomischen Beziehungen fehlen oder weniger ins Gewicht fallen, dient die Bureaukratie viel mehr dem Gemeininteresse.
[1] Freilich auch ein Feind aller körperschaftlichen Freiheit und Eigenwüchsigkeit, dessen „Kastengeist“ leicht im Staat „lediglich eine privilegierte Versorgungsanstalt sieht“. Dann entsteht die „Schreibstubenherrschaft“, als die Riehl Bureaukratie bissig übersetzt (D. bürgerl. Gesellsch., S. 240, 243). Dann wird leicht „der rechtschaffene Stolz auf die Würde der gesellschaftlichen Stellung zur ärgerlichen Anmaßung“ (S. 285).
[2] Diese Domestikation ist die Aufgabe und Leistung der höheren Schulen, namentlich der Internate (Eton, Joachimsthal) und der Hochschulen namentlich Englands. (Oxford. Cambridge), und der deutschen Studenten- und aller Offizierkorps: die Erziehung zum „Gentleman“.
[3] S. S. I, S. 703 ff.
[670]
Aus diesem Grunde finden wir in armen Ländern oft die beste Beamtenschaft, wenn sie nur eben finanziell gut verwaltet sind, so daß die Gehälter pünktlich ausgezahlt werden. (Wo das nicht der Fall ist, wie oft im Orient, wird die Beamtenschaft systematisch und unvermeidbar zur Korruption gezwungen.) So z. B. verdankte Preußen seinen sprichwörtlich tüchtigen und unbestechlichen Beamtenstand früher vor allem seiner Armut. Von allen Interessen des ökonomischen Lebens gelöst, dazu noch von Jugend auf in jenem Rigorismus erzogen, der ebenfalls in der allgemeinen Armut, im Stolz auf diese Armut, und in der Verachtung allen Mammons eine seiner Wurzeln hatte, waren diese Männer wirklich vor allem die Vertreter des Gesetzes und der allgemeinen Wohlfahrt, und nur in geringem Maße die der herrschenden Klassen.
In reicheren Staatengebilden ist dieser ideale Typus seltener zu finden. Der Beamte bringt schon aus der Kinderstube Gefühle und Vorstellungen mit, die ihm die Unparteilichkeit fast unmöglich machen: die Verachtung des fronenden Armen, den Stolz des Reichtums, der sich sehr zu seinem Nachteil von der ehemaligen Verachtung der niedrig geborenen unteren Stände unterscheidet: denn jetzt ist der Emporkömmling, wenn er nur reich genug ist, seiner Rezeption sicher geworden. Dem entsprechen die persönlichen Ansprüche an die Lebenshaltung: man will „mitmachen“ können, und so zieht die plutokratische Entwicklung jeden Beamten mehr oder minder in ihren Bann. Dennoch erfüllt auch heute noch in allen entwickelteren Staaten die Beamtenschaft noch einigermaßen die ihr zugefallene Aufgabe: das Gemeininteresse gegen die Partikulärinteressen zu wahren. Und zwar wahrt sie es in der Regel, wenn auch vielleicht wider Willen und jedenfalls zumeist ohne klares Bewußtsein davon, lediglich unter dem Einfluß der gefühlsmäßigen Pflicht, derart, daß das ökonomische Mittel in seinem langsamen, schmerzensvollen Siegesgang gegen das politische gefördert wird. D
amit wollen wir nichts von dem zurücknehmen, was wir oben über die Klassenkämpfe gesagt haben. Gewiß : die Beamten treiben die Klassenpolitik, die die Konstellation der Kräfte im Staate ihnen vorschreibt, und belasten dabei fast immer nur die eine Wagschale mit einem gewissen Plus an Gewicht; gewiß: sie sind im Grunde Vertreter der Herrenklasse, der sie entstammen, von der ihr Schicksal, ja, ihr Leben abhängt. (Der sozusagen legalisierte Mord, ausgeübt durch berufsmäßige Raufbolde an hohen Beamten, die das Interesse ihrer Klasse verletzt haben und durch deren Ehrenstandpunkt gezwungen sind, sich einer noch so rohen Provokation zu stellen, ist nicht ohne Beispiele, und die Drohung damit nicht ohne Wirkung in der Geschichte der Klassenkämpfe gewesen.)
[671]
Aber, das alles zugegeben: die Beamten sind doch bestrebt, die Schärfe des Kampfes zu mildern; sie treten Ausschreitungen entgegen, sie bewilligen Änderungen des Rechts, die durch die gesellschaftliche Entwicklung reif und unvermeidbar geworden sind, ehe der offene Kampf darum entbrennt und den Staat in seinen Grundfesten erschüttert.
Wo ein tüchtiges Fürstengeschlecht herrscht, dessen jeweiliges Haupt sich gleich Friedrich II. als den „Ersten Diener des Staates“ betrachtet, gilt das Gesagte in verstärktem Maße von ihm, da sein Interesse, als des dauernden Nutznießers des Dauerwesens Staat, ihm vor allem gebietet, die zentripetalen Kräfte zu stärken und die zentrifugalen zu schwächen. Das ist der Grund, aus dem die Monarchie auch unter solchen Männern noch Freunde hat, die nicht an das „Charisma“ der Dynastie und ihres jeweiligen Trägers glauben: „Erst da, wo jener über alle Gesellschaft erhabene Besitz der Staatsgewalt der Besitz der eigenen Familie, wo er mithin erblich wird, ist der dauernden Idee des Staates dauernd ein Vertreter gegeben, den die nicht minder dauernd bewegte und kämpfende Gesellschaft nicht mehr in ihren Streit hineinzuziehen vermag. Dann erst ist jener Mann der Staatsidee gefunden, an dem sich wie in ihrem Mittelpunkte alle Organe und Funktionen des über die Gesellschaft erhabenen Staates kristallisieren können“ [1].
In der Tat: wer auf Steins grundsätzlichem Standpunkte steht, daß die Klassenbildung und daher der „Kampf der Gesellschaft um die staatliche Herrschaft“ [2] naturnotwendige, ewig unvermeidliche, „immanente“ Eigenschaften jeder entfalteten Gesellschaft seien, der wird leicht zu einer Art von „Vernunftsmonarchismus“ kommen können. Wir haben im Laufe dieser Betrachtungen öfters die natürliche Solidarität zwischen Fürst und Volk als segensreiche geschichtliche Kraft kennen gelernt: im vollendeten Verfassungsstaat, in dem der Monarch nur noch in geringem Maße als Grund- und Kapitalbesitzer privatwirtschaftliches Subjekt, und fast ganz besoldeter „Staatsdiener“ ist, drückt diese Interessenverknüpfung noch viel stärker durch als im Feudal- und absoluten Staat, wo die Herrschaft noch wenigstens zum guten Teile Privatwirtschaft ist.
Aus diesem Grunde sind denn auch sogar jene radikalen Denker, die nicht an die ewige Notwendigkeit der Klassenscheidung und Klassenkämpfe glauben, die Sozialisten aller Richtungen, nicht grundsätzliche Antimonarchisten und grundsätzliche Republikaner. Um ein einziges Beispiel anzuführen, so schreibt sogar Bakunin: „daß der republikanische Staat ebenso unterdrückt wie der monarchische ; nur unterdrückt
[1] L. v. Stein, Soziale Bewegung III, S. 9· Vgl. S. 11ff. über das ideale Beamtentum, das er ungefähr wie wir bewertet. Vgl. List, a. a. O. S. 247.
[2] Jellinek, a. a. O. S. 116.
[672]
er nicht die besitzenden Klassen, sondern ausschließlich das Volk. . . . Sie wissen nicht, daß der Despotismus nicht nur unter der Form des Staates oder der Gewalt auftritt, sondern auch im Prinzip des Staates und der politischen Macht, und daß deshalb der republikanische Staat durch sein Wesen ebenso despotisch sein muß, wie der von einem Kaiser oder König regierte Staat“ [1].
Wirklich zeigt die Geschichte der kapitalistischen Republiken, daß sie sich grundsätzlich weder in ihrer Form noch in ihrem Inhalt von den kapitalistischen Monarchien unterscheiden. Der Klassenkampf wird in der Republik mit den gleichen Mitteln und zum gleichen Ziele geführt. Immerhin ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, daß dieser Klassenkampf in der Monarchie ein wenig mehr „das Gesicht wahrt“, d. h. daß grobe Schamlosigkeiten seltener ungerügt bleiben; und namentlich, daß unter sonst gleichen Umständen die Kurve der Staatsentwicklung in der Monarchie gestreckter, in einer weniger gezackten Kurve verläuft, weil der Fürst, für Tagesströmungen weniger empfindlich als ein auf kurze Jahre gewählter Präsident, eine vorübergehende Einbuße an Volkstümlichkeit nicht so sehr zu scheuen braucht, und daher seine Politik auf längere Zeiträume spannen kann [2].
Noch ist einer Art des Beamtentums zu gedenken, deren Einfluß auf die Höherentwicklung des Staates in früheren Zeiten nicht gering gewesen ist : des wissenschaftlichen Beamtentums der Hochschulen. Es ist nicht nur, wie das Beamtentum überhaupt, Schöpfung des ökonomischen Mittels; es hat nicht nur in erhöhtem Maße jene Unabhängigkeit von wirtschaftlichen Interessen besessen, die wir als die Bedingung einer idealen Bureaukratie kennen gelernt haben, jene Verachtung des Reichtums und Luxus, die aus dem Bewußtsein des Besitzes wesentlich wertvollerer Schätze hervorgeht: es ist gleichzeitig die Schöpfung einer geschichtlichen Kraft, die wir bisher nur als den Bundesgenossen des Staates kennen gelernt haben: des Kausalbedürfnisses. Dieses Bedürfnis sahen wir auf niederer Stufe die Superstition [3] erschaffen, und deren Bastard, das Tabu, fanden wir auf allen Stufen als starke Waffe in den Händen der Herrenklasse. Aus demselben Bedürfnis ist aber inzwischen die Wissenschaft erwachsen, die die Superstition angreift und zertrümmert und dadurch der Entwicklung den Weg bereiten hilft. An dieser unschätzbaren Leistung der Wissenschaft haben die Hochschullehrer ihren reichen Anteil gehabt.
[1] A. a. O. S. 24/5.
[2] Von Bebel wird berichtet, er habe geäußert: „Wenn ich die Wahl hätte zwischen •der Verfassung des deutschen Kaiserreichs und der französischen Republik, so würde ich mich für die französische Republik entscheiden. Hätte ich aber die Wahl zwischen dieser und der englischen Monarchie, so würde ich mich für die englische Monarchie entscheiden“ (Beckmann, a. a. O. S. 18).
[3] Nicht die Religion!
[673]
Wenn die Hochschulen diese ihre alte Führerwürde heute zum großen Teile eingebüßt haben, so liegt die Ursache einerseits in der allgemeinen psychologischen Umwälzung zur Plutokratie, der sich auch diese Beamten so wenig entziehen konnten wie ihre anderen Amtsgenossen. Wir glauben aber, daß noch ein anderes hier entscheidend einspielt. Wie die Dinge heute liegen, scheint der Menschheit nur die Qual der Wahl zwischen dem kapitalistischen Imperialismus und dem Kommunismus bolschewistischer Färbung gelassen zu sein. Und da ist es in der Psychologie des Gelehrten tief begründet, daß er der so rohen Grundkonzeption dieses letzteren widerstrebt, die sich noch dazu so überaus roher Mittel bedienen muß. Seine ganze Lebenskenntnis sagt ihm, daß die Kultur ebensowenig Sprünge machen kann wie die Natur : so viel für das Ziel; wer aber nicht an das Ziel glaubt, muß vor der Roheit der Mittel schaudernd zurückschrecken. Und da man einmal Partei nehmen muß, nimmt man sie eben notgedrungen auf der Gegenseite, die Einem wenigstens nicht das „Credo quia absurdum“ zumutet.
Dieses ganze Buch ist dem Einen Nachweis gewidmet, daß die Menschheit nicht notwendig vor diesem fürchterlichen Dilemma steht. Wenn unsere Argumente sich durchsetzen können, werden die Arbeiter des Geistes und ihnen voran die der Hochschulen wissen, wo sie Partei zu nehmen haben [1].
Das ist der Klassenkampf : seine Ziele und Mittel, seine Träger und Leiter, seine Triebkräfte und seine Hemmungen. Grundsätzlich ist nichts gegen die Vorstufen geändert. Nur das Gebiet, auf dem er sich abspielt, und daher seine Waffen, ändern sich allmählich in dem Maße, wie der kapitalistische Staat seine volle Reife erlangt. Aus dem politischen Kampf um die geschriebene Verfassung wird mehr und mehr der wirtschaftliche Kampf um die „ungeschriebene“ Verfassung.
Solange noch im Staatsrecht jene anachronistischen Reste aus den Vorstufen bestehen, von denen wir oben sprachen: Standesvorrechte, Zensuswahlsysteme, Koalitionsbeschränkungen, „Gesindeordnungen“, Steuerprivilegien usw. : solange ist der politische Verfassungskampf, der
[1] Vgl. Nelson: System der philosophischen Rechtslehre und Politik, S. 439: „Wenn der Zweck der Tätigkeit der Hochschullehrer nicht die Befriedigung ihres Privatinteresses ist, so erschöpft sich die Bedeutung ihres Berufs auch nicht in der Befriedigung ihres Forscherinteresses. Sondern er steht im Dienst der Allgemeinheit, des öffentlichen Zwecks der Verwaltung des gemeinsamen Gutes der Wahrheit. Es gibt daher einen volkstümlichen Beruf der Hochschule, wie er sich betätigt, nicht in der Anpassung an das Bedürfnis einer verflachenden Popularität, wohl aber in der Anerkennung der allgemeinen sittlichen Bedeutsamkeit der Wahrheit für einen jeden im Volke, und des Rechts eines jeden, der Segnungen ihrer Herrschaft teilhaft zu werden. Der Geist der Wahrheit ist der heilige Geist, der von der Hochschule aus das ganze Volk durchdringen und in ihm zur unüberwindlichen, aller Macht des Privatinteresses überlegenen Herrschermacht ausgebildet werden soll.“
[674]
Jahrhunderte hindurch das Staatsleben der Vorstufen beherrschte, nicht beendet. Er vollzieht sich in ruhigen Zeiten in der Wahlagitation und den Parlamenten, aber in Kampfzeiten auch in Straßendemonstrationen, Massenstreiks, Putschen, Attentaten und Revolten.
Lange aber, ehe dieser Verfassungskampf beendet ist, ist es der Unterklasse klar geworden, daß nicht, wenigstens nicht mehr, in diesen Resten der feudalrechtlichen Machtpositionen die Zitadelle der Gegner zu suchen ist. Sie erkennt deutlich, daß im Gegenteil auch diese Reste verankert sind in jener „ungeschriebenen“ Verfassung, von der uns Lassalle sprach: im Eigentum, und daß sie nur mit ihm entwurzelt werden können. Denn jene Reste sind zu klein, um erklären zu können, warum sich auch im freien Verfassungsstaate die „Verteilung“ grundsätzlich durchaus nicht geändert hat.
Fortan geht der Klassenkampf immer mehr um diese Verteilung unmittelbar: um die Verteilung der Arbeit und der Güter in den sog. „wirtschaftlichen“ Kämpfen: den Lohnkämpfen zwischen Proletariat und Exploiteuren mittels Gewerkschaften und Streiks unten, mittels Arbeitgeberkoalitionen, schwarzen Listen und Aussperrungen oben. Und um die Verteilung der Produktionsfaktoren, des Eigentums an den Produktionsmitteln : praktisch in winzigem Maße durch die Bildung von Genossenschaften, und in grandiosem Maße durch die kommunistischen Revolutionen und ihre imperialistischen Gegenspieler.
Um von den Sowjets auch hier vorläufig abzusehen, so tritt im Laufe der Entwicklung im kapitalistischen Staate die wirtschaftliche Organisation zuerst gleichberechtigt, später führend neben und vor die politische. Oben beherrscht „die Wirtschaft“ d. h. der Inbegriff der großen koalierten Kapitale, das „Finanzkapital“, unten die Gewerkschaft zuletzt die Parteien, deren sie sich immer ausschließlicher als ihrer Werkzeuge oder besser : Lakaien, bedienen, denen sie die Ziele und Mittel zum Ziele immer gebieterischer vorschreiben.
Und nun enthüllt sich der wahre Charakter des Klassenkampfes immer unzweideutiger. Die alten Parteien, die noch aus überlebten Ideologien heraus die Angehörigen mehrerer Klassen in sich vereinigen, werden an Zahl und Macht immer schwächer, und noch schwächer durch die innere Uneinigkeit, die sie der Bewegungsmöglichkeit beraubt; die übrigen Elemente, die das Gemeininteresse vertraten, vor allem die Beamtenschaft aller Grade und Berufe, werden immer mehr in die Kampffronten einbezogen, und das Gemeinbewußtsein selbst verliert mit dem Verfall der alten Ideologien, deren Bedeutungslosigkeit immer klarer hervortritt, mehr und mehr an verpflichtender, hemmender, vereinender Macht. So leert sich das Feld zwischen den beiden großen Heerkörpern immer mehr, und wieder stehen sich, wie in Platons Hellas,
[675]
die „beiden Völker“ innerhalb jedes einzelnen Volkes [1] als Todfeinde gegenüber, „die einander nach dem Leben trachten“. Während die Besonnenen ratlos beiseite stehen, in der Unmöglichkeit, sich für eines der beiden tödlichen Übel zu entscheiden, zwischen denen es zu wählen gilt, reißen die Menschen „mit dem schwülen Kopfe und dem kalten Herzen“, vor denen Nietzsche warnte, die Führung an sich: die Fanatiker und die Verrückten, die Abenteurer und die Verbrecher, die ihren Weizen blühen sehen. Sie schüren den Streit und die Erbitterung, wütender Haß tobt sich hier wie dort aus; die rohesten und wildesten Mittel werden angeraten und finden ihre Gläubigen und Ausführenden, Mord und Blutrache vernichten die letzten Möglichkeiten der Verständigung.
So stehen wir heute unmittelbar vor den Ausbruch des ungeheuersten Bürgerkrieges, der, wenn er wirklich ausbricht, diesen ganzen Erdteil in Trümmer und Asche legen und Hunderten von Millionen Menschen einen schweren Tod bringen wird. Wie der Seestaat des Altertums, so muß, wenn nicht in letzter Stunde noch die rechte Erkenntnis den rechten Weg weist, auch der Landstaat der germanisch-keltisch-slavischen Völker an dem alten furchtbaren Erbübel zugrunde gehen : an dem alten Unrecht, an der Erbsünde, die ihm seit seiner Entstehung anhaftet. Europa, seit Roms Glanzzeit der gewaltigste Nutznießer des politischen Mittels, diese kleine Halbinsel am Körper des asiatischen Kontinentes, die seit zwei Jahrtausenden den ganzen Weltkreis ausgebeutet und verheert hat, steht in dringendster Gefahr, an eben diesem politischen Mittel zugrunde zu gehen und zur Wüste zu werden, wie vor ihm die Sitze der großen gewaltgeschaffenen Hochzivilisation in Nordafrika, Vorderasien und Südeuropa. Bürgerkrieg im Inneren der Staaten, Bürgerkrieg zwischen den aufs engste kulturell und wirtschaftlich verflochtenen Staaten: das ist unser unvermeidbares Schicksal, wenn die Entwicklung so weiter geht wie bisher.
Muß sie so weiter gehen ? Das ist die Frage der Sphinx, an deren Beantwortung Tod und Leben hangen. —
IV. Der kapitalistische Dissensus. ↩
Die Antwort auf diese Frage des Schicksals kann nur die theoretische Ökonomik geben. Sie allein kann hier, wo Erfahrung und Geschichte uns verlassen, jenes „Bewegungsgesetz“ der modernen Gesellschaft enthüllen, das Lorenz Stein und Karl Marx suchten [2] — und beide
[1] 1848 schreibt Disiaeli: „Sie sind gleichsam zwei Völker, zwischen denen keinerlei Verkehr und kein verwandtes Gefühl besteht, die einander so wenig kennen in ihren Gewohnheiten, Gedanken und Gefühlen, als ob sie die Söhne verschiedener Zonen oder die Bewohner verschiedener Planeten wären“ (zit. nach Jul. Wolf, a. a. O. S. 57).
[2] S. S. I, S. 50.
[676]
nicht finden konnten, weil sie beide im Banne des Gesetzes der ursprünglichen Akkumulation standen. Nur wer jenes Bewegungsgesetz besitzt, kann mit wissenschaftlichen Mitteln dieser Gesellschaft die Prognose stellen, indem er „die Tendenz ihrer Entwicklung“ feststellt.
Damit stellt sich uns die Frage nach der Ursache und dem Wesen des Kapitalismus, oder, mit anderen Worten: nach der „ungeschriebenen Verfassung“ dieser Staatswesen, jenen Machtpositionen, die die krankhafte Verteilung der Güter, der Arbeit und des Eigentums zwischen den Klassen immer noch aufrechterhalten, obgleich aus den geschriebenen Verfassungen längst die Gesetze verschwunden sind, die die Ungleichheit, die Unterschiede der Stände, statuierten.
Wir werden auch hier wieder zuerst die Theorie entwickeln, werden sie zweitens mit den Tatsachen konfrontieren, die uns die beiden induktiven Methoden, Wirtschaftsgeschichte und Beobachtung der Gegenwart, namentlich mit den Methoden der Statistik, liefern, und werden drittens den sich aus diesen Betrachtungen ergebenden Heilplan darlegen. Es kann sich hier natürlich nur um einen allerkürzesten Auszug aus der im dritten Bande dieses Systems in aller gebotenen Ausführlichkeit enthaltenen Darstellung handeln.
1. Die Theorie. ↩
a) Die Methode der Ökonomik.
Die erste Frage ist, ob die theoretische Ökonomik nach ihrem heutigen Zustande oder überhaupt nach ihrem Wesen imstande ist, das Problem mit Sicherheit zu lösen. Das heißt: ob ihre Methode zu genügender Sicherheit entwickelt ist. Die Frage kann heute mit voller Gewißheit bejaht werden.
Die Methode der Klassiker, deren auch Karl Marx sich ausschließlich bediente, war die Deduktion aus dem sog. „ökonomischen Prinzip“ [1], das heißt der Annahme, daß der wirtschaftende Mensch immer das kleinste Mittel zum größten Erfolge wählt.
Diese Methode war eine Zeitlang in schweren Mißkredit geraten, und man hört auch heute noch vielfach die alten Argumente, die seinerzeit die „historische Schule“ gegen die klassische Methode geltend gemacht hat. Wir haben diese Argumente vollkommen widerlegen können
: Es hat sich erstens herausgestellt, daß die historische Schule ein ganz anderes Erkenntnisobjekt bearbeitete, als die Klassiker: eine Tatsache, die sie nicht bemerken konnte, weil sie von einer unzulänglichen Begriffsbestimmung der Ökonomik ausging. Diese ist nach unserer heute
[1] Das ist vollbewußt z. B. auch H. v. Thünens Methode, vgl. Isolierter Staat I, S. 327.
[677]
schon vielfach angenommenen und ernstlich auch gar nicht zu bestreitenden Definition die Lehre von der Gesellschaftswirtschaft einer entfalteten Wirtschaftsgesellschaft. Die historische Schule hat immer nur den Personenkreis, die Wirtschaftsgesellschaft, bearbeitet, während die Klassiker die verbindende Funktion, die Gesellschaftswirtschaft, ausschließlich in ihr Gesichtsfeld eingestellt hatten [1]. Jener Gegenstand läßt sich offenbar, weil geschichtlich, nur mit historischenMitteln, dieser, weil in allen Epochen und bei allen Völkern grundsätzlich identisch, nur mit psychologisch-deduktiver Methode behandeln. Die beiden Schulen standen also auf ganz verschiedenem Boden, hatten verschiedene Gegenstände und konnten friedlich nebeneinander bestehen.
Die historische Schule [2] erhob aber den Anspruch, die ganze Ökonomik allein beherrschen und betreiben zu dürfen, und griff zu dem Zwecke die klassische Methode mit Argumenten an, die wir einzeln dargestellt und widerlegt haben:
Es ist richtig, daß es den Klassikern nicht geglückt ist, die Erscheinungen der kapitalistischen Wirtschaft widerspruchsfrei zu erklären, und daß weiterhin ihre Voraussagen durch die wirkliche Entwicklung vielfach Lügen gestraft worden sind. Aber das lag nicht an der Methode, sondern an den Prämissen, vor allem an dem, wie wir wissen, von dieser Schule axiomatisch angenommenen „Gesetz der ursprünglichen Akkumulation“, der Wurzel aller soziologischen Übel in Theorie und Praxis. Das konnte die historische Schule nicht bemerken, weil sie ebenfalls von diesem Axiom ausging.
Es ist ferner richtig, daß die Klassiker den Kapitalismus in gewissem Maße „verabsolutiert“ haben, indem sie bereits in die primitivsten Gesellschaftszustände seine besonderen Kategorien, vor allem das Kapital selbst, hineinsahen. Auch dieser Fehler wächst aus der gleichen Wurzel wie der erste: wenn man einmal dogmatisch annahm, daß sich der heutige Zustand der kapitalistischen Gesellschaften ohne Eingriff irgendeiner außerökonomischen Gewalt rein durch die immanenten Kräfte der Konkurrenz aus einem Urzustände der Freien und Gleichen herausgebildet habe, war dieser Irrweg nicht mehr zu vermeiden. Aber auch er liegt nicht im Wesen der Methode. Sie setzt nichts anderes voraus, als daß die Menschen in ihren wirtschaftlichen Handlungen immer und überall von dem ökonomischen Prinzip des kleinsten Mittels zum größten Erfolge geleitet werden: und man braucht nur einmal flüchtig hinzuschauen, um zu erkennen, daß sich in jeder historisch gegebenen Wirtschaftsgesellschaft nach diesem Prinzip ein anderes Mittel, als das zurzeit kleinste, dem rationellen Handeln
[1] S. S. III, S. 168. Die folgenden Ziffern in () beziehen sich gleichfalls auf dieses Werk.
[2] Sie ist heute übrigens vollkommen verschwunden.
[678]
darbietet, und daß eben nur in der einen, modernen, Gesellschaft die Exploitation freier Arbeiter, d. h. der Kapitalismus, dieses kleinste Mittel ist (172).
Ein weiterer Einwand trifft nicht die großen Klassiker selbst, sondern nur ihre Epigonen, die die Methode der Meister nicht mehr verstanden. Sie glaubten irrigerweise, das ökonomische Prinzip fordere die Wahl des objektiv kleinsten Mittels, und kamen von hier aus zu der Zerrkonstruktion des sog. „economical man“, der immer auf dem besten Markte kauft und verkauft und ohne sittliche Skrupel lediglich seinem Gewinnstreben folgt. Wenn sie recht hätten, so könnte man nur eine fingierte, aus lauter solchen Wirtschaftsspezialisten zusammengesetzte, Gesellschaft, aber nicht die reale, aus gewöhnlichen Menschen bestehende Gesellschaft berechnen und verstehen. Aber sie haben zum Glück nicht recht. Die Deduktion fordert nicht mehr, als daß der Mensch bei seiner wirtschaftlichen Handlung sein subjektiv kleinstes Mittel wähle: und das tut unbestreitbar jeder nicht Geisteskranke. Die aus der verschiedenen Einsicht und Entschlußfähigkeit sich ergebenden Unterschiede der Wirtschaftslage buchte die Klassik, der wir auch hier folgen, einfach unter der ihr wohlbekannten Rubrik der persönlichen Qualifikation.
Der nächste Einwand hat überhaupt keine andere Ursache mehr als ein Mißverständnis der Kritiker. Sie behaupten, daß sich die wirtschaftliche Handlung nicht berechnen lasse, weil der „Wirtschaftstrieb“ durch andere Triebe, wie etwa den nach Nahrung, nach Geschlechtsvereinigung, nach Bürgerehre usw. „gekreuzt“ werde. Diese Meinung beruht auf einer grundfalschen Begriffsbestimmung. Man kann nämlich die Ökonomik auch definieren als die Lehre von der wirtschaftlichen Bedürfnisbefriedigung. (Das ist ein weiterer Begriff, der auch die isolierte Wirtschaft des Robinson und sogar die Wirtschaft höherer Tiere mitumfaßt.) Die Kritiker der klassischen Methode mißverstehen nun diesen Begriff als die Befriedigung des wirtschaftlichen Bedürfnisses. Aber ein solches existiert nicht. Richtig verstanden bedeutet die Definition die Befriedigung von Bedürfnissen auf wirtschaftliche Weise, d. h. eben nach dem Prinzip des kleinsten Mittels. Wirtschaften heißt : ein beschlossenes Ziel auf dem Wege anstreben, den man subjektiv für den kleinsten der erlaubten Wege hält (46/7). Da das Ziel per defini- tionem bereits feststeht, ehe die wirtschaftliche Handlung beginnt, kann von einer „Kreuzung der Motive“ nicht die Rede sein, so wenig wie von einem Zusammenstoß zwischen der Lokomotive und der Schienenbahn. Zum Überfluß sind der ungeheuren Mehrheit aller Menschen für die ungeheure Mehrheit ihrer Wirtschaftsakte die Ziele durch ihre gesamte Lage geradezu zwingend vorgeschrieben, ebenso wie die dazu führenden Wege. Aus diesem Grunde, und weil auf den wirtschaftlichen Entschluß
[679]
nur die eine Kraft wirkt, läßt sich die durchschnittliche gesellschaftliche Handlung mit voller Genauigkeit „more mathematico“ deduzieren (181 ff.).
Schließlich haben die Kritiker unbegreiflicherweise das sehr harmlose Prinzip des kleinsten Mittels, das Prinzip jeder (nicht bloß der wirtschaftlichen) rationellen Handlung, als den bösen Egoismus oder sittlichen Solipsismus mißverstanden, weil es von den Klassikern meistens als das „Selbstinteresse“ bezeichnet worden ist (186ff.).
Damit sind alle erhobenen Einwände erledigt, und die Methode der Klassiker als durchaus zuverlässig dargetan. Wir haben denn auch zeigen können, daß man, wenn man nur von richtigen Prämissen ausgeht, also vor allem jenes verhängnisvolle Axiom ausschaltet, durch die Deduktion aus dem ökonomischen Prinzip die kapitalistische Wirtschaft bis in ihre letzten Einzelheiten hinein deduzieren kann. Wir werden diese Deduktion hier in äußerster Kürze wiederholen. Sie liegt in voller Rüstung und gesichert durch die Kritik der entgegenstehenden Lehrmeinungen im dritten Bande dieses Systems vor. Und es wird sich zeigen, daß auch hier aus der vollständigen Diagnose die Prognose und der Heilplan gerade so sicher folgen wie am Krankenbett.
Dabei darf dem Leser nicht verschwiegen werden, daß unsere ökonomische Theorie noch weit davon entfernt ist, allgemein angenommen zu sein. Die gleichen Kritiker, die früher die klassische Methode bemängelten, weil sie unzulängliche Ergebnisse zeitigte, bemängeln sie in der Anwendung durch uns, weil sie allzu vollkommene Ergebnisse zeitigt. Was ihr nach den Grundsätzen der allgemeinen Wissenschaftslehre zum besten Beweise ihrer Wahrheit dienen sollte: die große Einfachheit ihrer Ableitung aus einer einzigen Grundvoraussetzung, wird ihr als „Monismus“ vorgeworfen [1]! Im übrigen, wie wir einmal gegen die Grenznutzentheoretiker schrieben: „Die Kapitalisten des Geistes wehren sich gegen ihre Expropriation“. Sustineatur opinio, pereat mundus!
Der Leser wird daher auf seine eigene Kritik gegenüber der hier vorgetragenen „monistischen“ Lehre angewiesen sein.
b) Der Kapitalismus.
Die uns gestellten Aufgaben sind mithin die folgenden: Ursache und Wesen des Kapitalismus sind aus jener einzigen Grundvoraussetzung der theoretischen Ökonomik zu entwickeln, daß die Menschen bei ihren wirtschaftlichen Handlungen von nichts anderem als dem ökonomischen Prinzip motiviert sind.
Wir fassen zunächst die erste der beiden Aufgaben ins Auge.
[1] Vgl. S. S. III, s. 556.
[680]
A. Die Ursache des Kapitalismus. (Die Reservearmee.)
Für uns, die wir der Überzeugung sind, daß die Geschichte nicht bloß gewesen ist, sondern auch gewirkt hat, ist der Weg zur Lösung unschwer aufzufinden. Die staatsbildende Gewalt hat zwei Institutionen geschaffen: die Stände und das Großeigentum. Die Stände sind nicht mehr: also muß die Ursache im Großeigentum gesucht werden.
Unsere bisherigen Ergebnisse gestatten uns, noch einen weiteren Schritt zum Ziele zu tun: die primäre Ursache muß im großen Grundeigentum stecken. Denn ohne die Sperrung des von Natur aus im Überfluß vorhandenen Bodens kann es keinen Kapitalismus geben: das hat uns früher Turgot und soeben Adam Smith gesagt, und das hat Karl Marx ausdrücklich in seiner Untersuchung über die Kolonien bestätigt, die wir oben (S. 222) angeführt haben [1].
Wir wollen von einem gesicherten Punkte, d. h. von einem Satze ausgehen, über den sich alle Schulen, bürgerliche wie sozialistische, einig sind:
Kapitalismus ist nur dort möglich, wo regelmäßig auf dem Markte der Arbeit ein Überangebot stattfindet; oder, um die berühmte Marxsche Formel zu brauchen, wo eine „Reservearmee unbeschäftigter Arbeiter“ vorhanden ist, die den Lohn der Beschäftigten in ungünstigen Zeiten niederzieht und in günstigen niederhält.
Fragt sich also nur noch : woher stammt diese Reservearmee ?
Die bürgerliche Theorie versuchte lange Zeit, sie mit dem Malthus- schen Bevölkerungsgesetz zu erklären. Danach soll kraft eines Naturgesetzes die Zahl der Menschen immer stärker zunehmen müssen als die für sie notwendige Nahrung. Daher die wütende Konkurrenz der vom Hungertode Bedrohten um die Arbeitsplätze im Dienste der Besitzenden, daher der Tiefstand der Löhne ! Die Lehre ist, wie wir schon einmal festgestellt haben, nichts besseres als eine Variante der Kinderfibel und zwar in noch verböserter Gestalt, da Malthus das bekannte „Gesetz der sinkenden Erträge“ als Prämisse benützt, ohne von der entscheidenden Einschränkung Notiz zu nehmen, die seine Anwendung in diesem Falle verbietet (263 ff. ; 1039 ff.). Es ist kein Wort mehr über dieses, im übrigen von fast allen Theoretikern aufgegebene Pseudogesetz zu verlieren.
Karl Marx erklärt die Bildung der Reservearmee mittels einer ebenso geistvollen wie komplizierten Theorie, die die populäre Meinung der Arbeiter unterbaut, daß die Maschine sie „freisetze“. Wir
[1] Marx könnte auch das, wie fast seine ganze Ökonomik, im Keime bei Ricardo gefunden haben. R. trägt die Theorie im Chapter II (on rent) im vierten Absatz vor (ed. Gönner S. 46, ed. Baumstark, S. 42).
[681]
haben gezeigt, daß die Deduktion auf einem Trugschluß beruht, und daß die Tatsachen gegen sie Zeter schreien. Marx muß selbst zugeben, daß in der Gesamtindustrie die Zahl der Freisetzungen weit überwogen wird durch die der Neueinstellungen, so daß die Zahl der industriellen Proletarier viel schneller wächst als die Gesamtbevölkerung. Und er erkennt weiterhin, daß die Hauptquelle der Reservearmee auf dem Lande entspringt. Die Ursache sieht er, geblendet von seinen industriellen Kategorien, in der Freisetzung der Arbeiter durch die landwirtschaftliche Maschinerie. Wir haben zeigen können, daß das von ihm für diesen angeblichen Zusammenhang beigebrachte empirische Material das Gegenteil beweist, und weiterhin, daß die Loslösung der Arbeiter vom Lande und die Bildung der städtischen Reservearmee nicht, wie Marx annahm, mit der Betriebs-, sondern ausschließlich mit der Besitzform der Landwirtschaft zusammenhängt (1084ff.) [1]. Nicht der Großbetrieb, sondern der Großbesitz setzt die Arbeiter frei; mehr noch: je „kapitalistischer“ der Großbetrieb ist, d. h. je mehr er sich der Maschinerie bedient, um so mehr Arbeiter gebraucht er beständig, berechnet auf die Flächeneinheit. Darum ist denn auch die Wanderung der Landproletarier aus den Bezirken des technisch völlig rückständigen Kleinpachtsystems, z. B. aus Irland, viel gewaltiger gewesen, als aus Bezirken des maschinell hoch entfalteten Großbetriebes.
Die theoretische Aufgabe ist hier wie überall (Marx hatte sie richtig gestellt, aber falsch beantwortet), die Abwanderung der Landproletarier aus dem ökonomischen Prinzip zu deduzieren. Das haben wir getan durch unser „Gesetz vom einseitig sinkenden Druck“. Es hat den folgenden Inhalt:
Die Gewerbe stehen unter dem Gesetz der steigenden, die Landwirtschaft unter dem der sinkenden Erträge. Das heißt, daß die Ergiebigkeit der Arbeit in den Gewerben schneller wächst als in der Urerzeugung. Und das wieder bedeutet, daß der wirtschaftliche Druck über den Städten dahin tendiert, schneller zu sinken als über dem
[1] Der immanente Gegenbeweis gegen Marx' Beweis und die empirischen Gegenbeweise gegen seine Behauptung liegen seit nunmehr 22 Jahren, seit dem Erscheinen meines Buches: „Das Grundgesetz der Marxschen Gesellschaftslehre“ der Antikritik der Marxisten vor. Früher hieß es stolz: „Marx hat bewiesen, widerlege ihn wer kann“. Jetzt hat man sich auf den „besseren Teil der Tapferkeit“ zurückgezogen, und jetzt genügt es den Jüngern offenbar, zu wissen und zu wiederholen, was der Meister gesagt hat. Damit ist es auf jener Seite zu Ende mit dem „wissenschaftlichen Sozialismus“; und ich darf mich, da ich mit Marxens Fragestellung und Methode arbeite, rühmen, ein weit besserer Marxist zu sein als seine heutigen Anhänger. Ich muß, so scheint es, darauf verzichten, die Herren noch auf die Mensur zu bekommen. Versucht habe ich es immer wieder. (Vgl. den Wechsel „offener Briefe“ zwischen Kautsky und mir im Vorwort zu meinem „Die soziale Frage und der Sozialismus“.) Sorel hat es ebenso vergeblich versucht. Siehe das Zitat bei Antonelli, a. a. O. S. 233.
[682]
Plattlande. Diese Tendenz kann sich aber in einem System der Konkurrenz nicht auswirken, weil nach dem ökonomischen Prinzip die Menschen immer von weniger begünstigten Zweigen der Erzeugung sich den mehr begünstigten zuwenden, „bis alle Vorteile wieder in einer Linie sind“, wie Adam Smith sagt, d. h. bis die Unterschiede des Druckes durch Gleichheit der Einkommen ausgeglichen sind; also in unserem Falle, bis der Druck über Stadt und Land wieder der gleiche ist.
Diese Ausgleichung durch Übertritt von Landkindern in städtische Gewerbe erfolgt dort, wo das Land in Bauernhänden ist, zweiseitig, durch Druckminderung über dem Lande und Druckmehrung über der Stadt. Gelockt durch die günstigeren Lebensverhältnisse, wandert eine mäßige Menge von Landkindern in die Stadt, vermehrt dort das Angebot städtischer Produkte und senkt deren Preise, erhöht also den Druck um ein geringes. Auf der anderen Seite bedarf die vermehrte Stadtbevölkerung vermehrter Zufuhr von Nahrungsmitteln. Sie können nur beschafft werden durch Ausdehnung und Intensivierung der Landwirtschaft, und das ist nur möglich bei Vermehrung der Selbstkosten des letzten „Grenzproduzenten“, dessen Produkt der Markt braucht und bezahlen muß. Infolgedessen steigt der Preis des Urprodukts oder, was das gleiche sagt, sinkt der Druck über der Landwirtschaft.
Diese Druckausgleichung ist also zweiseitig: nach Ablauf des Prozesses hat der Bauer höheren Geldpreis seines Erzeugnisses, während die Industrieerzeugnisse im Geldpreise billiger geworden sind, so daß der Wert der Nahrungsmittel, ausgedrückt in Gewerbserzeugnissen, von beiden Seiten her gestiegen, der der Gewerbserzeugnisse, ausgedrückt in Urerzeügnissen, von beiden Seiten her gesunken ist. Trotzdem befinden sich auch die Gewerbetreibenden, dank der stärker gestiegenen Ergiebigkeit (Produktivität) ihrer Arbeit, besser als zuvor und stehen jetzt unter genau dem gleichen Druck, d. h. haben das gleiche Geld- und Realeinkommen wie die Bauern. Außerdem ergibt die Deduktion, daß eine gewisse, mäßige Abwanderung (Zug von Landkindern in die Stadt) und Auswanderung (Besiedelung neuen Landes an der Peripherie des bisherigen Anbaukreises) in der reinen Ökonomie notwendig ist.
Wie verhält es sich nun mit alledem dort, wo das Land von Großgrundeigentum eingenommen ist ?
Auch hier muß die gleiche Tendenz bestehen, den Druck über den Gewerben zu vermindern, über dem Lande zu vermehren. Auch hier muß diese Verschiebung des Gleichgewichts durch Wanderung immer in statu nascendi ausgeglichen werden. Aber diese Ausgleichung kann hier nur durch einseitige Druckvermehrung über der Stadt ausgeglichen werden.
Alle Vorteile der steigenden gesellschaftlichen Kooperation fallen
[683]
hier nämlich nicht den Bebauern selbst, sondern dem Titulareigentümer des Bodens zu, der sie in Gestalt erhöhter Grundrente einstreicht. Die Löhne seiner Arbeiter steigen aus diesem Grunde nicht: sie können sogar aus anderen Gründen fallen, wenn die Rente steigt, und steigen, wenn sie sinkt. Abgesehen von solchen anderen Gründen, die uns hier nicht interessieren, stehen also die Landarbeiter unter konstantem Druck. Folglich ist eine viel stärkere Abwanderung in die Städte und Gewerbe nötig, um die Druckunterschiede auszugleichen ; folglich wächst die Stadtbevölkerung und ihr Bedürfnis nach vermehrter Nahrung viel stärker, folglich muß auch die „Auswanderung“ viel größer sein, und der Preis des Urprodukts viel stärker steigen.
Hier haben wir die Ursache der Reservearmee und daher nach allgemeinem, auch Marx' Urteil, des Kapitalismus. Aber damit ist unsere Aufgabe noch nicht erschöpft: wir haben noch aus unserem einzigen Prinzip das Wesen des Kapitalismus abzuleiten.
B. Das Wesen des Kapitalismus. (Der Kapitalprofit.)
Hier steht die Frage vor uns auf, wie sich im Getriebe der Konkurrenz, ohne Eingreifen neuer außerökonomischer Gewalt, der Kapitalprofit oder „Mehrwert“ bildet. An diesem Problem ist die Ökonomik als Wissenschaft erwachsen: aber es ist heute noch heftig umstritten. Hier ist die einfache Lösung:
Nach dem ökonomischen Prinzip sucht jeder auf dem Markte seine Ware so teuer wie möglich zu verkaufen und die von ihm benötigte Ware so billig wie möglich einzukaufen. Das ist die „Konkurrenz“, die nichts anderes ist als die von der Seite der Einzelwirtschaft her gesehene Kooperation (249, 849).
Wo immer, wie in diesem Falle, Kräfte antagonistisch gegeneinanderspielen, tendieren sie dahin, sich in einen Zustand des Gleichgewichts einzustellen, den man als „Statik“ bezeichnet. Die Statik der Marktwirtschaft läßt sich a priori durch Überlegung als dasjenige Verhältnis aller Preise aller Waren zueinander bestimmen, wo „alle Vorteile auf einer Linie“, d. h. alle Einkommen aller „Produzenten“ [1] soweit ausgeglichen sind, wie die Konkurrenz wirken kann.
Es bestehen nämlich zwei, und nur zwei, Hemmungen der Tendenz der Konkurrenz zum vollen Ausgleich aller Einkommen : die erste ist die Qualifikation. Keine Konkurrenz kann verhindern, daß überlegene Körper- oder Geisteskraft entweder in gleicher Zeit mehr Produkte der gleichen Art oder Produkte höherer Qualität, d. h. größerer Selten-
[1] Das sind alle Wirtschaftspersonen, die Waren zum Markte bringen. Waren sind Güter oder Dienste oder sog. „Rechte und Verhältnisse“ und deren Nutzungen.
[684]
heit und größeren Wertes und Preises zu Markte bringt. Wenn zwei Arbeiter von ungleicher Kraft im Akkord tätig sind, wird der Stärkere mehr schaffen und verdienen. Und weil nach den Leistungen eines berühmten Arztes oder Anwalts oder Künstlers größere Nachfrage ist als nach denen unberühmter Fachgenossen, so werden sie öfter beansprucht werden und für die Einzelleistung mehr erhalten und daher im Jahre ein größeres Einkommen beziehen.
Auf die notwendig — denn in jeder Gesellschaft finden sich natürlich Menschen von verschiedener Kraft des Körpers, Geistes und Willens — aus der Verschiedenheit der Qualifikation folgenden Unterschiede des Einkommens und des daraus gebildeten Vermögens stützt, wie wir wissen, die Lehre von der ursprünglichen Akkumulation auf. Wir haben oben gezeigt, daß sie unhaltbar ist, weil die Differenzierung erst dann eintreten könnte, wenn „alle Hufen, sich gegenseitig berührend, das ganze Land bedecken würden“. Die Erklärung der heutigen Klassenscheidung und Vermögensordnung aus der Verschiedenheit der Qualifikation ist also mißglückt. Übrigens bliebe selbst dann, wenn man sich auf den Boden dieser Lehre stellt, noch immer eine Hilfserklärung dafür erforderlich, wie aus der, als derart entstanden angenommenen, Verteilung des Eigentums die der Güter hervorgeht.
Eine bürgerlich-apologetische Lehre, die sich keine Anhängerschaft hat gewinnen können, hat den Mut, allen Kapitalprofit aus der Qualifikation der heutigen Kapitalisten abzuleiten: eine Übertragung der historischen „Heldenverehrung“ auf das Gebiet der Ökonomik. Wie Simson mit des Esels Kinnbacken Zehntausende von Philistern schlug, so (so wird mit demselben Werkzeug jetzt von den Philistern erklärt) soll auch eines Unternehmers Arbeit zehntausendmal soviel Wert schaffen und haben wie die eines einfachen Arbeiters. Jeder Blick auf die Dividende von Aktiengesellschaften, an deren Produktion die Aktionäre nicht im geringsten beteiligt sind, oder auf das Rieseneinkommen eines Milliardärbabys widerlegt diese Fehlvorstellung.
Dennoch enthält sie ein Gran Wahrheit. In dem Einkommen eines kapitalistischen Unternehmers mischen sich drei verschiedene Bestandteile, die theoretisch auseinandergehalten werden müssen. Erstens der sog. „Unternehmerlohn“: das Entgelt der durch Ausbildung erworbenen Qualifikation als Kaufmann, Techniker usw. Zweitens der von uns sogenannte „Pionierlohn“: das Entgelt besonderer angeborener Qualifikation, die Belohnung namentlich für organisatorische, kommerzielle und technische Verbesserungen des Betriebes, die er zuerst einführt, und von denen er so lange höheres Einkommen bezieht, bis die Konkurrenz nachgegriffen und ihm diese Vorteile wieder abgejagt hat. Der dritte Bestandteil ist der reine Kapitalprofit, der im Verhältnis nicht zur Leistung, sondern zum Eigenkapital eingeht. Nur von diesem
[685]
ist im folgenden die Rede. Die beiden anderen Bestandteile des Unternehmereinkommens sind Wirkungen der Qualifikation, wobei freilich erwogen werden muß, daß, unter den Bedingungen der heutigen Klassenordnung, im allgemeinen nur die Angehörigen der besitzenden Oberklasse imstande sind, sich die erworbene Qualifikation zu beschaffen und die angeborene zur Ausbildung, Anerkennung und Wirkung zu bringen.
Um zusammenzufassen, so würden in einer Gesellschaft, in der kein anderes Hemmnis der Konkurrenz bestände, als die Qualifikation, alle Einkommen aller Produzenten nur im Maße der Qualifikationsdifferenzen verschieden sein. Wir wollen diesen Gleichgewichtszustand als den Zustand der rationellen Gleichheit bezeichnen. Rationell, weil er offenbar derjenige Zustand ist, den die praktische Vernunft als den besten und gerechtesten anerkennen muß. Sehr groß können die hier vorkommenden Unterschiede des Einkommens nach dem, was wir oben über die Verschiedenheiten der Begabung feststellen konnten, nicht sein, zumal, wenn man beherzigt, daß in einer Gesellschaft, wie wir sie hier voraussetzen, die Möglichkeit, zu anerzogener Qualifikation zu kommen und angeborene auszubilden und zur Geltung zu bringen, allen, und nicht mehr bloß den Kindern der Oberklasse gegeben wäre. Die relative Seltenheit und der Preis solcher Qualifikationen wäre also hier viel geringer als in der kapitalistischen Ordnung.
Dieser Zustand der rationellen Gleichheit wäre erstens gerecht: denn, wie die bürgerliche Theorie ja selbst mit so großer Emphase erklärt, es ist nur gerecht, daß jedermann so viel Wert aus dem Markte nehme, wie er an Gütern oder Leistungen hineingetan hat. Und in der Tat hat bisher wohl kaum jemand einem genialen Arzte oder Künstler sein höheres Einkommen mißgönnt.
Dieser Zustand wäre zweitens ebenso offenbar der der Gesellschaft nützlichste. Denn es folgt aus unserem Prinzip, und wird durch die Geschichte aller kommunistischen Versuche bestätigt, daß der durchschnittliche Mensch nur dann mit voller Kraft arbeitet, wenn ihm ein entsprechendes Entgelt in Aussicht steht. Eine solche Gesellschaft würde also den höchsten, in ihr nach Lage der Technik überhaupt erreichbaren Reichtum und zugleich die gerechteste Verteilung besitzen.
Da unsere Gesellschaft von diesem schönen Ideal so weit wie möglich entfernt ist, muß das an dem zweiten Hemmnis der Konkurrenz liegen. Dieses Hemmnis ist das Monopol.
Wenn wir mit den Klassikern die bewegende Kraft der Gesellschaft, in der nichts anderes als die Qualifikation die Tendenz zur vollen Gleichheit der Einkommen hindert, als die „freie Konkurrenz“ bezeichnen, so sind diese und das Monopol disjunktive, einander ausschließende Begriffe. Wo freie Konkurrenz besteht, gibt es per definitionem kein Monopol, und wo ein Monopol besteht, gibt
[686]
es per definitionem keine freie Konkurrenz. Diese ist, nach Adolf Wagners glücklicher Formel, überall dort gegeben, wo jeder, der sich an einer Produktion beteiligen will, es auch kann und darf. Wenn er es nicht kann, ist ein natürliches, wenn er es nicht darf, ein rechtliches Monopol die hemmende Ursache.
Die Ursache der heutigen Verteilung der Güter könnte also entweder ein natürliches oder ein rechtliches Monopol sein.
Es gibt in jeder realen Gesellschaft gewisse „natürliche“ Monopole: Weine, die aus besonders beliebten Lagen stammen, Kunstwerke verstorbener Meister usw. Es bedarf keines Beweises, daß die Verteilung im großen, die wir aufzuklären haben, von den auf solchem Besitz beruhenden Glücksfällen Einzelner nicht abhängt.
Im Banne des Gesetzes der ursprünglichen Akkumulation haben Viele, voran kein Geringerer als Adam Smith, den Grund und Boden für ein natürliches Monopolgut angesehen. Vor der Vollbesetzung des Bodens, so erklärte er ausdrücklich, muß jeder Arbeiter den vollen Ertrag seiner Arbeit erhalten ; nach ihr werden Boden und, sekundär, Kapital, zu Monopolen und erpressen ihren Monopolgewinn, Grundrente und Profit, „so hoch er irgend erpreßt werden kann“. Aber Smith war im Irrtum: der Boden ist kein natürliches Monopol: das wäre er nur, wenn seine Menge im Verhältnis zum Bedarf nicht ausreichte; wir wissen aber, daß diese Grundvoraussetzung des Pseudogesetzes von der ursprünglichen Akkumulation falsch ist (oben, S. 223ff.).
Somit scheidet auch das natürliche Monopol aus unserer Untersuchung aus. Die Ursache der kapitalistischen Verteilung kann nur in einem Rechtsmonopol gesucht werden. Dieses gilt es aufzufinden.
Wir haben nach den soeben festgestellten Ergebnissen anzunehmen, daß dieses Rechtsmonopol irgendwie mit dem großen Grundeigentum zusammenhängen muß. Und das ist in der Tat der Fall.
Wo ein so großer Teil des Bodens in der Rechtsform des Großgrundeigentums angeeignet ist, daß eine bedeutende Anzahl der im Bezirke lebenden Menschen kein Grundeigentum erwerben können und daher darauf angewiesen sind, als Landarbeiter im Dienste der Bodenbesitzer ihr Brot zu suchen; wo, mit anderen Worten die Bodensperre besteht (denn vereinzeltes Großgrundeigen ist selbstverständlich harmlos), da stehen die Großbesitzer den Nichtbesitzenden in der Stellung von Monopolisten gegenüber. Denn das Austauschbedürfnis ist auf die Dauer oben viel geringer, als unten, und eine solche Situation konstituiert ein Monopolverhältnis.
Wo immer unter einem Monopolverhältnis getauscht wird, erhält der Monopolist für sein Tauschgut mehr, und der Kontrahent weniger, als bei voller freier Konkurrenz der Fall wäre. Das heißt, daß der
[687]
Monopolist einen „Mehrwert“ einstreicht, der Kontrahent einen Minderwert erhält.
Das gilt für die beiden Arten der Monopole, die man hier aus Zweckmäßigkeitsgründen unterscheidet. Bei den sog. „Verkaufsmonopolen“, die man fast immer allein ins Auge faßt, bekommt der Verkäufer für seine Ware mehr Geld, als sie bei voller freier Konkurrenz wert wäre; und bei den „Einkaufsmonopolen“ bekommt der Monopolist für sein Geld mehr Ware, als er bei voller freier Konkurrenz erhalten würde. Und zwar ganz gleich, welche „Ware“ er einkauft, ob Güter (wie etwa der Fleischtrust auf Grund seines Eisenbahnmonopols das Vieh des westamerikanischen Farmers) oder Dienste.
Die Bodensperre in der Rechtsform des großen Grundeigentums konstituiert, indem sie eine Klasse von Menschen auf dem Lande schafft und erhält, die keinen eigenen Boden als Produktionsmittel besitzen und daher ihre Dienste verkaufen müssen, zwischen ihnen und den Großbesitzern von Boden ein Einkaufsmonopolverhältnis; damit ist der Profit des landwirtschaftlichen Kapitals auf das einfachste abgeleitet [1].
Bleibt noch der Profit des städtischen, des industriellen und kommerziellen Kapitals abzuleiten. Das ist jetzt sehr einfach: der einseitig sinkende Druck treibt eine große Anzahl besitzloser, der eigenen Produktionsmittel entbehrender Proletarier in die Städte. Hier können sie nur leben, wenn sie ihre Dienste an die Besitzer von Produktionsmitteln verkaufen; da auch ihnen der Austausch auf die Dauer viel dringlicher ist als diesen „Kapitalisten“, so besteht auch hier das Einkaufsmonopol, und der Mehrwert, der Kapitalprofit, muß sich bilden.
So einfach ist die Lösung des so viel umstrittenen Problems, wenn man, statt von der unhistorischen Prämisse der ursprünglichen Akkumulation, von der verbürgten Tatsache ausgeht, daß die Geschichte nicht nur gewesen ist, sondern in Gestalt der von ihr geschaffenen Institutionen auch fortwirkt. Alle anderen Theorien vom Mehrwert, nicht nur die in unzähligen Varianten ausgebildeten bürgerlichen, sondern auch die Marxsche, sind unhaltbar und vollkommen widerlegt (659—722). Und wären sie es selbst nicht, so ist doch die unsere so unendlich viel einfacher, daß sie schon aus denkökonomischen Gründen den Vorzug verdiente. „Simplex sigülum veri.“
Schließlich können wir auch den „Consensus Prudentium“ für uns anführen. Wir haben gezeigt, daß Smith den Mehrwert ungeschminkt als einen „Monopolgewinn“ bezeichnet hat. Wir können hinzufügen, daß es in der ganzen großen Literatur der Ökonomik kaum einen Theoretiker von einigem Range gegeben hat, der nicht gesehen hätte, daß irgendwie
[1] Wir betonen sehr nachdrücklich: der Profit, nicht etwa die Grundrente. Die steht auf einem ganz anderen Blatt und interessiert uns in diesem Zusammenhang nicht.
[688]
im Grundeigentum die Ursache der sozialen Not gesucht werden muß. Wir nennen von den bürgerlich Eingestellten Ricardo, James und John Stuart Mill, Wallace, Gossen, Walras, Henry George und könnten die Liste fast endlos verlängern, namentlich wenn wir die Gegner des städtischen Grundeigentums mit nennen wollten. Wir wollen uns daran genügen lassen, die Äußerung eines Mannes anzuführen, der zu seiner Zeit das erklärte Haupt der liberalen Parteischule war, John Stuart Mills, eines Liberalen freilich, der zu tiefdenkend und zu großherzig war, als daß er sich zum bloßen Apologeten des Klassenrechtes erniedert hätte, und der, durch Vermittlung von Comte, schon unter dem Einfluß St. Simons stand.
„Die sozialen Einrichtungen des heutigen Europa nahmen ihren Anfang von einer Eigentumsverteilung, die nicht das Ergebnis einer gerechten Teilung oder der Aneignung durch Erwerbstätigkeit, sondern von Eroberung und Gewalttätigkeit war. . . . Die Gesetze in betreff des Eigentums haben sich noch keineswegs den Prinzipien angepaßt, auf denen die Rechtfertigung des Privateigentums beruht. Sie haben ein Eigentum an Dingen festgestellt, die nie Eigentum hätten werden sollen, und ein unbedingtes Eigentum da, wo nur ein bedingtes Eigentum stattfinden sollte. Die Gesetze haben die Wagschale zwischen den verschiedenen Klassen nicht nach Recht und Billigkeit gehalten, sondern haben Einigen Hindernisse in den Weg gelegt, um Anderen Vorteile zu gewähren; sie haben absichtlich Ungleichheiten begünstigt und verhindert, daß alle beim Wettlauf gleichmäßig gestellt sind“. Wenn das nicht geschehen wäre, so würde „sich erwiesen haben, daß das Prinzip des Privateigentums in keinem notwendigen Zusammenhang steht mit den physischen und moralischen Leiden, welche fast sämtliche sozialistischen Systeme als davon untrennbar voraussetzen“ [1].
Das sind bürgerliche Stimmen [2]. Was aber die Sozialisten angeht, so haben sie von jeher das Grund- und Kapitaleigentum als „Monopole“ bezeichnet : noch im Erfurter Programm fand sich in den ersten beiden Absätzen der Ausdruck nicht weniger als dreimal. Um auch hier nur den größten zu nennen, so stellen wir ohne weiteren Kommentar zwei Sätze von Karl Marx zusammen:
„In der heutigen Gesellschaft sind die Arbeitsmittel Monopol der
[1] Grundsätze der pol. Ökon., S. 164/5.
[2] Sogar Bastiat unterscheidet klar zwischen „Production“ und „Spoliation“ (wie John Rae zwischen production und acquisition) und nennt als Hauptformen der Spoliation: den Krieg, die Sklaverei, die Theokratie und das Monopol (Sophismes économiques, Physiologie de la Spoliation. Oeuvres choisies, éd. Guillaume, Paris 1863 Bd. I, S. 127ff.).
[689]
Grundeigentümer (das Monopol des Grundeigentums ist sogar die Basis des Kapitalmonopols) und der Kapitalisten“ [1].
„Damit die Preise, wozu Waren sich gegenseitig austauschen, ihren Werten annähernd entsprechen, ist nichts nötig, als daß . . . kein natürliches oder künstliches Monopol eine der kontrahierenden Seiten befähige, über den Wert zu verkaufen oder sie zwinge, unter ihm loszuschlagen“ [2].
Und dazu einen Satz von Karl Kautsky, der sich ausdrücklich als reine Erläuterung eines Marxschen Satzes gibt:
„Wo noch freies Land im Überfluß vorhanden ist, und der Zugang dazu allen offen steht, hören Geld und andere Produktionsmittel auf, Kapital zu sein“ [3].
Diese drei Sätze enthalten, bis auf das Gesetz vom einseitig sinkenden Druck, unsere gesamte Theorie von Ursache und Wesen des Kapitalismus. Der Leser fängt an zu verstehen, warum die Marxisten sich von der Debatte mit mir hartnäckig drücken!
Hiermit ist die uns gestellte Aufgabe völlig gelöst. Und damit ist •der letzte und vollkommenste Beweis gegen die Irrlehre von der ursprünglichen Akkumulation erbracht. Nicht aus einem Anfangszustande der Gleichheit und Freiheit hat sich rein durch die inneren Kräfte der Konkurrenz der heutige Zustand der Klassenscheidung entwickelt, sondern die Verteilung der Produktionsmittel, d. h. des Eigentums, ist durch außerökonomische Kräfte der Gewalt und Eroberung geschehen, und aus ihr muß kraft der Logik des ökonomischen Prinzips die Verteilung der Arbeit und der Güter folgen, wie wir sie um uns herum beobachten.
Das aber läßt sich in eine Formel zusammenfassen, aus der die ganze Haltlosigkeit des von uns bekämpften Pseudogesetzes sich mit leuchtendster Klarheit ergibt:
Es schiebt der freien Konkurrenz die Schuld an der heutigen Lage zu. Nun aber besteht per definitionem, wie wir fanden, freie Konkurrenz nur dort, wo kein Monopol besteht. Und da unsere Analyse ergeben hat, daß die moderne Gesellschaft geradezu als ein einziges Monopolverhältnis von ungeheuerster Größe und Wirksamkeit aufgefaßt werden muß, so ergibt sich der zwingende Schluß:
Es hat in ihr niemals freie Konkurrenz gegeben!
Also kann die freie Konkurrenz auch nicht an all den schweren gesellschaftlichen Übeln schuld sein, die man ihr seit Platon in die Schuhe schiebt; also ist das Gesetz der ursprünglichen Akkumulation auch durch den Immanenzbeweis widerlegt ; also ist es nicht wahr, daß
[1] Kritik des sozialdemokratischen Parteiprogramms, Neue Zeit, IX. I, S. 561 ff.
[2] Das Kapital, III. 1, S. 156.
[3] Karl Marx' ökonomische Lehren, 14. Aufl., Stuttgart 1912, S. 265.
[690]
die Menschheit nur zwischen den beiden Übeln zu wählen hat: der Freiheit, die die Gleichheit, oder der Gleichheit, die die Freiheit zerstören muß; also ist nicht „ein Narr oder Charlatan“, wer Gleichheit und Freiheit zusammen verspricht, wie Goethe sagte; also besteht dennoch jene „List der Idee“, die von Mandeville an bis auf Hegel den Optimismus unserer klassischen Idealisten begründete [1] : gerade durch die Freiheit und nur durch die Freiheit kann die Menschheit zu jenem Zustande der „rationellen Gleichheit“ gelangen, den wir im Umriß schon dargestellt haben und sofort noch weiter ausführen werden.
Jetzt verstehen wir auch besser, warum die Konkurrenz in dieser Gesellschaft ihre Tendenz zur Ausgleichung aller Einkommen auf das Niveau der Qualifikationsdifferenzen nicht durchzusetzen vermag. Sie leistet es innerhalb der Unterklasse: Ausgleichung der Löhne, und innerhalb der Oberklasse: Ausgleichung der Profite nach der Größe der funktionierenden Kapitale; aber sie kann es nicht leisten zwischen oben und unten, über die Barre des riesenhaften Klassenmonopols hinweg, weil eben zwischen oben und unten keine freie Konkurrenz besteht.
Wie überall, ergibt sich auch hier aus der vollständigen Diagnose, und das heißt : der Zurückführung sämtlicher Symptome auf eine einzige Ursache, der Heilplan ohne weiteres.
Der Unterklasse ist der Weg und das Ziel ihres Klassenkampfes unzweideutig bestimmt.
Ob die europäische Gesellschaft die Einsicht und die Kraft haben wird, den vorgeschriebenen Weg nun auch wirklich noch rechtzeitig zu beschreiten und bis zu Ende zu gehen, ist nicht mehr Sache des theoretischen Diagnostikers, sondern des praktischen Politikers. Geschieht es nicht, so wird das Schicksal der Antike auch das der europäischen Moderne sein: der Völkertod. Und auch hier werden neue Völker auf neuem Boden, von jenem tödlichen Gift nicht befallen, den nächsten Schritt auf der Leidensbahn der Menschheit tun müssen, der die alte Erbsünde ausrottet und der Gesellschaft die Erlösung bringt. Vielleicht wird Rußland, vielleicht Neuseeland dieses Land der Verheißung und Erfüllung sein.
2. Die Tatsachen. ↩
Die rein theoretische Aufgabe ist vollkommen gelöst : die Gesetze sind abgeleitet, aus denen der Dissensus der kapitalistischen Wirtschaft sich mit verhängnisvoller Konsequenz ergeben muß. In diesem Abschnitt wollen wir die Theorie mit einigen Tatsachen konfrontieren, um erstens die ganze ungeheure Größe des Unheils darzulegen, und
[1] Unsere „Wege zur Gemeinschaft“, S. 32.
[691]
um zweitens eben diese Tatsachen, die von der bisherigen sozialistischen Kritik fast regelmäßig in einen völlig falschen Zusammenhang gestellt worden sind, in ihren wahren Zusammenhang zu ordnen. Selbstverständlich kann es sich hier nur um eine flüchtigste Skizze handeln : diese Dinge gehören zum Teil in die theoretische Ökonomik, wo wir sie in gebotener Ausführlichkeit abgehandelt haben, zum Teil in die politische und Wirtschaftsgeschichte: sie werden in dem geschichtlichen Teile dieses Systems zu ihrem Rechte kommen [1].
a) Der agrarische Kapitalismus.
Das patriarchalische Großgrundeigentum ist verhältnismäßig harmlos, etwa wie wir die patriarchalische Sklaverei fanden. Solange noch keine warenmäßige Produktion von landwirtschaftlichen Erzeugnissen für den Markt stattfindet, ist der Grundherr auf die Treue und Wehrkraft seiner Hintersassen angewiesen und hat daher alle Ursache, sie sehr pfleglich zu behandeln. Er hat mehr die Stellung eines Fürsten als die eines privatwirtschaftlichen Subjekts, und so nähert sich das Großgrundeigentum mehr oder weniger der „Grundherrschaft“, die sich vom Großgrundeigentum entscheidend dadurch unterscheidet, daß in ihr die Eigentümer, und nicht die Bearbeiter, auf ein Fixum gesetzt sind, so daß der ganze Zuwachs der volkswirtschaftlichen Produktivität nicht dem Eigentümer, sondern den Bearbeitern zufließt [2]. Infolgedessen besteht hier eine Gesellschaftswirtschaft mit beiderseitig, nicht mit einseitig sinkendem Druck, und industrieller Kapitalismus kann hier nicht aufkommen.
Im Augenblicke aber, wo die privatwirtschaftlich-kapitalistischen Interessen den Ausschlag geben, wandeln sich die Psychologie und das Verhalten des Eigentümers mit einem Schlage. „Aus dem Ritter wird der Rittergutsbesitzer“. Und nicht nur in Europa. Wir bringen aus der allerneuesten Geschichte ein schlagendes Beispiel aus einem, von Europa nach Klima, Betriebsrichtung und Rasse so verschiedenen, Lande wie Indien: „Schon 1869 hat ein gut beobachtender Offizier diese Wandlung angemerkt. Es hat in der Richtung unserer Regierung gelegen, so schreibt er, die Unsicherheit der Landpächter stark zu vermehren: erstens hat die Landbevölkerung zugenommen, so daß der Wettbewerb sich verschärft hat, und zweitens hat der Zamindar nicht mehr die Gelegenheit, seine Hintersassen zu den Waffen zu rufen; er betritt den Arbeitsmarkt ungehindert durch
[1] Zum Teil, für Deutschland, ist diese geschichtliche Aufgabe im zweiten Teile unseres „Großgrundeigentum und soziale Frage“ bereits behandelt worden.
[2] Großgrundeigentum und soziale Frage, S. 280/1.
[692]
den Nebengedanken, ob der Mann ebensogut im Hauptquartier oder im Gefecht zu brauchen ist, wie hinter dem Pfluge“ [1].
Diese ökonomisch-psychologische Umwandlung und Umwertung hat sich von allen Ländern des europäischen Kreises zuerst in England vollzogen.
Hier hat die starke Differenzierung des Grundeigentums bereits mit der angelsächsischen Eroberung eingesetzt, da selbstverständlich — es ist der typische Verlauf, wie wir ihn oben dargestellt haben — „die Häuptlinge, deren Zahl nicht gering war, mit größeren Landstücken ausgerüstet wurden, auf denen sie Bauern ansetzten“ [2], und zwar selbstverständlich Unfreie, mindestens Zinsverpflichtete. „Das Ende der angelsächsischen Periode zeigt uns dann schon die volle Ausbildung der Grundherrschaft“ (12). Die regelmäßige Marktproduktion begann hier viel früher als auf dem Kontinent (44). Seit dem 13. Jahrhundert wandelt sich die wesentlich auf Bedarfsdeckung gerichtete, vorwiegend naturalwirtschaftliche Grundherrschaft zur kapitalistischen Unternehmung (56). Die Möglichkeit dazu gab die oben von uns geschilderte vorwiegend „seestaatliche“ Beschaffenheit der Gesellschaft, die Entwicklung der Städte, der Geldwirtschaft und des Seetransports (57). Das Land wird zur Ware (58), auch Kapitalisten können Großgrund- eigen erwerben (59). Die Leibeigenschaft verschwindet als nutzlos, aber dafür wird das Land in immer größerem Umfange von den Macht- habern, dem Adel und der Stadtoligarchie, die im Parlament entscheiden, (399) akkapariert und gegen die Besiedlung durch die Unterklasse gesperrt. Im 15. Jahrhundert sucht man die Vermehrung der Grundrente durch Vergrößerung der Pachten zu erreichen und entsetzt Bauern und Kleinpächter. „Klagen vom Ende des Jahrhunderts zeigen uns, daß schon damals sozialpolitische Erwägungen hinter wirtschaftlichen Rentabilitätsberechnungen durchaus zurücktreten mußten“ (449). Die Träger dieser Bewegung sind vor allem die Männer der nuova gente, die die Güter zu hohem Preise erworben haben und „ihre in Handel und Gewerbe erworbenen Anschauungen nun aufs Land übertragen“ (449). „Am Ende des 15. Jahrhunderts kann bereits kein Zweifel mehr an der vollkommen veränderten Struktur der englischen Landwirtschaft sein; 1489 ergeht das erste Gesetz gegen die Einhegungen, die das äußere Zdchen der kommerzialisierten Landwirtschaft darstellen“ (450). Durch diese Einhegungen wird die Sperrung des ganzen Bodens, die schon durch das soeben dargestellte Bauernlegen weit vorbereitet war, erst vollendet. An die Stelle der
[1] Morison, Economic Transition in India, S. 59/60. Vgl. oben (S. 558) die Stelle aus Sismondi, Etudes I, S. 215 über Schottland.
[2] Brodnitz, Engl. Wirtsch.-Gesch. S. 31. Auch die folgenden Ziffern in () aus diesem Werke.
[693]
gelegten Bauern treten Schafe (450), und so wird England das schreckliche Land, „wo die Schafe die Menschen fressen“ (Morus).
Die Folge ist, streng nach der Theorie, eine maßlose Abwanderung, eine „Landflucht“. „Die Hörigen ergreifen immer massenhafter die Flucht, um sich in den Städten emporzuarbeiten“ (83). Aber hier spürt man sofort, daß die Zuwanderung sich nicht mehr nach dem Gesetze des zweiseitig, sondern nach dem des einseitig sinkenden Druckes vollzieht: „Der unvermögende Hörige fand seit dem 13. Jahrhundert keine freundliche Aufnahme mehr in den Städten, keine Neigung, ihn an den errungenen Privilegien teilnehmen zu lassen“ (113). So schichtet sich der vierte Stand der „freien Arbeiter“ unter den der städtischen Besitzer von Produktionsmitteln, und der Kapitalismus setzt auch hier ein: „Im großen und ganzen hatten die ersten Stadtbewohner doch wohl ziemlich gleichartige niedrige Vermögen und Einkommen die Erlangung größerer Kapitalien fällt zusammen mit einer Mobilisierung der ganzen Bevölkerung, mit einer starken Konzentrationsbewegung des ländlichen Bevölkerungsüberschusses in den Städten“ (113).
Diese ganze Entwicklung ist vollkommen unbestreitbar die unmittelbare Wirkung äußerer Gewalt. Um mit Marx zu sprechen, so ist „die Grundlage des ganzen Prozesses die Expropriation der Volksmasse von Grund und Boden“ [1], zuerst mit den kriegerischen Mitteln der Eroberung, dann mit den friedlicheren Mitteln der Klassengesetzgebung und -Verwaltung. Wie die vereinten herrschenden Klassen im Parlament allein bestimmen, so haben sie auch die „Selbstverwaltung“ völlig in ihre Hände gebracht: „Die Feudalität hatte ganz richtig erkannt, daß es nicht einmal so sehr auf ihre Stellung im Parlament als auf ihre Vorherrschaft in der Verwaltung ankomme. Das hatte sie vollkommen erreicht. . . . Das Amt (als Friedensrichter) ist faktisch dem Adel vorbehalten, da seine unbesoldete Verwaltung als Ehrensache gilt ; seit 1439 ist gesetzlich Grundbesitz von 20 Pfund Jahresertrag Voraussetzung der Ernennung. Die Folge davon war eine tatsächliche Erblichkeit des Amtes, das immer unabhängiger wurde“.
Zweitens ergibt sich mit vollkommener Klarheit, daß in dieser ganzen Kette, streng nach der Deduktion, die landwirtschaftliche Entwicklung zum Kapitalismus führt, und die industrielle nur sehr langsam und zögernd folgt. „Es ist eine Eigentümlichkeit der englischen Entwicklung, daß sich in der Landwirtschaft die kapitalistischen Ideen viel schneller und eher durchsetzen konnten als in den Gewerben“ (450). Wir stimmen für England zu und haben nur zu bemängeln, daß dieses Verhalten hier als eine Ausnahme dargestellt wird. Es ist aber die Regel, wie wir schon 1898 in unserem „Großgrundeigentum“ für den Kon-
[1] Kapital I, S. 682, 686.
[694]
tinent nachgewiesen haben. Wir wollen damit Brodnitz keinen Vorwurf machen: wie sollte er das alte Buch kennen können, das mit vollkommenem Erfolge von der, im Kern ihrer Lehre angegriffenen und widerlegten, historischen Schule totgeschwiegen worden ist ? ! Überall geht der landwirtschaftliche Kapitalismus voran; der Großgutsbetrieb ist nicht nur, wie schon Knapp sah, der zeitlich erste, sondern auch der ursächlich erste Vertreter der Gattung.
Es ist der schwerste Fehler in dem großartigen System von Karl Marx, daß er, geblendet durch seine an Ricardo orientierte „industriezentrische“ Auffassung [1], diese Dinge nicht gesehen hat [2]: hätte er sie gesehen, so hätte er ohne weiteres auch erkennen müssen, daß es nicht die Betriebs- sondern die Besitzform ist, die die Abwanderung herbeiführt; denn von irgend welcher „kapitalistischen“ Ausstattung der damaligen englischen Landwirtschaft mit Maschinen kann natürlich keine Rede sein [3].
Was war die Folge ? Hören wir einen Zeitgenossen, Thomas Morus : „Damit also ein einziger Prasser, unersättlich und wie ein wahrer Fluch seines Landes, ein paar tausend Morgen zusammenhängenden Ackerlandes mit einem einzigen Zaun umgeben kann, werden Pächter von Haus und Hof vertrieben ; durch listige Ränke oder gewaltsame Unterdrückung macht man sie wehrlos oder bringt sie durch ermüdende Plackereien zum Verkauf. So oder so müssen die Unglücklichen auswandern. ... Ist das bißchen Erlös (der fahrenden Habe) auf der Wanderschaft verbraucht : was bleibt ihnen schließlich anderes übrig, als zu stehlen und sich hängen zu lassen (versteht sich von Rechts wegen), oder aber Landstreicher und Bettler zu werden, nur daß sie freilich auch dann als Vagabunden, die müßig umherstreichen, ins Gefängnis geworfen werden; und doch will kein Mensch ihre Dienste haben, sie mögen sich noch so eifrig anbieten“ [4].
Marx berichtet im Anschluß an diese Sätze des Morus, nach Hollings- hed, denn auch, daß allein unter der Regierung Heinrichs VIII. nicht weniger als 72000 große und kleine Diebe hingerichtet wurden [5]. Der Straßenraub nahm überhand, und dabei war England, wie wir oben mitgeteilt haben, vorher ein im Verhältnis zum Kontinent hervorragend verkehrssicheres Land gewesen: ein exquisit „seestaatlicher“ Zug!
Das waren die Folgen für die soziale Moral. Betrachten wir jetzt die für die Volkswirtschaft.
[1] S. S. III, S. 305.
[2] „Die kapitalistische Ära datiert erst vom 16. Jahrhundert“, (Kapital I, S. 68t).
[3] S. und B. Webb sagen ausdrücklich, „daß die frühesten dauernden Koalitionen der Arbeitnehmer in England ein volles Jahrhundert älter sind als das Fabriksystem“ (History of Trade-Unionism, S. 26 Anm.).
[4] Utopia, S. 18.
[5] Kapital I, S. 702 Anm.
[695]
Hasbach berichtet über die volkswirtschaftliche Rolle der derart ins kapitalistische umgewandelten Landwirtschaft: „Die in allen Teilen des Landes mit ungleichem Erfolge vor sich gehenden „inclosures“ {Einhegungen) lassen die nicht landwirtschaftliche Bevölkerung in den Städten und Industrieorten anschwellen, wodurch die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Erzeugnissen gesteigert wird. Diese aber haben in ihrer Gesamtheit nicht zugenommen, trotz vieler Bestrebungen, die Produktivität der Landwirtschaft zu heben. So steigen die Preise. Die steigenden Preise reizen zu neuen Einhegungen, und deren Wirkungen verändern und gestalten allmählich in den Köpfen der Theoretiker drei Lehren unserer Wissenschaft, die Lehre von der Grundrente, dem sinkenden Bodenertrage und der Bevölkerung“ [1].
„Die landwirtschaftlichen Erträge haben nicht zugenommen!“ Hasbach zeigt an anderer Stelle sogar, daß die Mehrerzeugung an Brotkorn weitaus überkompensiert worden ist durch die Mindererzeugung der spezifisch bäuerlichen Produkte: Fleisch, Milch, Obst usw.
Und die Einhegungen „lassen die Städte und Industrieorte anschwellen“ ! Man sieht, daß richtige Deduktion aus verifizierten Prämissen zu Ergebnissen führt, die von der Realität der Tatsachen bestätigt werden müssen.
Aber wir haben uns diese in die Städte gedrängten Massen etwas näher anzuschauen, als es im Rahmen der Hasbachschen Arbeit geschehen konnte. Es ist eine proletarische Einwanderung durchaus vermögensloser Elemente.
Das Elend dieser Schichten spottet jeder Beschreibung. Schon 1727 machte Jonathan Swift „mit scharfer beißender Ironie den Vorschlag, der Übervölkerung (Irlands) dadurch abzuhelfen, daß man geröstete Säuglinge in Geschmack bringe und als leckere Speise für die Reichen jährlich 100 000 irische Kinder der Schlachtbank überliefere“ [2]. John Gray schreibt: „Ein einsichtiger schottischer Landwirt, der Irland während der letzten Jahre besuchte, sagt, daß ein großer Teil der Landbevölkerung in einem Zustande des Elends lebt, den er sich niemals hätte vorstellen können, da er nicht gedacht hätte, daß menschliche Wesen in einem solchen Zustande der Armseligkeit leben könnten. Ihre Hütten enthielten kaum etwas, was man Einrichtung nennen könnte. In einigen Familien hätte es keine Bettücher gegeben, die Bauern zeigten einige Farrenkräuter und einen Haufen Stroh darüber, worauf sie in ihren Arbeitskleidern geschlafen hätten. Immer, wenn sie eine Kartoffelmahlzeit gehabt hätten, wären sie selig gewesen. Der größere Teil hatte nur Wasser getrunken“ [3].
[1] Die englischen Landarbeiter usw., S. 58. Im Orig. nichts gesperrt.
[2] Zit. nach Henry George, Fortschritt und Arbeit, S. 111.
[3] Vom menschlichen Glück, S. 88. Fast hundert Jahre vor Swift schreibt Sir William Petty (Political Arithmetic of Ireland, Economic Writings I, S. 156): „6 von 8 Irländern leben in wüster arger Verfassung, in Hütten ohne Rauchfang, Treppen, Tür und Fenster und nähren sich hauptsächlich von Milch und Kartoffeln“; vgl. S. 188, wo er den unglaublich niedrigen Markt bedarf dieser Elenden berechnet, der keinen Aufschwung der Gewerbe und des Handels zuläßt.
[696]
Und nun bedenke man den Druck dieser Hungerleider auf die Löhne: „Die Landbevölkerung des Südens und Westens verläßt ihre Wohnsitze zu bestimmten Jahreszeiten, um Beschäftigung zu suchen. Herr Nimmo, der Zivilingenieur, stellte, als er vom Ausschuß von 1819 befragt wurde, fest, daß viele hundert Bauern aus Kerry sich bereitwillig in der benachbarten Grafschaft Limerick als Arbeiter für vier Pence den Tag verdungen hätten; und ein Mitglied des Ausschusses hat angegeben, ihm wären viele Bauern von Kerry bekannt, die ihre Heimat auf der Suche nach Beschäftigung verließen, indem sie sich erboten, für den geringsten Unterhalt, den man erhalten könnte, zu arbeiten, zu dem geringsten Lohn, der möglich wäre, für zwei Pence den Tag, kurz für irgend etwas, für das man sich genügend Nahrung kaufen könnte, um während der folgenden vierundzwanzig Stunden am Leben zu bleiben. Die Bauern überarbeiten sich — wie bekannt ist — in einer ihrer Gesundheit schädlichen Weise, wenn sie Arbeit im Akkord annehmen“ (Gray, a. a. O. S. 90).
Wie diese Dinge sich in der industriezentrischen Auffassung der Theoretiker spiegelten, hat uns soeben Hasbach gesagt: sie sehen das „Bevölkerungsgesetz“ am Werke. Mac Culloch schreibt 1838 in der Note 4 zu Adam Smith „Völkerwohlstand“: „Die wunderbare Dichtigkeit der Bevölkerung in Irland ist die unmittelbare Ursache der abschreckenden Armut und gedrückten Lage der großen Masse des Volkes. Es ist nicht zu viel gesagt, daß es augenblicklich noch einmal so viel Menschen in Irland gibt, als es bei den vorhandenen Produktionsmitteln völlig beschäftigen oder einigermaßen bequem ernähren kann.“ Damals hatte die grüne Insel ungefähr acht Millionen Einwohner; George bemerkt bissig, sie hätte also nach Mac Culloch vier Millionen Menschen bequem ernähren können: als aber Swift jenen furchtbaren Vorschlag machte, 1727, hätte Irland erst zwei Millionen Einwohner und kein geringeres Elend gehabt. Irland hatte um 1820: 212 Einwohner auf die englische Quadratmeile von 2,60 qkm, also rund 80 Menschen pro qkm, eine bei der großen Fruchtbarkeit des gesegneten Landes geringe Bevölkerung.
Auf der Hauptinsel und dem Kontinent lagen die Dinge vielleicht nicht ganz so arg wie auf dem mit Waffengewalt unterworfenen und niedergehaltenen, von einer fanatisch andersgläubigen Herrenklasse ausgebeuteten Irland. Aber sie lagen noch schlimm genug ! Von Frankreich heißt es: „Man kann nicht zweifeln, daß die Lage der französischen
[697]
Bauern vor der Revolution eine im höchsten Grade elende und verzweifelte war. Kam es auch nicht weiter vor, daß sie, wie unter der Regierung des glorreichen Ludwig, ausgesogen durch Kriegsfronden und Steuern, zum Eichelbrot ihre Zuflucht nehmen, ja, Gras fressen mußten, so haben wir doch das Zeugnis Arthur Youngs, des ersten Landwirts des damaligen Europa, der Frankreich kurz vor dem Ausbruch der Revolution drei Jahre lang bereiste, und der eine „an Irlands Elend mahnende Armut seiner ländlichen Bevölkerung“ konstatiert. Auch sein Landsmann Wraxel, der Frankreich 1776 bereiste, spricht von dem äußersten Elend der Bauern „in der Mitte eines Paradieses“, das ihn mit Mitleid, Erstaunen und Zorn erfüllt habe. Young hielt dafür, daß ein Fünftel des pflugbaren Bodens brach und wüst liege. Nach einem anderen zeitgenössischen Berichterstatter (Doyen zit. bei Sugenheim) lagen im Lande Beaune mit seinem unvergleichlichen Getreideboden 1786 über zweihundert Höfe in Ruinen, und ganze Landstrecken wüst, weil die Bauern in der Voraussicht, „daß ihr Fleiß nur ihren habsüchtigen Grundherren zugute kommen und zu einer Steigerung ihrer Lasten führen werde“, die Muße vorzogen“ [1].
Alfred Nossig schränkt diese Angaben unter Berufung auf Young selbst und andere zeitgenössische Schriftsteller erheblich ein. Es sei nur in einzelnen französischen Landschaften so arg gewesen, „aber das Ungewöhnliche ist nicht selten, und es ist schrecklich“ [2]. Man durfte das erwarten: nur dort, wo in Frankreich die kapitalistische Landwirtschaft bereits eingedrungen war, konnte das Übel hohe Grade erreichen, und das war nur in einigen Gegenden der Fall. Z. B. fand Boisguillebert charakteristischerweise in der Nähe von Rouen die Bauernhütten in Ruinen, alle Felder, die nicht erster Qualität waren, unkultiviert. Wir wissen, daß die Normandie die erste vom Kapitalismus befallene Landschaft Frankreichs gewesen ist! Was den französischen Bauern aber in der Regel zerstört hat, ist der tief entartete Absolutismus seiner Hofgesellschaft mit seiner Steuerpolitik, noch nicht der Kapitalismus.
Dagegen hat in Spanien der Absolutismus im Bunde mit seinem Zwilling, dem agrarischen Kapitalismus, vor allem in Gestalt der Groß- Schafzucht, die die verderbliche Pest der „Mesta“ über das unglückliche Land brachte, Volkswirtschaft und Bevölkerung ruiniert. Das haben wir im Anschluß an Sugenheim und Leonhard an anderer Stelle ausführlich dargestellt [3].
Um noch das letzte der großen europäischen Länder zu nennen, Deutschland, so schreibt nach dem Bauernkriege Sebastian Münster, der Kosmograph: „Der vierte Stand ist der der Menschen, die
[1] Eisenhart, Gesch. d. Nat.-Ökonomie, S. 59.
[2] Das System des Sozialismus, S. 192/3.
[3] S. S. I, S. 1006ff.
[698]
auf dem Felde sitzen und in Dörfern, Höfen und Weilern, und werden genannt Bauern. . . . Diese führen ein gar schlecht Leben. Ihre Häuser sind schlechte Häuser, aus Kot (Lehm) und Holz gemacht und mit Stroh gedeckt. Ihre Speise ist trucken Brot, Haberbrei oder gekochte Erbsen und Linsen. Wasser und Molken ist fast ihr einziger Trank. Die Leute haben nimmer Ruh'. Früh und spat hangen sie der Arbeit an. Ihren Herren müssen sie oft durch das (ganze) Jahr dienen, das Feld bauen, säen, die Frucht abschneiden und in die Scheuer führen, Holz hauen und Gräben machen. Dies mühselig Volk der Bauern und Hirten ist ein sehr arbeitsam Volk, das jedermanns Fußhader (Fußdecke) ist und mit Fronen, Scharwerken, Zinsen, Gülten, Steuern und Zöllen hart beschwert und beladen ist“ [1]. So war es im Westen: im Osten, wo in den „Adelsrepubliken“ die Unfreiheit wieder aufgelebt war, war es, wie wir wissen, noch viel ärger.
Derart sah es überall in Europa aus, als der städtische Kapitalismus kaum seine ersten schwachen Schritte getan hatte. Und auch später, als er zur vollen Blüte gediehen war, war das Bestreben der agrarischen Bourgeoisie überall mit dem größten Erfolge darauf gerichtet, die Bodensperre vollkommen durchzuführen oder, wo sie bestand, aufrecht zu erhalten. Von den Steinschen Agrarreformen haben wir schon in einem anderen Zusammenhang gesprochen. Wir wissen, wie der große Gedanke durch die Nachfolger Steins verpfuscht und verdorben wurde. Jentsch schreibt darüber: „Für die Gesetze waren die Herren im Anfang, opponierten aber heftig dem weiteren Fortgang; sie bekämpften, vom Geiste Kants und Adam Smith' beseelt, die „schimpfliche Sklaverei“ der Erbuntertänigkeit, aber sie hielten es für selbstverständlich, daß der ganze Grund und Boden des Dorfes Eigentum des Grundherren sei, dessen Ermessen es anheimgestellt werden müsse, ob er das ganze Land für sich einziehen oder die Bauern als Zeitpächter darauf lassen, oder die Bauernhöfe in Kätnerstellen verschlagen wolle. Den Bauern die Freiheit, uns das Land, war die Losung“ [2]. Schon vorher hatte die gleiche Clique die Bemühungen Friedrichs II., auf neugewonnenem Bruchlande Bauern anzusetzen, durchkreuzt. „Man hätte auf den besiedelten Flächen mindestens die dreifache Anzahl Vollbauern ansetzen können, als tatsächlich Bauern zur Ansiedlung gekommen sind“ [3].
So wurde Ostelbien ein Land des Großgrundeigentums. In Frankreich hat die Revolution die Latifundienwirtschaft beseitigt: aber in Großbritannien hat sie eine ungeheuerliche Ausdehnung erreicht. Dank der bis in die Neuzeit fortgesetzten Politik der Einhegungen ist es dahin gekommen, daß die Hälfte des englischen Bodens 2000 Familien gehört ;
[1] Günther, Deutsche Kulturgeschichte, S. 58.
[2] Die Agrarkrise, S. 33.
[3] Neuhaus, Die friderizianische Kolonisation im Netze- und Warthebruch, S. 134.
[699]
ein Sechstel des Königreichs ist im Besitz von 92 Personen, und zwar gibt es 47 Besitzer von 20—40000 ha, 25 von 40—60000, 10 von über 60000, darunter 8 von über 80000 ha [1].
Noch viel großartiger war die Schamlosigkeit und die politische Kunst, mit der es der Oberklasse gelang, die schier unendlichen Ackerflächen der neuen Erdteile gegen die Siedlung kleiner Selbstwirte zu sperren. Wir haben an anderer Stelle [2] die Daten namentlich für Nordamerika und Australien, Neuseeland eingeschlossen, zusammengetragen. Hier eine kleine Nachlese über einige andere Kolonialländer:
Nach Prof. Münch [3], der sich der offiziellen Statistik des Landes (von 1916—19) bedient, waren in Argentinien die kleineren Güter bis zur Größe von 500 ha (!) im Gesamtareal von 25,8 Mill, ha in den Händen von 267000 Kleingrundbesitzern, dagegen die großen Güter von 500 ha aufwärts im Gesamtareal von 136,5 Mill, ha in den Händen von nur 39000 Großgrundbesitzern. „Die Kleingrundbesitzer sind also zwar siebenmal so stark wie die Großgrundbesitzer, aber diese verfügen über fast sechsmal so viel Land wie jene“. An eine Absicht der Regierung zur Schaffung eines tüchtigen Bauernstandes ist nicht zu denken. „Sitzen doch gerade die Familien der argentinischen Estancieros in der Regierung, und sie würden sich selbst aus ihrer beherrschenden Stellung verdrängen, wenn sie einen wohlhabenden, wurzelfesten Bauernstand großzögen“.
In Brasilien das gleiche Bild ! Kaiser Pedro hatte eine Kolonisation deutscher Bauern ins Werk gesetzt, die sehr gut glückte, obgleich sich unter den Ansiedlern angeblich eine Menge „zusammengefegter Leute“, auch Vagabunden und Zuchthäusler befanden. „Aber die Plantagenbesitzer sahen mit Mißvergnügen diese Schöpfung eines Kerns kleiner Grundbesitzer. Ihre Intriguen zwangen Don Pedro, der eben einen großenAufruf an die freien Arbeiter Europas vorbereitete, abzudanken.“ Damit war die große Unternehmung gescheitert [4]. Die wenigen Siedlungslustigen, die noch kamen, wurden in halbe Sklaven verwandelt, die niemals ihrer Schulden ledig werden konnten, so daß die preußische Regierung offiziell vor der Auswanderung in das Land warnte.
Gerade so hören wir aus Hawaii, daß sich das Interesse der großen Pflanzungseigentümer der Ansiedlung freier kleiner Landwirte entgegenstellt [5]. Und wieder auf die gleichen Schwierigkeiten stößt die zionistische Kolonisation in Palästina: „In den Händen der arabischen Groß-
[1] Nach Salvioli, Der Kapitalismus im Altertum, S. 80.
[2] S. S. III, s. 540—558.
[3] Die Verteilung des Grundbesitzes in Argentinien, Deutsche Allg. Ztg. süddeutsche Ausgabe, Jahrg. 63, Nr. 58 vom 4. II. 24.
[4] Tonnelat, L'expansion allemande hors d'Europe, Paris 1903.
[5] Aubert, Américains et Japonais.
[700]
grundbesitzer, Effendis, sind ungeheure Latifundien konzentriert Insgesamt befinden sich in der Hand von 120 Familien mehr als drei Millionen Dunam (etwa ein Zehntel ha). Die Familie Sursuk allein verfügt in verschiedenen Teilen des Landes über einen Besitz von ungefähr 230000 Dunam.“ Dabei handelt es sich um ein kleines Land, das nur etwa zwei Drittel der Fläche der Mark Brandenburg einnimmt! Ein volles Fünftel des anbaufähigen Bodens bleibt unter diesem System unbebaut [1].
Nach Edgar Granville [2] ist auch die armenische Frage keine Rassen-, sondern eine Klassenfrage. Es sind nicht die Kurden als solche, sondern nur die kurdischen Großgrundbesitzer, „wahre Feudalherren“, die die Armenier und auch viele Kurden als Leibeigene behandeln und ausbeuten ; von ihnen geht der Druck aus, der zu den Revolten und Metzeleien führen mußte.
Auch in Turkestan wird „die rasche Zunahme des Großgrundbesitzes, die heute z. B. aus ähnlichen Gründen wie in Turkestan auch in Teilen der Türkei immer weiter fortschreitet, zu einer großen allgemeinen Gefahr“ [3].
Es bleibt dabei, was wir (555) schrieben: „Das Bodenmonopol überspannt die ganze Welt des weißen Mannes und ist deshalb unentrinnbar. Und wenn heute ein neuer Erdteil aus dem Meere tauchte, flugs würde eine Flagge gehißt, und der Staat dieser Flagge lieferte, kraft seines Hoheitsrechtes, sich selbst, d. h. seiner Herrenklasse, das Land aus, um es zu sperren, ehe es noch für Kulturmenschen möglich sein würde, dort von ihrer Arbeit ein einigermaßen erträgliches Dasein zu führen. Das Monopol ist allgegenwärtig wie die Luft, ist allmächtiger als Dschinghis-Khan ; es ist der Götze Dschaggernaut, dessen schwerer Prunkwagen seit Jahrtausenden über Milliarden zuckender Menschenleiber zermalmend dahinfährt, Naben und Speichen von Blut und Gehirn überspritzt“.
Was das System für die Landeskultur bedeutet, haben wir immer wieder gehört: übermäßige Ausdehnung der brachen und wüsten Ländereien, und auf den bebauten Rückständigkeit der Landwirtschaft. Nach A. Schulz [4] betrug die mittlere Ernte auf dem Hektar im Mittel des Jahrzehntes 1899/1908 nur 15 Doppelzentner und weniger in den sechs östlichen Provinzen Preußens. Aber die kleinbäuerlichen Provinzen und Länder ernteten wesentlich mehr: Hessen-Nassau 17,2, Rheinland 18,3, Hessen und Bayern links des Rheins 19,08, Braunschweig 20,5 Doppelzentner. Gewiß ist die Bodengüte westlich der
[1] Jüdische Rundschau, 1925, S. 324.
[2] Le Tsarisme en Asie mineure, (Revue Politique Internationale, Mars-Avril 1917).
[3] Junge, a. a. O. S. 409. Vgl. S. 145, S. 153.
[4] Volksernährung und innere Kolonisation, Sozial. Monatshefte XV, 1.
[701]
Elbe bedeutend besser : dennoch sind die Unterschiede auffällig, namentlich, wenn man aus Keup und Mührer [1] weiß, daß die Produktivität guter Bauernstellen in den Ostprovinzen wesentlich größer ist als die guter Großbetriebe der gleichen Gegend und Bodengüte. Und so ist es auch bemerkenswert, daß nach den Veröffentlichungen des Internationalen Instituts in Rom, (berichtet in der „Times“ vom 27. Dezember 1910) die höchsten durchschnittlichen Weizenerträge in Ländern mit bäuerlicher Besitzverteilung erzielt worden sind: Dänemark 27,38 Doppelzentner je ha, Irland 23,60, Niederlande 22,04, Schweiz 21,93 Doppelzentner.
Aber wir wollen auf diese Zahlen kein Gewicht legen, weil sie verschiedene Deutung zulassen könnten. Was aber statistisch keinem Zweifel unterliegen kann, ist die Wirkung dieser Grundbesitzverteilung auf die körperliche und seelische Gesundheit der Hintersassen.
G. von Rohden schreibt: „Aus der großen Tabelle der Kriminalitätsgeographie in Deutschland während der Jahre 1883/1897 geht hervor, daß der Osten der preußischen Monarchie kriminell ganz erheblich mehr belastet ist als der Westen. Die Verbrechen nehmen von der russischen Grenze bis zur französischen Grenze fast stetig ab. Auf 10000 Strafmündige kommen in Preußen überhaupt 110,3 Verbrechen gegen Reichsgesetze, in der Provinz Ostpreußen aber 165,5 (im Bezirk Gumbinnen gar 180,5), Posen 159,7 (Bromberg 186,6) . . . aber in Schleswig-Holstein 75,0 Hessen-Nassau 88,1, Westfalen 76,0, Rheinland 79,0“. Von den außerpreußischen Staaten hatten Württemberg, Sachsen, Baden und Lübeck 90—92, Waldeck 44,1, und Schaumburg-Lippe 40,2. Selbstverständlich muß man auch hier die Verschiedenheit der wirtschaftlichen Ausstattung der Länder berücksichtigen, aber Rohden erklärt ausdrücklich, daß diese Erklärung nicht ausreicht : „Sind denn die westlichen Regierungsbezirke Koblenz (61,1), Aachen (69,8), Trier (72,8) wirtschaftlich so viel besser gestellt als z. B. die Bezirke Magdeburg (108,9), Potsdam (113,0) oder Oppeln (184,1) ? Ist etwa die Pfalz (162,4) oder Hamburg oder Bremen ärmer als Baden, Lübeck und Lippe? Die Hypothese, daß die Armut am Verbrechen schuld sei, versagt hier ganz“ [2].
Wenn wir von der Pfalz absehen, deren auffällig hohe Kriminalität einer eigenen Untersuchung bedürfte, zu der hier kein Raum ist, sind die Ziffern eindeutig. Selbstverständlich muß man überall von den großen Industriestädten abstrahieren, in denen der Anreiz zu Verbrechen
[1] Die volkswirtschaftliche Bedeutung von Groß- und Kleinbetrieb in der Landwirtschaft, Berlin 1913.
[2] Zeitschr. f. Soz.-Wissensch. VII (1904) S. 522!. „Von den sozialen Motiven des Verbrechens“.
[702]
besonders groß ist : aber die agrarischen Bezirke allein stufen sich ganz regelmäßig nach der Besitzverteilung ab; und es ist in diesem Zusammenhang nicht ohne Interesse, daran zu erinnern, daß in den genossenschaftlichen Kolonien, z. B. in Eden, die Kriminalität geradezu Null istl).
So viel über die seelisch-sittliche Gesundheit der Hintersassen des großen Grundeigentums. Was nun die körperliche Kraft und Gesundheit anlangt, so berufen sich die Vertreter der Institution gern auf die Wehrstatistik, die allerdings klar zeigt, daß der „Jungbrunnen“ der Volkskraft auf dem Lande sprudelt. So z. B. entnehmen wir der preußischen Statistik [2] die erschütternden Ziffern, die mehr als irgend etwas anderes — es sei denn die Ziffer der Kriminalität der Jugendlichen — den furchtbaren Raubbau anklagen, den der Kapitalismus in seiner industriellen Ausgestaltung mit unserer Volkskraft treibt :
In dieser Statistik wird das „Soll“ der verschiedenen Herkunftsorte an zu stellenden Rekruten, berechnet auf die erwachsene männliche Bevölkerung, gegenübergestellt dem „Ist“, d. h. den aus diesen Orten tatsächlich als volltauglich befundenen und eingestellten Soldaten und Unteroffizieren. Die Herkunftsorte sind in drei Kategorien gegliedert: unter 20000 Einwohner (das sind vor allem die Dörfer und Ackerstädte), 20—100000 (Mittelstädte), und über 100 000 (Großstädte).
Dabei ergibt sich im Durchschnitt des ganzen Staates, daß die erste Kategorie 111 % ihres Soll, die zweite 76, die dritte 51 % ihres Soll gestellt hat; und im einzelnen, daß die östlichen, vorwiegend agrarischen Bezirke, zum Teil hoch, über dem Durchschnitt stehen (ausgenommen nur Schlesien mit 109 und Brandenburg mit 104) ; Ostpreußen hat nicht weniger als 142, Pommern 136, Westpreußen 132. Dagegen stellt der Westen der Monarchie mit einziger Ausnahme Sachsens (138) beträchtlich unter seinem Soll, zwischen 90 und 101. Der Stadtkreis Berlin stellt ganze 37% seines Soll!
Die preußische Statistik hat aber einmal — ein einziges Mal — die Rekruten nicht nach ihren Herkunftsorten, sondern nach ihrer Beschäftigung und sozialen Stellung aufgenommen unter Berücksichtigung der Fragen, die sich jedem Kenner der Materie ohne weiteres stellen müssen. Sie hat gegliedert in drei Kategorien: selbständige und unselbständige Landwirte, selbständige und unselbständige Freiluftarbeiter, und selbständige und unselbständige Werkstättenarbeiter. Und dabei haben sich Ergebnisse herausgestellt, von denen die großen Kapitalisten des platten Landes nicht gerne sprechen hören.
Die selbständigen Landwirte, also die Grundbesitzer und Beamten, unter denen die Bauern statistisch so ungeheuer überwiegen, daß man die anderen Kontingente vernachlässigen darf, stelltenfast das Doppelte
[1] Unsere „Wege zur Gemeinschaft“, S. 500.
[2] Statist. Jahrbuch für den preußischen Staat, 1911, S. 468.
[703]
ihres Soll. Die „unselbständigen“ Landwirte, d. h. die Landproletarier, aber nur etwa drei Viertel ihres Soll. Die Meister der Freiluftgewerbe, also vor allem Maurer, Zimmerer usw. stellten fast so viel voll Wehrfähige wie die Bauern, ihre Arbeiter aber beträchtlich mehr als die Landarbeiter, etwa 106 %. Die Zahlen der Geschlossen-Raum-Arbeiter waren fürchterlich.
Die Zahlen bedürfen keines ausführlichen Kommentars. Der „Jungbrunnen“ sprudelt im Bauernstande, aber nicht im Landproletariat. Jener stellt fast genau 2 1/2 mal so viele voll wehrfähige Männer als dieses. Wenn man nun weiterhin bedenkt, daß der Bauer durchschnittlich fast dreimal so dicht auf gegebener Fläche sitzt wie der Großbesitzer mit seinen Arbeitern, dann zeigt sich klar, was die Bodenbesitzverteilung hygienisch und auch militärisch für Deutschland bedeutet! Sapienti sat!
b) Die Wanderung.
Wir haben das Gesetz vom einseitig sinkenden Druck entwickelt. Wir werden jetzt zeigen, daß die Tatsachen es vollkommen bestätigen:
Schon 1874 schrieb v. d. Goltz auf Grund eingehender statistischer Untersuchungen: „Mit dem Umfang des Großgrundbesitzes parallel und mit dem Umfang des bäuerlichen Besitzes in umgekehrter Richtung geht die Auswanderung“ [1]. Seither hat sich der Zusammenhang, der sich, wie Max Weber einmal sagte, mit einem „seltenen statistischen Eigensinn“ durchsetzt, als die Wirkung eines Gesetzes herausgestellt, das in allen kapitalistischen Staaten gleichmäßig wirkt: eben unseres Gesetzes vom einseitig sinkenden Druck. Wir haben es folgendermaßen formuliert: „Die Wanderbewegung aus verglichenen agrarischen Bezirken verhält sich wie das Quadrat des in ihnen enthaltenen Großgrundeigentums“ (910). (Damit soll aber nicht etwa eine exakte mathematische Beziehung behauptet, sondern nur der Sachverhalt einigermaßen quantitativ verdeutlicht werden.)
Wir greifen als Beleg zunächst die ungeheure Tatsachenmasse heraus, die die überseeische europäische Auswanderung nach den Vereinigten Staaten betrifft.
„Die Deutsche Einwanderung hat bekanntlich bis vor 20 Jahren, d. h. bis zum Beginn der Caprivischen Handelspolitik, gewaltige Menschenmassen über das Meer geschickt, so daß die Einwohner der Vereinigten Staaten, die selbst aus Deutschland stammten, oder deren Eltern in Deutschland geboren waren, im Jahre 1900: 7832601 Köpfe zählten, gegenüber 7047318 Personen englischer und irischer Geburt oder Elternschaft. Von 1821—1900 wanderten (zusammen mit Österreichern und Schweizern) 5200000 Deutsche nach Amerika gegenüber
[1] Die ländliche Arbeiterklasse und der preußische Staat, S. 143.
[704]
3000000 Engländern und 3900000 Irländern. Die größere Fruchtbarkeit der deutschen Ehe hat also den Anteil des deutschen Blutes an dem Aufbau der Gesamtnation der Vereinigten Staaten wesentlich vermehrt. Gegenüber der deutschen, englischen und irischen Einwanderung ist die aller anderen Völker im 19. Jahrhundert verschwindend gering. Über eine halbe Million Menschen haben außerdem nur die Schweden und Norweger abgegeben mit zusammen 1280000 und die Italiener mit 1058000 Köpfen. In weitem Abstände folgten dann Franzosen, Chinesen, Holländer, Belgier, Spanier, Portugiesen usw.“ [1].
Mit Ausnahme Norwegens, dessen Anteil hier nicht besonders ausgeworfen ist, sind alle Länder der starken Wanderung exquisite Großgrundbesitzländer.
Deutschland insbesondere hat sich durch diese Ausstoßung der Millionen seiner Kinder, von denen der weitaus größte Teil Landproletarier waren, nicht bloß die furchtbar schwere Agrarkrise der achtziger Jahre auf den Hals gezogen, die ausbrechen mußte, als die von jenen Wanderern neu unter den Pflug genommenen unendlichen Flächen ihre Riesenernten nach Europa sandten [2], sondern hat auch die unüberwindliche Großmacht mit aufgefüttert, die durch ihre Beteiligung am Weltkriege seine Niederlage herbeigeführt hat. Auch das gehört in das Kapitel von der militärischen Bedeutung des Großgrundeigentums !
Seit dem Schluß des 19. Jahrhunderts sind die deutsche und englisch-irische Einwanderung stark zurückgetreten, dank der Industrie, die für die überschüssigen Kinder der Großgrundbesitz-Bezirke in immer wachsender Zahl Arbeitsstellen erschloß; dafür sind andere Länder gleicher Bodenverfassung an die Stelle getreten, vor allem der slavische Osten und Südosten Europas und Italien. Die Zahl der Einwanderer aus diesen Ländern betrug im Jahrfünft 1900—1904 nicht weniger als 74,8 % der zudem noch an absoluter Zahl stark gewachsenen Einwanderung [3]. Sie ist bis zum Weltkriege in immer wachsender Flut eingeströmt, bis sie gesetzlich abgedämmt wurde.
Diese Einwanderung stellte nämlich für die Arbeiterschaft der Staaten eine scharfe, schwer empfundene Konkurrenz dar, zumal diese Elemente, namentlich in den letzten Jahren, aus Ländern kamen, in denen sie so wenig wie möglich für den Eintritt in die Gewerkschaften vorbereitet waren, und vor allem, weil sie in ihren Lebensansprüchen „mehr als bescheiden sind“ [4]. Zu einer Zeit, in der die Hauptstadt
[1] Ernst Schultze, Die Italiener in den Vereinigten Staaten, Ztsch. f. Soz. Wiss. IX (1906) S. 643.
[2] Vgl. Unsere Siedlungsgenossenschaft, S. 224ff.
[3] Ztsch. f. Soz.-Wiss. 1906 (IX) S. 193.
[4] Schultze, a. a. O. S. 645.
[705]
Italiens, Rom, 425000 Einwohner hatte, lebten allein in New York 450000 Italiener, 40% aller ihrer Konnationalen in den Vereinigten Staaten [1]; und man hörte früher dort oft sagen, daß in New York mehr Juden leben als in Jerusalem, mehr Litauer als in Wilna usw. Man bedenke, wie die Konkurrenz solcher massenhaft sich anbietender Elemente auf den Lohn der heimischen Arbeiterschaft drücken mußte, namentlich dieser „animals without souls“, wie die Slaven oft genannt wurden, die mit Begeisterung als fürstliche Löhne empfanden, was die Amerikaner Hungerlöhne nannten. Auf den gleichen Gründen beruht der Widerstand gegen die Einwanderung der Japaner in die Vereinigten Staaten und neuerdings gegen die der Hindu, namentlich der Sikhs, entlassener Soldaten der indischen Armee, in Kanada. „Ohne Murren ließen sie sich Herabsetzungen ihres Lohnes gefallen, bis sie heute nur die Hälfte des Verdienstes bekommen, der den ersten Ankömmlingen bezahlt worden war. Dem Arbeitermangel des Gebietes war durch ihre Ankunft abgeholfen, die Dividenden der Sägemühlen und Bergwerke, deren weiße Arbeiter in vielen Fällen fast sämtlich entlassen waren, um den billigen Sikhs Platz zu machen, gingen in die Höhe. . . . Die Arbeiter sahen ihre Löhne sinken und konnten ausrechnen, in wie viel Monaten ihre Plätze von den neuen Einwanderern eingenommen sein würden. Der Umsatz der Kaufleute sank, je mehr Hindus ankamen, da Reis und Fisch für deren geringe Bedürfnisse ausreichten, und das Haus einer weißen Familie genügte für die Behausung von zwei Dutzend Asiaten“ [2]. An Lohnbewegungen sich zu beteiligen, die die Japaner und Chinesen ins Werk setzten, haben die Sikhs abgelehnt.
Derart wirkt schon die Auswanderung auf die Arbeiterschaft und die mittelständischen Elemente. Die Abwanderung, d. h. die binnenländische Wanderung vom Lande in die Industriebezirke, wirkt aus zwei Gründen noch viel vernichtender: erstens ist sie ungleich massenhafter, und zweitens schwächt sie den inneren Markt, soweit er von der Landwirtschaft gebildet wird, in demselben Maße, wie sie die Produktivität der Industrie stärkt, der die Wanderer zuströmen. Während das Angebot industrieller Waren ungesund vermehrt wird, wird die Nachfrage nach den gleichen Waren ungesund vermindert.
Die Abwanderung ist in allen kapitalistisch entfalteten Ländern des Großgrundeigentums ungeheuer viel größer als die Auswanderung. Sogar in der Zeit, in der die deutsche Massenwanderung nach den Staaten ihr Höchstmaß erreicht hatte, war die Abwanderung aus dem preußischen Osten fast dreimal so stark wie die Auswanderung: von
[1] Schultze, S. 647.
[2] Aus der „Vossischen Zeitung“, Nr. 501 von 1907.
[706]
1885—1890 sind von dort 180000 Menschen aus-, aber 460000 abgewandert [1].
Wir brauchen uns hier nicht mit statistischen Einzelziffern aufzuhalten. Die Dinge liegen äußerst klar : in allen Staaten des Großgrundeigentums ist in ihrer kapitalistischen Epoche der gesamte Zuwachs der Bevölkerung, und darüber, der Industrie zugewandert. Deutschland hatte 1820 rund 24 Mill. Einwohner, davon 18 Mill, auf dem Lande: 1914 hatte es rund 66 Mill. Einwohner, davon weniger als 17 Mill, auf dem Lande. In Großbritannien sank, wie die Enquête von 1897 ergab, die Zahl der Landarbeiter von 1861, wo sie noch 1163 000 betragen hatte, bis 1871 auf 996000, und war 1891 auf 799000 angelangt [2]. Während dieser Jahre aber stieg die Gesamtbevölkerung von rund 29. auf rund 38 Mill. Köpfe.
Es braucht nicht vieler Worte, um zu sagen, wie ungeheuer diese maßlose Zuwanderung in die Industriebezirke den Lohn der dort schon früher beschäftigten, autochthonischen Elemente drücken mußte, zumal in der ersten Periode des Kapitalismus, in der die Zuwanderung im Verhältnis zu der noch schwach entfalteten Industrie so viel größer war als später, wo das Prozentverhältnis der zuwandernden Lohndrücker zu den schon beschäftigten Millionen diesen nicht so ungünstig war, wie zur Zeit, als erst Zehn- und Hunderttausende beschäftigt waren.
Selbstverständlich ist der Zusammenhang nicht unbemerkt geblieben. In dem berühmten Chartistenroman „Alton Locke“ des Historikers Kingsley heißt es: „Wir werden den Wettbewerb von Frauen und Kindern und verhungernden Irländern zu bestehen haben“ [3]. Und kein Geringerer als Karl Marx spricht aus, daß alle Bemühungen der städtischen Verwaltungen Englands um die Behebung der grauenhaften Wohnungsnot erfolglos bleiben müssen: „Morgen wandert ein Heuschreckenschwarm von verlumpten Irländern oder verkommenen englischen Agrikulturarbeitern ein“ [4].
[1] Nach Serings „Landwirtschaftliche Konkurrenz Nordamerikas“ berechnet in. unserer „Siedlungsgenossenschaft“, S. 224.
[2] Vandervelde, L'exode rural et le retour aux champs, Paris 1903, S. 27.
[3] Ausg. Nelson, London 1908 S. 126.
[4] Das Kapital, I, S. 628. Der Geschichte des Gewerkschaftswesens von Sidney und Beatrice Webb entnehmen wir folgende Daten: „Schon 1675 verbanden sich die Tuchweber Londons zu einer Petition an den Hof der Tuchergilde gegen die Anstellung von Arbeitern vom Lande her“ (S. 33). Von den Baumwollwebern nach 1800 schreibt Place, daß „ihre Leiden über alle Vorstellung gehen : sie wurden in Einungen hineingezogen,, verraten, verfolgt, zu Zuchthaus und Tod verurteilt und mit fürchterlich strengen Strafen belegt; sie wurden in den elendesten Stand der Existenz herabgedrückt und in ihm erhalten“. Ihre Arbeitgeber waren nicht mehr wie in den alten Handwerken zünftige- Meister, die den hergebrachten Lebensstandard ihrer Arbeiter anerkannten, sondern kapitalistische Unternehmer, die sich ganz auf die händlerische Seite des Geschäfts warfen und es ihren Direktoren überließen, Arbeit auf dem Markte so billig wie irgend möglich zu kaufen. Diese Arbeit wurde von allen möglichen örtlichkeiten und den verschiedensten Berufen her rekrutiert, (S.86/87). . . . Lord Londondery in seiner Doppeleigenschaft als Bergherr und Lord-Lieutenant der Grafschaft Durham importiert zum Zwecke der Niederwerfung eines Streiks, den er außerdem in seiner Eigenschaft als höchster Beamter des Bezirks mit allen Mitteln der polizeilichen und militärischen Gewalt niederzuschlagen versucht, irische Arbeiter von seinen Besitzungen auf der grünen Insel und verbietet außerdem noch den Lebensmittelhändlern „seiner Stadt Seaham“, bei Strafe des Verlustes seiner Kundschaft und Gunst, den Arbeitern Lebensmittel zu verkaufen, die sich in „ungerechtem und sinnlosem Kriege gegen ihre Eigentümer und Herren (proprietors and masters) befinden“ (166). Die Autoren erinnern an den berüchtigten Verfechter der amerikanischen Negersklaverei Calhoun (vgl. S. S. I, S. 974), der es ausgesprochen hatte, daß, „die wahre Lösung in dem ewigen Streit zwischen Arbeit und Kapital darin bestehe, daß das Kapital der Eigentümer des Arbeiters sein müsse, sei er weiß oder schwarz“ (167).
[707]
Auch in der bürgerlichen Wissenschaft sind diese Erscheinungen nicht unbemerkt geblieben. Wir nennen Hasbach [1] und Sering [2]. Der erste führt zur Stütze seiner mit der unseren weithin übereinstimmenden Diagnose den Bericht eines Gewerkschaftsbeamten Englands an, der es klar ausspricht, daß es nicht gelingen kann, die Löhne der ungelernten Arbeiter zu heben, so lange die Abwanderung besteht. Sering schreibt : „Während infolge der übermäßigen Zuwanderung . . . die furchtbarste Geißel der Industriearbeiterschaft, die Arbeitslosigkeit, ein wahrhaft himmelschreiendes Elend verbreitet, leidet die östliche Landwirtschaft unter zunehmender Blutleere“ [3].
Aber weder in der bürgerlichen noch in der proletarischen Theorie ist diese zufällige Kenntnis irgendwie ausgewertet worden, offenbar unter der Blendung durch das Pseudogesetz, das wir überall als die letzte Wurzel aller Irrtümer auffinden. Unsere schon 1896 in unserer „Siedlungsgenossenschaft“ enthaltene Einordnung der Tatsachen in das theoretische System hat kein Echo geweckt. Erst ganz neuerdings scheint es in der Sozialdemokratie ein wenig zu dämmern. Der Reichstagsabgeordnete Schnabrich hat kürzlich zu dem von seiner Fraktion eingebrachten Verlangen auf Vorlage eines Gesetzentwurfs „zur Reform der Bodenverteilung und Bodennutzung“ in einer Zeitung der SPD. folgendes geschrieben: „Mit der Durchsetzung dieses Zieles hebt sich auch die Lage der Bauern und die Lage der Industriearbeiter. Je mehr Arbeitskräfte auf dem Lande selbst Verwendung finden können, desto weniger Zulauf von Arbeitskräften zur Industrie. Kann aber die Industrie nicht mehr auf das große Reservoir aus der Landbevölkerung zurückgreifen, dann verschwindet die Lohndrückerei in den Städten,
[1] Die englischen Landarbeiter, S. 335ff.
[2] Die innere Kolonisation, S. 8.
[3] Zit. n. Buchenberger, Agrarpolitik, I, S. 558.
[7θ8]
und die Industriearbeiter sind wieder in der Lage, durch ihre Gewerkschaften ihre Lohn- und Arbeitsbedingungen zu heben.“
c) Der industrielle Kapitalismus.
Die, wie wir sehen, gar nicht so seltenen Schriftsteller, die den Zusammenhang zwischen Abwanderung und Lohn der Industriearbeiterschaft bemerkt haben, haben den methodischen Fehler begangen, sich das hier auftauchende Problem nicht streng wissenschaftlich, d. h. quantitativ zu stellen. Sie waren offenbar, wie das auch bei Schnabrich der Fall zu sein scheint, der dogmatischen Überzeugung, daß die Zuwanderung nur gewisse Ausschreitungen, eine gewisse „Lohndrückerei“ erklären könne, daß aber das Lohnsystem, als solches, andere, von der Wanderbewegung unabhängige Ursachen habe und fortbestehen würde, auch wenn sie aufhörte. Aber die Aufgabe wäre gerade gewesen, jenes Dogma auf Grund der neuen Tatsachen neu zu untersuchen und festzustellen, ob nicht vielleicht das ganze Lohnsystem als solches lediglich eine Folge der Abwanderung und Auswanderung ist.
Das aber ist in der Tat der Fall. Wir wollen kein allzu großes Gewicht darauf legen, daß die theoretische Deduktion dieses Ergebnis hat, obgleich wir glauben, die Sicherheit unserer Methode jetzt bewiesen zu haben. Aber wir können uns außerdem auf Tatsachen genug stützen, und zwar auf Tatsachen, die durch den „Consensus Prudentium“ in unserem Sinne bereits gedeutet sind. Sobald wir die völlig gesicherte Tatsache heranziehen, daß eine starke Wanderbewegung ausschließlich aus Bezirken der Bodensperre in der Rechtsform des massenhaften großen Grundeigentums stattfindet, können wir feststellen, daß jedes Land der heutigen kapitalistischen Gesellschaft bei Wegfall der Bodensperre ein Land sein würde, in dem keine Klassenscheidung bestände, weil, nach Turgot, „jeder arbeitsame Mann so viel Boden, wie er braucht, nehmen und nicht daran denken würde, für andere zu arbeiten“. Oder, um mit Marx zu sprechen: daß jedes Land nach Fortfall der Bodensperre eine „freie Kolonie“ sein würde, in der „jedermann ein Stück Boden in sein individuelles Eigentum und Produktionsmittel verwandeln könnte, ohne den späteren Pionier an der gleichen Operation zu verhindern“ : und unter einer solchen Bodenverfassung kann, das haben uns Marx und Kautsky mit dürren Worten erklärt, ein Kapitalismus nicht entstehen; hier sind „Produktionsmittel und Geld nicht Kapital, sie ver wer ten sich nicht“, weil das,,Kap it al Verhältnis“ mangels „freier Arbeiter“ nicht besteht.
Diese Sätze der proletarischen Bibel und ihres Oberpriesters Kautsky sind nicht theoretische Spintisiererei, sondern richtigeErklärung
[709 ]
vorliegender, massenhafter, genau beobachteter Tatsachen. Und derartige Tatsachen gibt es eine ganze Reihe ; man muß nur verstehen, sie zu erkennen. Wir kommen weiter unten auf diese Tatsachen zu sprechen. Hier nur noch eine Bemerkung:
Wenn die Beobachter der ersten stürmischen industriekapitalistischen Periode nicht industriezentrisch befangen und durch das Pseudogesetz von der ursprünglichen Akkumulation geblendet gewesen wären; wenn sie die ungeheure Tatsache der Massenwanderung von armseligen Landkulis in die Industriestädte in ihre Rechnung eingestellt hätten, so wären die beiden Lehrmeinungen, die wir hier zu bekämpfen haben, niemals entstanden, weder die „bourgeois-ökonomische“, noch die proletarisch-kollektivistische. Man hätte niemals auch nur einen Augenblick den Glauben an die segensreiche Wirkung der Konkurrenz verloren, zur Gleichheit und zur „Harmonie der Interessen“ zu führen.
Wie nämlich ist die entscheidende britische Entwicklung von der Handwerksperiode der städtischen Gewerbe zu ihrer kapitalistischen Epoche verlaufen?
Die städtischen Handwerker haben ihr bescheidenes Brot; wir hörten soeben von Brodnitz, daß die wirtschaftliche Lage der Städter keine groben Verschiedenheiten aufwies. Das Gewerbe entfaltet sich allmählich; je länger je mehr fühlt es sich unerträglich gehemmt durch die Reste der alten Wirtschaftspolitik : durch die Privilegien der Zünfte, durch die Lehrlingsgesetze, durch die Beschränkungen der Freizügigkeit, die (Kirchspielgesetze) dem Fortzug der Menschen vom Lande fort geradeso im Wege standen wie (Zunftgesetze) dem Zuzug in die städtischen Gewerbe. Nach langen Kämpfen gelingt es dem wirtschaftlichen Liberalismus, diese Hemmungen eine nach der anderen zu beseitigen. Der freie Zug der Bevölkerung wird neben manchen anderen Rechten errungen, und die Abwanderung setzt ein. Jetzt scheinen sich alle Pforten der Hölle aufgetan zu haben, denn die Hungerkonkurrenz der Opfer des agrarischen Kapitalismus reißt die Löhne der alten städtischen Handwerker in die Tiefe. Hatten sie vorher in anständigen Häusern gelebt und Beefsteak und Porter genossen, so müssen sie sich jetzt mit den gleichen „Schweineställen“ begnügen, wie die, aus denen ihre Wettbewerber herstammen, und müssen gleich ihnen von Kartoffeln und Wasser und ein wenig Schnaps leben. Dieser furchtbare Niedergang des alten Mittelstandes in den Städten machte auf die Zeitgenossen den stärksten Eindruck. Schon Morus hatte geschrieben: „Wenn ich unsere Staaten ... im Geiste betrachte, so stoße ich auf nichts anderes, so wahr Gott mir helfe, als eine Art von Verschwörung der Reichen, die den Namen und Rechtstitel des Staates mißbrauchen, um für ihren eigenen Vorteil zu sorgen. Sie sinnen und hecken sich alle möglichen Methoden und Kunstgriffe aus, zunächst um ihren Besitz, den sie mit verwerf-
[710]
liehen Mitteln zusammengerafft haben, ohne Verlustgefahr festzuhalten, sodann um die Mühe und Arbeit der Armen so billig als möglich sich zu erkaufen und zu mißbrauchen. Haben die Reichen erst einmal im Namen des Staates, also auch der Armen, den Beschluß gefaßt, ihre Machenschaften durchzuführen, so erhalten diese sogleich Gesetzeskraft“ [1].
Morus hatte mindestens so sehr die agrarischen Kapitalisten, deren größter Ankläger er war, im Auge wie die industriellen, die zu seiner Zeit noch schwach entwickelt waren. Das gleiche mag vielleicht noch von dem edlen Linguet gelten, der, ehe er auf der Guillotine verblutete, geschrieben hatte: „Die Gesetze sind gleichsam Festungen, von den Reichen in Feindesland erbaut, wo nur ihnen Gefahren drohen“ [2]. Hier spricht Rousseauscher Geist, und der Genfer lebte noch im vorkapitalistischen Frankreich, wenigstens so weit nur der industrielle Kapitalismus in Frage steht.
Dann aber sah alle Welt immer nur den städtischen Arbeiter und sein Grauen erregendes Los. So ist gemeint, was Thorold Rogers, der berühmte Historiker der britischen Arbeit, schrieb: „Ich behaupte, daß in der Zeit von 1563 bis 1824 in Form von Gesetzen, deren Ausführung in der Hand von Interessenten lag, eine Verschwörung zusammengebraut worden ist, zu dem Zwecke, den englischen Arbeiter um seinen Lohn zu betrügen, jeder Hoffnung zu berauben, und ihn in unheilbare Armut hinabzustoßen. Länger als zwei und ein halbes Jahrhundert hindurch haben es sich in England die Gesetzgebung und die Verwaltung zur Aufgabe gemacht, den Arbeiter auf die tiefste Daseinsstufe hinab- zupeinigen, jede Regung eines organisierten Widerstandes niederzutreten und Strafe auf Strafe zu häufen, so oft er sich seiner Menschenrechte erinnerte“ [3].
Die Anklage gegen den Klassenstaat ist richtig; wir wollen die furchtbaren Tatsachen hier nicht noch einmal anführen, die den Raubbau an der industriellen Arbeiterschaft beweisen [4]. Aber die Deutung der Tatsachen war und ist falsch. Man klagte, nach der populären Auffassung der Arbeiter selbst, immer das industrielle „Kapital“ als den Schuldigen an, in der Gefolgschaft von Owen, der als erster die Maschine
[1] Utopia, Dtsch. v. Oncken, S. 111.
[2] Zit. bei Lorenz Stein, a. a. O. I, S. 309. „Unser Recht ist ein Faustrecht der Reichen“ (Fries, a. a. a., S. 210).
[3] Zit. n. Adler, Staatsauffassung des Marxismus, S. 192, Anm. Vgl. über das Koalitionsrecht der Arbeiter und Unternehmer, S. u. B. Webb, a. a. O. S. 73·
[4] Nach der von Charles Booth, einem großen Reeder, aufgenommenen, 1886 begonnenen privaten Statistik standen in London 1 ^Million Menschen unter der „Armutslinie“. 32 % der Londoner Gesamtbevölkerung (in großen Bezirken über 60 %) lebten in chronischer Armut, die nicht nur die elementaren Bedingungen der Zivilisation, sondern auch körperliche Gesundheit und wirtschaftliche Tüchtigkeit ausschloß (Webb, S. 381).
[711]
für die Freisetzung der Arbeiter verantwortlich machte [1]. Aber das Kapital in seiner volkswirtschaftlichen Bedeutung, die Maschine, ist vollkommen unschuldig an der ganzen Entwicklung.
Man kam auf jene Deutung nur, weil man irrtümlicherweise annahm, jenes Elend der Arbeiterschaft sei, wie aus dem Nichts gestampft, plötzlich in den Städten entstanden. Es war aber nur in den Städten erschienen, nachdem es jahrhundertelang in den Höhlen der Hintersassen des halbfeudalen agrarischen Kapitalismus den höchsten Grad erreicht hatte, den menschliche Leidensfähigkeit ertragen kann.
Und dieser ganze Prozeß, den bisher alle Beobachter als einen Vorgang auffassen, der nichts als Elend über die Welt brachte, war in Wirklichkeit ein Prozeß der Ausgleichung zwischen zwei bisher nicht miteinander konkurrierenden „non-competing groups“ [2]: einer relativ hoch, und einer unglaublich tief stehenden, die plötzlich miteinander in konkurrierende Verbindung gerieten: zu schwerem Nachteil der ersten, aber zu ebenso großem Vorteil für die zweite. Diese Kehrseite der Münze darf nicht übersehen werden. Für die Irländer war das Elend von Liverpool und Manchester noch ein Aufstieg, und ihre Fortwanderung war es, die, durch Verdünnung des exploitablen Menschenmaterials in der Heimat, hier die Löhne hob und damit das Nullniveau, über dem sich die Löhne auch der industriellen Arbeiterschaft auf staffeln [3].
Wir sehen also: die Konkurrenz ist vollkommen unschuldig gewesen. Sie hat vom ersten Tage an, wo sie wirken konnte, den durchschnittlichen Lohn der gesamten Arbeiterschaft gehoben — und hat ihn immer kräftiger gehoben, nachdem einmal die Überschußbevölkerung der Agrarbezirke nach Übersee und in die Industrie abgeströmt war. Es war nicht ihre Schuld, daß der Durchschnitt im Anfang viel niedriger ausfallen mußte als der vorher von den Städtern verdiente Lohn, so daß sie jahrzehntelang in die größte Not gerieten, bis die Konkurrenz das Durchschnittsniveau allmählich wieder so hoch, und höher, hatte heben können, wie ihre Sonderlohnklasse vor der großen Ausgleichung gestanden hatte. Sie hat auch hier ihre große Kraft bewährt, die Einkommen so weit auszugleichen, wie das weiter bestehende Monopol es ihr möglich machte.
Nicht die Konkurrenz also, und nicht die Maschine tragen die Schuld an den Greueln der frühkapitalistischen Periode, als deren geistiger Reflex die beiden hier bekämpften, einander befehdenden Theoreme entstanden sind, sondern der Rest der alten erobernden,
[1] Vgl. z. B. Gray, a. a. O. S. 16.
[2] S. S. III, S. 640.
[3] S. S. III, S. 652. S. 16.
[712]
klassenschöpfenden Gewalt, der noch in der Gestalt der Bodensperre in den Gesellschaftswesen der Neuzeit überdauert.
Und dieser Angeklagte ist bereits verurteilt, so sehr sich seine Advokaten auch um eine Freisprechung bemühen mögen. Wir haben bereits gesagt, daß sich kaum ein einziger Ökonomist von einigem Ruf und Rang finden läßt, der nicht irgendwie im Grundeigentum die Wurzel aller Übel gesucht hätte. Wir können jetzt hinzufügen, daß viele der bedeutenderen Rechtsphilosophen das große Grundeigentum als antisozial verworfen haben. Einige Belege:
Metzger führt einen Ausspruch Fichtes an, den er im Hinblick auf die wirtschaftlichen Zustände im damaligen Großgrundeigentum, deren Unhaltbarkeit er mit lebhaftester Teilnahme beklagt, getan habe: „Kein Mensch auf der Erde hat das Recht, seine Kräfte ungebraucht zu lassen und durch fremde Kräfte zu leben“ [1].
Und ferner: Keiner ist verbunden, zweck- und arbeitsloses Eigentum in den Händen anderer anzuerkennen, denn „von dem Gebrauch eines Dinges . . . alle übrigen auszuschließen, ohne selbst einen Gebrauch desselben angeben zu können, ist . . . widerrechtlich“ (168/9). Leo beklagte, daß unser Privatrecht auf fremden, auf römischen Grundlagen entwickelt sei: „Solche Dinge wie echtes, egoistisches, ganz meinem Willen, sei er noch so eigensinnig und launenhaft, nach gewissen Seiten preisgegebenes Eigentum . . . ist, wenigstens in bezug auf Grund und Boden, kein deutscher Rechtsbegriff“ [2].
Konstantin Frantz schreibt: „Ich habe ein Anrecht auf den vaterländischen Boden und bin von Rechts wegen Mitbesitzer desselben, nach einem viel älteren und heiligeren Titel, als alle Grafen, Barone und Ritter in ihren Archiven aufzutreiben vermögen. Wie sinnlos ist es doch, von Grundrechten zu sprechen und damit in Konstitutionsurkunden wichtig zu tun, solange nicht dies Anrecht auf den vaterländischen Boden anerkannt ist, welches die Grundlage jeder Existenz ist! Es ist ein Schrei der beleidigten Menschennatur, der in dem Kommunismus zum Durchbruch kommt. Die phantastischen Entwürfe, die sich daran anschließen, gehören der kommunistischen Poesie an, aber jener Grundgedanke ist wahr, und die liberalen Ökonomisten werden ihn früher oder später akzeptieren müssen, wenn auch ihr ganzes System darüber zugrunde gehen sollte“ [3]. Und an anderer Stelle: „Es ist aber an gar keine gründliche Hilfe zu denken, solange man nicht die falsche Ansicht vom Lande aufgibt, wie wenn es ein bloßes Objekt des Willens wäre, und nicht vielmehr selbst die
[1] A. a. O. S. 141.
[2] Zit. nach v. Below, a. a. O. S. 14.
[3] Naturlehre des Staates, S. 106/7.
[713]
Grundlage der menschlichen Gesellschaft“ [1]. Er weiß, daß Deutschlands ganzes Schicksal nur daraus verstanden werden kann, daß das mittel- und kleinbäuerliche Stammland im Westen mit dem Großbesitzerlande im Osten zu einem Staatswesen zusammengefaßt worden ist, „so daß eine gleichartige Verfassung für beide Landesteile unmöglich wird, wenn sie nicht ein äußerlicher Formalismus bleiben soll, wie es die preußische Verfassung wirklich ist. Daß die abnormen Zustände Mecklenburgs ganz und gar aus den dortigen Grundbesitzverhältnissen folgen, ist wohl allgemein bekannt“ [2]. Und er versteht sehr wohl, was die terra libera für die Entwicklung der Vereinigten Staaten und ihres Nationalcharakters bedeutet hat [3].
Sogar ein Treitschke, auf den sich unsere Agrarier ebenso gern berufen wie auf Fichte, von dem sie nichts anderes wissen, als daß er gegen die napoleonische Fremdherrschaft aufgetreten ist, nicht aber, daß er Sozialist und entschiedener Demokrat war — sogar ein Treitschke kann sich den Schäden des Großgrundeigentums, vor allem natürlich des außerpreußischen, nicht ganz verschließen. „Rußland hat vor allem soziale Reformen nötig. Die Leibeigenschaft muß ganz aufgehoben werden, so daß der Bauer Eigentum erhält, das elende Volksschulwesen muß von Grund aus reformiert werden. Fragt man nun, wer sind die natürlichen Feinde dieser Reformen? So lautet die Antwort: es ist der Großgrundbesitz“ [4]. „Zustände, wie man sie bei uns nur in Mecklenburg und in Teilen von Vorpommern findet, sind in England noch heut die Regel. . . . Die Aristokratie hat den Bauernstand, der gerade Deutschlands Stärke ist, verschlungen, und ganz konsequent hat sich der Parlamentarismus im Sinne einer reinen Adelsherrschaft entwickelt“ (ib. S. 137). Gegen den Latifundienbesitz im preußischen Nordosten findet er sanfte Worte des Tadels, weil er die Auswanderung sehr befördert habe, und verlangt „große sozialpolitische Maßnahmen des Staates“ (I, S. 234); diese Maßnahmen scheinen allerdings im wesentlichen darin bestehen zu sollen, daß „der Staat seine großen Domänen zerschlägt und an kleine Kolonisten verpachtet“ (Π. S. 454).
3. Die Praxis. ↩
a) Bauernpolitik.
Sie sind also sämtlich Verfechter einer Bauernpolitik, d. h. der Erhaltung und Vermehrung des eigentlichen Bauernstandes auf Kosten übermäßigen Großgrundeigentums und jedenfalls in Abwehr seiner
[1] Naturlehre des Staates, S. 104.
[2] Naturlehre des Staates, S. 108.
[3] Naturlehre des Staates, S. 109. Vgl. dazu Jellinek, a. a. O. S. 123.
[4] Politik, II, S. 129/30.
[714]
Vergrößerungsgelüste. Wenn man genau hinsieht, gibt es überhaupt niemanden, der Gegner solcher Bauernpolitik ist : sogar die Großagrarier selbst bekennen sie im Lippendienst, indem sie sich selbst als „Bauern“ bezeichnen, mit demselben Recht, mit dem sich einmal einer der größten Kapitalisten Deutschlands als einen „Kupferschmied“ vorstellte, und mit dem sich der Staat, das „kalte Untier“, als die Gemeinschaft, das Volk, aufzuspielen liebt.
Alle Denker über den Staat, die nicht blinde Städter, und deshalb „industriezentrisch“ befangen waren, haben klar erkannt, daß das Grundeigentum der archimedische Punkt ist, von dem aus unsere soziale Welt in Theorie und Praxis allein bewegt werden kann.
In der Theorie! Für Ökonomik und Staatslehre haben wir das, wie wir hoffen, völlig nachgewiesen. Für die Historik soll der nächste Teil dieses Systems den Beweis noch einmal [1] zu erbringen versuchen. Wir stellen uns die Aufgabe ganz so, wie sie vor einem Jahrhundert der weise Justus Moser, der kein Städter und nicht industriezentrisch geblendet war, prophetisch prägte:
„Die Geschichte von Deutschland hat meines Ermessens eine ganz neue Wendung zu erhoffen, wenn wir die gemeinen Landeigentümer, als die wahren Bestandteile der Nation, durch alle ihre Veränderungen verfolgen, aus ihnen den Körper bilden und die großen und kleinen Bedienten dieser Nation als böse oder gute Zufälle des Körpers betrachten [2] . . ., wenn es einem Manne von gehöriger Einsicht gelingen wird, sich auf eine solche Höhe zu setzen, wovon er alle diese Veränderungen, welche den Reichsboden und seine Eigentümer betroffen, mit ihren Ursachen und Folgen in den einzelnen Teilen des deutschen Reiches übersehen, solche zu einem einzigen Hauptwerke vereinigen, und diese in ihrer ganzen Größe ungemalt und ungeschnitzt, aber stark und rein aufstellen kann“ [3].
Was aber die Praxis anlangt, so lehrt alle Weltgeschichte nur einen einzigen Satz, ihn aber auf allen ihren Seiten, und es gehört zu den merkwürdigsten Tatsachen, daß ihn kaum einer bisher gelesen hat:
Wer das Land hat, hat die Macht.
Zu diesen Wenigen gehört eines der anerkanntermaßen größten politischen Genies aller Geschichte, Niccolo Machiavelli, dessen Name, wie auf seinem Grabdenkmal in Florenz steht, größer ist als jeder Nachruf. Wir haben oben die Stelle angeführt, wo er die Zusammenhänge in seiner gewohnten Scharfkantigkeit herausarbeitet : wer eine Republik will, muß den großen Landadel ausrotten; wer eine Monarchie will, muß
[1] Für Deutschland ist er in „Großgrundeigentum und Soziale Frage“ erbracht.
[2] Gesellschaft und Staat, S. 77.
[3] Gesellschaft und Staat, S. 85/6.
[715]
die unruhigen Leute mit Großlandbesitz und festen Schlössern ausstatten.
Einundeinhalb Jahrhunderte später nahm ein ebenso großer politischer Kopf im England der Cromwellzeit den Gedanken wieder auf: James Harrington, dessen „Ozeana“ unter der Form der Utopie den sehr ernsthaften Entwurf einer Verfassungs- und Sozialreform vortrug. „Ozeana ist von allen Utopien die am wenigsten utopische; sie ist eines der frühesten Beispiele des politischen Denkens nach der historischen Methode“, rühmt Gooch von Harrison [1], von dem er an anderer Stelle in höchster Bewunderung sagt: „Wir vermissen das Donnergrollen der Prosa Miltons, die gedankenschwangere Kürze von Hobbes, die funkelnden Aphorismen von Halifax, aber Harrington überragt sie alle an Originalität“ [2].
Hören wir ihn selbst:
„Wenn nur ein Mann der einzige Herr des Landes ist oder das Volk überwiegt, indem er z. B. drei Viertel des Bodens eignet, so ist er der Großherr, wie der Türke wegen seines Grundeigentums genannt wird, und sein Reich ist eine absolute Monarchie.
„Wenn die Wenigen oder ein Adel oder der Adel mit dem Klerus zusammen das Land besitzen oder das Volk in gleichem Verhältnis überwiegen, so haben wir das „Gothische Gleichgewicht“ . . . und das Reich ist eine gemischte Monarchie, wie Spanien, Polen und das frühere Ozeanien (England).
„Und wenn das ganze Volk Grundbesitz hat, d. h. das Land derart unter sich verteilt hat, daß kein einzelner Mann und auch keine Verbindung von einzelnen im Bereiche des Adels sie überwiegen kann, dann ist das Reich, (wenn keine Gewalt sich einmischt) eine Republik (commonwealth) “ [3].
Um dieses Gleichgewicht des Bodenbesitzes zu erhalten, baut er seinen Verfassungsentwurf auf einem „agrarian“, einem Landgesetz auf; er will das Eigentum der Gentry nicht ganz abschaffen und polemisiert gegen Machiavelli (18), den er offenbar in dieser Beziehung mißversteht (der Florentiner dachte lediglich an so großen Besitz, daß er eigene politische Macht verleiht), sondern er will das Großgrundeigentum nur nicht das Übergewicht gewinnen lassen, wie es zum Verderben Roms geschehen ist (36).
Harrington ist also ein sehr gemäßigter Bodenreformer, nicht im mindesten ein Radikaler. Daß er in der Hauptsache die Wahrheit ergriffen hat, werden nur Wenige zu bestreiten wagen. Ein Blick einerseits auf Bauernländer wie die Schweiz, Norwegen, Holland, China, und
[1] A. a. O. S. 117. Vgl. Beards, a. a. O. S. 35, s. a. 24/5.
[2] A. a. O. S. 113.
[3] Ozeana, S. 15.
[716]
andererseits auf Großgrundbesitzländer wie Rumänien, Polen, Japan, zeigt, daß die Forderung, auf die die Ökonomik ebenso kommen muß, wie die Ethik: Bauernpolitik, auch das letzte Wort der an der Geschichte orientierten Politik sein muß. Überall bestimmt nicht die geschriebene, sondern die „ungeschriebene Verfassung“, bestimmen die in der Bodenverteilung gegebenen Machtverhältnisse das Geschick von Staat und Gesellschaft.
Diese Erkenntnis hat kein einziger der größeren Köpfe vermissen lassen, die sich überhaupt mit Politik wissenschaftlich beschäftigt haben.
J. F. Fries schreibt (eine „Autorität“ mehr für die soziologische Staatsidee!): „Der Krieg gibt überhaupt die Unterjochung dienender Stämme, Sklaven und Leibeigene unter der Herrschaft von Fürsten und Adel. Die Vorherrschaft des Handels führt zu schützenden Patriziern über Klienten; die Vorherrschaft der Gelehrten führt zur Herrschaft der Feder bei Priestern, Mandarinen und Doktoren; wo aber der Ackerbau herrscht, da bereitet sich gleiches Recht der Hausväter vor in den Demokratien“ [1]. Wie das gemeint ist, wird völlig klar, wo er von der „Forderung der Aufhebung der Sklaverei“ spricht: „Aber was diese Idee eigentlich verlange, erkennen die Völker noch nicht, indem zur Sicherheit der Privatrechte jede plumpe Verteilung des Grundeigentums für unantastbares Recht gehalten wird“ (191). Es ist aber nichts als „der aristokratische Despotismus, welcher die rohe Gewaltheit für Recht erklärt“ (206). „Freilich wenn unser Leben sich einer gerechten Verteilung des Grundeigentums und einer besonnenen Mäßigung in der Gewirbigkeit ergäbe, ... so würden wir ein frohes, ehrenhaftes Volksleben gewinnen, welches seinen Bedürfnissen gewachsen und der drückenden Armut zu steuern imstande wäre“ (207/8).
Und so lautet denn sein „drittes Gesetz“: Das Mein und Dein soll nach dem Grundsatz der persönlichen Gleichheit in der Gesellschaft verteilt werden (256). Das heißt aber nicht etwa roher Kommunismus sondern „Gleichgewicht zwischen Arbeit und Genuß ... ein jeder soll die Früchte seiner Arbeit selbst genießen (262).
Auf dem gleichen Standpunkt stand Proudhon, so daß Berthod seiner Schrift „P. J. Proudhon und das Eigentum“ geradezu den Untertitel geben konnte: „Ein Sozialismus für die Bauern“. Proudhon, der selbst vom Lande stammte, verstand von Grund aus den Bauer und seine Existenzbedürfnisse, von denen die „industriezentrischen“ Städter, die fast allein die politische Ökonomie und den Sozialismus geschaffen haben, nicht die mindeste Vorstellung hatten [2]. Und so
[1] Politik S. 61.
[2] Darum bringen die Herren auch nirgends ein Agrarprogramm zustande, so wenig in Deutschland wie in Frankreich (Berthod, S. 8/9).
[717]
„beherrschte dieser Gedanke ihn durch sein ganzes Leben hindurch, dem Bauern den innigen Besitz an seiner Scholle zu geben, die der wahre Inhalt seines Lebens ist“ (8).
Er konnte diese Aufgabe theoretisch nicht vollkommen lösen, weil auch er von dem Glauben an das unglückselige Gesetz der ursprünglichen Akkumulation gelähmt [1] (135); und so schwankte er in seinen praktischen Vorschlägen hin und her, begann mit einer Art von Erbpacht und entschied sich zuletzt doch für das volle Eigentumsrecht, aber immer bleibt die Wiederherstellung der Hufe sein unverlierbares Ideal [2]: kleines Einzeleigentum oder Genossenschaft; er versteht sehr wohl, daß sich nur in der Genossenschaft die Vorteile des Groß- mit dem des Kleinbetriebes vereinigen lassen [3]. Er hat die Dinge mit solcher Gewissenhaftigkeit durchgearbeitet, daß er sogar auf Grund genauester Beobachtung auf exakt die gleiche Grundfläche als den mittleren Bodenbedarf einer Bauernstelle kommt, die wir immer angegeben haben, und die R. Zinkann durch die genaueste Berechnung mit allen statistischen Finessen der Neuzeit bestätigt hat: 5 ha [4].
Hier also muß alle soziale Reform einsetzen, und bald, wenn unser Europa der drohenden Vernichtung entgehen soll. Das hat der industriezentrische Städter bisher versäumt: „Unsere ganze praktische Politik hat bis jetzt den Bauer als politische Potenz ignoriert“ [5]. Und doch: „Ein Agitator, welcher der Bauern sich zu bemächtigen verstünde, würde wahrhaftig ein recht fürchtenswerter Agitator sein. Er hätte die wirkliche Majorität des Volkes auf seiner Seite, nicht bloß der Kopfzahl nach, sondern auch nach der materiellen und moralischen Macht“, sagt Riehl (44). Denn „gegen die Empörung einer städtischen Bevölkerung hätten die vorhandenen Militärkräfte einschreiten mögen, aber wo sich die Bauern von ihren Sitzen erheben, da ist es, als ob eine Stadt an allen Punkten zugleich brenne“ (88).
Freilich, mit dem städtischen Industriezentrismus und der „kommunistischen Poesie“ wird man den Bauern nicht politisch mobilisieren. Wir haben vor fast 20 Jahren folgendes über den russischen Bauern geschrieben: es gilt für den Bauern in der ganzen Welt und zu allen Zeiten: „Der russische Bauer verlangt Land, er hat keine Theorien und keine Prinzipien; er will keine neue Weltordnung aus dem Nichts stampfen und weiß nichts von dem Glauben des Abbé Sieyès und seiner Anhänger an eine alleinseligmachende Staatsverfassung. Dafür fühlt
[1] Vgl. z. B. Théorie de la Propriété, S. 194. Er braucht „Garantien“. Er glaubt an die Fabel von der Konkurrenz von landwirtschaftlichem Groß- und Kleinbetrieb (ib. 157).
[2] Berthod, S. 90.
[3] Théorie de la Propriété, S. 179.
[4] Vgl. S. S. I, S. 998. Die Proudhonschen Ziffern finden sich bei Berthod, S. 91.
[5] Riehl, Die bürgerl. Gesellschaft, S. 76.
[718]
er aber, wo ihn der Schuh drückt, deutlich, ohne Möglichkeit des Irrtums. Er hat zu wenig Acker, um seine Familie ernähren und seine staatsbürgerlichen Pflichten erfüllen zu können, und darum verlangt er den Acker, der zur Hand ist, der gar nicht oder nur ungenügend Früchte trägt, den Acker der großen Grundbesitzer, der Kirche und des Staates selbst. . . . Solange er dieses Ziel erreichbar vor sich sieht, wehrt er mit dem gesunden Instinkt des Naturmenschen, der den Schwulst der Logiker und Rhetoren als hohl herausfühlt, alle Salbadereien der Verfassungskonditoren und Staatsordnungsfabrikanten ruhig von sich ab“ [1]. Wenn ihm aber alle Hoffnung geschwunden ist, „dann bemächtigt er sich wohl der ihm unverständlichen Schlagworte der Städter und bricht in dem Zorn des Mannes los, dem Unverstand und Frevel weigern, was recht und gerecht ist. Dann bleibt vom alten Rußland kein Stein auf dem anderen, und das Blutmeer, das hier fließen wird, wird sich gegen die Opfer von 1789 bis 1791 ausnehmen wie ein Ozean gegen einen Weiher. Wehe den Schlössern, wehe den Landstädten!“
Riehl, der feinste Einfühler des deutschen Schrifttums, der Mann, der lange vor der modernen Soziologie die „sozialpsychologische Determination“ der verschiedensten Gruppen der modernen Gesellschaft erkannt und beschrieben hat, hat auch diesen Gegensatz der bäuerlichen und städtischen Psychologie, und daher der bäuerlichen und städtischen Revolutionsgesinnung, wohl bemerkt: „So werden wir bei dem Revolutionstreiben der Bauern überall einen direkten Gegensatz gegen den Revolutionsgeist der Städter gewahren: der Bauer wollte sich das aufgedrungene Neue vom Halse schaffen, um zum Alten zurückzukehren, der Städter, um es gegen ein theoretisch-phantastisches Neuestes zu vertauschen “(96). Und zwar ist jenes Neue, das der Bauer sich vom Halse zu schaffen wünscht, im Grunde nichts Geringeres als der ganze moderne, zentralisierte Staat, von dem Riehl mit Recht nicht einsehen kann, „wofür der Bauer ihm hold und dankbar sein sollte“ (76).
Wahrlich: „der Bauer ist die erste konservative Macht im Staate“(76) in dem Sinne, daß er alles wirklich Erhaltenswerte auch erhalten will, als er nicht wie der Städter immer „novarum rerum cupidus“ ist. Und wahrlich: wo der Bauer einmal unter glücklichen Verhältnissen die außerökonomische Gewalt abzuwehren imstande war, die sein Glück zerstören wollte, wo das ökonomische Mittel einmal allein wirken konnte, „wie etwa bei den Dithmarsen des Mittelalters, da war auch ein streng gegliedertes, freies genossenschaftliches Leben vorhanden, das
[1] „Was uns die russische Agrarreform bedeutet ?“ Patria, Jahrbuch der „Hilfe“ 1906. Abgedruckt in „Wege zur Gemeinschaft“, S. 163/4. Man sieht, daß eine richtige Theorie auch richtige Voraussagen erlaubt.
[719]
sich auch ohne Stütze kaiserlicher Privilegien durch seine eigene Tüchtigkeit lange Zeit in Geltung zu erhalten vermochte“ (113/4).
So haben denn diejenigen Sozialisten, die den modernen Staat nicht nur deshalb verwerfen, weil er Klassenstaat ist, sondern auch, weil er zentralistisch ist, so haben die Anarchisten, die diese Erbschaft des Absolutismus nicht anzutreten gesonnen sind, von jeher die Bauernpolitik empfohlen. Stirner, der „sich über taktische Fragen nur sehr beiläufig ausgesprochen hat“, hat doch, obgleich prinzipiell Anhänger der freien Konkurrenz, gefordert, daß „rationiertes Eigentum dort eintreten solle, wo es zweckmäßig ist, nämlich beim Grundeigentum“ [1]. Bakunin aber, der gerade auf die Taktik des politischen Kampfes das Hauptgewicht legte, und der sein Rußland zu gut kannte, um sich von dem Industriezentrismus der Kommunisten, selbst in der gereinigten Form des Marxismus, fangen zu lassen, hat mit flammendem Appell die städtische Arbeiterschaft zur Revolutionierung der Bauern aufgerufen :
„Die Bauern sind keine Faulenzer, sie sind harte Arbeiter wie sie selbst, nur arbeiten sie unter anderen Bedingungen. Das ist alles. Dem bourgeoisen Ausbeuter gegenüber muß der Arbeiter sich als der Bruder des Bauern fühlen. Die Bauern werden mit den Arbeitern zusammen zur Rettung des Vaterlandes marschieren, sobald sie überzeugt sein werden, daß die Arbeiter der Städte ihnen weder ihren Willen, noch irgendeine politische und soziale Ordnung aufzwingen wollen, eine Ordnung, die von den Städten zur größeren Glückseligkeit des Landes erfunden ist, sobald sie die Gewißheit erhalten haben, daß die Arbeiter keineswegs die Absicht haben, ihnen ihren Boden zu nehmen. . . . Hätte man dadurch aber nicht auf ärgerliche Weise das Prinzip des Privateigentums sich befestigen lassen, und ständen nicht die Bauern den sozialistischen Arbeitern der Städte feindseliger gegenüber als je ? Keineswegs, denn wenn einmal der Staat abgeschafft ist, wird ihnen die juristische und politische Weihe, die Garantie des Eigentums durch den Staat fehlen. Das Eigentum wird kein Recht mehr sein, es wird zurückgeführt sein auf eine einfache Tatsache“ [2].
In diesen Worten schimmern matt erfühlte, aber nicht klar bewußte Vorstellungen auf: der Unterschied zwischen großem und kleinem Grundeigentum, „ökonomischem und politischem“ Eigentum [3]. Ferner
[1] Ludwig Oppenheimer, a. a. O. S. 289/90.
[2] Das knutogermanische Kaiserreich, S. 32/4.
[3] S. S. III, S. 409/10. Vgl. kommunist. Manifest, S. 38: „Erarbeitetes, erworbenes, selbstverdientes Eigentum. Sprecht ihr von dem kleinbürgerlichen, kleinbäuerlichen Eigentum . . .? Wir brauchen es nicht abzuschaffen; die Entwicklung der Industrie hat es abgeschafft und schafft es täglich ab“. Hier spricht der Fehlgedanke von der „Niederkonkurrierung“ des Bauern durch das agrarische „Großkapital“ (S. 20). Eine solche hat es nie gegeben. Vgl. S. S. III, S. 1096ff.
[720]
fehlt hier selbstverständlich jede Vorstellung davon, wie eine solche Reform oder Revolution, die Eroberung des ganzen Bodens für das Volk, auf die städtische Arbeiterschaft wirtschaftlich, politisch und daher psychologisch wirken müßte.
Nun, jedenfalls haben die Ereignisse gezeigt, daß Bakunin doch schärfer gesehen und besser prophezeit hat als sein großer Gegner Marx, der ihn in theoretischem Wissen und lange auch in politischem Einfluß so sehr überstrahlt hat. In Rußland haben die städtischen Arbeiter den Bauern als ihren „Bruder“ gegen die Bourgeoisie revolutioniert, haben ihm das Land, das er begehrte, gegeben oder wenigsten gelassen; haben sich wohl oder übel davon überzeugen müssen, daß die kommunistische Gemeinwirtschaft hier ihre, wenigstens zurzeit nicht überschreitbare, Grenze hat; und haben derart in ihrer „Republik der Arbeiter und Bauern“ anerkannt, daß das bäuerliche Eigentum keine Ausbeutungsposition ist. Es wird nur an dem Versuche liegen, den schon dadurch ausgehöhlten Kommunismus im übrigen aufrecht zu erhalten, wenn die Führer erleben sollten, daß die Bauern „ihnen eines Tages feindseliger als je gegenüberstehen werden“.
Im übrigen hat in dieser ganzen großartigen Aktion Bakunin neben Marx gewirkt. „Lenins .oberste Phase der kommunistischen Gesellschaft' ist gar nichts anderes als die einfache Kopie des Anarchistenparadieses Bakunins und Krapotkins'“ [1].
All das, was in den Worten des Meisters und den Taten des Schülers als eine in wildester Gärung begriffene Mischung wahrer und falscher Elemente auftritt, läßt sich nur reinlich trennen durch eine wissenschaftliche Deduktion der klassenlosen Gesellschaft, der „Freibürgerschaft“.
b) Revolution.
Ist solche Bauernpolitik „Revolution“ ? Ja und nein, je nachdem man den Begriff faßt.
Nach Karl Marx und seinen Schülern besteht die „soziale Revolution“ in der „langsameren oder rascheren Umwälzung des ganzen ungeheuren juristischen und politischen Überbaus der Gesellschaft, die aus der Veränderung ihrer ökonomischen Grundlagen hervorgeht“ [2].
Kautsky nennt das den weiteren Begriff, dem er den engeren gegenüberstellt: darunter versteht er eine besondere Form oder Methode
[1] Gide und Rist, a. a. O. (dritte deutsche Ausgabe), S. 704. Dieses anarchistischkommunistische Paradies schildert wieder Pierre Ramus (Die Neuschöpfung der Gesellschaft). In den Grundlinien richtig: Erkenntnis der Monopolcharakters der heutigen Gesellschaft, aber keine Ahnung von theoretischer ÖkonomikI Freie Konkurrenz ohne Wert, Preis, Geld usw.!! Das ethische Gefühl allein kann die große Aufgabe nicht lösen.
[2] Zur Kritik der politischen Ökonomie, S. LV. Vgl. Kautsky, Soziale Revolution, S. 7.
[721]
der Umwälzung, nämlich „die Eroberung der politischen Macht durch eine neue Klasse“. Nicht das ist ihr Charakteristikum, daß äußerliche Gewalttätigkeit angewendet wird: „DieKonstituierung der Abgeordneten des dritten Standes als Nationalversammlung Frankreichs am 17. Juni 1789 war eine eminent revolutionäre Tat ohne jede äußerliche Gewalttätigkeit. . .. Die Eroberung der Staatsgewalt durch eine bis dahin unterdrückte Klasse, also die politische Revolution, ist demnach ein wesentliches Merkmal der sozialen Revolution im engeren Sinne, im Gegensatz zur sozialen Reform. . . . Jeder ist ein Revolutionär, der dahin strebt, daß eine bisher unterdrückte Klasse die Staatsgewalt erobert. . . . Andererseits wird nur jene politische Revolution zu einer sozialen Revolution, die von einer bisher gesellschaftlich unterdrückten Klasse ausgeht, welche gezwungen ist, ihre politische Emanzipation durch ihre soziale zu vollenden, da ihre bisherige gesellschaftliche Stellung im unvereinbaren Gegensatz steht zu ihrer politischen Herrschaft“ [1].
Im „Erfurter Programm“ desselben Schriftstellers heißt es ähnlich: „Ein solcher Umsturz . . . muß keineswegs notwendig mit Gewalttätigkeiten und Blutvergießen verknüpft sein“ (S. 106).
In diesem Sinne wäre die von uns empfohlene Bauernpolitik sicherlich eine „politische und soziale Revolution“ : denn sie würde die politische Macht für eine neue, bisher unterdrückte Klasse erobern, die mittleren und kleinen Bauern und die Landarbeiter und die mit ihnen verbündeten Industriearbeiter. Aber sie muß nicht notwendig eine Revolution im üblichen „Heugabelsinne der Gewalt“, sie muß nicht notwendig mit Blutvergießen verknüpft sein.
Es handelt sich um die Aufhebung des Klassenmonopols der Bodensperre. Dieses besteht in der Rechtsform massenhaften Großgrundeigentums. (Wir haben immer wieder erklärt, daß vereinzeltes Eigentum dieser Art harmlos ist.) Das Bodenmonopol ist also schon gesprengt, wenn es gelingt, einen so großen Teil des Großgrundbesitzes in Dauereigentum des Volkes zu bringen, daß die „einseitige Dringlichkeit des Angebots“ auf Seiten zunächst der Landarbeiter nicht mehr besteht, ja, sogar, daß sie bloß nicht mehr in dem heutigen Grade besteht. Denn eine erhebliche und schnell sich vollziehende innere Kolonisation würde die an sich schon nicht mehr sehr bedeutende Zahl der Landarbeiter so sehr vermindern, daß ihr Lohn stark steigen müßte, und das würde die schwächsten Elemente der Großbesitzer zu Fall bringen, der rettenden Aktion neues billiges Land zur Verfügung stellen, neue Lücken in den Bestand der Landarbeiter reißen, neue Zusammenbrüche herbeiführen usw., bis hier „immer zwei Unternehmer einem Arbeiter nachlaufen
[1] Die soz. Revolution, S. 7/9.
[722]
und sich überbieten“, womit das Kapital-, das Monopolverhältnis aufgehoben wäre. Dieser „Stich mit der Lanzette in einen zum Platzen reifen Abszeß“ [1] würde z. B. in Deutschland mit einem Bruchteil des Geldes auszuführen gewesen sein, das das Proletariat auf den Sparkassen besaß, als der Weltkrieg ausbrach, der sie auch von diesem Eigentum expropriierte. Wir schätzen, daß der Erwerb von einem Zehntel bis zu einem Fünftel des damals vorhandenen Großbesitzes und seine schnelle Vergebung in der Gestalt des Einzelbesitzes oder — wenigstens vorläufig — in der der „Anteilswirtschaft“ [2] an Landarbeiter hingereicht hätte, um den Prozeß in Gang zu bringen und zu erhalten.
Wenn sich die rettende „Revolution“ auf diese Weise durchführen läßt, ist das zweifellos der beste, menschlichste und billigste Weg, unvergleichlich besser, menschlicher und billiger als ein Bürgerkrieg. Ja, wir würden aus diesen drei Gründen auch nichts gegen eine letzte „Kriegsentschädigung“, eine großmütige Abfindung der ehemaligen Land- und Staatsherren haben, um sie über die Übergangszeit fortzubringen, obgleich rechtlich bei solchem Verfahren nicht der geringste Anspruch darauf bestünde: denn eine Expropriation durch rein wirtschaftliche Kräfte ist in der ganzen kapitalistischen Epoche niemals als entschädigungsberechtigend betrachtet worden. Der Handweber, den die Fabrik, der kleine Händler, den das Warenhaus aus seinem Erwerbe warf, ist nie entschädigt worden.
Wenn freilich die besitzende Klasse dieser friedlichsten und segensreichsten „Revolution“ gewaltsamen Widerstand entgegensetzen wollte, dann würde nichts anderes übrig bleiben als die ultima ratio nationum : die Revolution im üblichen Sinne. Und dann würde sich, um noch einmal Riehl anzuführen, bald zeigen, wer die wirkliche Majorität auf seiner Seite hat, nicht nur der Kopfzahl nach, sondern auch nach der materiellen und moralischen Macht.
Das Recht zu solcher Setzung der Gewalt gegen die Gewalt gibt sogar Treitschke dem Volke: „Entsprechen in einem Staate die alten Institutionen nicht mehr den veränderten sozialen Verhältnissen, so ist Neu- und Umbildung des Rechts notwendig, denn das Recht kann nur der Ausdruck sein der gegebenen sozialen Machtverhältnisse. Verharrt diese Umbildung auf gesetzmäßigem Wege, so nennt man sie Reform. In der Geschichte eines jeden Staates treten aber Fälle ein, in denen die gesetzmäßige Fortbildung unmöglich oder durch menschliche Leidenschaft verhindert wird; dann kommt es zu gewaltsamen Umbildungen, und diese bezeichnet man als Revolutionen. . . . Daß es Revolutionen
[1] S. S. III, S. 1108.
[2] Vgl. unsere „Genossenschaftliche Ansiedlung“.
[723]
in der Geschichte gegeben hat, und immer geben wird, bei welchen das moralische Recht auf sehen der Aufständischen ist, liegt auf der Hand [1].
Treitschke führt die großen Führer der Reformation als Kronzeugen für seine Anschauung an: „Zwingli, als ein entschlossener Republikaner, sagte kurzab: so die Obrigkeit aus der Schnur Christi fährt, mag sie mit Gott entsetzt werden. Und Calvin : wenn das weltliche Regiment mit Gottes Wort in Widerspruch gerät, so ist der Untertan seiner Pflicht enthoben. Luther dagegen hat erst nach und nach begonnen, seine Gesinnung dahin zu wandeln, unter schweren Kämpfen, und kam erst am Abend seines Lebens zu dem Schlüsse, daß kein Unterschied sei zwischen einem Privatmörder und dem Kaiser, so er außer seinem Amt öffentlich oder notorie unrechte Gewalt vornimmt, denn öffentliche violentia hebt auf alle Pflichten zwischen dem Untertanen und der Obrigkeit. . . . Selbst Friedrich der Große hat sich zu dieser Auffassung bekannt. Er sagt: der Fürst hat versprochen, die Rechte seines Volkes zu wahren ; wenn der eine Teil eidbrüchig wird, so wird der andere Teil seinerseits frei von aller Verpflichtung“ (192/4).
Wir haben dem Streit um das Widerstandsrecht im geistesgeschichtlichen Teil dieses Buches reichen Raum gewährt. Wir wissen, daß auch, und zuerst, die katholischen Autoritäten unter Umständen den Kampf gegen, ja, sogar den Mord des Fürsten rechtfertigten. Damit glauben wir den ängstlichen Gemütern Genüge getan zu haben, die bei dem Gedanken schaudern, daß aus der notgedrungenen Abwehr der unterdrückten Klassen gegen die hier theoretisch vorausgesetzte gewaltsame Widerstandsaktion der bedrohten Oberklasse Gewalttätigkeiten hervorgehen könnten. „Wo die Arzenei nicht hilft, hilft das Eisen, wo das Eisen nicht hilft, das Feuer“, lautet ein alter Ärztespruch.
Die Juristen zerbrechen sich den Kopf darüber, ob es „ein Recht zur Revolution“ geben könne [2]. Selbstverständlich kann es ein positives Recht dieses Inhalts nur dort geben, wo es ausdrücklich in der Verfassung verbrieft ist, wie etwa in der „Joyeuse Entrée“ oder der Verfassung der Aragonier [3]. Aber ein solches Recht hebt die Souveränität des Staates auf und ist unpraktisch, weil es darauf „hinausläuft, daß jeder Untertan in seinem Gewissen der Souverän ist über die Obrigkeit“ [4].
[1] Politik, 1, S. 131/3.
[2] „Das Recht der Revolution sanktioniert zugleich das Recht der Gegenrevolution, wie das Recht der Autokratie zugleich das Recht der siegreichen Revolution sanktioniert... Derselbe Zweck wäre bald Recht bald Unrecht, je nach der Machtstellung der Partei, die ihn verfolgt. . . . Statt der Diktatur des Rechts, die den Despotismus ablöst, um dem Rechtsstaat Bahn zu brechen, erhalten wir das Recht der Diktatur, das den Rechtsstaat vereitelt und den Despotismus verewigt“. (Nelson, phil. Rechtslehre u. Politik, S. 572/74.)
[3] Nach Bury (a. a. O. S. uff.) besaßen die Römer das positive Widerstandsrecht gegenüber den Kaisern: sie hatten das Recht der Wahl und mit ihm auch das der Absetzung.
[4] Treitschke, a. a. O. I, S. 196.
[724]
Das ist praktisch unmöglich : denn, wie Burke einmal sagte, Medizin ist zwar zuweilen nötig, darf aber nicht als tägliches Brot gebraucht werden [1]. Keine Verfassung des neunzehnten Jahrhunderts gewährt mehr ein Widerstandsrecht, seit man mit dem Paragraphen der französischen Konventsverfassung schlimme Erfahrungen gemacht hatte: „Wenn die Regierung die Rechte des Volkes verletzt, so ist der Aufruhr für das Volk und für jeden Teil des Volkes das heiligste Recht und die unumgänglichste Pflicht“. Jedem der dreißig Millionen Franzosen wird also ein Richteramt darüber zugeschrieben, ob die Obrigkeit die Rechte des Volkes verletzt hat, sagt Treitschke spöttisch dazu.
Man kann das auch so ausdrücken, daß kein Staat in seine Verfassung Normen aufnehmen kann, die zu seiner „Ursprungsnorm“ im Widerspruch stehen.
Schmitt-Dorotic hat in geistreicher Weise die hier entstehenden juristischen Schwierigkeiten zu lösen versucht: durch seine Analyse der souveränen Diktatur: „Die souveräne Diktatur sieht... in der gesamten bestehenden Ordnung den Zustand, den sie durch ihre Aktion beseitigen will. Sie suspendiert nicht eine bestehende Verfassung kraft eines in dieser begründeten, also verfassungsmäßigen Rechts, sondern sucht einen Zustand zu schaffen, um eine Verfassung zu ermöglichen, die sie als wahre Verfassung ansieht. Sie beruft sich nicht auf eine bestehende, sondern auf eine herbeizuführende Verfassung. Man sollte glauben, ein solches Unternehmen entzöge sich jeder rechtlichen Betrachtung. Denn der Staat kann rechtlich nur in seiner Verfassung begriffen werden, und die totale Negation der bestehenden Verfassung müßte eigentlich auf jede rechtliche Begründung verzichten. . . . Demnach würde es sich um eine bloße Machtfrage handeln. Das ist aber dann nicht der Fall, wenn eine Gewalt angenommen wird, die, ohne selbst verfassungsmäßig konstituiert zu sein, trotzdem mit jeder bestehenden Verfassung in einem solchen Zusammenhang steht, daß sie als die begründende Gewalt erscheint, auch wenn sie selbst niemals von ihr erfaßt wird, so daß sie infolgedessen auch nicht dadurch negiert werden kann, daß die bestehende Verfassung sie etwa negiert. Das ist der Sinn des Pouvoir constituant“ [2]. „Die Vorstellung des Verhältnisses von pouvoir constituant zu pouvoir constitué hat ihre . . . Analogie in der Vorstellung des Verhältnisses der natura naturans zur natura naturata. . . . Das Volk, die Nation, die Urkraft alles staatlichen Wesens, konstituiert immer neue Organe. . . . Sie konstituiert niemals sich selbst, sondern immer nur einen Andern. Ihre Beziehung zu dem konstituierten Organ ist daher keine gegenseitige Rechtsbeziehung. Die Nation ist immer im Naturzustande, lautet ein berühmter Ausspruch von Sieyès“
[1] Nach Lord, a. a. O. S. 59/60. Vgl. Laski, a. a. O. S. 51.
[2] Die Diktatur, S. 137.
[725]
(S. 142/3). „Das formale Merkmal (der Rechtmäßigkeit) liegt in der Ermächtigung einer höchsten Autorität, die rechtlich imstande ist, das Recht aufzuheben und eine Diktatur zu autorisieren“ (S. IX).
Wir müssen es den Juristen überlassen, ob sie sich mit dieser geistvollen Lösung für befriedigt erklären wollen und können oder nicht. Uns ist auch diese juristische Streitfrage ohne Bedeutung. Wir fragen nach dem „Recht, das mit uns geboren ist“, nicht nach jenem anderen, das „sich wie eine ewige Krankheit fortschleppt und aus Vernunft zu Unsinn, aus Wohltat zu Plage geworden ist“. Der große Deutsche, der das schrieb, hat zwar die französische Revolution zuerst abgelehnt, aber später zu Eckermann gesagt, er habe kein Freund dieser Umwälzung sein können, weil ihm ihre Greuel zu nahe gestanden hätten, während ihre wohltätigen Folgen damals noch nicht zu ersehen gewesen wären. Er sei aber schon damals vollkommen davon überzeugt gewesen, „daß irgendeine große Revolution nie Schuld des Volkes ist, sondern der Regierung. Revolutionen sind ganz unmöglich, sobald die Regierungen fortwährend gerecht und fortwährend wach sind, so daß sie ihnen durch zeitgemäße Verbesserungen entgegenkommen und sich nicht so lange sträuben, bis das Notwendige von unten her erzwungen wird“. Er wollte gegen die Revolutionen nicht die „Dummheit und die Finsternis zu Hilfe rufen, sondern den Verstand und das Licht“ und brach einmal gegen den Vergangenheitskultus „mit Heftigkeit“ in die Worte aus: „Ich statuiere keine Erinnerung in eurem Sinne . . ., es gibt kein Vergangenes, das man zurücksehnen könnte, es gibt nur ein Neues, das sich aus den erweiterten Elementen des Vergangenen gestaltet, und die echte Sehnsucht muß stets produktiv sein, ein neues Besseres erschaffen [1]“.
In diesem Geiste der echten Sehnsucht nach dem neuen Besseren rufen auch wir gegen Dummheit und Finsternis das Licht und den Verstand zu Hilfe und fragen wenig, ob sich eine juristische Rechtfertigung dafür finden läßt, wenn sich die Unterdrückten ihr Recht holen, das „unverlierbar an den ewigen Sternen hängt“. Sogar ein Treitschke sagt: „Es gibt große sittliche Güter der Menschheit, die so hoch stehen, daß ihnen gegenüber die Rechtsordnung des Staates gering erscheinen kann; es können Bürger sich gedrungen fühlen, vor allem um ihres Glaubens willen, die bestehende Rechtsobrigkeit zu verwerfen und eine Revolution zu wagen“. Mag daraus in der Tat „nie ein Recht werden [2]“ : Treitschke selbst erkennt an, daß „man die niederländischen Rebellen und viele andere historisch rechtfertigen kann“.
[1] Nach einer Zusammenstellung in der Frankfurter Zeitung, in der der Versuch des Professors Röthe abgewiesen wird, Goethe für die deutsch-nationale Weltanschauung in Beschlag zu nehmen.
[2] A. a. O. I, S. 198.
[726]
Siebenter Abschnitt.
Die klassenlose Gesellschaft. ↩
I. Die Utopie. ↩
Wir werden jetzt daran gehen, die klassenlose Gesellschaft der Zukunft in ihren Hauptzügen zu zeichnen.
Der Leser denkt selbstverständlich: „Utopie!“ Versuchen wir, uns zu verständigen.
Ein Utopist ist jemand, der eine unmögliche Gesellschaftsordnung für möglich hält. Nun hält aber jeder Lebende, mit der einzigen Ausnahme der winzigen Schar, die auf unserem Standpunkt steht, eine von zwei Gesellschaftsordnungen für möglich: die kapitalistische oder die kommunistische. Da wir bereits nachgewiesen haben, daß beide unmöglich sind, so sind unsere Gegner sämtlich — Utopisten.
Was zunächst die Gläubigen der kapitalistischen Gesellschaftsordnung angeht, so haben wir geschrieben [1]:
„Wenn derjenige mit Recht Utopist gescholten wird, der eine unmögliche Wirtschaftsordnung für möglich hält, dann ist jeder Gläubige der kapitalistischen Ordnung ein Utopist. Sie ist ein Turmbau von Babel, errichtet auf schwankendem Grunde von schlecht beratenen Baumeistern aus Baustoffen, die unter ihrem eigenen Gewicht zusammenbrechen müssen; und sie muß daher um so gewisser und furchtbarer einstürzen, je höher sich ihre Stockwerke auftürmen. Es ist wahr, sie hat mehr Reichtum geschaffen als alle Wirtschaftsperioden vorher zusammen: aber sie muß in Krisen münden, die immer mehr als diesen Reichtum wieder verschlingen. — Es ist wahr, sie hat Lebensraum für mehr Menschen geschaffen, als jemals zuvor in den Ländern ihrer Herrschaft gelebt haben: aber sie muß verhängnisvollerweise nebenher Kräfte der Vernichtung entfesseln, die in grauenhafteren Katastrophen, als jemals die schwerste Sturmflut oder der fürchterlichste Vulkanausbruch herbeiführten, ungezählte Millionen unschuldiger Opfer dem gräßlichsten Tode ausliefern. — Und es ist schließlich wahr, sie hat durch die Herstellung der Internationalwirtschaft mehr dafür geleistet, die Völker zu verbinden und zum gegenseitigen Verständnis zu bringen
[1] Kapitalismus, Kommunismus usw., S. 1/2.
[727]
als irgendeine Periode vor ihr : aber sie muß verhängnisvollerweise diese gleichen Völker in Kriegen von beispielloser Dauer, Wut und Zerstörung gegeneinander hetzen und sich aneinander verbluten lassen“.
Dies also den bürgerlichen Kritikern ins Stammbuch, die die klassenlose Gesellschaft als Utopie bezeichnen werden, während sie selbst Anhänger der wildesten aller Utopien sind. Den kommunistischen Kritikern aber, die ganz sicherlich den gleichen Vorwurf gegen uns erheben werden, erwidern wir lächelnd : „Quis tulerit Grachos de seditione ferentes?“
Ihnen gegenüber haben wir noch stärkere Argumente als gegen ihre kapitalistischen Gegner.
Karl Marx hat in meisterhafter Weise den Begriff der Utopie bestimmt. Utopist ist, wer eine Gesellschaftsordnung aus dem Kopfe erfindet. Wissenschaftlicher Sozialist ist dagegen, wer sie mittels des Kopfes aus der Entwicklungstendenz der kapitalistischen Wirtschaft selbst, aus ihrem „Bewegungsgesetz“ entdeckt.
Mithin ist seiner eigenen Feststellung nach aller vormarxische Kommunismus utopisch. Er war in der Tat nichts anderes als das photographische Negativ des Kapitalismus, gebildet durch die bekannte „Imitation par opposition“ [1]: er war vor Marx der von allen Geistmenschen und Sachkennern, z. B. von Lorenz Stein [2], und Proudhon [3], aufs tiefste verachtete Sozialismus der ungebildeten Unterklasse, des Handwerksburschen. Erst Marx erhob den Kommunismus (in seiner gemäßigten Gestalt als Kollektivismus) zum wissenschaftlichen System, indem er die Tendenz der Entwicklung festzustellen sich bemühte. Aber er hat das Problem nur endgültig gestellt, aber nicht gelöst; das wurde oben bereits gezeigt, und wir können hier nicht noch einmal darauf zurückkommen. Was uns hier interessiert, ist, daß heute selbst seine vermeintlich treuesten Anhänger, die Bolschewisten, reuig „von der Wissenschaft zur Utopie“ zurückgekehrt sind. Sie haben nicht abgewartet, bis im Schöße der kapitalistischen Gesellschaft die neue sozialistische Ordnung zur vollen Reife gediehen ist, sondern sie haben in dem industriell rückständigsten der europäischen Länder, in Rußland, wo von solcher Reife nicht im entferntesten die Rede sein konnte, die Gewalt nicht als „Geburtshelferin“ gebraucht (was Marx als das äußerste zuließ), sondern sie haben die Gewalt angewendet, um eine „aus dem
[1] S. S. III, S. 193, vgl. oben S. 158.
[2] Geschichte der sozialen Bewegung I, S. 114: „Der Kommunismus ist daher in allen seinen Formen das erste roheste System der sozialen Idee der Gleichheit“. . . .
[3] „Die Kommunisten hocken nebeneinander, bewegungs- und gefühlslos, angewachsen wie Austern auf dem Felsen der Brüderlichkeit“ (zit. nach Antonelli, a. a. O. S.201.) „Hinweg von mir, Kommunisten! Eure Gegenwart ist mir ein Gestank und euer Anblick ein Ekel“ (zit. nach Gide und Rist, 3. deutsche Ausg., S. 320).
[728]
Kopf erfundene“ neue Gesellschaft auf den Trümmern der alten zu errichten; die ganze Aktion hätte, um im Bilde zu bleiben, mit einer blutigen Fehlgeburt nicht nur begonnen, was der Fall war, sondern auch geendet, wenn sie nicht wider Willen das einzige getan hätten, was zu tun war: Bauernpolitik! Jetzt scheint die Politik der Sowjets, entgegen ihrer Theorie, immer weiter und weiter zu der einzig möglichen Praxis gedrängt zu werden, zur Entfesselung des natürlichen Lebens jeder höher entfalteten Wirtschaftsgesellschaft : des Wettbewerbs. Und so wäre denn auf einem ungeheuren Umwege, mit fürchterlichen Opfern an Gut und Blut, schließlich gar nichts anderes geschehen, als was mit den geringsten Opfern und schnellstem Erfolge sofort hätte geschehen können: die Ausführung des von uns seit nahezu 30 Jahren in jeder Einzelheit entwickelten Aktionsprogramms der revolutionären Bauernpolitik.
Daß diese unsere Politik an sich utopisch sei, das heißt, daß sie, zunächst einmal abgesehen von ihrer Wirksamkeit und ihrer Tauglichkeit zur Erreichung des Endziels, unmöglich durchgeführt werden könne, wird niemand behaupten wollen. Selbstverständlich ist es möglich, das private Großgrundeigentum, z. B. durch freihändigen Aufkauf oder durch legale Expropriation mit Entschädigung, in den Besitz der Gemeinschaft zu bringen. Es würde in Deutschland z. B. beträchtlich weniger an Geldaufwendung erfordern, als seinerzeit die Verstaatlichung der Eisenbahnen. Und auch der einzige, an sich bereits sehr fadenscheinige und verdächtige Einwand, der den Plänen radikaler Bauernkolonisation entgegengestellt worden ist, trifft unsere Vorschläge durchaus nicht: wenn es wahr sein sollte, daß eine gewisse Mischung von Groß-, Mittel- und Kleinbetrieben das für die Landeskultur günstigste System der Verteilung ist, so haben wir erstens niemals die Expropriation sämtlicher Großbetriebe verlangt und haben zweitens selbst vorgeschlagen, eine Anzahl von Großbetrieben als Genossenschaftswirtschaften wenigstens vorläufig bestehen zu lassen. Man soll sich doch nicht so stellen, als glaube man, Großbetrieb sei nur im Großbesitz möglich! Jede Domäne beweist das Gegenteil.
Soviel vom Mittel. Was nun aber das Ziel anlangt, so ist sich alle Welt bis in die äußerste revolutionäre Linke hinein darüber einig, daß die kommunistische Revolution der Zukunft unendlich viel schwerer durchzuführen sein wird als die politische Revolution der Vergangenheit, wie sie 1648 England und 1789 Frankreich erlebt haben. Und zwar, weil es sich damals nur um die negative Aufgabe handelte, gewisse Institute abzubauen: das absolute Königtum, die Privilegien der Stände usw. ; — während es sich jetzt, positiv, darum handeln soll, etwas ganz Neues aufzubauen. Schon in dieser Zielsetzung wird ganz richtig die Utopie erblickt, denn eine Gesellschaft ist nun einmal ein kollektiver Organis-
[729]
mus, und den kann man nicht machen: den kann man nur nach seinen eigenen Gesetzen sich entwickeln lassen und nur dadurch unterstützen, daß man ihm hilft, Hemmungen aus dem Wege zu räumen.
Nun, auch von diesem Gesichtspunkt aus enthält unser Vorschlag nicht einen Deut von Utopismus [1]. Auch wir wollen nicht auf-, sondern abbauen, wollen das Werk der großen politischen Revolution nur vollenden, indem wir die letzte, bisher, weil ökonomisch maskiert, unerkannte feudale Machtposition ihren Geschwistern in den Orkus nachsenden. Dann, so behaupten wir, wird der von seiner letzten Hemmung befreite soziale Organismus aus eigenen Kräften den Zustand seiner Gesundheit, den Consensus erreichen.
Nun könnte die Utopie auch in diesem Glauben gesehen werden, daß es einen Consensus überhaupt geben könne. Wir haben den entgegengesetzten Glauben an die ewige Notwendigkeit des Dissensus als den Schluß aus einer, allen unseren Gegnern gemeinsamen, vollkommen haltlosen, durch nichts substantiierten Prämisse erwiesen: dem Pseudo- gesetz der ursprünglichen Akkumulation. Unsere Gegner werden ihre Lehrmeinung neu zu begründen haben — wenn es ihnen möglich sein wird. Wir werden nämlich eine Anzahl gut verbürgter Tatsachen anzuführen haben, die diese „Utopie als Wirklichkeit“ erhärten.
Aber, selbst wenn wir jene verhängnisvolle Prämisse nicht zerstört hätten; — selbst wenn wir jene Tatsachen nicht zur Verfügung hätten: unsere Gegner haben unserer angeblichen Utopie nur ihre, wie soeben gezeigt, sozusagen gerichtskundige Utopie entgegenzustellen. Wenn sowohl der Kapitalismus wie der Kommunismus unmögliche Gesellschaftsordnungen sind, und wenn auch ihre Synthese, die Freibürgerschaft, die die Freiheit des Liberalismus und die Gleichheit des Kommunismus vereint, indem sie ihre Gegensätze in jenem dreifachen Sinne Hegels „aufhebt“ : wenn auch diese letzte, theoretisch mögliche Ordnung praktisch unmöglich sein soll, dann ist der Menschheit Geschick das der Verdammten im Tartarus.
Ist man unter diesen Umständen nicht verpflichtet, den einzigen theoretisch möglichen Ausweg wenigstens zu versuchen? Wenn das „utopistisch“ ist, so gibt es keinen größeren Ehrentitel als den des Utopisten [2]. Wir haben in der Einleitung zur zweiten Auflage unserer Siedlungsgenossenschaft (Seite XIII/XIV) folgendes geschrieben:
[1] Wir brauchen Sorels „Soziale Mythe“ nicht, „in der sich die stärksten Tendenzen des zeitgenössischen Gedankens finden, die sich dem Geiste mit der Kraft von Instinkten aufdrängen und Hoffnungen einer nahen Aktion das Antlitz voller Wirklichkeit verleihen“ (nach Antonelli, a. a. O. S. 41).
[2] Nelson schreibt (Phil. Politik S. 550) : „Das Ideal des gesicherten Rechtszustandes ist nicht der Gegenstand einer Prophezeiung für den Geschichtsforscher, sondern es ist der Gegenstand einer Aufgabe für den Politiker“. Und die ist nur auf dem „Umwege über die Eroberung der politischen Macht“ zu lösen (S. 299).
[730]
„Ich scheue den Titel nicht [1]. Alle Wirklichkeit ist die Utopie von gestern. Wir leben in lauter verwirklichten Utopien: Deutschlands Einigung war eine Utopie, deren Gläubige nicht nur verspottet, sondern gar ins Zuchthaus gesteckt wurden. Den Anhängern Malthus' galt es als eine Utopie, daß die Lebensmittel schneller vermehrt werden könnten, als die Volkszahl wachse (wie schwarz sah Gustav Rümelin noch 1881 in die allernächste Zukunft !) — und wir produzieren heute pro Kopf der so sehr vermehrten Bevölkerung viel mehr Lebensmittel als damals, und Niemand zweifelt, daß wir noch viel mehr produzieren könnten, wenn die Preise höher wären. Wir leben in lauter verwirklichten Utopien: alle Wunder aus Tausend und einer Nacht sind uns zur Wahrheit geworden. Wir senden unsere Botschaften im Gedankenblitze um die Erde, wir fahren dahin schneller als die Windsbraut, der Pflug zieht seine Furchen ohne den Stier, und das Weberschiffchen fliegt durch die Fäden ohne den Weber. Die Sonne malt uns farbige Bilder, und wir sehen lange Verstorbene sich vor uns bewegen und hören sie zu uns sprechen; wir fahren im Schiff gegen den Wind und fliegen wie der Adler in den Lüften. Alle Welt hat Zeppelin als „Utopisten“ verlacht: als aber sein Luftkreuzer dennoch flog, da erhoben ihn die gleichen Leute zum Nationalheros und forderten fast allen seinen Ruhm für sich, als hätten sie ihm geholfen oder doch wenigstens vertraut. Ich habe in der ersten Auflage dieses Buches (S. 419/420) meinen Glauben an diese „Utopie“ ausgesprochen: weniger als ein halbes Menschenalter hat genügt, sie zu verwirklichen; und auch die zweite, an der gleichen Stelle erwähnte „Utopie“ von gestern ist die Wirklichkeit von heute: Peary hat vor Jahren bereits den Nordpol erreicht [2].
„Dürfen wir da nicht sagen, wir Kinder dieser großen gewaltigen Zeit, die alle Elemente bändigt, ist es zu kühn, wenn wir sagen: „Alle Utopie ist die Wirklichkeit von morgen!?“ Freilich, die „Realisten“ werden jeden Segler nach neuen Kontinenten nach wie vor verhöhnen, trotz der Erfahrung jedes Tages; aber das muß, und das kann man lächelnd ertragen“.
Aber dieser Schlag von Köpfchen beruft sich ja doch auf die Erfahrung? Dann berufen wir uns zunächst auf die oben (S. 50) angeführten Worte Kants: „Nichts kann schädlicheres und eines Philosophen unwürdigeres sein als die pöbelhafte Berufung auf vorgeblich
[1] Vgl. Rodbertus-Jagetzow: Das Kapital, S. 230. „Ich meine freilich, daß Theorie, Philosophie, Prophétie und Utopie nur die Meilensteine sind, die sich die soziale Idee in immer weiterer Zukunft und deshalb auch in immer nebelhafteren Umrissen selber setzt, und daß also eine sozialwissenschaftliche Auffassung, die gar nichts von Prophétie in sich trägt, auf sehr dürftigen Anschauungen beruht“.
[2] Seitdem wir dieses schrieben, sind allerdings starke Zweifel an Peary's Erfolg laut geworden — um uns sehr vorsichtig auszudrücken. Aber niemand zweifelt heute mehr daran, daß das Ziel bald erreicht werden wird.
[731]
widerstreitende Erfahrung, die doch gar nicht existieren würde, wenn jene Anstalten (der Staat) zur rechten Zeit nach den Ideen getroffen würden, und an deren Statt nicht rohe Begriffe, eben darum, weil sie aus der Erfahrung geschöpft werden, alle guten Absichten vereitelt hätten“ [1].
Außerdem : auf welche Erfahrung berufen sich denn diese Neunmalweisen ? Die menschliche Geschichte erstreckt sich ganz bestimmt über Zehntausende, höchst wahrscheinlich über Hunderttausende von Jahren. Die Vorgeschichte nimmt wenigstens 99/100 dieser Zeit ein: in ihr aber hat nach allem, was wir wissen, innerhalb der Gemeinschaften die Gerechtigkeit der Gleichheit gewirkt und dauernde Ausbeutung und Klassenbildung verhindert. Und ferner: freilich ist die eigentliche Weltgeschichte erfüllt von nicht endenden Kämpfen zwischen den Gemeinschaften, aber innerhalb der Gemeinschaften kennen wir auch in ihr die wirtschaftliche Ausbeutung des Menschen durch den Menschen nur aus zwei im Verhältnis winzigen Epochen : aus der kapitalistischen Sklavenwirtschaft des Altertums und aus der kapitalistischen Verkehrswirtschaft der Neuzeit.
Aber selbst wenn diese ungeheuren Tatsachenmassen nicht für uns sprächen, selbst wenn wir von Vorgeschichte und selbst von vorkapitalistischer Geschichte gar nichts wüßten : was würden denn diese Erfahrungen groß beweisen?
Eine Generation der Menschen rechnet etwa für einen Tag der Menschheit, so daß ein Jahrhundert etwa drei Menschheitstage umfaßt. Die Geschichte der westeuropäischen Menschheit ist etwa fünfzehnhundert Jahre alt, sie befindet sich also noch in ihrem frühesten Kindheitsalter. Der Schluß darauf, daß sie in alle Ewigkeit in dem gleichen Dissensus leben muß, in dem sie sich jetzt quält und vielleicht zugrunde gehen muß, ist gerade so begründet, wie es etwa die Ansicht einer jungen Mutter sein würde, daß sie ihren Sohn auch noch als Vierzigjährigen täglich siebenmal mit reinen Windeln werde versorgen müssen.
Unsere Voraussage, daß der Consensus, die klassenlose politische Gesellschaft, die ausbeutungsfreie Wirtschaftsgesellschaft, durch Bauernpolitik hergestellt werden kann, beruht auf breitester wissenschaftlich-logischer Grundlage. Wer die Prognose bestreiten will, muß sich schon dazu entschließen, unsere Beweise zu widerlegen, die von uns geordneten Tatsachen anders und glaubhafter zu ordnen, die von uns widerlegten Gesetze mit neuen Beweisen neu zu fundieren. Wer sich anstatt dessen damit begnügt, das Schlagwort von der „Utopie“ zu brauchen, der mag in dieser schlappen und gedankenlosen Zeit, in der die Skepsis auch dann als höchste Wissenschaftlichkeit gepriesen wird,
[1] Nelson spricht mit Recht (a. a. O. S. 599) von der „Verblendung, die der Gewaltpolitiker und der Autoritätspolitiker Menschenkenntnis nennen“.
[732]
wenn sie keinerlei wissenschaftliche Begründung hat, auf den Beifall des „Pöbels“ rechnen dürfen: vor dem Forum der Wissenschaft hat er keine Aussicht, seinen Prozeß zu gewinnen.
II. Der Consensus. ↩
Die Lehre vom Consensus ist aus zwei verschiedenen Wurzeln gewachsen. Die eine entstammt der naturwissenschaftlichen Anschauung eines hervorragenden Arztes: Bernard de Mandeville. Der Arzt steht täglich vor dem staunenswerten Schauspiel, daß jede einzelne Zelle des menschlichen Körpers aus dem allgemeinen Nahrungssaftstrom ohne jede Rücksicht auf die anderen an sich rafft, was sie braucht, und ebenso rücksichtslos die Abfallstoffe in den allgemeinen Strom zurücksendet, und daß trotzdem normalerweise die Gesamtfunktion in voller Harmonie abläuft. In einer Zeit, in der der Egoismus auch da noch als Sünde galt (katholisch-kanonische Auffassung), wo er keinen Schaden stiftet, wandte Mandeville in seiner berühmten Bienenfabel diese Konzeption zuerst auf die menschliche Gesellschaft an und kam von hier aus zu der paradoxen Anschauung, daß „private Laster öffentliche Tugenden sind“. Er schreibt [1]: „Ich beschreibe, was die Folge von allgemeiner Redlichkeit und Tugend, von Mäßigkeit, Unschuld und Zufriedenheit des ganzen Volkes sein würde, und beweise dadurch, daß — wenn die Menschheit von den ihr nun einmal anhaftenden Schwächen geheilt werden könnte — daß sie dann auch nicht mehr solche umfangreichen, mächtigen und hochkultivierten Gemeinschaften würde bilden können, wie sie dies in den verschiedenen großen Republiken und Monarchien seit der Welt Beginn getan hat“.
Und an anderer Stelle [2]: „Nun ist aber jedenfalls der Mensch ein außerordentlich selbstsüchtiges und widerspenstiges sowie auch schlaues Tier. Wie sehr er sich daher sonst auch mag überlegener Stärke unterwerfen müssen: es ist doch unmöglich, ihm mit Gewalt allein beizukommen und all die Vervollkommnung, deren er fähig ist, angedeihen zu lassen“ ; und schließlich [3]: „Ich beabsichtige nunmehr, das Wesen der Gesellschaft zu erforschen und durch Zurückgehen auf ihre ersten Anfänge zu beweisen, daß nicht die guten und liebenswerten, sondern die schlechten und allgemein verabscheuten Eigenschaften des Menschen, seine Unvollkommenheiten und der Mangel an Vorzügen, die anderen Geschöpfen zukommen, daß diese die ersten Ursachen gewesen sind, die den Menschen nach dem Sündenfall mehr als andere Tiere zu einem geselligen Wesen gemacht haben, und, falls er seine ursprüngliche Unschuld be-
[1] Mandeville, Bienenfabel, S. 6.
[2] Mandeville, Bienenfabel, S. 27.
[3] Ebenda, S. 309.
[733]
halten und deren selige Freuden weiter genossen hätte, daß dann seine Umwandlung in ein solches geselliges Wesen, wie er gegenwärtig eines ist, außerhalb des Bereiches aller Wahrscheinlichkeit gelegen haben würde“.
Mandeville hat auf die folgende Generation außerordentlich tiefen Einfluß ausgeübt, und zwar nicht nur durch die Kraft seiner sachlichen Gründe, die um so stärker wirkten, als sie in der anmutigsten und witzigsten Form vorgetragen wurden, sondern auch deswegen, weil sie gewaltigen geistigen Strömungen der Zeit entgegenkamen. Zunächst haben namentlich die englischen Moral-Philosophen, allen voran Cumberland und Shaftesbury, aus der großbürgerlichen Psychologie heraus den wirtschaftlichen „Egoismus“, das Selbstinteresse, das sich in seinen Schranken hält, als eine nicht nur nicht unsittliche, sondern geradezu sittliche Kraft anzusehen gelehrt ; vor allem aber traf die ganze Stimmung jener Zeit, traf der hohe Optimismus einer schnell und hoch aufsteigenden Klasse mit einer nahe verwandten antiken philosophischen Auffassung zusammen: der Stoa. Ihr ist ja, wie wir sahen, die Harmonie geradezu das Grundgesetz der Welt. Das ist die zweite Wurzel der Lehre vom Consensus oder, wie sie in jener Zeit am liebsten genannt wird: von der „Harmonie aller Interessen“. Aus beiden Wurzeln zusammen entsprießt der Deismus, den wir kennen, der die Welt als ein vollkommenes, sich selbst regulierendes Kunstwerk des großen transzendenten Mechanikers betrachtet.
Das ist die Weltanschauung, aus der heraus Quesnay und Smith das Problem stellten und zu lösen suchten, und ganz so dachten alle bedeutenderen Köpfe der Zeit. Wir geben nur zwei Belege: den einen aus Anderson [1] :
„Diese Einrichtung ist also nur das Resultat jener Harmonien in der Natur, welche nach dem Plane des höchsten Wesens allgemein aus den Wirkungen des Prinzips der Selbstliebe oder des von Gerechtigkeit geleiteten persönlichen Interesses entstehen sollten. Dieses treibende Prinzip der Selbstliebe, welches allgemein alle menschlichen Wesen beeinflußt, ist so beständig wach und so sehr genau in allem, was es durchforscht, daß nicht der geringste Umstand seiner Beobachtung entgehen kann, und es ist so fruchtbar in seinen Hilfsmitteln, daß es sich dem geringsten Wechsel der Umstände sofort in der geeignetsten Weise anpaßt. Es beachtet weder die Vergangenheit, noch die Zukunft, sondern lediglich die Gegenwart, so daß das geringste seine Absichten kreuzende Hemmnis, welches aus Einrichtungen der Vergangenheit herrührt, die nicht mehr mit dem gegenwärtigen Stand der Dinge übereinstimmen, sofort beseitigt wird, und Vollkommenheit für die Gegen-
[1] Anderson, Drei Schriften über Korngesetze und Grundrente, herausg. v. Lujo Brentano, S. 177/8.
[734]
wart, insofern die Veränderung der menschlichen Angelegenheiten und die Schwäche der menschlichen Fähigkeiten sie zulassen wird, ist die notwendige Folge davon.
„Die nie aufhörende Wirkung dieses Prinzips, das in vielen Millionen menschlicher Wesen tätig ist, bewirkt in einer Weise, die von denen, für welche sie heilbringend sein soll, gar nicht bemerkt wird, mit größter Leichtigkeit und Regelmäßigkeit Dinge, welche auch nur unvollkommen zu verstehen die stolzesten Anstrengungen des menschlichen Geistes weit übersteigen würde. . . . Auch könnte ein Gesetz, welches menschliche Weisheit erdachte, um Personen in dieser Hinsicht einzuschränken, und um sie zu zwingen, nach irgend einer vorgeschriebenen Regel zu handeln, nichts anderes als eine Störung dieser natürlichen Harmonie und Elend und Verwirrung hervorrufen, weil das Gesetz nicht jene häufigen Veränderungen zuläßt, welche der ewig wechselnde Zustand menschlicher Angelegenheiten unumgänglich notwendig macht [1]“.
Ähnlich schreibt von Thünen [2] : „Wir haben, um die Gestaltung des isolierten Staates zu entwickeln, keines anderen Prinzips als der Annahme, daß jeder sein eigenes Interesse richtig erkennt und danach handelt, bedurft [3]. Wie nun aus dem Zusammenwirken aller, von denen jeder seinen eigenen, richtig verstandenen Vorteil anstrebt, die Gesetze, wonach die Gesamtheit handelt, hervorgehen, so muß wiederum in der Befolgung dieser Gesetze der Vorteil der Einzelnen enthalten sein. Während der Mensch nur seinen eigenen Vorteil zu verfolgen wähnt, ist er das Werkzeug in der Hand einer höheren Macht und arbeitet, ihm selbst oft unbewußt, an dem großen und künstlichen Bau des Staates und der bürgerlichen Gesellschaft; und die Werke, die die Menschen, als Gesamtheit betrachtet, hervorbringen und schaffen, sowie die Gesetze, wonach sie dabei verfahren, sind gewiß nicht weniger der Bewunderung würdig als die Erscheinungen und Gesetze der physischen Welt“.
Von hier aus ergab sich ohne weiteres der prinzipiell richtige Weg zur Herstellung der Normalität. August Oncken [4] sagt über d'Argenson folgendes: „Er fügt hinzu, der Instinkt der Biene richte hier mehr aus als das Genie des größten Staatsmannes. Nichts weiter brauchten Handel und Gewerbe, als daß man ihnen die Hindernisse aus dem Wege räume (le retranchement des obstacles est tout ce qu'il faut au commerce).
[1] Brentano bemerkt in seiner Einleitung zu den Schriften Andersons (S. XXXII). „Auch entspricht sein Lobgesang auf die vollkommene Harmonie der Interessen Aller und die Verwirklichung des größtmöglichen Wohls des Ganzen durch ungestörtes Verfolgen des Selbstinteresses jedes Einzelnen völlig der Lehre der Stoiker von der vollkommenen Harmonie von Natur und Vernunft, aus der auch die Werke A. Smiths und samtlicher Hassischen Nationalökonomen hervorgegangen“.
[2] Thünen, Isolierter Staat, I, S. 327.
[3] Hier ist die Methode der Klassiker in kürzester Formel dargestellt.
[4] August Oncken, Gesch. d. Nationalökonomie I, S. 274/5.
[735]
Sobald das Schlechte beseitigt ist, sprießt das Gute von selbst hervor. Von Seiten des Staates bedürfe es einzig „guter Richter, Unterdrückung der Monopole, eines für alle Einwohner gleichen Schutzes, unveränderlicher Münzen, Wege, Kanäle, par delà ces articles les autres soins sont vicieux“.
Prinzipiell ist die Lösung gegeben. Es fehlt d'Argenson, wie Smith, Carey, Bastiat und so vielen anderen nichts als die Erkenntnis, daß die Bodensperre ein Monopolverhältnis begründet und daher mit den übrigen Monopolen zusammen abgebaut werden muß. Wie Oncken feststellt [1], haben sich die ersten Physiokraten um die feudalen Lasten nicht viel gekümmert. Erst bei Letrosne beginnt sehr zaghaft die Kritik des Eigentums einzusetzen, die, fügen wir hinzu, dann St. Simon und seine Schüler weiterführten.
Soviel für die praktische Auswirkung dieser Vorstellung. Was die Theorie anlangt, so hat Kant namentlich von Mandeville her das Stichwort zu seiner grundlegenden Auffassung erhalten, die wir (S. S. I, S. 1062) ausführlich zitiert haben.
Gumplowicz [2] stellt diese Kantsche Auffassung folgendermaßen dar : „Alle menschlichen Handlungen, also auch die Geschichte im ganzen ist „nach allgemeinen Naturgesetzen bestimmt“. Diesen Gesetzen liegt offenbar eine „Naturabsicht“ zugrunde. Denn die „Naturanlagen jedes Geschöpfes“ sind doch offenbar dazu da, um sich zweckmäßig „auszuwickeln“, wenn nicht im Individuum, so doch in der Gattung. Beim Menschen ist es also offenbar die Vernunft, welche sich in der Gattung nach der Naturabsicht vollständig entwickeln müsse. Wie stellt nun die Natur es an, um diese ihre Absicht zu verwirklichen ? „Das Mittel, dessen sich die Natur bedient, die Entwicklung aller ihrer (d i. der Menschen) Anlagen zustande zu bringen, ist der Antagonismus derselben (d. i. der Menschen) in der Gesellschaft. ...“ Die Erreichung aber dieses Zweckes ist das „größte Problem für die Menschengattung, zu dessen Auflösung die Natur ihn (den Menschen) zwingt“. Behufs „Auflösung dieses Problems“ aber ist die „Erreichung einer vollkommen gerechten bürgerlichen Verfassung“ nötig, denn nur in einer solchen Verfassung kann die Natur ihren „obersten“ Zweck erreichen, nämlich „alle Anlagen in der Menschheit vollkommen entwickeln“. Verhält sich aber die Sache so, dann muß es möglich sein, eine „Weltgeschichte abzufassen, daß die allmähliche Verwirklichung dieser Naturabsicht dabei klar hervortrete.“ Eine solche Weltgeschichte werde einmal ein Historiker- Newton verfassen“.
In weiterer Folge kommt dann von hier aus Hegel zu seiner Kon-
[1] A. a. O. S. 474/5.
[2] Die soziologische Staatsidee, S. 81.
[736]
zeption von der „List der Idee“ oder, wie man heute gerne sagt, der „Heterogeneität der Zwecke [1]“.
Solange das Bürgertum an diesen großartigen Mechanismus glaubte, war es, wie schon oben gesagt, optimistisch. Von dem Augenblick, wo dieser Glauben verloren ging, schlug die bürgerliche Soziologie ins Pessimistische um [2], entstand die „dismal science“. Wir haben die Gründe aufgeführt, aus denen jener Glaube schwand, und haben sie als vollkommen falsch widerlegt. Damit ist der Glaube wieder begründet, und der Optimismus kann den Platz des Pessimismus wieder einnehmen. Einzelne Soziologen haben den Glauben nie verloren. Zu ihnen gehört Izoulet [3] : „Wissen die Bürger einer Gemeinde, daß sie sich gegenseitig helfen: entwickeln, ja geradezu erschaffen? Nicht im mindesten! Sind sie geneigt, sich gegenseitig zu lieben? Du lieber Gott, es muß heißen: sich gegenseitig die Gurgeln abzuschneiden! Und dennoch: die menschliche Gemeinschaft flicht sieht, gründet sich, vertieft sich, festigt und ordnet sich immer dauerhafter. Ja, die Genossenschaft knüpft sich immer inniger und enger gerade zwischen einander widerstrebenden Individuen. Die Einigkeit baut sich auf Uneinigkeit, die Sympathie auf Antipathien auf“.
Alle die genannten Denker haben die klar von ihnen gestellte Aufgabe nicht zu lösen vermocht, weil auch sie, im Banne jenes Pseudogesetzes, von einer falschen Prämisse ausgehen. Wir, die wir von der richtig gestellten Prämisse ausgehen, werden bessere Aussicht haben, die Lösung zu erreichen.
Wir haben im dritten Bande dieses Systems (S. 199ff.) die allmähliche Entwicklung der gesellschaftsphysiologischen Theorie in Kürze dargestellt. Wir wollen sie hier in noch kürzeren Worten wiederholen und ein wenig ergänzen:
Seit Anbeginn der kapitalistischen Wirtschaft, und mithin seit den ersten Anfängen der mit ihr gleichzeitig entstandenen ökonomischen Theorie, haben ihre sämtlichen bedeutenden Vertreter nicht den mindesten Zweifel daran gehegt, erstens: daß diese Gesellschaft abnorm ist, und zweitens, daß es eine Norm gibt, die zu erreichen die Aufgabe des Staatsmannes und Volkswirtes großen Stils ist. In der ersten Periode der Neuzeit, als alle Wissenschaft, unter dem Einfluß der von Descartes ausgehenden mathematisch-mechanischen Grundauffassung, alle Dinge mit den Kategorien der mathematischen Mechanik deutete, wurde diese Norm dargestellt als ein „Gleichgewicht“. Der Gedanke beherrscht z. B. Harringtons und nach ihm Montesquieus politisches und später Sir James Steuarts ökonomisches System : ihnen allen kommt es darauf
[1] S. S. I, S. 389. Vgl. Metzger, a. a. O. S. 335.
[2] Vgl. Unsere „Wege zur Gemeinschaft“, S. 32, S. 42.
[3] A. a. O. S. 483/4.
[737]
an, die „ballance“ herzustellen, die einander widerstreitenden Kräfte der Gesellschaft derart auszubalancieren, daß das Gemeinwohl, die Norm, das „common-wealth“ sich einstellen muß [1].
Als dann die Wissenschaften vom organischen Leben sich mehr in den Vordergrund schoben, hat man an einen höheren Organismus gedacht, dessen ungestörte Gesamtfunktion Gesundheit heißt. Das war z. B. und vor allem die Auffassung des großen Arztes François Quesnay ; sein erstes Werk, eine Physiologie, nannte er charakteristischerweise „économie animale“. Dann schuf er das erste wirkliche System der Ökonomik, das er kontrastierend wohl als das „animal économique“ hätte bezeichnen dürfen. Auch so noch erhielt es in bewußtem Anklang an die Physiologie den Namen „Physiokratie“.
Hier stellt er sich die Aufgabe, die der Arzt sich überall zu stellen hat, wenn er einer Krankheit gegenübersteht, d. i. „dem Ablauf des Lebens unter abnormen Bedingungen“: volle letzte Erkenntnis der funktionalen Zusammenhänge, die die Norm herstellen und erhalten, und Ableitung der Abnormität aus ganz bestimmten äußeren Einwirkungen, die ein Organ und eine Funktion betreffen und von hier aus die Gesamtfunktion, den Consensus, ablenken und verzerren.
Er hat sein Ziel nicht erreichen können, zum Teil weil er aus seiner Klassenhaut nicht heraus konnte, mit anderen Worten, weil er seine persönliche Gleichung nicht kannte; vor allem aber, weil er die Methode noch nicht besaß, die allein zum Ziele führen kann: jene Methode, die wir oben ausführlich dargestellt und gegen die ihr gemachten Einwände gesichert haben.
Diese Methode gab der Wissenschaft erst sein großer Zeitgenosse und Nachfolger Adam Smith: die Deduktion der Normalität aus der einen und einzigen Prämisse des ökonomischen Prinzips. Er hat zuerst die Selbststeuerung der Gesellschaft durch die Konkurrenz in allen ihren Grundzügen erkannt und dargestellt und gesehen, daß sie, wenn ungestört, daraufhin tendiert, die Normalität, die „reine Wirtschaft“, herzustellen. Er wäre zum Ziele gelangt, wenn nicht auch ihn seine persönliche Gleichung verhindert hätte, die Störungen durch außerökonomische Gewalt korrekt in seine Rechnung einzustellen. Zwar hat er geradeso wie Quesnay mit voller Klarheit erkannt, daß es der Staat ist, der durch seine Eingriffe die Tendenz der Konkurrenz zur Herstellung der Gleichheit ablenkt und verzerrt : aber er beachtete gerade wie Quesnay nur die unmittelbaren Eingriffe der staatlichen Gesetz-
[1] Vgl. Schmitt-Dorotic, Die Diktatur, S. 102ff. „Das Bild von der Ballance wurde im 17. und 18. Jahrhundert für jede Art wahrer Harmonie (im Weltall, in der äußeren und inneren Politik, in der Moral und in der Nationalökonomie) verwertet. . .. Montesquieus Lehre von der sogenannten Teilung der Gewalten wird unverständlich, wenn man sich an das Wort von der Teilung oder Trennung statt an jenes Bild von der Ballance hält.“
[738]
gebung und Verwaltung in den Ablauf der Wirtschaft: die Grenzzölle, Taxen, Privilegien der Handelsgesellschaften usw., kurz das ganze Rüstzeug des Merkantilismus. Aber er sah so wenig wie Quesnay, daß die außerökonomische Gewalt längst in der Institution des Großgrundeigentums zum integrierenden Bestandteil der kapitalistischen Ordnung geworden war; oder mit anderen Worten: auch er glaubte, daß Geschichte gewesen sei, aber nicht fortwirke ; auch er war geblendet von dem Pseudogesetz der kapitalistischen Akkumulation.
Die volle Lösung des Problems konnte nur geschehen durch eine Kombination historischer mit ökonomischen Methoden. Von der historischen Seite aus hat St. Simon zuerst mit Erfolg diesen Weg betreten, indem er im großen Eigentum, namentlich dem großen Grundeigentum, jenes Element außerökonomischer Gewalt nachwies, das heute in ökonomischer Maske die causa morbi und zugleich die sedes mali ist.
Aber er und seine Schüler, die St. Simonisten Bazard und Enfantin, haben die Synthese ihrer historischen Anschauung mit der theoretischen Ökonomik, wie nach Smith vor allem Ricardo sie ausgestaltet hatte, kaum versucht. Auf diesem Wege weiter geschritten sind dann im deutschen Sprachbereich Eugen Dühring und Theodor Hertzka, ohne jedoch zum Ziele gelangen zu können, während auf der anderen Seite Karl Marx zu sehr Ricardianer und zu wenig St. Simonist war, um das von ihm klar gesteckte Ziel erreichen zu können: er blieb als Ricardianer immer im Banne der „Kinderfibel“. Immerhin haben diese gewaltigen Köpfe die Probleme so weit gefördert, daß nur noch ein einziger, verhältnismäßig kleiner Schritt zu tun war, den es uns gelungen ist, zu machen. In dem Augenblick, wo erkannt wurde, daß jene, ursprünglich von äußerer ökonomischer Gewalt geschaffenen Machtpositionen, die im Großeigentum wurzeln, echte Monopole und zwar Klassenmonopole sind, war der Weg zu jener überaus einfachen Lösung geöffnet, die wir oben in Kürze dargestellt haben.
Wir kennen jetzt die „Ballance“, den „Consensus“, die „Normalität“, die „Gesundheit“ der Gesellschaft: ihre Physiologie, vollkommen genau. Die von allen Resten der ursprünglich staatsbildenden Gewalt erlöste Gesellschaft ist zum ersten Male in aller Weltgeschichte die Gesellschaft der freien Konkurrenz. Denn hier zuerst gibt es kein Klassenmonopolverhältnis mehr, kein Einkaufsmonopol mehr, das den Besitzern von Produktionsmitteln in Stadt und Land ermöglicht, von den eigentumslosen „freien Arbeitern“ den Klassenmonopoltribut einzuziehen. Es gibt infolgedessen keine Ausbeutung mehr. Diese Gesellschaft ist die klassenlose Gesellschaft. Sie ist unter ökonomischem Aspekt die „Reine Wirtschaft“, unter politischem Aspekt die „Freibürgerschaft“.
[739]
Um die „Physiologie“ dieser, unseren Erfahrungen so fremdartigen, Gesellschaft zu bestimmen, dazu gehört freilich ein nicht geringes Vermögen wissenschaftlicher Phantasie.
Es handelt sich nämlich hier, um es zu wiederholen, um die Aufgabe, die regelmäßig der medizinischen Diagnostik gestellt ist: die Aufgabe, die sich auch Quesnay stellte. Es ist festzustellen, wie die Störung eines einzelnen Organs oder Organteils den Consensus der Gesamtfunktion in einem Prozesse stört, der funktional, d. h. nicht linear-kausal verläuft : eines Prozesses also, in dem die Folge immer wieder zur Ursache, und die Ursache immer wieder zur Folge wird, weil das Bestreben jedes lebendigen Organismus, seinen Lebensprozeß fortzusetzen, mit seiner Gesamtmacht, d. h. mit allen seinen Organen und ihren Funktionen geführt werden muß, um sich der Störung anzupassen und sie womöglich auszustoßen.
Um eine derartige, der wissenschaftlichen Phantasie gestellte Aufgabe zu lösen, bedarf es freilich gewisser unentbehrlicher Grundlagen :
Der Diagnostiker muß erstens die Physiologie des von ihm studierten Organismus bis ins Letzte kennen, muß wissen, wie sich der Consensus des nicht gestörten Organismus funktional in der Reziprozität der sich herüber und hinüber verschlingenden Ursachen und Wirkungen als dynamisches Gleichgewicht bildet ; und er muß zweitens wissen, wie eine Störung das zuerst betroffene Organ und seine Funktion betrifft, und wie sie von hier nach der Logik der Dinge weiterwirkt. Durch diese, auf wissenschaftlicher Logik und Erkenntnis sicli aufbauende, Phantasie unterscheidet sich der Arzt vom Kurpfuscher.
So muß auch der ökonomische Diagnostiker die Physiologie des sozialen Körpers in ihren funktionalen Zusammenhängen genau kennen, damit es ihm gelingen könne, die Diagnose der ihm vorliegenden Gesamtstörung zur letzten Vollendung zu führen, d. h. auch das letzte Symptom auf die causa morbi mit wissenschaftlicher Exaktheit („monistisch“) zurückzuführen.
III. Die reine Ökonomie. ↩
Die klassenlose Gesellschaft unterscheidet sich in ihrem äußerlichen Aufbau in fast nichts von der freien Verkehrsgesellschaft, in der wir zu leben gewohnt sind : sie ist eine um ihren Markt zentrierte hochentfaltete Wirtschaftsgesellschaft mit weit gestaffelter Arbeitsteilung und Vereinigung; ihre Gütererzeugung und Güterverteilung wird reguliert durch die Konkurrenz mittels frei sich bildender Preise, die in Geld ausgedrückt werden. Die Träger dieser Wirtschaft sind freie Individuen, die nur ihrem Selbstinteresse folgen. Es gibt Unternehmungen aller Art: Fabriken, Banken, landwirtschaftliche Großbetriebe, Handels-Unter-
[740]
nehmungen, Warenhäuser, neben denen mannichfaltige genossenschaftliche Verbände, und gewiß auch eine Anzahl von öffentlichen Unternehmungen des Staates und seiner Unterglieder bis herab zur Kommune stehen : Monopolverwaltungen und Eisenbahnen, Post- und Telegraphenverwaltung, vielleicht Telephonverwaltung usw. ; und es gibt Ausübende freier Berufe, die ihre Dienste zu Markte bringen, ganz wie heute. Nur eines gibt es nicht: das massenhafte Großgrundeigentum, das in seiner Gesamtheit die Bodensperre begründet.
Man wird nicht behaupten können, daß eine solche Gesellschaft unvorstellbar ist, und ebensowenig, daß sie der Psychologie des Menschen, wie wir ihn kennen, irgendwie widerspricht. Denn es gibt ja schon heute einzelne Länder, in denen das Bauerneigentum weit alles andere agrarische Eigentum überwiegt, ja solche, in denen überhaupt Großgrundeigentum so gut wie gar nicht vorkommt.
1. Die Theorie. ↩
Wir sind in der glücklichen Lage, bei der Darstellung der reinen Ökonomie uns auf eine Reihe von Tatsachen berufen zu können. Wir werden also auch hier wieder auf Grund der klassischen Methode zuerst theoretisch den Consensus entwickeln, wobei wir ihn fortwährend dem Dissensus der kapitalistischen Gesellschaftswirtschaft entgegenstellen werden, — und werden dann wieder zeigen, daß die Tatsachen völlig der Deduktion entsprechen.
Es wäre zunächst darzustellen, wie unter der Voraussetzung der geglückten Bauernpolitik sich der Übergang von der heutigen zur kommenden Ordnung vollziehen würde. Wir können uns aber hier auf eine bereits vorhandene ausführliche Darstellung berufen [1] ; auf die wir verweisen müssen. Hier kann nur der leitende Gedanke in äußerster Kürze wiedergegeben werden:
Wenn unsere These richtig ist, daß aller Mehrwert der Monopolgewinn des durch die Bodensperre begründeten Klassenmonopols ist, so zwingt sich der Schluß mit Notwendigkeit auf, daß mit dem Verschwinden der Bodensperre und des darauf ruhenden Monopols auch der Mehrwert „verdampfen“ muß [2]. Wenn hier Schwierigkeiten des Verständnisses bestehen, so liegt es nur an der kindlichen oder vielmehr kindischen Vorstellung, daß reiche Leute „viel Geld haben“, oder: daß große Vermögen von heute aus „Geld“ bestehen. Sie sind aber in der Tat nichts anderes, als individuelle Anteile am Klassenmonopol, nichts als „kapitalisierter Mehrwert“. Verschwindet der Mehrwert, so ver-
[1] „Das Erlöschen des Kapitalismus“, S. S. III, S. 1111.
[2] Gerade diese Deduktion wird, wie sieb sofort zeigen wird, durch die geschichtlichen Tatsachen in überraschender Weise bestätigt.
[741]
schwindet auch das Vermögen, genau so, wie die Einkünfte aus einem Patent und der Vermögenswert eines Patents mit dem Ablauf der Schutzfrist verschwinden, und es bleibt nichts anderes übrig, als der Besitz an einigen Barmitteln, Möbeln, Schmuck und dergleichen, der aber kein Einkommen mehr abwirft, der sogar zum großen Teil, wie etwa Schlösser und Sammlungen, „fressendes“ Kapital darstellt, weil seine Verwaltung hohe Kosten verursacht. Solcher nicht werbender Besitz aber ist volkswirtschaftlich harmlos und wird durch persönlichen Konsum und vor allem durch die Zersplitterung im Erbgang in wenigen Generationen verschwinden.
Unterstellen wir daher die Übergangszeit als abgelaufen. Wie sieht die Ökonomie dieser klassenlosen Gesellschaft aus?
Zunächst: es gibt keine Großstädte im heutigen Sinne. Da die Massenabwanderung völlig aufgehört hat, da im Gegenteil während der Übergangszeit eine beträchtliche Menge von Großstädtern auf das Land zurückgewandert ist, um entweder als Bauern (Gärtner) oder als Handwerker in den unzähligen neugeschaffenen Dorfschaften sich eine selbständige Existenz des mittelständischen Behagens zu schaffen, so ist die großstädtische Terrainspekulation vollkommen zusammengebrochen, die nur unter der Voraussetzung eines regelmäßigen starken und schnellen Wachstums der großstädtischen Bevölkerung möglich ist (S. S. III, S. 562 ff.). Die bisher gegen die Bebauung gesperrten Gelände rings um die großen Zentren sind auf den Ackerpreis herabgesunken; die jetzt in Mietskasernen zusammengehudelten Massen haben sich hierher gezogen ; ein Kranz von Gartenstädten umgibt den zur City gewordenen, fast nur noch dem Geschäftsverkehr dienenden Kern: die alte Großstadt.
In Parenthese: Hieraus kann man sehen, mit wie untrüglicher Sicherheit die „Schau“ den „ästhetischen Historiker“ leitet. Oswald Spengler [1] hält die Bildung von Großstädten im heutigen Sinne : dieser von jedem Gesichtspunkt aus, vom ästhetischen, ethischen und politischen, mit nichts anderem als bösartigen Geschwülsten vergleichbaren Mißbildungen, für die Notwendigkeit jeder „alternden Kultur“! Sie sind aber, wie das Gesetz des einseitig sinkenden Druckes zeigt, Erscheinungen nicht des Alterns, sondern jener wohl charakterisierten Sozialkrankheit, als die wir den Kapitalismus kennen gelernt haben.
In der City mag noch an einigen bevorzugten Stellen eine geringe „Grundrente“ für Geschäftsgrundstücke besonders günstiger Lage gezahlt werden. Im Vergleich zur Gegenwart ist sie winzig. Denn eine Unzahl von Geschäftsinhabern sind ihrer Kundschaft gefolgt, haben sich in den Mittelpunkten der neuen Gartensiedlungen angesetzt; es sind also außerordentlich viele Räumlichkeiten leer geworden, die
[1] Der Untergang des Abendlandes.
[742]
Grundrente ist überall absolut gesunken, und die begünstigten Stellen ragen höchstens noch so weit über das tief erniedrigte Niveau empor wie heute. Und diese geringen Renten werden binnen kürzester Zeit gleichfalls im Erbgang zersplittert sein.
In den umliegenden Gartensiedelungen werden einige Wohngelände wegen ihrer besonders schönen Lage, etwa an einem See oder Wasserlauf, und einige bevorzugte Geschäftslagen gleichfalls eine gewisse Vorzugsrente tragen, für die das gleiche gilt. Im übrigen ist nichts leichter, als diese Renten von vornherein für den Seckel der Gemeinschaft zu sichern. Die Gemeinde braucht sich nur das Eigentumsrecht vorzubehalten und die Erbmiete für Wohngrundstücke resp. die Zeitmiete für Geschäftsräumlichkeiten entsprechend festzusetzen. Da Grundrente in ihrer ökonomischen Bedeutung das Einkommen eines Privatsubjektes darstellt, so ist sie als Ursache von Einkommensverschiedenheiten damit verschwunden. Aber auch ohne diese Regelung handelt es sich um Einkommenszuwächse von so geringer Größe, daß sie niemals klassenbildend wirken können: und das ist das einzige, was uns interessiert.
Das Normalniveau des Einkommens ist das eines Bauern auf unverschuldetem ausreichendem Grundbesitz. Unverschuldet, weil Boden hier an sich so wenig einen Wert haben kann wie Luft und Wasser, also auch nicht mit Hypotheken belastet werden kann; und ferner bei verständiger Regelung auch aus dem Grunde, weil die Gemeinden auch hier das Obereigentumsrecht für sich bewahren und den einzelnen nur als unabsetzbaren Erbsiedler sozusagen belehnen werden: „le fief par Opposition à l'alleu“, wie Proudhon sagt.
Dieses Normalniveau ist schon heute gut mittelständisch, wird aber in der reinen Ökonomie schon aus dem folgenden Grunde noch erheblich höher sein: die sehr gleichmäßige Verteilung der städtischen Siedelung über das ganze Land versetzt viel mehr Bauern als heute in günstige Verkehrslagen und erlaubt ihnen, ihre Wirtschaft auf diejenigen Zweige der Erzeugung einzustellen, in denen die spezifisch bäuerliche Qualifikation die höchsten Reinerträge erwirtschaftet: Viehzucht, Milchproduktion, Obsterzeugung usw. für die überaus kaufkräftigen städtischen Märkte.
Auch hier werden Splitter von Grundrente, Lagerente und Fruchtbarkeitsrente, vorhanden sein. Aber sie sind schon an sich gering, weil die Bauernhufen nur klein, im Durchschnitt etwa 5 ha, groß sind; und vor allen Dingen, weil sich hier, wo keine Landarbeiter mehr zu mieten sind.dieHöfe im Erbgang derartig teilen müssen, daß die Betriebe besserer Verkehrslage und fruchtbareren Bodens entsprechend kleiner sind als die schlechterer Verkehrslage und geringeren Bodens. Das ist die Auswirkung des Prozesses, den wir als „die Bewegung zur natürlichen
[743]
Hufengröße“ bezeichnet haben (S. S. III, 726ff.). Die etwa noch bleibenden Rentenzuwächse sind winzig und höchst wahrscheinlich beträchtlich geringer als diejenigen Mehreinkommen, die aus höherer Qualifikation stammen.
Damit sind wir zu diesem wichtigsten der Gegenstände gelangt, die hier zu betrachten sind:
Da alle ungefähr der gleichen Bildungsmöglichkeiten genießen, hat die erworbene Qualifikation ihre heutige Seltenheit verloren, bringt also ein wesentlich geringeres Mehreinkommen. Was aber die angeborene Qualifikation anlangt, so muß man sich klar machen, daß heute die riesenhaften Einkünfte derartig begabter Menschen sich nur erklären lassen aus dem Vorhandensein einer üppigen Klasse überreicher Menschen. Denn erstens stellt ein genial qualifizierter und anerkannter Künstler, Anwalt oder Arzt selbstverständlich die gleichen Ansprüche an Einkommen und Lebensführung, wie die Klasse, in deren Mitte er lebt ; und zweitens kann er diese Ansprüche bei seinen Patronen, Klienten oder Patienten auch durchsetzen. Wo solche reiche Klasse nicht existiert, die in der Lage ist, fürstliche Honorare zu zahlen, da haben Hochqualifizierte weder den Antrieb noch die Möglichkeit, ein solches Einkommen zu erringen. Mag man die hier bestehenden Verschiedenheiten der Begabung und daher des Einkommens noch so hoch schätzen: sie werden schon aus dem Grunde nicht klassenbildend sein können, weil solche Qualifikation sich äußerst selten auch nur auf das nächste Geschlecht vererbt. Und die höheren Einkünfte werden in der Regel schon aus Prestigegründen durch eine entsprechend gehobene Lebenshaltung und höhere Opfer des Bürgersinns aufgezehrt werden.
Wir sagten oben: es gibt Unternehmungen aller Art: Fabriken, Banken usw. Wir werden sogar zeigen können, daß aus notwendigen Zusammenhängen heraus die hochmaschinelle Gütererzeugung, dasjenige, was wir als den „Kapitalismus im volkswirtschaftlichen Sinne“ bezeichnet haben, Ausmaße annehmen wird, die wir uns heute kaum vorstellen können. Und das heißt natürlich: es gibt eine unendlich große Zahl von „unselbständig Dienstleistenden“, also von „Arbeitern“ ebenfalls im volkswirtschaftlichen Sinne. Aber diese Arbeiter sind es nicht im heutigen privatwirtschaftlichen Sinne, weil es auch keinen „Kapitalismus“ im privatwirtschaftlichen Sinne mehr gibt: es sind keine „freien Arbeiter“ im Marxschen Sinne.
Diese Arbeiter beziehen nämlich ein Einkommen, das dem Nominalbetrage nach über dem Normalniveau des freien unverschuldeten Bauern auf ausreichendem Lande stehen muß, weil die Nahrungsmittel in den Städten (dank dem Transportaufschlage) teurer sind als in den Dörfern (S. S. III, S. 918) : es muß also ein gewisser Aufschlag auf das Nominaleinkommen erfolgen, um die Gleichheit der Realeinkommen
[744]
herzustellen. Qualifizierte Arbeiter werden außerdem noch einen Mehrlohn erhalten. Dieser Lohn ist hoch genug, um daraus erhebliche Ersparnisse zurückzulegen. Nicht die winzigen „Notgroschen“ von heute, sondern wirkliche Kapitale, die in ihrer Summation vollauf genügen, um auch die gewaltigsten Produktionsmittel zu beschaffen, deren eine große Arbeiterschaft bedürfte. Um ein Beispiel anzuführen: Krupp hatte auf der Höhe seiner Tätigkeit vor dem Kriege nahezu 100000 Arbeiter und Angestellte. Wenn jeder von ihnen aus eigenem Vermögen tausend oder zweitausend Mark Genossenschaftsanteil hätte zeichnen oder Aktien hätte übernehmen können, so hätten sie zusammen das Werk erwerben oder ein gleiches errichten können. Das aber wird in der reinen Ökonomie der Fall sein.
Die großen Betriebe werden zumeist das Eigentum der in ihnen Beschäftigten sein, sei es, daß sie sie aus eigenen Mitteln errichtet haben, sei es, daß sie sie auf dem Wege der kollektiven Kapitalsbildung für sich erworben haben, sei es, daß sie allmählich die Majorität der Aktien oder Anteile gewonnen haben; das wird um so leichter sein, weil der Kurs der Aktien in dem Maße fallen muß, wie der Mehrwert verdampft (S. S. III, S. 1112). Daneben werden in der Übergangszeit noch einige Groß werke im Privatbesitz bestehen: aber auch sie werden faktisch, was die Verteilung des Gewinns anlagt, Genossenschaften sein, weil diese Verteilung nicht mehr unter dem Monopolverhältnis stattfindet, der Lohn den vollen Arbeitsertrag darstellt, und sich lediglich nach der Qualifikation der Beteiligten abstuft.
Aus dieser grundstürzend veränderten Verfassung ergibt sich die erste der Ursachen, aus denen der Reichtum dieser Gesellschaft, ihre Produktivität, beträchtlich größer sein wird, als die heutige. Denn alle die Störungen, die aus der heutigen Klassenscheidung innerhalb der Betriebe folgen: Streiks, Sabotage, Arbeitsunlust, Ca'canny-System, Boykott und Aussperrung entfallen selbstverständlich, wenn die Arbeiterschaft ihr eigener Arbeitgeber ist.
Der Reichtum der Gesamtgesellschaft ist ferner aus dem Grunde beträchtlich höher als heute, weil relativ außerordentlich wenig Menschen vorhanden sind, die nichts zur Gütererzeugung beitragen. Wir wissen aus unserer Darstellung vom Gesetz des einseitig sinkenden Drucks, daß in der kapitalistischen Wirtschaft die durchschnittliche Siedelungsdichtigkeit des flachen Landes im Verhältnis zur Norm gering, der Anbaukreis ungesund überdehnt ist. Das bedingt eine Unmasse von Transportleistungen, die in dem gedrungeneren Körper der reinen Ökonomie fortfallen. Dazu kommt hier die unmittelbare Nachbarschaft der über das ganze Land hin verstreuten städtischen Siedelungen zu ihren bäuerlichen Versorgern: die Transportentfernung zwischen dem Ur-
[745]
produzenten und dem Konsumenten ist durchschnittlich viel kleiner [1]. Man bedenke ferner, welche ungeheuren Kosten und Arbeitsaufwände heute aus der Zusammendrängung des Verkehrs in den engen Großstädten entstehen; die Anlagekosten der Stadtbahnen in London z. B. müssen viele Hunderte von Millionen £ betragen, und ihr Betrieb beschäftigt eine ganze Armee von Bediensteten. All das kann zum großen Teil erspart werden, und die Hersteller der Transportmittel wie ihre Beamten und Arbeiter können an Stelle dieser jetzt überflüssig gewordenen Güter und Dienste solche Güter herstellen, die in Wirklichkeit der Lebenserhöhung der Gesamtheit dienen.
Noch viel wichtiger ist die Ersparnis an den unzähligen Berufstätigen des Handels, namentlich des Kleinhandels. Hier wirkt sich die Konkurrenz heute in seltsamer Weise aus. Sie führt zwar auch hier zur Ausgleichung der Einkommen entsprechend der Qualifikationsstufe, aber nicht durch Erniedrigung der Preise, sondern durch Vermehrung der beschäftigten Personen. Das gilt namentlich für den großstädtischen Kleinhandel mit Lebensmitteln: Fleisch, Gemüse, Milch, der ungeheuerlich übersetzt ist. Der Zudrang zu diesen Berufen ist die unmittelbare Folge des kapitalistischen Systems. Wer immer aus der Unterklasse ein kleines Vermögen ererbt oder erspart hat, flüchtet aus dem Fabrikproletariat in die Selbständigkeit des Kleinhändlers, weil hier doch wenigstens eine gewisse Möglichkeit des Aufstiegs zu höherer Klassenstellung besteht, und vor allem, weil diese Berufe eines höheren Prestige genießen als die verachtete Arbeit.
In der reinen Ökonomie, wo die Arbeit ihre volle Ehre zurückgewonnen hat, wo auch der bei einem Unternehmer angestellte unselbständige Arbeiter sich eines auskömmlichen Verdienstes und voller sozialer Anerkennung erfreut, sind diese Bedingungen nicht mehr gegeben. Die Austeilung der Produkte im Kleinhandel wird hier durch eine viel geringere Anzahl von Personen, wahrscheinlich in der Hauptsache durch Angestellte von Konsumvereinen erfolgen. Auch hier werden viele Elemente für die eigentlich güterschaffende Arbeit frei.
Aus den gleichen Gründen wird die heute im Verhältnis viel zu große Zahl der Ausübenden freier Berufe viel geringer sein. Im Verhältnis! Vielleicht wird die reiche Gesellschaft der reinen Ökonomie einen noch größeren Prozentsatz von Ärzten, Zahnärzten, Patentanwälten, vielleicht von Geistlichen, jedenfalls von Lehrern aller Stufen brauchen und entlohnen. Aber die heutige Disproportion zwischen dem Bedarf
[1] Dazu kommt, worauf vor allen Dingen Carey Nachdruck gelegt hat, die eben darauf beruhende ungleich günstigere Düngerwirtschaft. Die Abfälle, die heute mit großen Kosten abgeführt werden müssen, kehren auf kürzestem Wege zu dem Boden zurück, dem sie entstammen, und der heute verarmen oder mit hohen Kosten in seinem statischen Zustande erhalten werden muß.
[746]
an solchen Diensten und ihrem Angebot wird nicht gegeben sein. Es gibt keine reichen Familien mehr, die ihre nur normal begabten, ja sogar ihre unternormal begabten Söhne mit aller Gewalt in die freien Berufe drängen und durch die Examina schieben; es gibt keine Motive mehr, um solche Menschen ängstlich vor dem „Absturz“ in die Hölle des Bauern oder Arbeiters zu schützen. Und es gibt die Rieseneinkommen der wenigen Arrivierten nicht mehr, die heute den phantasievollen und ehrgeizigen jungen Menschen in alle jene Laufbahnen locken, in denen er schließlich nichts als ein „Stehkragenproletarier“ sein wird.
Eine ganze weitere Armee von Menschen, die heute nicht in der eigentlichen Gütererzeugung beschäftigt sind, sind die im Dienste der „Propaganda“ tätigen Wirtschaftssubjekte: die Reisenden, die Inseratenagenten und ihr ganzes Zubehör. Auch dieses große Heer wird in der reinen Ökonomie auf einen Bruchteil einschrumpfen. Und zwar hauptsächlich aus dem Grunde, weil die Konkurrenz der reinen Ökonomie einen völlig anderen Charakter trägt als die der kapitalistischen. Wir haben diesen Gegenstand mehrfach ausführlich dargestellt (zuletzt S. S. III, 948ff.) und müssen hier auf diese überaus wichtigen Auseinandersetzungen verweisen; sie sind uns die Grundlage für weittragende ökonomische und historische Ableitungen geworden, mit denen es gelungen ist, bisher unlösbare Schwierigkeiten aufzulösen. Hier nur das folgende:
In der kapitalistischen Ökonomie besteht notwendigerweise zwischen den Unternehmern der von uns so genannte „feindliche Wettkampf“. Er läuft auf das Bestreben hinaus, die Konkurrenten mit allen Mitteln aus dem Markte zu werfen, niederzukonkurrieren. Zu diesen Mitteln gehört jene Propagandatätigkeit.
In der reinen Ökonomie aber herrscht der „friedliche Wettbewerb“. Mangels der Möglichkeit, „freie Arbeiter“ in beliebiger Zahl einzustellen, besteht weder die Möglichkeit noch die Absicht, die Konkurrenten aus dem Markt zu werfen. Der Wettbewerb beschränkt sich lediglich darauf, durch höchste Qualität der Leistung ein höheres Einkommen zu erzielen, indem man die wohlhabenderen Schichten und die lohnenderen Aufträge für sich gewinnt.
Aus dieser ganz anderen psychologischen Einstellung ergibt sich nun gegenüber der kapitalistischen Wirtschaft eine neue, ungeheure Ersparnis an „falschen Kosten“ der Gesamtwirtschaft. Es sind keine Krisen mehr möglich, die, wie wir haben nachweisen können, lediglich aus der Psychologie des feindlichen Wettkampfs entstehen können und müssen. Mit ihnen entfallen die gewaltigen Verluste, die sie durch Entwertung vorhandener Produktionsmittel und namentlich durch die weit verbreitete und lang dauernde erzwungene Arbeitslosigkeit
[747]
von Zehntausenden oder Hunderttausenden mit sich bringen (S. S. III, 996 ff.).
Man muß sich überhaupt klar machen, daß es in der reinen Ökonomie, wo keine freien Arbeiter existieren, Konjunkturschwankungen von der Größe, wie wir sie heute kennen, nicht geben kann. Das hat ein Beobachter, der uns im übrigen so fern wie möglich steht, Gustav Cassel, mit voller Klarheit erkannt (S. S. III, 997 Anm. [1].
Ferner gibt es in der reinen Ökonomie kaum noch „Drohnen“, die auf Grund ihres Renteneigentums sehr viel verzehren, ohne zu dem Gütervorrat der Gesamtheit etwas beizutragen. Und mit ihnen verschwindet das ungeheure Heer ihrer Parasiten: der männlichen und weiblichen Prostituierten aller Grade und der von jenen beschäftigten, nur für ihre Luxuszwecke vorhandenen Bediensteten.
Schließlich und endlich wird auch die Zahl der öffentlichen Beamten und des Staates und seiner Unterabteilungen, und zwar sowohl der Zivil-, wie der Militärbeamten außerordentlich einschrumpfen. Das werden wir vor allem bei der Betrachtung des neuen politischen Consensus darzustellen haben. Aber schon hier kann darauf aufmerksam gemacht werden, daß mit dem allgemeinen Wohlstande, der allgemein verbreiteten Bildung und der Nivellierung der Klassen auch das Heer derjenigen Parasiten gewaltig einschrumpfen wird, die nicht auf den einzelnen Reichen, sondern auf der ganzen Gesellschaft schmarotzen: der Verbrecher und der arbeitsfähigen Almosenempfänger. Deren Bekämpfung und Versorgung nimmt heute eine bedeutende Zahl von Beamten der Gerichte und Gefängnisse, der Polizei und der Armenverwaltung in Anspruch. Auch diese fallen in Zukunft fort, ebenso ein großer Teil der heute für die Versorgung der nicht arbeitsfähigen Almosenempfänger und Kranken benötigten Kräfte: der Gesundheitszustand der Gesamtheit muß natürlich wesentlich höher stehen als heute, und zwar nicht nur leiblich, sondern auch sittlich : es wird viel weniger Verbrecher, Prostituierte und Arbeitsscheue geben als heute.
Aber alle diese Vorteile, die die reine Ökonomie vor der kapitalistischen voraus hat, wiegen federleicht gegenüber jener vollkommenen Veränderung des Mechanismus, der die Produktivität in einem für uns heute noch fast unvorstellbaren Maße zu vermehren verspricht:
In der reinen Ökonomie gibt es nur noch die eine Grenze der Gütervermehrung, die im Stande der Technik gegeben ist. Aber es gibt nicht mehr die „politisch-ökonomische Grenze der Produktion“, die heute die Gütererzeugung nicht überschreiten kann: eine Grenze, die weit vor jener technischen Grenze liegt. Wir haben diese Zusammenhänge (S. S. III, S. 1021ff.) ausführlich dargestellt. Hier können wir nur die großen Linien andeuten:
Zwischen Erzeugung und Verteilung besteht, wie zwischen allen
[748]
Funktionen eines Organismus, eine Beziehung der Reziprozität. Man hat bisher immer nur die eine Seite gesehen : es kann nicht mehr verteilt werden, als vorher erzeugt worden ist. Aber noch wichtiger ist die verborgene Rückbeziehung: es kann nicht mehr erzeugt werden, als nachher verteilt werden kann.
Nun kann aber die große Masse der kapitalistischen Völker nicht mehr Waren aufnehmen, als sie mit ihrem Lohne bezahlen kann. Das aber bedeutet, daß hiermit der maschinellen Produktion jene enge unüberschreitbare Grenze gesteckt ist. Denn der Bedarf der Oberklasse an maschinellen Produkten ist klein, schon ihrer geringen Zahl wegen. Sie wären, selbst wenn sie es wollten, gar nicht imstande, den gewaltigen Mehrwert zu konsumieren, falls er ihnen in Gestalt maschineller Produkte zuflösse. Sie müssen also den größten Teil ihres Einkommens für unproduktive Dienste oder für solche Erzeugnisse ausgeben, die von Erzeugern hoher Qualifikation aber geringer Produktivität hergestellt werden, also von Künstlern und Kunsthandwerkern aller Art, vom Porträtmaler und Elfenbeinschnitzer abwärts bis zur Spitzenklöpplerin.
Somit wird das Maximum der Aufnahmefähigkeit einer kapitalistischen Gesellschaft für großindustriell erzeugte Produkte durch das Lohnsystem verhältnismäßig tief gehalten. Daraus entspringt nicht nur die Unmöglichkeit, die schon vorhandene Maschinerie voll auszunutzen, sondern vor allem die entscheidendere Unmöglichkeit, auch nur diejenige Maschinerie aufzustellen, die heute schon technisch möglich ist. Wir besitzen sie „potentiell“, aber nicht „aktuell“.
Diese Grenze ist in der reinen Ökonomie verschwunden. Hier entscheidet über das Ausmaß der Gütererzeugung lediglich der Stand der Technik; Potentialität und Aktualität fallen zusammen. Nun würde uns schon der heutige Stand der Technik gestatten, in viel kürzerer durchschnittlicher Arbeitszeit eine viel größere Menge von Genußgütern zu erzeugen: und diese technische Grenze ist fast ins grenzenlose elastisch, weicht immer weiter vor uns zurück. Wir sind heute technisch-potentiell bereits soweit vorgeschritten, daß fast jede Maschinerie von noch so ungeheurer Leistungsfähigkeit geschaffen werden könnte, wenn ihre Rentabilität gesichert wäre. Und wir stehen doch offenbar erst am Anfang! Wenn für jedes verbesserte und verbilligte Produkt ohne weiteres der Markt gesichert ist, dann werden unsere Erfinder die neu sich stellenden Aufgaben mit immer neuen Mitteln zu lösen imstande sein. Was heute Ford für den, unter europäischen Gesichtspunkten, enorm kaufkräftigen amerikanischen Markt geleistet hat, wird dann die Regel sein.
Man kann die Dinge auch von einer anderen Seite her verständlich machen :
Eine Maschine ist, volkswirtschaftlich gesehen, ein Ding, das Arbeit
[749]
spart, ist aber, vom privatwirtschaftlichen Standpunkt des Unternehmers aus gesehen, ein Ding, das Löhne spart. Folglich sind um so gewaltigere Maschinen rentabel, je höher die Löhne stehen. Dennoch wird das Produkt billiger. Nur aus diesem Grunde kann z. B. Ford, der das Vielfache der europäischen Löhne zahlt, seine Automobile und Traktoren zu Preisen nach Europa liefern, bei denen die europäischen Werke nicht konkurrieren können.
Die Nutzanwendung ergibt sich von selbst:
Da in der reinen Ökonomie die Löhne ihr mögliches Maximum erreichen, ist auch dem Maximum der technisch möglichen Maschinerie die Rentabilität sicher.
Und noch ein letzter, ebenfalls unendlich wichtiger Grund dafür, daß der Reichtum der künftigen Gesellschaft viel größer sein wird als der der heutigen. Sie wird auf dem größten denkbaren Markte stehen. Sie wird freihändlerische Weltwirtschaft sein. Die Zollgrenzen werden gefallen sein, jedes Land wird diejenigen Produkte herstellen, für die es nach natürlicher Ausstattung und Zahl und Arbeitsrichtung seiner Bevölkerung die höchste Eignung besitzt.
Nun aber besteht ein unbestrittenes Gesetz der Ökonomik, das „Hauptgesetz der Beschaffung" (S. S. III, S. 306/7), demzufolge die Ergiebigkeit der Arbeit eine Funktion der Marktgröße ist. Man könnte es, um seine Wirkung einigermaßen quantitativ zu illustrieren, derart bestimmen, daß die Produktivität wächst wie das Quadrat der Marktgröße.
Die Marktgröße ihrerseits ist das arithmetische Produkt aus der Zahl der Mitglieder der Gesellschaft und ihrer durchschnittlichen Kaufkraft. Wie groß diese ist, haben wir soeben bereits betrachtet: und nun wolle man bedenken, zu welcher gewaltigen Ziffer die Marktgröße anschwellen wird, wenn die gesamte Bevölkerung des Planeten in einer einzigen, durch keine Zollgrenzen mehr zerspaltenen, um einen einzigen Markt zentrierten Wirtschaftsgesellschaft vereinigt sein wird.
Mit diesen letzten Erörterungen haben wir bereits die Linie erreicht und ein wenig überschritten, die zur Betrachtung der politischen Funktion, zur Freibürgerschaft, führt. Bevor wir diesen Gegenstand ins Auge fassen, wollen wir, wie angekündigt, der theoretischen Deduktion die Tatsachen gegenüberstellen.
2. Die Tatsachen. ↩
Wir besitzen zum Glück eine größere Anzahl von verbürgten Nachrichten aus der Vergangenheit und Gegenwart über solche Gemeinwesen, in denen die Bodensperre entweder gar nicht bestand oder noch nicht ihre volle Höhe erreicht hatte. Wir haben sie kurz in unserem
[750]
Aufsatz „Die Utopie als Tatsache“ [1] zusammengestellt. Sie betreffen eine Anzahl kleinerer Gruppen auf begrenzter Grundfläche mit einem die Bodensperre ausschließenden Eigentumsrecht, ferner einen ganzen Staat der Union: die Mormonensiedlung Utah, und vor allem Deutschland in der Zeit vom Anfang des II. bis zum letzten Drittel des 14. Jahrhunderts. Diejenigen Tatsachen, die unsere Auffassung an diesem letzten großartigsten Beispiel vollkommen beweisen, haben wir im zweiten, historischen Teil unseres „Großgrundeigentum und soziale Frage“ in größter Ausführlichkeit dargestellt, und zwar gestützt ausschließlich auf die Erhebungen, die unsere ausgesprochenen theoretischen Gegner, die Meister der historischen Schule, einhellig gemacht hatten. Wenn wir die von ihnen festgestellten Tatsachen völlig anders und wie wir hoffen dürfen [2], in besserem und ohne weiteres überzeugenden Zusammenhang haben ordnen können, so liegt das nur daran, daß wir das theoretisch errechnete Gedankenbild der reinen Ökonomie bereits besaßen: man kann eben nur erkennen, was man kennt!
Zu diesen Daten, die wir im folgenden in äußerster Kürze noch einmal darstellen und auswerten werden, sind noch diejenigen hinzuzurechnen, auf die wir im Laufe der bisherigen Darstellung bereits gestoßen sind: die einhellige Feststellung, zu der auch Marx gelangt ist, daß unter der Voraussetzung noch freien Bodens Kapitalismus unmöglich ist, d. h. daß große Gleichheit der Einkommen und Vermögen besteht, weil der Lohn hoch, und der Mehrwert infolgedessen gering ist. Ferner die Mitteilung von Brodnitz, daß in England vor dem Aufkommen der Bodensperre und des agrarischen Kapitalismus die Einkommen der Städter bescheiden und außerordentlich gleichmäßig verteilt waren.
Wir werden jetzt Punkt für Punkt die theoretisch erhobenen Einzelzüge der reinen Ökonomie mit Tatsachen belegen:
In den ewigen Fehden zwischen den einzelnen feudalen Machthabern und den Verwüstungen durch Land- und Seenomaden, die die Folge der durch eben jene Fehden verschuldeten Wehrlosigkeit Deutschlands waren, ist der Bauer selten geworden. Seltene Dinge aber haben hohen Wert. Die Grundherren konkurrieren heftig um die wenigen vorhandenen Arbeitskräfte, zumal sie die Hintersassen auch als Krieger dringend brauchen. Sie treten in eine Art Auktion ein, bei der sich der Bauer sozusagen selbst an den Höchstbietenden versteigert. Bis dahin auf das furchtbarste gedrückt, erhält er jetzt wie mit einem Schlage die kostbarsten aller Rechte: politisch die glebae adscriptio (das
[1] „Wege zur Gemeinschaft“, S. 493ff.
[2] Vgl. den in dem Vorwort zur 2. Auflage des genannten Buches publizierten Brief Karl Lamprechts. Adler (Gesch. d. Sozialismus, S. 88) hat die Erklärung gleichfalls.
[751 ]
heißt: er kann nicht mehr ohne seine Scholle, und die Scholle nicht mehr ohne ihn verkauft werden) ; er erhält ferner in den „Hofrechten“ das wichtigste aller wirtschaftlichen Rechte: die Festlegung seiner Zinsverpflichtung. Damit ist das Großgrundeigentum in die harmlose Großgrundherr Schaft verwandelt, von der wir schon sprachen: von jetzt an fließen alle Vorteile der wachsenden Kooperation nicht mehr dem Titulareigentümer, sondern dem Bauern selbst zu ; oder mit anderen Worten, das Gesetz des einseitigen Druckes besteht nicht. Die bäuerliche Kaufkraft, noch stark vermehrt durch die Falschmünzerei der Fürsten — denn die Zinse sind in Geldstücken festgelegt, und diese Stücke enthalten immer weniger Silber — stampft sofort eine Unzahl von städtischen Märkten aus dem Boden: Wer Bauern schafft, schafft Städte!; und ein gleichmäßiger und erstaunlich schnell wachsender Reichtum besteht in Land und Stadt.
Wir werden die gleiche Entwicklung der anderen europäischen Staaten im nächsten Bande dieses Systems darstellen. Hier nur eine Notiz, die beweist, daß z. B. auch Frankreich den gleichen Prozeß durchgemacht hat: [1] „Der durch Kriege, Pest, Hungersnot erzeugte Menschenmangel läßt ein lebhaftes Bedürfnis nach Arbeitskräften überhaupt entstehen. Es beginnt förmlich eine Konkurrenz der Produktionsmittelbesitzer um die Arbeitskräfte, wie es heute umgekehrt der Fall ist. Zahlreiche Feudalherren gründen Freistätten (woher noch heute die vielen Villeneuves, Villefranches usw. in Frankreich), deren Einwohnern mannigfache Erleichterungen der Unfreiheit versprochen werden. Bald entstehen innere Wanderungen nach jenen Punkten, und die betroffenen Seigneurs sehen sich gezwungen, ebenfalls in der Konkurrenz mitzubieten“.
In diese Auktion um den Bauern treten auch die Städte ein, die, um ihre Produktionskraft und politische Macht zu entfalten, die Bevölkerung mit allen möglichen Privilegien an sich zu locken versuchen (274). Karl Bücher berichtet wie folgt [2]: „War ein Gewerbe in den Städten nicht vertreten, das seinen Mann noch hätte nähren können, so berief der Rat einen geschickten Meister von außen und bewog ihn durch Steuererlaß und andere Vorteile zur Ansiedlung. Brauchte er größeres Anlagekapital, so trat die Stadt selbst ins Mittel, baute Werkstätten und Verkaufsläden und legte Mühlen, Schleifwerke, Tuchrähme, Bleichen,
[1] Fr. Ott, Feudales und Bürgerliches Eigentum, Sozialistische Monatshefte 1900 S. 64.
[2] Bücher, Entstehung der Volkswirtschaft, S. 95. Vgl. G. Schmoller, Grundriß 2. Teil, München 1919, S. 536: „Solange die innere Kolonisation, in Deutschland die Wanderung nach dem Osten, dauert, sind die Menschen begehrter als die Grundstücke, die beginnende Städtebildung mit ihrer Verleihung persönlicher Freiheit und ihrem Menschenbedarf hindert von 1100—1400 jeden sehr starken Druck auf die Bauern.“
[752 ]
Färbhäuser, Walkmühlen u. dgl. auf ihre Kosten an — alles in der Absicht, möglichste Vielseitigkeit der Bedarfsbefriedigung durch einheimische Produktion zu gewährleisten“. Ferner auch hier ein außerdeutscher Beleg aus Italien [1]: „Aber zu derselben Zeit hörte in diesen Landesteilen die persönliche Hörigkeit gänzlich auf. Den ersten Schritt zu ihrer vollständigen Beseitigung tat Bologna, indem es im Jahre 1256 sämtliche auf den öffentlichen wie den privaten Ländereien lebenden Leibeigenen emanzipierte und die Gutsherren aus Staatsmitteln entschädigte. Ungefähr vier Jahre später befolgte Treviso das gute Beispiel. Florenz erließ 1288 ein Edikt, das allen auf seinen Gebieten vorhandenen unfreien Personen erlaubte, sich loszukaufen und ihre Feudalpflichten — Abgaben und Dienste — bar abzulösen; gleichzeitig wurde die Veräußerung von Hörigen auch für den Fall des Verkaufs ihrer Anwesen verboten, und die Bestimmung getroffen, daß jede solche Veräußerung die sofortige Befreiung der betreffenden Leibeigenen nach sich ziehen werde. Andere Städte handelten ähnlich; in ihnen war vor dem Schluß des 14. Jahrhunderts die Hörigkeit entweder durch Gesetze aufgehoben, oder hatte in anderer Weise ihr Ende erreicht.“
Es gibt keine Großstädte. Nürnberg hatte zur Zeit seiner höchsten Blüte in jener Periode der nahezu reinen Ökonomie etwa zweiundzwanzigtausend, eine Stadt wie Frankfurt a. M. weniger als neuntausend, London (1377) zweiunddreißigtausendfünfhundert Einwohner. Die größte Stadt Deutschlands, das nordische Venedig Lübeck, die Herrscherin über ganz Skandinavien, das Haupt der Hansa, hatte kaum achtzigtausend Einwohner. Dagegen war das ganze Land mit Siedlungen, auch kleinstädtischen Siedlungen überdeckt [2].
Die städtische Bodenrente war niedrig und wuchs nicht (356). Was hier auch noch innerhalb der kapitalistischen Wirtschaft erreichbar ist, hat die Bodenpolitik der Hohenzollern für Berlin gezeigt [3]. Hier gaben die Fürsten aus ihrem starken Domanialbesitz im unmittelbaren Umkreis ihrer Hauptstadt regelmäßig so viel Bauland her, daß das Wohnungsbedürfnis der Bevölkerung überdeckt, die Wohnungsmieten überaus billig, und die Einwohner höchst wohlhabend, zufrieden und loyal waren.
Die Bewegung der Bauernhöfe zur natürlichen Bodengröße vollzog sich entsprechend der Deduktion: schon Anfang des 12. Jahrhunderts haben wir nach Lamprecht den Beginn starker Parzellierung zu verzeichnen. Ein Jahrhundert später notiert er die erste
[1] John Keils Ingram, Gesch. d. Sklaverei und d. Hörigkeit, S. 75.
[2] Großgrundeigentum S.354ft.; dort die Belege. Die folgenden Zitate in ( ) gleichfalls aus diesem Buche.
[3] Paul Voigt, Grundrente und Wohnungsfrage in Berlin und seinen Vororten, 1. Teil, Jena 1901.
[753 ]
große Periode der Güterteilung und Parzellierung in Deutschland. Um 1250 beginnen die Gemeinheitsteilungen, wenig später die Verkoppe- lungen, und dieser Vorgang setzt sich bis zum Ende des folgenden Jahrhunderts fort. Im 13. Jahrhundert stellt in einzelnen Gegenden die Viertelhufe das typische Gut dar (360).
Das bäuerliche Einkommen war sehr hoch. Die Grundherren waren teilweise enterbt, die Bauern im Genuß rasch und stark steigender Einnahmen. Es nahten die Zeiten bäuerlichen Übermutes und ritterlichen Neides gegenüber stolz zur Schau getragenen bäuerlichen Reichtümern (Meier Helmbrecht, Neidhard von Reuenthal). Aus Pommern berichtet Kantzow, daß um diese Zeit häufig verarmte Ritter um reiche Bauerntöchter warben, ohne sie immer zu erhalten (349) [1].
Der Lohn der industriellen Arbeiter steht unter diesen Umständen sehr hoch. Die Kaufkraft des gemeinen Arbeiterlohnes stieg, auf Korn berechnet, nach Lamprecht vom 8. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts auf fast das Doppelte (350). Wir werden sofort zeigen, daß dieser Lohn den vollen Arbeitsertrag repräsentierte.
Wie hoch auch in der Neuzeit die Löhne unter derartigen Verhältnissen des Wettbewerbes sich einstellen, wissen wir bereits aus Marx. Einige andere Belege zur Verstärkung. Fr. J. Neumann berichtet nach Godeffroy [2] wie folgt: „In jungen, noch unentwickelten freien Staaten wie Nordamerika und Neuholland, sei die Stellung der Arbeiter zu den Lohnherren an sich eine günstigere. Denn weil dort die Bevölkerung noch außer Verhältnis zu den Erwerbsquellen stände, veranlasse die Nachfrage nach Arbeitern nur Konkurrenz unter den Lohnherren zugunsten der Ersteren. Der Lohn stelle sich deshalb dort à la hausse und versetze die arbeitende Klasse wohl bis auf die Hefe in den Bemittlungsstand hinüber. Diese jugendliche Periode der Staaten bilde unter der Herrschaft wirtschaftlicher Freiheit aber gewissermaßen das goldene Zeitalter des Arbeitsstandes“.
Aus Australien und Neuseeland berichtet Métin folgendes [3] : „Man
[1] „Im Mittelalter begann seit dem 10. Jahrhundert der Markt größer zu werden, weil die Kaufkraft der Bauern stieg. . . . der Herr mußte den ganzen Zuwachs an Grundrente ihnen überlassen. Dieser Tatbestand hat das Aufblühen des Handwerks erst ermöglicht“ (Weber, Wirtschaftsgeschichte, S. 124).
[2] Jahrb. f. Nationalökonomie u. Statistik III. Folge 17, S. 186, Fr. J. Neumann, Zur Geschichte der Lehre von der Gravitation der Löhne usw.
[3] Métin, Le socialisme sans doctrines, S. 128. Röscher (Politik, S. 318) zeigt, wie das Vorhandensein der Terra libera in Nordamerika früher auf den Lohn einwirkte, und bringt viele Einzeldaten. „In Lowell fand M. Chevallier die Lage der Fabrikarbeiterinnen so, daß die meisten 1 Уг Dollar wöchentlich zurücklegen und gar oft nach vierjähriger Arbeitszeit, mit einem Heiratsgut von 250—300 Dollar versehen, . . . sich verheiraten konnten.“ Noch 1849 meinte ein Arbeiter sich „übel zu befinden, wenn er nicht die Hälfte seines Lohnes zurücklegen könnte“. In Philadelphia waren mehr als ein Viertel der verheirateten Arbeiter Hauseigentümer, die von Ohio speisten so gut wie die deutsche Mittelklasse usw.
[754]
muß nicht vergessen, daß Australien und Neuseeland ferne Kolonien sind, wo die Arbeit suchende Reservearmee kaum existiert, wo die Arbeitgeber zuweilen glücklich sind, einen Arbeiter oder Angestellten zu Bedingungen einzustellen, die uns als exorbitant erscheinen“. Métin fügt hinzu, daß die Arbeiter dort, trotzdem sie wesentlich bessere Nahrung, namentlich mehr Fleisch zu verzehren haben als der europäische Kamerad, dennoch nur 34,4% ihres Lohnes gegenüber von 42,2% in England und 44% in Frankreich für Nahrungsmittel auszugeben haben (S. 262/3) [1].
Der nächste Punkt, den wir zu belegen haben, ist diejenige unserer Behauptungen, die höchst wahrscheinlich den Schein der allerärgsten Paradoxie erweckt haben wird: daß nämlich die in größeren Unternehmungen beschäftigten Arbeiter formell oder faktisch genossenschaftliche Teilhaber des Betriebes sein werden. Die Arbeiter jener Zeit sind fast durchaus Handwerksgesellen. Soweit sie Lernende sind, die im Haushalt ihres Meisters leben und gewerblich ausgebildet werden, interessiert ihr Lohn selbstverständlich nicht. Wo aber, in einzelnen Fällen, völlig ausgelernte Arbeitskräfte in tertiärer Arbeitsteilung in einem Betriebe vereinigt sind, da arbeiten Geselle und Meister miteinander in produktiv-genossenschaftlicher Arbeitsteilung, auf den halben oder dritten Pfennig [2] (335).
Die wichtigsten dieser Fälle betreffen die Bergwerke. Max Weber berichtet: „Die Entwicklung ... ist durch die außerordentliche Machtstellung begründet, welche die gelernten freien Arbeiter vom II. bis 14. Jahrhundert einnahmen. Die gelernten Bergwerkarbeiter waren
[1] Vgl. Zeitschrift für Sozialwissenschaft 7. Jahrg. 1904, S. 472: „Die Arbeitsverhältnisse Neuseelands liegen nach einer Meldung des deutschen landwirtschaftlichen Sachverständigen für die Arbeiter durch ihre Vereinigungen und hohen Löhne günstig (selbst die Kuhjungen sicherten sich jüngst in Otago in einer Union ihre Unabhängigkeit). Dem Landwirt entsteht mancher Nachteil daraus, da die Arbeit teuer, und dabei, besonders für Pflügen und Melken, knapp und ungenügend ist. Farmarbeiter erhalten neben Beköstigung 15—30 M. die Woche, in der Ernte 25—30 M., Schafscherer 15—20 M. für 100 Schafe, Handwerker 8—-12 M. den Tag. Der Lebensunterhalt ist etwas billiger als in Australien, aber etwa doppelt so teuer wie in Deutschland. Man zieht im ganzen vor, sich auf eigenen kleinen Farmen vorwärtszuhelfen, als für andere zu arbeiten.“
[2] Sombart, Der moderne Kapitalismus I, S. 121: „Wo aber etwa aus betriebstechnischen oder sonstigen Gründen eine größere Gehilfenzahl erforderlich war, da wußte man in der Weise zu helfen, daß man materiell wie ideell den Unterschied zwischen Meister und Gesellen fast völlig auslöschte und den Meister als einen Primus inter pares ansah. Das war der Grundgedanke beispielsweise der Baugewerke, namentlich der Steinmetzen im Mittelalter, bei denen der Meister zwar als Organisator und Leiter unentbehrlich war, die Gesellen ihm aber in Lohn sowie Achtung und Ansehen fast völlig gleichstanden.“
[755 ]
selten und besaßen Monopolwert. Die einzelnen partikularistischen Gewalten konkurrierten miteinander und versprachen ihnen Vorteile .. ., die erste und wichtigste Epoche ist die einer starken Machtstellung der Bergwerksarbeiter. Sie hatte zunehmende Appropriation des Bergwerks an die Arbeiter zur Folge und zunehmende Expropriation [1] des Herrn, der zum bloßen Zinsherrn wird und seine Bergschätze nur noch als Rentenquelle nutzt“ (also auch hier Großgrundherrschaft und nicht Großgrundeigentum). „Betriebsinhaberin ist jetzt die genossenschaftliche Einung der Arbeiter. Diese verteilen die Gewinnste . . . unter tunlichster Einhaltung des Prinzips der Gleichheit. Es entsteht die Berggemeinde als Gesamtheit der Berginteressenten, d. h. derjenigen, die auf dem Bergwerk arbeiten (später derjenigen, die dort arbeiten lassen), jedoch unter Ausschluß des Bergherrn. . . . Solange der Gewerke die Schächte abbaute, blieb er Besitzer; ließ er den Betrieb auch nur kurze Zeit ruhen, so verfiel sein Eigentum“ [2]. Wir haben also auch hier das ausgesprochen genossenschaftliche Bodenrecht der „Rückennutzung“, das wir kennen.
Auch die Hütten waren bis ins 14. Jahrhundert hinein Kleinbetrieb (ib. S. 172) [3].
Ganz ebenso waren die übrigen Großbetriebe handwerksmäßiggenossenschaftlich organisiert, die Organisation der Pfännerschaften, der Baugewerbe bis in unser Jahrhundert hinein [4].
Wo ein Monopol bestand, verlor es seinen wirtschaftlichen Inhalt vollkommen, und die Vorteile flössen den Arbeitern zu. So berichtet Max Weber, daß das Monopol der Grundherren in der Binnenschiffahrt an die „Einung der Transportarbeiter“ überging, und der Grundherr expropriiert wurde [5]. Unter solchen Umständen waren sowohl der Kapitalbesitz wie der Kapitalgewinn winzig: „Die Umsätze des mittelalterlichen Handels sind, an modernen Verhältnissen gemessen, geradezu minimal ; er wird von lauter Kleinhändlern bestritten, die mit
[1] Gerade so werden alle anderen Großeigentümer expropriiert. In den Städten bleibt den Bodeneigentümern nur ein winziges, nicht steigerungsfähiges Zinsrecht gegenüber den auf ihrem Lande Angesessenen; aber das Recht, Hypotheken aufzunehmen, fällt diesen zu, so daß der alte Besitz faktisch expropriiert ist. (Nach Arnold, Zur Geschichte des Eigentums in den Städten; unser Großgrundeigentum, S. 316). Und genau so müssen die alten Grundherren im Nordwesten Deutschlands plötzlich zu ihrem Entsetzen die Entdeckung machen, daß die Essenz ihres Eigentums durchaus an die „Meier“ übergegangen ist.
[2] Wirtschaftsgeschichte S. 167.
[3] Vgl. Sombart, Der moderne Kapitalismus I, S. 105: „Es sind fast immer von Anfang an, jedenfalls sehr frühzeitig, Handwerkergenossenschaften, die nach einem gemeinsamen Plane die Ausbeute der Gruben und teilweise auch die Verhüttung der Erze besorgten.“
[4] Sombart, a. a. O. S. 117.
[5] a. a. O. S. 187/8.
[756]
geringen Quantitäten arbeiten. 1277 betrug der englische Export an Wolle 30000 Doppelzentner. In diese Masse teilten sich 250 Kaufleute, so daß auf den einzelnen 120 Doppelzentner entfielen. Die durchschnittliche Höhe einer Commenda in Genua im 12. Jahrhundert betrug 1000 deutsche Reichsmark in Silber; im 14. Jahrhundert war es im Bereich der Hansa verboten, mehr als eine Commenda mitzunehmen, und der Betrag war auch hier nicht höher. ... In Reval waren 1369 an 12 dort abgehenden Schiffen 178 Kaufleute beteiligt, von denen jeder durchschnittlich für 1700 deutsche Reichsmark Waren versandte. ... Es ist ein Gewimmel kleinkapitalistischer Händler, die selbst reisen oder andere für sich reisen lassen: daraus erklärt sich auch die Vergenossenschaftung“ [1]. Es war durchaus handwerklich-genossenschaftlicher Betrieb. Und von großen Gewinnen für die Einzelnen konnte dabei keine Rede sein: „Der Gedanke, daß die mittelalterlichen Berufskaufleute in ihrer großen Mehrzahl durch ihre Handelstätigkeit zu Reichtum gelangt wären, ist geradezu ungeheuerlich“ (ib. 226).
Im Gegensatz dazu war der allgemeine Reichtum für unsere Begriffe ungeheuerlich groß. Kaum ein Großstaat der Gegenwart kann einen einzigen der gewaltigen, mit der höchsten Pracht erbauten Dome errichten, von denen auch kleinere Städte des Mittelalters häufig genug mehrere zu gleicher Zeit neben prachtvollen Rathäusern und großartigen Befestigungswerken erbauen konnten. Um ein Beispiel aus der Gegenwart zu bringen, so hat A. Milton Musser, der Geschichtsschreiber der Mormonen, berechnet, daß sie in den ersten 40 Jahren dem dürren wüsten Lande durch Fleiß und Geduld 543 Millionen Dollar abgerungen haben. „Daraus ergibt sich, daß jeder mormonische Bauer in diesen 40 Jahren durchschnittlich 482 Dollar mehr als die Unterhaltskosten vereinnahmte, beträchtlich mehr als der Bruttoverdienst der Lohnarbeiter im übrigen Amerika“ [2].
Darüber, daß kein feindlicher Wettkampf im Mittelalter bestand, sind sich sämtliche Autoritäten der historischen Schule völlig einig. Knapp sagt ausdrücklich: „Die gebildete Form der Habsucht, der moderne Erwerbstrieb, ist dem Mittelalter fremd“ [3]. Die Folge davon ist zunächst die von uns deduzierte : die Konkurrenz, der friedliche Wettbewerb prägt sich aus in einer heute von uns noch nicht wieder erreichten Qualität der handwerklichen Erzeugnisse; das Gewerbe ist durchaus Qualitäts- vielfach Kunstgewerbe.
Das gleiche berichtet Junge aus dem Orient : „Der Gewerbetreibende
[1] Max Weber, a. a. O. S. 184. Vgl. Sombart, a. a. O. S. 171: Die winzigen Schiffe wurden zumeist von mehreren besessen. Vgl. auch S. 183.
[2] Unsere „Wege zur Gemeinschaft“ 509/10.
[3] Knapp, Die Landarbeiter in Knechtschaft und Freiheit, S. 46.
[757 ]
kennt noch nicht den reinen Erwerbstrieb“ [1]. Und die Folge davon ist „die eigene Freude am schönen Werk und der Stolz auf der Hände schöne Arbeit ... so entstanden mit einer ganz wunderbaren Geschicklichkeit die kleinen Kunstwerke der Leder- und Metallarbeit, der Holzschnitzerei, der Seidenfärberei und der Stickerei. . . . Der ganze wunderbare Zauber, der sich für unser Auge um alles orientalische Gewerbe überhaupt legt, hat seinen Hauptgrund nicht zuletzt in dieser Stellung von Kunst und Gewerbe, das Schuh und Mantel und Turban, Tasse und Kanne, Hausriegel, Fenster und Tor und alles vom kleinsten nichtigsten Alltagsgegenstand bis zur Kuppel der Moschee als ein Meisterwerk der Schönheit gestaltet“ (ib. 213/4) und „gleichzeitig den Gegenständen eine Dauerhaftigkeit verleiht, wie wir sie heute mit allen Maschinen überhaupt nicht mehr herzustellen vermögen“ (ib. S. 215).
Das ist die positive Folge aus dem Bestehen des friedlichen Wettbewerbs. Nicht minder erfreulich ist die zweite, von uns deduzierte negative Folge: da es keinen feindlichen Wettkampf gibt, gibt es keine Krisen. Die ersten Krisen treten erst etwa 100 Jahre nach dem Schluß der von uns betrachteten Periode auf (Großgrundeigentum S. 468).
Als Folge dieser Gesamtlagerung wird die Gesellschaft nicht vom „kapitalistischen“ sondern vom genossenschaftlichen Geist beherrscht. Wie in der Stadt die damals noch nicht gesperrte Zunft oder Innung, eine „harmonische “ Genossenschaft (S. S. III, S. 957ff.), so herrscht auf dem Lande die genossenschaftliche Mark. Und genau das Gleiche wird wieder aus der Neuzeit über Utah berichtet [2].
Unser letzter Zug: Verbrechen und Prostitution als sozialpathologische Massenerscheinungen existieren nicht (selbstverständlich kommen sie als Einzelerscheinungen vor, wie sie immer vorkommen werden). Wir besitzen keine exakten Zahlen, da zu jener Zeit eine Statistik noch nicht existierte ; wir wissen aber, daß nach dem Ende der Periode, mit dem Umschwung zum Kapitalismus, die beiden Erscheinungen gewaltig zunahmen, in gleichem Schritt mit der Armut, für die vorher die kirchliche Wohltätigkeit völlig ausgereicht hatte, da es keine wirtschaftlich bedingte Armut gab [3]. Wir haben schon oben von der fürchterlichen Vermehrung des Kriminalismus in England gesprochen. Dasselbe gilt von Deutschland: viele Wandergesellen und Fechtbrüder machten die Straßen unsicher*). Und ebenso tritt das Geschwister des Verbrechens, die Prostitution, erst jetzt massenhaft auf. Bücher sagt, daß „nach allen Schilderungen die Pro-
[1] a. a. O. S. 215.
[2] Wege zur Gemeinschaft, S. 507ff., S. 512.
[3] Die ersten Bettelverbote finden sich in der 2. Hälfte des 14. Jahrh. (Art. „Armenwesen“ [Uhlhorn-Münsterberg] Hdw. d. St. II, S. n).
[4] Stahl, Das deutsche Handwerk I, S. 354.
[758]
stitution in den deutschen Städten im 15. Jahrhundert eine furchtbare Ausdehnung gewonnen haben muß“ [1]. Der Zusammenhang ist völlig klar: um diese Zeit wurden die Frauen, die bis dahin gewerblich fast überall gleichberechtigt gewesen waren, immer mehr vom Handwerk ausgeschlossen [2].
Wie es in der reinen Ökonomie bei Abwesenheit der Bodensperre um die leibliche und seelische Gesundheit der Menschen stehen würde, können wir ungefähr aus den uns vorliegenden Daten über solche Siedlungen erschließen, die jedermann den Zugang zu Boden eröffneten. Von den kommunistischen Siedlungen in Nordamerika berichtet Nordhoff [3], daß der Einfluß des Gemeindelebens auf den Charakter der Genossen überall ein staunenswerter war. Sie sind durchgängig innerlich wie äußerlich reinliche Menschen. Müßiggang und Trunksucht, Unehrlichkeit und Streitlust sind unter ihnen gänzlich unbekannt; sie sind als barmherzige Wohltäter und gütige Arbeitgeber ebenso berühmt, wie als vortreffliche Landwirte und Gewerbetreibende. Sie sind durchgängig gesund und langlebig, „der langlebigste Teil der amerikanischen Bevölkerung“; trotz ihres einfachen monotonen Lebens sind sie zumeist fröhlich und sorglos und betreiben die Arbeit als ein Vergnügen. „Zwei Lohnarbeiter leisten dasselbe wie drei von uns.“ Kleinwächter [4] trägt die allgemein verbreitete Anschauung vor, daß sich diese guten Eigenschaften hier entwickeln, weil es sich um religiöse Gruppen handelt. Diese Ansicht wird widerlegt durch die Erfahrungen über Vineland [5]. Hier war von irgendeinem religiösen Band zwischen den Siedlern keine Rede. Aber es war dafür gesorgt, daß lange Zeit hindurch „jeder Mann ein Stück Land als sein individuelles Eigentum und Produktionsmittel erwerben konnte“ : und auch hier war der allgemeine Reichtum außerordentlich hoch und gleichmäßig verbreitet, die Armentaxe fast gleich Null: 5 Cents pro Jahr und Kopf, ein Vierzigste! von der im Nachbarorte erhobenen; und Verbrechen und Vergehen kamen nicht vor.
Das gleiche gilt von der vor mehr als 30 Jahren nach den Ideen des Verfassers begründeten Obstbaukolonie Eden bei Berlin-Oranienburg. In der ganzen Zeit ist keiner der Siedler, die den verschiedensten religiösen Richtungen und politischen Parteien angehören, wegen eines
[1] Die Frauenfrage im Mittelalter, S. 48.
[2] Stahl, a. a. O. S. 74, 83 usw. Nach einer Notiz in der Zeitschr. f. Sozialwissenschaft III, S. 396 waren 87,4 % der russischen Prostituierten vater- und mutterlose Waisen: „ein sprechender Beweis gegen die Lehre von der geborenen Prostituierten“.
[3] The communistic societies of the United States; vgl. unsere Siedlungsgenossenschaft, S. 442.
[4] Die Staatsromane, S. 119ff.
[5] Vgl. Siedlungsgenossenschaft, S. 477ft., ferner Wege zur Gemeinschaft, S. 495ff.
[759 ]
Vergehens oder Verbrechens auch nur angeklagt gewesen, ist kein uneheliches Kind geboren worden. Der seelischen Gesundheit entsprach die leibliche: Eden hält den Weltrekord der Säuglingssterblichkeit. Die deutsche Durchschnittsziffer betrug in den 90 er Jahren etwa 24% und sank vor dem Weltkriege langsam auf 18%. Eden aber hatte im Durchschnitt nur 3,8 %, also etwa den fünften Teil, und hat damit wahrscheinlich das absolute Minimum nahezu erreicht : denn einige Kinder werden immer lebensschwach geboren oder in der Geburt vernichtend geschädigt werden. Ja, Eden übertraf sogar alle anderen Gartenstädte : Hellerau bei Dresden hatte 9%, Hampstead bei London 6,6% und sogar Letchworth 5,5 % Säuglingssterblichkeit. Ebenso günstig ist die Gesundheit der älteren Kinder : in der ganzen Zeit ist nicht ein einziges der mehr als dreihundert Kinder gestorben, die die Edener Schule besuchten [1]. Und das auf einer Siedlung, die auf 50 Hektar ärmsten Landes 350, also, berechnet auf den Quadratkilometer, 700 Köpfe zählt und größtenteils von Gartenbau lebt!
Diese Ziffern sind für die Vertreter der bürgerlichen Theorie sehr unangenehm; man kann es daher wohl verstehen, daß es unseren Bemühungen bisher nicht gelingen konnte, unsere Gegner zu einer Betrachtung und Diskussion dieser an sich so sehr erfreulichen, für ihren soziologischen Skeptizismus und Pessimismus aber so sehr unerfreulichen Tatsachen zu bringen.
Wir könnten noch eine Anzahl anderer Tatsachen beibringen, die wir an anderer Stelle zusammengetragen haben, so z. B. daß nach dem Eingeständnis der englischen Blautempler „die Genossenschaft mehr für die Austreibung des Schnapsteufels tut als alle unsere Schriften“ ; oder die erstaunliche Tatsache, die wir nach Sismondi über die Besiedlung von Zagarolo bei Rom durch eine Schar blutarmer Bettler und Vagabunden berichten konnten [2]. Aber wir nehmen an, daß die bisher hier berichteten Daten den nicht unheilbar klassenbefangenen Leser bereits überzeugt, zum wenigsten aber stutzig gemacht haben.
Jetzt verstehen wir die oben über die Zunft mitgeteilten Tatsachen besser :
Die Sperrung des Bodens erzwingt die Sperrung der Zunft.
Denn darüber kann gar kein Zweifel bestehen, daß diese ganze Umwandlung der städtischen Gewerbe zum Kapitalismus durch die Sperrung des Bodens in Form des massenhaften Großgrundeigentums, durch die Verwandlung der Großgrundherrschaft in das Großgrundeigentum eigentlichen Sinnes verursacht worden ist. Die historische
[1] Unsere „Wege zur Gemeinschaft“, S. 500.
[2] S. S. III, S. 599.
[7б0]
Schule hat den ihr vor fast 30 Jahren hingeworfenen Handschuh bis heute nicht aufgenommen. Ich hatte ihr vorgeworfen, daß sie den Hauptwendepunkt ihres Hauptarbeitsgebiets: der mittelalterlichen Gewerbegeschichte, um nicht weniger als 180 Jahre zu spät datiert. Der ausführliche Beweis findet sich in „Großgrundeigentum und soziale Frage“ S. 391 ff. Hier können nur die Hauptargumente in äußerster Kürze dargestellt werden:
Die historische Schule setzt den Umschwung auf ca. 1550, also 25 Jahre nach der letzten gewaltigen Explosion der durch den agrarischen Kapitalismus verschuldeten Bauernnot, die schon seit mehr als einem Jahrhundert in immer wiederholten bäuerlichen Aufständen Deutschland erschütterte. Und sie erklärt diesen Umschwung dogmatisch-malthusisch aus einer „Übervölkerung“, obgleich die seit dem schwarzen Tode von 1350 immer wieder durch schwere Pestausbrüche gezehntete Bevölkerung kaum schon den Stand vor der Pest wieder erreicht haben konnte. Die Erklärung ist prinzipiell irrig, weil das Bevölkerungsgesetz nicht existiert, und sie ist hier im besonderen wertlos, weil die Bevölkerungsstauung in den Städten, die Folge der von der Bodensperrung verursachten Massenabwanderung, ohne weitere Untersuchung als Zeichen einer allgemein übermäßigen Volksvermehrung angegeben wurde.
In Wahrheit erfolgt der Umschwung etwa 1370. Um diese Zeit hat die Sperrung des Bodens zuerst im slawischen Siedlungsgebiete, die als Folge des wachsenden Kornbedarfs des industriellen Westens, namentlich Flanderns auftritt, schon einen bedeutenden Grad erreicht und ist, von Ost nach West, von den Küsten und schiffbaren Strömen ins Innere des flachen Landes vorschreitend, auch bereits im Deutschen Reiche zu gefährlicher Ausdehnung gekommen. Ihre Wirkung haben wir folgendermaßen zusammengefaßt (395) :
Um diese Zeit herum treten folgende Erscheinungen im deutschen Volksleben scharf ausgeprägt hervor:
In der allgemein-politischen Gestaltung: das Aus- und Pfahlbürgerrecht verfällt, der Bauer stürzt in seiner sozialen Stellung tief unter den Bürger; der Siegesgang der Handwerker gegen die Geschlechter hat ein plötzliches Ende, selbst in den Zunftstädten dringt die Reaktion siegreich vor ; die süddeutschen Städtebünde erliegen und zerfallen, während die Hansa jetzt erst den glänzenden Aufschwung nimmt. Die Territorialfürsten gewinnen die Obmacht, die adligen „Stände“ erringen in den Fürstentümern den hauptsächlichen Einfluß, das römische Recht dringt siegreich vor.
Auf dem platten Lande: Verfall der bäuerlichen Standesfreiheit und des Hoferechts, Häufung eines landlosen Proletariats, Auftauchen von Beisassen und Kossäten in Gerechtsamegemeinden, Verschuldung
[761]
der Bauern, Zersplitterung der Betriebseinheiten in Zwerg wirtschaften, Untergang neuangelegter Dorf schaffen, die sich als „unrentabel“ herausstellen, Usurpation der Allmenden, Entstehung von Großgütern oder wenigstens einer Großherdenhaltung der Grundherren auf den Allmenden.
In den Städten : Entstehung eines vierten Standes, bestehend erstens aus Gesellen, die sich als Klasse gegen die Meister stellen und mit Koalitionsverboten beschränkt werden, zweitens aus einem massenhaften nichtshäbigen Proletariat unqualifizierter „Arbeiter“; — Vernichtung der Zünfte der ungelernten Arbeit; Entartung der Zünfte der gelernten Arbeit: Anfänge des „Zunftgeistes“ (Meisterstück, Meisteressen, Wanderzwang, Lehrzwang, Mut jähre, Bannmeile usw.); Lohnregulierungen, Gewerkvereine und Streiks erscheinen; Akkordlohn und Heimindustrie nehmen ausbeuterischen Charakter an; die Produktionsrichtung macht eine deutliche Schwenkung zur Luxusproduktion und zum Export- industrialismus ; die Kleinstädte bleiben stehen oder verfallen, die Großstädte wachsen ungesund. Große Kapitalvermögen bilden sich, die Kreditwirtschaft im eigentlichen Sinne beginnt mit „produktiven Anlagen“ und Spekulation; der Zinsfuß fällt und wird bald stationär, großindustrielle Anlagen entstehen, der „Gradient“ wächst enorm.
In der Tat: eine Umwälzung, welche alle Klassen des Volkes, alle Organe der Volkswirtschaft mit gleicher Wucht und Kraft ergreift.
Demgegenüber beruhen die Gründe für die Datierung der historischen Schule auf 1550, ganz abgesehen davon, daß sie von einer falschen Prämisse abgeleitet werden, nur auf einer isoliert betrachteten Seite einer isoliert betrachteten Abteilung der Volkswirtschaft. Es ist weder auf die anderen Seiten der städtischen Entwicklung, noch auf die andere Abteilung der Volkswirtschaft, nämlich die Landwirtschaft, noch auf die zweite große Abteilung der Soziologie: auf Politik und Standesbildung, Rücksicht genommen.
Wir wiederholen: wir betrachten unsere Datierung und damit unsere Erklärung des kapitalistischen Umschwungs in den Städten aus dem mit der Bodensperrung einsetzenden agrarischen Kapitalismus als vollkommen gesichert [1].
Wie schnell dann der Kapitalismus fortschritt, dafür nur zwei Belege :
Der Begründer des Welthauses Medici, Averardo, der in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts lebte, hatte noch kein großes Vermögen besessen: aber Cosimo und Lorenzo besaßen 1440 bereits etwa 30 Mill.
[1] Karl Lamprecht schreibt in dem oben erwähnten Brief, den ich im Vorwort zur 2. Auflage des „Großgrundeigentums“ publiziert habe (S. VI): „Der von Ihnen hergestellte Zusammenhang zwischen ländlicher und städtischer Bewegung in dieser Zeit scheint mir evident.“
[7Ó2]
Mark heutigen Wertes. Die Fugger gewannen vom 14. Februar 1511 bis Ende 1527 mit einem Grundkapital von rund 200000 Gulden nicht weniger als eine Million 824000 Gulden, 924% in 17 Jahren oder durchschnittlich 54%% jährlich [1].
Waren in der Periode der reinen Ökonomie die Mitglieder der Oberklasse die Leidtragenden, die von ihren Arbeitern friedlich expropriiert wurden, so vollzieht sich jetzt das umgekehrte. So z. B. im Bergbau. Seit Mitte des 15. Jahrhunderts entglitten die Bergwerksanteile in rasch wachsendem Umfang den Händen der alten Gewerke und wurden von vermögenden Leuten, adligen Herren, oder großen Handelshäusern namentlich Nürnbergs und Augsburgs aufgekauft [2].
Wir sehen auch hier wieder, daß richtige Deduktion aus wahren Prämissen Resultate ergibt, die mit der Wirklichkeit vollkommen übereinstimmen.
IV. Die Freibürgerschaft. ↩
Wir werden nunmehr versuchen, mit derselben Methode nach der wirtschaftlichen auch die politische Verfassung der klassenlosen Gesellschaft zu deduzieren. Dilthey hat einmal gesagt, eine Methode sei einem Messer zu vergleichen: es käme nur darauf an, ob es schneide. Wir hoffen, bewiesen zu haben, daß unser Messer sehr gut schneidet.
1. Die Übergangsperiode. ↩
Eine Anzahl unserer Gegner aus dem marxistischen und neuerdings aus dem kommunistischen Lager werfen uns vor, unsere Absicht sei, „den Kapitalismus zu überlisten“. Dieser sehr unbegründete Einwand zwingt uns, die möglichen Erscheinungen der Übergangszeit ins Auge zu fassen, während deren sich die von uns als notwendig nachgewiesene Bauernpolitik allmählich durchsetzt:
Die Voraussetzung ist, daß sich die Einsicht in die hier von uns entwickelten Zusammenhänge allmählich verbreitet und zu den entsprechenden wirtschaftspolitischen Gestaltungen führt. Diese Voraussetzung ist allerdings die conditio sine qua non. Ich habe immer und immer wiederholt:
Nichts ist so praktisch wie die Theorie!
Es sei gestattet, hier, nachdem wir bereits die eindrucksvollen Kantischen Sätze über die „pöbelhafte“ Berufung auf die Erfahrung angeführt haben, eine Auslassung von Constantin Frantz zu zitieren: „Bei jedem Schritte wurde mir klarer, wie sehr der ganze gegenwärtige Zustand Europas mit den herrschenden Staatslehren zusammenhängt.
[1] Ehrenberg, Das Zeitalter der Fugger I, S. 119.
[2] Sombart, a. a. O. I, S. 279.
[763]
So sehr, daß selbst diejenigen dadurch beeinflußt und geleitet werden, welche nicht einmal eine äußere Kenntnis jener Lehren besitzen, oder wohl gar durch ihre geflissentliche und zur Schau getragene Verachtung aller Theorie ihre Unwissenheit beschönigen möchten, indessen doch ihr eigenes Urteil und Handeln selbst vielleicht durch die allerschlechteste Theorie bestimmt wird, die sie ganz unbewußt in sich aufgenommen haben“ [1].
Zum Glück kann es keinem Zweifel unterliegen, daß jene Voraussetzung zu irgendeiner Zeit, die ich freilich kaum noch die Hoffnung habe, selbst zu erleben, verwirklicht sein wird. Nicht nur, weil es denn doch auf die Dauer unmöglich ist, daß die sorgfältig begründeten Lehrmeinungen eines Mannes totgeschwiegen werden, der sich doch immerhin eine gewisse Anerkennung als Fachmann erworben hat; nicht nur weil einer nach dem anderen von den Schülern dieses Mannes in akademische Lehrstellungen einrückt: sondern vor allem aus dem Grunde, weil die Umlagerung der Gesellschaft die in Betracht kommenden Parteien unwiderstehlich zwingen wird, diese Lehre anzunehmen. Wir wissen, daß eine Gruppe immer vom Orte höheren sozialen Drucks zum Orte geringeren sozialen Drucks auf der Linie des geringsten Widerstandes strömt, ganz wie ein Fluß; und ganz wie bei einem Fluß paßt sich die Strömung in Krümmungen aller Art den Hindernissen des Geländes an. Zu jeder Zeit erscheint nun der strömenden Gruppe diejenige gesellschaftliche Lehre als ihr endgültiger Zielpunkt, die zufällig gerade in der augenblicklichen Stromrichtung vor ihr steht. Sobald die Stromrichtung sich ändert, wählt sie diejenige Theorie als ihr Bekenntnis, auf die jetzt der Strom zufließt. Das geschieht zwar nicht momentan, weil Ideen ihre „Eigengesetzlichkeit“ besitzen, aber es geschieht doch bald mit Notwendigkeit.
Die Dinge liegen nun heute so, daß überall in der Welt die großen Parteien der Untergruppe sich am Umbiegungspunkt der Stromrichtung befinden. Das gilt vor allem von der sozialdemokratischen Partei. Sie muß jetzt erkennen, daß immer derjenige die politische Macht hat, der das Land besitzt, und braucht ein neues Agrarprogramm, eine neue „Bauernpolitik“ [2]. Dieses Programm kann nicht kommunistisch sein, weil das Landvolk sich als gegen diese „Poesie“ vollkommen immun erwiesen hat, sogar im sowjetistischen Rußland.
Dazu kommt, daß diese Parteien auf die Dauer den Kampf gegen die links von ihnen entstandenen konsequent kommunistischen Gruppen unmöglich mit Erfolg führen können, solange sie selbst den Kommunis-
[1] Die Naturlehre des Staates, S. XII.
[2] Es hat sich gezeigt, „genau wie zu Proudhons Zeiten, daß die sozialdemokratische Dogge den kapitalistischen Stacheligel wohl verbellen, aber nicht fassen kann“ (Beckmann a. a. O. S. 32).
[764]
mus mit den Lippen bekennen. Hier tut eine reinliche Scheidung bitter not, soll nicht der Bruderkampf innerhalb der Arbeiterklasse alle politische Macht in die Hände des kapitalistischen Imperialismus spielen und überall der faszistischen Diktatur den Weg bereiten.
Die Erkenntnis wird also kommen. Ob früh genug, um Europa noch zu retten, wissen wir nicht. Aber das ist, sub specie aeternitatis betrachtet, auch nicht von allzu großer Bedeutung. Bevor eine der großen Parteien in einem der großen Länder sich offiziell zu der Bauernpolitik bekennen wird, ohne sie, wie leider die Sowjets, mit der ebenso überflüssigen wie Gut und Blut zerstörenden kommunistischen Gewerbepolitik zu verquicken, werden kleine aufgeklärte Kreise die ersten Schritte tun, um Vorbilder für eine spätere sozialreformerische Aktion im großen dadurch zu schaffen, daß man die möglichen Formen experimentell gestaltet. Das ist zum Teil schon durch Private und einzelne Regierungen in der Form der einfachen Bauernkolonisation geschehen: in Irland und Schottland, in Mecklenburg, im ostelbischen Preußen auf Grund der Ansiedlungs- und Rentengutsgesetze. Dabei hat sich bereits herausgestellt, daß die Produktivität der Landwirtschaft nicht nur, wie selbstverständlich, in der Erzeugung von Vieh und Viehprodukten, sondern auch in der von Brotkorn, Kartoffeln und sogar Zuckerrüben wesentlich gehoben worden ist; und ferner, daß streng nach der Theorie die Städte und Gewerbe in den von der Bauernsiedlung beglückten Bezirken des ehemaligen Großgrundeigentums den schönsten Aufschwung genommen haben [1]. Bevölkerung und Wohlstand haben sich erstaunlich vermehrt.
Diese bisherige Bauernkolonisation unterliegt vor allem dem Bedenken, daß sie dem einzigen schweren Schaden der Bauernwirtschaft, der Erb- und Aussteuerverschuldung, das Tor öffnet, weil bei Verkauf und Vererbung nicht nur die Melioration des Bauerngutes: Gebäude und Inventar, sondern auch der Wert des Bodens selbst in Anrechnung kommt [2]. Aus diesem Grunde wird die Bauernpolitik sich im wesentlichen auf die Schaffung genossenschaftlicher Ansiedlungen einzustellen haben. Hier sind zwei Formen möglich: die Produzentengenossenschaft von in ihren Betrieben selbständigen Erbsiedlern, die ihren Grund und Boden nicht verschulden können, weil er in irgendeiner Rechtsform unter dem Obereigentum der Genossenschaft bleibt. Und zweitens die Produktivgenossenschaft: der Großbetrieb, dessen sämtliche Arbeiter Genossen, und dessen sämtliche Genossen Arbeiter sind. Welche der beiden Formen unter rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten vorzugswürdig ist, kann nur durch eine Anzahl von Versuchen herausgefunden werden. Wahrscheinlich wird je nach Verkehrslage, Erzeu-
[1] Unsere „Soziale Frage und Sozialismus“, S. 86ff.
[2] Vgl. S. S. Ill, S. 6o4ff.
[765]
gungsrichtung und Bodenfruchtbarkeit hier die eine und dort die andere Form produktiver und rentabler sein; noch wahrscheinlicher ist uns, daß die Kombination der beiden Formen den endgültigen Sieg davon tragen wird, wie wir sie in unserer „Siedlungsgenossenschaft“ und unserer „genossenschaftlichen Ansiedlung“ skizziert haben. Ein solcher Versuch, die zunächst als „Anteilswirtschaft“ aufgezogene gemeinnützige Siedlung Bärenklau bei Berlin, tritt in dem Augenblick, wo wir dieses schreiben, in ihr sechstes Lebensjahr ein und verspricht weiteres gutes Gedeihen: immerhin ein beträchtlicher Erfolg angesichts des Umstandes, daß uns die großen agrarischen Autoritäten fast einhellig den Zusammenbruch binnen sechs Wochen oder längstens binnen sechs Monaten vorausgesagt hatten. Es hat sich bereits jetzt, trotz aller Schwierigkeiten dieser Nachkriegszeit, herausgestellt, daß die Arbeiterschaft mindestens so gut arbeitet und mindestens so gut Disziplin hält, wie auf Privatgütern: und es sind nicht etwa ausgesuchte Leute, sondern es sind die mit dem Gut übernommenen Familien!
Wenn die ersten Versuche weiterhin zum Segen der Landeskultur und der Volksernährung ausfallen, so werden sie in immer vermehrtem Umfang nachgeahmt werden. Wenn sich darüber hinaus unsere wohlbegründete Hoffnung erfüllt, daß diese Betriebsformen auch eine höhere Rentabilität aufweisen, so wird die Bewegung noch schneller vorschreiten, weil Landbanken daran in ganz legitimer Weise beträchtliche Gewinne machen könnten. Die großen Konsumvereine der Großstädte, die, wie z. B. die englischen Verbände und in Deutschland die Hamburger „Produktion“, bisher mit ihren Gutskäufen keine günstigen Erfahrungen gemacht haben [1], würden dann wahrscheinlich dazu gebracht werden können, ihrerseits die Bewegung aktiv zu fördern. Auch die Gewerkschaften würden dann vielleicht davon zu überzeugen sein, daß eigener erheblicher Grundbesitz eine überaus scharfe Waffe in ihren Lohnkämpfen sein könnte. Sie könnten ihre Mitglieder während solcher Konflikte in großer Zahl vom städtischen Arbeitsmarkt gänzlich zurückziehen und bei geschickter Disposition sogar produktiv in der Melioration ihres Gutsbesitzes beschäftigen, jedenfalls aber, viel billiger und in, für die Betroffenen weit angenehmerer, Weise während der Zeit der Arbeitslosigkeit unterhalten.
Nehmen wir nun an, daß in irgendeinem Bezirk eine Anzahl solcher Güter genossenschaftlich umgewandelt worden seien. Die früheren Landarbeiter genießen höherer Einkommen, besserer Wohnung, weitaus besserer Behandlung, und sehen den Weg zu eigener Selbständigkeit weit
[1] Sie haben die Güter kapitalistisch mit Lohnarbeitern bewirtschaftet und hatten dabei auch noch alle Nachteile der sog. „Administrationswirtschaft“ durch Beamte. Vgl. Vorwort zur 2. Aufl. der „Siedlungsgenossenschaft“, S. IV/V.
[766]
geöffnet vor sich. Eine Anzahl von Handwerkern: Schmiede, Zimmerleute, Maurer, Schuhmacher und Schneider usw. haben sich angeschlossen und finden in Selbständigkeit, unterstützt durch eigenen Erbbesitz an Land, ihr gutes Auskommen. Die Kenntnis dieser Erfolge verbreitet sich in immer wachsenden Kreisen der Nachbarschaft. Die Landarbeiter der anderen Großgüter streben nach dem gleichen Ziele. Sie haben im Falle von Konflikten moralisch und finanziell Rückhalt an den Genossenschaften; ihre etwa entlassenen Führer finden hier Aufnahme, Brot und soziale Anerkennung.
Wenn jetzt hier eine Partei der Erbsiedler sich bildet, so hat sie die Gewißheit, früher oder später den Wahlkreis zu erobern. Sie wird nicht nur die gesamte Landarbeiterschaft für sich haben, sondern unter unserer Voraussetzung allmählich auch einen wachsenden Teil der industriellen Arbeiter der in den Wahlkreis eingesprengten Städte, ferner den allergrößten Teil der Intelligenz, die gegen das Programm der Bauernpolitik nicht die geringste stimmungs- oder verstandesmäßige Abneigung hat, zahlreiche Kleinbauern und Zwergwirte, die die Möglichkeit vor sich sehen, ihren allzu kleinen Grundbesitz abzurunden, und viele Handwerker, denen man ad oculos demonstrieren kann, daß ihre gesamte wirtschaftliche Stellung gewaltig gehoben wird, wenn ihre ländliche Kundschaft sich an Zahl und noch mehr an Kaufkraft vermehrt. Die Mittelbauern werden neutral bleiben, da ihnen nicht die geringste Beeinträchtigung droht: und nur die ländlichen Großbesitzer und die Kapitalisten werden Gegner sein, die aber auf die Dauer nicht stark genug sein können, um ihre Kandidaten durchzusetzen.
Der erste Wahlsieg muß die politische Atmosphäre völlig ändern. Zwei Fälle sind theoretisch möglich. Der eine ist der, daß die herrschende Klasse noch mächtig genug ist, um das noch kleine Feuerchen auszustampfen. Wie das auf gesetzlichem Wege geschehen könnte, ist allerdings schwer einzusehen. Man müßte das ganze Recht des Grundeigentums, das Hypothekenrecht und das Genossenschaftsrecht von der Wurzel aus umgestalten, um zum Ziele zu kommen, und müßte dabei tiefer ins eigene wirtschaftliche Fleisch schneiden, als vielleicht erträglich wäre. Es bliebe also kaum anderes übrig, als außergesetzliche Gewalt, womöglich maskiert in die scheingesetzliche Form verwaltungsmäßiger Schikanen, schlimmstenfalls offener Terror, gewaltsame Unterdrückung. Wir halten das durchaus für möglich: das Wort „qui mange du pape en meurt“ gilt von jeder praktischen Agrarreform der bisherigen Geschichte. Solon mußte ins Exil gehen, und die Gracchen starben unter den Dolchen der bedrohten Herrenklasse.
Aber das gerade wäre der Sieg des Gedankens! Er trüge die Krone des Märtyrers, und das ist auf die Dauer die des Siegers.
[767]
Er würde die Welt erobern und dann in solchen Ländern schnelle und glorreiche Wirklichkeit werden, in denen die Herrenklasse schon nicht mehr die Möglichkeit besitzt, ihre Interessen mit nackter Gewalt zu verteidigen. Was heute etwa in Polen noch möglich ist, ist schon längst nicht mehr in Deutschland möglich und noch weniger in Großbritannien.
Irgendwo muß also der zweite Fall eintreten, den wir ins Auge zu fassen haben: der erste Wahlsieg der Erbsiedlerpartei wird alle anderen politischen Gruppen, ausgenommen die Klassenvertretung des Großgrundeigentums selbst und vielleicht der Großbauernschaften, dazu zwingen, die siegreiche Aktion, die sie schon längst sämtlich als „Sonntagsbekenntnis“ in ihrem Programm fordern, zur wirklichen Werktagsaktion zu machen und allen anderen praktischen Bestrebungen voranzustellen, um nicht die Landkreise zu verlieren. Das gilt vor allem für die städtischen Arbeiterparteien, gilt aber in Deutschland unbedingt auch für das Zentrum. Die Parteien werden darin wetteifern, sich durch Bauernsiedlungen eigene feste Stützpunkte zu schaffen; und sie werden damit auf die Dauer nichts anderes erreichen, als daß alle diese Siedlungen zuerst wirtschaftlich und dann auch politisch zu der einen großen Partei verschmelzen, die nicht mehr den „Staat“, wohl aber die jetzt entstandene Freibürgerschaft beherrscht und im Interesse der Gesamtheit, nicht aber mehr einer winzigen Minderheit leitet.
Man hat mir öfters den folgenden Einwand gemacht : die Deduktion, daß die Bauernsiedlung großen Stils die noch bestehenden Großgutsbetriebe durch Absaugung ihrer Arbeiterschaft ruinieren würde, ist nur richtig, wenn man ein einzelnes Land ins Auge faßt. Aber in Deutschland z. B. würden die Großagrarier in diesem Falle fremde Arbeiter massenhaft einführen; wenn es keine Polen oder Russen mehr sein könnten, würden es eben japanische oder chinesische Kulis sein.
Darauf erwidere ich : erstens, daß eine solche Umwälzung der gesamten Grundverfassung unmöglich auf ein einzelnes Land beschränkt bleiben kann. Diejenige Staatsgesellschaft, die sie zuerst durchführen würde, würde an Reichtum und militärischer Kraft so ungeheuer wachsen, daß die anderen Staaten schon aus diesem Grunde gezwungen wären, nachzufolgen, selbst wenn ihre eigene Unterklasse nicht mit allen gesetzlichen, und im Notfall mit revolutionären, Mitteln die Einführung der rettenden Reform auch von ihnen fordern oder erzwingen würde. Politische Grenzen stellen weder für Gedanken noch für wirtschaftliche Umwälzungen ernsthafte Widerstände dar.
Zweitens aber : stellen wir uns für einen Augenblick auf den Standpunkt eines einzelnen Landes. Nehmen wir an, daß in der ersten Zeit der Übergangsperiode z. B. die deutschen Agrarier noch die Macht hätten, die in ihren Arbeiterbestand gerissenen Lücken durch den Import von
[768]
Fremdarbeitern zu stopfen. Dann wird ihr Todeskampf nur verlängert werden. Soweit die Fremden erwünschten Zuwachs darstellen, werden auch sie in die Bauernsiedlungen einbezogen werden, deren Kapazität fast ohne erkennbare Grenze ist, weil sie mit ihrem Wachstum sich auch den im gleichen Schritt wachsenden Markt städtischer Elemente selbst erschaffen. Soweit die Fremden aber, weil rassefremd, etwa nicht erwünscht sein werden, wird eines Tages ihre Einfuhr einfach verboten werden in dem Augenblick, wo die Anhängerschaft der Bauernpolitik im Reichstag die Mehrheit erlangt haben wird.
Soviel für die Übergangszeit, die irgendwie, hoffentlich ohne Bürgerkrieg, überwunden werden muß.
2. Der Dauerzustand. ↩
Für den Dauerzustand der Freibürgerschaft besitzen wir keine so absolut beweisenden Tatsachen wie für den der reinen Ökonomie. Zwar wären wir in der Lage, auch hier viele Züge historisch zu belegen : aber das ist immer nur möglich in bezug auf kleinere Gruppen; in unserem großen Beispiel, der reinen Ökonomie des hohen Mittelalters, hat es nämlich zwar keine ökonomisch bedingten Klassen, wohl aber noch politisch bedingte Stände gegeben: Fürsten, Adel und hohen Klerus, mit Ehrenvorrechten und Tributrechten, so daß die politischen Züge der Freibürgerschaft hier nicht mit gleicher Klarheit hervortreten konnten, wie die der reinen Ökonomie. Um so erstaunlicher ist es, daß diese sich dennoch so entscheidend durchzusetzen, ja, wie wir gesehen haben, die wirtschaftlichen Unterschiede in der „Übergangsperiode“ so radikal abzubauen imstande war. Wir sind hier im wesentlichen auf die Deduktion angewiesen, glauben aber, daß die Schlüsse aus unseren Voraussetzungen geradezu apodeiktisch sind: und unsere Voraussetzungen dürfen wir als vollkommen gesichert betrachten.
Diese Voraussetzungen sind: erstens, es gibt keine anderen Unterschiede des Einkommens und Vermögens als die der Qualifikation entsprechenden, und diese Unterschiede sind gering. Also mit anderen Worten: es besteht der „Zustand der rationellen Gleichheit“. Zweitens: es gibt keine Großstädte im heutigen Sinne.
a) Die Sozialpsychologie.
Um zunächst die sozialpsychologischen Folgen der zweiten Bedingung flüchtig zu betrachten, so lebt hier also alle Welt in relativ kleinen, leicht übersehbaren Siedlungen. Und das heißt: der Mensch ist hier nicht mehr, wie heute in der Großstadt, lediglich eine statistische Nummer, sondern ein in einen festen sozialen Zusammenhang einge-
[769]
ordneter Bürger. Und das bedeutet wieder, daß er unter ständiger Aufsicht seiner Mitbürger steht: er kann sich nicht im geheimen Ausschweifungen und verbrecherischer Lebensweise hingeben; schon der jedermann offenliegende Zustand seines Häuschens und Gartens, die Kleidung und das Benehmen seiner Familienmitglieder sind deutliche Zeichen für seine wirtschaftliche und sittliche Tüchtigkeit. Er kann aber auch nicht mehr wie heute gelegentlich in der alles verdeckenden Atmosphäre der Großstadt verschwinden, um seinen lasterhaften oder verbrecherischen Neigungen die Zügel schießen zu lassen. Was aber eine derartige Aufsicht bedeutet, wissen wir z. B. aus den Erfahrungen •der ländlichen Raiffeisenkassen, die ihren Mitgliedern ungestraft die unbeschränkte Haftpflicht zumuten können, eben weil das Offenliegen der Lebenshaltung jedes Kreditschuldners Unwirtschaftlichkeit in der Regel verhindert und in den seltenen Fällen, wo sie vorkommt, so schnell und rechtzeitig enthüllt, daß die Rechner rechtzeitig eingreifen können, um die Genossenschaft vor Schaden zu bewahren.
Dazu kommt ein Wichtigeres: das Streben nach bürgerlicher Anerkennung, nach „Prestige“, kann sich in diesen kleinen Siedlungen leicht auf nicht nur harmlose, sondern sogar nützliche Weise befriedigen. Heute, unter den schlimmen Verhältnissen namentlich der Großstadt, führt dieses allmenschliche Streben, der Sporn allen Fortschritts, ein an sich durchaus sittlicher Trieb, leider oft genug auf Abwege, die in sittlichen und wirtschaftlichen Verfall und zuweilen bis ins Zuchthaus und aufs Blutgerüst führen. Der junge Großstädter namentlich der weniger geschützten und größeren Versuchungen ausgesetzten Unterklasse kommt unter der Wirkung dieses Triebes, in dem Wunsche, sich in seiner Gruppe auszuzeichnen, häufig zunächst zu schweren alkoholischen Exzessen und damit auf die schiefe Ebene, die über das Zuhältertum bis zum schwersten Verbrechertum führt. Und es sind oft gerade die an Körper, Geist und Willen Begabtesten, die, unter der Wirkung des klassenmäßigen Ressentiments, sich zu Roheitsdelikten und Schlimmerem verführen lassen. Man weiß, daß der Weg von gewissen Athletenklubs zum Apachentum nicht viele Schritte lang ist, und daß diese „Mutterlauge des Verbrechens“: die Verbindung von Kriminalismus und Prostitution, eine lockende, geradezu dämonisch faszinierende Anziehungskraft gerade auf die stärksten, mutigsten und willenskräftigsten Elemente der großstädtischen Jugend ausübt; all das ist von einem Schimmer infernalischen Heldentums umwittert.
In der Freibürgerstadt gibt es keine Großstädte, keine Slums, keine Prostitution in dem einzigen Sinne, der uns interessiert: als gewerbsmäßig käufliche Hingabe der Frau an beliebige und beliebig viele Männer, gibt es kein Klassenressentiment, und daher nicht die Mißleitung des Triebes des Gruppenprestige auf Exzesse in Baccho et Venere als helden-
[770]
mäßige Taten zum Trotz der Gesetze und der Polizei. Hier wird das- selbstverständlich weiter wirkende Auszeichnungsbedürfnis andere, harmlosere Befriedigungsmöglichkeiten haben. Schon die unzähligen Arten des Sports bringen Viele an irgendeine weit sichtbare Stelle : als- Schwer- oder Leichtathleten, im Fuß- und Baseball, im Lauf, im Sprung, im Speer- und Diskuswurf, im Ringen und Fechten usw. Andere, körperlich weniger Begabte, werden als geschätzte Mitglieder von Vereinen für Gesang, Instrumentalmusik, Schauspielaufführungen oder etwa Schachspiel die Stelle erreichen, die ihren Ehrgeiz befriedigt. Denn nicht mehr ist oben das Geld, und unten die rohe Kraft das einzige Mittel, um sich auszuzeichnen. So kann sich jeder nach seiner Individualität, zu seiner Befriedigung und Freude ausleben.
Wenn ein Bild gestattet ist : einer der schönsten Bäume des Nordens ist die frei stehende Kiefer, ein breitästiger, knorriger, individuell eigenwüchsiger Baum. Aber in der modernen Kiefernforst, die um der Gewinnung von Nutzholz halber angelegt ist, ist die Kiefer ein trauriger Besen, der die unteren Äste abzuwerfen gezwungen ist, um sich verzweifelt immer länger zu strecken, dem ihm noch vergönnten kärglichen Himmelslicht entgegen. Ganz ähnlich ist auch der in eine kleinere Siedlung eingeordnete Bürger ein eigenwüchsiges Individuum von nur ihm eigener Gestalt und Schönheit: aber der Staatsbürger des zentralisierten Einheitsstaates wird genau so wie die Kiefer als, und auf, Nutzholz gezüchtet und ist gerade so nur eine statistische Nummer in der Rechnung des Klassenstaats und gerade so ein verkümmertes Exemplar seiner Gattung.
Diese Eigenwüchsigkeit wird nun hier auch befördert durch die rationelle Gleichheit der wirtschaftlichen Lage. Hier, wo alle Unehrlichkeit bald entlarvt werden muß und sofortige Schande bringt, bringt nur ehrliche Arbeit Prestige. Wer hier auf ehrenhafte Weise zu höherem Einkommen gelangt, genießt ohne weiteres der höheren Bürgerehre, die dieser Beweis einer höheren Qualifikation verdient. Der tüchtigste Meister seines Gewerbes, der erfolgreichste Arzt, der gesuchteste Künstler brauchen keine Auszeichnung in anderen Dingen, um der allgemeinen Verehrung sicher zu sein [1].
Wir sagten : nur die Arbeit bringt noch Ehre, und die Auszeichnung in irgendeiner Betätigung höhere als die durchschnittliche Ehre. Mit anderen Worten: der Besitz als solcher bringt keine Ehre mehr, es sei denn als Zeichen eben dieser höheren Tüchtigkeit. Der mammonistische Geist, der die Gegenwart beherrscht, ist verschwunden. Es gibt, um noch einmal Rousseau zu zitieren, „niemanden mehr, der reich genug ist, um andere zu kaufen, und niemanden, der arm genug ist, um sich
[1] Das hat auch schon Harrington klar gesehen; vgl. Gooch, a. a. O. S. 116.
[771]
verkaufen zu müssen“. Was heute alles gesellschaftliche Leben vergiftet und zersetzt : die Hybris von oben, und die feile Demut wie der giftige Neid von unten, sind verschwunden, und mit ihnen die Todesangst vor dem Sturz in den stinkenden Sumpf des Pauperismus unterhalb der Gesellschaft. Jeder arbeitswillige und arbeitsfähige Mensch ist seines behaglichen Einkommens sicher ; die fortbestehenden geringen Unterschiede der Wirtschaftslage wecken bei allen nicht durchaus gemeinen Seelen nicht den Neid, sondern den edlen Ehrgeiz, es dem Begünstigten gleich zu tun, ihn womöglich zu übertreffen.
Wir wissen bereits: überall, wo die Bodensperre nicht besteht, wo infolgedessen keine freien Arbeiter sich massenhaft anbieten, ist der Oberbau der Gesellschaft durchaus die Genossenschaft. Und so herrscht hier auch durchaus der „genossenschaftliche Geist“ der gegenseitigen Hilfe und liebevollen Unterstützung. Hier zum erstenmal ist wahre Demokratie möglich und wirklich. Bisher konnte es nur zur größten Unordnung führen, wenn man den Besitzlosen die vollen politischen Rechte gab. Das hat schon Proudhon in schärfster Prägung ausgesprochen: „Es war an sich kein schlechter Gedanke, dem Volk die politischen Rechte zu geben: man hätte nur damit anfangen müssen, ihm das Eigentum zu geben“ [1]. Die Bedingung ist hier erfüllt, und so kann hier zum erstenmal wahre Demokratie entstehen. „Wenn man zwischen den Menschen eine aufrichtige und vollständige Gemeinschaftlichkeit der Gedanken und des Wollens herstellen will, muß man sie gründen auf dieselben Lebensbedingungen, auf die Gemeinschaftlichkeit der Interessen“ sagt Bakunin mit Recht [2]. Nur unter dieser Voraussetzung kann Demokratie das werden, was ihre besten Gläubigen von ihr erwartet haben: „Der Fortschritt Aller, durch Alle, unter der Führerschaft der Weisesten und Besten“ (Mazzini) ; „die Gleichheit der Chance, die Freiheit individuellen Wuchses und soziale Hilfsbereitschaft“ (J. T. Dye). Nur hier kann das prächtige Wort Theodor Parkers Wahrheit werden: „Demokratie bedeutet nicht: ich bin so gut wie Du, sondern: Du bist so gut wie ich“ [3].
Das ist nicht mehr die Pseudo-Demokratie im Klassenstaat, die nichts ist als eine neue Form der Herrschaft und Ausbeutung, sondern das ist die klassenlose Gesellschaft selbst, die keine Herrschaft und Ausbeutung mehr kennt. Was das aber zu bedeuten hat, möchten wir noch einmal kontrastierend mit den bitteren Worten eines Mannes darstellen, dessen Name unter den edelsten Patrioten deutscher Zunge genannt wird, Ernst Moritz Arndts in seinem „Geist der Zeit“:
[1] Théorie nouvelle de la Propriété, Oeuvres Posthumes, S. 154.
[2] Gesammelte Werke I, S. 45/46.
[3] Zusammengestellt von Lucy M. Salmon (American Journal of Sociology, Januar 1912).
[772]
„Unter der Arbeit stöhnt die Mehrzahl der Menschen, den Genuß, welchen sie haben sollten, nimmt der Staat für seine Bedürfnisse. Genuß und Freude hat die Natur allen Lebendigen verheißen, und sie müssen danach streben, sollten sie die Lust auch von Galgen und Rad herabstehlen. Weil die Kräfte überspannt sind, weil die Staatsmaschine sie wie Mühlenpferde mit verbundenen Augen rundlaufen läßt, weil sie bei der neuen Ordnung in Ausnahmen und Vorrechten so viele alte Ungleichheit und Ungerechtigkeit sehen, so hat sich ein schlauer und spitzbübischer Sklavensinn bei ihnen angesetzt, der, wo er durch das Gesetz kann, allenthalben durchdringt und wie ein Dieb wieder stiehlt, was er als ein ehrlicher Mann gab. Es ist wenig Redlichkeit zwischen den Bürgern und dem Staat; zu welcher Entwürdigung dies führt, ist begreiflich. So im gemeinen Diebssinn genießen die meisten Menschen jetzt das Leben und seine Güter ohne das Gefühl, daß, was einer hat, allen gehöre und alle es mitgenießen sollten“ [1].
b) Die innere Politik.
Echte Parteien kann es hier selbstverständlich nicht geben, wo die Klassen verschwunden sind: „denn eine völlig homogene Gesellschaft wäre nicht mehr imstande, dauernde Parteigegensätze in sich zu bergen“*). Wohl aber wird es, hoffentlich, unechte Parteien, Parteiungen und Faktionen genug geben, in denen der Ehrgeiz strebt, sich an die höchste sichtbare Spitze durchzuringen, zur Führerschaft im kleineren oder größeren Kreise : vom Vorstand des Vergnügungsvereins über den Stadtverordnetenvorsteher der Kleinstadt bis zum Präsidenten der nationalen Republik, des Völkerbundes und vielleicht des planetarischen Bundes. Davon sofort!
Zunächst die Feststellung, daß aller solcher Aufstieg nicht mehr wie heute durch die Begabung des Agitators zur rednerischen Faszination der Masse und zur Skrupellosigkeit der Versprechungen, sondern lediglich durch wirkliche Leistungen im Interesse der kleineren oder größeren Gruppe möglich ist, in der er aufsteigen will. Wir können das heute schon in einer noch so unvollkommenen Demokratie wie den Vereinigten Staaten beobachten, wo die zahlreichen Beamten der Justiz und der
[1] Bastiat schreibt in seinen Sophismes économiques: „Der Staat ist der große Schwindel (la grande fiction), durch welchen alle Welt sich bemüht, auf Kosten von aller Welt zu leben.“ Und Leroy-Beaulieu führt das Wort eines Anonymus an, der vom Etat-ulcère, der bösartigen Geschwulst Staat, spricht.
[2] Jellinek, Allgemeine Staatslehre, S. 115. Madison: „Die häufigste und dauerhafteste Ursache der Parteiungen war die Verschiedenheit und Ungleichheit des Eigentums“. Er wird, wie Otis, John Adams (Laski, a. a. O. S. 39) und Jefferson, von Harrington angeregt worden sein (Gooch, S. 121). Fries (Politik, S. 256, 262) fordert Gleichheit des Sachbesitzes.
[773]
Verwaltung, deren Wiederwahl von ihrer Wählerschaft abhängt, alles nur erdenkliche zu tun gezwungen sind, um deren Interessen zu befördern: in den Bezirken des Proletariats z. B. durch Begründung, Leitung und Unterhaltung wahrhaft großartiger Anstalten der Volkswohlfahrt und Volksbildung.
Dem bloßen Redner, dem Agitator mit dem schwülen Kopf und dem kalten Herzen, fehlt hier der Resonanzboden, den nur die Klassenscheidung bieten kann. Außerdem fehlt hier vollkommen die Nervosität und die aus ihr folgende politische Reizbarkeit des Großstädters. Hier handelt es sich nicht mehr darum, den Gegner für das bekannte Gemisch von Schurken und Trottel zu erklären und selber die unmöglichsten Versprechungen zu machen, sondern hier handelt es sich um praktische Leistungen: um Straßen, Häfen und Eisenbahnen, öffentliche Bauten, um Schule und Krankenwesen, um vernünftige und allgemein nützliche Verwendung der Steuermittel, da es hier nicht mehr darum geht, die Lasten auf die Schultern der einen zu legen, um die anderen zu bereichern. Hier sind alle Interessen gleich, und somit ist das Ziel für alle dasselbe : es kann sich nur darum handeln, welches der Zwischenziele zunächst, und wie es am besten erreicht werden kann. Und darüber entscheidet nicht mehr „Rednergebärde und Sprechergewicht“, sondern Sachverstand und ehrliche Arbeit. Es ist den Beobachtern aufgefallen, wie unvergleichlich besser von den russischen Zemstvos organisiert und gearbeitet wurde, als von der allgemeinen Staatsverwaltung : eine harte Nuß für die Rassenschwätzer! Die Lösung des Rätsels ist die soeben gegebene: wo es sich nicht um hohe Politik, sondern um praktische Aufgaben handelt, da kommen „the brains to the top“ wie in den genossenschaftlichen Kolonien nach Nordhoff überall [1].
Und es handelt sich nirgends mehr um hohe Politik. Das wollen wir zunächst für die Innenpolitik darlegen. Es gibt keine Klassengegensätze mehr, die auszugleichen und im Notfall niederzuhalten sind; es gibt keine partikulären Klasseninteressen mehr, die miteinander in dem widerlichen Schacher des heutigen Parlamentbetriebes kompromittieren. Und mehr:
Es gibt keinen zentralisierten Staat mehr!
Der zentralisierte Staat von heute, der sich in alles mischt, der alles regiert und reguliert, der dem Bürger kaum in seinen privatesten Verhältnissen etwas freien Raum läßt, ist geradeso expropriiert, von innen her ausgehöhlt und entkräftet, wie der Kapitalismus, dessen Gehäuse er war.
[1] Die Webbs berichten (a. a. O. S. 309), daß „der erfolgreiche Organisator oder geborene Redner“ sich sehr häufig durchaus nicht für die Stellung als sachverständiger Sekretär der Baumwollspinner eignete.
[774]
A. Der Föderalismus.
An seiner Stelle steht jetzt die föderalistische Gesellschaft auf dem Plan; das heißt: ein Gemeinwesen, das allen örtlichen und beruflichen Gruppen grundsätzlich soviel Freiheit läßt, wie mit dem Wohl der Gesamtheit irgend verträglich ist. Zentralisiert sind wahrscheinlich noch die großen Verkehrsunternehmungen, weil sonst leicht Privatmonopole entstehen könnten, zentralisiert sind selbstverständlich Recht und Gerichtswesen, weil im ganzen Kreise gleiches Recht und gleiche Rechtspraxis herrschen müssen, zentralisiert ist, solange es noch nötig ist, das Wehrwesen und ein Teil der Polizeimacht usw. Aber im übrigen begnügt sich der „Staat“ damit, seinen Untergliedern gewisse Mindestleistungen vorzuschreiben, und behält sich die Aufsicht darüber vor, läßt ihnen aber in diesem Rahmen völlig freie Hand, und hat nicht im mindesten etwas dagegen einzuwenden, wenn sie aus eigenen Steuermitteln in Schule und Straßenwesen, in Bauten und Kunstpflege usw. die Minima beliebig überschreiten; er stachelt diesen Wettbewerb der Kollektivitäten um die höchste Ehre innerhalb der ganzen Gemeinschaft im Gegenteil nach Kräften an.
Wir haben oben dargestellt, daß die Zentralisierung durch den absoluten Staat seinerzeit eine unvermeidliche Notwendigkeit war. Das durch die Ausschreitungen des politischen Mittels geschaffene Chaos konnte gar nicht anders geschlichtet, die Gesellschaft konnte gar nicht anders zu einiger Ordnung und Leistungsfähigkeit gebracht werden als dadurch, daß die Sonderrechte der einzelnen Individuen und Landesteile nivelliert, daß erst einmal der „Staatsuntertan“ geschaffen wurde. Es war ein Stück des Weges zur Gerechtigkeit, das hier gegangen wurde: denn Gerechtigkeit ist Gleichheit, und der absolute Staat hat wenigstens die Gleichheit der Untertanenschaft hergestellt. Er war sozusagen der Gipsverband, unter dessen Schutz, schmerzlich immobilisiert, die vollkommen zerbrochenen Knochen der Gemeinschaft wieder zusammenheilen konnten.
Aber ein Gipsverband bleibt nicht liegen, wenn die Heilung schon vollzogen ist. Die Zentralisierung war zwar ein kleineres Übel [1], aber dennoch ein großes Übel. Sie diente zuletzt doch immer der Herrschaft und der Ausbeutung und der Niederpflügung allen Eigenwuchses.
[1] Biermann, Staat und Wirtschaft, S. 93: „So scheint denn auch dem großen Menschenverächter Schopenhauer der Staat nur ein notwendiges Übel zu sein. Man hat eben die Wahl zwischen einem Zustand ohne jeden Zwang, dem Anarchismus, und einem höheren Tierbändigertum, das darüber wacht, daß der an sich völlig berechtigte Egoismus des einzelnen nicht berechtigte Interessen des anderen verletzt, d. h. dem Staate. Der Staat ist eben das kleinere von zwei Übeln.“
[775 ]
Der große und weitverbreitete Haß gegen den Staat gilt, das muß man sich klar machen, nicht bloß dem Gehäuse und Instrument der Ausbeutung, sondern auch, ganz abgesehen davon, der zentralistischen bürokratischen Plumpheit. Die Liberalen der ersten Generation erkannten noch nicht, daß der Staat ein Parasit auf dem Leibe der Gemeinschaft ist, aber sie verwarfen ihn, weil er bei jedem Versuch, das gesellschaftliche und vor allem das wirtschaftliche Leben zu regulieren, immer die Rolle des „Bull in the China-shop“ spielt ; — weil er, ob er will oder nicht, immer nur Monopole schafft und dadurch das natürliche Leben der Gesellschaft ablenkt und verzerrt, den Consensus stört, die Tendenz zur Harmonie der Interessen hemmt und zum Teil aufhebt. Das war die Stellung der Physiokraten, des Adam Smith und seiner Zeitgenossen; und diese Auffassung des Staates, als des „bösen Tieres“, wurde von der folgenden Generation der bürgerlichen Ökonomie nicht nur aus dem Grunde festgehalten, weil sie die Einmischung des Staates in das Arbeitsverhältnis, also in dasjenige, was sie die „freie Konkurrenz“ nannten, zu fürchten hatte, sondern auch, weil der Staat in der Tat ein plumpes und ungeschicktes Untier ist.
So ist z. B. die Auffassung von Herbert Spencer zu erklären. Gewiß war er, ein typischer englischer Großbourgeois, seiner persönlichen Gdeichung völlig unbewußt : aber er war doch auch ein ehrlicher Anhänger •der Freiheit in allen ihren Gestalten, auch der wirtschaftlichen. Das ist der Grund, aus dem er in seinem „the Man versus the State“ gewaltig gegen den überhandnehmenden Staatssozialismus seiner Zeit, selbst in seinen gemäßigtesten Formen, vom Leder zieht. Er verwirft ihn als zuwider der Würde des Menschen, als ein Verhängnis für die Tugenden •der Selbstverantwortung, der Unabhängigkeit und daher des Fortschrittes. Die Neigung der Menschen, ihre Last auf die Schultern des Staates zu wälzen, bereitet ihm zufolge die „coming slavery“ vor — und diese Sklaverei wird nicht milde sein. Auf ähnlichem Standpunkt steht Taine [1]: „Einzig in seiner Art, alleiniger Herr des Schwertes, der von oben her und von fern her durch Zwang und Autorität handelt, wirkt der Staat gleichzeitig auf dem ganzen Gebiet: durch gleichförmige Gesetze, durch gebieterische und umständliche Vorschriften, durch eine Hierarchie gehorsamer Beamter, die er unter strengem Befehl hält. Darum ist er untüchtig zu allen Geschäften, die andere Triebkräfte und Verfahrungsarten erfordern, um gut ausgeführt zu werden. . . . Folglich ist der Staat ein schlechter Familienvater, ein schlechter Gewerbtreibender, Landwirt und Handelsherr, ein schlechter Verteiler der Arbeit und der Unterhaltsmittel, ein schlechter Organisator der Erzeugung, des Austauschs und des Verbrauchs, ein sehr mäßiger Verwalter der
[1] Formation de la France contemporaine, Revue des Deux Mondes, 1886.
[776]
Provinz und der Gemeinde, ein Philanthrop ohne Urteil, ein unzulänglicher Leiter der Künste, der Wissenschaft, des Unterrichtswesens und der Kulte. In allen diesen Ämtern ist sein Vorgehen langsam oder ungeschickt, verläuft nach Schema F (routinière) oder macht alles kaputt (cassante), ist immer verschwenderisch, von geringer Wirkung und schwacher Ergiebigkeit, wirkt immer neben den wirklichen Bedürfnissen vorbei oder über sie hinaus, die er zu befriedigen vorgibt“. Die Einmischung des Staates lähmt den Geist der Initiative, hemmt die Konkurrenz und verlangsamt sehr schmerzlich die Fortschritte der gesellschaftlichen Kooperation.
Ganz ähnlich hatte es, unter dem Einfluß von Smith, Wilhelm von Humboldt gesehen : „Alle Einmischung des Staates in dieAngelegenheiten des Individuums ist schädlich, solange es die Rechte seines Nächsten nicht beeinträchtigt“ [1]. Er wirft ihm außer seiner Inkompetenz vor, durch solche Einmischung verhängnisvollerweise die Gleichförmigkeit im Volke zu befördern und zu dem Zweck ein großes Heer von Staatsdienern zu brauchen ; je mehr deren Zahl wachse, um so mehr vermindere sich die Freiheit der Bürger. Er will dem Staat nur die Funktionen des „Nachtwächters“ lassen: „Er enthalte sich aller Sorgfalt für den positiven Wohlstand der Bürger und gehe keinen Schritt weiter, als zu ihrer Sicherstellung gegen sich selbst und gegen auswärtige Feinde notwendig ist. Zu keinem anderen Zwecke beschränke er ihre Freiheit“' (S. 39)·
Um auch noch einen deutschen Denker über Staatsdinge von hoher Bedeutung anzuführen, dem man gewiß nicht vorwerfen kann, ein „Manchestermann“ zu sein, so war auch Constantin Frantz ein Todfeind des zentralisierten Staates: „Der Konstitutionalismus, welcher aus den Ideen von 1789 entsprungen ist, führt zur Zentralisation, und jede Zentralisation wird zuletzt militärisch“ [2].
Aber Frantz bleibt nicht im Negativen stecken, sondern entrollt positiv das Bild eines ganz anderen Gemeinschaftswesens: des Föderalismus.
Eine Bemerkung zuvor: Der Föderalismus darf nicht mit dem Partikularismus zusammengewirrt werden, wie das heute häufig geschieht, um für durchsichtige Sonderinteressen die Deckung durch eine berühmte, sehr allgemein angenommene und an sich einleuchtende Doktrin zu gewinnen. Der Partikularismus will nicht die Dezentralisation, sondern die Zentralisation, nur auf kleinerem Gebiet: statt eines zentralisierten Großstaates eine Reihe locker verbundener zen-
[1] W. v. Humboldt, Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen, S. 16.
[2] Die Naturlehre des Staates, S. 264.
[777]
tralisierter Kleinstaaten. Das ist ganz etwas anderes, und gewiß nichts gutes.
Wir haben hier nicht die Geschichte des Föderalismus zu schreiben, die wohl einer eigenen Bearbeitung wert wäre. Die Literatur ist sehr groß und schwillt in neuerer Zeit immer mehr an. Hier wollen wir nur die Hauptstufen in ihren stärksten Vertretern darstellen.
Zu den Ahnen der Idee wird man keinen geringeren als Turgot rechnen dürfen, wenn auch sein bekannter Munizipalitätenentwurf den charakteristischen Stempel der extremen Aufklärung und ihres wohl extremsten Vertreters, — denn das war Turgot — unverkennbar trägt. Der von ihm und Dupont de Nemours entworfene Plan hat nach Oncken [1] den folgenden Inhalt: „Das Ganze stellt den Aufbau von einer Reihe übereinander geschichteter Munizipalitäten dar, nämlich von ländlichen und städtischen Gemeindemunizipalitäten, von Kreismunizipalitäten, Provinzialmunizipalitäten, mit einer allgemeinen Reichsmunizipalität an der Spitze, wobei die oberen Stufen aus Delegierten der jeweils unteren beschickt werden. . . . Politische Befugnisse kommen den Kollegien hier nicht zu. Sie sollen nur zur Unterrepartition der Steuern dienen. . . . Höchstens sollen sie die in ihren Sprengel fallenden Angelegenheiten des Straßenbaus und der Armenpflege erörtern dürfen (!)“. Man sieht, hier sind wir vom Schematismus der Aufklärung und vom Zentralismus des absoluten Staates (die beide alles über einen Kamm scheren wollen) kaum schon den kleinsten Schritt entfernt.
Die folgende Generation, die von der Vorstellung der Romantiker beherrscht war, daß der Staat ein Organismus sei, sah die Dinge bereits unter einem anderen Gesichtswinkel. Heller [2] berichtet über die föderalistischen Elemente in Hegels Rechtsphilosophie. Er lehnt jedes direkte Wahlrecht jedes Einzelnen rundweg ab und will dafür eine ständische Vertretung haben, zusammengesetzt aus Grundbesitzern, die „ohne die Zufälligkeit einer Wahl durch die Geburt dazu berufen und berechtigt sind“, und aus Abgeordneten, die aber auch nicht von den „einzelnen, atomistisch aufgelöst“, sondern von den „konstituierten Genossenschaften, Gemeinden und Korporationen“ abgeordnet werden sollen. Dabei stellt sich Hegel eine starke Mitarbeit des Einzelnen „in einer Sphäre der Korporationen, Gemeinden usf. vor, wo er seine wirkliche und lebendige Bestimmung für das Allgemeine erreicht“.
Auch dieser sehr gemäßigte Föderalismus ist noch überaus zeitgebunden, gibt sich als eine Ergänzung und Verbesserung des absoluten Staates, ist ihm noch nicht grundsätzlich entgegengesetzt [3].
[1] Geschichte der Nationalökonomie, S. 452.
[2] Heller, a. a. O. S. 101/102.
[3] Im zersplitterten Deutschland fielen föderalistische Strömungen vielfach mit den, mindestens äußerlich verwandten, Tendenzen zur Wiederherstellung Deutschlands als eines einzigen politischen Körpers in der Gestalt des Staatenbundes oder Bundesstaates zusammen. Meinecke ist diesen Zusammenhängen liebevoll nachgegangen. Vgl. „Weltbürgertum und Nationalstaat“, S. 80 über Novalis und Schlegel (hier geht der Wunsch noch weiter bis zum Völkerbund, Völkerstaat und zur Weltrepublik); ferner S. 230 über A. v. Haller (ebenso S. 256), S. 343 über Pfizer, Welcker und Friedrich v. Gagern und das 6. Kapitel: „Von Heinrich v. Gagern zu Bismarck“ (S. 468—-505).
[778]
Die nächste Stufe, noch ein wenig romantisch, noch ausgesprochen bürgerlich, aber schon stark von der soziologischen Theorie beeinflußt, wird, wie erwähnt, von Constantin Frantz dargestellt: „Soll in einem Staat politische Freiheit bestehen, so muß das Volk sich selbst regieren. Die Teilnahme an der Gesetzgebung folgt dann ganz von selbst, während nicht umgekehrt aus dem Letzteren auch das Erstere folgt“ (S. 247). „Mag die Zentralgewalt im Kabinett eines absoluten Monarchen oder in einer konstitutionellen Kammer oder in einem souveränen Konvente ruhen, das ändert sehr wenig an der Sache. Immer bleibt die politische Freiheit haltungslos und kaum mehr als ein frommer Wunsch, solange die Gemeinden, Kreise und Provinzen nicht auf eigenen Füßen stehen. Ist dies nicht der Fall, so muß man sie auf eigene Füße zu stellen suchen, und nur insoweit das gelingt, wird politische Freiheit Wurzel schlagen“ (S. 214) [1].
„Weil also die Repräsentation sich gar nicht an die wirkliche Gliederung des Staates und der Gesellschaft anschließt, sondern vielmehr selbst desorganisierend wirkt, indem die Wahlversammlungen die verschiedensten Elemente zusammenwerfen, und die Wahlkreise die bestehenden Korporationen sehr häufig durchschneiden, so müssen sich wohl Parteien organisieren, um irgendeinen Halt zu gewinnen“ (S. 316). Was aber kommt dabei heraus? „Aussicht, gewählt zu werden, haben dabei im Durchschnitt nur solche Kandidaten, die selbst Durchschnittsmenschen sind, für die am leichtesten die erforderliche Stimmenmehrheit zu gewinnen ist, weil jedenfalls nichts Auffallendes an ihnen hervortritt, was diesen oder jenen Wähler abstoßen könnte. Die Mittelmäßigkeit ist privilegiert. Dazu der unvermeidliche Humbug, weil die große Masse der fast immer kenntnislosen Wähler, deren Stimmen gleichwohl entscheiden, durch Agitationsmittel und Wahlmanöver gewonnen sein will, worauf sich in der Regel oberflächliche Menschen am besten verstehen, gediegene Charaktere aber und gründliche Köpfe sich kaum einlassen mögen“ (S. 326). „Wie ganz anders wäre es, wenn die Deputierten nicht bloße Wählerhaufen verträten, sondern die Provinzen, die Kreise oder wenigstens die Gemeinden, überhaupt Korporationen, und darum ihren Deputierten zum wirklichen Rückhalt dienten“ (308).
Die höchste und letzte Stufe stellt Proudhon dar. Er ist Sozialist
[1] Diese, wie uns scheint, unbestreitbaren Äußerungen muß man, um sie völlig zu würdigen, mit den „bauernpolitischen“ Forderungen des Verfassers kombinieren (vgl. oben S. 712).
[779]
und weiß als solcher, daß der Klassenstaat mit seiner Zentralisation nicht nur ein schlechter und kostspieliger Verwalter, sondern der Träger und das Organ der kapitalistischen Ausbeutung ist. Und er ist liberaler Sozialist und als solcher der Todfeind der bis zur letzten Höhe zugespitzten und verzerrten bürokratischen Zentralisation des „Zukunftsstaates“, wie ihn die kommunistische Poesie zusammenphantasiert: eine Zentralisierung, die den Staatsbürger auch in seinem gesamten wirtschaftlichen Leben und, in ihren äußersten Zuspitzungen, sogar in seinem Familienleben beherrschen, und das heißt: vergewaltigen möchte. Erst von hier aus konnte die Notwendigkeit des Föderalismus, als des genauen Gegenspiels des zentralisierten bürokratischen Klassenstaats, voll begriffen werden; und nur dieser Einstellung konnten sich die Hauptzüge der künftigen Organisation des Gemeinwesens enthüllen [1].
Aus diesem Grunde hat Proudhon schärfer als die meisten seiner Vorläufer schon die finanziellen Nachteile der übertriebenen Zentralisation untersucht. In seiner Théorie de l'impôt [2] stellt er sechs Regeln einer gesunden Steuerpolitik für die zukünftige Rechtsgesellschaft auf: „Von ihnen ist die wichtigste, die sozusagen alle anderen in sich schließt, diejenige, die die Dezentralisation betrifft. Mit ihr wird das absolutistische Prinzip in seiner Wurzel vernichtet ; der Luxus, die Sinekuren, die Günstlingswirtschaft, der Militarismus sind mit ihr unvereinbar; sie bedeutet die öffentliche Aufsicht und die Sparsamkeit. Das hat uns der von uns angestellte Vergleich zwischen den Budgets der republikanischen, konstitutionellen und absoluten Staaten bewiesen. In dem Maße, wie der Staat sich der monarchischen, theokratischen und feudalen Form nähert, schwellen die Ausgaben unmäßig an, und die Steuer überschreitet ihr natürliches Maß; und umgekehrt: in dem Maße, wie der Staat sich von dieser Form entfernt, werden die Ausgaben geringer, erhalten den ausschließlichen Charakter der Nützlichkeit, und die Steuer nähert sich ihren normalen Verhältnissen.“ Er verweist zum Beleg dieser Anschauung auch noch auf die Gemeindesteuern, die in den zentralisierten Staaten noch am besten verwendet werden und den geringsten Widerstand seitens der Steuerpflichtigen hervorrufen; für die Großstädte freilich gilt das nur in geringerem Maße; hier mischen sich bereits Willkür und Phantasie hinein, „unter dem Vor- wande der Verbesserung der Straßenführung, ferner für Denkmäler und Paläste, Kunstwerke, monarchische Feste, Geschenke an Fürstlichkeiten und hohe Beamte“.
Im Föderalismus ist das anders und besser. In der Schweiz z. B.
[1] „Proudhon hat Marx als den leitenden Geist der französischen Arbeiterschaft verdrängt, und sein Föderalismus ist vor allem die Quelle der neuen Begeistung“ (Laski. a. a. O. S. 114).
[2] Oeuvres complètes, XV, S. 102.
[780]
„muß Lausanne für Lausanne, und nicht für Bern, Zürich oder Freiburg zahlen. In Frankreich hat die Regierung immer diesem Prinzip entgegen gehandelt und sich daher immer mehr von der fiskalischen Sparsamkeit und Gleichheit entfernt : wenn es sich die Ernennung der Bürgermeister vorbehält, wenn es die Stadträte einsetzt, wenn es Gemeinden wie Paris und Lyon durch Kommissionen regiert, wo es doch gewiß nicht an kompetenten Männern mangelt“ (237). „Nur die politische Dezentralisation kann die Sparsamkeit bringen, ohne sie gibt es keine Gerechtigkeit im Staat und keine Freiheit für die Bürger. Wer sie nicht will, mag die Revolution abschwören und das Gottesgnadenrecht von neuem bekennen; dann werdet ihr wenigstens das Lob der Freimütigkeit verdienen, und euch wird Recht geschehen sein“ (S. 238).
Proudhon hat ein eigenes Buch über den Föderalismus geschrieben : „Du Principe fédératif“ [1]. Hier heißt es (S. 9): „Unter den vielen Verfassungsarten, die die Philosophie vorschlägt, und die Geschichte in Versuchen zeigt, erfüllt eine einzige die Forderung der Gerechtigkeit, der Ordnung, der Freiheit [2] und der Dauerhaftigkeit, ohne welche die Gesellschaft und das Individuum nicht leben können“. Der Föderalismus ist „ein System, in dem die Vertragschließenden: Familienhäupter, Gemeinden, Gaue, Provinzen oder Staaten, sich nicht nur gegenseitig verpflichten, sondern auch sich mehr Rechte, mehr Freiheit, mehr Autorität und Eigentum vorbehalten, als sie preisgeben“ (S. 47).
Er polemisiert in einer Anmerkung zu dieser Seite gegen Rousseau, dessen Sozialvertrag (der ganz das gleiche verspricht) er eine juristische Fiktion nennt. „Aber der Kontrakt im Föderalismus ist mehr als eine Fiktion; es ist ein echter und wirksamer Vertrag, der in Wirklichkeit vorgeschlagen, erörtert und nach Abstimmung angenommen worden ist und sich regelmäßig mit dem Willen der Kontrahenten ändert. Zwischen diesem und dem Rousseauschen Vertrage und der aus diesem hervorgehenden Verfassung von 1793 besteht der ganze Unterschied wie zwischen der Wirklichkeit und der Hypothese“.
„Im Föderativsystem kann die Exekutivgewalt niemals die Herrschaft über die, die sie einsetzten, erringen“ (S. 48) ; sie ist der Gegenpol der verwaltungs- und regierungsmäßigen Hierarchie oder Zentralisation. Ihr auszeichnendes Grundgesetz lautet, daß sich die Kompetenzen der Zentralgewalt spezialisieren und einengen, an Zahl und unmittelbarer Wirksamkeit und sozusagen an Kraft verringern, und zwar in dem Maße, wie der Verband sich durch neue Zutritte vermehrt (S. 49). Hier hat der Staat durchaus die Aufgabe der Gesetzgebung, der Schöpfung, der ersten Einrichtung, aber so gut wie gar nicht die Aufgabe der Aus-
[1] Oeuvres complètes, VIII.
[2] Hier sprechen deutlich St. Simon und Comte: das Problem ist, Ordnung und Freiheit zusammen zu verwirklichen. Vgl. S. S. I, S. I2ff.
[781]
führung: „Wenn das Werk geschaffen, die Einrichtung auf die Füße gestellt ist, zieht der Staat sich zurück und überläßt den örtlichen Behörden und den Bürgern die Ausführung des neuen Dienstzweiges“ (S. 54). Als Beispiel wagt er die Schöpfung des Metallgeldes anzuführen: eine Aufgabe, die bisher fast durchaus als eine der Zentralgewalt notwendig zukommende betrachtet worden ist. Heute könnte er sich nicht nur auf das frühe Altertum berufen, dessen vorderasiatische Hochkultur niemals staatliches Geld gekannt hat, wie wir oben mitgeteilt haben, sondern auch auf China, wo privates Silbergeld zirkuliert, nachdem dei Staat die Währung vollkommen ruiniert hat, wie das leider fast überall der Fall gewesen ist, vom „Kippen und Wippen“ der Landesfürsten an bis zu der ungeheuerlichen Noteninflation der jüngsten Vergangenheit [1].
In ähnlicher Weise will er auch „eine Masse anderer Dienste, die mißbräuchlicherweise dem Staate überlassen worden sind, dezentralisieren: Straßen, Kanäle, Tabakmonopol, Post und Telegraphen, Eisenbahnen usw. „Ich verlange die Einmischung des Staates in alle diese großen Schöpfungen des öffentlichen Nutzens, aber ich sehe die Notwendigkeit nicht ein, sie ihm zu lassen, sobald sie erst einmal dem Publikum übergeben worden sind“ (S. 55).
Im Lichte dieser Auffassung entwirft er eine Skizze der französischen Geschichte seit 1789, die den zentralistischen Demokraten übel in den Ohren klingen muß, so „konservativ“ klingt sie: „Das war unser Fortschritt seit dem Sieg der Jakobiner über die Gironde, das unvermeidliche Ergebnis eines künstlichen Systems, in dem auf der einen Seite die metaphysische Souveränität und das Recht der Kritik, aber auf der anderen alle Wirklichkeiten des nationalen Gebietes, alle Handlungsmöglichkeiten eines großen Volkes lagen. Und der namenlose zentralistische Despotismus wuchs unaufhörlich, während die Freiheit im gleichen Schrittmaß verfiel“ (S. 70).
All das kann im Föderativsystem nicht vorkommen. Die Zentralgewalt ist an sich den so gut wie souveränen Bundesgliedern gegenüber viel zu schwach, und sie ist ihnen insofern untergeordnet, als sie von einer Versammlung der Delegierten der Bundesglieder ausgeübt wird, die sehr häufig Mitglieder ihrer eigenen Sonderregierungen sind und daher die Bundesversammlung um so eifersüchtiger und strenger überwachen werden.
Ebenso „kurzen Prozeß macht das System mit der Gärung der Masse, mit all dem Ehrgeiz und den Aufreizungen der Demagogie; es ist das Ende der Herrschaft der Straße, der Triumphe von Volkstribunen und der Allmacht der Hauptstädte. Mag Paris immerhin in
[1] Vgl. S. S. III, S. 996.
[782]
seinen eigenen Mauern Revolution machen: zu was kann das führen, wenn Lyon, Marseille, Toulouse usw. usw., wenn die Departements, Herren aus eigenem Recht, nicht Folge leisten? Paris wird nicht auf seine Kosten kommen. Und so wird die Föderation zum Heil des Volkes, denn sie rettet es, indem sie es gliedert, gleichzeitig vor der Tyrannis seiner Leiter und seiner eigenen Torheit“ (S. 71/72). Er weist aut das Beispiel der Schweiz hin, um z. B. zu zeigen, daß das Heer unter solchen Umständen niemals das Instrument einer Unterdrückung werden kann. Er zitiert Chaudey: „Die Kontingente der Kantone vergessen ihre Heimat nicht, wenn sie unter die eidgenössische Fahne treten : im Gegenteil, sie tun es nur, weil der Heimatkanton ihnen befiehlt, dem Bunde zu dienen. Wie könnten die Kantone jemals fürchten, daß ihre Landeskinder sich zu den Werkzeugen einer gegen sie gerichteten zentralistischen Verschwörung machen lassen könnten [1] ? In den anderen Staaten Europas liegt es anders; hier wird der Soldat dem Volke entnommen, um von ihm getrennt und mit Leib und Seele zu dem Geschöpf der Regierung gemacht zu werden“ (S. 75).
Wir können dem großen Denker hier nicht weiter folgen und haben auch nicht den Raum, um über die Einzelheiten seiner Vorschläge zu diskutieren [2]. Nur das eine mag noch gesagt sein: Proudhon erkennt mit voller Klarheit, daß die Föderation solange unmöglich sein wird, wie die Klassenscheidung besteht, weil dann „das Föderativsystem nur dazu dient, die kapitalistische Unordnung zu schützen. . . . Wahrlich, wenn die Zivilisation, wenn die Gesellschaftswirtschaft auf ihrem alten status quo verharren müßte, dann würden die Völker sich bei der imperialistischen Einheit immer noch wohler befinden, als bei der Föderation“ (S. 77/78).
Nun, diese Bedingung ist nach unseren Voraussetzungen hier erfüllt. Die Klassenscheidung ist verschwunden, mit ihr die Anarchie. Und so ist „der Gipsverband“ der Zentralisation überflüssig geworden. Die Freibürgerschaft braucht sie nicht mehr und streift sie ab. Es bleibt
[1] Wir erinnern an unsere Ausführungen oben unter dem Titel „Herrschaft und Führerschaft“ (S. 244).
[2] Sein bedeutendster heutiger Anhänger, Professor Duguit, versucht, den modernen Syndikalismus Frankreichs mit Proudhons Föderalismus zu verbinden. Als souveräne Einheiten stellt er sich so etwas wie gildenmäßige Gruppen dar. Wir wollen darüber hier nicht diskutieren. Sicherlich werden solche Gruppen neben den Lokalgruppen ihre Rolle im Föderalismus spielen. Hier wollen wir nur Duguits Schilderung des künftigen „Staats“ wiedergeben: „Oben Regierende, die die wirkliche Mehrheit der die soziale Gesamtheit zusammensetzenden Individuen vertreten; ihnen kommt keinerlei Recht öffentlicher Macht, wohl aber die Pflicht zu, alle Kräfte anzustrengen, um das Recht im weitesten Sinne zu verwirklichen; ihre Befugnis geht in bezug auf alle technischen Dinge nicht weiter als bis zu der Rolle der Aufsicht und Kontrolle“. (Zitiert bei Antonelli, a. a. O. S. 105/6.)
[783]
von ihr nur, was als oberste Zusammenfassung der fast selbständigen Einheiten zu einem großen leistungsfähigen Organismus unentbehrlich ist ; die Zentralgewalt verhält sich zu den Provinzen, wie diese zu den Gauen, und wie die Gaue zu den einzelnen Gemeinden: jede höhere Bindung übernimmt lediglich diejenigen Aufgaben, die die tiefer geordneten Bindungen ihrer Natur nach nicht übernehmen können.
Die Beamten aller dieser korporativen Behörden, auch die der obersten Spitze, sind jenes ideale Beamtentum, an das auch die besten Bürokratieen des historischen Staates nur eine schwache Annäherung darstellen. Sie bringen aus der Kinderstube keine klassenmäßigen Vorurteile und Wertungen mehr mit ; sie können und werden nichts sein als die unparteiischen und sachverständigen Vertreter des Gemeininteresses gegenüber dem Geist der Faktionen und Parteiungen, der sich unvermeidlich auch hier zeigen muß.
Robert Michels hat in seiner ausgezeichneten Untersuchung „Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie“ das pessimistische Fazit gezogen, daß Demokratie unmöglich sei, weil sich überall Dauerführerschaft ausbildet. An der Tatsache ist nicht zu zweifeln, und wir werden annehmen dürfen, daß es auch in der Freibürgerschaft sich ähnlich verhalten wird. Aber es ist verfehlt, daraus pessimistische Schlüsse zu ziehen. Man darf nicht Führerschaft und Herrschaft verwechseln. Heute wird Führerschaft fast unvermeidlich in Herrschaft entarten: in der Freibürgerschaft ist das unmöglich, und es ist nicht einzusehen, warum eine Demokratie, selbst unter Dauer- Führerschaft, nicht echte Demokratie sein sollte. Denn Führerschaft ist selbstverständlich immer notwendig; eine unmittelbare Selbstregierung des Volkes ist allenfalls in den Gemeinden und Gauen noch möglich, aber auch hier nicht notwendig. Wo der erwählte Führer sich täglich neu durch wahre Leistungen bewähren muß, wo er nicht in der Lage ist, eine Gruppe gegen die andere auszuspielen, da kann Führerschaft, wie wir wissen, nie zu Herrschaft, zu „Politik“, d. h. zur Ausbeutung werden; und da ist dauernde Führerschaft nicht nur demokratisch, sondern im höchsten Maße wünschenswert. Auch sie ist eine Form der gesellschaftlichen Arbeitsteilung und Vereinigung, und sie ist so segensreich wie jede andere. Gezahlt wird auch hier nur mit Prestige.
Wie der Staat, das Beamtentum und die Parteiführerschaft, so wird auch die letzte der politischen Großmächte, die Presse, hier sozusagen entgiftet [1]. Auch sie kann sich nicht mehr auf die Gläubigkeit und die fanatische Erbitterung echter Parteien stützen; auch sie findet niemanden mehr, den sie kaufen kann, — und der reich genug
[1] Antonelli (a. a. O. S. 12) nennt sie die „offene Wunde (plaie) unserer modernen Zivilisation, wo alle gemeinen Instinkte und Gefühle sich ausbreiten und vermischen“..
[784]
ist, um sie selbst zu kaufen. Keine politischen Parteien und keine großen wirtschaftlichen Konzerne existieren, die die Mittel und das Interesse haben, Zeitungen zu begründen oder zu kaufen, ihre Redakteure zu bestechen oder „durch Stockschläge auf den Magen“ zu terrorisieren. Da der friedliche Wettbewerb den feindlichen Wettkampf ersetzt hat ; da der leidenschaftliche Kampf um den Absatz nicht mehr besteht, so gibt es auch keine „Tintenkulis“ mehr, die in „Annoncenplantagen“ schuften müssen. Die Zeitungen, die nicht mehr von Inseraten leben können, müssen sich geradeso wie die Beamten und die Führer durch wirkliche Leistungen um die allgemeine Wohlfahrt, Bildung und Aufklärung das zahlende Publikum erwerben. Es wird wieder, und nur noch, Gesinnungszeitungen geben, wie eine solche Gustav Frey tag in seinen „Journalisten“ so köstlich geschildert hat; auch hier werden die Demagogen verschwinden, und die besten Sachverständigen werden um die Palme ringen.
Es ist vielleicht interessant, hier anzufügen, daß in dieser Staatskonzeption das alte, seit Montesquieus Mißverständnis der englischen Verfassung soviel umstrittene, Problem der „Teilung der Gewalten“ gleichfalls gegenstandslos wird. Es existiert offenbar nur für einen zentralisierten Staat mit formeller Allmacht, die zu beschränken wünschenswert ist : und so hat man j ene Teilung erfunden, um, nach dem Lieblingsbilde der Denker ihrer Entstehungszeit, zwischen den Gewalten ein „Gleichgewicht“, eine „Ballance of powers“ zu konstruieren. Alle diese Vorsichtsmaßnahmen sind gegenüber dem völlig machtlosen obersten Apparat der Freibürgerschaft offenbar völlig überflüssig.
Wenn Laski, der sein gewichtiges Buch im wesentlichen in der Absicht geschrieben hat, den Föderalismus zu rechtfertigen und vorzubereiten, richtig sieht, so ist er in den angelsächsischen Gemeinwesen und in Frankreich bereits kraftvoll auf dem Marsche. Es heißt (a. a. O. S. 109) :
„Das bedeutet, daß eine demokratische Gesellschaft den souveränen Staat verwerfen muß, weil er schon dem Begriffe nach mit der Demokratie unverträglich ist. Und es scheint uns, daß der moderne Staat sich bereits in dieser Richtung bewegt. Wir stehen an der Schwelle einer jener kritischen Perioden in der Menschheitsgeschichte, in denen auch die letzten Grundbegriffe sich erneuter Prüfung stellen müssen. In England, Frankreich und Amerika läßt sich jene Unzufriedenheit bereits von weitem erkennen, aus der zuletzt eine neue Synthese geboren wird. Die Zeit, in der die Souveränität des Staates ein notwendiger Glaubensartikel war, scheint im ganzen sich ihrem Ende zuzuneigen“.
[785 ]
Β. Das Problem der nationalen Minderheiten.
Hiermit haben wir soviel über die innere Politik im engsten Sinne der Freibürgerschaft gesagt, wie im Rahmen dieser allgemeinen Abhandlung möglich und geboten war. Der nächste Schritt führt uns zu einem der wichtigsten und dringendsten Probleme der Gegenwart, das eine Art von Mittelding zwischen innerer und äußerer Politik darstellt: zum Problem der nationalen Minoritäten. Wir sehen heute, wie es die national gemischten Staaten zerklüftet; wir müssen erleben, daß die früher Unterdrückten, denen durch den Weltkrieg ein Teil des früheren Herrenvolkes Untertan geworden ist, die früher von ihnen so beredt vor dem Gewissen der Welt angeklagten, ebenso widerwärtigen wie wirkungslosen Versuche der Entnationalisierung sofort aufgenommen haben: in der Tschechoslowakei, in Polen, leider auch, trotz aller feierlichen Zusagen, in Südtirol und anderwärts. Wir haben weiter erlebt, daß Karl Renner, der beredte und begeisterte Anwalt des Minoritätenrechts, der Verfasser des berühmtesten Buches über den Gegenstand [1], als Minister von Deutsch-Österreich nicht die Kraft gefunden, jedenfalls nicht die Macht besessen hat, um seine eigenen Gedanken in die Wirklichkeit zu übertragen.
Das Problem wird in der Freibürgerschaft nicht existieren. Wir haben immer wieder gefunden, daß der aggressive Nationalismus, den wir sorgfältig von dem guten Heimats- und Volksbewußtsein unterschieden haben [2], erst mit dem absoluten Staat und seinem Zwillingsgeschwister, dem Kapitalismus, entstanden ist. Er ist ganz offenbar und ohne jeden Zweifel ein Ausfluß der spezifisch kapitalistischen Konkurrenz, des „feindlichen Wettkampfes“, den die Kapitalisten unter sich führen müssen. Wir werden diesen Zwang sofort in seinen Wurzeln aufdecken, wenn wir die Veränderung der Außenpolitik entwickeln werden : hier genügt es zu sagen, daß jede nationalistische Sondergruppe von Kapitalisten heute das Bestreben haben muß, sich der Staatsgewalt zu bemächtigen, um ihre Sonderzwecke durchzusetzen : sei es der Zweck der Niederhaltung einer Arbeiterschaft fremder Sprache, sei es die Ausschließung konkurrierender Kapitalisten des fremden Sprachtums von den Vorteilen, die nur der Staat mit seinen gewaltigen Aufträgen und seiner Verfügung über die Zollpolitik, die Transportmittel, das Steuerwesen usw. zu vergeben hat. Wir wollen damit nicht etwa behaupten, daß der sogenannte Rassenhaß nur ein wissentlicher Vorwand ist: unsere grundlegende Erkenntnis von der Macht der sozialpsychologischen Determination macht uns hier wie überall eine derartig kränkende Unterstellung unmöglich. Aber wir lassen uns ebensowenig durch das offenbar gute
[1] Das Selbstbestimmungsrecht der Nationen, I. Teil: Nation und Staat.
[2] S. S. I, S. 645f. Oppenheimer, System der Soziologie. Band II.
[786]
Gewissen der Hetzapostel auf allen Fronten über die Fadenscheinigkeit der angeführten Gründe täuschen. Die Rassentheoretik hat, allermindestens, insofern es sich um weiße Menschen handelt, nicht die geringsten Grundlagen [1]. Die verschiedenen Sprachabteilungen der weißen Rasse, und nun gar erst der Nordeuropäer: Slaven, Germanen und Kelten, stellen eine einzige, an körperlicher und seelischer Begabung vollkommen gleiche Spielart des homo sapiens dar; das letztere hat sogar Houston Stuart Chamberlain zugeben müssen, um alle Wucht der rassentheoretischen Argumente seines unvergleichlich größeren Vorbilds Gobineau auf die eine schmale Front des Antisemitismus zu konzentrieren. Die Bevölkerung der national strittigen Grenzbezirke ist überall eine unzweifelhafte Mischung aus den beiden beteiligten Sprachgruppen : man kann es heute noch aus den Namen erkennen, daß überaus häufig nur der Zufall der Wahl des Wohnorts, der Heirat, und sehr oft (die Bamberger bei Posen!) die Konfession die Option für eine Nationalität bestimmt haben. Oft genug stehen leibliche Brüder, unzählige Male die nächsten Verwandten in der ersten Reihe beider kämpfenden Gruppen.
Aber auch für den antisemitischen Nationalismus gilt fast uneingeschränkt das Gleiche. Der Beweis dafür ist, daß er überall erst aufkommt, sobald eine nationale Bourgeoisie sich entwickelt und in den Konkurrenzkampf mit den früher als verehrte Gäste aufgenommenen Lehrern in Gewerbe und Handel eingetreten ist [2].
In der Freibürgerschaft gibt es weder einen zentralisierten allmächtigen Staat noch eine herrschende Bourgeoisie mehr : der feindliche Wettkampf hat dem friedlichen Wettbewerb den Platz geräumt, und der aggressive Nationalismus ist mit diesen seinen Wurzeln verdorrt [3]. Die Gemeinden und Bezirke haben die volle Freiheit, ihre nationale, namentlich ihre Schulpolitik nach ihren Wünschen und Bedürfnissen einzurichten. Und dieses Bedürfnis wird sie ganz selbstverständlich dahin leiten, ihre Kinder in den beiden heut streitenden Sprachen so vollkommen wie möglich auszubilden, schon weil die Zwiesprachigkeit ein unschätzbarer Vorteil im Wirtschaftsleben ist. Das war in den Grenzbezirken auch früher schon fast überall der Fall, wo sich der zentralistische Staat nicht mit Zwangsmaßnahmen einmischte, die Muttersprache auszurotten versuchte und erst dadurch dem vorher Selbstverständlichen den ungeheuersten Affektionswert verlieh. Wie der verderbliche Grundsatz: cujus regio ejus religio, so ist auch der kaum
[1] Vgl. darüber noch Ludw. Mises: 'Nation, Staat und Wirtschaft' S. 6ff. s) Vgl. meinen Aufsatz: „Der Antisemitismus im Lichte der Soziologie“ in „Der Morgen“, I )i925) 2. Heft.
[2] „Tout Etat est de sa nature annexionniste ... Il en est autrement dans le système fédératif“ (Proudhon, Du principe fédératif, Oeuvres, VIII, S. 61). Er verweist auf die Schweiz.
[787]
minder verderbliche Grundsatz: cujus regio ejus lingua, nichts als ein Symptom der allgemeinen Sozialkrankheit, des zentralistischen Kapitalismus [1].
So wird dieser Pfahl aus dem Fleisch der europäischen Menschheit schon gezogen sein, ehe noch das Prinzip des Föderalismus die heutigen politischen Grenzen zwischen den europäischen Staaten im wesentlichen ausgelöscht und sie zu einer föderalen Einheit verbunden haben wird — und das ist eine unausweisliche Notwendigkeit, logisch nicht minder wie politisch, wenn Europa nicht an diesen Grenzen zugrunde gehen soll. Davon sofort.
Auch hier fehlt uns der Raum, um die Einzelheiten der kommenden Regelung auszuführen. Nur soviel kann gesagt werden, daß alle die unüberwindlichen Schwierigkeiten, die sich unter den heutigen Verhältnissen der Lösung entgegentürmen, in der klassenlosen Gesellschaft völlig verschwunden sein werden. Wenn alle Bundesglieder bis herab zur Gemeinde aus eigenen Steuermitteln für alle ihre wesentlichen Zwecke aufzukommen haben werden; wenn z. B. in den gemischtsprachigen Bezirken die nach dem Muster der heutigen Kultusgemeinden geschaffenen nationalen Korporationen nicht mehr vom Staate, sondern nur noch von ihrer eigenen Opferwilligkeit die erforderlichen Mittel für alle die Institutionen zu erwarten haben, die über die staatlich vorgeschriebenen Minima hinausgehen: dann wird die großmäulige Demagogie von heute nüchterner Rechnung Platz machen. Und vor allem wird man als Minderheit nirgends von den anderen mehr verlangen dürfen, als man selbst im Nachbarbezirk als Mehrheit zu leisten bereit ist: denn es gibt keinen allmächtigen Staat mehr, der sein Schwergewicht immer nur in die eine Wagschale wirft. So wird es z. B. ganz selbstverständlich sein, daß alle Behörden derjenigen größeren Bezirke, in denen mehrere Sprachgruppen zusammenhausen, mit Beamten besetzt sind, die dieser Sprachen mächtig sind.
Heute stehen einer entsprechenden Reform namentlich die beiden folgenden Hindernisse entgegen : es muß in national gemischten Staaten eine innere, eine Aktenamtssprache bestehen; und es muß ferner eine einheitliche Kommandosprache im Heere herrschen. Was das erste anlangt, so gelangen in der Freibürgerschaft nur noch außerordentlich wenige Agenden mit den zugehörigen Akten überhaupt an die zentralen Behörden ; fast alles wird in den unteren Instanzen endgültig entschieden. Das wenige, was vorkommt, läßt sich leicht mit Hilfe vereidigter, von den nationalen Korporationen selbst angestellter Dolmetscher erledigen. Das gleiche gilt für die verhältnismäßig seltenen Fälle, wo Zivil- und Strafprozesse bis vor das höchste Gericht gebracht werden; außerdem
[1] Vgl. meinen Aufsatz: Nationale Autonomie, Neue Rundschau 1917·
[788]
könnten hier ohne Schwierigkeiten einige Senate mit sprachkundigen Richtern besetzt sein. Im Zentralparlament, das nur noch wenige Aufgaben hat, mögen, wie in der Schweiz, alle in der Konföderation heimischen Sprachen zugelassen sein: die Redner einer sehr kleinen Minderheit, die regelmäßig der vorherrschenden Sprache mächtig sein werden, werden sich im eigenen Interesse sehr hüten, sich eines Idioms zu bedienen, das der Mehrheit völlig unverständlich ist.
Ein Heer aber heutigen Sinnes gibt es nicht. Damit haben wir endgültig die Grenze zu der äußeren Politik der Freibürgerschaft überschritten.
c) Die äußere Politik.
Die Außenpolitik des Staates ist, das haben uns unsere Untersuchungen aller seiner Formen gelehrt, immer durch das Interesse der Oberklasse bestimmt worden. Wo der Landjunker herrscht, drängt eine rastlose Expansion nach außen, um neues Land und neue Leute zu erobern; wo der Sklavenbesitzer den Staat regiert, ist Sklavenjagd der Ausdruck seines Interesses; wo die Bourgeoisie ans Ruder kommt, treibt sie im Frieden die Politik des Merkantilismus nach außen hin mit den Waffen der Zölle, der Subventionen und Prämien aus Staatsmitteln, der Anleihepolitik, um den Konkurrenten wegzulaufen und die Märkte womöglich zu monopolisieren: — und führt sie Kriege zu dem gleichen Ziele.
A. Der kapitalistische Imperialismus.
Bis sich der Kapitalismus zu seiner höchsten Ausgestaltung im Imperialismus entwickelt hatte, beruhte diese Politik auf einer in der Regel mehr erfühlten als bewußten Kalkulation. Ihre Opfer trug nicht einmal das gesamte Volk in gleicher Verteilung, sondern vor allem die Unterklasse, der durch den Merkantilismus die schmale Existenzgrundlage noch mehr verschmälert wurde, weil sie als Konsumenten jedenfalls mehr litten, als sie als Produzenten gewinnen konnten ; und die im Kriege die Hauptblutlast zu tragen und selbst im Falle des Sieges wirtschaftlich am schwersten zu leiden hatte. Wir haben ein charakteristisches Beispiel von der Plebs des antiken Seestaates genauer betrachtet. Der Erfolg des Sieges aber kam fast ausschließlich der Herrenklasse zugute. Der Krieg war bisher ein Hazardspiel, bei dem der eine die Einsätze macht, während der andere die Gewinne einstreicht.
Das ist jetzt anders geworden. Der Weltkrieg hat gezeigt, daß ein moderner Krieg im großen Stil zwischen kapitalistischen Völkern auch den Sieger zugrunde richtet. Wie schwer drücken heute Verschuldung, Inflation und Arbeitslosigleit auch auf fast alle Siegerstaaten! „Das Spiel ist nicht mehr die Kerze wert“. Auf dieser Erkenntnis vor allem, außer
[789]
auf dem Grauen vor der entsetzlichen Vernichtung von Menschenleben, beruht vor allem die zunehmende Verbreitung pazifistischer Gesinnung auch in den oberen Schichten.
Aber es wäre verfehlt, zu glauben, daß diese Umwertung aller Werte allein stark genug sein muß, um einen künftigen Krieg unmöglich zu machen, ja, auch nur zu glauben, daß ein solcher Krieg nur weniger wahrscheinlich geworden ist als vor der niederschmetternden Erfahrung, die die trunkenen Sieger machen mußten:
Wir haben bei der Analyse des Seestaats gezeigt, daß die Gesellschaft sich in einem Hexenkreise drehte, aus dem ein Ausgang kaum zu finden war. Man hätte die erste Schöpfung des politischen Mittels, die Sklaverei, ausrotten müssen, um sich zu retten : und dazu war kaum eine Möglichkeit gegeben.
Auch die kapitalistische Gesellschaft von heute dreht sich in einem ähnlichen Hexenkreise. Auch hier müßte eine Schöpfung des politischen Mittels, die Klassenscheidung samt dem Kapitalismus, mit der Wurzel ausgerottet werden; das ist der einzige denkbare Ausgang. Wir sind der Meinung, daß dies nicht so fast an das Unmögliche streift, wie das der Antike gestellte Problem : aber es ist schwierig genug ; es bedarf der Erfüllung der Unterklasse mit dem neuen Wissen und Glauben, ihrer Hinwendung zu entschlossener Bauernpolitik: und wir haben unseren Zweifel daran bereits ausgesprochen, daß dieser Umschwung noch rechtzeitig genug eintreten wird.
Folgendes ist der Hexenkreis: die kapitalistische Verteilung läuft, wie wir zeigten, darauf hinaus, daß sämtliche an der Gütererzeugung beteiligten Arbeitenden: Leiter, Angestellte und Arbeiter insgesamt, mit ihrenLöhnen ihr Produkt nicht zurückkaufen können. Ein gewaltiger, stets wachsender Teil bleibt zur Verfügung der Inhaber der Produktionsmittel in Stadt und Land, der Kapitalisten. Diese sind nicht nur nicht imstande, den ungeheuren gesellschaftlichen Mehrwert in Gestalt von Gütern oder Luxusdiensten zu verbrauchen, sondern sie dürfen es nicht einmal wollen können. Die Not des feindlichen Wettkampfes zwingt sie kategorisch, einen beträchtlichen Teil des ihren Konsum überschreitenden Einkommens zu kapitalisieren, d. h. in immer wirksameren, immer produktiveren Werkgütern anzulegen, dadurch die disponible Gütermasse immer mehr zu steigern; und den anderen Teil, der aus dem soeben dargelegten Grunde immer mehr anschwillt, auf fremde Märkte zu exportieren.
Aber sie können nicht Waren exportieren, um dafür fremde Waren zu importieren. Würden sie das tun, so stände dasselbe Problem wieder vor ihnen, von dem wir ausgegangen sind: die Unmöglichkeit, diese eingeführten Güter selbst zu verbrauchen, und ebenso die Unmöglichkeit,
[790]
sie zur Gänze an die Lohnempfänger abzusetzen. Wir haben geschrieben [1] : Dem ungeschulten und leider auch manchem geschulten Auge stellt sich der Welthandel so dar, daß die Völker Güter und Dienste tauschen : ägyptische oder amerikanische Baumwolle gegen norwegische Fische oder britische Frachterdienste, italienische Orangen und spanischen Wein gegen französische Luxuswaren, oder deutsche Chemikalien gegen russischen Weizen: segensreiche internationale Arbeitsteilung und Vereinigung! Und man versteht nicht recht, wie es darüber zu Konflikten und Kriegen kommen kann, weil ja doch bei steigendem Angebot auch dieNachfrage entsprechend wächst, und auf dieDauer alle Völker nur Vorteil davon haben können. Aber man sieht kaum jemals, daß ein Teil, und zwar ein gewaltiger und ständig wachsender Teil der von hochkapitalistischen Nationen ausgeführten Güter gar nicht die Bestimmung hat und haben kann, andere Güter zu kaufen, sondern daß er ausgeführt wird, um Machtpositionen dafür einzutauschen : Rechtstitel,,, Kapitalstücke“, deren Zinsen und Dividenden gleichfalls Mehrwert sind, aber gesteuert von den Proletariern fremder Länder. Diese Exporte von Gütern und diese Gegenimporte von „Kapital im privatwirtschaftlichen Sinne“ sind für eine kapitalistische Volkswirtschaft auf höherer Entwicklungsstufe eine vitale Notwendigkeit, und zwar aus dem soeben dargelegten Grunde:
Sollte irgendeine nationale Bourgeoisie gezwungen sein, alle Produkte, die im Inlande hergestellt, oder gegen inländische Produkte aus dem Auslande eingeführt werden, auch im Inlande selbst zum Verbrauch zu bringen, so wäre der Kapitalismus tot. Denn entweder müßte sie den ganzen Mehrwert selbst konsumieren: dann aber wäre sie gezwungen, ihn zum allergrößten Teile in Gestalt von hochwertiger Handwerks- und Künstlerarbeit oder von Luxusdiensten zu verzehren. Zu dem Zwecke aber müßte sie die Produktivität der Gesamtwirtschaft nicht bloß stabilisieren, sondern gewaltig zurückschrauben, Maschinerien von weit geringerer Wirksamkeit an die Stelle der heutigen setzen, kurz, nach der Art antiker Oikenbesitzer oder mittelalterlicher Feudalherren leben. Diesen Ausweg aber versperrt die Notwendigkeit des feindlichen Wettkampfes jedem Einzelnen bei Strafe des wirtschaftlichen Untergangs, und so kann ihn die Klasse als Ganzes nicht betreten. Es bliebe also nur die zweite Möglichkeit, diese ganze ungeheure Warenmasse den Produzenten selbst als Lohn zu überlassen. Damit aber wäre das Kapitalverhältnis aufgehoben.
Das ist der Hexenkreis, von dem wir sprachen. Der Kampf um die Weltmärkte ist vitale Notwendigkeit der kapitalistischen Bourgeoisie. Wir erleben ja heute täglich die tragi-
[1] S. S. III, S. II20.
[791]
komische Tatsache, daß die Sieger im Weltkriege, trotz aller Finanznot und Verschuldung, sich weigern müssen, den größten Teil der Kriegsentschädigung anzunehmen, die die Besiegten bereit sind, in der einzigen Valuta zu zahlen, die möglich ist: in Gütern und Diensten. Man stelle sich vor, welches Geschrei in Frankreich über deutsche Intriguen entstanden wäre, wenn Deutschland sich erboten hätte, sämtlichen französischen Familien der Unterklasse ein fertiges Haus mit vollem Mobiliar und Inventar und angelegtem Garten als Kriegsentschädigung zu erbauen. Das hätte die französische Bourgeoisie durch Verlust großer Teile ihres Binnenmarktes und Hebung der Unterklasse und der Löhne sofort ruiniert: man sieht hier erstens, wie die angebliche Solidarität der Klassen in Wahrheit beschaffen ist, und zweitens, eine wie unmögliche Gesellschaftsordnung der Kapitalismus ist.
B. Der Freihandelsbund.
Betrachten wir nun demgegenüber die Außenpolitik der Freibürgerschaft, zunächst ihre Wirtschaftspolitik:
Sie kann gar nichts anderes als der vollendete Freihandel sein. Wenn selbst den Sonderinteressenten die Macht nicht fehlen würde, ihre Sonderinteressen durch Schutzzölle und dergleichen zum Schaden der Gesamtheit durchzusetzen, so würde ihnen dennoch jedes Motiv dazu fehlen. Oder mit anderen Worten: es gibt hier keine Sonderinteressen von irgend erheblicher Bedeutung und irgend politischem Schwergewicht. Vielleicht gibt es hie und da einen rückständigen Betrieb, der es recht bequem finden würde, wollte die Gemeinschaft ihn durch einen kostspieligen Panzer vor dem Wettbewerb schützen: aber er wird niemals auch hur versuchen können, ein solches Bestreben durchzusetzen.
Alle wissenschaftliche Schutzzollpolitik, wie sie von Carey und vor allem von Friedrich List verfochten worden ist, fußt auf einem einzigen starken Argument: der Notwendigkeit, „die produktiven Kräfte“ des betreffenden Volkes voll zu entfalten. Zu dem Zwecke sollen „Erziehungszölle“ dienen, die den Wettbewerb des früher und höher entwickelten Auslandes solange abwehren sollen, bis die heimische Industrie konkurrenzfähig geworden ist. Es mag nebenbei bemerkt sein, daß List alle Agrarzölle völlig verwarf und alle Industriezölle nur befristet gewähren wollte: eine Industrie, die nicht binnen gemessener Zeit die nötige technische Höhe erstiegen hat, soll preisgegeben werden.
Dieses Argument gilt ausschließlich, das muß man wohl verstehen, für rückständige kapitalistische Volkswirtschaften. Wenn in eine solche die hochmaschinell hergestellten, unvergleichlich wohlfeileren Waren eines vorgeschrittenen Industriegebietes plötzlich einbrechen,
[792]
so wird die ungeschützte heimische Industrie sofort völlig vernichtet. Das große Beispiel dafür ist der Einbruch der englischen Textilwaren in die Länder des europäischen Kontinents, Vorderasiens und Indiens. Und an die Stelle dieser vernichteten Gewerbe kann hier nichts anderes treten: die „Manufakturkraft“, der „zweite Arm der Volkswirtschaft“, ist ein für allemal verdorrt. Denn hier ist die Kaufkraft der Volksmasse zu gering, um noch andere als diese Massenartikel aufzunehmen, ja, sie sinkt noch durch Vernichtung der Mittelstände und ihren Sturz ins Proletariat, der die Löhne senkt; und der ganze Zuwachs der Kaufkraft kommt der hier überaus schmalen Oberschicht zugute, die höchstens einige Luxusgewerbe unterhalten kann, wenn sie es nicht vorzieht, auch diese Produkte aus dem Auslande zu beziehen.
Von all dem ist in der reinen Ökonomie keine Rede. Zunächst können die fremden Waren nicht so billig importiert werden. Würde ein vorgeschrittenes Land noch einmal technisch einen so ungeheuren Vorsprung gewinnen können, wie England vor einem Jahrhundert, so würde doch seine industrielle Expansion scharf begrenzt sein durch die Unmöglichkeit, die notwendigen zahllosen Arbeitskräfte im Lande zu gewinnen; außerdem würden die Löhne gewaltig steigen und das Produkt verteuern. Kann es aber trotzdem noch mit Vorteil ins Ausland exportiert werden, so setzt es hier die gewaltige Kaufkraft frei, die aus der Ersparnis folgt; und diese Kaufkraft muß notwendigerweise andere einheimische Gewerbe entwickeln. Hier also führt der internationale Wettbewerb lediglich zu dem höchst erwünschten Ziele, daß jeder Teil des Marktes diejenigen Produkte erzeugt, für die Land und Volk die höchste Qualifikation besitzen: und schon das bedingt eine ungeheure Vermehrung des Reichtums Aller, im Vergleich zu der heutigen tragikomischen Situation, daß jedes einzelne politische Gebiet sich bemüht, womöglich alle gebrauchten Erzeugnisse selbst herzustellen, sei es auch noch so teuer und unwirtschaftlich.
Eine noch viel ungeheurere Vermehrung des allgemeinen Reichtums aber folgt daraus, daß — wir haben es schon einmal betrachtet — mit dem Fortfall des feindlichen Wettkampfes zwischen den nationalen Bourgeoisien selbstverständlich auch die Zollgrenzen fallen; und daß damit der „Kollektivbedarf“ des Marktes auch an Extensität das letzte Maximum erreicht, das er bereits an Intensität, d. h. an durchschnittlicher Einzelkaufkraft erreicht hat. Von der Größe des Kollektivbedarfs aber hängt nach dem nie bestrittenen Gesetz, das bereits Adam Smith entwickelt hat, die Staffel der gesellschaftlichen Kooperation, und von ihr die Gütererzeugung und das heißt der Reichtum der Gesellschaft ab, und zwar wächst, um es noch einmal einzuprägen, der Reichtum etwa im geometrischen Verhältnis, während der Kollektivbedarf nur im arithmetischen wächst.
[793 ]
C. Der Völkerbund.
Schon der Fortfall der Zollgrenze macht die politischen Grenzen zu etwas, das kaum mehr bedeutet als bunte Linien auf der Landkarte. Die arbeitsteilige Wirtschaft für den einen gewaltigen Weltmarkt webt die Völker, nicht mehr bloß die Kapitalisten, sondern die ganzen Völker, zu einem so dichten Geflecht ineinander, daß jeder gewaltsame Austrag einer politischen Differenz noch viel mehr zur wirtschaftlichen Unmöglichkeit wird, als nach den Erfahrungen des Weltkrieges schon heute der Fall ist. Außerdem ist nicht abzusehen, wie es unter solchen Umständen überhaupt noch zu ernsten Konflikten sollte kommen können. Kein Staat hat mehr das geringste Interesse an militärischer Expansion; keine „Irredenta“ leidet in Wahrheit oder angeblich noch durch Unterdrückung; das unausrottbare Streben nach Prestige läßt sich vornehmer und wirksamer durch Höchstleistung in Kunst, Wissenschaft, Verwaltung und — last not least — Sport befriedigen; die Nationen werden mit ihren statistischen Ziffern über Mortalität und Morbidität, Kriminalismus und Prostitution, Analphabetismus usw. und auf den Olympiaden kämpfen; und Ehrverletzungen, die etwa von einem anachronistischen Narren gegen ein anderes Volk begangen werden sollten, werden vom Heimatstaat nicht mehr aus „Prestigegründen“ verteidigt, sondern geahndet werden, falls nicht schon die allgemeine Verachtung als genügende Strafe betrachtet werden sollte.
Zum Zweck des ungestörten Marktverkehrs müssen die verschiedenen Nationen einen beträchtlichen Teil ihrer inneren Gesetzgebung und Verwaltung aneinander angleichen — Transport- und Verkehrswesen, Geldwesen, Handels-, Verkehrs- und Prozeßrecht usw. usw. Selbstverständlich besteht volle Freizügigkeit und volles Niederlassungsrecht im ganzen Gebiet.
Wenn dieses Stadium erreicht ist, sind die Vereinigten Staaten des betreffenden Erdteils, später des Planeten, tatsächlich bereits fertig. Es bedarf gar keiner formellen Vereinigung mehr. Der Föderalismus feiert auf dem größeren Gebiet gerade so, und aus genau den gleichen Gründen, seine Triumphe und zeitigt die gleichen Segnungen, wie vorher auf dem kleineren. Wir brauchen uns also den Kopf nicht darüber zu zerbrechen, ob es irgendwo dauernde internationale Behörden geben muß, deren Kompetenzen wesentlich über das hinaus gehen, was heute etwa die internationale geodätische Kommission oder die internationalen Kommissionen für transkontinentale Eisenbahnverbindungen oder für Portofragen oder für Arbeitergesetzgebung usw. besitzen. Wo keine Zollfragen mehr bestehen, wo keine Verletzung des Ehrenstandpunktes mehr Kriege nötig macht, da werden solche Oberbehörden an Kompetenzen gerade so arm sein, wie heute die letzten Oberbegriffe der Logik an Inhalt.
[794]
Die Konzeption eines wirklichen Völkerbundes hat sich bisher immer an dem Problem der „Souveränität“ gestoßen. Was aber ist Souveränität? Treitschke sagt: „Der feste, schlechthin unveräußerliche Kern aller Souveränität, ohne den kein Staat ein Staat heißen kann, ist das Recht der Waffen und die Befugnis, den Umfang der eigenen Hoheitsrechte selbst zu bestimmen. Ein Staat, der kein Waffenrecht hat, ist überhaupt kein Staat mehr. Das ist das Wesen des Staates, daß er seinen Willen mit physischen Kräften durchsetzen kann“ [1].
Nun, nach diesen Kennzeichen brauchen die Glieder eines künftigen Völkerbundes, die sämtlich Freibürgerschaften sind, keine Souveränität mehr. Sie haben nicht die geringste Veranlassung zu einem „Willen, der sich nur mit physischen Kräften durchsetzen lassen kann“; das Recht der Waffen ist antiquiert, es sei denn das Recht der Polizeiwaffe gegen vereinzelte Verbrecher. Und der „Umfang der Hoheitsrechte“ ist fast punktförmig zusammengeschrumpft: die Hoheitsrechte liegen hier durchaus bei den Untergliedern jeder Freibürgerschaft: die Zentralbehörden sind nichts als ausführende Behörden, die garnicht auf den Gedanken kommen können, die ihnen anvertraute Führerschaft zur Gewinnung von Herrschaft zu mißbrauchen. Und dieses Verhältnis gilt verstärkt im Verhältnis der einzelnen nationalen Freibürgerschaften zu ihren obersten Bundesbehörden, die kaum noch mehr als ein Gremium von Sachverständigen und ein statistisches Zentralamt darstellen.
Ob man dieses Gebilde, bei dem die Souveränität von unten nach oben regelmäßig abnimmt, bis sie in der Spitze vollkommen verschwunden ist, einen Staatenbund oder einen Bundesstaat nennen soll, ist ein Problem, mit dem die Juristen sich plagen mögen, wenn es ihnen beliebt: soziologisch ist es ohne jedes Interesse. Der folgende Satz von Treitschke, der für die zentralisierten Staaten von heute völlig richtig ist, ist für die Föderation der freibürgerschaftlichen Föderationen vollkommen sinnlos: „Der radikale Unterschied zwischen Staatenbund und Bundesstaat liegt darin, daß im Staatenbund die Glieder souverän sind, die Zentralgewalt unter ihm steht. Nur in Beschlüssen kann hier die Zentralgewalt ihren Willen äußern ; es bleibt den einzelnen Verbündeten Regierungen überlassen, diese Bundesgesetze, wie man sie fälschlich nennt, als Landesgesetze zur Geltung zu bringen. Es ist aber keine Gewähr dafür gegeben, mithin ist Anarchie hier die Regel [2]. Im Bundesstaate dagegen wird die Souveränität der bisher unabhängigen Glieder aufgehoben“ (S. 325).
Eine Hindeutung darauf, wie vollkommen gleichgültig diese klas-
[1] Politik, II, S. 329.
[2] Jellinek (a. a. O. S. 769) sagt: „daß sich ein Staatenbund auf die Dauer nicht zu erhalten imstande ist. Er zählt daher bereits heute zu den ausgestorbenen Arten der Staatenverbindungen.“
[795 ]
sische Unterscheidung unter unseren Voraussetzungen ist, gibt wieder Treitschke (S. 327): „Beobachtet man nun weiter, unter welchen politischen Verhältnissen sich Bundesstaaten bisher gedeihlich entwickelt haben, so finden wir : die zwei, welche die Geschichte kennt, die Schweiz und Nordamerika, sind Demokratien, Republiken. Es ist deutlich, daß in einer Republik bei dieser Umwandlung aus dem Staatenbunde in den Bundesstaat am letzten Ende niemand etwas verliert; es verschiebt sich nur der Schwerpunkt der Staatsgewalt, aber keines Untertanen Rechte werden gekürzt. Alle Rechte, die der Urner und Luzerner im alten Staatenbunde ausübte, übt er auch heute aus, nur nicht in seinem Kanton, sondern zum Teil in der Gesamtvertretung der Eidgenossen. Der Einzelne bringt also bei dieser Umwandlung gar kein Opfer“.
Wenn das schon in den kapitalistischen Republiken von heute gilt, um wieviel mehr wird es von einem Gemeinwesen gelten, das zum erstenmal eine wirkliche „Demokratie“ ist! Und zwar, um noch einmal Treitschke als gewiß sehr widerwilligen Zeugen anzuziehen: eine nicht nur soziale, sondern gleichzeitig auch territorial gegliederte föderative Republik. Er spricht (S. 309/10) von der erstaunlichen Tatsache, „daß von all den unzähligen Bünden des Mittelalters nur einer gedauert hat : die Eidgenossenschaft der Schweizer. Worin liegt der Grund? Jene anderen Bünde sind alle ständisch“, geschlossen von Städten, Edel- leuten oder Bauern; „immer ist es nur ein Stand, der gegen andere Stände sich zu verteidigen sucht“. Aber aus einer rein ständischen Korporation kann niemals ein Staat werden. Das beweisen die Hansa und der lombardische Städtebund. „Dagegen die kleine Schweizer Eidgenossenschaft war von vornherein territorial, sie umfaßte Stadt und Land, daher konnte sie sich zu einem Staat entwickeln“. Und das gleiche gilt von den Föderationen, aus denen die Niederlande und die Vereinigten Staaten Nordamerikas entstanden sind.
Es ist hier nicht der Ort, die zahllosen Propheten des Völkerbundes als des Zieles der Menschheit anzuführen. Wir begnügen uns damit, einige weniger bekannte Vertreter des Gedankens zu nennen. Suarez (1548 bis 1617) hat bereits, katholisch-kanonisch, jeden Einzelstaat als Mitglied einer universellen Gemeinschaft begriffen : Denn diese einzelnen Gemeinschaften genügen sich selbst niemals vollständig, sondern sie bedürfen der gegenseitigen Hilfe, der Gesellschaft und der Gemeinschaft [1]. Ein weiterer weniger bekannter Verfechter des Gedankens, als dessen Hauptvertreter fast immer nur der Abbé St. Pierre und Kant genannt werden [2], ist Christian Wolf, der berühmte Hallische Philosoph (1679 bis
[1] Zitiert von W. J. Hill, Die Völkerorganisation und der moderne Staat, S. 141.
[2] Meinecke (Weltbürgertum und Nationalstaat) bringt reichliches Material zu dem Gegenstande. Vgl. z. B. S. 75 über Novalis, Schlegel und ihre Berührung mit Kant. S. 300/1 über Ranke, ebenso 321 und passim.
[796]
1754): „Im Weltstaat soll jedes Volk jedem anderen geben, was es sich selbst gibt, insofern als das eine es nicht besitzt, und das andere es geben kann, ohne seine Pflicht gegen sich selbst zu vernachlässigen“ (Hill, a. a. O.). Von den großen grundlegenden Demokraten der englischen Frühzeit hat Price ebenfalls eine Föderation aller europäischen Staaten erstrebt ; alle in dieser föderativen Gemeinschaft aufkommenden Streitfragen sollten von einem internationalen Schiedsgerichte geschlichtet werden [1].
Niemand aber hat, mit Ausnahme von Proudhon, diese Dinge so tief durchdacht, wie C. Frantz, der ja auch, wie dieser, für das innerstaatliche Leben den Föderalismus so beredt forderte. Er verwirft selbstverständlich die „Idee eines Universalstaates, wie es das alte Rom gewesen. Diese Idee ist in verschiedenen Wendungen wiederholt ausgesprochen, neuerdings wieder von Bluntschli. Die Völkergemeinschaft kann aber um so weniger ein Staat sein, je umfassender sie werden soll, und hier zeigt sich eben der Mangel einer Staatslehre, die nicht über ihre selbst gemachten Begriffe hinauskommt. Man muß vielmehr anerkennen, daß neben und über dem Staat noch ganz andere Formen rechtlicher Gemeinschaft bestehen, die freilich noch ebensowenig theoretisch erforscht als praktisch geordnet, aber doch um deswillen kein reines Nichts sind. Statt dessen bleibt man immer in der falschen Voraussetzung befangen, daß, wo keine Staatsgemeinschaft stattfindet, überhaupt keine lebendige Gemeinschaft möglich sei, sondern nur äußerlicher Verkehr“ [2].
In Anwendung dieses Grundgedankens, der durch unsere vorstehenden Ausführungen zum ersten Male einen wirklichen Körper erhalten haben dürfte, schreibt er, es habe zwar für das Zarenreich seinen guten Sinn, wenn es seinen Verkehr mit anderen Staaten nur als eine auswärtige Angelegenheit behandele, sei aber um so sinnloser für die abendländischen Staaten, wenn sie „immer noch so tun wollten, als ob hier auch jeder einzelne Staat eine Welt für sich wäre, und womöglich eine sogenannte Großmacht darstellen oder werden müßte“ (426). „Hier noch innere und äußere Politik auseinanderhalten zu wollen, wo doch die Tatsachen alltäglich lehren, wie sehr beides in Wechselwirkung steht, ist entweder ein Zeichen äußerster Oberflächlichkeit und Unkenntnis oder bewußte Unwahrheit“ (366). Und er zieht daraus mutig den notwendigen Schluß: „Julius Fröbel hat den drastischen Ausdruck gebraucht, daß die einzelnen Staaten des abendländischen Europa für die Zukunft nur noch eine kantonale Bedeutung besäßen. Und in der Tat, wenn es auch bei weitem nicht so ist, so müßte es doch in gewissem Sinne wirklich so werden: alle zusammen eine Art von Eid-
[1] Pierre Ramus, William Godwin, S. 7.
[2] Die Naturlehre des Staates, S. 414/5.
[797 ]
genossenschaft, worin die sogenannten Großstaaten sich als Vororte benehmen mögen; aber mehr sind sie auch nicht“ (S. 425).
Wie eine solche Eidgenossenschaft der Staaten juristisch möglich ist, sagt uns Jellinek [1] sehr klar: „Aber nicht nur innen, auch nach außen erkennt sich der Staat ... als durch das Völkerrecht gebunden an, ohne sich deshalb einer höheren Gewalt zu unterwerfen. Wenn Recht die von einer äußeren Autorität ausgehenden, durch äußere Mittel garantierten Normen für gegenseitiges Verhalten von Personen sind, so paßt diese Definition vollinhaltlich auf das Völkerrecht. Auch im Völkerrecht bleibt rechtlich der Staat nur seinem eigenen Willen unterworfen. Nur ruhen die Garantien des Völkerrechts, so wenig wie die des Staatsrechts, nicht gänzlich auf seinem Willen. Für das Recht ist es aber nur notwendig, daß Garantien seiner Geltung vorhanden sind, nicht, daß sie dem Willen des Staates entstammen. Dies ist der einzig mögliche Weg, das Völkerrecht rechtlich zu begründen“.
Nun, die Garantien des Völkerrechts im Bunde der Freibürgerschaften ruhen auf der vollkommenen Übereinstimmung der materiellen und vor allem der sittlichen Interessen der einzelnen und der, je weiter nach unten sie geordnet sind, je kleiner sie sind, um so größeren souveränen Gewalt der Bundesglieder. Hier in der Tat paßt das Bild der Pyramide, die, breit gelagert, aus der „Recht“-winkligen Basis zu der Spitze aufsteigt, die das Ganze nur noch krönt und abschließt : die Stabilität in aeternum.
Wie klar der „Utopist“, der Föderalist Frantz die bewegenden Kräfte seiner Gegenwart und die Tendenz ihrer Entwicklung beurteilt hat, beweist die folgende grandiose Prophétie die, im Jahre 1858 (!) im Druck erschienen ist: „Wo bleiben da noch die alten Vorstellungen vom europäischen Gleichgewicht ? Wo die Einbildungen unserer pentarchischen Diplomatie, die in ihren beschränkten Kombinationen die Geschicke der Menschheit zu umspannen vermeinte? Die wirkliche Entwicklung der Menschheit ist auf andere Ziele gerichtet, und vollzieht sich auf einem unendlich viel größeren Theater. Diese Perspektive soll der europäische Staatsmann ins Auge fassen. Nicht bloß des kontemplativen Reizes willen, sondern um seine Seele zu erweitern und sich dadurch auf den Höhepunkt zu schwingen, von welchem jetzt schon — und um wieviel mehr in Zukunft — die europäischen Angelegenheiten behandelt sein wollen, wenn Europa noch ferner das Zentrum der Kultur bleiben soll, und nicht vielmehr zum Spott und Hohn werden, durch die kleinlichen Unternehmungen einer in Nationalitätsschwindel versunkenen oder mit eroberten Länderfetzen prahlenden Politik, während jenseits des Ozeans neue Völker,
[1] A. a. O. S, 479.
[798]
neue Staaten, neue Lebensformen entstehen, woran sich neue Interessen anschließen, deren massenhaftes Gewicht das alte zerrissene und ausgemergelte Europa zu erdrücken droht“ (S. 546).
Und er schildert den Staatsmann, den diese arge Zeit braucht — und nicht gefunden hat, wie die furchtbare Weltkatastrophe beweist, unter der wir seit mehr als zehn Jahren seufzen, und deren letzten Akt wir noch längst nicht gesehen haben:
„Der allein ist dann für einen Staatsmann in hohem Stile zu erachten, welcher die Entwicklung dieses Ganzen vor Augen hat, und, von seinem Standpunkt aus daran mitzuarbeiten, für seine edelste Aufgabe hält. Dahingegen rücksichtslos gegen die Wohlfahrt dieser Völkergemeinschaft nur die Sonderinteressen eines Staates zu verfolgen, heißt ein Geschäft treiben, welches den Staatsmann auf das Niveau eines Börsenspekulanten herabdrückt“ (S. 367).
3. Staat und Individuum. ↩
In der Freibürgerschaft findet auch ein letztes praktisches Problem seine Lösung, soweit solche Probleme überhaupt eine restlose Lösung finden können. Mögen auch immer gewisse Erdenreste, zu tragen peinlich, für Einzelne übrig bleiben: sie werden im Verhältnis zu den heutigen Lasten gerade der suprasozialen Persönlichkeiten winzig sein und kaum mehr darstellen, als den Tropfen Wermut, der den Becher würzt. Wir sprechen von dem „immanenten“ Konflikt zwischen dem Staat und dem Individuum.
Georg Simmel schreibt: „Auch ruht darauf, daß die Gesellschaften Gebilde aus Wesen sind, die zugleich außerhalb und innerhalb ihrer stehen, eine der wichtigsten soziologischen Formungen: daß nämlich zwischen einer Gesellschaft und ihren Individuen ein Verhältnis wie zwischen zwei Parteien bestehen kann, ja vielleicht offener oder latenter immer besteht. Damit erzeugt die Gesellschaft vielleicht die bewußte, mindestens die allgemeinste Ausgestaltung einer Grundform des Lebens überhaupt: daß die individuelle Seele nie innerhalb einer Verbindung stehen kann, außerhalb deren sie nicht zugleich steht, daß sie in keine Ordnung eingestellt ist, ohne sich zugleich ihr gegenüber zu finden“ [1]. Und an anderer Stelle: spricht er von jener „tiefen und tragischen Zwiespältigkeit, die jede Gesellschaftsbildung, jede Formung einer Einheit aus Einheiten in ihrem Grunde durchzieht. Das Individuum, das aus einem inneren Fundament heraus lebt, das sein Handeln nur verantworten kann, wenn seine eigene Überzeugung es lenkt, soll . . . mit seinem auf sich ruhenden Sein zum Gliede einer Gesamtheit werden, die ihr Zentrum außerhalb seiner hat. Es handelt sich nicht um einzelne
[1] Soziologie S. 38.
[799 Harmonien oder Kollisionen dieser beiden Forderungen; sondern darum, daß wir innerlich unter zwei gegeneinander fremden Normen stehen, daß die Bewegung um das eigene Zentrum, die etwas völlig anderes ist als Egoismus, ebenso etwas Definitives und der entscheidende Sinn des Lebens zu sein verlangt, wie die Bewegung um das soziale Zentrum dieses fordert“ (S. 196). „Dieser Widerstreit zwischen dem Ganzen, das von seinen Elementen die Einseitigkeit der Teilfunktion fordert, und dem Teil, der selbst ein Ganzes sein will, ist prinzipiell nicht zu lösen : man kann kein Haus aus Häusern bauen, . . . keinen Baum aus Bäumen erwachsen lassen. Diese Formulierung scheint mir den Gegensatz der beiden Parteien deshalb so weitgreifend zu umschreiben, weil sie ihn über die übliche Reduktion auf Egoismus und Altruismus vollkommen hinausführt“ [1]. ]
Diese Auslassungen sind nicht nur, wie bei Simmel immer zu rühmen, formal bis aufs äußerste zugeschliffen, sondern scheinen mir auch sachlich stark überspitzt. Und zwar beruht das auf zwei Gründen: erstens wirken bei diesem ausgesprochenen Universalisten doch noch aufklärerische Gedankengänge nach; das Individuum, von dem er hier spricht, ist doch dem verabsolutierten Individuum des Rationalismus mindestens sehr nahe verwandt. Es wird nicht genügend die Simmel sonst immer bewußte Tatsache eingestellt, daß das Individuum ja fast nur immer als solches bezeichnet werden kann, weil es das Mitglied einer Gruppe mit festem Normenapparat ist. Das gilt schon prinzipiell. Und noch mehr gilt in historischer Betrachtung, daß nur in Zeiten so starker sozialer Zersetzung, wie diejenigen sind, aus denen die Aufklärung erwuchs, sich gerade das höher entwickelte, das „suprasoziale“, dem Normenapparat seiner Gruppe mehr oder minder entwachsene Individuum: die Persönlichkeit, dieses Konfliktes bewußt wird. In Zeiten des Consensus wird das nur außerordentlich selten überhaupt, und noch seltener in schmerzlich erregendem Maße der Fall sein.
Mit diesem Einwand hängt der zweite eng zusammen: Simmel spricht von „Gesellschaft“, meint aber offenbar vorwiegend diejenige Form der Gesellschaft, die den stärksten Druck und Zwang auf die Persönlichkeit ausübt: den Staat der Gegenwart, den zentralisierten Machtstaat.
Und für den gilt in der Tat, daß der Konflikt um so dauernder und um so peinlicher zum Bewußtsein kommen muß, je höher über das menschliche Herdentier hinaus entfaltet die Persönlichkeit ist. Im Staat besteht in der Tat „der seltsame Widerspruch“, von dem Ewald spricht [2]: „Der Staat, der für die Kultur arbeiten soll, ist antiindivi-
[1] Grundfragen der Soziologie, S. 72/73.
[2] Probleme der Romantik, S. 54. Vgl. C. Schmitt (Der Wert des Staates, S. 108): „Die Vernichtung des Individuums, die der hier zu erwartende Einwand meint, kommt nicht vom Recht und dem ganz in der Verwirklichung des Rechts aufgehenden Staate her, sondern von dem Machtkomplex Staat, von der Tatsächlichkeit, der durch einen Kampf der Macht mit der Macht zu begegnen ist. Die Frage, wie hier dem empirischen Individuum zu helfen wäre, ist keine rechtsphilosophische mehr, ebensowenig wie die Frage, auf welchem Wege es zu bewerkstelligen ist, daß die Machtinhaber sich stets an das Recht halten.“
[800]
dualistisch. Aber die Kultur selber hat den reinsten Individualismus zur Voraussetzung“.
Und weiter: im Staat besteht allerdings die von v. Wiese [1] glücklich herausgearbeitete Antinomie zwischen Liberalismus und Demokratie. Jener erhebt das Individuum zur Souveränität, dieser setzt die Herrschaft der Mehrheit als Prinzip : zwei in der Tat grundsätzlich unvereinbare Forderungen!
Aber, wie wir einleitend sagten, all das gilt nur noch in verschwindendem Maße für die föderalistische Freibürgerschaft.
Hier ist „der Staat“ dem Individuum unendlich fern, nicht in dem Sinne wie heute, daß das machtlose Individuum den von ferne her mit Übermacht wirkenden Staat nicht erreichen, sich seiner nicht erwehren kann, sondern genau umgekehrt derart, daß der unendlich machtlose „Staat“, nämlich jene obersten Behörden, das Individuum in keiner seiner wichtigen Lebensäußerung erreichen, beeinflussen, gar zwingen können. Hier wird der Mensch nicht mehr auf Nutzholz gezüchtet, wie in der Kiefer-Forst, sondern es ist gerade die Voraussetzung der ganzen Ordnung, daß er sich in voller Freiheit nach seinen Gaben als eigen- wüchsige originale Persönlichkeit entfalte [2].
Und vor allen Dingen: hier besteht nicht mehr der grauenhafte sittliche Konflikt, der das eigentliche Gift ist, an dem unsere Gesellschaft siecht, daß wir im allgemeinen nur dann sittlich, das heißt: sozial, handeln können, wenn wir entschlossen sind, eigenen Schaden zu erdulden — und daß wir im allgemeinen nur dann unseren wirtschaftlichen und politischen Vorteil verfolgen können, wenn wir uns entschließen, antisozial, und das heißt vor dem höchsten Forum unseres Gewissens: unsittlich zu handeln. Das ist die Psychologie des feindlichen Wettkampfs in der kapitalistischen Ordnung.
Davon ist in der reinen Ökonomie keine Rede mehr. Hier herrscht die Harmonie der Interessen, politisch wie wirtschaftlich, und deren Inhalt ist eben, daß alles sittliche Handeln Ehre, Wohlstand und Sicherheit des Bürgers erhöht, und alles antisoziale Handeln mit der größten
[1] Der Liberalismus in Vergangenheit und Zukunft.
[2] „Die Individualität muß leiden, wenn alle Macht ungebührlich in einem Punkt des politischen Körpers konzentriert ist. Die einzige Gewähr der Freiheit besteht darin, die Macht auf der Grundlage der Funktionen zu verteilen . . . Freie Regierung heißt: Demokratisierung der Verantwortlichkeit, ohne die das Leben nicht lebenswert ist“ (Laski, S. 90/1).
[801]
Wahrscheinlichkeit in kurzer Zeit zum Schaden des Übeltäters ausfallen muß.
Gewiß wird auch hier in manchen Fällen die Mehrheit entscheiden, und das Mitglied der Minderheit wird sich der volonté générale zu beugen haben. Und das mag zuweilen mit peinlichen Empfindungen verknüpft sein. Aber um was gehen denn solche Mehrheitsbeschlüsse in der föderalistischen Freibürgerschaft? Es ist kaum vorzustellen, daß es sich jemals um Prinzipienfragen handeln kann, durch deren Austrag die sittliche Persönlichkeit leiden könnte. Hier hat niemand mehr einen Grund, Andere um ihres religiösen oder politischen Glaubens willen zu hassen und zu unterdrücken; es kann sich im wesentlichen nur um Fragen der Zweckmäßigkeit oder der Personen handeln : soll der oder der dieses Amt erhalten, soll dieses oder jenes Institut jetzt, und wo und wie soll es errichtet werden ? In solchen Fragen überstimmt zu werden, mag kleinem persönlichem Ehrgeiz schmerzlich sein : aber gerade die freie Persönlichkeit, auf die allein es ankommt, wird unter solchen Regungen kaum zu leiden haben. Man darf hierbei nicht vergessen, daß der Geist der mißtrauischen Kritik, die hinter jeder Handlung der Gegenpartei, und oft nicht mit Unrecht, geheime uneingestandene Motive wittert, sich dann nur noch sehr selten regen wird. Wo die Menschen wieder in feste gewachsene Gruppen eingeordnet sind (es müssen nicht Blutsgruppen sein; Nachbarschaften, die durch keine Klassengegensätze gespalten sind, leisten ganz das gleiche); wo infolge all dessen die antisoziale Handlung zur Seltenheit geworden ist, da ist das Gewissen wieder zum zuverlässigen Berater des Einzelnen und Wächter der Gesellschaft geworden, und man kann endlich wieder das Vertrauen in jeden Mitbürger haben, das den letzten und stärksten Kitt aller Gesellschaft bildet.
Um den Gegenstand noch von einer anderen Seite her zu beleuchten : was fordert denn der Liberalismus für das Individuum oder die Persönlichkeit? Er fordert Freiheit. Was aber ist Freiheit? Aristoteles sagt: „Der eine Bestandteil der Freiheit ist, abwechselnd zu regieren und regiert zu werden, der andere, zu leben nach eigenem Belieben.“ Nun, diese beiden Postulate scheinen uns in der Freibürgerschaft, der föderalistischen sozialen Republik, in höherem Maße verwirklicht, als selbst die entschlossensten Liberalen von heute zu hoffen wagen. In den kleinen Einheiten, bei denen die eigentliche Souveränität ruht, in denen der Mensch keine Nummer, sondern ein Bürger ist, dessen Stimme nicht bloß eine „Wahlstimme“, sondern eine eindringliche Menschenstimme ist, regiert er wirklich selbst, auch als Mitglied einer gelegentlichen Minderheit in sekundären Fragen, statt nur immer regiert zu werden [1].
[1] Laski (a. a. O. S. 56) macht sehr fein darauf aufmerksam, daß der volle Begriff der Freiheit auch für die sozialen Gruppen gelten müsse. „Nichts kann stupider sein, als wenn der Staat sich selbst und die Individuen als die einzigen Entitäten betrachtet, die Rücksicht verdienen“.
[802]
Der aristotelische Begriff muß aber mit noch viel reicherem Inhalt erfüllt werden, um das zu erfüllen, was wir heute unter „Freiheit“ verstehen. Es handelt sich nicht bloß um jene „liberale, abstrakte negative Freiheit der Selbstbestimmung, die keine konkreten Werte spürt“ [1], sondern um die Freiheit mit vollem positivem Vorzeichen, die Stirner dieser Negation entgegengestellt hat- „Frei wovon! Was läßt sich nicht alles abschütteln? . . . Du müßtest nicht bloß los sein, was Du nicht willst, Du müßtest auch haben, was Du willst, Du müßtest nicht nur ein „Freier“, Du müßtest auch ein „Eigener“ sein“.
Auch diese Bedingung ist hier erfüllt. In der Freibürgerschaft hat jeder zwar wohl nicht alles, was er haben will, wohl aber alles, was er nach seiner Leistung für die Gesellschaft mit Recht wollen darf. Er ist nicht nur ein Freier, er ist ein Eigener.
Daß aber unter solchen Umständen alles erreicht ist, was im echten Sinne Freiheit heißen darf, das bestätigt sogar der Mann, der als der Prototyp des extremen Individualismus gilt, eben Stirner. „Er bezeichnet das Ideal der absoluten Freiheit als den Unsinn des Unmöglichen: „Beschränkung der Freiheit ist überall unabwendbar. Daß eine Gesellschaft, z. B. die Staatsgesellschaft, mir die Freiheit beschränkt, empört mich wenig. In bezug auf die Freiheit unterliegen Staat und Verein keiner wesentlichen Verschiedenheit.“ Nur sind die Bindungen des freien Vereins vom „Eigenen“ bejaht, erfreuen sich seiner Zustimmung und entsprechen seinem Interesse . . . Das Wesen des Staates ist der Gesinnungszwang, das Preisgeben der Eigenheit, die Einheit in ihm ist bloße Mitgliedschaft; im Vereine aber bejaht man sich echter, enger, persönlicher Nur von innen heraus, aus der freien Entschließung und Selbsthingabe der einzelnen, kann daher die neue Verbindung kommen. „Erst mit der letzten Separation endet die Separation selbst und schlägt in Vereinigung um.“ Mehr als künstliche und fragwürdige Normen, Verbote und Eingriffe vermag für den Zusammenschluß der Appell an die wirklichen Interessen und Bedürfnisse des Lebens. Diejenige Ordnung ist die beste, die sich diesen Interessen und ihrem Wandel am fügsamsten anschmiegt. „Der Föderalismus ist die Verfassungsform der neuen Welt und der Zukunft [2]“.“
„Der Grundgedanke des folgerichtigen Föderalismus ist also die
[1] L. Oppenheimer, a. a. O. S. 300, vgl. dazu Spinoza: „Ein freier Mann . . . ist, wer mit voller Zustimmung seines Herzens tut, was die Vernunft ihm anrät. Ein solcher Mann ist freier innerhalb Schlüssen der Gemeinschaft regelt, gehorcht . . . .“
[2] Ludwig Oppenheimer, a. a. beziehen sich auf diesen Aufsatz.
[803]
von innen her bejahte Verbindung, die vom Wissen und Gewissen der einzelnen freiwillig getragen wird. ... Er bedeutet nur, daß die Ordnung ihrem Prinzip und ihren wesentlichen Bestimmungen nach von der Gesamtheit bejaht wird, daß sie also als gerecht empfunden wird, und daß sie ferner bei jedem Wandel der Verhältnisse und Auffassungen so abgeändert werden kann, daß sie wieder als gerecht gilt“ (265/6).
So hat es auch Proudhon gemeint. Er verstand unter dem von ihm geprägten Wort Anarchie ursprünglich „gar nichts anderes als den Kantischen Gedanken, daß die Bestimmungen des Rechtes kritisch geläutert und dem Bewußtsein überzeugend gemacht werden müßten. „Anarchie ist hier im Sinne der Negation der Souveränität gebraucht, das heißt der Ersetzung der Willkür durch die reine Vernunft“ (266) ... ; nur die Gerechtigkeit einer lebendigen Gemeinschaft schafft eine Würde der hier verbundenen Einzelnen, nur die Wirksamkeit des Rechtes in der äußeren Welt lenkt das Schaffen des Einzelnen auf die würdige Aufgabe ihrer Gestaltung, nur der geistige Zauber gemeinsamer Ideale, gemeinsamer Würde veredelt und läutert die Triebe und hilft dem Einzelnen, auch seine eigene Würde . . . nicht an die Triebhaftigkeit zu verlieren (301). „Die Freiheit ist die bewegende, die Gerechtigkeit die leitende Fähigkeit des Menschen. Nur weil das Ideal die Gerechtigkeit aus eigenstem Drange bejaht und als höchsten denkbaren Gegenstand der Begeisterung mit unwiderstehlichem Zauber bekleidet, handeln wir gerecht (302). . . . Die Vollendung des einzelnen steht nicht im Widerspruch zur wirksamen Ordnung der Gesamtheit, sondern wird erst zugleich mit ihr erreicht“ (303).
In dieser Auffassung begegnen sich in merkwürdiger Weise der feudal-konservative Machtpolitiker und der idealistische Anarchist. Treitschke schreibt: „Die Freiheit, wie wir schon wissen, besteht in vernünftigen Gesetzen, denen der Einzelne mit sittlicher Zustimmung folgen kann, und in dem Halten dieser Gesetze. Die Begriffe: gesetzliche Macht und gesetzliche Freiheit sind keine Gegensätze, sondern Korrelate“ [1].
4. Der Souverän. ↩
Damit sind wir zu dem letzten Gegenstande unserer Untersuchung geführt worden: der Frage, wer denn der Souverän dieser klassenlosen Gesellschaft der nächsten Zukunft sein wird ? Die Antwort ist leicht und ist — wir haben Beispiele angeführt — unzählige Male in der Geschichte der Staatslehre gegeben worden:
Der Souverän der Freibürgerschaft ist niemand anderes als das
[1] Politik I, S. 156. Er konstatiert sogar ein „historisch sicheres Gesetz der Demokratisierung der Staatsformen“ (S. 160).
[804]
Recht in seiner höchsten Bedeutung: als Gerechtigkeit, als Wahrung der Gleichheit der Würde der Personen.
Jede „Machtlehre verfehlt ihr Ziel. Sie rechtfertigt den Staat nicht, sondern sie vernichtet ihn, sie ebnet der permanenten Revolution die Wege“ [1]. Das gibt, wie wir soeben gesehen haben, auch der Machttheoretiker selbst zu. Treitschke schreibt an einer anderen Stelle: „Der Staat fühlt, daß seine eigene Schönheit und Kraft am letzten Ende auf der Freiheit vernünftig denkender Menschen beruht. Er arbeitet darauf hin, nur solche Gesetze zu geben, die von den Besten des Volkes als vernünftig anerkannt werden und die Selbständigkeit des Menschen nicht erdrücken, sondern wecken“ [2]. Und er wirft Macchiavelli vor, man finde bei ihm keine Spur davon, „daß die erworbene Macht sich rechtfertigen muß, indem sie verwendet wird für die höchsten sittlichen Güter der Menschheit“ (S. 91). Grundsätzlich sind wir uns völlig einig; ob freilich Treitschke angebrachtermaßen unseren Voraussetzungen und Schlüssen zustimmen würde, dürfte einigermaßen fraglich sein.
Constantin Frantz, der nicht, wie Treitschke, den Staat der Wirklichkeit für den Rechtsstaat hielt, hat das Sein und das Sollen in gewohnter Klarheit anti- und synthetisiert: „Das Recht ist niemals die Grundlage der Staatsgewalt, sondern vielmehr die Norm für die Wirkung der Gewalt, und das Recht selbst muß auf Macht ruhen. Dieses aber anerkannt, so wird das Recht dadurch nicht etwa herabgewürdigt oder verdrängt, sondern sein Wesen gelangt erst dadurch zur vollen Bedeutung. Denn weit entfernt, daß die Macht dadurch über das Recht erhoben würde, wird sie vielmehr demRechte untergeordnet“ [3].
Er versteht unter „Macht“ die geistigen Elemente, worauf die Herrschaft im Staate beruht, wobei die materiellen Elemente nur als äußere Machtmittel hinzukommen (187/8) ; und er erblickt in der Fundierung des Rechtes auf die Macht in diesem Sinne das Heilmittel gegen „die beiden Hauptkrankheiten unserer Zeit, welche in unverkennbarer Wechselwirkung stehen: rechtlose Macht und machtloses Recht. Die moderne Doktrin hat den seit den letzten Jahrhunderten emporgekommenen Absolutismus prinzipiell widerlegt, aber nicht realiter bezwungen, und weil den doktrinären Verfassungen die reale Machtbasis fehlt, so haben sie nicht verhindern können, daß die noch fortlebenden Machtelemente des Absolutismus gegen das ihnen aufgezwungene Recht hinterher wieder reagieren“ (189/90).
Nun, die letzten Machtelemente des Absolutismus, die letzten Reste des politischen Mittels, sind aus der Freibürgerschaft ausgerodet. Hier
[1] Jellinek, a. a. O. S. 196.
[2] S. 83.
[3] a. a. O. S. 189.
[805]
zum ersten Male fallen Macht und Recht wirklich zusammen. Und damit wird das alte Ideal Wirklichkeit, das von jeher alle Staatsphilosophen ohne jede Ausnahme bekannt haben. Herrschen soll die Vernunft, und das ist nichts anderes als die geistige Kraft, die das Göttliche, die Gerechtigkeit, nicht nur kraftlos zu erkennen vermag, sondern als kategorischen Imperativ auch mit allen Mitteln verwirklichen will und kann, weil sie ihn verwirklichen soll [1]. Fraglich war bis jetzt nur immer, wie die Führer gefunden oder ausgebildet werden sollen, denen dieses Wissen und Wollen unverfälschbar innewohnt.
Platon ersann die schärfste Siebung und erdachte die härtesten Erziehungsmaßnahmen, um das Ideal einer Beamtenschaft, seine „Wächter“, heranzuziehen, die durch keinerlei wirtschaftliche und familiäre Beziehungen von ihrer Aufgabe abgelenkt werden können, nur der Wohlfahrt des Ganzen zu dienen: sie durften weder Eigentum noch Sonderfamilie haben. Aus diesem Korps erprobtester Offiziere sollten dann durch neue noch engere Siebe die Generale ausgesondert werden : die den Vernunftstaat leitenden, nur von der im höchsten Maße geläuterten Vernunft beseelten „Philosophen“, Männer, die das Ideal des „vollkommen gebildeten Menschen“ fast restlos verwirklichen: das Vorzugswürdige zu erkennen, zu wollen und auszuführen.
Dann hat die christliche Staatslehre im Evangelium das Gebot der göttlichen Vernunft, und in der Priesterschaft seine berufenen Interpreten und ausführenden Beamten gesehen. So sehr auch die kanonische Doktrin zeitlich gebunden war und in der Anwendung des Grundsatzes geirrt haben mag: an dem Grundsatz selbst ist nie gezweifelt worden, daß der Herrscher eines wahren Gemeinwesens niemand anders sein könne, als Gott, die ewige Vernunft, und daß das Wesen des Staates nichts anderes sein dürfe und solle als Gerechtigkeit.
Dieser Gedanke ist immer wieder in all den großen Kämpfen um den Staat mit voller Klarheit hervorgetreten, auch bei solchen Denkern, die in der Anwendung weit von dem letzten Ideal der von allen Machtpositionen erlösten föderalistischen Freibürgerschaft abwichen. Selbst tin gekrönter Politiker wie Jakob I. gab zu, daß der König, der sonst niemandem verantwortlich ist, doch Gott verantwortlich ist [2], und gab damit allen Kronenträgern der nächsten Zeit das Stichwort. Es war die gleiche Verzerrung des ursprünglich großen Gedankens, die dem extremen Absolutismus Köpfe von dem Range eines Bacon [3] und Hobbes zuführte.
In Frankreich war es nicht anders als in England. Voltaire freilich
[1] „Der Glaube an die Vernunft, an die Gerechtigkeit ist die tiefste Grundlage des ganzen Proudhonschen Lebenswerkes“ (Antonelli, a. a. O. S. 221).
[2] Gooch, a. a. O. S. 15.
[3] Vgl. Gooch, a. a. O. S. 22ff.
[806]
„hat die Lehre von der Diktatur der aufgeklärten Vernunft noch nicht konsequent entwickelt. . . Dagegen herrscht bei den . . . Physiokraten der Grundgedanke, der sich aus der gemeinsamen Gegnerschaft gegen die historischen intermediären Gewalten und dem gemeinsamen Glauben an die Macht einer aufgeklärten Bürokratie ergibt. . . . Die konsequente Formulierung und den Namen erhielt diese Staatsauffassung durch Mercier de la Rivière in dem Buch: „L'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques“. Er entwickelt das System eines despotisme légal aus allgemeinsten Vernunftsprinzipien. Die Vernunft diktiert, Ihr Despotismus hat nicht den Zweck, die Menschen zu Sklaven zu machen, sondern im Gegenteil, ihnen wahre Freiheit und „culture“ zu bringen. Durch diesen Zweck unterscheidet sich der despotisme légal vom despotisme arbitraire. Aber es bleibt trotzdem ein persönlicher Despotismus, nämlich desjenigen, der die evidente Wahrheit erkennt. Wer die richtige, natürliche und wesentliche Einsicht hat, darf gegenüber jedem, der sie nicht hat, oder sich ihr verschließt, Despot sein“ [1].
Wir erkennen hier sehr deutlich die Linie, die von Rousseau zu St. Simon und Comte führt, die beide eine Art von Priesterschaft in Gestalt von positivistisch ausgebildeten Philosophen als Vertreter des eigentlichen Souveräns, der Vernunft, einsetzen wollten und damit zu Platons Vorstellungen zurückkehrten [2].
Auch dieses Problem verliert in der föderalistischen Freibürgerschaft sehr an Bedeutung, ja, man kann sagen, daß es nicht mehr existiert. Solange man noch den zentralistischcn Staat als den einzig möglichen Staat betrachtet, hat man sich den Kopf darüber zu zerbrechen, wie die Männer erzogen und ausgesiebt werden sollen, denen die. Allmacht der Zentralbehörden ohne Schaden für Gemeinwohl und Freiheit anvertraut werden können. Aber in der Freibürgerschaft ist die Ohnmacht der Zentralbehörden so groß, daß ein absichtlicher Mißbrauch unmöglich ist ; und darum kann eine Persönlichkeit, deren Unzulänglichkeit als Sachverständiger seines Fachs sich herausgestellt haben sollte, ohne jede Schwierigkeit ersetzt werden [3].
Das Gleiche gilt von den Führern der einzelnen Bundesglieder. Niemals kann hier Führerschaft in Herrschaft ausarten. Und da es keine „partikulären Interessen“ mehr gibt, so herrscht hier nur eins:
[1] Schmitt-Dorotic, Die Diktatur, S. 109 ff.
[2] Es ist sehr interessant, daß der kraftvollste Vertreter der Volkssouveränität, Milton, in seinen späteren Schriften zu ähnlichen Ergebnissen gelangte. Sein Großer Rat soll dauernd sein „Das Schiff ist immer unter Segel; wenn die Männer am Ruder gut steuern, warum soll man sie wechseln?“ (Gooch, a. a. O. S. 109).
[3] Das ist fast der einzige Punkt, in dem ich von Nelson ein wenig abweiche. Er hat offenbar noch allzusehr den zentralisierten Allmachtstaat der Gegenwart im Auge und stellt sich daher die Schwierigkeit, den „Weisesten“ zu finden, allzu schwierig vor (vgl. phil. Rechtslehre S. 270ff.).
[807]
die Vernunft, die Gerechtigkeit. Hier ist der Staat in Wahrheit nur der „Diener des Rechts“ [1].
---
„Wer sinnend den Prozeß steigender Gewähr der Festigung des öffentlichen Rechtes und der Erfüllung der auf ihm ruhenden individuellen Forderungen an den Staat überblickt, der kann, wenn er auch noch so zweifelnd der Vortrefflichkeit menschlicher Dinge gegenübersteht, sich nicht des Gedankens erwehren, daß es der Zukunft vorbehalten sei, das schwer zu erringende Gut unverbrüchlicher Rechtsordnung zum dauernden Besitze der Staaten und damit der Menschheit zu gestalten [2]“.
Diese Hoffnung ist völlig gerechtfertigt. Wir dürfen sie, ohne den Mollklang des durchschimmernden Zweifels, der den Rechtsstaat nur in einer unendlich fernen Zukunft anzunehmen wagt, sogar als vollkommene Gewißheit einer nahen Zukunft betrachten. Die Tendenz der Staatsentwicklung, die wir gezeichnet haben, erlaubt uns, auszusprechen, daß wir bereits an der Schwelle der neuen Zeit stehen.
Diese Tendenz enthüllte sich uns als ein steter siegreicher Kampf des ökonomischen Mittels gegen das politische. Das Recht des ökonomischen Mittels, das Recht der Gleichheit und des Friedens, das Recht der Gerechtigkeit, sahen wir im Anfang auf den winzigen Kreis der Blutsverwandtschaftshorde [3] beschränkt: eine Mitgift schon aus vormenschlichen Gesellschaftszuständen ; rings um dieses Friedenseiland tobte der Ozean des politischen Mittels und seines Rechtes. Aber weiter und weiter sahen wir die Kreise sich spannen, aus denen das Recht des Friedens seinen Widerpart verdrängt hat, und sahen sein Vordringen überall geknüpft an das Vordringen des ökonomischen Mittels: des als äquivalent betrachteten Tauschverkehrs der Gruppen untereinander. Zuerst vielleicht durch den Feuertausch, dann durch den Frauentausch und schließlich durch den Gütertausch dehnte sich das Gebiet des Friedensrechtes immer weiter: es schützte die Marktplätze, dann die zum Markt führenden Straßen, dann die auf den Straßen ziehenden Kaufleute. Wir haben gesehen, wie der „Staat“ diese Friedensorganisation in sich aufnimmt und fortbildet, und wie sie dann im Staate selbst das Gewaltrecht immer weiter zurückdrängt. Kaufmannsrecht wird Stadtrecht; die Gewerbsstadt, das entfaltete ökonomische Mittel, unterhöhlt durch seine Waren- und Geldwirtschaft den Feudalstaat,
[1] Karl Schmitt, Der Wert des Staates, S. 85.
[2] Jellinek, Allgemeine Staatslehre, S. 795.
[3] Müller-Lyer macht darauf aufmerksam, daß Sibja zugleich Sippe und Frieden bedeutet. Auch pax und pactum entstammen, wie oben erwähnt, der gleichen Wortwurzel.
[808]
das entfaltete politische Mittel [1]; und die städtische Bevölkerung vernichtet zuletzt im offenen Kampf die politischen Reste des Feudalstaates und erstreitet der gesamten Bevölkerung des Staates die Freiheit und das Recht der Gleichheit zurück. Stadtrecht wird Staatsrecht, und zuletzt Völkerrecht.
Nun sehen wir nirgend eine Kraft, die dieser bisher dauernd wirksam gewesenen Tendenz jetzt noch ernstlich hindernd in den Wegtreten könnte. Im Gegenteil : die bisherigen Hemmungen des Prozesses werden augenscheinlich immer schwächer. Die Tauschbeziehungen der Nationen überwiegen immer mehr die kriegerisch-politischen Beziehungen; und durch den gleichen Prozeß der ökonomischen Entwicklung gewinnt im Innern der Gemeinwesen das mobile Kapital, die Schöpfung des ökonomischen Mittels, immer mehr das Übergewicht über das Grundeigentum, die Schöpfung des politischen Mittels. Gleichzeitig verliert die Superstition immer mehr an Einfluß. Und so darf man, muß man, schließen, daß die Tendenz sich bis zur vollen Ausscheidung des politischen Mittels und seiner Schöpfungen, bis zum vollen Siege des ökonomischen Mittels durchsetzen wird.
Man muß das um so mehr schließen, weil hier eine Kraft wirkt, die unabhängig von aller wirtschaftlichen Entwicklung mit ungeheuerster Energie auf die Erreichung dieses Zieles hindrängt: der kategorische Imperativ, der als Trieb der Gerechtigkeit in den Menschen der Unterklasse und ihren Vorfechtern die Macht des Angriffs gewaltig verstärkt, während er umgekehrt in seiner negativen Ausgestaltung als Gewissen die Widerstandskraft ihrer Gegner herabsetzt [2].
Diese Kraft hat in der Vergangenheit, wie wir soeben zeigten, das reine Gewaltverhältnis immer gehemmt und allmählich immer mehr zurückgedrängt. Und so kann sie „in der Idee verallgemeinert und zum leitenden Beweggrund universeller Bestrebungen werden. Von den unterdrückenden Ungleichheiten und von allen Übeln, in welche die Völker durch die Logik der Gewalt geraten mußten, werden sie sich vermöge einer anderen Art von Notwendigkeit, nämlich vermöge derjenigen Kräfte, welche im Dienste des gesteigerten Bewußtseins stehen, auch wieder befreien und so zu Organisationen gelangen, in
[1] „Im dreizehnten Jahrhundert erscheinen die Reformen des Rechts und der Gesetzgebung; sie greifen das Feudalrecht an und leiten ein neues bürgerliches Recht ein, das aus dem Kreise der Gemeinden in die hohe Sphäre des Staates übergeht. Entstanden in den Verfassungen der Kommunen und den Gewohnheitsrechten der Städte und Flecken, unterschied sich dieses Recht der Bürgerschaft von dem des Adels, dem es feindlich entgegenstand, in seinem ganzen Grundwesen: ihm lag die natürliche Gerechtigkeit zugrunde. ... Es war in ungeschlachter Gestalt . . . der gleiche Geist der Gerechtigkeit und der Vernunft, der einstmals die großen Linien des römischen Rechtes gezogen hat“ (Thierry, a. a. O. S. 26).
[2] S. S. I, S. 297ff.
[809]
denen die Gegenseitigkeit der Arbeit nicht nur zur zweckmäßigsten Teilung der Funktionen, sondern auch zur ebenmäßigsten Verteilung der Früchte führt“ [1].
Dieser Gedanke gestattet eine höchst wichtige Anwendung: der Optimismus der katholisch-kanonischen Geschichtsauffassung beruhte auf dem Glauben an die „Theophanie“. Gott offenbart sich in der Geschichte, indem er die widerstreitende Kraft des Bösen immer weiter zurückdrängt und schließlich ganz ausrottet, und so die Menschheit zu immer größeren Höhen der Schönheit und Sittlichkeit emporleitet. Die Aufklärung, die mit dieser außerweltlichen Macht nicht rechnen konnte, machte aus der Theophanie, wie wir wissen, die „Ideophanie“ [2]. Aber das reichte nicht hin, um den Glauben an den Fortschritt wirklich zu begründen. Denn die Idee im Sinne der Aufklärung ist rein intellek- tualistisch aufgefaßt, ist keine Kraft; und nur von einer Kraft können wir annehmen, daß sie Wirkungen ausübt. So ist der Glaube an einen geschichtlichen Fortschritt der Menschheit bisher ohne wirkliche Begründung geblieben.
Das ist jetzt, anders geworden. Wir wissen heute, daß Ideen „Sentiments“ sind. Sentiments aber sind nicht bloß intellektualistische kraftlose Vorstellungen, sondern sind vielmehr um einen Kern gruppierte Instinkte, die deren ganzen Vorrat an konativer Kraft in sich haben [3]. Sie sind zugleich „Ideen“ und „Interessen“.
Nun ist, wie wir in der allgemeinen Soziologie dargestellt haben, das wichtigste aller Gruppeninteressen das ethische an der Aufrechterhaltung und, wo er verloren war, der Wiederherstellung des Consensus.
Dieses Interesse spiegelt sich vorstellungsmäßig als die Idee der Gerechtigkeit, und diese Idee ist, eben weil sie gleichzeitig ein Interesse ist, nicht kraftlos, sondern enthält den ganzen Reichtum der um sie gruppierten Instinkte an konativer, zum Ziele drängender, realer, kooperierender Kraft [4]. Diese Kraft ist es, die immer wieder in suprasozialen Persönlichkeiten sich gegen die Verletzungen der Reziprozität empört und sie zu Führern der Unterdrückten im Kampfe gegen die Störungen der gerechten Ordnung macht; diese Kraft ist es, die auf die Länge immer wieder die Massen diesen Persönlichkeiten zuführt; diese Kraft schließlich, die in allen Kämpfen der Gruppen und Klassen in immer nur die eine Wagschale fällt und auf die Dauer den Sieg immer nur der einen Partei herbeiführt.
In dieser neuen vervollkommneten Bedeutung des Begriffs „Idee“ ist also die Weltgeschichte in der Tat die Ideophanie. Wir bedürfen
[1] Dühring, Cursus der National- und Sozialökonomie, 2. Auflage, S. 257.
[2] S. S. I, S. 39, S. 755.
[3] S. S. I, S. 230ff.
[4] S. S. I, S. 953·
[810]
jetzt weder theologisch eines Deus ex machina noch metaphysisch der Setzung einer qualitas occulta, um den Prozeß zu verstehen, der durch alle Peripetien und Störungen hindurch dennoch jenem Einen Wertresultat entgegenführt, das in all den berühmten Formeln der großen Philosophen vom Gang der Geschichte in den verschiedensten Worten geschildert worden ist. Die Geschichte ist in der Tat die „Entfaltung zur Humanität“ (Herder), der „Fortschritt von kriegerischer zu friedlicher Tätigkeit“ (St. Simon, Spencer), „das Hindurchdringen der Vernunft durch die Natur“ (Schleiermacher) ; sie ist in der Tat die Entwicklung zur „unsichtbaren Kirche“, zum „ethischen Gemeinwesen“ (Kant), „zur Gemeinschaft freiwollender Menschen“ (Stammler).
An diesem Leitfaden mag in der Tat einmal in Erfüllung der Hoffnung Kants ein „Historiker-Newton eine Weltgeschichte abfassen, in der die allmähliche Verwirklichung dieser Naturabsicht klar hervortritt“ [1].
Wir werden auf Grund unserer prinzipiellen Ergebnisse im nächsten Bande dieses Systems, der „Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Europas von der Völkerwanderung bis zur Gegenwart“ unser möglichstes tun, um dem von Kant erhofften Historiker-Newton das Baugelände vorzubereiten, auf dem er sein Werk errichten kann.
Dieses Werk wird die Forderung Diltheys erfüllen, „im All die Explikation Gottes zu sehen“.
Da Gott nichts anderes ist als die auf den Himmel projizierte Gemeinschaft [2], so handelt es sich in Wirklichkeit um die Erlösung Gottes, um die Befreiung der civitas Dei von der civitas Diaboli, um die Ausrottung des „magnum latrocinium“, das der Staat der Geschichte war und ist.
Und niemals war diese Befreiung eine so bittere Notwendigkeit wie in dieser schweren Zeit, die mit den gewaltigsten Dingen schwanger geht. Wir zitieren eine vom tiefsten sittlichen Ernst getragene Äußerung Laskis [3] : „Wir erkennen jetzt die Gefahr eines Staates, der die Macht für das höchste aller Güter erklärt und sich wenig um die Zwecke kümmert, für die er sie einsetzt. Wir haben die Jugend der halben Welt geopfert, um unsere Freiheit gegen seine Übergriffe zu bewahren. Und sicherlich muß die Freiheit, die wir gewinnen, sinnlos sein, wenn wir sie nicht in jeder Sphäre des gesellschaftlichen Lebens zur dauernden Geltung emporführen. Wenigstens diese Generation kann niemals die geisterhaften Legionen vergessen, von denen sie umgeben ist ; es ist ihre
[1] Er wird dabei die Mahnung Mosers nicht vergessen dürfen, das Schicksal der „gemeinen Landeigentümer“ und ihres Besitzes in den Mittelpunkt der Darstellung zu rücken (vgl. oben S. 714).
[2] S. S. I, S. 422. s
[3] a. a. O. S. 122.
[811]
Pflicht, niemals zu vergessen, daß ihre Anstrengung dem Urteil dieser Geisterscharen unterliegt. Sie werden unsere Erfolge an dem Maßstabe ihrer unendlichen Hingegebenheit messen. Und sie werden jede andere Belohnung als die Eroberung ihres Traumlandes von sich weisen.“
Wir werden dieses Traumland erobern. Das ist nicht bloß unser heiliger Glaube, ein Glaube von tiefster religiöser Kraft, der gleiche Glaube, der alle Religionsstifter, Propheten und großen Philosophen befeuert und beseligt hat [1]: sondern dieser Glaube ruht zum ersten Male in aller Geschichte auf dem sichersten Wissen, das gedacht werden kann. Nicht nur auf dem Wissen a priori des Gewissens in unserer Brust, das uns unsere Pflicht vorschreibt, mögen wir uns eigensüchtig noch so sehr gegen sie sträuben, mögen wir mit noch so schlauen Ausflüchten uns ihr zu entziehen suchen: sondern jetzt auch auf dem logischen Wissen a posteriori um die Wahrheit, gesichert durch die klare Erkenntnis des gegnerischen Irrtums und durch die Analyse von unzähligen Tatsachen, die uns immer wieder auf die eine Ursache aller sozialen Übel, auf jene alte Erbsünde der kinderhaften Menschheit, geführt hat, die sie unschuldig-schuldig beging.
So ist hier erreicht, was Proudhon durch sein ganzes Leben hindurch mit aller Leidenschaft seines glühenden Prophetenherzens erstrebte, aber nicht ganz erreichen konnte: die Übereinstimmung von „science et conscience“ [2]: der letzte, einzige Prüfstein soziologischer Wahrheit.
Das ist der Leidens- und Erlösergang der Menschheit, ihr Golgatha und ihre Auferstehung zum ewigen Reich : vom Krieg zum Frieden, von der feindlichen Zersplitterung der Horden zur friedlichen Einheit der Menschheit, von der Tierheit zur Humanität, vom Raubstaat zur
Freibürgerschaft.
[1] „Zur Religion gehört nämlich, wiefern sie über bloße Ethik hinausgeht, die Anerkennung objektiver Zwecke in dem Sinne, daß der Mensch sie sich nicht selbst setzt“ (Nelson, a. a. O. S. 487).
[2] Théorie de l'impôt, Oeuvres complètes, tome XV, S. 57: „La science et la con science, si parfaitement unies, si démonstratives, si décisives“.