LUDWIG MISES,
Grundprobleme der Nationalökonomie (1933)
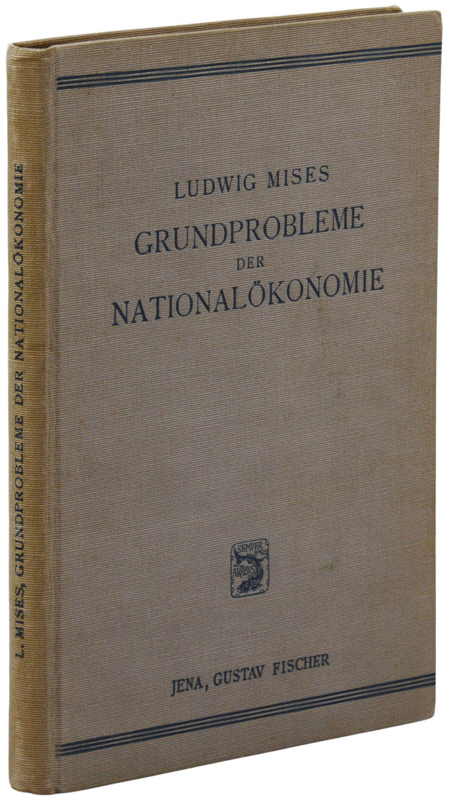
[Created: 26 December, 2024]
[Updated: 26 December, 2024] |
 |
This is an e-Book from |
Source
, Grundprobleme der Nationalökonomie. Untersuchungen über Verfahren, Aufgaben und Inhalt der Wirtschafts- und Gesellschaftslehre (Jena: Gustav Fischer, 1933).http://davidmhart.com/liberty/Books/1933-Mises_Grundprobleme/Mises_Grundprobleme1933-ebook.html
Ludwig Mises, Grundprobleme der Nationalökonomie. Untersuchungen über Verfahren, Aufgaben und Inhalt der Wirtschafts- und Gesellschaftslehre (Jena: Gustav Fischer, 1933).
Editor's Introduction
To make this edition useful to scholars and to make it more readable, I have done the following:
- inserted and highlighted the page numbers of the original edition
- not split a word if it has been hyphenated across a new line or page (this will assist in making word searches)
- added unique paragraph IDs (which are used in the "citation tool" which is part of the "enhanced HTML" version of this text)
- retained the spaces which separate sections of the text
- created a "blocktext" for large quotations
- moved the Table of Contents to the beginning of the text
- placed the footnotes at the end of the book
- reformatted margin notes to float within the paragraph
- inserted Greek and Hebrew words as images
Inhaltsverzeichnis.
- Vorwort V
- Inhaltsverzeichnis XV
- Aufgabe und Umfang der allgemeinen Wissenschaft vom menschlichen Handeln 1
- A. Wesen und Entwicklung der Gesellschaftswissenschaft 1
- 1. Die Keime der Gesellschaftswissenschaft in den geschichtlichen und in den Normwissenschaften 1.
- 2. Die Nationalökonomie 3.
- 3. Das Programm einer Soziologie und die Suche nach historischen Gesetzen 4.
- 4. Der Standpunkt des Historismus 5.
- 5. Der Standpunkt des Empirismus 7.
- 6. Der logische Charakter der allgemeingültigen Wissenschaft vom menschlichen Handeln 12.
- 7. Die allgemeingültige Wissenschaft vom menschlichen Handeln als Gesellschaftswissenschaft und als Nationalökonomie; einige dogmengeschichtliche Bemerkungen 17.
- B. Umfang und Bedeutung des Systems apriorischer Sätze 22
- 1. Das Handeln als Grundbegriff und die kategorialen Bedingungen des Handelns 22.
- 2. Apriorische Theorie und empirische Verifikation 26.
- 3. Theorie und Erfahrungsstoff 29.
- 4. Die Scheidung von Mittel und Zweck; das »Irrationale« 30.
- C. Wissenschaft und Wert 34
- 1. Der Sinn der Wertfreiheit 34.
- 2. Wissenschaft und Kunstlehre; Nationalökonomie und Liberalismus 35.
- 3. Die universalistische Kritik der individualistischen Methode 39.
- 4. Erleben der Ganzheit und wissenschaftliche Erkenntnis 42.
- 5. Irrtümer der universalistischen Methode 45.
- 6. Der »objektive« Sinn 46.
- D. Utilitarismus und Rationalismus und die Lehre vom Handeln 49
- 1. VIERKANDTS Triebsoziologie 49.
- 2. MYRDALS Attituden- lehre 55.
- 3. Ethnologische und urgeschichtliche Kritik des Rationalis- mus 59.
- 4. Triebsoziologie und Behaviorismus 63.
- A. Wesen und Entwicklung der Gesellschaftswissenschaft 1
- Soziologie und Geschichte 64
- Einleitung 64.
- I. Das methodologische und das logische Problem 67.
- II. Der logische Charakter der Geschichtswissenschaft 69.
- III. Idealtypus und soziologisches Gesetz 71.
- IV. Die Wurzel der Irrtümer über den logischen Charakter der Nationalökonomie 88.
- V. Geschichte ohne Soziologie 94.
- VI. Allgemeine Geschichte und Soziologie 102. -
- VII. Soziologische Gesetze und historische Gesetze 104.
- VIII. Qualitative und quantitative Analyse in der Nationalökonomie 113.
- IX. Die Allgemeingültigkeit soziologischer Erkenntnis 116.
- Schluß 120.
- Begreifen und Verstehen 122
- I. Erkenntnis von außen und Erkenntnis von innen 122.
- II. Be- greifen und Verstehen 124.
- III. Das Irrationale als Gegenstand der Erkenntnis 127.
- IV. SOMBARTs Kritik der Nationalökonomie 129.
- V. Logik und Sozialwissenschaft 134.
- Vom Weg der subjektivistischen Wertlehre 137
- I. Die Umgrenzung des »Wirtschaftlichen« 137.
- II. Das Vorziehen als Grundelement des menschlichen Verhaltens 139.
- III. Eudämonis- mus und Wertlehre 141.
- IV. Nationalökonomie und Psychologie 142.
- V. Nationalökonomie und Technologie 145.
- VI. Die Geldrechnung und das im engeren Sinne »Wirtschaftliche« 146.
- VII. Die Austauschverhältnisse und die Grenzen der Geldrechnung 148.
- VIII. Datenänderungen 150.
- IX. Die Zeit in der Wirtschaft 151.
- X. Die »Widerstände« 152.
- XI. Die Kosten 154.
- Bemerkungen zum Grundproblem der subjektivistischen Wertlehre 156
- Die psychologischen Wurzeln des Widerstandes gegen die nationalökonomische Theorie 170
- Einleitung 170.
- I. Das Problem 171.
- II. Die marxistische (wissenssoziologische) Hypothese 173.
- III. Die Rolle des Ressenti- ments 181.
- IV. Notwendigkeit und Freiheit 184.
- Schluß 187.
- Der Streit um die Wertlehre 189
- Das festangelegte Kapital 201
- I. Die Determinante »Vergangenheit« in der Produktion 201.
- II. Die Determinante »Vergangenheit« und die Handelspolitik 206.
- III. Die Fehlverwendung von Kapital 208.
- IV. Die Umstellung der Arbeiter 211.
- V. Die Fehlanlage von Kapital im Urteil des Unternehmers 213.
- Noten
- Register 215
[V]
Vorwort.↩
Wesen und Bedeutung der Nationalökonomie begegnen Mißverständnissen, die nicht allein in der einem politischen Wollen entspringenden Abneigung gegen die Ergebnisse der Forschung und die aus ihnen notwendigerweise zu ziehenden Folgerungen ihre Wurzel haben. Die logische und verfahrensmäßige Sonderart der nationalökonomischen Theorie bietet der Wissenschaftslehre, die lange Zeit nur Mathematik und mathematische Naturwissenschaft zu betrachten liebte und erst spät auch der Biologie und der Geschichte Aufmerksamkeit zuzuwenden begann, scheinbar unüberwindliche Schwierigkeiten. Diese Schwierigkeiten kommen wohl vor allem aus erstaunlicher Unvertrautheit mit den grundlegenden nationalökonomischen Dingen. Wenn ein Denker vom Range BERGSONS, dessen umfassender Geist die Wissenschaft der Gegenwart meistert wie kaum ein zweiter, Anschauungen äußert, die beweisen, daß ihm der Grundgedanke der subjektivistischen Wertlehre fremd geblieben ist, [1] kann man sich ungefähr vorstellen, wie es heute um die Verbreitung nationalökonomischer Kenntnisse bestellt ist.
Unter der Herrschaft des MILLschen Empirismus und Psychologismus war die Logik für die Behandlung der Aufgaben, die ihr die Nationalökonomie stellt, nicht vorbereitet; die Unzulänglichkeit des werttheoretischen Objektivismus der zeitgenössischen Nationalökonomie mußte übrigens jeden Versuch einer befriedigenden Lösung vereiteln. Nichtsdestoweniger verdanken wir gerade dieser Epoche die wertvollsten Beiträge zur Erhellung der wissenschaftstheoretischen Probleme der Nationalökonomie. SENIOR, JOHN STUART MILL und CAIRNES erfüllten eben im höchsten Maße die wichtigste Bedingung für ihre erfolgreiche Bearbeitung: sie waren selbst Nationalökonomen. Aus ihren Ausführungen, die sich in den Bahnen der zu jener Zeit herrschenden psychologistischen Logik bewegen, leuchten Gedanken hervor, die nur der Befruchtung durch eine vollkommenere Lehre von den Denkgesetzen bedürfen, um zu ganz anderen Ergebnissen hinzuleiten.
[VI]
Die Unzulänglichkeit der empiristischen Logik hat die Bemühungen CARL MENGERS stärker behindert als die der genannten englischen Denker. Seine genialen »Untersuchungen über die Methode der Sozialwissenschaften« können heute noch weniger befriedigen als etwa das Methodenbuch von CAIRNES. Das ist vielleicht gerade dadurch bedingt, daß MENGER radikaler vorgehen wollte und daß er, mehrere Jahrzehnte später wirkend, den Zwiespalt bereits sah, an dem seine Vorgänger vorübergegangen waren.
Was seither zur Aufhellung der logischen Grundprobleme der Nationalökonomie geleistet wurde, entsprach nicht den Erwartungen dieser glänzenden Anfänge. Die Schriften der Anhänger der historischen und kathedersozialistischen Schulen in Deutschland und England und der Institutionalisten Amerikas haben unser Wissen um diese Dinge mehr verwirrt als gefördert [2].
Den Untersuchungen von WINDELBAND, RICKERT und MAX WEBER verdanken wir die Erhellung der logischen Probleme der Geschichtswissenschaft. Daß diesen Denkern die Tatsache und die [VII] Möglichkeit einer allgemeingültigen Wissenschaft vom menschlichen Handeln entgangen sind, daß sie, im Zeitalter der historischen Schule lebend und wirkend, nicht sahen, daß es Soziologie und Nationalökonomie als allgemeingültige Wissenschaft vom menschlichen Handeln geben kann und gibt, beeinträchtigt nicht das, was sie für die Logik der Geschichtswissenschaft geleistet haben. Anstoß zur Beschäftigung mit diesen Problemen gab ihnen die positivistische Forderung, die überkommenen geschichtlichen Wissenschaften die Geisteswissenschaften als unwissenschaftlich zu verwerfen und durch eine Wissenschaft der historischen Gesetze zu ersetzen. Sie haben das Verkehrte dieser Auffassung aufgezeigt und die logische Eigenart der Geschichtswissenschaft im Anschluß an die Lehre vom »Verstehen«, um deren Entwicklung sich Theologen, Philologen und Historiker verdient gemacht hatten, dargelegt.
Man hat nicht beachtet oder vielleicht nicht beachten wollen, daß die WINDELBAND-RICKERTsche Lehre auch die grundsätzliche Ablehnung der Bestrebungen zur Schaffung einer »geschichtlichen Theorie« der Staatswissenschaften einschließt. Gesetzeswissenschaft und Geschichtswissenschaft sind für sie logisch geschieden. Allgemeine Volkswirtschaftslehre, die, wie SCHMOLLER dachte, als empirisch-realistische Theorie der Wirtschaftsgeschichte aus dem geschichtlichen Material gewonnen werden könnte, muß ihrer Auffassung geradeso absurd erscheinen wie das Streben nach Gesetzen geschichtlicher Entwicklung, wie sie etwa KURT BREYSIG aufzustellen versucht hat. Auch für MAX WEBER gehen Nationalökonomie und Soziologie vollständig in der Geschichte auf. Sie sind Geistesoder Kulturwissenschaften wie diese und arbeiten mit denselben logischen Mitteln; ihr wichtigstes begriffliches Werkzeug ist der Idealtypus, der in Geschichte und in dem, was MAX WEBER als Nationalökonomie und Soziologie ansah, von gleicher logischer Struktur ist. Wenn man idealtypische Konstruktionen mit dem Namen Wirtschaftsstil, Wirtschaftssystem oder Wirtschaftsstufe belegt, so ändert man damit nichts an ihrem logischen Charakter. Sie bleiben begriffliche Mittel geschichtlicher und nicht theoretischer Forschung. Die Herausarbeitung der charakteristischen Merkmale eines Geschichtsabschnittes und das Verstehen seiner Sinnzusammenhänge, denen sie dienen, sind unbestrittenermaßen Aufgaben der Geschichtswissenschaft. Der Ausdruck Wirtschaftsstil ist der Sprache und dem Begriffsapparat der Kunstgeschichte nachgebildet. Niemand ist es aber bisher eingefallen, die Kunstgeschichte als theoretische [VIII] Wissenschaft zu bezeichnen, weil sie den geschichtlichen Stoff, mit dem sie sich befaßt, in den Denkgebilden der Kunststile ordnet. Die Unterscheidung der Kunststile beruht übrigens auf rationaler — man könnte sagen: nach naturwissenschaftlicher Methode vorgenommener — Klassifizierung der Kunsterzeugnisse. Der Weg, der zur Scheidung der Kunststile führt, ist zunächst nicht spezifisches geisteswissenschaftliches Verstehen, sondern rationale Erfassung der Objektivationen der Kunst; das Verstehen knüpft erst an die Ergebnisse dieser rational-schemati-sierenden Arbeit an. Zur Unterscheidung von Wirtschaftsstilen fehlen uns diese Voraussetzungen. Das Ergebnis der wirtschaftlichen Tätigkeit ist immer Bedürfnisbefriedigung, die nur subjektiv beurteilt werden kann und nicht in Artefakten zutage tritt, deren Klassifikation in ähnlicher Weise wie die der Kunsterzeugnisse möglich wäre. Es geht nicht an, die Wirtschaftsstile etwa zu scheiden nach den Merkmalen der in den verschiedenen Perioden der Wirtschaftsgeschichte erzeugten Güter, wie man gotischen Stil und Renaissancestil nach den Merkmalen der Bauwerke unterscheidet. Die Versuche, Wirtschaftsstile nach Wirtschaftsgesinnung, Wirtschaftsgeist und ähnlichen Gesichtspunkten zu sondern, vergewaltigen die Tatsachen. Sie sind eben nicht auf objektiv (rational) unterscheidbaren und daher unbestreitbaren Merkmalen aufgebaut, sondern auf dem Verstehen, das von subjektiver Beurteilung der Qualitäten nicht zu trennen ist.
Vollends absurd aber würde es jedermann finden, wollte ein Kunsthistoriker sich anmaßen, aus den von ihm erkannten Stilzusammenhängen der Vergangenheit Stilgesetze abzuleiten für die Kunst der Gegenwart und Zukunft.
Wenn man selbst zugeben wollte, daß es möglich sei, aus dem wirtschaftsgeschichtlichen Stoff auf empirischem Wege Gesetze des Wirtschaftens innerhalb zeitlich, national oder sonstwie begrenzter Geschichtsabschnitte zu gewinnen, so bliebe es doch unzulässig, diese Gesetze als Nationalökonomie zu bezeichnen und zu lehren. So sehr auch die Auffassungen vom Wesen und Inhalt der Nationalökonomie auseinandergehen mögen, darüber herrscht doch Einhelligkeit, daß unter der Bezeichnung Nationalökonomie nur eine Lehre begriffen werden kann, die auch über das künftige Wirtschaften, über die Wirtschaft von morgen und übermorgen, auszusagen weiß. Der Begriff Theorie wurde und wird (in Unterscheidung von dem Begriff Geschichte) immer und allgemein dahin gefaßt, daß Theorie von einer Regelmäßigkeit spricht, die auch für künftiges Geschehen Geltung [IX] beansprucht. Das Interesse der Wißbegierigen wendet sich der Nationalökonomie zu, weil man von ihr auch über die Gesetze künftigen Geschehens Belehrung erwartet. Würden sich die Anhänger der historischen Schule darauf beschränken, der Logik und Erkenntnislehre ihres Programms gemäß, nur von der Wirtschaft der Vergangenheit zu sprechen, und würden sie die Befassung mit allen Fragen der Wirtschaft der Zukunft ablehnen, so könnte man ihnen zumindest den Vorwurf der Inkonsequenz ersparen. Sie behaupten jedoch, Nationalökonomie zu schreiben und vorzutragen, und greifen vom Standpunkte der Wissenschaft in die Erörterungen über Fragen der Wirtschaftspolitik ein, als ob ihre Wissenschaft, wie sie selbst sie auffassen, in der Lage wäre, etwas über die Wirtschaft der Zukunft auszusagen. Hier handelt es sich nicht um jene Probleme, die im Streit um die Zulässigkeit der Werturteile in der Wissenschaft behandelt wurden, sondern um die Frage, ob der Volkswirt der historischen Schule in der Erörterung rein wissenschaftlicher Fragen abseits von jeder Erörterung über die Erwünschtheit der angestrebten letzten Ziele das Wort ergreifen darf, ob er z. B. etwas über die künftigen Wirkungen einer vorgeschlagenen Änderung der Währungsgesetzgebung aussagen darf. Die Kunsthistoriker sprechen von der Kunst und den Kunststilen der Vergangenheit, und kein Maler würde auf ihre Worte achten, wenn sie anfangen wollten, von der Malerei der Zukunft zu sprechen. Doch die Volkswirte der historischen Schule sprechen mehr über die Zukunft als über die Vergangenheit. (Für den Historiker gibt es grundsätzlich nur Vergangenheit und Zukunft; die Gegenwart ist ein flüchtiger Augenblick zwischen den beiden.) Sie sprechen von den Wirkungen von Freihandel und Schutzzoll, von den Folgen der Kartellbildung, sie verkünden uns, daß wir zu Planwirtschaft, zu Autarkie und zu manchem andern kommen müssen. Hat je ein Kunsthistoriker es gewagt, uns zu sagen, zu welchen Kunststilen der Zukunft wir gelangen müssen?
Der folgerichtige Anhänger der historischen Schule müßte sich darauf beschränken, zu sagen: Es gibt zwar einiges Allgemeingültige, das für alle Wirtschaft gilt [3]. Doch das ist so wenig und unerheblich, daß es sich nicht lohnt, dabei zu verweilen. Einer Behandlung wert ist allein das, was man an Merkmalen der sich wandelnden Wirtschaftsstile aus der Wirtschaftsgeschichte festzustellen vermag und die zu [X] den Stilen gehörigen geschichtlichen Theorien. Von ihnen kann die Wissenschaft reden. Von der Wirtschaft im allgemeinen und damit auch von der Wirtschaft von morgen ziemt es ihr zu schweigen. Denn eine »geschichtliche Theorie« der künftigen Wirtschaft kann es nicht geben.
Wenn man die Nationalökonomie in die Reihe der »verstehenden« Geisteswissenschaften einreiht, dann muß man auch so vorgehen, wie diese vorgehen. Man darf dann, wie eine Geschichte des deutschen Schrifttums oder allenfalls eine Geschichte der Weltliteratur geschrieben wird, eine Geschichte der deutschen Wirtschaft oder eine Geschichte aller bisherigen Wirtschaft schreiben, aber doch gewiß nicht Allgemeine Volkswirtschaftslehre. Wenn man »Allgemeine Volkswirtschaftslehre als Universalwirtschaftsgeschichte einer vermeintlichen »Speziellen Volkswirtschaftslehre«, die sich mit den einzelnen Produktionszweigen befassen soll, gegenüberstellt, dann geht dies vom Standpunkte der historischen Schule immerhin noch an. Der Standpunkt der historischen Schule gestattet aber nicht, Volkswirtschaftslehre von der Wirtschaftsgeschichte zu sondern.
Die Untersuchungen dieses Buches erblicken ihre Aufgabe darin, das logische Recht der Wissenschaft darzulegen, die nach allgemeingültigen Gesetzen des menschlichen Handelns strebt, d. h. nach Gesetzen, die Geltung beanspruchen ohne Rücksicht auf Ort, Zeit, Rasse, Volkstum, Klasse der Handelnden, und damit zu zeigen, was die allgemeingültige Wissenschaft vom menschlichen Handeln, die als Soziologie und Nationalökonomie vor uns steht, anstrebt. Nicht das Programm einer neuen Wissenschaft wollen sie entwerfen, sondern feststellen, was die Wissenschaft, die wir kennen, im Auge hat. Sie umschreiben dabei ein Gebiet, das WINDELBAND, RICKERT und MAX WEBER fremd geblieben war, dessen logische Berechtigung sie aber wohl nicht bestritten hätten, wenn sie es gekannt hätten. Verneint wird die Möglichkeit einer empirischrealistischen Theorie, d. h. die Möglichkeit, aus der geschichtlichen Erfahrung empirische Gesetze des geschichtlichen Ablaufes im allgemeinen oder des wirtschaftsgeschichtlichen Ablaufes im besonderen oder »Gesetze« des »wirtschaftlichen Handelns« innerhalb eines bestimmten Geschichtsabschnittes a posteriori abzuleiten.
Es wäre daher durchaus verfehlt, aus dem Ergebnis dieser Untersuchungen eine Ablehnung der Lehren herauslesen zu wollen, die den mit geschichtlicher Methode arbeitenden Geistesoder Kulturwissenschaften die Erfassung des Geschichtlichen, des Besonderen, [XI] des Einmaligen, des Individuellen, des Irrationalen zuweisen, und als ihr besonderes Verfahren das Verstehen und als ihr wichtigstes begriffliches Mittel die Bildung von Idealtypen bezeichnen. Sie wollen das Verfahren, dessen sich die Geistes- und Kulturwissenschaften bedienen, nicht kritisieren. Meine Kritik richtet sich vielmehr nur gegen jene unzulässige Vermengung der Methoden und Unklarheit der logischen Voraussetzungen, die auch unter Preisgabe dessen, was wir den Untersuchungen von WINDELBAND, RICKERT und MAX WEBER verdanken vermeint, es wäre möglich, aus der geschichtlichen Erfahrung a posteriori »theoretische« Erkenntnis zu gewinnen, gegen jene Lehre, die einerseits glaubt, daß man an das historische Material ohne eine Theorie des Handelns überhaupt heranzutreten vermag, und andererseits glaubt, aus dem historischen Material durch Induktion eine empirisch-realistische Theorie des Handelns gewinnen zu können. Der Erkenntniswert der geschichtlichen Forschung und unter diesen Begriff fällt auch alle Art von Wirtschaftsbeschreibung und Wirtschaftsstatistik (auch sie berichten immer nur von Vergangenem, mag es auch Jüngstvergangenes sein; unter der Hand der empirischen Wissenschaft wird die Gegenwart sogleich zur Vergangenheit) liegt nicht darin, daß aus ihr Lehren gewonnen werden können, die man in Lehrsätze fassen könnte. Wer das verkennt, dem sind Sinn und logische Eigenart geschichtlicher und geisteswissenschaftlicher Forschung verschlossen geblieben.
Man würde die Absicht der folgenden Untersuchungen auch durchaus falsch beurteilen, wollte man sie als ein Eingreifen in einen vermeintlichen Kampf der reinen und abstrakten Theorie alle Theorie muß rein und abstrakt sein gegen Geschichte und Erfahrungswissenschaft ansehen. Theorie und Geschichte sind beide gleichberechtigt und gleichunentbehrlich. Der logische Gegensatz, der zwischen ihnen besteht, hat mit Gegnerschaft nichts zu tun. Ziel meiner Untersuchungen ist vielmehr, apriorische Theorie und historische Erfahrungswissenschaft auseinanderzuhalten und die Verkehrtheit jener Bemühungen der historischen und institutionalistischen Richtungen der Staatswissenschaften nachzuweisen, die logisch Unverträgliches zu vereinigen suchen und die unhistorisch sind gerade darum, weil sie aus der Geschichte Nutzanwendungen auf die Gegenwart und auf die Zukunft zu ziehen suchen, mag auch diese Nutzanwendung dem Prinzip nach wenigstens nur in der Ablehnung der Anwendbarkeit der Sätze der allgemeingültigen Theorie auf die Gegenwart und Zukunft bestehen.
[XII]
Das Wesen der historischen Forschung liegt nicht in der Gewinnung von Gesetzen, und ihr Erkenntniswert ist nicht darin zu suchen, daß sie unmittelbar Nutzanwendungen für unser Handeln liefern könnte. Geschichte befaßt sich nur mit dem Vergangenen, kann sich nie der Zukunft zuwenden. Geschichte macht weise, doch nicht tüchtig zur Lösung konkreter Aufgaben. Die pseudohistorische Disziplin, die sich heute den Namen Soziologie beilegt, ist im wesentlichen eine Deutung der geschichtlichen Vorgänge und Verkündung angeblich unausweichlicher künftiger Entwicklung im Sinne der skurrilen marxistischen Fortschrittsmetaphysik, die sich gegen die Kritik durch die wissenschaftliche Soziologie und Nationalökonomie von der einen Seite und durch die Geschichtsforschung von der anderen Seite durch die Berufung darauf zu sichern sucht, daß sie die Dinge »soziologisch« und nicht nationalökonomisch, historisch oder sonstwie in einer der »nichtsoziologischen« Kritik ausgesetzten Weise betrachte. Die pseudohistorischen »wirtschaftlichen Staatswissenschaften« und der Institutionalismus schützen sich gegen die Kritik, die die Nationalökonomie an ihrem interventionistischen Programm übt, durch die Berufung auf die Relativität aller nationalökonomischen Einsicht, die sie aus voraussetzungsloser Befassung mit der Wirtschaftsgeschichte gewonnen zu haben behaupten. Gegen die Logik und das diskursive Denken der Wissenschaft suchen beide das Irrationale auszuspielen.
Um die Berechtigung aller dieser Einwendungen zu prüfen, erschien es mir nicht nur erforderlich, den logischen Charakter der nationalökonomischen und soziologischen Sätze positiv darzulegen, sondern auch unabweislich, die Lehren einiger Vertreter des Historismus, des Empirismus und des Irrationalismus kritisch zu würdigen. Das mußte die äußere Gestalt meiner Arbeit bestimmen. Sie zerfällt in eine Reihe von selbständigen Untersuchungen, die mit Ausnahme der umfangreichsten, der ersten schon früher veröffentlicht wurden [4]. Sie waren jedoch von vornherein als Teile eines Ganzen gedacht und entworfen und sind vor allem die zweite Untersuchung durch Umarbeitung noch fester zu einer Einheit verbunden worden. Ich hielt es dabei für notwendig, in diesem Rahmen einige Grundgedanken der nationalökonomischen Theorie neu darzustellen, um sie von [XIII] Widersprüchen und Beimengungen zu befreien, die ihnen in den bisherigen Darstellungen anzuhaften pflegen, ferner darzulegen, von welchen psychischen Quellen die Widerstände gegen die Anerkennung national-ökonomischer Theorie gespeist werden, und schließlich an einem Beispiel zu zeigen, in welcher Weise die geschichtlichen Faktoren in die Wirtschaft hineinragen und was wohl eine Schule hätte beachten müssen, die in der Zuwendung zum Historischen nicht einen Vorwand zur Ablehnung der ihr aus politischen Gründen nicht genehmen Ergebnisse der Theorie, sondern ein Mittel zur Förderung der Erkenntnis gesucht hätte. Daß bei diesem Verfahren Wiederholungen mitunter nicht zu vermeiden waren, ergab sich aus dem Umstande, daß die Argumente, die gegen die Möglichkeit der allgemeingültigen Theorie in verschiedener Gestalt vorgetragen werden, in letzter Linie immer auf die gleichen Irrtümer zurückführen.
Grundsätzlich wird heute die Allgemeingültigkeit nationalökonomischer Sätze auch von den Vertretern der historischen Schule nicht mehr bestritten; sie haben diesen Grundsatz des Historismus schon preisgeben müssen. Sie beschränken sich darauf, den Umfang der Erscheinungen, die durch solche Sätze erklärt werden könnten, als sehr eng zu bezeichnen, und diese Sätze für so selbstverständlich und banal zu halten, daß sie eine Wissenschaft, die sich mit ihnen zu befassen hätte, für überflüssig ansehen. Auf der anderen Seite behauptet die Schule und darin liegt ihr Empirismus -, daß man aus dem wirtschaftsgeschichtlichen Stoff Wirtschaftsgesetze einzelner Geschichtsabschnitte zu gewinnen vermag. Was an solchen Gesetzen von ihr vorgewiesen wird, entpuppt sich jedoch bei näherer Betrachtung als Charakterisierung einzelner Geschichtsabschnitte und ihres Wirtschaftsstiles, mithin als spezifisches Verstehen von Epochen der Vergangenheit. Nicht ein einziger Satz konnte bis heute aufgestellt werden, der sich logisch den Sätzen der allgemeingültigen Theorie an die Seite stellen ließe. Nie konnte etwa ein Satz vorgewiesen werden, der, dabei von den Gesetzen der allgemeingültigen Theorie inhaltlich verschieden, den Verlauf von Geldwertveränderungen im alten Athen oder im »Frühkapitalismus« des 16. Jahrhunderts uns doch in derselben Weise begrifflich erfassen ließe wie die nach Auffassung der historischen Schule nur auf den Kapitalismus des liberalen Zeitalters zugeschnittenen Gesetze der allgemeingültigen Theorie.
Bei diesem Sachverhalt könnte es nicht zu verstehen sein, warum die Anhänger der historischen Schule es ängstlich vermeiden, sich mit den Lehren der allgemeingültigen Theorie immanent auseinanderzusetzen [XIV] und überhaupt jede Befassung mit ihr hartnäckig ablehnen [5] , und warum sie noch hartnäckiger für ihre geschichtlichen Ausführungen die unzutreffenden Bezeichnungen Nationalökonomie und nationalökonomische Theorie in Anspruch nehmen. Das kann eben nur verstanden werden, wenn man beachtet, daß hier politische und nicht wissenschaftliche Rücksichten den Ausschlag geben, daß es sich darum handelt, die Nationalökonomie zu bekämpfen, weil man ein unhaltbares politisches Programm gegen unliebsame Kritik, die die Ergebnisse der Wissenschaft verwertet, nicht anders zu schützen weiß. Die historisch-empirisch-realistische Schule in Europa und die institutionalistische Schule in Amerika sind die Vorkämpfer jener destruktionistischen Wirtschaftspolitik, die die Welt in den Zustand gebracht hat, in dem sie sich heute befindet, und die zweifellos, wenn sie weiter die Herrschaft behält, die moderne Kultur vernichten wird.
Diese politischen Hintergründe werden in diesem Buch, das die Probleme fern von aller Politik in ihrer grundsätzlichen Bedeutung betrachtet, nicht behandelt. Vielleicht aber ist es in einem Zeitalter, das die Beschäftigung mit Dingen flieht, die nicht gleich auf den ersten Blick als unmittelbar nützlich erscheinen, nicht unangebracht, festzustellen, daß die abstrakten Probleme der Logik und Methodologie in enger Beziehung zum Leben jedes Einzelnen und zum Schicksal unserer ganzen Kultur stehen. Und nicht minder wichtig mag sein, darauf hinzuweisen, daß kein nationalökonomisches oder soziologisches Problem, mag es sich auch oberflächlicher Betrachtung als recht einfach darstellen, zu bewältigen ist, wenn man nicht bis auf die logischen Grundlagen der Wissenschaft vom menschlichen Handeln zurückgeht.
Wien, Januar 1933.
L. Mises.
[1]
Aufgabe und Umfang der allgemeinen Wissenschaft vom menschlichen Handeln.↩
A. Wesen und Entwicklung der Gesellschaftswissenschaft.
1. Die ältesten Keime gesellschaftswissenschaftlicher Erkenntnis finden wir in den Geschichtserzählungen. Eine heute überwundene Erkenntnislehre meinte, der Geschichtsschreiber trete an seinen Gegenstand ohne Theorie heran und stelle einfach dar, wie es gewesen ist. Er habe die vergangene Wirklichkeit abzubilden und zu beschreiben, und dies werde ihm am besten gelingen, wenn er möglichst unvoreingenommen und voraussetzungslos die Geschehnisse und die Quellen, die ihm die Geschehnisse erschließen, betrachtet. Sehr spät erst erkannte man, daß der Geschichtsschreiber kein Abbild und keine Wiederholung der Vergangenheit bieten kann, vielmehr eine Darstellung, das ist Umbildung, gibt, und daß Darstellung und Umbildung vorgefaßte Begriffe verlangen, die der Geschichtsschreiber im Kopfe tragen muß, ehe er an die Arbeit schreitet [6]. Es mag sein, daß er im Laufe seiner Arbeit zu neuen Begriffsbildungen gelangt, zu denen ihn die Beschäftigung mit seinem Stoffe angeregt hat, doch die Begriffe stehen logisch immer vor der Erfassung des Individuellen, des Einzelnen und des Einmaligen. Man kann nicht von Krieg und Frieden sprechen, wenn man nicht schon vor der Zuwendung zu den Quellen einen bestimmten Begriff von Krieg und Frieden hatte. Man kann nicht von Ursachen und von Folgen im Einzelfalle sprechen, wenn man nicht über eine Theorie verfügt, die bestimmte Verknüpfungen von Ursache und Wirkung als allgemeingültig hinstellt. Daß der Satz »der König besiegte die Rebellen und behielt daher die Herrschaft« von uns hingenommen wird, wogegen der Satz »der König besiegte die Rebellen und verlor daher die Herrschaft« als widerspruchsvoll logisch nicht befriedigt, liegt darin, daß jener unseren Theorien von den Wirkungen militärischer Siege entspricht, dieser aber ihnen widerspricht. Geschichtsschreibung setzt immer ein bestimmtes Maß [2] von allgemeingültiger Erkenntnis des menschlichen Handelns voraus. Die Erkenntnisse, die das geistige Rüstzeug des Geschichtsschreibers bilden, mögen mitunter oberflächlicher Betrachtung banal scheinen. Wer sie genauer betrachtet, wird in ihnen öfter den notwendigen Ausfluß eines das gesamte menschliche Handeln und gesellschaftliche Geschehen umfassenden Gedankenbaus erkennen. Wird z. B. ein Ausdruck wie »Landhunger«, »Landmangel« oder dergleichen verwendet, so ist damit eine Theorie entwickelt, die, folgerichtig zu Ende gedacht, zum Gesetz vom abnehmenden Ertrag oder, noch allgemeiner ausgedrückt, zum Ertragsgesetz führt. Denn würde das Ertragsgesetz nicht gelten, dann würde der Landwirt, der höheren Reinertrag herauswirtschaften will, nicht mehr Land benötigen; er könnte durch erhöhten Aufwand von Arbeit und sachlichen Produktionsmitteln auch auf dem kleinsten Acker den Erfolg erzielen, den er durch Vergrößerung der verfügbaren Fläche erreichen will. Die Größe der ihm zur Verfügung stehenden Anbaufläche wäre ihm dann gleichgültig.
Allgemeingültige Aussagen über menschliches Handeln finden wir jedoch nicht nur in der Geschichte und in den übrigen Wissenschaften, die mit den Denkmitteln der geschichtlichen Forschung arbeiten. Auch in den Normwissenschaften Ethik und Rechtsphilosophie und in der systematischen Rechtswissenschaft sind nicht wenige Begriffe und Begriffsverknüpfungen aus solcher Erkenntnis heraus gebildet. Rechts- und Staatsphilosophie und die Wissenschaft Politik setzen sich die Findung allgemeingültiger Erkenntnis des Gesellschaftlichen zur eigentlichen Aufgabe. Daß sie dabei nicht selten zu anderen Zielen abirrten und wie die Philosophie der Geschichte nicht das Allgemeingültige im Wechsel der einzelnen Erscheinungen suchten, sondern nach dem objektiven Sinn der Dinge zu forschen begannen, trug nicht allein daran schuld, daß sie nicht die allgemeine Wissenschaft vom menschlichen Handeln zeugten. Entscheidend war, daß sie sich schon von vornherein einer wissenschaftlich unfruchtbaren Methode bedienten; sie gingen nicht vom Einzelnen und von seinem Handeln aus, sondern vom Versuche, das Ganze als Ganzheit zu schauen; sie wollten den Weg der Menschheit von ihrem Ursprung bis zum Ende aller Dinge erkennen und nicht das Walten der Gesetzlichkeit im Handeln des Menschen.
Die Psychologie fand den geeigneten Ausgangspunkt der Forschung, indem sie sich dem Einzelnen zuwendete. Doch ihr Weg führt notwendigerweise in andere Richtung als der der Wissenschaft [3]vom Handeln. Gegenstand der Wissenschaft vom menschlichen Handeln sind das Handeln und das, was aus dem Handeln wird; Gegenstand der Psychologie sind die innermenschlichen Vorgänge, deren Ergebnis das Handeln ist. Der Grenzstein, der die Stelle bezeichnet, wo die Arbeit der Psychologie ihr Ende findet, bezeichnet zugleich die Stelle, an der die Arbeit der Gesellschaftslehre erst ansetzt.
2. Zur Wissenschaft wurden die verstreuten gesellschaftswissenschaftlichen Erkenntnisse erst durch die Ausbildung der Nationalökonomie, die ein Werk des 18. Jahrhunderts ist. Man entdeckt die gesetzmäßige Verbundenheit der Markterscheinungen und baut damit die Katallaktik auf, die Lehre vom Tauschverkehr, die das Kernstück der nationalökonomischen Theorie bildet, und man entwickelt die Lehre von der Arbeitsteilung und erfaßt durch das RICARDOsche Vergesellschaftungsgesetz Wesen und Sinn der Arbeitsteilung und damit der Gesellschaftsbildung.
Die Ausbildung der Nationalökonomie und der rationalistischen Gesellschaftslehre von CANTILLON und HUME bis BENTHAM und RICARDO hat das menschliche Denken stärker umgestaltet als irgendeine andere wissenschaftliche Lehre vorher oder nachher. Man hatte bis dahin geglaubt, daß dem handelnden Menschen andere Schranken als die durch die Naturgesetze gezogenen nicht im Wege stünden. Daß es noch anderes gibt, was der Macht eine Grenze setzt, die sie nicht überschreiten kann, war unbekannt. Man erfuhr nun, daß auch im Gesellschaftlichen etwas wirksam ist, das Macht und Gewalt nicht beugen können und dem sie sich, wenn sie Erfolg haben wollen, geradeso fügen müssen wie den Naturgesetzen.
Unermeßlich war die Tragweite dieser Einsicht für das Handeln der Menschen. Sie schuf den Liberalismus als Lehre und die liberale Wirtschaftspolitik und entfesselte damit die menschlichen Kräfte, die im Kapitalismus Werke setzten, die die Welt umgestalteten. Doch gerade die praktische Bedeutung der Lehren der neuen Wissenschaft wurde ihr zum Verhängnis. Wer die liberale Wirtschaftspolitik bekämpfen wollte, mußte sie angreifen und ihr den Charakter als Wissenschaft streitig machen. Aus politischen Gründen erwuchsen ihr Feinde.
Der Geschichtsschreiber darf keinen Augenblick vergessen, daß das wichtigste und folgenschwerste Ereignis der Geschichte der letzten hundert Jahre, die Bekämpfung der allgemeingültigen Wissenschaft vom menschlichen Handeln und ihres bisher am besten ausgebauten Teiles, der nationalökonomischen Theorie, von Anfang [4] an von politischem Wollen und nicht von wissenschaftlichen Ideen getragen war. Doch die Wissenschaft vom menschlichen Handeln selbst hat sich nicht um diese politischen Hintergründe zu kümmern, sondern um die Argumente, die man ihr entgegengehalten hat. Denn man hat ihr auch Argumente entgegengehalten, man hat sie auch sachlich und mit Gründen bekämpft. Ihr Wesen bleibt problematisch, solange es nicht gelungen ist, Klarheit über die Frage zu gewinnen, was diese Wissenschaft eigentlich sei und welchen Charakter ihre Sätze tragen.
3. Neben den Leistungen, die den Grundstein einer Wissenschaft vom menschlichen Handeln gelegt haben, gingen hochtrabende programmatische Erklärungen her, die eine Wissenschaft vom Gesellschaftlichen forderten. HUME, SMITH, RICARDO, BENTHAM und manche andere fanden Sätze, in denen wir den geschichtlichen Ausgangspunkt und das Fundament gesellschaftswissenschaftlicher Erkenntnisse zu erblicken haben. Die Bezeichnung »Soziologie« aber prägte AUGUSTE COMTE, der sonst die Gesellschaftswissenschaft keineswegs bereicherte. Eine große Zahl von Schriftstellern forderte mit ihm und nach ihm eine Wissenschaft vom Gesellschaftlichen; die meisten von ihnen sahen nicht, was für eine solche Wissenschaft schon getan worden war, und wußten auch nicht anzugeben, wie man zu einer Wissenschaft dieses Charakters gelangen könnte. Viele verloren sich in Tändelei, als deren abschreckendstes Beispiel die organizistische Schwärmerei gelten darf. Andere brauten vorgebliche Wissenschaft, um ihre politischen Pläne zu rechtfertigen. Andere wieder, z. B. COMTE selbst, bereicherten die Philosophie der Geschichte um neue Konstruktionen und nannten das Soziologie.
Die Verkünder einer neuen Epoche der Wissenschaft, die vorgaben, eine neue Wissenschaft vom Gesellschaftlichen zu schaffen, versagten aber nicht nur auf diesem Gebiete, das sie für das eigentliche Feld ihrer Tätigkeit erklärt hatten. Sie gingen unbedenklich darauf aus, die Geschichtsforschung und alle mit der geschichtlichen Methode arbeitenden Wissenschaften zu zerschlagen. In der Vorstellung befangen, alle echte Wissenschaft sei im Grunde genommen Naturwissenschaft von der Art der NEWTONschen Mechanik, forderte man von der Geschichte, daß sie endlich daran gehen möge, durch die Aufstellung von »historischen Gesetzen« sich zum Range einer exakten Wissenschaft zu erheben.
WINDELBAND, RICKERT und ihre Schule haben diese Ansprüche des Naturalismus zurückgewiesen und die Eigenund [5] Sonderart der geschichtlichen Forschung dargelegt. Ihre Ausführungen leiden jedoch darunter, daß sie die Möglichkeit allgemeingültiger Erkenntnis auf dem Gebiete des menschlichen Handelns nicht erkannt haben. Für sie gibt es im Gesellschaftlichen nur Geschichte und geschichtliche Methode [7]. Die Ergebnisse der nationalökonomischen und gesellschaftswissenschaftlichen Forschung sahen sie nur durch die Brille der historischen Schule; so mußten sie dem Historismus verhaftet bleiben. Sie haben dabei nicht bemerkt, daß mit dem Historismus eine dem von ihnen erkenntnistheoretisch bekämpften Empirismus auf dem Gebiete der Wissenschaften vom menschlichen Handeln entsprechende Geisteshaltung vielfach Hand in Hand ging.
4. Für den Historismus gibt es auf dem Gebiete der Wissenschaft vom menschlichen Handeln nur Geschichtsforschung und historische Methode. Es sei ein vergebliches Bemühen, meint er, nach allgemeingültigen Sätzen zu suchen, d. h. nach Sätzen, die unabhängig von Zeit, Ort, Rasse, Volk und Kulturgestaltung gelten sollen. Alles, was die Soziologie und die Nationalökonomie bringen könnten, sei Erfahrung eines Geschichtlichen, das durch neue Erfahrung widerlegt werden kann. Was gestern gewesen sei, könne morgen anders sein. Alle gesellschaftswissenschaftliche Erkenntnis sei aus Erfahrung gewonnen, sei Verallgemeinerung von Erfahrungen, die durch neue Erfahrungen erschüttert werden kann. Die allein dem Charakter der Gesellschaftswissenschaft angemessene Methode sei daher die »geisteswissenschaftliche«, deren Werkzeug das Verstehen, d. i. das spezifische geisteswissenschaftliche Verstehen, sei. Es gebe keine Erkenntnis, deren Geltung über eine bestimmte Epoche der Geschichte oder bestenfalls über mehrere Geschichtsepochen hinausreicht.
Man kann diese Auffassung gar nicht folgerichtig bis zum Ende durchdenken. Wenn man es versucht, muß man früher oder später an einen Punkt gelangen, an dem man sich genötigt sieht, einzugestehen, daß es irgendetwas in unserer Erkenntnis dieser Dinge gibt, das vor der Erfahrung liegt und dessen Geltung von Ort und Zeit unabhängig ist. Selbst SOMBART, der heute den Standpunkt der »verstehenden« Nationalökonomie am schroffsten vertritt, muß zugeben, daß es auch »im Bereich der Kultur, insonderheit der menschlichen Gesellschaft, so etwas wie sinnotwendige Beziehungen« gebe. »Sie machen«, meint er, »das aus, was wir die Sinngesetzmäßigkeit nennen, und die a priori aus dem Sinn abgeleiteten Sätze nennen wir deren Gesetze« [8]. Damit [6] hat SOMBART, freilich ohne es zu wollen und ohne es zu bemerken, alles zugestanden, was zur Begründung der Notwendigkeit einer allgemeingültigen Wissenschaft vom menschlichen Handeln, die von den historischen Wissenschaften vom menschlichen Handeln grundsätzlich verschieden ist, erfordert wird. Wenn es solche Sätze und Gesetze überhaupt gibt, dann muß es auch eine Wissenschaft von ihnen geben und diese Wissenschaft muß logisch jeder anderen Befassung mit diesen Problemen voranstehen. Es geht nicht an, diese Sätze einfach so hinzunehmen, wie sie in der nichtwissenschaftlichen Auffassung des täglichen Lebens dastehen. Es ist absurd, dem wissenschaftlichen Denken das Eindringen in einen Bezirk verbieten zu wollen und Duldung für überkommene Irrtümer und unscharfes widerspruchvolles Denken zu fordern. SOMBART weiß denn auch nichts anderes zur Stützung seiner Verwerfung der Befassung mit der allgemeingültigen nationalökonomischen Theorie vorzubringen als ein paar spöttische Bemerkungen. Es sei, meint er, »zuweilen sehr lustig anzusehen, wie hinter einer großen Aufmachung ein silbernes Nichtschen oder ein goldenes Warteweilchen sich verborgen hat, das nun in seiner mitleiderregenden Kümmerlichkeit uns vor die Augen tritt und fast unseren Spott erregt« [9]. Das ist wohl ein sehr unzureichender Versuch, das Verfahren, das SOMBART und die anderen Anhänger des Historismus mit ihren Arbeiten befolgen, zu rechtfertigen. Wenn es, wie SOMBART ausdrücklich zugesteht, »allgemeinökonomische Hauptbegriffe . . . die für alle Wirtschaft gelten«, gibt [10] , dann darf es der Wissenschaft nicht verwehrt werden, sich mit ihnen zu befassen.
SOMBART gibt noch mehr zu. »Alle Theorie«, sagt er ausdrücklich, »ist ‚rein’, nämlich raum- und zeitlos« [11] , und tritt damit der Auffassung von KNIES entgegen, der den »Absolutismus der Theorie« bekämpfte, d. i. ihren »Anspruch, Unbedingtes, für alle Zeiten, Länder und Nationalitäten in gleicher Weise Gültiges in der wissenschaftlichen Verarbeitung der politischen Ökonomie darzubieten« [12].
Vielleicht wird man einwenden, es sei ein Einrennen offener [7] Türen, wenn man nachdrücklich darauf hinweist, daß es einen Bestand an allgemeingültiger nationalökonomischer Erkenntnis gibt. Leider hätte ein derartiger Vorwurf keine Berechtigung; die Türen sind recht fest verriegelt. Wer den Versuch unternommen hat, die Lehren des Historismus geschlossen darzustellen, hat wohl in der Regel die Unmöglichkeit, die Auffassung des Historismus systematisch auszubauen, an irgendeiner Stelle seines Lehrgebäudes erkennen lassen müssen. Doch die Bedeutung des Historismus liegt nicht in den durchaus mißglückten Versuchen, ihn als geschlossene Lehre vorzutragen. Er ist seinem Wesen nach nicht System, sondern Ablehnung und grundsätzliche Verneinung der Möglichkeit, ein System zu bilden. Er lebt und wirkt nicht im Gesamtaufbau eines Gedankengefüges, sondern in kritischen Aperçus, in den Begründungen wirtschafts- und sozialpolitischer Programme und zwischen den Zeilen geschichtlicher, beschreibender und statistischer Darstellungen. Die Politik und die Wissenschaft der letzten Jahrzehnte standen durchaus unter der Herrschaft der Anschauungen des Historismus und des Empirismus. Wenn man sich erinnert, daß ein Schriftsteller, der zu Lebzeiten in deutschen Landen als Theoretiker der »wirtschaftlichen Staatswissenschaften« in höchstem Ansehen stand, das wirtschaftliche Prinzip als ein Spezifikum der geldwirtschaftlichen Produktion erklärt hat [13] , so wird man wohl zugeben müssen, daß es nicht überflüssig ist, die Unhaltbarkeit des Historismus nachdrücklich zu betonen, bevor man daran schreitet, den logischen Charakter der Wissenschaft vom menschlichen Handeln darzulegen.
5. Unbestritten ist, daß es eine apriorische Theorie des menschlichen Handelns geben muß und gibt, und unbestritten ist es, daß das menschliche Handeln Gegenstand geschichtlicher Darstellung sein kann. Der Einspruch der folgerichtigen Vertreter des Historismus, die die Möglichkeit absoluter, d. i. raum- und zeitloser Theorie nicht zugeben wollen, hat uns nicht mehr zu stören als die Behauptung des Naturalismus, der der Geschichte den Wissenschaftscharakter bestreiten will, solange sie nicht zur Aufstellung historischer Gesetze gelangt ist.
Der Naturalismus meint, es könnten empirische Gesetze aus der Betrachtung des historischen Materials a posteriori gewonnen werden. Dabei wird bald angenommen, daß diese Gesetze raum- und zeitlos gelten, bald, daß sie nur für bestimmte Epochen, Länder, Rassen und [8] Völker Geltung hätten [14]. Die weitaus überwiegende Mehrzahl aller Geschichtsforscher lehnt beide Spielarten dieser Auffassung ab. Auch diejenigen Geschichtsforscher lehnen sie meist ab, die auf dem Boden des Historismus stehen und nicht zugeben wollen, daß der Historiker ohne Hilfe der apriorischen Lehre vom menschlichen Handeln seinem Stoffe ganz hilflos gegenüberstünde und keine seiner Aufgaben lösen könnte; die Anhänger des Historismus unter den Historikern meinen in der Regel, überhaupt ganz theoriefrei arbeiten zu können. Ob der Historismus notwendig zu der einen oder zu der anderen Auffassung hinführen muß, möge hier nicht weiter untersucht werden; wer der Meinung ist, daß der Standpunkt des Historismus folgerichtig nicht zu Ende gedacht werden kann, der wird die Durchführung einer solchen Untersuchung überhaupt für aussichtslos halten. Wichtig ist nur die Feststellung, daß zwischen der Auffassung der Anhänger der historischen Schule der Staatswissenschaften und der der Mehrzahl der Geschichtsforscher ein scharfer Gegensatz insofern besteht, als diese nicht zugeben wollen, daß aus dem historischen Material empirische Gesetze gewonnen werden könnten, wogegen jene glauben, solche Gesetze finden zu können und der Zusammenstellung dieser Gesetze die Bezeichnungen Soziologie und Nationalökonomie beilegen wollen. Wir wollen den Standpunkt derer, die die Möglichkeit, empirische Gesetze aus dem geschichtlichen Stoff zu gewinnen, bejahen, Empirismus nennen. Historismus und Empirismus decken sich somit nicht. Die Geschichtsforscher bekennen sich, wenn sie zum Problem überhaupt Stellung nehmen, meist, doch durchaus nicht immer, zum Historismus; sie sind mit seltenen Ausnahmen (z. B. BUCKLE) Gegner des Empirismus. Die Anhänger der historischen und der institutionalistischen Schule der Staatswissenschaften stehen auf dem Boden des Historismus, wenn sie auch diesen Standpunkt, sobald sie anfangen, ihn logisch und erkenntnistheoretisch begründet vortragen zu wollen, nicht rein festzuhalten vermögen; sie stehen nahezu immer auf dem Boden des Empirismus. Zwischen den Historikern und den Volkswirten und Soziologen der historischen Schule klafft mithin meist ein scharfer Gegensatz der Auffassung.
Die Frage, die uns nun zu beschäftigen hat, ist nicht mehr die, ob im menschlichen Handeln das Walten einer Gesetzlichkeit erkannt werden kann, vielmehr die, ob als Weg, der uns zur Erkenntnis solcher Gesetzlichkeit zu führen vermag, eine Beobachtung von Tatsachen, [9] die keinen Bezug auf ein System apriorischer Erkenntnis des menschlichen Handelns nimmt, in Betracht kommen kann. Kann, wie SCHMOLLER [15] meint, Wirtschaftsgeschichte »Bausteine« zu einer nationalökonomischen Theorie liefern, können »Ergebnisse der wirtschaftsgeschichtlichen Spezialschilderung zu Elementen der Theorie werden, zu allgemeinen Wahrheiten führen«? Wir wollen dabei der schon oft erschöpfend erörterten Frage nach der Möglichkeit allgemeiner (also nicht »wirtschaftlicher«) »historischer Gesetze« ausweichen [16] und uns darauf beschränken, zu prüfen, ob wir zu Aussagen der Art, wie sie das System der nationalökonomischen Theorie sucht, durch Beobachtung der Tatsachen, also a posteriori hätten gelangen können.
Der Weg, der den Naturforscher zur Erkenntnis der Gesetze des Geschehens führt, beginnt mit der Beobachtung. Der entscheidende Schritt wird aber erst durch die Setzung einer Hypothese vollzogen; ein Satz wird aufgestellt mit dem Anspruch allgemeiner Geltung. Dieser Satz stammt nicht einfach aus Beobachtung und Erfahrung, denn diese bieten uns immer nur komplexe Erscheinungen dar, in denen verschiedene Faktoren so eng verbunden auftreten, daß nicht zu erkennen ist, was jedem einzelnen Faktor zuzuschreiben ist. Die Hypothese ist schon geistige Verarbeitung der Erfahrung, und sie ist es vor allem in ihrer entscheidenden Eigenschaft als allgemeiner Satz. Die Erfahrung, die zur Bildung des Satzes geführt hat, ist immer beschränkte Erfahrung, ist vor allem immer Erfahrung eines Vergangenen und Gewesenen, eines dort und damals Geschehenen. Die Allgemeingültigkeit, die für ihn in Anspruch genommen wird, bedeutet aber gerade auch Geltung für alles übrige vergangene und für alles künftige Geschehen. Er beruht auf unvollständiger Induktion. (Aus vollständiger Induktion gehen keine allgemeinen Sätze hervor, vielmehr nur Beschreibungen eines Abgeschlossenen und Vergangenen.)
Die Hypothesen haben sich immer wieder von neuem in der Erfahrung zu bewähren. Man vermag sie in der Regel im Versuch einem besonderen Prüfungsverfahren zu unterziehen. Man schließt die verschiedenen Hypothesen zu einem System zusammen, leitet aus den einzelnen Hypothesen alles das ab, was logisch aus ihnen folgen muß, und stellt immer wieder Versuche an, um das Gedachte zu verifizieren. Man prüft, ob neues Geschehen den Erwartungen [10] entspricht, zu denen die Hypothesen berechtigen. Zwei Voraussetzungen werden für diese Prüfungsweisen erfordert: die Möglichkeit, die Bedingungen zu isolieren, die das Experiment bietet, und das Bestehen von experimentell auffindbaren konstanten Verhältnissen, die die zahlenmäßige Bestimmung der Größen gestatten. Wenn wir einen Satz der Erfahrungswissenschaft (mit dem Grade von Gewißheit oder Wahrscheinlichkeit, dessen ein empirisch gewonnener Satz überhaupt fähig ist,) wahr nennen wollen, wenn Veränderung der relevanten Bedingungen in allen beobachteten Fällen zu dem erwartungsgemäßen Erfolg führt, dann besitzen wir die Mittel zur Prüfung der Wahrheit dieser Sätze.
Der geschichtlichen Erfahrung gegenüber befinden wir uns in anderer Lage. Hier fehlt uns nicht nur die Möglichkeit, die einzelnen Determinanten einer Veränderung im Versuch isoliert zu beobachten, sondern auch die Möglichkeit, zahlenmäßig Konstante zu bestimmen. Auch das geschichtliche Werden können wir nur als Ergebnis des Zusammenwirkens einer unendlichen Menge von Einzelursachen, die wir ihrer Tragweite nach nicht zu scheiden vermögen, beobachten und erfahren. Nirgends finden wir feste zahlenmäßig erfaßbare Beziehungen; die lange gehegte Annahme, daß die Beziehungen der Geldmenge zu den Preisen in einer Gleichung als proportionale Beziehung beschrieben werden könnten, hat sich als irrig erwiesen, womit die einzige Stütze der Lehre von der Quantifizierbarkeit der Erkenntnis menschlichen Handelns zusammengestürzt ist. Wer Gesetze des menschlichen Verhaltens aus der Erfahrung schöpfen will, müßte dazu gelangen, festzustellen, wie gegebene Situationen auf das Handeln qualitativ und quantitativ einwirken. Solche Feststellungen pflegt die Psychologie zu suchen, und alle jene, die der Soziologie und der Nationalökonomie diese Aufgabe zuweisen, pflegen ihnen daher das psychologische Verfahren zu empfehlen. Dabei verstehen sie unter psychologischem Verfahren nicht etwa das, was man am Vorgehen der österreichischen Schule in wenig zweckmäßigem, ja irreführendem Sprachgebrauch als psychologisch bezeichnet hat, vielmehr die Anwendung der Methoden und der Ergebnisse der wissenschaftlichen Psychologie selbst. Nun hat aber die Psychologie auf diesem Gebiete versagt. Wohl vermag sie, dabei mit den Methoden der Physiologie arbeitend, in der Art der biologischen Naturwissenschaft die unbewußte Reaktion auf Reize zu beobachten. Darüber hinaus kann sie nichts leisten, was zur Aufstellung empirischer Gesetze führen könnte. Sie kann feststellen, wie sich bestimmte Menschen in bestimmten [11] Lagen in der Vergangenheit benommen haben, und sie folgert daraus, daß es sich ähnlich auch in der Zukunft verhalten werde, wenn ähnliche Menschen vor ähnliche Situationen gestellt sein werden. Sie kann uns berichten, wie sich englische Schulknaben in den letzten Jahrzehnten benommen haben, wenn sie einer bestimmten Situation gegenüberstanden, z. B. wenn sie einem bettelnden Krüppel begegneten. Solche Feststellung besagt sehr wenig für das Verhalten englischer Schulkinder in den kommenden Jahrzehnten und für das Verhalten französischer oder deutscher Schulkinder. Sie kann nichts weiter feststellen als ein Historisches: die beobachteten Fälle haben das und jenes ergeben, wobei schon der Schluß aus den beobachteten Fällen, die englische Schulkinder einer bestimmten Epoche betrafen, auf andere nichtbeobachtete Fälle desselben historisch-ethnologischen Charakters logisch nicht gerechtfertigt erscheint. Was uns die Beobachtung lehrt, ist allein das, daß dieselbe Situation auf verschiedene Menschen verschieden wirkt. Da es nicht gelungen ist, die Menschen in Klassen einzuordnen, deren Angehörige in derselben Weise reagieren, da auch dieselben Menschen zu verschiedenen Zeiten verschieden reagieren, ohne daß man den verschiedenen Lebensaltern oder anderen objektiv unterscheidbaren Lebensabschnitten und Lebenslagen bestimmte Reaktionsarten eindeutig zuzuordnen vermochte, ist es aussichtslos, auf diesem Wege zur Erkenntnis einer Regelmäßigkeit der Erscheinungen zu gelangen. Das ist der Tatbestand, den man im Auge hat, wenn man von der Willensfreiheit, von der Irrationalität des Menschlichen, Geistigen und Geschichtlichen, vom Individuellen in der Geschichte, von der Unmöglichkeit, das Leben in seiner Fülle und Mannigfaltigkeit rational zu begreifen, spricht. Man bringt denselben Tatbestand zum Ausdruck, wenn man darauf hinweist, daß es uns nicht gegeben ist, zu erfassen, wie die Einwirkung der Außenwelt unseren Geist, unseren Willen und damit unser Handeln beeinflußt. Daraus folgt, daß die Psychologie, soweit sie sich mit diesen Tatbeständen befaßt, Geschichte, oder, wie man es in der Sprache der gegenwärtigen deutschen Wissenschaftslehre ausdrückt, Geisteswissenschaft ist.
Wer das geisteswissenschaftliche Verstehen als die der Nationalökonomie entsprechende Methode erklärt, sollte sich vor allem darüber klar werden, daß das »Verstehen« niemals zur Aufstellung empirischer Gesetze führen kann. Das »Verstehen« ist gerade das Verfahren, das die Geschichtswissenschaft (im weitesten Sinne des Ausdrucks) gegenüber dem Individuellen und Einmaligen, dem [12] schlechthin Geschichtlichen, befolgt; das Verstehen ist das Feststellen eines Irrationalen, das wir nicht in Regeln zu fassen und dadurch zu erklären vermögen [17]. Das gilt nicht nur für das Gebiet, das man herkömmlicherweise als das des Allgemeingeschichtlichen zu bezeichnen pflegt, sondern gerade so auch für alle Sondergebiete, vor allem auch für das Gebiet des Wirtschaftsgeschichtlichen. Der Standpunkt, den die empiristische Richtung der deutschen Staatswissenschaft im Kampfe gegen die nationalökonomische Theorie eingenommen hat, ist auch vom Standpunkt der Logik der Geschichtswissenschaft, wie sie DILTHEY, WINDELBAND, RICKERT und MAX WEBER ausgebildet haben, nicht zu halten.
Für die Bildung von erfahrungswissenschaftlichen Sätzen a posteriori ist überall dort, wo die Erfahrung uns nur komplexe Erscheinungen zeigt, in denen die Wirkung verschiedener Ursachen zusammenfließt, der die Bedingungen einer Veränderung isolierende Versuch nicht zu entbehren. Die geschichtliche Erfahrung bietet unserer Beobachtung stets nur komplexe Erscheinungen, und das Experiment ist ihnen gegenüber unanwendbar. An seine Stelle, meint man bisweilen, könne das Gedankenexperiment treten. Doch das Gedankenexperiment hat logisch ganz andere Bedeutung als das eigentliche Experiment. Es ist das Durchdenken eines Satzes im Hinblick auf seine Verträglichkeit mit anderen, für wahr gehaltenen Sätzen. Wenn diese anderen Sätze nicht aus der Erfahrung stammen, wird auch durch das Gedankenexperiment keine Beziehung zur Erfahrung hergestellt.
6. Die Wissenschaft vom menschlichen Handeln, die nach allgemeingültiger Erkenntnis strebt, steht vor uns als System der Gesellschaftslehre; in ihr ist das bisher am feinsten ausgearbeitete Stück die Nationalökonomie. Diese Wissenschaft ist in allen ihren Teilen nicht empirische, sondern apriorische Wissenschaft; sie stammt wie Logik und Mathematik nicht aus der Erfahrung, sie geht ihr voran. Sie ist gewissermaßen die Logik des Handelns und der Tat [18].
Das menschliche Denken dient dem menschlichen Leben und Wirken, dem Handeln und der Tat. Es ist nicht absolutes Denken, sondern Vorbedenken der Taten und Nachbedenken des Geschehenen. In letzter Linie sind Logik und allgemeine Wissenschaft vom Handeln daher eins. Wenn wir sie sondern, um der Logik die Praktik gegenüberzustellen, [13] so haben wir zu zeigen, wo ihre Wege sich trennen, und wo das besondere Gebiet der Wissenschaft vom Handeln liegt.
Eine der Aufgaben, die das Denken zu bewältigen hat, um seinen Dienst zu erfüllen, ist die Erfassung der Bedingungen, unter denen das menschliche Handeln steht. Das ist im Einzelnen das Werk der Naturwissenschaft und in gewissem Sinne auch der Geschichte und der übrigen historischen Wissenschaften. Die Erfassung des Allgemeinen, die vom Besonderen absieht und formalaxiomatisch nur das Prinzipielle ins Auge faßt, ist die Aufgabe, die unserer Wissenschaft obliegt. Sie betrachtet das Handeln und die Bedingungen, unter denen gehandelt wird, nicht in ihrer konkreten Gestalt, die uns das Leben täglich entgegenbringt, und nicht nach ihrem Sachzusammenhang, wie wir sie in den Einzelwissenschaften von der Natur und der Geschichte betrachten, sondern als formale Gebilde, die uns die Figuren menschlichen Handelns rein erkennen lassen.
Die einzelnen Bedingungen in ihrer konkreten Gestalt kann uns nur die Erfahrung kennenlernen lassen. Daß es Löwen und daß es Mikroben gibt und daß deren Sein den handelnden Menschen unter Umständen vor bestimmte Aufgaben stellen kann, vermag nur die Erfahrung zu lehren, und es wäre sinnlos, ohne Erfahrung über Sein oder Nichtsein irgendwelcher Fabelwesen Erwägungen anzustellen. Als seiend wird die Außenwelt uns durch die Erfahrung gegeben, und nur die Erfahrung kann uns lehren, wie wir uns ihr gegenüber in konkreten Lagen verhalten müssen, wenn wir bestimmte Absichten verfolgen.
Nicht aus der Erfahrung, sondern aus der Vernunft stammt aber das her, was wir über unser Verhalten den gegebenen Bedingungen gegenüber wissen. Nicht aus der Erfahrung stammt, was wir über die Grundkategorien des Handelns wissen, über Handeln, Wirtschaften, Vorziehen, über die Beziehung von Mittel und Zweck, und über alles andere, das mit diesem zusammen das System menschlichen Handelns ausmacht. Das alles erkennen wir wie die logischen und mathematischen Wahrheiten aus uns heraus, a priori und ohne Bezug auf irgendwelche Erfahrung. Und nie könnte Erfahrung jemand, der dies nicht aus sich heraus begreift, zur Erkenntnis dieser Dinge bringen.
Als apriorische Kategorie ist das Prinzip des Handelns dem der Kausalität ebenbürtig. Es steht vor aller Erkenntnis irgendeines Verhaltens, das über unbewußte Reaktion hinausgeht. »Im Anfang war die Tat.« Der Begriff des Menschen ist uns vor allem auch Begriff des handelnden Wesens. Unser Bewußtsein ist das eines handlungsfähigen [14] und handelnden Ich; die Intentionalität macht unsere Erlebnisse zu Handlungen. Unser Denken über Menschen und ihr Verhalten, unser Verhalten zu Menschen und zu der uns umgebenden Welt überhaupt setzen die Kategorie Handeln voraus.
Wir vermögen jedoch diese Grundkategorie und das aus ihr gebildete System gar nicht zu denken, ohne allgemeine Bedingungen des menschlichen Handelns mitzudenken. Wir können z. B. den Begriff des Wirtschaftens und der Wirtschaft nicht erfassen, ohne den Begriff wirtschaftliches Mengenverhältnis und den Begriff wirtschaftliches Gut mitzudenken. Ob diesen Begriffen in den gegebenen Bedingungen, unter denen wir zu leben und zu wirken berufen sind, tatsächlich etwas entspricht, kann nur die Erfahrung lehren. Nur die Erfahrung sagt uns, daß nicht alle Dinge der Außenwelt freie Güter sind. Doch was ein freies und was ein wirtschaftliches Gut ist, sagt uns nicht die Erfahrung, sondern das Denken, das vor der Erfahrung liegt.
Es wäre mithin möglich, eine allgemeine Praktik in axiomatischer Methode in solcher Allgemeinheit aufzustellen, daß ihr System nicht nur alle Figuren des Handelns in der uns gegebenen Welt umschließen würde, sondern auch Figuren des Handelns in Welten, deren Bedingungen wir nur hypothetisch setzen, ohne daß dieser Setzung irgendwelche Erfahrung entsprechen würde. Eine Geldlehre wäre auch dann sinnvoll, wenn in der Geschichte stets nur unmittelbarer Tausch aufgetreten wäre. Daß sie in einer geldlosen Welt praktisch keine Bedeutung hätte, würde an der Wahrheit ihrer Aussagen nichts ändern. Daß wir Wissenschaft für das Leben treiben auch der Wunsch nach reiner Erkenntnis an sich ist ein Stück Leben und nicht als Gedankenspiel, führt dazu, daß wir im allgemeinen leichten Herzens auf die Genugtuung verzichten, die uns ein vollständiges, geschlossenes System der Axiomatik menschlichen Handelns, das so allgemein gefaßt wäre, daß es alle denkbaren Kategorien von Bedingungen des Handelns umschließen würde, bieten könnte, und uns mit dem begnügen, was sich auf die Bedingungen bezieht, die in der Welt der Erfahrung gegeben sind. Doch diese Art der Bezugnahme auf die Erfahrung hebt den apriorischen Charakter unserer Erkenntnis nicht auf. Die Erfahrung gibt dabei unserer Denkarbeit nichts, was sie selbst betreffen würde. Alles, was die Erfahrung leistet, ist die Abgrenzung jener Probleme, die wir mit Interesse ins Auge fassen, von Problemen, die wir, weil für unseren Wissensdrang uninteressant, abseits liegen lassen wollen. Diese Erfahrung bezieht sich daher auch gar nicht immer [15] auf Sein oder Nichtsein von Bedingungen des Handelns, sondern vielfach auf das Vorhandensein eines Interesses für die Behandlung eines Problems. Ein sozialistisches Gemeinwesen gibt es in der Erfahrung nicht; dennoch ist die Untersuchung der Wirtschaft eines solchen Gemeinwesens ein Problem, das in unserer Zeit höchstes Interesse erweckt.
Es wäre denkbar, eine Theorie des Handelns unter der Voraussetzung zu bilden, daß den Menschen die Möglichkeit, sich durch Zeichen wechselseitig zu verständigen, fehlt, oder unter der Voraussetzung, daß die Menschen unsterblich und ewig jung in jeder Beziehung dem Zeitablauf gegenüber indifferent sind und daher den Zeitablauf in ihrem Handeln nicht beachten. Es wäre denkbar, die Theorie axiomatisch so allgemein zu fassen, daß sie auch diese und alle übrigen Möglichkeiten in sich schließt, und es wäre denkbar, ein formal-praxeologisches System, das sich etwa die Logistik oder die Axiomatik der HILBERTschen Geometrie zum Vorbild nimmt, zu entwerfen [19] Wir verzichten darauf, weil uns die Bedingungen, die nicht dem entsprechen, was unserem Handeln gegeben ist, nur soweit interessieren, als ihr Durchdenken im Gedankenexperiment unsere Erkenntnis des Handelns unter den gegebenen Bedingungen zu fördern vermag.
Besonders deutlich ist das Verfahren, das wir in der Entwicklung und Darstellung unserer Probleme einschlagen, an der Behandlung des Zurechnungsproblems zu erkennen. Es wäre denkbar, eine Theorie der Bewertung und Preisgestaltung der Produktionsfaktoren (Güter höherer Güterordnungen, Produktivgüter) in höchster Allgemeinheit vorzutragen, so daß wir zunächst nur mit einem Begriff Produktionsmittel ohne nähere Bestimmung arbeiten und die Theorie so ausgestalten, daß die in der üblichen Darstellung aufgezählten drei Produktionsfaktoren nur als Spezialfälle erscheinen. Wir gehen anders vor. Wir halten uns nicht dabei auf, vom Produktionsmittel an sich eine allgemeine Zurechnungstheorie zu geben, sondern gehen gleich zur Behandlung von drei Kategorien von Produktionsmitteln: Arbeit, Boden und Kapital über. Dieser Vorgang ist durchaus gerechtfertigt durch die Aufgabe unserer Forschung, die wir nie aus dem Auge verlieren dürfen. Der Verzicht auf axiomatische Allgemeinheit und Bestimmtheit birgt aber auch manche Gefahren, und es ist nicht [16] immer gelungen, sie zu vermeiden. Man hat nicht nur in der marxistischen Klassentheorie [20] den kategorialen Charakter der Zusammenfassung der einer jeden der drei Gruppen zugewiesenen konkreten Produktionsfaktoren mißverstanden. Man hat zwar die Besonderheit des Produktionsfaktors Boden in der Verschiedenheit der Brauchbarkeit der einzelnen Grundstücke für die Zwecke des Handelns gesehen; die Grundrentenlehre hat niemals vergessen, daß der Boden der Beschaffenheit und der Lage nach verschieden bewertet wird. Doch die Lohntheorie hat übersehen, daß auch die Arbeit von verschiedener Qualität und Intensität ist und daß auf dem Markte nie »Arbeit«, vielmehr nur Arbeit bestimmter Art angeboten und gesucht wird. Als sie es schon bemerkt hatte, suchte sie den Folgen dieser Feststellung dadurch auszuweichen, daß sie annahm, Hauptnachfrage und Hauptangebot bezögen sich auf ungelernte (unqualifizierte) Arbeit, und es sei zulässig, die der Menge nach unbeträchtliche anders geartete »höhere« Arbeit zu vernachlässigen. Viele Irrwege wären der Lohntheorie erspart geblieben, wenn sie nie außer acht gelassen hätte, sich darauf zu besinnen, welche Aufgabe der Sonderbehandlung der Arbeit in der Verteilungslehre zukommt, und wo es notwendig wird, nicht mehr von Arbeit schlechthin zu sprechen, sondern von Arbeit bestimmter Qualität, die zu gegebener Zeit an gegebenem Ort angeboten oder gesucht wird. Noch schwerer fiel es der Kapitalstheorie, sich von der Vorstellung abstrakten Kapitals dort freizumachen, wo nicht mehr die kategoriale Verschiedenheit von Boden, Arbeit und Kapital in Frage steht, vielmehr die Bewertung bestimmter, an bestimmtem Ort zu bestimmter Zeit angebotener oder gesuchter Kapitalgüter ins Auge zu fassen ist. Es war eben auch in der Verteilungsund Zurechnungslehre nicht leicht, sich von der Herrschaft der universalistischen Auffassung zu befreien [21].
Unsere Wissenschaft befaßt sich mit den Formen und Figuren des Handelns unter den verschiedenen Kategorien der Bedingungen dieses Handelns. Indem wir dies feststellen, entwerfen wir nicht etwa das Programm einer künftigen Wissenschaft. Wir sagen nicht, daß die Wissenschaft vom menschlichen Handeln zu einer apriorischen Wissenschaft gemacht werden soll, sondern daß sie eine apriorische Wissenschaft ist. Wir wollen nicht etwa eine neue Methode finden, [17] sondern nur das tatsächlich gehandhabte Verfahren zutreffend charakterisieren. Die nationalökonomischen Sätze wurden nicht aus der Beobachtung der Tatsachen gewonnen, sondern durch Ableitung aus der Grundkategorie des Handelns, die man bald als Prinzip der Wirtschaftlichkeit, bald als Wertprinzip oder als Kostenprinzip gefaßt hat. Sie sind apriorischer Herkunft und nehmen daher die apodiktische Gewißheit in Anspruch, die so gewonnenen Grundsätzen zukommt.
7. Die allgemeingültige Wissenschaft vom menschlichen Handeln steht vor uns in der Gesellschaftslehre und vor allem in der Nationalökonomie. Was für diese Wissenschaft bisher geleistet wurde, wird im herkömmlichen Sinne entweder zur Gesellschaftslehre oder zur Nationalökonomie gerechnet.
Namen sind konventionelle Bezeichnungen, die keineswegs, wie es eine immerhin weitverbreitete Auffassung fordert, das Wesen des Bezeichneten unmittelbar d. h. ohne Bezugnahme auf eine bestehende Übung auszudrücken vermögen. Es muß daher zwecklos erscheinen, die Brauchbarkeit der Ausdrücke Nationalökonomie (Sozialökonomik) und Soziologie (Gesellschaftslehre) zur Bezeichnung der allgemeingültigen Wissenschaft vom menschlichen Handeln zu prüfen. Sie sind geschichtlich überkommen und haben die Wissenschaft auf ihrem Wege bis zur Ausbildung geschlossener Systeme begleitet. So erklärt es sich, daß sie der Wortbildung nach an den geschichtlichen Ausgangspunkt der Forschung und nicht an den logischen Ansatzpunkt der ausgebildeten Lehre oder an den Kern der Lehre selbst anknüpfen. Man hat das leider nicht immer beachtet und hat immer wieder versucht, Umfang und Aufgabe der Wissenschaft aus den Bezeichnungen zu erfassen und zu bestimmen. Grob begriffsrealistisch wurde der Gesellschaftslehre als Gegenstand die Befassung mit der Gesellschaft, der Nationalökonomie die Befassung mit der Wirtschaft oder mit der wirtschaftlichen Seite der Kultur zugewiesen. Und nun gab man sich alle Mühe, um festzustellen, was denn Gesellschaft und Wirtschaft eigentlich wären.
Wenn wir heute die Behauptung, der Gegenstand unserer Wissenschaft sei das menschliche Handeln, vertreten dürfen, ohne befürchten zu müssen, damit mehr Anstoß zu erregen, als jede wissenschaftliche Lehre findet, so ist dies das Ergebnis der Arbeit einiger Forschergenerationen. Die Untersuchungen so ganz verschieden gearteter Männer wie CAIRNES, BAGEHOT, MENGER, MAX WEBER und ROBBINS weisen doch das Gemeinsame auf, daß sie nach diesem Ziele gerichtet sind. Daß die Behauptung, unsere [18] Wissenschaft sei apriorisch und nicht empirisch, mehr Widerspruch erwecken mag, weil für sie durch das bisherige Schrifttum der Boden wenig vorbereitet wurde, kann man wissenschaftsgeschichtlich wohl verstehen. Die zweihundert Jahre, in denen sich die Entwicklung unserer Wissenschaft vollzogen hat, waren der Anerkennung eines neuen Bereiches apriorischer Wissenschaft nicht günstig. Die Erfolge der empirischen Naturwissenschaft und der quellenerforschenden historischen Wissenschaften zogen in solchem Maße die Aufmerksamkeit auf sich, daß man darob die Fortschritte, die die apriorischen Wissenschaften gleichzeitig machten, nicht beachtete, obwohl ohne sie ein Fortschreiten der Empirie nicht möglich gewesen wäre. Eine Zeit, die selbst der Logik den apriorischen Charakter absprechen wollte, war für die Erkenntnis des apriorischen Charakters der Praktik gewiß nicht vorbereitet.
Daß ungeachtet des Vorwaltens einer anderen Ausdrucksweise und einer anderen Beurteilung des logischen Charakters der Nationalökonomie und ihrer Stellung im Kreise der Wissenschaften die Auffassung der Nationalökonomie als apriorischer Wissenschaft der Sache nach sowohl den auf dem Boden der klassischen Schule stehenden Nationalökonomen als auch den Begründern der subjektivistischen Wertlehre nicht allzu fern lag, mag ein Blick auf die Lehren von SENIOR, JOHN STUART MILL, CAIRNES und WIESER zeigen. Man darf jedoch dabei nicht außer acht lassen, daß angesichts der tiefgehenden Wandlung, die in der Auffassung der logischen und methodologischen Grundfragen und demgemäß auch in der Ausdrucksweise des ihrer Behandlung gewidmeten Schrifttums seither eingetreten ist, allzu weitgehende Schlüsse aus solchen Äußerungen nicht gezogen werden dürfen.
Für SENIOR steht fest, daß die Wissenschaft der Ökonomik »depends more on reasoning than on observation« [22]. Über die Methode des Nationalökonomen meint er: »His premises consist of a very few general propositions, the result of observation, or consciousness, and scarcely requiring proof, or even formal statement, which almost every man, as soon as he hears them, admits, as familiar to his thoughts, or at least as included in his previous knowledge« [23]. Hier werden Beobachtung äußerer Tatsachen und Selbstbesinnung als die Quellen der Erkenntnis bezeichnet. Von diesen Sätzen, die aus dem Innern des Menschen stammen, wird aber gesagt, daß sie entweder [19] unmittelbar evident sind oder daß sie sich aus solchen unmittelbar evidenten Sätzen durch analytische Urteile ergeben; sie sind mithin apriorischer Herkunft und nicht aus der Erfahrung gewonnen, es sei denn, man wollte apriorische Einsicht als innere Erfahrung bezeichnen.
JOHN STUART MILL kennt nur Erfahrungswissenschaft und lehnt grundsätzlich ab »a supposed mode of philosophizing, which does not profess to be founded upon experience at all«. Er unterscheidet zwei Methoden des wissenschaftlichen Denkens, die Methode a posteriori »which requires, as the basis of its conclusions, not experience merely, but specific experience«, und die Methode a priori, worunter er »reasoning from an assumed hypothesis« versteht. Von der Methode a priori wird dabei gesagt, sie sei »not a practice confined to mathematics, but is of the essence of all science which admits of general reasoning at alle. Die politische Ökonomie sei zu charakterisieren »as essentially an abstract science, and its method as the method a priori« [24].
Es würde uns von unserem Gegenstande weit abführen, wollten wir im einzelnen das ausführen und kritisch prüfen, was uns heute von MILLs Auffassung des a priori und von seiner Auffassung der Nationalökonomie trennt. Für MILL waren auch die Axiome »nur eine Klasse, allerdings die umfassendste Klasse, von Induktionen aus der Erfahrung«; auch Logik und Mathematik waren in seinen Augen Erfahrungswissenschaften [25]. So wie die Geometrie »presupposes an arbitrary definition of a line: that which has length but not breadth«, so »does Political Economy presuppose an arbitrary definition of man, as a being who invariably does that by which he may obtain the greatest amount of necessaries, conveniences and luxuries, with the smallest quantity of labour and physical self-denial with which they can be obtained in the existing state of knowledge« [26]. Für uns ist hier allein das von Bedeutung, daß MILL Logik, Mathematik und »moral sciences« in eine Reihe stellt als Wissenschaften, für die jener Weg, den er als »the method a priori« bezeichnet, angemessen sei. Für die »moral sciences« sei dieser Weg »the only method«, da Unmöglichkeit des Experiments den Weg der »method a posteriori« [20] ausschließe [27].
Auch der Gegensatz von induktiver und deduktiver Methode, wie ihn CAIRNES entsprechend dem Sprachgebrauch und der Problematik der durchaus unter dem Einflusse des Empirismus und Psychologismus stehenden zeitgenössischen Philosophie sieht, entspricht nicht dem Gegensatz von Empirismus und Apriorismus, wie wir ihn sehen. Wenn CAIRNES daran geht, die Frage zu beantworten, ob die Nationalökonomie nach deduktiver Methode oder wie allgemein angenommen werde nach induktiver Methode zu betreiben sei, und schließlich dazu gelangt, der deduktiven Methode entscheidende Bedeutung für die nationalökonomische Forschung beizumessen, bedient er sich einer Ausdrucksweise, die von der modernen Logik und Erkenntnistheorie soweit abliegt, daß es einer breitangelegten Untersuchung bedürfte, um den Sinn seiner Worte in die Sprache zu übersetzen, die dem modernen Leser geläufig ist. Doch sein Gedankengang selbst steht, wenn auch in andere Worte gekleidet, unserer Auffassung näher, als man auf den ersten Blick hin anzunehmen bereit wäre. CAIRNES weist darauf hin, daß die Stellung des Naturforschers und die des Nationalökonomen dem Gegenstande der Forschung gegenüber durchaus verschieden sei. Der Naturforscher habe keinen anderen Weg vor sich als den der induktiven wir würden sagen: empirischen Forschung, denn »mankind have no direct knowledge of ultimate physical principles« [28]. Anders der Nationalökonom. »The Economist starts with a knowledge of ultimate causes« [29]. Wir verfügen eben über »direct knowledge . . . of causes in our consciousness of what passes in our own minds, and in the information which our senses convey, or at least are capable of conveying, to us of external facts« [30]. So sei der Nationalökonom »at the outset of his researches . . . already in possession of those ultimate principles governing the phenomena which form the subject of his study« [31].
Noch deutlicher als bei CAIRNES sieht man es bei WIESER, wie er der Auffassung, die Nationalökonomie sei eine apriorische Wissenschaft, zustrebt und diesen Endpunkt seines Gedankenganges nur darum nicht erreicht, weil die herrschenden erkenntnistheoretischen [21] Lehren im Wege stehen [32].Die Aufgabe der Wirtschaftstheorie besteht nach WIESER darin, »den Inhalt der gemeinen wirtschaftlichen Erfahrung wissenschaftlich auszuschöpfen und zu deuten«. Das Bewußtsein der wirtschaftenden Menschen biete ihr »einen Schatz von Erfahrungen, die jedermann besitzt, der praktische Wirtschaft treibt, und die daher auch jeder Theoretiker in sich bereit findet, ohne daß er sie erst mit besonderen wissenschaftlichen Hilfsmitteln zusammenzubringen hätte. Es sind Erfahrungen über äußere Tatsachen, wie z. B. über das Dasein der Güter und ihrer Ordnungen, es sind Erfahrungen über innere Tatsachen, wie z. B. über die menschliche Bedürftigkeit und ihre Gesetze, es sind Erfahrungen über den Ursprung und über den Ablauf des wirtschaftlichen Handelns der Masse der Menschen«. Der Umfang der Wirtschaftstheorie reicht »genau so weit, wie die gemeine Erfahrung. Die Aufgabe des Theoretikers endet immer dort, wo die gemeine Erfahrung endigt und wo die Wissenschaft ihre Beobachtungen im Wege der historischen oder statistischen Arbeit oder auf irgendeinem anderen sonst für zulässig erachteten Wege sammeln muß« [33]. Es ist klar, daß die »gemeine Erfahrung« WIESERs, die der übrigen Erfahrung gegenübergestellt wird, nicht jene Erfahrung ist, mit der die Erfahrungswissenschaft es zu tun hat. Die Methode, die WIESER selbst die psychologische nennt, aber gleichzeitig auch scharf von der Psychologie unterscheidet, beobachtet, meint er, »vom Innern des Bewußtseins aus«, wohingegen der Naturforscher, also die Erfahrungswissenschaft, die Tatsachen »nur von außen« beobachte. Den Grundfehler der SCHUMPETERschen Methode erblickt WIESER gerade darin, daß SCHUMPETER glaubt, dieses naturwissenschaftliche Verfahren sei auch in der nationalökonomischen Theorie am Platze. Die Nationalökonomie, meint WIESER, findet, »daß gewisse Akte im Bewußtsein mit dem Gefühle der Notwendigkeit vollzogen werden«; warum »sollte sie sich erst bemühen, durch lange Induktionsreihen ein Gesetz festzustellen, während jeder in sich selbst die Stimme des Gesetzes deutlich vernimmt«? [34]
[22]
WIESERs »gemeine Erfahrung«, die scharf von der »durch Beobachtungen im Wege der historischen oder statistischen Arbeit« erworbenen Erfahrung zu unterscheiden ist, ist nicht Erfahrung im Sinne der Erfahrungswissenschaft, sondern gerade das Gegenteil davon, ist das, was der Erfahrung logisch vorangeht und Bedingung und Voraussetzung jeder Erfahrung ist. Wenn WIESER die Wirtschaftstheorie von der geschichtlichen, beschreibenden und statistischen Bearbeitung wirtschaftlicher Probleme in der Weise abzugrenzen sucht, daß er jener das Gebiet der gemeinen Erfahrung zuweist, lenkt er in eine Bahn ein, auf der man folgerichtig weiterschreitend zur Anerkennung des apriorischen Charakters der Wirtschaftstheorie gelangen muß. Daß WIESER selbst diese Folgerung nicht zu ziehen dachte, kann freilich nicht auffallen. Er hat sich von dem Einflusse der psychologistischen Wissenschaftslehre MILLs, die auch den Denkgesetzen empirischen Charakter beigemessen hat, nicht freizumachen gewußt [35].
B. Umfang und Bedeutung des Systems der apriorischen Sätze.
1. Der Ausgangspunkt unseres Denkens ist nicht die Wirtschaft, sondern das Wirtschaften, d. i. das Handeln oder, wie man pleonastisch zu sagen pflegt, das rationale Handeln. Menschliches Handeln ist bewußtes Verhalten des Menschen, das wir begrifflich scharf und genau von dem unbewußten Verhalten zu unterscheiden vermögen, mag es vielleicht auch in einzelnen Fällen nicht immer leicht festzustellen sein, ob ein bestimmtes Verhalten der einen oder der anderen Kategorie zuzuweisen sei.
Den Begriff des Handelns erfassen wir als denkende und handelnde Menschen. Indem wir diesen Begriff erfassen, erfassen wir zugleich die Begriffspaare Weg und Ziel, Mittel und Zweck, Ursache und Wirkung, Anfang und Ende und damit auch die Begriffe Wert, Gut, Tausch, Preis, Kosten. Sie alle sind notwendigerweise mitgedacht im Begriffe des Handelns und mit ihnen die Begriffe Werten, [23] Rangordnung und Wichtigkeit, Knappheit und Überfluß, Vorteil und Nachteil, Erfolg, Gewinn und Verlust. Die logische Entfaltung aller dieser Begriffe und Kategorien in systematischer Ableitung aus der Grundkategorie »Handeln« und die Aufweisung der zwischen ihnen bestehenden notwendigen Beziehungen bilden die erste Aufgabe unserer Wissenschaft; das Lehrstück, das ihr dient, ist die elementare Wert- und Preislehre. Über den apriorischen Charakter dieser Untersuchungen kann ein Zweifel überhaupt nicht aufkommen.
Allgemeinste Bedingung des Handelns ist ein Zustand des Unzufriedenseins auf der einen Seite und die Möglichkeit einer Behebung oder Milderung dieser Unzufriedenheit durch das Handeln auf der anderen Seite. (Zu dem in letzter Linie unserem Denken doch nicht erreichbaren Begriff eines vollkommenen Wesens gehört wohl das vollkommene Zufriedensein und damit auch die Abwesenheit jedes Antriebs zur Veränderung und zum Handeln; ein vollkommenes Wesen würde nicht handeln.) Nur diese allgemeinste Bedingung ist im Begriff des Handelns notwendigerweise mitgesetzt. Die übrigen kategorialen Bedingungen des Handelns sind von dem allgemeinen Begriff des Handelns unabhängig; sie sind dem konkreten Handeln nicht notwendig als Bedingung gesetzt. Ob sie im Einzelfalle gegeben sind oder nicht, kann nur durch die Erfahrung gezeigt werden. Doch wo sie gegeben sind, steht das Handeln notwendig unter bestimmten Gesetzen, die aus der kategorialen Bestimmtheit dieser weiteren Bedingungen fließen.
Daß der Mensch altert und stirbt, daß er daher dem Zeitablauf gegenüber sich nicht neutral verhalten kann, ist Erfahrungstatsache. Der Umstand, daß alle bisherige Erfahrung uns nur alternde und sterbliche Menschen gezeigt hat, daß wir nicht das geringste Anzeichen dafür haben, daß einmal eine andere Erfahrung gemacht werden könnte, und daß kaum eine andere Erfahrung uns in höherem Maße auf das Zugrundeliegen eines ehernen Naturgesetzes hinzudeuten scheint, ändert nichts an ihrem empirischen Charakter. Daß der Zeitablauf eine der Bedingungen ist, unter denen das Handeln sich vollzieht, ist daher empirische und nicht apriorische Feststellung. Wir können ein Handeln nicht alternder und unsterblicher Wesen widerspruchsfrei denken. Doch soweit wir das Handeln von dem Zeitablauf gegenüber nicht indifferenten Menschen, also von Menschen, die mit der Zeit haushalten, weil es für sie von Bedeutung ist, ob sie früher oder später einen angestrebten Zustand erreichen, in Betracht ziehen, haben wir notwendig all das diesem Handeln zuzuschreiben, was sich notwendig [24] aus der kategorialen Bedingung »Zeit« ergibt. Wir können den Schlußfolgerungen, die sich aus der Einführung der Kategorie Zeit ergeben, nicht mehr dadurch ausweichen, daß wir uns auf den empirischen Charakter der Feststellung, daß der Zeitablauf Bedingung des gegebenen Handelns ist, berufen. Empirischen Charakter hat nur diese Feststellung selbst; was aus der Einführung des Zeitmomentes notwendig folgt, z. B. das, wovon die Agiotheorie des Kapitalzinses handelt, liegt jenseits des Bereiches der Empirie.
Ob der Tausch von wirtschaftlichen Gütern (im weitesten Sinne des Begriffs, der auch die Dienstleistungen einschließt) sich in unmittelbarem oder in dem durch ein Tauschmittel vermittelten Tausche abspielt, ist nur empirisch festzustellen. Wo aber, und soweit Tauschmittel verwendet werden, muß all das wirken, was dem vermittelten Tausche wesensnotwendig ist. All das, was die Quantitätstheorie, die Lehre vom Verhältnis von Geldmenge und Zins, die Umlaufsmitteltheorie und die Zirkulationskredittheorie des Konjunkturwechsels lehren, ist dann dem Handeln unentrinnbar. Alle diese Aussagen wären auch dann sinnvoll, wenn es nie vermittelten Tausch gegeben hätte; nur ihre praktische Bedeutung für unser Handeln und für die das Sein erklärende Wissenschaft wäre dann anders zu beurteilen. Die heuristische Bedeutung der Erfahrung für die Analytik des Handelns ist nicht zu verkennen. Vielleicht wären wir, wenn es nie vermittelten Tausch gegeben hätte, auch nicht dazu gelangt, ihn als mögliche Figur des Handelns zu erfassen und in alle Verästelungen hinein zu verfolgen. Doch das ändert nichts an dem apriorischen Charakter der Ableitung unserer Sätze.
Diese Überlegungen ermöglichen es uns, die Stichhaltigkeit der Auffassung zu prüfen, die alle oder doch die meisten Sätze der nationalökonomischen Theorie als Aussagen über das, was nur in einem begrenzten Geschichtsabschnitt gegolten hätte, ansehen, und daher an Stelle oder zumindest neben die allgemeingültige Theorie eine solche von Sätzen, deren Geltung geschichtlich und national begrenzt ist, treten lassen will. Alle Sätze, die unsere allgemeingültige Theorie aufzustellen weiß, gelten insoweit und insofern, als die von ihnen vorausgesetzten und genau umschriebenen Bedingungen gegeben sind. Wo diese Bedingungen gegeben sind, gelten diese Sätze ausnahmslos. Das bedeutet, daß diejenigen Sätze, die das Handeln an sich betreffen, d. h. also nur den Tatbestand eines Unbefriedigtseins auf der einen Seite und auf der anderen Seite die erkannte Möglichkeit, durch bewußtes Verhalten diesem Unbefriedigtsein abzuhelfen, [25] zur Voraussetzung haben, für alles menschliche Handeln ausnahmslos Geltung haben, und daß mithin die elementaren Wertgesetze ausnahmslos für alles menschliche Handeln gelten. Wo ein isolierter Mensch handelt, verläuft sein Handeln so, wie die Wertgesetze es fassen. Wo auch Güter höherer Ordnungen in das Handeln einbezogen werden, gelten alle Gesetze der Zurechnungslehre. Wo interpersoneller Tausch auftritt, gelten alle Preisgesetze. Wo indirekter Tausch Platz greift, gelten alle Gesetze der Geldtheorie. Wo Umlaufsmittel geschaffen werden, gelten alle Gesetze der Umlaufsmitteltheorie (Banktheorie). Es wäre unzweckmäßig, diesen Tatbestand in der Weise auszudrücken, daß man etwa sagt, die Sätze der Geldlehre haben nur für jene Geschichtsperioden Geltung, in denen indirekter Tausch vorkommt.
So aber ist auch die Lehre jener, die die geschichtliche Gebundenheit der Theorie verfechten, gar nicht gemeint. Was sie zunächst behaupten, ist gerade das, daß sie den von der allgemeingültigen Theorie gebildeten Sätzen die Gültigkeit für Geschichtsperioden absprechen wollen, in denen die von der Theorie vorausgesetzten Bedingungen gegeben sind, daß sie z. B. behaupten, daß die Preisgesetze einer bestimmten Epoche andere gewesen wären als die Preisgesetze einer anderen geschichtlichen Epoche. Sie erklären z. B., daß die Sätze der Preistheorie, wie sie die Nationalökonomie der subjektivistischen Schule entwickelt, nur für eine freie Wirtschaft gelten, daß sie aber nicht mehr Geltung hätten im Zeitalter der gebundenen Wirtschaft, der Kartelle und der staatlichen Eingriffe. Doch die Preistheorie entwickelt die Sätze der Preisbildung für den Fall des Konkurrenzpreises und für den Fall des Monopolpreises und zeigt, daß jeder Preis entweder Konkurrenzpreis oder Monopolpreis sein muß und daß es eine dritte Art von Preisen nicht gibt. Soweit Preise in der gebundenen Wirtschaft Monopolpreise sind, folgt die Bildung dieser Monopolpreise den Gesetzen des Monopolpreises. Beschränkte und behinderte Konkurrenz, die nicht zur Monopolpreisbildung führt, stellt der Theorie keine besondere Aufgabe. Die Bildung des Konkurrenzpreises ist grundsätzlich von dem Umfang der Konkurrenz unabhängig. Der größere oder geringere Umfang der Konkurrenz im einzelnen Fall ist ein Datum, das die die Bedingungen kategorial, doch nicht konkret erfassende Theorie daher nicht zu berücksichtigen hat, sie beeinflußt im einzelnen Fall die Preishöhe, doch nicht das Wesen und die Art der Preisbildung.
Es ist der historischen Schule nicht gelungen, den Beweis für [26] ihre Behauptung zu erbringen, daß die von der allgemeingültigen Theorie entwickelten Sätze nicht für alles menschliche Handeln unabhängig von Ort, Zeit, Rasse, Volk gelten. Um das zu beweisen, hätte sie beweisen müssen, daß die logische Struktur des menschlichen Denkens und die kategoriale Natur des menschlichen Handelns sich im Geschichtsverlauf wandeln und für die einzelnen Völker, Rassen, Klassen usw. verschieden wären. Das konnte von ihr nie bewiesen werden; wohl aber hat die Philosophie das Gegenteil erwiesen [36]. Die historische Schule hat auch nie einen Satz vorweisen können, für den sie den Anspruch hätte erheben können, daß man ihn als ein nationalökonomisches Gesetz mit zeitlich, örtlich, national oder ähnlich begrenzter Gültigkeit anzusehen habe. Sie hätte zu einem solchen Satz weder a priori noch a posteriori gelangen können. Wenn Denken und Handeln wirklich kategorial gebunden sind an Ort, Zeit, Rasse, Volkstum, Klima, Klasse usw., dann ist einem Deutschen des 20. Jahrhunderts wohl nicht gegeben, aus der Logik und Praktik eines Hellenen des perikleischen Zeitalters heraus einen Satz zu finden. Warum a posteriori die Findung von empirischen Gesetzen des Handelns nicht möglich ist, wurde schon gesagt [37]. Alles, was die »geschichtliche Theorie« vorzubringen wußte, war Geschichte, zwar meist recht schlechte Geschichte, doch dem logischen Charakter nach doch Geschichte und keineswegs Theorie.
2. Neue Erfahrung kann uns nötigen, Auffassungen, die wir aus älterer Erfahrung gewonnen haben, umzumodeln oder aufzugeben. Niemals aber kann irgendwelche Erfahrung uns veranlassen, apriorische Sätze aufzugeben oder umzugestalten. Sie stammen nicht aus der Erfahrung, sie sind logisch vor der Erfahrung und können durch bestätigende Erfahrung nicht gerechtfertigt und durch widerstreitende Erfahrung nicht erschüttert werden. Wir können das Handeln nur durch sie begreifen. Nichts ist verkehrter als die Auffassung des Empirismus, der meint, die Aussagen der Theorie wären durch Induktion aus theoriefreier Beobachtung der Tatsachen gewonnen. Wir können an die Tatsachen gar nicht anders heran als mit dem Werkzeug der Theorie. Auch der naive Mensch, der vom wissenschaftlichen Denken himmelweit entfernt ist, der glaubt, nichts als »Praktiker« zu sein und den »Theoretiker« gründlich verachtet, hat eine bestimmte theoretische Auffassung von dem, was er tut. Ohne diese »Theorie« könnte er über sein Handeln überhaupt nicht sprechen, [27] könnte er darüber nicht nachdenken, könnte er auch nicht handeln. Das wissenschaftliche Denken unterscheidet sich von dem täglichen Denken jedermanns nur dadurch, daß es weiterzugehen sucht und daß es nur an einem Punkte haltmachen will, über den hinaus man überhaupt nicht mehr zu denken vermag. Die wissenschaftlichen Theorien unterscheiden sich von denen jedermanns nur dadurch, daß sie danach streben, auf einer Grundlage zu bauen, die das Denken nicht zu erschüttern vermag. Wenn man sich im Leben im allgemeinen damit begnügt, überkommene Auffassungen ohne Bedenken beizubehalten, Vorurteile und Mißverständnisse aller Art mitzuschleppen und Trugschlüsse und Irrtümer gelten zu lassen, wo es nicht leicht fällt, sie zu meiden, streben die wissenschaftlichen Theorien nach Einheit und Geschlossenheit, nach Klarheit, Schärfe, apodiktischer Evidenz und Widerspruchslosigkeit.
Schon in den Wörtern, die wir handelnd gebrauchen, und in noch höherem Maße in den Wörtern, die wir verwenden, um über unser Handeln zu sprechen, stecken Theorien über das Handeln. Die oft beklagte Schwierigkeit, die der wissenschaftlichen Erkenntnis durch die Unbestimmtheit der Sprachbegriffe erwächst [38] , wurzelt gerade darin, daß diese Begriffe schon der Ausfluß bestimmter Theorien sind, nämlich der im allgemeinen Bewußtsein lebenden Auffassungen. Daß der Historismus glauben konnte, man könne Tatsachen theoriefrei erfassen, erklärt sich daraus, daß er nicht bemerkt hat, daß bereits in den Sprachbegriffen, mit denen jedes Denken arbeiten muß, Theorie enthalten ist. Wer mit der Sprache und mit ihren Wörtern und Begriffen an die Dinge herantritt, bringt damit schon Theorie mit. Auch der angeblich theoriefrei arbeitende Empiriker bedient sich eines theoretischen Rüstzeugs. Sein geistiges Werkzeug unterscheidet sich von dem durch die wissenschaftliche Theorie geschaffenen nur dadurch, daß es weniger vollkommen und daher auch weniger brauchbar ist.
Eine Aussage apriorischer Theorie kann daher niemals durch die Erfahrung widerlegt werden. Das menschliche Handeln bietet sich der Erfahrung stets nur als komplexe Erscheinung dar, die erst durch die Theorie zergliedert und dadurch schon gedeutet werden muß, ehe sie zu eben dieser Theorie in eine Beziehung gesetzt werden kann, aus der Bestätigung oder Widerspruch herausgelesen werden könnte. Daher der ärgerliche Zustand, daß die Anhänger widerstreitender [28] Lehren sich auf dasselbe Erfahrungsmaterial zur Bestätigung der Richtigkeit ihrer Auffassungen zu berufen pflegen. Die Behauptung, daß sich mit Statistik alles beweisen lasse, ist der volkstümliche Ausdruck dieser Wahrheit. Kein noch so unsinniges politisches oder wirtschaftspolitisches Abenteuer kann in den Augen seiner Befürworter die zugrundeliegende Lehre widerlegen; wer a priori von der Richtigkeit seiner Auffassung überzeugt ist, weiß sich immer darauf zu berufen, daß irgendwelche seiner Theorie nach für das Gelingen wesentliche Bedingungen nicht mitgesetzt worden wären. In den Erfahrungen des zweiten deutschen Kaiserreiches will jede der politischen Parteien des deutschen Volkes die Bestätigung der Richtigkeit ihrer Theorie finden; aus der Erfahrung des russischen Bolschewismus ziehen Anhänger und Gegner des Sozialismus entgegengesetzte Schlüsse. Das Entscheidende an der Auseinandersetzung über die Beweiskraft konkreter geschichtlicher Erfahrung ist immer die Erörterung der dabei verwendeten Sätze der allgemeingültigen apriorischen Theorie abseits von aller Erfahrung. Jeder Streit um Lehren, die man aus der Geschichte ziehen soll, wird notwendig zu einem logisch von aller Geschichte abgetrennten Streit um reine Theorie. Daß in grundsätzlichen Auseinandersetzungen über Fragen des Handelns nichts »Schädlicheres und eines Philosophen Unwürdigeres gefunden werden« kann »als die pöbelhafte Berufung auf vorgeblich widerstreitende Erfahrung«, sollte man doch endlich ausnahmslos zugeben und nicht wie KANT [39] und ihm folgend die Sozialisten aller Richtungen nur dann, wenn die Berufung auf widerstreitende Erfahrung gegen den Sozialismus erfolgt.
Der komplexe Charakter der geschichtlichen Erfahrung bringt es mit sich, daß die Unzulänglichkeit einer unrichtigen Theorie sich nicht zwingender aufdrängt, wenn man sie den Tatsachen gegenüberhält, als wenn man sie an der richtigen Theorie mißt. Das eherne Lohngesetz wurde nicht etwa aufgegeben, weil die Erfahrung es widerlegt hat, sondern weil man seine grundsätzliche Widersinnigkeit erkannt hat. An seiner anfechtbarsten Behauptung, daß der Lohn um das Existenzminimum herum liegt, deren Nichtübereinstimmung mit den Tatsachen am leichtesten erkannt werden müßte, wird in der laienhaften Erörterung durch die öffentliche Meinung noch heute ebenso hartnäckig festgehalten wie in der marxistischen Mehrwertlehre, die im übrigen behauptet, das eherne Lohngesetz abzulehnen. [29] Keine Erfahrung der Vergangenheit hat KNAPP abgehalten, seine Staatliche Theorie des Geldes aufzustellen, und keine spätere Erfahrung hat seine Anhänger veranlaßt, die Lehre fallen zu lassen.
Die Wissenschaft muß sich den Starrsinn solcher Unbelehrbarkeit zur Warnung dienen lassen. Ergibt sich der Anschein eines Widerspruchs zwischen Theorie und Erfahrung, so haben wir freilich im allgemeinen anzunehmen, daß eine Bedingung, die die Theorie voraussetzt, nicht gegeben war, oder daß unsere Beobachtung sonst irgendwelche Fehler aufweist; da die allgemeine Bedingung des Handelns Unzufriedenheit und Möglichkeit, sie ganz oder teilweise zu beheben dem Handeln immer gegeben ist, bleibt gegenüber den das Handeln an sich betreffenden Theoremen nur die zweite Annahme Beobachtungsfehler offen. In der Wissenschaft kann man aber nicht genug vorsichtig sein. Gelingt es nicht, die Theorie an den Tatsachen zu verifizieren, so kann die Ursache vielleicht auch in der Unvollkommenheit der Theorie liegen. Die Nichtübereinstimmung von Theorie und Erfahrung muß uns daher veranlassen, die Probleme der Theorie immer wieder neu durchzudenken. Doch solange das theoretische Denken uns keine Denkfehler enthüllt, sind wir nicht befähigt oder berechtigt, an der Wahrheit der Theorie zu zweifeln. Andererseits muß auch eine Theorie, die mit der Erfahrung nicht in Widerspruch zu stehen scheint, keineswegs endgültig sein. Der große Logiker des Empirismus, JOHN STUART MILL, hat zwischen der objektivistischen Wertlehre und der Erfahrung keinen Widerspruch zu finden gewußt; sonst hätte er gewiß nicht, gerade am Vorabend einer radikalen Umwälzung der Wert-und Preislehre, die Behauptung aufgestellt, soweit die Gesetze des Werts in Frage kämen, sei für die Gegenwart und für die Zukunft keine Aufgabe mehr zu lösen; die Lehre sei eben vollkommen [40]. Solch ein Irrtum eines solchen Mannes muß allen Theorien stets als Warnung dienen.
3. Indem die Wissenschaft vom Handeln sich nur jenen Aufgaben zuwendet, deren Lösung mittelbar oder unmittelbar einem praktischen Interesse begegnet und aus Gründen, die wir schon ausgeführt haben [41] , auf die vollständige Entfaltung eines umfassenden Systems aller denkbaren Kategorien des Handelns in höchster Allgemeinheit verzichtet, sichert sie sich noch einen besonderen Gewinn. Daß sie durch die Bevorzugung jener Probleme, die das Handeln unter den [30] von der Erfahrung als dem Handeln gegeben nachgewiesenen Bedingungen bietet, genötigt wird, ihre Aufmerksamkeit auf die Erfahrungstatsachen hinzulenken, bewahrt sie davor, zu vergessen, daß eine ihrer Aufgaben in der Feststellung der Grenze zwischen den Bedingungen des Handelns, die kategorialer Erfassung zugänglich sind und kategoriale Erfassung erfordern, und den konkreten Daten des Einzelfalles liegt. Die Theorie muß sich unaufhörlich mit den konkreten Tatsachen des Einmaligen und Einzelnen beschäftigen, weil nur das ihr die Möglichkeit bietet, zu zeigen, wo (geistig, nicht etwa räumlich, zeitlich oder sonstwie sinnlich wahrnehmbar) der Bereich des theoretisch Begreifbaren endet und der des nur geschichtlich Verstehbaren anhebt. Wenn die nach allgemeingültiger Erkenntnis strebende Wissenschaft ihr Rüstzeug so ausbauen soll, daß sie die Theorie soweit treibt, als sie überhaupt geführt werden kann, d. h. so, daß keine Bedingung des Handelns, die kategorialer Erfassung zugänglich ist, außerhalb der Theorie bleibt, wenn die Erfahrung die Frage der Angezeigtheit ihrer Einbeziehung bejaht hat, so ist sie genötigt, auch einen Teil der Probleme der beschreibenden, statistischen und geschichtlichen Forschung zu behandeln. Anders könnte sie gar nicht dazu gelangen, die Grenzen ihres eigenen Bereiches zu erkennen und abzustecken. Denn diese Abgrenzung ist ihre Aufgabe, nicht etwa die der empirischen beschreibenden Fächer, da sie logisch diesen vorangeht.
Diese Vorgangsweise birgt freilich auch manche Gefahren. Man unterläßt es mitunter, das Allgemeingültige vom Historischen zu sondern, man vermengt die Methoden und gelangt dann zu unbefriedigenden Ergebnissen. So leidet z. B. die geniale Leistung der BÖHMBAWERKschen Zinstheorie ganz besonders unter der mangelnden Scheidung der beiden Verfahrensarten.
4. Die meisten Einwendungen, die gegen das System der Wissenschaft vom Handeln erhoben werden, gehen von mißverständlicher Auffassung der Scheidung von Mittel und Zweck aus.
Im strengen Sinn des Wortes ist Zweck immer die Behebung eines Unbefriedigtseins. Wir können aber ohne Bedenken als Zweck auch die Erreichung desjenigen Zustandes der Außenwelt bezeichnen, der unsere Befriedigung entweder unmittelbar herbeiführt oder uns gestattet, den Akt, durch den die Befriedigung erzielt wird, ohne weitere Schwierigkeiten zu vollziehen. Wenn Beseitigung des Hungergefühls als Zweck gesetzt ist, kann man auch die Beschaffung der Speise und ihre Bereitstellung zum Genuß als Zweck bezeichnen, und wenn Beseitigung des Kälteempfindens als Ziel gesetzt ist, auch [31] schon die Erwärmung des Aufenthaltsraumes. Sind zur Behebung des Unbefriedigtseins weiterausgreifende Vorkehrungen erforderlich, dann pflegt man auch die Erreichung der einzelnen Vorstufen des gesuchten Endzustandes als Zweck zu bezeichnen. In diesem Sinne wird in der arbeitteilenden Marktwirtschaft der Gegenwart die Erlangung von Geld als Zweck eines Handelns bezeichnet, in diesem Sinne erscheint die Erlangung aller Dinge, die mittelbar der endlichen Bedürfnisbefriedigung dienen, als vorläufiger Zweck oder Zwischenzweck.
Auf dem Wege zum Hauptzweck werden Nebenzwecke mitgenommen. Ein Mann wandert von A nach B. Er würde den kürzesten Weg wählen, wenn nicht noch Nebenzwecke Befriedigung heischen würden. Er schlägt Umwege ein, wenn er so länger im Schatten wandern kann, wenn er dabei noch einen anderen Ort C, den er auch aufsuchen will, mitnehmen kann, wenn er damit Gefahren vermeiden kann, die auf dem kürzesten Wege lauern mögen, oder wenn ihm der weitere Weg eben besser gefällt. Wenn er sich für einen Umweg entscheidet, so entnehmen wir daraus, daß der Erreichung solcher Nebenzwecke im Augenblick der Entscheidung in seinem Urteil höhere Wichtigkeit zukam als der Ersparnis an Weglänge. Der »Umwege war mithin für ihn gar kein Umweg, da sein Begehen ihm mehr Befriedigung brachte oder nach der Sachlage, wie er sie im Augenblicke der Entscheidung sah hätte bringen müssen als das Erreichen des Zieles auf dem kürzeren Wege. Nur wer diese Nebenzwecke nicht mit ins Auge faßt, kann den an Meilen längeren Weg einen Umweg nennen. Für unseren Wanderer war er der angezeigte Weg, d. i. der Weg, der die höchste Befriedigung versprach [42].
Da das Unbefriedigtsein stets nur subjektiv vom Einzelnen aus gesehen werden kann, kann man in der Wissenschaft, die die Werte nicht setzt und nicht aburteilt, vielmehr lediglich als gegeben betrachtet, über das, was im strengen Sinne des Wortes Zweck zu nennen ist, überhaupt nicht streiten; die Zwecke sind durch das Wollen und Begehren der Einzelnen gegeben. Wenn man von größerer oder geringerer Brauchbarkeit der Mittel spricht, so kann man das immer nur vom Standpunkte der handelnden Einzelnen tun.
Danach sind die Einwände jener richtigzustellen, die nicht müde werden, zu behaupten, der Mensch handle gar nicht rational. Daß der Mensch nicht immer objektiv richtig handelt, d. h., daß er aus [32] Unkenntnis der Kausalzusammenhänge oder aus unrichtiger Beurteilung der gegebenen Lage anders handelt, als er als Richtigwissender handeln würde, um seine Zwecke zu verwirklichen, ist nie bestritten worden. 1833 hat man die Heilung von Wunden anders zu fördern gesucht als 1933, und 2033 wird man voraussichtlich wieder anders vorgehen. Staatsmänner, Feldherren und Börsenspekulanten handeln häufig anders, als sie handeln würden, wenn ihnen alle zur Beurteilung der Verhältnisse erforderlichen Daten genau bekannt wären. Nur ein vollkommenes Wesen, dessen Allwissenheit und Allgegenwärtigkeit alle Daten und jeden Kausalzusammenhang überblickt, könnte wissen, wie jeder irrende Mensch in jedem Augenblick handeln müßte, wenn er die göttliche Eigenschaft der Allwissenheit besäße. Wenn wir rationales Handeln vom irrationalen unterscheiden wollten, so würden wir uns nicht nur zum Richter über die Wertsetzungen unserer Mitmenschen aufwerfen, sondern auch, unser eigenes Wissen zum objektiv richtigen Wissen verabsolutierend, uns den Standpunkt anmaßen, den nur ein allwissendes Wesen einzunehmen vermag. Die Behauptung, daß es irrationales Handeln gebe, läuft immer auf ein Werten fremder Zwecksetzungen hinaus. Wer meint, das Irrationale spiele eine Rolle im menschlichen Handeln, sagt nur, daß seine Mitmenschen nicht so handeln, wie er es für richtig hält. Wenn wir nicht fremder Leute Zwecke und Zielsetzungen werten und uns nicht Allwissenheit zuschreiben wollen, ist die Behauptung, es werde irrational gehandelt, sinnlos, weil mit dem Begriff Handeln nicht vereinbar. Das »einen Zweck zu verwirklichen suchen« und das »Zielen zustreben« können aus dem Begriff des Handelns nicht getilgt werden. Das nicht zweckund zielstrebige Wesen ist das, das auf äußere Einwirkung ohne Mitwirkung eines eigenen Wollens reagiert wie das willenlose Werkzeug und der duldende Spielball. Auch der Mensch ist jenseits des Wirkungsbereichs seines Handelns wie das Rohr im Winde. Doch soweit er zu wirken vermag, handelt er immer; auch die Unterlassung und das Dulden sind Handeln, wenn anderes Verhalten zur Wahl steht. Auch das Verhalten, das durch das Unbewußte im FREUDschen Sinne und durch das Unterbewußte bestimmt wird, ist Handeln, wofern ihm das bewußte Verhalten entgegentreten könnte und es unterläßt. Und auch im Unbewußten und im scheinbar sinnlosen Verhalten der Neurotiker und der Psychopathen waltet »Sinn«, d. h. Zweckund Zielstrebigkeit [43].
[33]
Alles, was wir vom Handeln aussagen, ist unabhängig von den Motiven, die das Handeln im einzelnen Fall auslösen, und von den Zielen, denen es im einzelnen Falle zustrebt. Es spielt keine Rolle, ob dieses Handeln aus altruistischen oder aus egoistischen Motiven, aus vornehmer oder aus gemeiner Gesinnung entspringt, ob es auf Materielles oder auf Ideelles gerichtet ist, ob es eingehender, auf lange Sicht eingestellter Überlegung entspringt oder flüchtigen Impulsen und Affekten folgt. Die Gesetze der Katallaktik, die die Nationalökonomie entwickelt, gelten für jeden Austausch, ohne Rücksicht darauf, ob die Handelnden weise oder umweise gehandelt haben, und ob sie von »wirtschaftlichen« oder »nichtwirtschaftlichen« Motiven geleitet wurden [44]. Die Beweggründe des Handelns und die Ziele, denen es zustrebt, sind für die Lehre vom Handeln Daten, von deren Gestaltung der Verlauf des Handelns im einzelnen Falle abhängt, ohne daß das Wesen des Handelns dadurch beeinflußt wird.
Wir sehen mithin, welche Bewandtnis es mit der heute beliebten Berufung auf das Irrationale hat. Auf die Zwecke können die Begriffe rational und irrational überhaupt nicht angewendet werden. Wer die Zwecke werten will, mag sie gut oder böse, edel oder gemein oder sonstwie preisen oder schelten. Die Ausdrücke rational und irrational, die immer nur auf die Mittel und Wege angewendet werden können, gewinnen in dieser Verwendung nur Sinn, wenn sie vom Standpunkte einer bestimmten Technologie gebraucht werden. Ein Abweichen vom Wege, den diese Technologie als den »rationalsten« vorschreibt, kann aber nur auf zwei Umstände zurückzuführen sein: entweder darauf, daß der »rationalste« Weg dem Handelnden nicht bekannt war oder darauf, daß er ihn verlassen hat, weil er noch andere (vom Standpunkt des Betrachtenden vielleicht sehr törichte) Zwecke mitnehmen wollte. In keinem der beiden Fälle ist man berechtigt, von »irrationalem« Handeln zu sprechen.
Handeln ist ex definitione immer rational. Die Ziele des Handelns irrational zu nennen, wenn sie vom Standpunkt unserer Wertungen nicht anstrebenswert sind, empfiehlt sich durchaus nicht.
Es führt zu argen Mißverständnissen. Statt zu sagen: das Irrationale spielt eine Rolle im Handeln, sollte man sich gewöhnen, einfach zu sagen: es gibt Leute, die anderes anstreben, als ich es tue, und Leute, die andere Mittel anwenden, als ich in ihrer Lage anwenden würde.
[34]
C. Wissenschaft und Wert.
1. Die Herkunft der Nationalökonomie aus einer Technik der Wirtschaftspolitik erklärt es, daß die meisten Nationalökonomen sich in der Darstellung der Lehre einer Ausdrucksweise bedienen, die die von der ganzen Menschheit oder doch von nahezu allen Menschen anerkannten Werturteile und Wertmaßstäbe gelten läßt. Wird z. B. von den Wirkungen der Zölle gesprochen, so pflegt man oder pflegte man zumindest früher allgemein eine Ausdrucksweise zu verwenden, die einen Zustand, in dem ein gegebener Aufwand von Kapital und Arbeit eine bestimmte Menge an materiellen wirtschaftlichen Gütern zu erzeugen vermag, »besser« nennt als einen Zustand, in dem der gleiche Aufwand nur eine geringere Menge zu erzeugen vermag. Durch die Verwendung dieser Ausdrucksweise wird der wissenschaftliche, alle Wertmaßstäbe und Wertungen ausschließende Charakter der Untersuchung wohl der Form, aber keineswegs auch der Sache nach gefährdet. Wer der Ansicht sein sollte, man müsse die Wirtschaftspolitik anders einrichten, etwa so, daß die Menschen an materiellen Gütern nicht reicher, sondern ärmer werden, kann aus der Theorie, die man die Freihandelslehre nennt, alles entnehmen, was er zu wissen braucht, um die Wege einzuschlagen, die zu dem von ihm angestrebten Ziele führen; wenn er selbst Theorie treiben wollte, würde er, richtiges Denken vorausgesetzt, zu keinen anderen Ergebnissen gelangen als die übrigen Theoretiker; er würde nur in der Darstellung in einigen für das Wesen der Lehre bedeutungslosen Rand- und Zwischenbemerkungen andere Ausdrücke gebrauchen. Die Wertfreiheit der Bakteriologie als eines Zweiges der Biologie wird durch den Umstand, daß die Forscher die Bekämpfung der Erreger von dem menschlichen Organismus schädlichen Zuständen als ihre Aufgabe betrachten, nicht im geringsten beeinträchtigt. Ihre Theorien sind, mag auch die Darstellung von Werturteilen wie schädlich und nützlich, günstig und ungünstig u. dgl. m. durchsetzt sein, durchaus objektiv. Die Frage nach dem Wert des Lebens und der Gesundheit wird durch sie weder aufgeworfen noch beantwortet, und ihre Ergebnisse sind unabhängig von der Bewertung dieser Güter durch den einzelnen Forscher. Wer nicht Menschenleben erhalten, sondern Menschenleben zerstören will, wird alles, was er zu wissen braucht, aus ihnen ebenso zu entnehmen vermögen wie der Arzt, der heilen und nicht töten will.
Man kann der Ansicht sein, daß den von der Freihandelstheorie dargelegten »ungünstigen« Wirkungen der Zölle andere Wirkungen [35] gegenüberstehen, die es gerechtfertigt erscheinen lassen, jene ungünstigen Wirkungen in Kauf zu nehmen. Dann hat man, wenn man Wissenschaft treiben will, zunächst die Aufgabe, diese anderen Wirkungen so genau und klar als möglich aufzuzeigen und nachzuweisen. Sache der Politik ist es sohin, die Entscheidung zu treffen. Es ist dabei keineswegs unerwünscht, daß der Nationalökonom auch in der politischen Erörterung das Wort ergreife. Niemand ist berufener als er, die Dinge denen, die zu entscheiden haben, klar und vollständig auseinanderzusetzen. Freilich ist es dabei seine Pflicht, immer deutlich zu zeigen, wo die wissenschaftliche Darlegung von Kausalbeziehungen endet und der Widerstreit der Werte eine Entscheidung verlangt.
Unzulässig ist allein die Verwischung der Grenzen zwischen wissenschaftlicher Darlegung und politischer Wertung. Gerade das ist es, dessen sich jene immer wieder schuldig machen, die nicht müde werden, der Nationalökonomie politische Voreingenommenheit vorzuwerfen, weil man in den nationalökonomischen Schriften sich oft einer Ausdrucksweise bedient, die bestimmte allgemein anerkannte Wertmaßstäbe nicht bestreitet. Gerade diese Gegner wissen nur zu gut, daß sie ihr politisches Ziel nicht erreichen könnten, wenn sie zugeben wollten, daß ihre Vorschläge, an diesen allgemein anerkannten Wertmaßstäben gemessen, sich als nicht empfehlenswert erweisen. Die Schutzzöllner wissen sehr wohl, daß sie keine Aussicht hätten, ihre Absichten zu erreichen, würden die zur Entscheidung Berufenen einsehen, daß Protektionismus die Ergiebigkeit der gesellschaftlichen Arbeit an materiellen Gütern herab
Weil sie das wissen und weil sie dennoch Schutzzölle durchsetzen wollen, bemühen sie sich, den Nachweis zu erbringen, daß Schutzzölle auch »vom wirtschaftlichen Standpunkte« als vorteilhaft anzusehen sind. Und weil sie mit diesen Versuchen kläglich scheitern, erheben sie gegen die Nationalökonomie den Vorwurf politischer Voreingenommenheit.
2. Ob die Wissenschaft Erkenntnis lediglich um der Erkenntnis willen anstrebt oder ob sie die Erkenntnis sucht, um aus ihr Belehrung für das Handeln zu ziehen, oder ob sie sich beide Ziele gleichzeitig setzt, jedenfalls ist es zulässig, aus den Ergebnissen der wissenschaftlichen Forschung Nutzen für das Handeln zu ziehen. Der Mensch denkt nicht nur um des Denkens willen, sondern auch um zu handeln. Diese Gemeinplätze müßte man nicht erst erwähnen, würde uns nicht der Umstand dazu nötigen, daß die antiliberale Parteiliteratur sie im wissenschaftlichen Gewande Tag für Tag leidenschaftlich zu bestreiten [36] sucht.
Daß die Nationalökonomie als Wissenschaft wertfrei ist und daß sie als Wissenschaft weder empfehlen noch verwerfen kann, hindert nicht, daß wir aus der Nationalökonomie zu lernen trachten, wie wir unser Handeln einzurichten haben, um Ziele, denen wir zustreben wollen, zu erreichen. Die Ziele können verschieden sein. CALIGULA, der dem ganzen römischen Volke einen einzigen Kopf wünschte, damit er es mit einem Schlage köpfen könne, hat andere Ziele im Auge gehabt als die übrigen Sterblichen. Doch solche Ausnahmefälle sind selten, und ihr Selbstvernichtungsdrang CALIGULA hätte die Erfüllung seines Wunsches wohl kaum lange überlebt macht eine eingehende Befassung mit ihren Idealen überflüssig. Schon aus biologischen Gründen haben die Menschen, so sehr ihr Wünschen und Wollen und ihre Wertungen im einzelnen auch verschieden sein mögen, doch im großen und ganzen die gleichen Ziele. Sie streben, ohne Unterschied der Weltanschauung, der Religion, der Nation, der Rasse, der Klasse, des Standes, der Bildung, der persönlichen Fähigkeiten, des Alters, der Gesundheit und des Geschlechts zunächst danach, ihr Leben unter möglichst günstigen physiologischen Bedingungen verbringen zu können. Sie wollen essen und trinken, sie suchen Wohnung, Kleidung und Verschiedenes noch dazu. Und sie sind dabei der Meinung, daß mehr Nahrungsmittel, Kleider u. dgl. besser sind als weniger Nahrungsmittel, Kleider u. dgl.
Jeder Einzelne will für sich und für seine Angehörigen Leben, Gesundheit und Wohlstand. Leben, Gesundheit und Wohlstand der anderen mögen ihm dabei gleichgültig sein. Er mag auch, von atavistischen Raubtierinstinkten erfüllt, der Meinung sein, daß die anderen ihm im Wege stehen, daß sie ihm Futterplätze fortnehmen und daß sein Weg zur Befriedigung seiner Wünsche über die Leichen oder über die Beraubung der Mitmenschen führen muß. Doch da kommt die auf Erkenntnissen der Wissenschaft vom menschlichen Handeln aufgebaute Kunstlehre und zeigt ihm, daß es anders ist. Arbeitsteilig verrichtete Arbeit ist ergiebiger als isolierte Arbeit der Einzelnen. Auch wenn hochwertige Menschen sich mit Minderbegünstigten, die ihnen an Arbeitstüchtigkeit und geistigen und körperlichen Fähigkeiten in jeder Hinsicht nachstehen, durch Arbeitsteilung verbinden, ist der Vorteil auf beiden Seiten (RICARDOsches Vergesellschaftungsgesetz, gewöhnlich als Gesetz der komparativen Kosten bezeichnet). Jeder Einzelne vermag mithin seine Ziele in der gesellschaftlichen Arbeitsvereinigung besser zu erreichen als in gesellschaftsloser [37] Vereinzelung. Die gesellschaftliche Kooperation kann aber nur auf Grundlage des Sondereigentums an den Produktionsmitteln aufgebaut werden. Sozialismus Gemeineigentum an den Produktionsmitteln würde keine Wirtschaftsrechnung ermöglichen und ist daher undurchführbar; die Widersinnigkeit des Syndikalismus ist unbestritten; die interventionistischen Eingriffe erweisen sich vom Standpunkte derer, die sie setzen oder fordern, betrachtet als sinn- und zweckwidrig, weil sie zwar nicht die angestrebten, doch manche von ihren Urhebern nicht erwünschte Folgen nach sich ziehen. Wenn man also, streng mit den Mitteln der Wissenschaft schließend, endlich dazu gelangt, festzustellen, daß das Sondereigentum an den Produktionsmitteln die einzige durchführbare gesellschaftliche Organisationsform ist, so liegt darin keine Apologie des Kapitalismus und kein Versuch, den Forderungen des Liberalismus ungebührlich den Nimbus der Wissenschaft zu verleihen. Der Liberalismus ist die Politik, die dem mit den Mitteln der Wissenschaft über die Probleme des menschlichen Wirkens und Handelns Nachdenkenden als der einzige Weg erscheinen muß, der für ihn und die Seinen damit aber zugleich auch für alle anderen zu dauerndem Wohlstand zu führen vermag. Nur wer diesen Weg nicht gehen will, weil er diese Ziele Leben, Gesundheit, Wohlstand für sich und seine Angehörigen und Freunde gar nicht erreichen will, weil er etwa Krankheit, Elend, Not vorzieht, wird die Beweisführung des Liberalismus als nicht »wertfrei« von vornherein zurückweisen dürfen.
Die Verteidiger des herrschenden etatistischen und interventionistischen Systems verkennen das vollkommen, wenn sie glauben, die Anerkennung des Liberalismus unter den bezeichneten Voraussetzungen setze das Bekenntnis zu einer bestimmten Weltanschauung voraus [45]. Liberalismus hat mit Weltanschauung, Metaphysik und Wertung nichts zu tun.
Wir können uns menschenähnliche Wesen denken, in denen der Willen lebt, ihr Menschentum auszulöschen und durch Ertötung des Denkens und Handelns die Stufe des gedankenund tatenlosen Vegetierens der Pflanzen zu erreichen. Ob es solche Menschen gibt oder [38] gegeben hat, ist zu bezweifeln. Selbst der Heilige AEGIDIUS, der radikalste Vertreter der Askese, war in seinem asketischen Eifer noch nicht folgerichtig genug, wenn er die Vögel und die Fische als Vorbild empfohlen hat. Um ganz folgerichtig zu sein, hätte er mit der Bergpredigt die Lilien auf dem Felde als das Ideal völliger Aufgabe jeglicher Sorge um Verbesserung des gegebenen Zustandes preisen müssen. Menschen dieser Art, folgerichtigen Asketen, die sich durch asketisches Nichthandeln dem Tode weihen, haben wir nichts zu sagen, wie auch sie uns nichts zu sagen hätten. Wenn man ihren Standpunkt Weltanschauung nennen will, dann darf man zumindest nicht vergessen hinzuzufügen, daß es unmenschliche Weltanschauung wäre, da sie zum Auslöschen des Menschentums führen muß. Wir sehen den Menschen in unserer Wissenschaft nur als handelnden Menschen, nicht als Pflanze mit menschlichem Äußern. Der handelnde Mensch sucht Ziele, d. h. er will einem Unbefriedigtsein, soweit es geht, abhelfen. Unsere Wissenschaft zeigt nun, wie Zielsuche wesensnotwendig sein muß, und daß menschliche Ziele, wie immer sie im einzelnen gestaltet sein mögen, in arbeitteilender gesellschaftlicher Vereinigung besser erreichbar sind als in Vereinzelung. (Daß die geschichtliche Erfahrung diesem Satz widerstreite, ist noch nie behauptet worden; das ist immerhin bemerkenswert.) Hat man das einmal eingesehen, dann erkennt man, daß im System der nationalökonomischen und soziologischen Theorie und mithin auch in den Lehren des Liberalismus, die die Nutzanwendung dieser Theorie auf das gesellschaftliche Handeln darstellen, keine Wertsetzung irgendwelcher Art enthalten ist. Alle Einwendungen, die gegen das »Weltanschauliche« der nationalökonomischen und soziologischen Wissenschaft und des Liberalismus vorgebracht wurden, erweisen sich als unhaltbar, wenn man erkannt hat, daß die Wissenschaft vom menschlichen Handeln sich eben nur mit dem handelnden Menschen befaßt und daß sie von pflanzenhaft dahinlebenden Wesen, denen wir doch kaum die Bezeichnung Mensch zubilligen könnten, nichts zu sagen weiß.
3. Der Vorwurf des Individualismus wird gegen die Nationalökonomie in der Regel vom Standpunkt eines vermeintlich unüberbrückbaren Gegensatzes zwischen den Interessen der Gesellschaft auf der einen Seite und den Interessen des Einzelnen auf der anderen Seite erhoben. Die Nationalökonomie der Klassiker und der Subjektivisten stelle einseitig die Interessen des Einzelnen über die der Gesellschaft, wobei sie in der Regel in bewußter Verkennung der Sachlage die [39] Harmonie der Interessen von Individuum und Gesellschaft behaupte. Aufgabe der echten Wissenschaft wäre es, zu zeigen, daß das Ganze über den Teilen stehe, daß das Individuum sich der Gesellschaft ein- und unterzuordnen und seine eigensüchtigen Sonderinteressen dem allgemeinen Besten zu opfern habe.
Wer diesen Standpunkt teilt, dem muß die Gesellschaft als ein Mittel erscheinen, das die Vorsehung will, um ihre uns verborgenen Ziele zu erreichen. Der Einzelne habe sich dem Willen der Vorsehung zu fügen und seine Interessen zu opfern, damit ihr Wille geschehe. Seine höchste Pflicht sei Gehorsam; er habe sich den Führern unterzuordnen und so zu leben, wie sie befehlen.
Wer aber, so lautet unsere erste Entgegnung, soll Führer sein ? Denn viele wollen führen, und zwar verschiedene Wege und nach verschiedenen Zielen. Die kollektivistischen Lehren, die nicht müde werden, die liberale Lehre von der Harmonie der Interessen mit Spott und Hohn zu überschütten, gehen nämlich mit Stillschweigen über die Tatsache hinweg, daß es verschiedene Kollektivgebilde gibt und daß die Interessen dieser Kollektivgebilde in unüberbrückbarem Gegensatz stehen. Wenn die Kollektivisten das Mittelalter und seine Gemeinschafts- und Ganzheitskultur preisen und mit romantischem Pathos von den Gemeinschaftsverbänden schwärmen, »in die der einzelne eingeschlossen und in denen er warm gehalten und geschützt war wie die Frucht in der Schale« [46] , vergessen sie, daß z. B. Kaisertum und Papsttum sich jahrhundertelang als Gegner gegenüberstanden, und daß jeder Einzelne in die Lage kommen konnte, zwischen beiden die Wahl treffen zu müssen. Waren auch die Bürger Mailands, als sie ihre Stadt Friedrich Barbarossa überliefern mußten, »warm gehalten und geschützt wie die Frucht in der Schale«? Kämpfen nicht heute mit Erbitterung auf deutschem Boden verschiedene Parteien, von denen jede für sich den Anspruch erhebt, das alleinrichtige Kollektivgebilde darzustellen? Und treten nicht an jeden Einzelnen Klassensozialismus, Nationalsozialismus, Kirche und viele andere Parteien mit der Aufforderung heran: Schließe dich uns an, denn du gehörst in unsere Reihen, und bekämpfe bis auf den Tod die »falschen« Kollektivgebilde? Kollektivistische Sozialphilosophie, die nicht ein bestimmtes Kollektivgebilde als wahr und alle übrigen entweder als diesem untergeordnet bezeichnet oder als Ungebilde verdammt, wäre inhaltsund sinnlos. Sie muß immer dem Einzelnen sagen: Dieses Eine ist und sei [40] dein einziger und wahrer Leitstern, ihm hast du blind zu folgen und keinem anderen darfst du Gehör schenken. Sie kann sich nicht damit begnügen, dem Einzelnen zu sagen: Opfere dein Ich und deine Interessen irgendeinem Kollektivum; sie muß ihm schon genau sagen, wem er sich hinzugeben habe, und daß er allen anderen Kollektivgebilden abzuschwören habe. Der Kollektivismus sagt immer: Hier hast du das Ziel, das fraglos gegeben ist, weil es mir eine innere Stimme verkündet hat; diesem Ziel hast du alles andere und vor allem auch dich zu opfern. Kämpfe bis zum Sieg oder Tod für das Banner dieses bestimmten Ideals und kümmere dich um nichts anderes. Kollektivismus kann gar nicht anders denn als Parteidogma vorgetragen werden; die Empfehlung eines bestimmten Ideals und die Verwerfung aller übrigen ist für ihn gleichnotwendig. LOYOLA predigte nicht einen beliebigen Glauben, sondern den der römischen Papstkirche; LAGARDE verkündete nicht Nationalismus, sondern das, was er für deutsch ansah. Kirche, Nation, Staat in abstracto sind Begriffe der nominalistischen Wissenschaft. Die Kollektivisten vergotten nur die einzig wahre Kirche, nur die »große« Nation (das »auserwählte« Volk, dem von der Vorsehung eine besondere Sendung erteilt wurde), nur den wahren Staat; alles andere verdammen sie.
Darum sind auch alle kollektivistischen Lehren Verkünder unversöhnlichen Hasses und des Krieges bis aufs Messer.
Der Ausgangspunkt der Gesellschaftslehre, die Lehre von der Arbeitsteilung, zeigt, daß der von der kollektivistischen Metaphysik behauptete unüberbrückbare Gegensatz zwischen den Interessen der Gesellschaft und denen der Einzelnen nicht besteht. Der Einzelne kann seine Zwecke, welcher Art sie auch im besonderen sein mögen, in Vereinzelung entweder überhaupt nicht oder zumindest nicht in demselben Ausmaße wie im gesellschaftlichen Verbande verwirklichen. Die Opfer, die er der Aufrechterhaltung des gesellschaftlichen Zusammenwirkens bringt, sind daher nur vorläufige Opfer: Verzicht auf einen im Augenblick sich bietenden Vorteil, um dafür dauernden Gewinn durch Fortbestand und Weiterbildung der gesellschaftlichen Arbeitsteilung einzutauschen. Gesellschaft entsteht und bildet sich weiter nicht dadurch, daß ein von mystischen Mächten den Menschen auferlegtes Sittengesetz den Einzelnen gegen seine Interessen zur Unterordnung unter die Gesellschaft zwingt, sondern dadurch, daß die Einzelnen zur Erreichung der von ihnen angestrebten Ziele sich zusammenschließen, um sich den Vorteil der höheren Ergiebigkeit der arbeitteilig verrichteten Arbeit zu sichern. Daß jeder Einzelne durch [41] den Bestand der Gesellschaft gewinnt, daß keiner als frei schweifendes Individuum eines gedachten Zustandes individueller Nahrungssuche und Kampfes aller gegen alle besser daran wäre denn als tausendfach gebundener und gehemmter Gesellschaftsmensch, das ist der Sinn der »individualistischen« und »atomistischen« Gesellschaftslehre.
Der Kollektivismus behauptet, der »Individualismus« sehe in der Gesellschaft nur die Summierung der Individuen; Gesellschaft aber sei etwas Arteigenes [47]. Die Wissenschaft befaßt sich jedoch überhaupt nicht mit Aussagen über das Sein der Gesellschaft, vielmehr mit Aussagen über das Wirken gesellschaftlicher Zusammenarbeit, und dabei ist das erste, was sie aussagt, das, daß die Ergiebigkeit gesellschaftlichen Zusammenwirkens in jeder Hinsicht über die Summe der Leistungen isolierter Individuen hinausgeht.
Wir gehen in der Wissenschaft vom Handeln des Einzelnen aus, weil wir nur dieses unmittelbar zu erkennen vermögen. Die Vorstellung einer Gesellschaft, die außerhalb des Handelns von Einzelnen wirken oder sichtbar werden könnte, ist absurd. Im Handeln des Einzelnen muß alles Gesellschaftliche irgendwie erkennbar sein. Was wäre jene mystische Ganzheit der Universalisten doch für ein Ding, wenn sie nicht in jedem Einzelnen lebendig wäre! Jedes gesellschaftliche Gebilde wirkt in einem bestimmt gerichteten Handeln Einzelner. Was wäre ein Deutschtum, das nicht im Deutschsein Einzelner, was eine Kirche, die nicht im Kirchlichsein Einzelner den Ausdruck fände! Daß jemand Glied der Tauschgesellschaft ist, muß ebenso durch sein Handeln gegeben sein, wie daß einer Parteigenosse oder Bürger oder Glied irgendeiner anderen Gemeinschaft ist.
Der hervorragendste Vertreter des Universalismus in der Gegenwart, SPANN, hebt scharf hervor, daß die universalistische Soziologie es mit geistigen Tatsachen zu tun habe, die nicht aus der Erfahrung entnommen werden können, weil sie »durch ihre apriorische Natur ein vorempirisches, überempirisches Wesen besitzen« [48]. Das ist zunächst insofern nicht genau ausgedrückt, als apriorisch nur die Gesetze menschlichen Handelns gewonnen werden können; nur durch die Erfahrung aber kann festgestellt werden, ob die von der Theorie vorausgesetzten kategorialen Bedingungen des Handelns im konkreten Falle auch wirklich gegeben sind. (Daß jede Erfahrung ein [42] a priori voraussetzt, hat hier außer Betracht zu bleiben.) Daß die Arbeitsteilung nicht ohne ein Verständigungsmittel zwischen den Menschen durchführbar ist, kann man aus dem apriorischen System des Handelns ableiten. Ob aber Arbeitsteilung und Semantik tatsächlich bestehen, kann nur die Erfahrung zeigen. Und nur die Erfahrung kann uns zeigen, daß verschiedene semantische Systeme, d. i. konkreter ausgedrückt, verschiedene Sprachen, nebeneinander bestehen, und daß sich aus diesem apriorisch bestenfalls als möglich erkannten, doch gewiß nicht als existent erwiesenen Nebeneinander von Sprachgemeinschaften besondere Folgen ergeben. Daß zwischen der Ganzheit Menschheit oder der Ganzheit Weltstaat und dem Einzelnen die Ganzheiten Volk, Rassengemeinschaft, Sprachgemeinschaft, Staat stehen, kann nicht a priori erschlossen, sondern nur durch die Erfahrung ermittelt werden.
Doch das, was SPANN im Auge hat, wenn er der Soziologie, wie er sie auffaßt, das apriorische Verfahren als allein angemessen erklärt, ist gar nicht apriorisches Denken, sondern intuitives Schauen eines Ganzen. Immer wieder wird gegen die Wissenschaft der Vorwurf erhoben, daß sie nicht das Ganze des Lebens, des Werdens und des Seins zu erfassen vermöge. Das lebendige Ganze werde in ihren Händen zum toten Stückwerk, der Glanz und die Farbigkeit der Schöpfung verblaßten, die unendliche Mannigfaltigkeit und Buntheit des Universums verdorre zum rationalen Schema. Eine neue Wissenschaft müsse erstehen, die uns lehre, die Ganzheit als Ganzes zu erfassen. Nur solches Wissen verdiene die Bezeichnung wahre Wissenschaft, alles andere sei armselige rationalistische Deutung und als solche unwahr, weil sie an die Herrlichkeit der Schöpfung nicht heranzukommen vermöge.
4. Die an das diskursive Denken und an die Erfahrung gebundene Wissenschaft gibt uns kein einheitliches Bild der Welt. Ihr ist das Universum pluralistisch. Sie führt auf eine Anzahl von Begriffen und Sätzen zurück, die wir als letzte Deutung hinnehmen müssen, ohne zwischen ihnen eine Verbindung herstellen zu können. Sie erweist sich unfähig, die Lücke zu schließen, die zwischen dem System der Wissenschaften vom menschlichen Denken und Handeln und dem System der physikalischen Naturerkenntnis klafft; Empfindung und Bewegung, Bewußtsein und Materie weiß sie nicht zu vereinen. Was Leben und was Tod sind, bleibt ihr fremd.
Was uns Erfahrung und Denken versagen, gibt uns, wenn auch in anderer Weise, als wir es von der Wissenschaft fordern, wenn wir [43] sie darum angehen, das Erleben. Wir können das Leben durch das Denken nicht erfassen, noch können wir es erfahren unser Denken und unsere Erfahrung betreffen immer nur einzelne Bruchstücke des Lebendigen, die unter dem Akte des Denkens und Erfahrens sich in Totes verwandeln, nie das lebendige Leben und nie das Leben als Ganzes doch wir erleben es. Und indem wir unser Leben leben, leben wir alles Leben, erleben wir die Einheit und untrennbare Verbundenheit alles Lebens. Wir können die Totalität nicht im Denken fassen, doch wir erleben sie.
Das Erleben der Ganzheit, der Einheit und der Unendlichkeit ist das Höchste im menschlichen Dasein. Es ist das Erwachen zu höherem Menschentum, es macht das Dahinleben erst zum wahren Leben. Es bietet sich uns nicht täglich und allerorten dar; günstige Stunden müssen es sein, die uns dem Weltgeist näher bringen. Solche Stunden kommen nur selten, doch sie lohnen tausendfach, und ein Abglanz fällt von ihnen auf die dahinfließenden Tage, Wochen, Monate und Jahre.
Das, was wir in diesen Stunden der Erhebung erleben, ist unser Eigenstes und Persönlichstes, ist unser Tiefstes. Es ist so eigen und persönlich, daß wir es keinem anderen mitzuteilen vermögen; es ruht so tief in uns, daß es nicht bis zu unserem eigenen Bewußtsein klar zu gelangen vermag. Wer einem geliebten Menschenwesen, wer einem Stück Natur gegenüber, wer im Regen der eigenen Kraft noch so stark die Gewalt des Unermeßlichen erlebt, vermag weder sich selbst noch anderen zu sagen, was es ist, was ihn bewegt, und wie es ihn bewegt. Das Ganze bleibt das Unsagbare, weil Denken und Sprache hier nicht mitkommen können.
Denn nur ein stammelnder und unzulänglicher Versuch, das Erlebte auszudrücken und seinen Inhalt zu gestalten, ist die Kunst. Das Kunstwerk fängt nicht das Erlebnis ein, sondern nur das, was es in seinem Schöpfer an Ausdrückbarem hervorgerufen hat; Inhalt, Farbe und Kraft des Erlebens, die ganz aus dem Innern kommen, bleiben ihm fern. Wohl vermag auch das Kunstwerk bei dem, der es auf sich wirken läßt, neues Erleben zu entzünden. Doch das Erleben, das das Kunstwerk auslöst, ist nicht jenem adäquat, das sein Schöpfer ausdrücken wollte. Der Künstler gibt dem Werke Ton, Klang, Farbe, Worte, Gestalt, doch nicht Erlebnis; wir aber nehmen daraus mehr als die Empfindung von Ton, Klang, Farbe, Worten, Gestalten, wir erleben es. Und dieses Erlebnis ist ein Anderes, ein Neues und Neuartiges. Mit aller Mystik und Metaphysik steht es nicht anders. Wir nehmen [44] die Worte, doch den Sinn das Erlebnis müssen wir selbst dazutun. Denn an das Volle, an das Ganze, an das Leben reichen unsere Ausdrucksmittel und unsere Denkmittel nicht heran. Es ist, wie die alten Inder vom Brahman sagten, dasjenige, »vor dem die Worte kehren um und die Gedanken, ohne es zu finde« [49].
Darum kann es auch in Metaphysik, Mystik und Kunst keinen Fortschritt und keine Entwicklung geben. Die Genauigkeit, mit der ein Werk die Bilder der äußeren Welt wiedergibt, kann gesteigert werden, aber nicht das Wesentliche, das Künstlerische an ihm. Auch das primitivste Kunstwerk kann stärkstes Erleben ausdrücken und spricht zu uns, wenn wir es nur zu uns sprechen lassen wollen, führt uns in Tiefen, die die Wissenschaft uns nie zugänglich machen kann.
Immer wieder wird von jenen, die die Grenzen zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und mystisch-intuitiver Schau im Erlebnis verwischen wollen, gegen die Wissenschaft der Vorwurf erhoben, daß sie an der Oberfläche der Dinge hafte und nicht bis in die Tiefen dringe. Doch Wissenschaft ist eben nicht Metaphysik und gewiß auch nicht Mystik; sie kann uns niemals die Erleuchtung und Befriedigung bringen, die der Ekstatiker schaudernd in der Verzückung erlebt. Wissenschaft ist Nüchternheit und Klarheit des Begriffes und nicht Trunkenheit der Vision.
Es ist wahr, wie vor allem BERGSON in unübertrefflicher Klarheit ausgeführt hat, daß zwischen der Wirklichkeit und dem, was die Wissenschaft bringen kann, eine unüberbrückbare Kluft liegt [50]. Die Wissenschaft kann das Leben nicht unmittelbar erfassen; was sie in ihr Begriffssystem einfängt, ist immer von anderer Beschaffenheit als Lebendiges [51]. Man mag sie darum, wenn man will, auch tot nennen, weil doch der Tod der Gegensatz des Lebens ist. Wenn man aber meint, damit ein abfälliges Werturteil über die Wissenschaft ausgesprochen zu haben, dann irrt man. Man kann Wissenschaft tot nennen, man kann sie aber nicht unbrauchbar nennen. Sie ist in doppeltem Sinn unentbehrlich: einmal als das einzige Mittel, das uns bis zu jenem Grad von Erkenntnis führt, der für uns überhaupt erreichbar ist, und dann als die einzige Grundlage für ein Handeln, das uns den von uns angestrebten Zielen näherbringt. Mag man nun in der Weisheit [45] oder mag man im Handeln den höchsten Wert sehen, in keinem Fall darf man die Wissenschaft verachten. Nur sie weist uns die Wege zur Erkenntnis und zur Tat. Ohne sie wäre unser Dasein nur Vegetieren.
5. Alles, was die universalistische Kritik an Vorwürfen gegen die individualistische Methode der Gesellschaftswissenschaft und insbesondere der Nationalökonomie erhebt, läßt sich damit als unberechtigt erweisen. Die Wissenschaft kann nicht anders als diskursiv verfahren; sie muß von Ansatzpunkten ausgehen, die so sicher erscheinen, wie menschliche Erkenntnis überhaupt sicher scheinen kann, und muß von da, Schritt für Schritt logisch schließend, weitergehen. Sie kann als apriorische Wissenschaft mit denknotwendigen Sätzen, die durch apodiktische Evidenz ihre Begründung und Rechtfertigung finden, oder als empirische Wissenschaft mit Erfahrungen beginnen. Niemals aber kann sie zum Ausgangspunkt die Schau eines Ganzen machen.
Man würde das Wesen und die Aufgaben der Kartographie verkennen, wollte man die Forderung aufstellen, die Landkarte müsse die Berge und Wälder in ihrer Schönheit und Pracht zeigen. Die trefflichste Schilderung der Herrlichkeit der Landschaft könnte uns nicht im mindesten die Landkarte ersetzen. Sie könnte uns nicht den Weg weisen, der zu den Zielen führt, die wir erreichen wollen. Die Botanik darf nicht von Schönheit und Pracht der Blumen sprechen, sie darf nicht von den Wäldern und Wiesen ihren Ausgangspunkt nehmen, sondern von den einzelnen Pflanzen, und sie studiert die Pflanze, indem sie als Pflanzenphysiologie und -biologie von der Zelle aus ihre Erkenntnis aufbaut.
Wenn der Universalismus sich gegen die Auffassung wendet, wonach die gesellschaftlichen Erscheinungen »kausalmechanischen Naturgesetzen« unterliegen, so ist ihm insoferne zuzustimmen, als das Sinnerfassen der Wissenschaften vom menschlichen Handeln von der Naturbeobachtung der Art nach verschieden ist. Die Auffassung des Behaviorismus ist ebenso unhaltbar wie der erkenntnistheoretische Standpunkt, den SCHUMPETER in seinem ersten Buche »Wesen und Hauptinhalt der theoretischen Nationalökonomie« [52] vertreten hat. Alle mechanischen Analogien führen irre. Doch die Denkkategorie der Kausalität können wir in unserem wissenschaftlichen Denken ebensowenig missen wie in dem Denken des Alltags; sie ist die einzige Kategorie, die sich nicht wegdenken läßt [53]. Ein Denken, das [46] die Kausalität nicht kennen würde, könnte auch nicht zum Gottes-und Ganzheitsbegriff gelangen. Daß Wissenschaft vor allem Denken bedeutet, wird wohl nicht bestritten werden. Denken aber muß stets kausal und rational sein.
Das menschliche Denken vermag den Inhalt des Universums nicht ganz auszuschöpfen. Es führt uns in den Wissenschaften vom menschlichen Handeln bis an einen Punkt, wo das Begreifen seine Grenze hat und darüber hinaus nichts weiter getan werden kann als die Feststellung des irrationalen Tatbestandes durch das spezifische Verstehen der Geisteswissenschaften.
Der Irrtum des Universalismus liegt darin, daß er in Übereinstimmung mit vielen Bearbeitern der methodischen und logischen Problematik der Geisteswissenschaften nicht sieht, daß dem Verstehen, d. i. dem Schauen von Gestalt und Qualität, nicht die Alleinherrschaft auf dem Gebiete der Geisteswissenschaft zukommt, daß ihm vielmehr das Begreifen, d. i. das denkende Erfassen des Sinns, logisch und zeitlich vorausgehen muß.
6. Die metaphysischen Systeme der Geschichtsphilosophie maßen sich an, hinter der Erscheinung der Dinge ihr »wahres« und »eigentliches«, dem profanen Auge verborgenes Sein zu erkennen. Sie trauen sich zu, Zweck und Ziel alles irdischen Treibens, der Menschheit und der Menschheitsgeschichte zu erkennen, sie wollen den »objektiven Sinn« des Geschehens erfassen, von dem sie behaupten, daß er von dem subjektiven, d. i. von dem von den Handelnden selbst gemeinten Sinn, verschieden sei. Alle Religionssysteme und alle Philosophien der Geschichte verfahren dabei nach denselben Grundsätzen. Der marxistische Sozialismus und die in verschiedenen Spielarten vorgetragenen Lehren des deutschen Nationalsozialismus und der ihm verwandten außerdeutschen Richtungen stimmen ungeachtet der Schärfe, mit der sie sich bekämpfen, im logischen Verfahren überein, und es ist bemerkenswert, daß sie alle auf dieselbe metaphysische Grundlage, nämlich auf HEGELs Dialektik, zurückführen.
Die Wissenschaft vom menschlichen Handeln sieht keinen Weg, der die denkenden Menschen zur Erkenntnis der verborgenen Absichten Gottes oder der Natur führen könnte. Sie vermag auf die Frage nach dem »Sinn des Ganzen« keine Antwort zu geben, die in der Art logisch gesichert werden könnte, in der die Ergebnisse des [47] wissenschaftlichen Denkens gesichert werden müssen, um wenigstens als vorläufige Wahrheiten anerkannt zu werden. Sie verzichtet bewußt auf das Eindringen in metaphysische Tiefen [54] ; sie erträgt es leicht, daß ihr die Gegner vorwerfen, sie hafte an der »Oberfläche«.
Es soll nicht bestritten werden, daß die edelste Aufgabe, die dem menschlichen Denken gestellt werden kann, das Nachsinnen über die letzten Dinge ist. Ob dabei Erfolg zu erzielen ist, mag zweifelhaft sein. Viele der erhabensten Häupter der Geistesgeschichte waren der Meinung, daß Denken und Erkennen ihren Wirkungsbereich überschreiten, wenn sie sich solchen Aufgaben zuwenden. Sicher ist jedenfalls, daß zwischen metaphysischen Versuchen und wissenschaftlicher Forschung Unterschiede grundsätzlicher Art bestehen, die man nicht ohne Gefahr verwischen darf. Aufgabe der Wissenschaft ist es, die apriorischen Voraussetzungen der Erkenntnis rein durchzudenken und dadurch zu einem geschlossenen System zu entwickeln und mit Hilfe der Ergebnisse dieser Arbeit das Erfahrungsmaterial denkend zu verarbeiten. Es ist dagegen keineswegs Aufgabe der Wissenschaft, die letzten Dinge zu schauen, Werte zu setzen und ihre Rangordnung zu bestimmen. Man mag immerhin die Erfüllung dieser Aufgaben als höher, edler und wichtiger bezeichnen als die einfachere Aufgabe der Wissenschaft, ein System von Beziehungen UrsacheWirkung auszubilden, das uns ermöglicht, unser Handeln so einzurichten, daß es uns zu den von uns jeweils angestrebten Zielen führt. Man mag auch den Dichter, den Seher und den Verkünder neuer Werte über den Diener der Wissenschaft stellen. Doch man darf auf keinen Fall die beiden wesensverschiedenen Aufgaben vermengen, man darf nicht etwa versuchen, der Aufforderung von NOVALIS nachkommend, die Finanzwissenschaft zu »poëtisieren« [55].
Metaphysik und Wissenschaft setzen sich verschiedene Aufgaben. Sie können daher nicht dieselben Wege gehen und finden sich auch nicht im Ziele. Sie könnten ohne Feindschaft nebeneinander wirken, weil sie, solange sie ihr eigenes Wesen nicht verkennen, nicht genötigt sind, einander Gebiete streitig zu machen. Zu Zusammenstößen kommt es nur, wenn von der einen oder von der anderen Seite her eine Grenzüberschreitung gewagt wird. Der Positivismus hat geglaubt, daß er durch Übertragung der Methoden der Wissenschaft auf [48] die von der Metaphysik behandelten Probleme an Stelle der unsicheren Spekulation und Begriffsdichtung ein Verfahren setzen könnte, das der Behandlung der letzten Dinge der Erkenntnis die Gewißheit wissenschaftlicher Beweise gewährleiste. Er hat nicht bemerkt, daß er in dem Augenblick, in dem er sich anschickt, die Probleme der Metaphysik zu behandeln, notwendigerweise auch selbst Metaphysik betreibt, gerade weil er es nicht bemerkt hat, war seine Metaphysik ungeachtet der Anmaßung, die sie allem Metaphysischen gegenüber zur Schau trug, naiv. Auf der anderen Seite sucht man immer wieder, gesicherte Ergebnisse des wissenschaftlichen Denkens mit metaphysischen Gründen zu bekämpfen. Nun kann man wohl nichts wissenschaftlich Gesichertes gegen die Annahme vorbringen, daß einem anderen Geiste als dem menschlichen die Dinge sich anders darstellen könnten als wir sie erfahren und sehen, so daß seine Wissenschaft einen anderen Inhalt haben könnte als unsere. Wir können eben über das, was anderes als menschliches Denken übermenschliches Denken, göttliches Denken denken würde, durch unser Denken überhaupt nichts feststellen. Doch innerhalb des Kosmos, in dem unser Handeln zum Wirken gelangt und unser Denken dem Handeln vorarbeitet, sind die Ergebnisse unseres wissenschaftlichen Denkens in einer Weise gesichert, die die Behauptung, daß sie in einem weiteren Rahmen oder in einem tieferen Sinn ihre Geltung verlieren müßten und irgendwelcher anderer Erkenntnis zu weichen hätten, als sinnlos erscheinen lassen muß.
Da wir uns hier nicht mit der Erfahrungswissenschaft, sondern mit dem wissenschaftlichen Apriorismus der Wissenschaft vom menschlichen Handeln zu befassen haben, kommen die Übergriffe der Metaphysik in das Gebiet der Erfahrungswissenschaft für uns nicht in Betracht. Es leuchtet ohne weiteres ein, daß die Versuche, das, was das apriorische Denken ergibt, durch metaphysische Ausführungen zu entkräften, darauf hinauslaufen, das diskursive Denken durch die Willkür intuitiver Einfälle zu ersetzen. Keine Metaphysik vermag den Begriff des Handelns irgendwie zu erschüttern; demgemäß kann auch Metaphysik nichts von dem wegnehmen, was wesensmäßig aus dem Begriffe des Handelns abgeleitet wird. Wenn wir die Bedingungen menschlichen Handelns kategorial zu erfassen suchen, so mag man mit den Mitteln des wissenschaftlichen Denkens unser Verfahren kritisieren und berichtigen, wenn es in die Irre gegangen sein sollte. Doch das, was von unserer Denkarbeit logischer Kritik standhält, kann keinesfalls durch metaphysische Aussagen entkräftet werden. So [49] wenig es zulässig wäre, den binomischen Lehrsatz durch metaphysische Behauptungen wegzudisputieren, so wenig geht es an, irgendeinem der Sätze der nationalökonomischen Wert- und Preislehre mit dem Hinweis darauf die Anerkennung zu verweigern, daß man eine andere »Weltanschauung« habe oder daß man einen anderen Interessenstandpunkt, etwa den »proletarischen«, bezogen habe. Keine Ganzheitsschau, kein Universalismus und kein »Soziologismus« kann uns gestatten, die Dinge anders zu »verstehen«, als sie sich unserem nüchternen Denken darstellen müssen. Wenn ich nicht die Arithmetik, in der dreimal drei neun geben, durch arithmetisches Denken als widerspruchsvoll aufzuzeigen vermag, bin ich nicht berechtigt, zu behaupten, daß in einem »höheren« oder »tieferen« Sinne anderes zu gelten habe.
Die Schlüsse, die aus den Ergebnissen der Nationalökonomie gezogen werden müssen, finden nicht die Billigung jener, deren unmittelbare augenblicklichen Interessen es erwünscht erscheinen lassen, daß andere Lehren als richtig anerkannt werden. Da es ihnen nicht gelingen kann, im Denkgebäude der Nationalökonomie einen Irrtum zu entdecken, rufen sie überirdische Kräfte zu Hilfe.
D. Utilitarismus und Rationalismus und die Lehre vom Handeln.
1. Nichts von dem, was seit Jahrtausenden gegen Hedonismus und Utilitarismus vorgebracht wurde, trifft im mindesten die Lehre vom Handeln. Wenn die Begriffspaare Lust Unlust und Nutzen disutility formal gefaßt werden und keinen materiellen Inhalt umschließen, fallen alle jene Bedenken fort, die man bis zum Überdruß seit altersher wiederholt hat. Es bedarf schon einer beträchtlichen Unvertrautheit mit dem gegenwärtigen Stande der Auseinandersetzung, um die alten Anklagen gegen den »unsittlichen« Hedonismus und gegen den »gemeinen« Utilitarismus neuerdings vorzutragen.
Nun pflegt man heute, wenn man sich schon genötigt sieht, die logische Unmöglichkeit einer anderen Auffassung zuzugeben, zu sagen, die formale Fassung der Begriffe Lust und Nutzen entziehe der Lehre jeden Erkenntniswert. Der Begriff des Handelns werde damit so leer, daß man mit ihm nichts mehr anzufangen vermöge. Dieser Kritik gegenüber ist darauf hinzuweisen, was alles aus dem angeblich so leeren Begriff des Handelns von der nationalökonomischen Theorie abgeleitet werden konnte.
Will man ohne den verfehmten Grundsatz des Hedonismus [50] Wissenschaft von jenen Dingen betreiben, die nach unserer Auffassung Gegenstand der Wissenschaft vom menschlichen Handeln bilden, so gleitet man unversehens in einen Empirismus über, dem es nicht gelingen kann, die Fülle von Tatsachen, die er bringt, systematisch zu verbinden und zur Erklärung der Erscheinungen zu verwenden, die wir zu erfassen haben. Ein Beispiel möge es verdeutlichen.
In dem Bestreben, eine Gesellschaftslehre aufzubauen, weiß VIERKANDT nicht anders vorzugehen, als daß er, dabei dem Vorgang einer großen Anzahl von Forschern folgend, den Menschen eine Reihe von »sozialen Anlagen« zuschreibt. Unter den sozialen Anlagen des Menschen versteht er »solche angeborene Triebe (z. B. Hilfstrieb) und andere angeborene Eigenschaften und Verhaltungsweisen (z. B. Beeinflußbarkeit und Verstehen), die zu ihrer Betätigung die Anwesenheit anderer Menschen oder, genauer gesagt, den Zustand der Gesellschaft voraussetzen«. Daneben gibt es auch noch andere Anlagen, nämlich solche, die sich auch oder nur »anderen Gebilden gegenüber betätigen« [56]. Und nun geht VIERKANDT daran, eine Reihe von Trieben, Anlagen und Instinkten aufzuzählen und zu beschreiben. Diese Aufzählung kann natürlich nie vollständig sein. Die Abgrenzung eines Triebes gegenüber einem zweiten muß notwendigerweise willkürlich sein. Folgerichtig müßte man jedem Ziel, das von Menschen irgendwo und irgendwann angestrebt wurde, einen entsprechenden Trieb zuordnen. Nimmt man z. B. einen Nahrungstrieb oder Nahrungsinstinkt an, von dem man den Trieb oder Instinkt nach Genußmitteln unterscheidet, so ist nicht abzusehen, warum man in der Unterscheidung nicht weitergehen und nicht auch von einem Trieb nach Fleischnahrung oder, noch spezieller, von einem Trieb nach Rindfleischnahrung oder, noch spezieller, von einem Trieb nach Rindslendennahrung sprechen soll. Der Gesichtspunkt, nach dem man das auf die Beschaffung verschiedener Speise gerichtete Handeln der Menschen zusammenfaßt, wenn man vom Nahrungstrieb spricht, ist der des Zweckes, den sie mit diesem Handeln verfolgen. Wenn man das Handeln, das auf die Einverleibung von Kohlenhydraten, Fett und Eiweiß gerichtet ist, als Ausfluß des Nahrungstriebes zusammenfaßt, so kann man mit der gleichen Berechtigung auch das auf die Beschaffung von Wohnung, Kleidung und Nahrung gerichtete Handeln und manches andere Handeln als Ausfluß des Selbsterhaltungstriebes ansehen. Wieweit man in der Verallgemeinerung gehen will, kann nur [51] Willkür entscheiden, wofern man nicht mit radikaler Wendung des Denkens zur höchsten Verallgemeinerung schreitet, nämlich zum Begriff des formalen, von jedem materiellen Inhalt entleerten Zweckes. Weil VIERKANDT den Utilitarismus und Hedonismus ablehnt und daher diesen entscheidenden Schritt nicht macht, bleibt er bei willkürlicher Gliederung der verschiedenen menschlichen Begehrungen stecken.
Die angeborenen sozialen Anlagen treten, führt VIERKANDT weiter aus, »häufig paarweise in gegensätzlicher Form auf«. So stehe dem »Trieb des Selbstgefühls« sein »Gegenteil, der Gehorsamstrieb« gegenüber, dem »Hilfstrieb« der »Kampftrieb«, dem »Geselligkeitstrieb« ein »Trieb zum Meiden«, dem »Mitteilungstrieb« ein »Trieb zum Geheimhalten und Verbergen« [57]. Da über die Stärke, mit der diese gegensätzlichen Triebe wirken, nichts ausgesagt werden kann, ist nicht abzusehen, wie aus ihnen die Entstehung der gesellschaftlichen Verbundenheit erklärt werden soll. Daß die »sozialen Anlagen« zur Ausbildung gesellschaftlicher Verbundenheit führen können, mag man immerhin zunächst gelten lassen, ohne an der unzulässigen Hypostasierung Anstoß zu nehmen. Doch wir vermissen eine zureichende Erklärung dafür, daß die sozialen Triebe über die antisozialen siegen. Warum vereiteln nicht Kampftrieb, Trieb des Selbstgefühls und Trieb zum Meiden die Bildung gesellschaftlicher Verbände ?
Der »Instinkt des Selbstgefühls«, meint VIERKANDT, könne sich nicht betätigen, »ohne daß sich zugleich der Trieb der Unterordnung regt«. Man habe es hier mit der »charakteristischen Verschmelzung entgegengesetzter Triebe« zu tun; »die Gesamtfärbung wird dabei freilich durch den Trieb zur Überordnung bestimmt« [58]. Wenn man einen »Trieb der Unterordnung« annimmt, dann ist man, wenn man nicht ganz tatsachenblind sein will, genötigt, einen entgegengesetzten Trieb anzunehmen. VIERKANDT spricht von einem »Trieb des Selbstgefühls«. (Mit Recht hat WIESE eingewendet, daß VIERKANDT, wenn er einen Unterordnungstrieb behauptet, »nicht minder einen in der Geschichte und im Leben des Einzelnen sehr wichtigen Empörungstrieb gelten lassen« müsste [59].) Doch dafür, daß der Unterordnungstrieb über den des Selbstgefühls siegt, weiß VIERKANDT keinen anderen Beweis zu erbringen als den, daß er in seiner [52] Schilderung den Unterordnungstrieb als den stärkeren und besseren bezeichnet. »Die Unterordnung«, meint er, »ist ein gesunder, normaler und beglückender Zustand, bei dem durch die Situation die Ersetzung des Selbstgefühls durch die entgegengesetzte Haltung gefordert wird« [60]. Es ist immerhin bemerkenswert, daß VIERKANDT, der Gegner des Eudämonismus, der Unterordnung beglückkende Wirkung zuschreibt. Hier bricht einmal die Feststellung FEUERBACHs durch: »Jeder Trieb ist ein Glückseligkeitstrieb« [61].
Das Selbstgefühl, das VIERKANDT im Auge hat, ist aber von besonderer Art. Es ist gewissermaßen ein Nebenprodukt der Unterordnung. »Überall bedeutet das Eingehen auf den Willen des Überlegenen zugleich, daß man sich zu ihm erhebt: die Unterordnung bedeutet zugleich ein inneres Teilhaben an der Größe des Übergeordneten.« Ein Beispiel: »der Diener im Bereich patriarchalischer Zustände zu seiner Herrschaft« [62]. Ein andermal spricht VIERKANDT wieder von dem »Diener, der das Schloß seiner Herrschaft mit gehobenem Selbstgefühl zeigt«, weil er sich »innerlich eins« fühlt »mit dieser und ihrem Glanze« [63]. Das Selbstgefühl, das VIERKANDT meint, ist eben nichts anderes als Lakaienstolz. Da nimmt es weiter nicht wunder, daß es dem Unterordnungstrieb nicht im Wege steht. Diese Unterordnung kommt hinaus »auf unbedingte Folgsamkeit«. Der Abhängige macht sich »innerlich blindlings abhängig«. Er »unterwirft sich ganz dem Urteil, insbesondere dem Werturteil des Überlegenen: aus seiner Hand empfängt er seinen Wert, indem er nach seinen Maßstäben sein Verhalten regelt und dadurch sein Selbstgefühl befriedigt. Es wird der Untergeordnete gleichsam aufgesogen von dem Überlegenen: er verliert seine Persönlichkeit, findet aber in der Gemeinschaft mit dem Überlegenen eine neue wieder, die er als seine geläuterte eigene empfindet« [64]. Mit besonderer Genugtuung vermag VIERKANDT darauf hinzuweisen, daß alle diese Instinkte schon bei den Tieren zu finden sind. »Beim Hunde zeigt sich in einer elementaren, aber sehr starken Form schon die echt menschliche innere Hingabe an seinen Herrn: die Belebung durch seine Anwesenheit und überhaupt die [53] Polarisierung durch ihn.« Beachtenswert erscheint VIERKANDT »auch die Befriedigung des Selbstgefühls, die der Hund und wohl auch andere Tiere beim Gelingen einer Dressuraufgabe zeigen, wegen der Verbindung dieses Triebes mit dem Unterordnungstrieb beim Menschen« [65]. Für VIERKANDT ist mithin die menschliche Gesellschaft gewissermaßen in dem Verhältnis des Herrn zum Hunde, den er dressiert, bereits vorgebildet. Das Verhältnis Führer-Geführte entspricht dem Verhältnis Herr-Hund, es ist gesund und normal, und es beglückt beide, den Herrn wie den Hund. Man kann sich mit VIERKANDT da nicht weiter auseinandersetzen, denn letzte Erkenntnisquelle ist für ihn »der phänomenologische Befund, also das, was wir unmittelbar in uns erleben und uns mit Evidenz zum Bewußtsein bringen können« [66]. Wir wollen also nicht bezweifeln, daß er wirklich all dies innerlich erlebt hat, und wollen sogar noch weiter gehen und ihm die Berechtigung nicht bestreiten, über die »echt menschliche innere Hingabe« des Hundes an seinen Herrn aus unmittelbarem Erlebnis und aus Wesensschau heraus zu sprechen. Doch wie, wenn jemand kommt, der behaupten wollte, anderes unmittelbar erlebt und geschaut zu haben? Einer, der nicht das Selbstgefühl der Lakaien und der Hunde, vielmehr das von Männern als »gesund, normal und beglückend« bezeichnen wollte. Einer, der die Wurzel der »inneren Verbundenheit« nicht im »Unterordnungswillen« wie VIERKANDT [67] , vielmehr im Willen zum gemeinsamen Handeln suchen wollte.
VIERKANDT lehnt die individualistische Lehre vom Handeln ab, weil er ein politisches Programm vertreten will, das, vom Standpunkte der wissenschaftlichen Nationalökonomie und Gesellschaftslehre betrachtet, als widersinnig erscheint. Die Ablehnung vermag er nicht anders zu begründen als durch wiederholten Hinweis auf den rationalistischen, individualistischen und atomistischen Charakter alles dessen, was seinen Beifall nicht findet [68] Rationalismus, Individualismus und Atomismus werden heute von allen herrschenden Parteien aus leicht erkennbaren Gründen verfehmt, und so genügt diese Begründung für den Bereich offizieller Meinungsbildung und Geltung. An die Stelle der Wissenschaften, die er ablehnt, ohne ihre Lehren erfaßt zu haben, setzt VIERKANDT eine willkürliche Aufzählung [54] und Beschreibung von Urtrieben und Urinstinkten, die er so und nicht anders erlebt und geschaut haben will, um dann auf dieser Grundlage ein politisches Programm so zu formen, wie er es für seine Zwecke braucht. Davon können wir hier absehen. Für uns ist die Einsicht beachtenswert, daß, wer jenem Wege ausweichen will, den die allgemeingültige Wissenschaft vom menschlichen Handeln geht, nichts anderes tun kann, als die gesellschaftliche Verbundenheit der Menschen durch das Wirken von angeborenen Anlagen, die zur Vergesellschaftung führen, zu erklären, wenn er es nicht vorzieht, sie noch einfacher als ein Werk Gottes oder der Natur hinzustellen.
Wenn jemand jedes menschliche Begehren oder jede von ihm gebildete Gruppe von menschlichen Begehrungen durch Zuordnung besonderer Triebe, Instinkte, Anlagen und Gefühle zu erklären vermeint, dann soll ihm dies gewiß nicht verwehrt werden. Wir bestreiten nicht nur nicht, daß die Menschen Verschiedenes begehren, wünschen und anstreben, sondern wir gehen in unseren Erwägungen gerade von dieser Tatsache aus. Wenn in der Wissenschaft von Lust, Glück, Nutzen, Bedarf gesprochen wird, dann soll damit nichts anderes bezeichnet werden als das Begehrte, Gewünschte, Angestrebte, das, was den Menschen als Ziel und Zweck erscheint, was sie entbehren und dessen Erreichung sie befriedigt. In dieser Ausdrucksweise wird auf den konkreten Inhalt des Begehrten in keiner Weise Bezug genommen; sie ist formal, und sie ist im Hinblick auf die Werte neutral. Das Einzige, das die Wissenschaft von der »Glückseligkeit« aussagt, ist das, daß sie rein subjektiv ist. In dieser Aussage ist daher Raum für alle erfindlichen Begehrungen und Gelüste. Keine Behauptung über die Qualität des von den Menschen Angestrebten kann mithin die Richtigkeit unserer Theorie irgendwie berühren oder gar erschüttern.
Der Punkt, an dem die Wissenschaft vom Handeln mit ihrer Gedankenarbeit einsetzt, ist die Unverträglichkeit der einzelnen Wünsche und die Unmöglichkeit der Vollbefriedigung. Da es dem Menschen nicht gewährt ist, alle Triebe voll zu befriedigen, da er dieses und jenes nur erreichen kann, wenn er auf anderes verzichtet, muß er zwischen den Trieben unterscheiden, muß er sich für dies und gegen anderes entscheiden, muß er wählen und werten, vorziehen und zurückstellen, kurz: handeln. Auch für den, der heiß das Glück der Unterordnung ersehnt, kann doch ein Augenblick kommen, in dem er zwischen der Hingabe an den Führer und der Befriedigung eines anderen Triebes, z. B. des Nahrungstriebes, zu wählen hat; es mag [55] etwa die am Ruder befindliche republikanische Partei die monarchistisch gesinnten Beamten mit Entlassung bedrohen. Jederman sieht sich immer wieder einer Lage gegenüber, in der sein Verhalten mag es nun in einem Tun, Unterlassen oder Dulden bestehen über das Erreichen und Nichterreichen von Zielen mitentscheidet. Darüber aber, über das menschliche Handeln, kann eine Lehre, die Rationalismus, Individualismus und Eudämonismus ablehnt, nichts aussagen. Sie bleibt dabei stehen, eine Anzahl von Trieben aufzuzählen und zu beschreiben. Sie erzählt uns wohl, daß die Menschen lieben und hassen, daß sie geschwätzig sind und verschlossen, daß sie grausam sind und mitleidsvoll, daß sie gesellig sind und daß sie die Gesellschaft fliehen. Darüber, daß sie handeln, daß sie wirken, arbeiten, sich mühen, um Ziele zu erreichen, weiß sie nichts zu berichten. Denn vom Handeln kann man nur sprechen, wenn man vom Einzelnen ausgeht, wenn man das Rationale ins Auge faßt und wenn man erkennt, daß das Ziel des Handelns Behebung eines Unbefriedigtseins ist. Und wenn man Gesellschaft erklären will, ohne auf das Handeln der Menschen einzugehen, bleibt eben nur der Ausweg, Gesellschaft als den Ausfluß geheimnisvoll wirkender Kräfte anzusehen: Gesellschaft ist dann Wirkung des Vergesellschaftungstriebs, ist »innere Gemeinschaft«, ist wurzelhaft, wesenhaft, ist nicht von dieser Welt.
2. Noch an einem anderen Beispiel sei gezeigt, wie haltlos alle Einwendungen sind, die gegen den »Atomismus, Individualismus, Utilitarismus und Rationalismus« der Wissenschaft erhoben werden. Nicht minder deutlich als bei dem eben besprochenen Falle wird es sich hier zeigen, daß die psychologische Triebkraft dieser Versuche im Unvermögen liegt, mit zwingender Logik geführte Beweise der Nationalökonomie zu entkräften. Unter der Maske unparteiischer Kritik aller bisherigen Gesellschaftswissenschaft versucht man den Interventionismus, dessen Sinn- und Zweckwidrigkeit (vom Standpunkte der Ziele, die ihm seine Verteidiger selbst setzen) die Nationalökonomie erwiesen hat, zu rechtfertigen.
MYRDAL meint, man verstehe »das Pathos der Arbeiterbewegung schlecht, wenn man glaubt, daß sie hauptsächlich für höhere Reallöhne kämpft. Sozialpsychologisch gesehen, handelt es sich hier um etwas anderes . . . Die Forderung höherer Löhne, kürzerer Arbeitszeit usw. sind natürlich wichtig an und für sich, aber tiefer gesehen, sind sie nur ein Ausdruck für weit allgemeinere Machtstrebungen und Gerechtigkeitsforderungen von seiten einer Gesellschaftsklasse, die sich eben unterdrückt fühlt. Dieses Gefühl ist das [56] Wichtige an der Sache. Selbst wenn es aussichtslos wäre, höhere Löhne durchzudrücken, würde der Kampf fortgehen. Selbst wenn die Arbeiter Grund hätten, zu glauben, daß ein Rückgang der Produktionseffektivität und der Arbeitslöhne resultieren würde, so würden sie trotzdem mehr Macht und Mitbestimmung an der Regulierung der Produktion fordern. Letztlich geht es ihnen um mehr als Geld, es geht um ihre Arbeitsfreude, ihr Selbstgefühl oder, wenn man so will, um ihren Wert als Menschen. Vielleicht kein großer Streik kann lediglich als Streik für höhere Löhne erklärt werden« [69]. Mit diesen Ausführungen glaubt MYRDAL wohl dem unwiderlegbaren Beweis der Nationalökonomie, daß die Löhne durch die Mittel der gewerkschaftlichen Politik für die Gesamtheit der Arbeiter nicht dauernd erhöht werden können, seine Bedeutung für die Beurteilung der Zweckmäßigkeit der gewerkschaftlichen Politik vom Standpunkte der Arbeitnehmer genommen zu haben. Denn wer »sozialpsychologisch« und »tiefer« zu blicken wisse, der erkenne, meint er, daß es den in den Gewerkschaften organisierten Arbeitern gar nicht um die Lohnhöhe und nicht um Geld zu tun sei, vielmehr um ganz andere Dinge, z. B. um ihre »Arbeitsfreude«, um ihr »Selbstgefühl« und um ihren »Wert als Menschen«. Wenn dem wirklich so wäre, könnte man nicht verstehen, warum die Führer der Gewerkvereine und die für sie kämpfenden Kathedersozialisten soviel Gewicht darauf legen, öffentlich immer wieder die von der Nationalökonomie als unhaltbar erkannte Behauptung zu vertreten, daß durch den gewerkschaftlichen Zusammenschluß die Löhne dauernd und für alle Arbeitnehmer erhöht werden, und warum sie sich eifrig bemühen, alle, die anderer Meinung sind, mundtot zu machen und zu ächten. Dieses Verhalten der Gewerkschaftsführer und ihres literarischen Gefolges ist eben darin begründet, daß die Arbeitnehmer von den Gewerkschaften Steigerung ihres Realeinkommens erwarten. Kein Arbeiter würde einer Gewerkschaft beitreten, wenn er davon nicht Lohnerhöhung erhoffen dürfte, vielmehr mit Lohneinbußen zu rechnen hätte; auch die Aussicht, durch Arbeitsfreude, Selbstgefühl, Menschenwert und anderes von dieser Art entschädigt zu werden, würde ihn nicht zu einem Freund der Gewerkschaften machen können. Die Gewerkschaftsführer wissen recht gut, daß einzig und allein die Aussicht auf Einkommenssteigerung die Gewerkschaften geschaffen hat und zusammenhält.
[57]
Wenn aber MYRDAL recht hätte, daß die Gewerkschaften eigentlich gar nicht für höhere Löhne, vielmehr für andere Dinge kämpfen, dann würden auch damit die Behauptungen der Nationalökonomie zur Frage der Beeinflussung der Lohnhöhe durch den gewerkschaftlichen Zusammenschluß der Arbeitnehmer nicht berührt werden. Die Nationalökonomie ist weder für noch gegen die Gewerkschaften; sie sucht nur festzustellen, wie die spezifische Politik der Gewerkschaften auf dem Arbeitsmarkt wirkt.
MYRDALS Stellung wird dadurch nicht besser, daß er es vermeidet, klar und offen zu sprechen. Indem er erklärt, die Forderung höherer Löhne sei »natürlich wichtig an und für sich«, meint er wohl, sich genügend gegen jegliche Kritik gesichert zu haben. Wir begegnen hier dem üblen Brauche des gesamten kathedersozialistischen Schrifttums, durch unscharfe und ungenaue Ausdrucksweise die Mangelhaftigkeit der logischen Beweisführung zu verhüllen. Da MYRDAL im weiteren Verlaufe seiner Ausführungen dazu gelangt, zu behaupten, daß die Arbeiter an der Gewerkschaftspolitik selbst dann festhalten würden, wenn sie erkennen würden, daß sie ihnen Lohnopfer auferlegt, so ist er der Ansicht, daß die Lohnsteigerung, die die Gewerkschaftspolitik seiner und aller Kathedersozialisten und Gewerkschaftsführer Meinung nach mit sich bringt, von ihnen nur als ein angenehmer Nebenerfolg der auf die Erreichung anderer Ziele gerichteten Politik gewertet wird. Damit aber ist die Erörterung der Frage, die an dem Gegenstande für die nationalökonomische Theorie und, wie alle nicht voreingenommenen Beurteiler wohl zugeben werden, erst recht für die Praxis allein von Bedeutung ist, ob nämlich die Anwendung der »gewerkschaftlichen Mittel« zu allgemeiner und dauernder Lohnsteigerung zu führen vermag, um keinen Schritt gefördert.
MYRDAL ist weder mit der Geschichte noch mit dem gegenwärtigen Stande der Wissenschaft vertraut und kämpft daher gegen Windmühlen. Seiner Auffassung nach behauptet die Nationalökonomie, daß nur »ökonomische Interessen« das menschliche Handeln leiten, wobei unter ökonomischen Interessen »das Wollen höherer Einkommen und niedrigerer Preise« verstanden wird. Das sei ein Fehler: »Bedauerlicherweise oder vielleicht erfreulicherweise erschöpft man die Motive menschlichen Handelns nicht damit, daß man einfach ökonomische Interessen registriert« [70].
[58]
Die ältere Nationalökonomie war der Auffassung, daß es einen abgrenzbaren Bezirk des »Wirtschaftlichen« gebe und daß es die Aufgabe der Nationalökonomie sei, dieses Wirtschaftliche zu erforschen. An dieser Auffassung haben die modernen Nationalökonomen noch lange festgehalten, obgleich ihrem Subjektivismus die Abgrenzung der »wirtschaftlichen« Zwecke von den »nichtwirtschaftlichen« noch aussichtsloser erscheinen mußte als dem Objektivismus der Klassiker. Auch heute ist diese Auffassung noch nicht von allen aufgegeben worden. Doch immer mehr dringt die Erkenntnis durch, daß man weder die Beweggründe noch die Ziele des Handelns als wirtschaftlich und nichtwirtschaftlich sondern kann. Wirtschaftlich ist nur das Verfahren der handelnden Menschen; Wirtschaften ist das Bestreben, das Unbefriedigtsein soweit abzustellen oder, in anderer Ausdrucksweise, seine Bedürfnisse soweit zu befriedigen, als die Beschränktheit der zur Verfügung stehenden Mittel es gestattet.
Von keiner der beiden Auffassungen darf man behaupten, daß sie die Motive menschlichen Handelns nur in der Verfolgung ökonomischer Interessen (in dem Sinne, in dem MYRDAL diesen Ausdruck verwendet) erblickt hätte. Die ältere Auffassung hat zwischen ökonomischem und nichtökonomischem Handeln unterschieden, sie hat von wirtschaftlichen und von nichtwirtschaftlichen Zielen und von wirtschaftlichem und von nichtwirtschaftlichem Verhalten gesprochen. Für die moderne Auffassung ist alles Handeln Wirtschaften; auch bei den Zielen macht sie keinen Unterschied, weil sie alle Ziele, auch die, welche die ältere Auffassung und die volkstümliche Ausdrucksweise (und auch MYRDAL) als nichtwirtschaftlich ansehen, als gleichberechtigt betrachtet und es nicht zulassen will, daß man in die Wissenschaft Wertungen einschmuggelt und etwa das Bestreben, »ideelle« Güter zu erlangen, irgendwie mit anderen Augen ansieht als das Streben nach »materiellen« Gütern. Daß vielfach ein Geldgewinn verschmäht oder eine Geldausgabe geleistet wird, um politische oder andere Ziele, die man gemeiniglich als nichtwirtschaftliche bezeichnet, zu erreichen, wird nicht nur nicht bestritten, sondern mit Nachdruck hervorgehoben.
MYRDAL arbeitet mit einem Begriff »Interesse«, den er dem Begriff »ökonomisches Interesse« und somit dem Begriff »Wollen höherer Einkommen und niedrigerer Preise« gleichsetzt. Das Verhalten der Menschen, meint er, werde nicht durch die Interessen allein bestimmt, sondern durch die »Attitüden«. Als Attitüde soll verstanden werden »die gefühlsbetonte Disponiertheit eines Individuums zu [59] bestimmtem Verhalten angesichts einer wirklichen oder hypothetisch gesetzten Gesamtsituation«. Es gebe »erfreulicherweise«, fügt er bei, »genug Menschen mit Attitüden, welche sich mit ihren Interessen durchaus nicht decken« [71]. Um dies festzustellen, bedurfte es allerdings nicht erst eines Buches von mehr als dreihundert Seiten. Daß es Menschen gibt, die auch anderes anstreben als »höheres Einkommen und niedrigere Preise«, hat niemand bestritten, am allerwenigsten die Nationalökonomen. BÖHM-BAWERK z. B. hat ausdrücklich festgestellt, daß er das Wort »Wohlfahrtszwecke« im weitesten Sinne gebraucht, in welchem es »nicht bloß die egoistischen Interessen eines Subjekts, sondern alles umfaßt, was diesem erstrebenswert erscheint« [72]. Alles, was MYRDAL gegen den Utilitarismus der Nationalökonomie vorzubringen weiß, zerfällt in Nichts, weil er den Grundgedanken der modernen Nationalökonomie, die er kritisieren will, nicht begriffen hat.
3. Auch die Versuche, durch Heranziehung der Ergebnisse der ethnologischen und urgeschichtlichen Forschung den »rationalistischen« Ausgangspunkt der nationalökonomischen Lehre zu untergraben, verfehlen das Ziel.
EDUARD HAHN führt die Entstehung des Pfluges und der Pflugwirtschaft auf mythische Quellen zurück. Die Pflugbestellung sei ursprünglich eine Zeremonie gewesen, bei der der Pflug den Phallus des ihn ziehenden, der Mutter Erde samenspendenden Kindes darstellte. Der Wagen war, seiner Meinung nach, ursprünglich nicht »wirtschaftliches« Beförderungsmittel, vielmehr Sakralgerät, das den Zweck hatte, »die Wanderungen der Lenker des Schicksals am Himmel auf Erden zu wiederholen«; erst später sei »der Wagen zum gewöhnlichen Gerät der Wirtschaft herabgesunken« [73]. Durch diese übrigens durchaus nicht unbestrittenen Feststellungen glaubt nun HAHN der utilitaristischen Denkungsart in der Wissenschaft den Boden entzogen und den vollen Beweis für die Richtigkeit seines politischen Programms, das die »Herstellung einer wirksamen Sozialaristokratie« fordert, erbracht zu haben [74]. »Die moderne Ethnologie«, [60] meint HAHN, »befindet sich . . . immer und immer wieder im stärksten Gegensatz gegen die landläufige Anschauung, die im bedauerlichsten Widerspruch gegen die Tatsachen der wirklichen Welt den reinen Nutzen als die einzige wirksame Triebfeder aller wirtschaftlichen Tätigkeit des Menschen, ja überhaupt alles historischen Geschehens hervorzukehren bestrebt ist. Allmählich aber wird doch die Erkenntnis durchkommen müssen, daß die ideale Seite naturgemäß eine sehr große Berücksichtigung verdient; daß sich nicht für alle Zeiten und für alle Völker, wie das für uns, die Kinder der letzten Hälfte des 19. Jahrhunderts, zutreffen soll, jeder Erfolg handelt es sich nun um einen Sack Kartoffeln oder um die größte philosophische oder physikalische Entdeckung sich in Mark und Pfennig, ganz besonders aber in Dollars und Cents ausdrücken läßt« [75].
Die Völker, deren Kultur HAHN studiert hat, hatten andere Vorstellungen von dem Kausalzusammenhang der Dinge als die Menschen des 19. Jahrhunderts. Wo wir heute von Vorstellungen beherrscht werden, die der modernen Chemie, Biologie und Physiologie entstammen, hatten sie Vorstellungen, die wir nun als magischen und mythologischen Glauben zu bezeichnen pflegen. Sie waren, sagt HAHN, von der Idee erfüllt, »man könne das Leben der Vegetation (oder der Tierwelt) durch wirksame rituelle Handlungen beeinflussen« [76] ; der älteste Pflanzenbau, meint er weiter, habe sich sicher auch von den Vorstellungen leiten lassen, die darauf hinauskamen, »es müßte etwas für das Gedeihen der Pflanzenwelt geschehen, ehe man vom Boden etwas verlangen könne, man müsse erst etwas dazu getan haben« [77]. HAHN gibt mithin selbst zu, daß die primitiven Landwirte ihre Riten des Nutzens und Erfolges wegen geübt haben. Ihre magischen Bräuche und Gepflogenheiten waren, nach HAHNS eigener Darstellung, zielbewußte Handlungen. Wenn wir ihre Technik »magisch« und unsere »wissenschaftlich« nennen, so wird damit allein schon zugegeben, daß die grundsätzliche Einstellung der Menschen in ihrem Verhalten in beiden Fällen dieselbe ist und daß die Verschiedenheit des Verhaltens durch die Verschiedenheit der die Menschen erfüllenden konkreten Vorstellungen von den Kausalzusammenhängen bedingt ist. Wenn diese mythologischen Vorstellungen zwischen der Nacktheit des Pflügers und dem Erntesegen oder zwischen [61] manchen uns als anstößig erscheinenden Bräuchen und der Fruchtbarkeit des Bodens einen Kausalzusammenhang erblicken wollten [78] , und wenn demgemäß Riten vollzogen wurden, um den Erfolg der landwirtschaftlichen Arbeit zu sichern, so kann man doch darin gewiß nicht eine Begründung für die Behauptung finden, daß jene Menschen der Vorzeit sich von uns dadurch unterschieden hätten, daß nicht der Nutzen, sondern der Idealismus die Triebfeder ihrer Handlungen gewesen sei. Daß sich in einer Zeit, die den Gebrauch des Geldes noch nicht kannte, der Erfolg wirtschaftlicher Tätigkeit nicht in Mark und Pfennig hat ausrechnen lassen, ist klar. Doch was jene Menschen der Vorzeit anstrebten, was sie allein schätzten und was sie gerade durch ihre Riten, Kulthandlungen, Beschwörungen, Gebete und Orgien zu erreichen suchten, war die Befriedigung der »gemeinen« Notdurft des Lebens, war Nahrung, Kleidung, Obdach, Gesundheit und Sicherheit. Für das, was wir heute sonst noch werthalten, hätten sie kein Verständnis gehabt, auch nicht für »die größte philosophische oder physikalische Entdeckung«.
Die Kulturfortschritte, meint FROBENIUS, entstammen nicht der »Not« und der »Sorge«, sondern den »Idealen«. Das beweise u. a. auch die Geschichte des Hackbaues. »Die erste Stufe war offenbar ein Einsammeln des Korns, das wild wuchs. Als Ideal entstand die Sitte, aus Dankbarkeit und um die durch den Kornschnitt verwundete Mutter Erde zu versöhnen, ihr wieder Körner zurückzuerstatten, deren Früchte aber als heilige Opfererzeugnisse nicht etwa dem profanen Leben zurückflossen. Erst in späterer Zeit nahm der Hackbau mehr und mehr profanen und verstandesmäßigen Charakter an . . . Erst als die sorgende Kausalität die Ideale verkümmern ließ, als die nüchternen Tatsachen im Geiste herrschend wurden, stellte sich die praktische, zweckmäßige Verwertung der Erfindung' des Hackbaues als profaner Wirtschaftsbetrieb ein« [79].
Es mag zutreffen, daß Hackbau und Pflügen als rituelle Handlungen aus magischer und mythologischer Technik heraus entstanden sind und daß man sie später, als man die Unzweckmäßigkeit der Kulthandlungen erkannt hatte, im Hinblick auf die Zweckmäßigkeit, die ihnen vom Standpunkte der mittlerweile gebildeten pflanzenbaulichen Kenntnisse zukam, beibehielt. Diese Feststellung könnte als sehr interessanter Beitrag zur Geschichte der Technologie und der Anwendung technologischer Kenntnisse begrüßt werden. Doch für [62] uns besagt sie nichts weiter als das, daß die technologischen Vorstellungen der Vorzeit anders geartet waren als unsere. Es wäre unzulässig, aus ihr die Folgerung abzuleiten, daß das Handeln der Menschen jener fernen Zeiten und Länder von dem Handeln moderner Menschen kategorial verschieden gewesen wäre. BERTHOLD SCHWARZ wollte Gold machen und soll dabei die Bereitung des Schießpulvers erfunden haben; COLUMBUS fuhr aus, um den Seeweg nach Indien zu suchen, und entdeckte Amerika. Darf man darum behaupten, daß die beiden grundsätzlich anders gehandelt haben als wir handeln? Daß menschliches Handeln nicht immer die Ziele erreicht, die es sich gesetzt hat, und dabei mitunter an Stellen gerät, die ihm erstrebenswert erschienen wären, wenn man sie schon früher gekannt hätte, ist nie bestritten worden.
Wenn die Landwirte der Urzeit durch symbolische Kulthandlungen den Ertrag des Bodens zu erhöhen suchten, war ihr Handeln in den herrschenden »technologischen« Auffassungen ihrer Zeit begründet; wenn wir heute anders vorgehen, entspricht es den heute herrschenden technologischen Auffassungen. Wer diese für irrig hält, möge es versuchen, ihre Irrtümer aufzudecken und an die Stelle einer unbrauchbaren Lehre eine zweckmäßigere zu setzen. Kann er das nicht, dann darf er das Vorgehen derer nicht tadeln, die für die Verbreitung moderner agrikulturtechnischer Kenntnisse wirken. Es ist sinnlos, sich darüber aufzuhalten, daß »der kurzsichtige Rationalismus des neunzehnten Jahrhunderts« die »Handlungen und Spenden eines alten Rituals . . . einfach als Aberglauben ansah und durch eine Belehrung in der Volksschule beiseitezuschieben gedachte« [80]. Geht man die langen Verzeichnisse der unserem Empfinden als wenig empfehlenswert erscheinenden Bräuche durch, die EDUARD HAHN in seinen Schriften mit erstaunlicher Belesenheit zusammenstellt, so findet man kaum einen, dessen Beseitigung zu beklagen wäre [81]. Was soll die Beibehaltung der Gebärden einer Technik, deren Erfolglosigkeit niemand bestreiten kann ?
Wir können im Verhalten der Menschen nur zwei Grundformen unterscheiden, die begrifflich scharf getrennt sind: das unbewußte [63] Verhalten, das vegetative Reagieren, und das bewußte Verhalten, das Handeln. Alles Handeln aber ist denknotwendig an das gebunden, was die apriorische Lehre vom menschlichen Handeln entwickelt. Die Ziele wechseln, die technologischen Vorstellungen wandeln sich, doch Handeln bleibt immer Handeln. Handeln sucht immer Mittel, um Zwecke zu verwirklichen, und ist in diesem Sinne immer rational und auf Nutzen bedacht, ist mit einem Worte: menschlich.
4. Wenn man die Methode der modernen Nationalökonomie ablehnt und darauf verzichtet, das menschliche Handeln formal zusammenzufassen unter dem »eudämonistischen« Gesichtspunkte, daß es ausnahmslos der Steigerung der vom Einzelnen nach seiner subjektiven Wertung beurteilten Wohlfahrt dient, dann bleibt nur die Wahl zwischen dem Verfahren der Triebsoziologie und dem des Behaviorismus. Die Triebsoziologie sucht dem Kern des Problems dadurch auszuweichen, daß sie jedem Begehren einen Trieb zuordnet, der das Handeln »erklären« soll; das ist die Methode, die die Wirkung des Opiums aus der »virtus dormitiva cuius est natura, sensus assupire«, erklärt. Der Behaviorismus vermeidet die Erklärung und begnügt sich mit der Registrierung der einzelnen Handlungen. Beide, »grobmaterialistischer« Behaviorismus und »idealistische« Triebsoziologie, könnten, wenn sie folgerichtig wären, gar nicht dazu gelangen, zwei Handlungen, die nicht vollkommen gleichgeartet sind, zusammenzufassen. Denn das Prinzip, das sie dazu bringt, den Trieb nach Brot und den nach Kartoffeln als Nahrungstrieb oder das Verzehren von Brot und das von Kartoffeln als Essen zusammenzufassen, müßte sie auch zu weiteren Zusammenfassungen führen, bis sie zur allgemeinsten Zusammenfassung »Bedürfnisbefriedigung« oder »Wohlbefindenssteigerung« gelangen. Beide stehen ratlos gegenüber dem Problem des Widerstreits verschiedener Wünsche, Wollungen und Begehrungen bei beschränkten Mitteln zu ihrer Befriedigung.
Mit der Ärmlichkeit und Unzulänglichkeit dessen, was diese beiden bieten, vergleiche man den Reichtum an Erkenntnis, die wir der nationalökonomischen und soziologischen Theorie schon heute danken.
[64]
Soziologie und Geschichte.↩
Einleitung.
Der Rationalismus hat den Wissenschaften, die sich mit dem menschlichen Handeln befassen, zwei umwälzende Neuerungen gebracht. In die Geschichte, die bis dahin die einzige Wissenschaft vom menschlichen Handeln gewesen war, führte er das kritische Verfahren ein; er löste sie von der naiven Bindung an das in Chroniken und Geschichtswerken der Vorzeit Überlieferte los, lehrte sie neue Quellen Dokumente, Inschriften und manches andere heranzuziehen und an allen Quellen Kritik zu üben. Das, was die Geschichtswissenschaft damit gewonnen hat, kann ihr nicht wieder verlorengehen; es ist ihr auch nie streitig gemacht worden. Auch die in jüngster Zeit unternommenen Versuche, Geschichte zu »schauen«, können sich davon nicht losmachen. Geschichte kann immer nur auf Grund von Quellen erforscht werden, und daß man dem Stoff kritisch gegenübertreten muß, wird niemand ernstlich in Frage stellen wollen. Zweifel kann nur das »Wie«, nie auch das »Ob« der Quellenanalyse und Quellenkritik erwecken.
Die andere große Errungenschaft des Rationalismus war die Ausbildung einer theoretischen Wissenschaft vom menschlichen Handeln, d. h. einer auf die Gewinnung allgemeingültiger Gesetze des menschlichen Verhaltens hinarbeitenden Wissenschaft. AUGUSTE COMTE verdankt diese Wissenschaft nichts weiter als ihren Namen. Ihre Grundlagen waren schon im 18. Jahrhundert gelegt worden. Denker des 18. und des beginnenden 19. Jahrhunderts haben vor allem den bis heute am besten ausgestalteten Teil der Soziologie, die nationalökonomische Theorie, auszubauen gestrebt; sie haben aber auch die Grundlagen für ein über das engere Gebiet der ökonomischen Theorie hinausgehendes, das Ganze der Soziologie umfassendes System zu schaffen gesucht [82].
Die grundsätzliche Zulässigkeit und Möglichkeit soziologischer Betrachtungsweise ist in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bestritten worden. Man hat es nicht gelten lassen wollen, daß es von der geschichtlichen Umwelt unabhängige Gesetze des menschlichen [65] Handelns geben kann, und hat demgemäß die Geschichtswissenschaft als die allein zur Behandlung des Erkenntnisobjektes »menschliches Handeln« berufene Wissenschaft bezeichnet. Dieser Angriff gegen die Daseinsberechtigung der Soziologie richtete sich nahezu ausschließlich gegen die Nationalökonomie; daß die Nationalökonomie nur ein Teilstück einer über ihr Gebiet hinausreichenden umfassenderen, denselben logischen Charakter aufweisenden Wissenschaft, der Soziologie, sein könnte, wurde den Angreifern nicht bewußt. Als dann später die Soziologie in Deutschland bekannter wurde und man daran ging, auch gegen das Ganze der Soziologie Sturm zu laufen, wurde der Umstand, daß auch die Soziologie mit demselben Anspruch auf Allgemeingültigkeit ihrer Aussagen auftritt wie die Nationalökonomie, nicht beachtet; man war mittlerweile, unter dem Eindrucke der Ablenkung, die die Problemstellung in der Behandlung durch WINDELBAND, RICKERT und MAX WEBER erfahren hatte, dahin gelangt, den logischen Charakter der Soziologie anders aufzufassen.
Die Ablehnung der Soziologie und ihres Teiles, der Nationalökonomie, hatte auch, vielleicht selbst in erster Reihe, politische Gründe; bei manchen, wie z. B. bei SCHMOLLER, BRENTANO und HASBACH, haben sie wohl den Ausschlag gegeben [83]. Man wollte politische und wirtschaftspolitische Forderungen vertreten, die sich als widersinnig nicht etwa vom Standpunkte irgendwelcher anders eingestellter Wertungen, sondern gerade vom Standpunkte derer, die mit ihnen bestimmte Ziele zu erreichen strebten erweisen mußten, wenn man sie einer Prüfung durch die Mittel der nationalökonomischen Theorie unterzogen hätte. Der Interventionismus konnte nur dem als sinnvoll erscheinen, der sich über alles, was die Nationalökonomie gebracht hatte, hinwegsetzte; jedem anderen mußte es klar sein, daß die interventionistische Politik ihre Ziele nicht erreichen kann [84]. Was Bismarck in der Reichstagsrede vom 2. Mai 1879, mit der er seine Finanz- und Wirtschaftspolitik zu rechtfertigen suchte, ausdrückte, daß er in allen diesen Fragen von der Wissenschaft gerade sowenig halte wie in irgendeiner anderen Beurteilung organischer Bildungen, daß ihn die abstrakten Lehren der Wissenschaft in dieser Beziehung vollständig kalt ließen und daß er »nach der Erfahrung, die wir erleben« urteile [85] ], das verkündete die historisch-realistische Schule [66] der wirtschaftlichen Staatswissenschaften mit mehr Worten, aber kaum mit besseren Argumenten. Doch der Bestreitung des Wissenschaftscharakters der Soziologie lagen jedenfalls auch sachliche Bedenken zugrunde. Nur mit diesen haben es die folgenden Erörterungen zu tun.
Methodologische und erkenntnistheoretische Ausführungen können auf zwei verschiedene Weisen verankert werden. Man kann versuchen, bis zu den letzten Problemen der Erkenntnistheorie hinabzusteigen, um festen Boden zu finden. Dieses Verfahren wäre zweifelsohne das beste, wenn es Erfolg versprechen würde, so daß man hoffen dürfte, in der Tiefe wirklich festen Grund zu finden. Man kann aber auch einen anderen Weg nehmen, indem man von den bestimmten Begriffen und Urteilen der Wissenschaft ausgeht und sie auf ihren logischen Charakter prüft. Daß man auf diese Weise niemals zur Erkenntnis der letzten Grundlagen unseres Wissens zu gelangen vermag, ist klar; aber das bietet der erste Weg auch nicht. Hingegen bewahrt uns der zweite Weg vor dem Schicksal, das den meisten Untersuchungen widerfahren ist, die in den letzten Jahren den methodologischen und erkenntnistheoretischen Fragen unserer Wissenschaft gewidmet wurden: daß sie nämlich über der mit den beschränkten Mitteln des menschlichen Geistes nicht zu meisternden Schwierigkeit der letzten Probleme der Erkenntnistheorie gar nicht dazu gelangt sind, sich mit den vergleichsweise leichter lösbaren logischen Aufgaben der Soziologie zu befassen.
Die Aufgabe, die den folgenden Ausführungen gestellt ist, ist von vornherein viel enger umgrenzt als die, die sich jene Untersuchungen gesteckt haben. Sie sollen nicht zu den Müttern hinabsteigen, sie sollen nicht die letzten Fragen der Erkenntnis bereinigen. Sie sollen nur darlegen, was Soziologie sein will und mit welchem Geltungsanspruch sie ihre Begriffe bildet und ihre Urteile fällt. Daß dabei vor allem die nationalökonomische Theorie in Betracht gezogen werden soll, bedarf wohl keiner besonderen Rechtfertigung; ist diese doch jenes Teilgebiet der Soziologie, das bis nun am besten ausgebaut wurde und die höchste systematische Geschlossenheit erreicht hat. Den logischen Charakter einer Wissenschaft studiert man am vorteilhaftesten an ihrem höchstentwickelten Teile. Dabei soll nicht, wie es bedauerlicherweise in vielen methodologischen und erkenntnistheoretischen Arbeiten Brauch ist, von der gerade auch in logischer [67] Beziehung unbefriedigenden Formulierung, die die Probleme und Problemlösungen bei den Klassikern gefunden haben, ausgegangen werden, sondern selbstverständlicherweise von dem gegenwärtigen Stande der Theorie [86].
I. Das methodologische und das logische Problem.
Man muß, von dem gewöhnlich eingeschlagenen Verfahren abweichend, zunächst das methodologische von dem logischen Problem sondern.
In der Regel wird unter Methodenlehre die Logik als Lehre von den Methoden des Denkens verstanden. Wir wollen von ihr in dem weniger gebräuchlichen Sinn als Technik des wissenschaftlichen Denkens (Heuristik) sprechen und sie der Wissenschaft der Logik als eine Kunstlehre (ars inveniendi) gegenüberstellen.
Lange Zeit hindurch hat man, in den Bahnen BACONS wandelnd, das induktive Verfahren ganz besonders hoch eingeschätzt. Die Naturwissenschaften, so hörte man besonders auch aus dem Munde von Laien, verdankten ihre Erfolge vor allem der vollständigen Induktion; habe man alle Fälle zusammengetragen, dann sei es erst möglich, das allgemeine Gesetz zu gewinnen. Man ließ sich nicht irremachen durch den Umstand, daß BACON und die meisten, die seine Lehre vortrugen, selbst keine Erfolge aufzuweisen hatten, und daß gerade die erfolgreichsten Forscher einen anderen Standpunkt eingenommen hatten. Man beachtete nicht, daß z. B. GALILEI die gewöhnliche vollständige Induktion in den Naturwissenschaften für überflüssig, die unvollständige für unsicher erklärt hatte, und daß er die Vergleichung der Fälle durch die Analyse eines Falles ersetzte, aus dem er das Gesetz gewann, das dann experimentell zu verifizieren war. Und geradezu grotesk war es, daß man die vollständige Induktion als die spezifische Verfahrensart der Naturwissenschaften pries, ohne zu bemerken, daß sie tatsächlich nicht von den Naturforschern, sondern von [68] den Altertumsforschern gehandhabt wurde, die bei der Spärlichkeit der ihnen zur Verfügung stehenden Quellen grundsätzlich darauf ausgingen, ihre Schlüsse aus einer Durcharbeitung des gesamten zugänglichen Materials zu ziehen.
Nicht auf das Material kommt es an, sondern auf den Geist, der sich mit ihm befaßt. Das Material, an dem sich GALILEI, NEWTON, HUME, RICARDO, MENGER, FREUD zur höchsten Leistung entzündeten, stand jedem ihrer Zeitgenossen und vorher schon ungezählten Geschlechtern zu Gebote. GALILEI war doch nicht der erste, der die schwingende Bewegung des Kronleuchters im Dom zu Pisa beobachten konnte. Wie viele Ärzte mögen wohl vor BREUER an das Bett eines an Hysterie Leidenden getreten sein! Nur die Technik wissenschaftlicher Kärrnerarbeit ist lehrbar und in Handbüchern darstellbar; die Kraft, wissenschaftliche Leistungen zu vollbringen, kann nur in dem geweckt werden, der die geistige Anlage und die Charakterstärke bereits besitzt. Ohne die Grundlagen, die die Beherrschung der wissenschaftlichen Technik und des wissenschaftlichen Schrifttums bietet, kann wohl nichts vollbracht werden; aber das Entscheidende bleibt doch die Persönlichkeit.
Hierüber sind die Meinungen nicht mehr geteilt. Wir haben dabei nicht länger zu verweilen.
Ganz anders ist es um das logische Problem bestellt. Die Frage nach dem logischen Charakter der Soziologie ist im Verlaufe des Methodenstreits in den Hintergrund getreten, sie ist schließlich ganz fallen gelassen worden. In den ersten Jahren des Methodenstreits war das anders. Da haben gegen die grundsätzliche Ablehnung jeder theoretischen Wissenschaft vom menschlichen Handeln zuerst WALTER BAGEHOT und dann CARL MENGER das Wesen und die logische Notwendigkeit theoretischer Sozialwissenschaft auseinandergesetzt. Wie dieser Streit im Deutschen Reiche ausging, ist bekannt. Die Nationalökonomie verschwand von den Kathedern und an ihrer Stelle, mitunter auch unter ihrem Namen, wurden »wirtschaftliche Staatwissenschaften« getrieben, eine enzyklopädische Sammlung von Kenntnissen aus dem Gebiete verschiedener Fächer. Wer sie wissenschaftlich bestimmen wollte, faßte sie als eine bis in die allerjüngste Vergangenheit fortgeführte Geschichte der Staatsverwaltung, der Wirtschaft und der Wirtschaftspolitik auf, aus der man sich, unter Festhalten an den von der Obrigkeit und von den politischen Parteien gegebenen Wertmaßstäben, praktische Regeln für die künftige Wirtschaftspolitik ähnlich abzuleiten mühte, wie die Militärschriftsteller [69] aus der Beschäftigung mit den Feldzügen der Vergangenheit Regeln für kommende Kriege zu finden suchten. Von den als Historiker abgestempelten Gelehrten unterschied sich der Vertreter der wirtschaftlichen Staatswissenschaften im allgemeinen dadurch, daß er sich gewöhnlich mehr mit der jüngsten Vergangenheit und mehr mit den Problemen der inneren Politik, der Finanzen und der Wirtschaftspolitik beschäftigte, daß er weniger darauf bedacht war, seine politische Stellungnahme zu verbergen, und daß er unbedenklicher aus der Vergangenheit Nutzanwendungen auf die Politik der Zukunft zu ziehen pflegte. Der logische Charakter seiner Arbeit wurde ihm kaum jemals zum Problem; geschah es doch, dann beruhigte er sich bald mit der von SCHMOLLER ausgegebenen Parole.
Unruhe brachte erst der Streit um das Werturteil, der im zweiten und dritten Lustrum des 20. Jahrhunderts losbrach. Man begann an der naiven Selbstverständlichkeit, mit der politische Forderungen in Vorlesungen, Lehrbüchern und Monographien als Postulate der Wissenschaft vorgetragen wurden, Anstoß zu nehmen. Eine Gruppe jüngerer Professoren verlangte, daß die Weltanschauung des Lehrers auf den Inhalt seines Lehrvortrags keinen Einfluß nehmen soll, oder daß zumindest der Lehrer, sobald er seine persönlichen Werturteile vorbringt, auf den subjektiven Charakter des Vorgetragenen ausdrücklich hinweise. Die Erörterungen, die sich an diesen Aufruhr knüpften, haben jedoch das Problem der Möglichkeit einer theoretischen Sozialwissenschaft kaum berührt [87].
II. Der logische Charakter der Geschichtswissenschaft.
Mittlerweile hatte sich, ganz abseits von allem, was mit dem logischen Problemkreis »Soziologie und Geschichte« zusammenhängt, ein wichtiger Fortschritt der Logik der Geisteswissenschaften vollzogen.
Man hatte schon lange die Forderung aufgestellt, die Geschichte müsse dadurch zu einer echten Wissenschaft erhoben werden, daß [70] man endlich damit beginne, sie naturwissenschaftlich, d. h. als Gesetzeswissenschaft, zu betreiben [88]. Die einen erklärten dieses Verlangen als unerfüllbar, weil sie keinen Weg sahen, wie man zu historischen Gesetzen gelangen könnte; von der Überzeugung durchdrungen, daß nur Gesetzeswissenschaften beanspruchen könnten, den Namen Wissenschaft zu tragen, gaben sie wehmutsvoll zu, daß die Geschichte keine Wissenschaft sei. (Manche wollten sie darum eine Kunst nennen.) Die anderen wieder schrieben sich die Kraft zu, »Gesetze der Weltgeschichte« zu formulieren. Am fruchtbarsten erwies sich darin KURT BREYSIG.
Wohlgemerkt: Hier ging es nicht um das Problem einer theoretischen Wissenschaft vom menschlichen Handeln. Was man anstrebte, waren Gesetze der geschichtlichen Entwicklung, waren Gesetze der Geschichte, nicht Gesetze der Soziologie. So lautet z. B. das 31. der BREYSIGschen Gesetze: »Die Volkswirtschaft muß unter der Kaiserund ihr gleich entwickelter Volksherrschaft zu einem bis dahin unerhörten Aufschwung im Handel und Gewerbe fortschreiten« [89].
Gegen die Verwirrung der Begriffe, die dieser Forderung nach einer neuen Geschichtswissenschaft zugrunde lag, traten in Frankreich BERGSON und in Deutschland WINDELBAND, RICKERT und MAX WEBER auf. Sie haben das Wesen der Geschichte und der Geschichtsforschung logisch zu bestimmen und die Unübertragbarkeit der Begriffsbildung der Physik auf die Geschichte aufzuzeigen gesucht. Die südwestdeutsche Schule des Neukritizismus hat damit ohne Zweifel eine Leistung vollbracht, die ungeachtet der ihr anhaftenden Mängel höchster Anerkennung wert ist und Grundlage und Ausgangspunkt aller weiteren Untersuchungen über die Logik der Geschichte bilden muß. Doch diese Leistung ist in einem Punkt durchaus unzulänglich: sie kennt das Problem soziologischer Wissenschaft überhaupt nicht und schenkt ihm darum keine Beachtung. WINDELBAND, RICKERT und MAX WEBER haben Naturwissenschaften und Geschichte gekannt; daß es Soziologie als Gesetzeswissenschaft gibt, ist ihnen fremd geblieben [90].
[71]
Diese Behauptung bedarf, soweit sie MAX WEBER betrifft, einer eingehenderen Begründung. MAX WEBER war doch Lehrer der Nationalökonomie an zwei Universitäten und an zwei anderen Lehrer der Soziologie. Dennoch war er weder Nationalökonom noch Soziologe, sondern Historiker [91]. Er hat das Lehrgebäude der nationalökonomischen Theorie nicht gekannt. Nationalökonomie und Soziologie waren in seinen Augen historische Wissenschaften. Soziologie ist für ihn so etwas wie eine stärker generalisierende und zusammenfassende Geschichte.
In dieser Feststellung liegt, wie kaum noch hervorgehoben werden muß, kein Versuch, MAX WEBER und sein Werk herabzusetzen. MAX WEBER war wohl eine der glänzendsten Erscheinungen, die die deutsche Wissenschaft des 20. Jahrhunderts aufzuweisen hat. Er war ein Bahnbrecher und Wegbereiter, und kommende Geschlechter werden genug damit zu tun haben, sich sein Erbe geistig zu eigen zu machen, es zu verarbeiten und auszugestalten. Daß er Historiker und Logiker der Geschichtswissenschaft war und nicht Nationalökonom und Soziologe, soll nicht besagen, daß er gegenüber den Aufgaben, die die Zeit gestellt und er zu bearbeiten übernommen hat, versagt hätte. Sein Gebiet war eben das der Geschichte, und auf diesem hat er sein Teil geleistet. Und endlich: wenn es heute möglich ist, an die logischen Probleme der Soziologie mit besserer Ausrüstung heranzutreten, so ist dies in erster Linie der Arbeit zu danken, die MAX WEBER den logischen Problemen der Geschichtswissenschaft gewidmet hat.
III. Idealtypus und soziologisches Gesetz.
Als »Ausgangspunkt des sozialwissenschaftlichen Interesses« erscheint MAX WEBER »die wirkliche, also individuelle Gestaltung des uns umgebenden sozialen Kulturlebens in seinem universellen, aber deshalb nicht minder individuell gestalteten Zusammenhange und in seinem Gewordensein aus anderen, selbstverständlich wiederum individuell gearteten, sozialen Kulturzuständen heraus« [92]. Wo immer aber »die kausale Erklärung einer ‚Kulturerscheinung’ eines ‚historischen Individuums’, . . . in Betracht kommt, da kann 172.[72] die Kenntnis von Gesetzen der Verursachung nicht Zweck, sondern nur Mittel der Untersuchung sein. Sie erleichtert und ermöglicht uns die kausale Zurechnung der in ihrer Individualität kulturbedeutsamen Bestandteile der Erscheinungen zu ihren konkreten Ursachen. Soweit und nur insoweit sie dies leistet, ist sie für die Erkenntnis individueller Zusammenhänge wertvoll. Und je ‚allgemeiner’, d. h. abstrakter, die Gesetze, desto weniger leisten sie für die Bedürfnisse der kausalen Zurechnung individueller Erscheinungen und damit indirekt für das Verständnis der Bedeutung der Kulturvorgänge« [93]. MAX WEBER stellt »Historiker und Sozialforscher« in eine Reihe; beider Aufgabe ist »Erkenntnis der Kulturwirklichkeit« [94]. Darum ist ihm auch das logische und methodologische Problem in Soziologie und Geschichte das gleiche; es lautet: »welches ist die logische Funktion und Struktur der Begriffe, mit der unsere, wie jede, Wissenschaft arbeitet, oder spezieller mit Rücksicht auf das entscheidende Problem gewendet: welches ist die Bedeutung der Theorie und der theoretischen Begriffsbildung für die Erkenntnis der Kulturwirklichkeit« [95].
MAX WEBER beantwortet diese Frage dahin, daß er »in der abstrakten Wirtschaftstheorie« einen »Spezialfall einer Form der Begriffsbildung, welche den Wissenschaften von der menschlichen Kultur eigentümlich und in gewissem Umfange unentbehrlich ist«, erkennt; wir hätten hier »ein Beispiel jener Synthesen vor uns, welche man als Ideen historischer Erscheinungen zu bezeichnen pflegt« [96]. Es ist das die Schaffung eines »Gedankenbildes«, das »bestimmte Beziehungen und Vorgänge des historischen Lebens zu einem in sich widerspruchslosen Kosmos gedachter Zusammenhänge« vereinigt. Wir veranschaulichen uns die Eigenart dieses Zusammenhangs pragmatisch, indem wir einen »Idealtypus« konstruieren [97]. Der Idealtypus »wird gewonnen durch einseitige Steigerung eines oder einiger Gesichtspunkte und durch Zusammenschluß einer Fülle von diffus und diskret, hier mehr, dort weniger, stellenweise gar nicht, vorhandenen Einzelerscheinungen, die sich jenen einseitig herausgehobenen Gesichtspunkten fügen, zu einem in sich einheitlichen Gedankenbilde« [98]. Für MAX WEBER steht mithin »die abstrakte Wirtschaftstheorie«, [73] die, seiner Auffassung nach, »ein Idealbild der Vorgänge auf dem Gütermarkt bei tauschwirtschaftlicher Gesellschaftsorganisation, freier Konkurrenz und streng rationalem Handeln« bietet [99] , logisch in einer Linie mit »der Idee der ‚Stadtwirtschaft’ des Mittelalters« oder mit der »Idee des Handwerks« [100] oder mit Begriffen »wie etwa: Individualismus, Imperialismus, Merkantilismus, konventionell und zahllosen Begriffsbildungen ähnlicher Art, mittels deren wir uns der Wirklichkeit denkend und verstehend zu bemächtigen suchen« [101]. Man könne diese Begriffe nicht »ihrem Inhalt nach durch ‚voraussetzungslose’ Beschreibung irgendeiner konkreten Erscheinung oder aber durch abstrahierende Zusammenfassung dessen, was mehreren konkreten Erscheinungen gemeinsam ist«, bestimmen [102]. Sie seien Formen des »Idealtypus«, der der Geschichte und der Soziologie, kurz aller Kulturwissenschaft, eigentümlichen Art der Begriffsbildung.
Soziologie und Geschichte sind aber auch in WEBERs Auffassung nicht identisch. Die Soziologie »bildet Typenbegriffe und sucht generelle Regeln des Geschehens«, wogegen die Geschichte »die kausale Analyse und Zurechnung individueller, kulturwichtiger Handlungen, Gebilde, Persönlichkeiten erstrebt . . . Wie bei jeder generalisierenden Wissenschaft bedingt die Eigenart ihrer Abstraktionen es, daß ihre Begriffe relativ inhaltsleer sein müssen. Was sie dafür zu bieten hat, ist gesteigerte Eindeutigkeit der Begriffe. Diese gesteigerte Eindeutigkeit wird durch ein möglichstes Optimum von Sinnadäquanz erreicht, wie es die soziologische Begriffsbildung erstrebt« [103]. Der Unterschied zwischen Soziologie und Geschichte ist mithin ein Gradunterschied. Das Erkenntnisobjekt ist bei beiden identisch, beide arbeiten mit derselben Art logischer Begriffsbildung; sie sind nur durch den Grad der Wirklichkeitsnähe, der Inhaltsfülle und der Reinheit ihrer idealtypischen Konstruktionen verschieden. MAX WEBER hat mithin die Frage, die einst den Inhalt des Methodenstreites gebildet hatte, implizite ganz im Sinne jener beantwortet, die das logische Recht der theoretischen Sozialwissenschaft bestritten haben; sozialwissenschaftliche Forschung ist ihm nur als besonders qualifizierte Art historischer Forschung logisch denkbar. Doch die Theorie, die er kennt und ablehnt, ist nicht die, die [74] WALTER BAGEHOT und CARL MENGER im Auge hatten, als sie gegen die Wissenschaftslehre der historischen Schule der Volkswirte auftraten. Das, woran MAX WEBER denkt, ist etwas ganz anderes. Er will uns beweisen »die Sinnlosigkeit des selbst die Historiker unseres Faches gelegentlich beherrschenden Gedankens, daß es das, wenn auch noch so ferne, Ziel der Kulturwissenschaften sein könne, ein geschlossenes System von Begriffen zu bilden, in dem die Wirklichkeit in einer in irgendeinem Sinne endgültigen Gliederung zusammengefaßt und aus dem heraus sie dann wieder deduziert werden könnte« [104]. Ihm erscheint nichts gefährlicher als »die,naturalistischen’ Vorurteilen entstammende Vermischung von Theorie und Geschichte, sei es in der Form, daß man glaubt, in jenen theoretischen Begriffsbildern [105] den ‚eigentlichen’ Gehalt, das,Wesen’ der geschichtlichen Wirklichkeit fixiert zu haben, oder daß man sie als ein Prokrustesbett benützt, in welches die Geschichte hineingezwängt werden soll, oder daß man gar die ‚Ideen’ als eine hinter der Flucht der Erscheinungen stehende ‚eigentliche’ Wirklichkeit, als reale ‚Kräfte’ hypostasiert, die sich in der Geschichte auswirken« [106].
Soweit MAX WEBER die logisch-begriffliche Gestalt der geschichtswissenschaftlichen Forschung zu bestimmen sucht, soweit er das Bemühen, »historische Gesetze« aufzustellen, ablehnt und soweit er, in WINDELBANDs und RICKERTs Bahnen wandelnd, die Unanwendbarkeit der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung auf das Gebiet des Geschichtlichen darlegt, kann man ihm ohne weiteres beipflichten. In allen diesen Dingen hat er, das Werk seiner Vorgänger fortführend und vollendend, der Logik und der Wissenschaftslehre Unvergängliches gegeben [107]. Wo er aber, darüber hinausgehend, versucht hat, das Wesen soziologischer Forschung zu bestimmen, ist er fehlgegangen und mußte fehlgehen, weil er eben unter Soziologie etwas ganz anderes verstanden hat als die Gesetzeswissenschaft vom [75] menschlichen Handeln, deren Möglichkeit den Gegenstand des Methodenstreits gebildet hatte. Daß und warum MAX WEBER diesem Irrtum verfallen ist, kann man aus seinem persönlichen Werdegang und aus dem Stande, auf dem die Kenntnis der Ergebnisse soziologischer Forschung sich zu seiner Zeit im Deutschen Reiche und besonders an den Universitäten des Reiches befand, wohl verstehen und erklären. Damit mögen sich Dogmenhistoriker befassen. Was uns am Herzen liegt, ist allein die Berichtigung der Mißverständnisse, die zwar MAX WEBER nicht ihren Ursprung verdanken, wohl aber dadurch, daß WEBER sie zur Grundlage seiner Wissenschaftslehre gemacht hat, weite Verbreitung gefunden haben [108]. Man kann die Wurzel der WEBERschen Irrtümer nicht anders aufdecken als durch Untersuchung der Frage, ob die Begriffe der nationalökonomischen Theorie tatsächlich den logischen Charakter des »Idealtypus« tragen. Diese Frage ist schlechthin mit nein zu beantworten. Wohl gilt auch von den Begriffen unserer Theorie, daß sie in ihrer »begrifflichen Reinheit . . . nirgends in der Wirklichkeit empirisch vorfindbar« sind [109]. Begriffe finden sich eben niemals und nirgends in der Wirklichkeit, sie gehören dem Bereiche des Denkens und nicht dem der Wirklichkeit an; sie sind das geistige Mittel, mit dessen Hilfe wir die Wirklichkeit denkend zu erfassen suchen. Doch man kann von diesen Begriffen der nationalökonomischen Theorie nicht aussagen, daß sie gewonnen werden »durch einseitige Steigerung eines oder einiger Gesichtspunkte und durch Zusammenschluß einer Fülle von diffus und diskret, hier mehr, dort weniger, stellenweise gar nicht vorhandenen Einzelerscheinungen, die sich jenen einseitig herausgehobenen Gesichtspunkten fügen, zu einem in sich einheitlichen Gedankenbild«. Sie werden vielmehr durch Denkakte gewonnen, die darauf ausgehen, das in jeder der in Betracht gezogenen Einzelerscheinungen Enthaltene zu erfassen. Ob diese Absicht durch die Aufstellung dieses [76] oder jenes Begriffes oder Satzes auch wirklich in logisch einwandfreier und die Wirklichkeit richtig erfassender Weise gelungen ist, das zu entscheiden gehört zu den eigentlichen Aufgaben der Wissenschaft, um deren logischen Charakter der Streit geht. Was uns hier interessieren kann, ist nicht die Frage nach dem materiellen Wahrheitsgehalt der einzelnen Begriffe und Sätze und des sie zu einem System verknüpfenden Gedankenbaues, sondern die Frage, ob die Aufstellung solcher Sätze logisch zulässig und für die Erreichung der Ziele, die wir der Wissenschaft setzen, zweckmäßig oder gar notwendig ist.
Das menschliche Handeln, das den Gegenstand aller gesellschaftswissenschaftlichen Forschung, der historischen sowohl als auch der theoretischen bildet, hat einen Tatbestand zur Voraussetzung, den wir in der GOTTLschen Formulierung bestimmen wollen, weil MAX WEBER sich gegen sie m. E. mit mangelhafter Begründung gewendet hat. GOTTL bezeichnet als das eine der zwei »Grundverhältnisse«, die über unserem Handeln walten, die »Not«, worunter er den Umstand versteht, »daß sich nie ein Streben erfüllen läßt, ohne dem Erfolge anderer Streben in irgendeiner Weise Abbruch zu tun« [110]. Nun meint MAX WEBER, daß dem Tatbestande dieses Grundverhältnisses die Ausnahmslosigkeit fehle. Es sei nicht wahr, daß »die Kollision und also die Notwendigkeit der Wahl zwischen mehreren Zwecken ein unbedingt gültiger Tatbestand ist« [111]. Dieser Einwand MAX WEBERs ist jedoch nur soweit richtig, als es auch »freie Güter« gibt; doch soweit er richtig ist, wird eben nicht »gehandelt«. Wären alle Güter »freie Güter«, dann würde der Mensch nur mit seinem persönlichen Wirken, d. i. mit dem Einsatz seiner persönlichen Kräfte und seiner dahinfließenden Lebenszeit, haushalten; mit den Dingen der Außenwelt würde er achtlos umgehen [112]. Nur in einem von unsterblichen und dem Ablauf der Zeit gegenüber gleichgültigen Menschen bevölkerten Schlaraffenlande, in dem jeder Mensch immer und überall voll befriedigt und genußgesättigt ist, oder in einer Welt, in der durch nichts eine bessere Befriedigung und Sättigung erreicht [77] werden kann, würde es den Tatbestand der GOTTLschen »Not« nicht geben. Nur soweit sie gegeben ist, wird gehandelt; soweit sie fehlt, fehlt auch das Handeln.
Hat man das einmal erkannt, so erkennt man auch ohne weiteres, daß jedes Handeln eine Entscheidung zwischen verschiedenen Möglichkeiten bedeutet; alles Handeln ist Wirtschaften mit den Mitteln, die zur Verwirklichung erreichbarer Ziele zu Gebote stehen. Das Grundgesetz des Handelns ist das wirtschaftliche Prinzip; unter seiner Herrschaft steht alles Handeln. Wer die Möglichkeit nationalökonomischer Wissenschaft leugnen will, muß damit beginnen, dem wirtschaftlichen Prinzip seine Stellung als allgemeingültige Aussage über das Wesen alles Handelns streitig zu machen. Das aber kann nur tun, wer das Prinzip ganz und gar mißverstanden hat.
Das gangbarste Mißverständnis besteht darin, daß man im wirtschaftlichen Prinzip eine Aussage über das Materielle und den Inhalt des Handelns erblickt. Man greift ins Psychologische hinüber, konstruiert den Begriff des Bedürfnisses und sucht dann die Spannung zwischen dem Bedürfnis, der Vorstellung eines Unlustgefühls, und der konkreten Entscheidung im Handeln. So wird das Bedürfnis zum Richter über das Handeln; man glaubt das richtige, der Bedürfnisgestaltung entsprechende, dem unrichtigen Handeln entgegenstellen zu können. Doch wir können das Bedürfnis nirgends erkennen als im Handeln [113]. Das Handeln ist immer den Bedürfnissen gemäß, weil wir nur aus dem Handeln auf das Bedürfnis zurückschließen. Was jemand über seine eigenen Bedürfnisse aussagt, ist immer nur Erörterung und Kritik vergangenen und künftigen Verhaltens; erst im Handeln und nur im Handeln wird das Bedürfnis existent. Bei dem, was wir über die Bedürfnisse anderer oder gar aller Menschen aussagen, ist es wohl jedermann klar, daß es nur zwei Möglichkeiten gibt: entweder festzustellen, wie gehandelt wurde oder voraussichtlich gehandelt werden wird, oder festzustellen, wie sie hätten handeln sollen oder wie sie in Zukunft handeln sollen.
Kein Mißverständnis kann daher fundamentaler sein als das des Historismus, wenn er im »Willen zur Wirtschaftlichkeit ein Glied einer späten Entwicklung« erblickt und einwirft, daß der »natürliche Mensch nicht in vollster Zweckmäßigkeit handelt« [114] , oder wenn er [78] das wirtschaftliche Prinzip als ein Spezifikum der geldwirtschaftlichen Produktion erklärt [115]. MAX SCHELER hat darauf die richtige Antwort erteilt, wenn er selbst auch von seinem Willen zu einer absoluten Rangbestimmung der Werte daran gehindert wurde, aus ihr die für die Ethik entscheidenden Schlußfolgerungen zu ziehen. »Daß das Angenehme«, meint er, »dem Unangenehmen vorgezogen wird (ceteris paribus), ist kein Satz, der auf Beobachtung und Induktion beruht; er liegt im Wesen dieser Werte und im Wesen des sinnlichen Fühlens. Würde uns z. B. ein Reisender, ein Historiker oder ein Zoologe eine Menschen- und Tierart beschreiben, bei der das Gegenteil der Fall wäre, so würden wir dem ‚a priori’ keinen Glauben schenken und zu schenken brauchen. Wir würden sagen: Dies ist ausgeschlossen, diese Wesen fühlen höchstens andere Dinge als angenehm und unangenehm wie wir; oder aber, sie ziehen nicht Unangenehmes dem Angenehmen vor, sondern es muß für sie ein (uns vielleicht unbekannter) Wert einer Modalität bestehen, die ‚höher’ ist als die Modalität dieser Stufe, und indem sie diesen Wert,vorziehen’, nehmen sie nur das Unangenehme auf sich; oder es liegt eine Perversion der Begierden vor, vermöge deren sie lebensschädliche Dinge als ‚angenehm’ erleben usw. Wie alle diese Zusammenhänge ist eben auch der, den unser Satz ausspricht, gleichzeitig ein Verständnisgesetz für fremde Lebensäußerungen und konkrete, z. B. historische Wertschätzungen (ja selbst der eigenen z. B. in der Erinnerung); und er ist daher bei allen Beobachtungen und Induktionen bereits vorausgesetzt. Er ist z. B. aller ethnologischen Erfahrung gegenüber ‚a priori’. Auch kann diesen Satz und seinen Tatbestand keine entwicklungstheoretische Betrachtung weiter,erklären’« [116]. Was SCHELER hier vom Angenehmen und Unangenehmen sagt, ist das Grundgesetz des menschlichen Handelns, das unabhängig von Ort, Zeit, Rasse u. dgl. gilt. Ersetzen wir in SCHELERs Ausführungen »angenehm« durch »subjektiv als wichtiger angesehen« und »unangenehme durch »subjektiv als minder wichtig angesehene, dann wird dies wohl noch deutlicher.
Der Historismus nimmt seine Aufgabe zu leicht, wenn er sich damit begnügt, einfach die Behauptung aufzustellen, daß die Qualität des menschlichen Handelns nicht überzeitlich sei und sich im Laufe der Entwicklung verändert habe. Man hätte doch, wenn man solche [79] Behauptungen vertritt, zumindest die Verpflichtung, anzugeben, worin sich das Handeln der vermeintlich vorrationalen Zeit von dem der rationalen unterschieden habe, wie etwa anders als rational gehandelt werden könnte oder hätte gehandelt werden können. Diese Verpflichtung hat nur MAX WEBER empfunden; ihm verdanken wir den einzigen Versuch, diese Grundthese des Historismus aus dem Bereich des feuilletonistischen Aperçus in den der wissenschaftlichen Betrachtung zu erheben.
MAX WEBER unterscheidet innerhalb des »sinnhaften Handelns« vier verschiedene Arten des Handelns. Das Handeln kann »bestimmt sein 1. zweckrational: durch Erwartungen des Verhaltens der Gegenstände der Außenwelt und von anderen Menschen und unter Benutzung dieser Erwartungen als ‚Bedingungen’ oder als ‚Mittel’ für rational, als Erfolg erstrebte und abgewogene eigene Zwecke, 2. wertrational: durch bewußten Glauben an den ethischen, ästhetischen, religiösen oder wie immer sonst zu deutenden unbedingten Eigenwert eines bestimmten Sichverhaltens rein als solchen und unabhängig vom Erfolg, 3. affektuell, insbesondere emotional: durch aktuelle Affekte und Gefühlslagen, 4. traditional: durch eingelebte Gewohnheit« [117]. Jenseits jeder Art von sinnhaftem Handeln steht »ein bloß reaktives, mit einem subjektiv gemeinten Sinn nicht verbundenes, Sichverhalten«; die Grenzen zwischen dem sinnhaften und dem bloß reaktiven Handeln sind flüssig [118].
Betrachten wir zunächst das, was MAX WEBER das bloß reaktive Verhalten nennt. Die Biologie und die Naturwissenschaften überhaupt können an das Verhalten der Objekte mit ihrer Betrachtung nur von außen herankommen; sie können daher nicht mehr feststellen als die Beziehung von Reiz und Reaktion; darüber hinaus heißt es für sie »ignorabimus«. Daß irgendwie das Verhalten des Gereizten so ähnlich zu erklären sein müßte wie rationales menschliches Handeln, mag der Naturforscher dunkel ahnen; es ist ihm aber nicht gegeben, in die Dinge tiefer hineinzusehen. Dem menschlichen Verhalten gegenüber ist aber unsere Stellung eine ganz andere; hier erfassen wir den Sinn, den, wie MAX WEBER sagt, vom »Handelnden subjektiv gemeinten Sinn«, der »nicht etwa ein objektiv,richtiger’ oder ein metaphysisch ergründeter ‚wahrer’ Sinn« ist [119]. Wo wir bei Tieren, denen wir [80] menschliche Vernunft nicht zuzutrauen vermögen, ein Verhalten beobachten, das wir zu erfassen in der Lage wären, wenn wir es als menschliches Verhalten beobachtet hätten, sprechen wir von instinktivem Verhalten.
Die Antwort des Menschen auf Reize kann entweder reaktiv oder sinnhaft oder sowohl reaktiv als auch sinnhaft sein. Auf die Zufuhr von Giftstoffen antwortet der Körper reaktiv, aber daneben kann auch das Handeln sinnhaft etwa durch Zufuhr von Gegengiften antworten; auf die Erhöhung der Marktpreise antwortet nur das sinnhafte Handeln. Die Grenzen zwischen sinnhaftem und reaktivem Verhalten sind für den Psychologen flüssig wie die zwischen Bewußtheit und Unbewußtheit; es mag aber sein, daß nur die Unvollkommenheit unseres Denkens uns hindert, zu erkennen, daß Reizreaktion und Handeln wesensgleich sind, und zwischen ihnen nur Gradverschiedenheit festzustellen.
Wenn wir von einem menschlichen Verhalten sagen, daß es bloß reaktiv, instinktiv, triebhaft sei, so meinen wir damit, daß es unbewußt vor sich geht. Man muß aber beachten, daß wir dort, wo wir es als unzweckmäßig erachten, uns so zu verhalten, sinnhaft darauf ausgehen, das bloß reaktive, instinktive, triebhafte Verhalten auszuschalten. Wenn meine Hand von einem scharfen Messer berührt wird, ziehe ich sie unwillkürlich zurück; soll aber etwa ein ärztlicher Eingriff vorgenommen werden, dann werde ich durch bewußtes Verhalten das reaktive zu überwinden trachten. Der bewußte Wille bemächtigt sich aller Gebiete unseres Verhaltens, die ihm überhaupt zugänglich sind, indem er hier nur jenes bloß reaktive, instinktive, triebhafte Handeln duldet, das er als zweckmäßig billigt und vollzogen haben will. Für die der Wissenschaft vom menschlichen Handeln angemessene Betrachtung, die eben anderes im Auge hat als die psychologische, ist somit die Grenze zwischen sinnhaftem und bloß reaktivem Verhalten durchaus nicht flüssig. Soweit der Wille wirksam zu werden vermag, gibt es nur sinnhaftes Handeln.
Das führt uns nun zur Prüfung der Verhaltensarten, die WEBER dem zweckrationalen Verhalten entgegenstellt. Zunächst ist es wohl klar, daß das, was WEBER das »wertrationale« Verhalten nennt, vom »zweckrationalen« nicht grundsätzlich geschieden werden darf. Auch die Erfolge, denen das zweckrationale Verhalten zustrebt, sind doch Werte und stehen als Werte jenseits der Rationalität; sie haben, um den Ausdruck WEBERs zu verwenden, »unbedingten Eigenwert«; das [81] zweckrationale Handeln ist »nur in seinen Mitteln zweckrational« [120]. Das, was WEBER das wertrationale Verhalten nennt, unterscheidet sich vom zweckrationalen nur darin, daß es auch ein bestimmtes Sichverhalten als Wert ansieht und demgemäß in die Rangordnung der Werte einstellt. Wenn jemand nicht nur überhaupt seinen Lebensunterhalt verdienen will, sondern auch auf »anständige« und »standesgemäße« Weise, also etwa als preußischer Junker älteren Schlages die Verwaltungslaufbahn der Anwaltschaft vorzog, oder wenn jemand auf die Vorteile, die die Beamtenkarriere bietet, verzichtet, weil er seine politische Überzeugung nicht aufgeben will, so liegt darin keineswegs ein Verhalten, das man als nicht zweckrational bezeichnen kann; das Festhalten an überkommenen Lebensauffassungen oder an der politischen Überzeugung ist ein Zweck wie jeder andere und geht wie jeder andere Zweck in die Rangordnung der Werte ein. WEBER verfiel hier eben in das alte Mißverständnis, dem die utilitarische Grundidee immer wieder verfällt: nämlich unter »Zweck« nur materielle und in Geld ausdrückbare Werte zu verstehen. Wenn WEBER glaubt, »rein wertrational« handle, »wer ohne Rücksicht auf die vorauszusehenden Folgen handelt im Dienst seiner Überzeugung von dem, was Pflicht, Würde, Schönheit, religiöse Weisung, Pietät, oder die Wichtigkeit einer ‚Sache’ gleichviel welcher Art ihm zu gebieten scheinen« [121] , so drückt er den Tatbestand in unzweckmäßiger Weise aus. Richtiger wäre, zu sagen, daß es Menschen gibt, die Pflicht, Würde, Schönheit u. dgl. m. so hoch stellen, daß sie dahinter andere Ziele und Zwecke zurückstellen. Dann erkennt man aber unschwer, daß es sich hier wohl um andere Zwecke handelt als die, denen die Masse zustrebt, daß es aber immerhin doch Zwecke sind und daß daher ein auf ihre Verwirklichung gerichtetes Verhalten gleichfalls als zweckrational bezeichnet werden muß.
Nicht anders steht es mit dem traditionalen Verhalten. Wenn der Bauer dem Agrikulturchemiker, der ihm die Verwendung von Kunstdünger empfiehlt, die Antwort gibt, er lasse sich von einem Städter, der doch unmöglich von Landwirtschaft etwas verstehen könne, in seine Wirtschaft nicht dreinreden; er wolle weiter so vorgehen, wie es seit altersher im Dorfe Brauch gewesen sei, wie sein Großvater und sein Vater, tüchtige Landwirte, es ihn gelehrt hätten und wie es sich bisher immer bewährt habe, so heißt das, daß er am überkommenen Verfahren festhalten will, weil er es für das bessere ansieht. Wenn der [82] hochadelige Großgrundbesitzer den Vorschlag seines Domänendirektors, die in den Einzelhandel gelangenden Butterpakete mit seinem Namen, Titel und Wappen zu kennzeichnen, mit der Begründung zurückweist, daß solches nicht dem adeligen Herkommen entspreche, dann heißt das: ich will auf eine Mehrung meiner Einnahmen verzichten, die ich nur unter Aufopferung eines Stückes meiner Würde erlangen könnte. In dem einen Falle wird die eingelebte Gewohnheit beibehalten, weil man sie ob mit oder ohne Berechtigung, ist für uns gleichgültig für »rationeller« hält, in dem zweiten Falle, weil man ihr einen Wert beilegt, den man über den Wert dessen, was durch ihre Aufopferung erreicht werden könnte, stellt.
Schließlich noch das »affektuelle« Verhalten. Im Affekt verschiebt sich die Rangordnung der Zwecke, man beurteilt sie anders als später bei kühler Erwägung der Dinge und gibt einer Gefühlsaufwallung, die sofortige Befriedigung heischt, leichter nach. Wer einem Ertrinkenden mit Gefahr des eigenen Lebens zu Hilfe eilt, kann es tun, weil er der augenblicklichen Regung, Hilfe zu leisten, nachgibt, oder weil er die Verpflichtung empfindet, sich unter solchen Umständen als Held zu bewähren, oder weil er die Lebensrettungsprämie verdienen will. In jedem Falle ist sein Handeln dadurch bedingt, daß er im Augenblicke den Wert des Zuhilfekommens so hoch stellt, daß andere Rücksichten auf das eigene Leben, auf das Schicksal der eigenen Familie u. dgl. m. zurückstehen; es mag sein, daß eine nachträgliche Überprüfung ihn dann zu einem anderen Ergebnisse führt. Doch im Augenblicke und nur darauf kommt es an -war auch dieses Verhalten »zweckrational«.
Die Unterscheidung, die MAX WEBER innerhalb des sinnhaften Verhaltens zieht, wenn er das zweckrationale Verhalten und das nicht zweckrationale Verhalten auseinanderzuhalten sucht, kann mithin nicht aufrechterhalten werden. Alles, was wir als menschliches Verhalten ansehen können, weil es über das bloß reaktive Verhalten der Organe des menschlichen Körpers hinausgeht, ist zweckrational, wählt zwischen gegebenen Möglichkeiten, um das am sehnlichsten erwünschte Ziel zu erreichen. Eine andere Auffassung ist für eine Wissenschaft, die das Handeln als solches, nicht aber die Beschaffenheit seiner Ziele ins Auge fassen will, nicht zu brauchen.
MAX WEBERS fundamentaler Irrtum liegt in der Verkennung des Anspruches auf ausnahmslose Geltung, mit der der soziologische Satz auftritt. Das wirtschaftliche Prinzip, die Grundgesetze der Bildung der Austauschverhältnisse, das Ertragsgesetz, das Bevölkerungsgesetz [83] und alle anderen Sätze gelten immer und überall, wo die von ihnen vorausgesetzten Bedingungen gegeben sind.
MAX WEBER nennt wiederholt als Beispiel eines nationalökonomischen Satzes das GRESHAMsche Gesetz, wobei er es nicht unterläßt, das Wort »Gesetz« unter Anführungszeichen zu setzen, um zu zeigen, daß es sich bei diesem Lehrsatze wie bei anderen der verstehenden Soziologie nur um »durch Beobachtung erhärtete typische Chancen eines bei Vorliegen gewisser Tatbestände zu gewärtigenden Ablaufes von sozialem Handeln, welche aus typischen Motiven und typisch gemeintem Sinn der Handelnden verständlich sind« handelt [122]. Dieses »sog. ‚GRESHAMsche Gesetz’« sei »eine rational evidente Deutung menschlichen Handelns bei gegebenen Bedingungen und unter der idealtypischen Voraussetzung rein zweckrationalen Handelns. Inwieweit tatsächlich ihm entsprechend gehandelt wird, kann nur die (letztlich im Prinzip irgendwie statistisch` auszudrückende) Erfahrung über das tatsächliche Verschwinden der jeweils in der Geldverfassung zu niedrig bewerteten Münzsorten aus dem Verkehr lehren; sie lehrt tatsächlich eine sehr weitgehende Gültigkeit« [123]. Das GRESHAMsche Gesetz das übrigens schon von ARISTOPHANES in den Fröschen erwähnt und, von NICOLAUS ORESMIUS (1364) klar ausgesprochen, erst 1858 von MACLEOD nach Sir THOMAS GRESHAM benannt wurde ist eine besondere Anwendung der allgemeinen Theorie der Preistaxen auf die Verhältnisse des Geldes [124]. Das Wesentliche, von dem es handelt, ist nicht das »Verschwinden« des »guten« Geldes, sondern das, daß Zahlungen, die nach Wahl des Schuldners mit gleicher Rechtswirkung in »gutem« oder in »schlechtem« Gelde geleistet werden können, in dem durch die Obrigkeit zu niedrig bewerteten Geld geleistet werden. Es geht nicht an, zu behaupten, daß das »unter der idealtypischen Voraussetzung rein zweckrationalen Handelns« immer der Fall ist, selbst dann nicht, wenn man, wie es MAX WEBER offenbar vorschwebt, zweckrational als synonym mit »auf höchsten Geldgewinn abzielend« gebraucht. Vor kurzem ist ein Fall berichtet worden, in dem das GRESHAMsche Gesetz »ausgeschaltet« war. Eine Anzahl österreichischer Unternehmer besuchte Moskau und wurde von den russischen Machthabern, die sie zur Gewährung langfristiger Warenkredite an die Sowjetunion veranlassen wollten, nach der alten Methode mit der [84] Lage Rußlands bekannt gemacht, die schon Fürst POTEMKIN seiner Souveränin gegenüber angewendet hatte. Man führte die Herren auch in ein Warenhaus, wo sie die Gelegenheit wahrnahmen, kleine Reiseandenken und Geschenke für ihre Freunde in der Heimat zu erwerben. Als der eine der Reisenden mit einer größeren Banknote bezahlte, bekam er auch ein Goldstück heraus. Auf seine erstaunte Bemerkung, er hätte nicht gewußt, daß Goldmünzen in Rußland effektiv zirkulieren, antwortete der Kassier, es käme doch mitunter vor, daß Käufer in Gold zahlen, und dann behandle er die Goldstücke wie jede andere Geldart und gebe sie geradeso wieder aus. Der Österreicher, der offenbar nicht »wundergläubig« war, beruhigte sich bei der Antwort nicht, ging der Sache weiter nach, und es gelang ihm schließlich zu erfahren, daß eine Stunde vor dem Besuche der Reisegesellschaft ein Regierungsbeamter im Warenhause erschienen war, dem Kassier ein Goldstück übergab und ihm auftrug, dieses eine Goldstück einem der Fremden beim Herausgeben unauffällig al pari einzuhändigen. Gesetzt, der Vorfall hätte sich wirklich so abgespielt, dann kann man dem Verhalten der Sowjetbehörde durchaus nicht die »reine Zweckrationalität« absprechen. Die Kosten, die ihr daraus erwuchsen sie sind durch das Goldagio gegeben erschienen ihr durch den Zweck – Gewinnung langfristiger Warenkredite gerechtfertigt. Ich wüßte nicht, was sonst »zweckrational« wäre, wenn solches Verhalten es nicht ist.
Wenn die Bedingungen, die das GRESHAMsche Gesetz voraussetzt, nicht gegeben sind, dann wird auch nicht so gehandelt, wie das Gesetz es beschreibt. Wenn der Handelnde die von der gesetzlichen Tarifierung abweichende Marktbewertung nicht kennt, oder wenn er nicht weiß, daß er zur Zahlung in der vom Markte niedriger bewerteten Geldart berechtigt ist, oder wenn er einen anderen Grund hat, dem Gläubiger mehr zu geben als ihm gebührt, etwa weil er ihm schenken will oder weil er Gewalttätigkeiten des Gläubigers fürchtet, dann treffen die Voraussetzungen des Gesetzes nicht zu. Daß diese Voraussetzungen für die Masse der Gläubiger-Schuldner Beziehungen zutreffen, lehrt die Erfahrung. Doch auch wenn die Erfahrung zeigen würde, daß die vorausgesetzten Bedingungen in einer größeren Anzahl von Fällen nicht gegeben sind, könnte das die Gedankengänge, die zur Aufstellung des Gesetzes führen, nicht erschüttern und dem Gesetz die ihm zukommende Bedeutung nicht nehmen. Ob nun aber die Bedingungen, die das Gesetz voraussetzt, gegeben sind oder nicht, und ob demgemäß so gehandelt wird, wie das Gesetz es beschreibt, oder nicht, in jedem Falle wird »rein zweckrational« gehandelt. Auch [85] wer schenkt oder wer der Drohung eines Erpressers weicht, handelt rein zweckrational, und ebenso der, der aus Unkenntnis anders handelt, als er besser unterrichtet handeln würde.
Die Gesetze der Katallaktik, deren Anwendung auf einen besonderen Fall das GRESHAMsche Gesetz darstellt, gelten ausnahmslos immer und überall, wo Tauschakte gesetzt werden. Faßt man sie in der unvollkommenen und unexakten Weise, daß man nur auf unmittelbaren und nächstliegenden Geldvorteil Rücksicht nimmt so etwa wie: man sucht so billig als möglich zu kaufen und seine Schulden zu tilgen, man sucht so teuer als möglich zu verkaufen -, dann muß man sie freilich noch durch eine Reihe von weiteren Sätzen ergänzen, wenn man etwa eine Erscheinung wie die Preise der zum Anlocken der Käufer besonders billig ausgebotenen Reklameartikel der Warenhäuser erklären will. Niemand wird aber doch bestreiten können, daß die Warenhäuser in diesem Fall auf Grund kühler Erwägung »rein zweckrational« vorgehen.
Wenn ich nur einfach Seife kaufen will, dann werde ich in vielen Kaufläden nach dem Preise fragen und dann im billigsten kaufen. Wenn ich Mühe und Zeitverlust, die solches Herumsuchen erfordert, für so lästig halte, daß ich lieber um einige Groschen teuerer kaufe, dann werde ich, ohne viel herumzufragen, in den nächsten Laden gehen. Wenn ich mit dem Einkauf der Seife auch die Unterstützung eines armen Kriegsbeschädigten verbinden will, dann werde ich beim hausierenden Invaliden kaufen, obwohl das teuerer ist. In diesen Fällen müßte ich, wenn ich meine Ausgaben genau in mein Wirtschaftsbuch eintragen will, den Ankauf der Seife mit dem allgemeinen Ladenpreis eintragen und den Mehrbetrag das eine Mal als »für meine Bequemlichkeit«, das andere Mal als »Unterstützung« [125]. Die Gesetze der Katallaktik sind nicht unexakt, wie es die Formulierung, die ihnen manche Schriftsteller gegeben haben, vermuten ließe. Wenn wir den Sätzen der Katallaktik den Charakter der Allgemeingültigkeit und Objektivität zuschreiben, so ist hier Objektivität nicht nur im gewöhnlichen und eigentlichen erkenntnistheoretischen Sinne zu verstehen, sondern auch in dem Sinne des Freiseins von der Beimischung von Werturteilen, wie es in dem jüngsten Streite um das Werturteil selbstverständlich durchaus mit Recht für die Gesellschaftswissenschaft gefordert wurde. Dieser Forderung entspricht allein die subjektivistische Wertlehre, die jedes Werturteil, jede subjektive [86]Wertschätzung der Individuen in gleicher Weise zur Erklärung der Bildung der Austauschverhältnisse heranzieht und überhaupt keinen irgendwie gearteten Versuch unternimmt, das »normale« Handeln vom »nicht normalen« zu sondern. Die Werturteildiskussion hätte viel gewonnen, wenn ihre Teilnehmer mit der modernen Nationalökonomie vertraut gewesen wären und erfaßt hätten, in welcher Weise hier das Problem der Objektivität gelöst wurde.
Nur die Fremdheit, mit der die historisch-realistische Schule der Staatswissenschaften der modernen Nationalökonomie gegenübersteht, und der Umstand, daß sie, wenn von Nationalökonomie gesprochen wird, stets nur an die klassische Nationalökonomie denkt, erklären es, daß man den Lehren der Nationalökonomie den Charakter wissenschaftlicher »Gesetze« absprechen will und vorschlägt, lieber von »Tendenzen« zu sprechen. So meint, um die jüngste Äußerung dieser Richtung anzuführen, KARL MUHS, daß »reine und für sich abgeschlossene Kausalreihen derart, daß eine gegebene Tatsache eine andere dauernd und unbedingt zur Folge habe, im »Wirtschaftsleben niemals« auftreten. »Jede Kausalität ist in Wirklichkeit meist mit anderen, gleichfalls mehr oder minder intensiv als Ursache wirkenden Tatbeständen verbunden, welch letztere die Wirkungen jener meist in irgendeiner Richtung beeinflussen, das Ergebnis sich daher als Wirkung eines Ursachenkomplexes bildet. Die Reduktion des Gesamtvorganges auf eine einfache Formel, in der einer Ursache eine Wirkung zugesellt wird, verbietet sich dadurch, weil unvereinbar mit dem mehrseitigen Kausalaufbau des Prozesses. Wo bestimmte Tatsachen einen Vorgang weitgehend kausal beherrschen . . . spricht man zweckmäßiger von Regeloder Gesetzmäßigkeiten oder Tendenzen, doch stets mit dem Vorbehalt, daß die Durchsetzung solcher Tendenzen von anderen Kausalkräften gehemmt oder modifiziert werden kann.« Das sei »die Erkenntnis von der Bedingtheit und dem Relativismus aller ökonomischen und sozialen Gesetzmäßigkeiten«, die sich bereits seit langem in der Nationalökonomie eingebürgert hätte [126]. Man begreift die weite Verbreitung dieser und verwandter Ansichten, wenn man auf der einen Seite beachtet, wie nahe sie jedem liegen müssen, der die von der klassischen Nationalökonomie überkommene und anfangs, wenn auch gewiß nicht dem Sinne nach, so doch in der Ausdrucksweise von den Begründern der österreichischen Schule festgehaltene Unterscheidung zwischen wirtschaftlichen und nicht [87] wirtschaftlichen Preisbestimmungsgründen vor Augen hatte [127] , und wenn man auf der anderen Seite beachtet, daß wir es hier eben mit dem Grundirrtum der historisch-realistischen Staatswissenschaft zu tun haben. Jedes Kausalgesetz gleichviel in welcher Wissenschaft gibt uns Aufschluß über ein Verhältnis von Ursache und Wirkung. Diese Erkenntnis wird sowohl in ihrem theoretischen Wert für unser Wissen als auch in ihrer praktischen Bedeutung für das Verständnis konkreter Vorgänge und für die Regelung unseres Verhaltens in keiner Weise von dem Umstande beeinflußt, daß gleichzeitig ein anderes Kausalverhältnis zu dem entgegengesetzten Ergebnis führen kann, so daß die Wirkung des einen durch die Wirkung des anderen ganz oder zum Teile aufgehoben wird. Das pflegt man mitunter durch den übrigens selbstverständlichen Beisatz ceteris paribus auszudrücken. Das Ertragsgesetz verliert seinen Charakter als Gesetz nicht dadurch, daß z. B. Veränderungen der Technik eintreten, die seine Wirkung kompensieren. Die Berufung auf die Mannigfaltigkeit und Kompliziertheit des »Lebens« ist logisch unhaltbar. Auch der menschliche Körper lebt und seine Prozesse sind dem »mehrseitigen Kausalaufbau« unterworfen. Dennoch würde wohl niemand dem Satz, daß die Zufuhr von Eiweiß, Fett und Kohlehydraten die Lebensfunktionen des Körpers fördert, aus dem Grunde den Charakter eines Gesetzes absprechen wollen, weil bei gleichzeitiger Zufuhr von Blausäure der Tod eintreten muß [128].
Fassen wir es zusammen: Die Gesetze der Soziologie sind keine Idealtypen und keine Durchschnittstypen; sie sind vielmehr der Ausdruck dessen, was aus der Fülle und Mannigfaltigkeit der Erscheinungen vom Gesichtspunkte der auf die Erkenntnis des Ablaufes menschlichen Handelns gerichteten Wissenschaft als das Bleibende und jedem einzelnen Fall Notwendige herauszuheben ist. Die soziologischen Begriffe sind nicht Konstruktionen, die gewonnen werden »durch einseitige Steigerung eines oder einiger Gesichtspunkte und durch Zusammenschluß einer Fülle von diffus und diskret, hier mehr, dort weniger, stellenweise gar nicht, vorhandenen Einzelerscheinungen, die sich jenen einseitig herausgehobenen Gesichtspunkten fügen, [88] zu einem in sich einheitlichen Gedankenbilde«. Sie sind vielmehr die Zusammenfassung der Merkmale, die in jedem einzelnen Gegenstand, auf den sie sich beziehen, in derselben Weise zu finden sind. Die soziologischen Kausalsätze sind nicht der Ausdruck dessen, was in der Regel einzutreten pflegt, durchaus aber nicht immer eintreten muß, sondern ein Ausdruck dessen, was notwendigerweise immer eintreten muß, wofern die Bedingungen, die sie voraussetzen, gegeben sind.
IV Die Wurzel der Irrtümer über den logischen Charakter der Nationalökonomie.
Die nationalökonomische Theorie ist wie jede Theorie und jede Wissenschaft in dem Sinne rationalistisch, als sie mit den Mitteln der Vernunft ratio arbeitet. Wissenschaft ohne Vernunft, was könnte das wohl sein? Man mag immerhin metaphysische Begriffsdichtung gegen wissenschaftliche Kritik und Intuition gegen diskursives Denken auszuspielen suchen, doch das heißt eben die Wissenschaft als solche ablehnen.
Die Ablehnung der Wissenschaft, des wissenschaftlichen Denkens und mithin des Rationalismus ist keineswegs eine Forderung des Lebens, als die man sie ausgeben wollte; sie ist ein Postulat, das Eigenbrötler und Snobs, voll von Ressentiment gegen das Leben, ersonnen haben. Wohl kümmert sich das Weltkind nicht um die graue Theorie; doch die Ergebnisse der wissenschaftlichen Arbeit, die sich in Verbesserung der technischen Ausrüstung des Menschen im Kampfe um Hebung seines äußeren Reichtums umsetzen lassen, werden vom Leben gierig aufgenommen. Daß manche von denen, deren Erwerb die Wissenschaft ist, in dieser Beschäftigung keine innere Befriedigung zu finden vermögen, ist kein Argument für die Abschaffung der Wissenschaft.
Die Richtung, die sich in der Gesellschaftslehre, besonders in der Nationalökonomie, und in den historischen Wissenschaften um das Banner des Antirationalismus schart, will aber gar nicht die Wissenschaft abschaffen. Sie will in Wahrheit ganz anderes. Sie will einerseits in die einzelnen wissenschaftlichen Gedankengänge Argumente und Behauptungen einschmuggeln, die der Kritik nicht standhalten können, und andererseits wieder Sätze, denen sie kritisch nicht beizukommen vermag, ohne sachliche Kritik aus dem Wege räumen. Meist handelt es sich dabei um ein Entgegenkommen an die Absichten und Ideen von politischen Parteien; es ist aber nicht allzu selten, [89] daß einfach der Wunsch eines für wissenschaftliche Leistung Minderbegabten im Spiele ist, der um jeden Preis irgendwie auffallen möchte. Nicht jeder ist dabei so ehrlich, das wahre Motiv es sei kein Vergnügen, sein ganzes Leben im Schatten eines Größeren zu stehen offen zuzugeben [129].
Wenn jemand für nationale Autarkie eintritt, sein Volk vom Verkehr mit den übrigen Völkern abschließen will und bereit ist, alle materiellen und ideellen Folgen solcher Politik zu tragen, um das angestrebte Ziel zu erreichen, dann ist das eine Wertung, die man als solche mit Argumenten nicht zu widerlegen vermag. Doch so pflegen die Dinge eben nicht zu liegen. Die Massen könnten vielleicht bewogen werden, kleine Opfer zugunsten der Autarkie zu leisten, sie werden aber kaum jemals dafür zu haben sein, große Opfer für ein derartiges Ideal zu bringen. Es ist nun einmal so, daß nur die Literaten für Armut, nämlich für Armut der anderen, schwärmen, die übrigen Menschen aber Wohlstand der Not vorziehen. Da man nun mit dem Argument, die Erreichung dieses oder jenes Literatenideals sei auch um den Preis beträchtlicher Senkung des allgemeinen Wohlstandes nicht zu teuer erkauft, kaum mit Aussicht auf Erfolg vor die Öffentlichkeit treten kann, muß man zu beweisen suchen, daß die Erreichung nur unbeträchtliche oder gar keine materiellen Opfer auferlege, ja, daß sie selbst noch besonderen materiellen Gewinn bringe. Um solche Beweise zu führen, um zu beweisen, daß Beschränkung des Handels und des Verkehrs mit dem Auslande, daß Verstaatlichungen und Verstadtlichungen, daß selbst Kriege »überdies auch noch ein gutes Geschäft« sind, muß man in den Gedankengang irrationale Glieder einzufügen suchen, weil es eben nicht möglich ist, derartige Dinge mit den rationalen, nüchternen Argumenten der Wissenschaft zu beweisen. Daß die Verwendung irrationaler Elemente im Zuge einer Argumentation unzulässig ist, ist klar. Irrational, d. h. einer rationalen Rechtfertigung weder bedürftig noch auch fähig, sind die Ziele; was bloß Mittel zu Zielen ist, muß immer rationaler Überprüfung unterworfen werden.
Allgemein verbreitet und übrigens im Hinblick auf die Entwicklung der Doktrinen entschuldbar, wenn auch darum umso gefährlicher ist der Irrtum, der »rationales« Handeln mit dem »richtigen« Handeln identifiziert. MAX WEBER hat diese Verwechslung [90] ausdrücklich abgelehnt [130] , wenn er ihr auch, wie wir gesehen haben, an anderen Stellen seiner Schriften immer wieder verfallen ist.
»Die Grenznutzenlehre«, sagt MAX WEBER, »behandelt . . . menschliches Handeln so, als liefe es von A bis Z unter der Kontrolle kaufmännischen Kalküls: eines auf der Kenntnis aller in Betracht kommender Bedingungen aufgestellten Kalküls, ab [131] «. Das ist gerade das Verfahren der klassischen Nationalökonomie, keineswegs aber das der modernen Nationalökonomen. Der klassischen Nationalökonomie blieb, weil es ihr nicht gelungen war, die scheinbare Antinomie des Wertes zu überwinden, kein anderer Ausweg übrig als der, von dem Handeln des Kaufmanns auszugehen. Sie konnte auf das, was hinter dem Verhalten des Kaufmanns und Unternehmers steht und es in letzter Linie beherrscht und leitet, auf das Verhalten der Verbraucher, nicht zurückgehen, weil sie mit dem Gebrauchswert, den sie nicht in objektiven und subjektiven Gebrauchswert zu spalten wußte, nichts anfangen konnte. Was nicht durch kaufmännische Rechnungen und Bücher durchgeht, war ihr unerreichbar. Schränkt man aber die Betrachtung auf das kaufmännische Verhalten ein, dann muß man recht wohl zwischen kaufmännisch richtigem und kaufmännisch unrichtigem Verhalten unterscheiden. Denn als Kaufmann nicht auch in seiner Eigenschaft als Verbraucher hat der Unternehmer als gegebenes Ziel: höchste Geldrentabilität des Unternehmens.
Die moderne Nationalökonomie geht aber nicht vom Handeln des Kaufmanns aus, sondern von dem des Verbrauchers, von dem jedermanns. Für sie gibt es daher darin liegt eben ihr »Subjektivismus« im Gegensatz zum »Objektivismus« der Klassiker und darin liegt zugleich auch ihre »Objektivität« im Gegensatz zur normativen Stellung der Klassiker weder richtiges noch unrichtiges Handeln der Wirtschafter. Ob jemand gesunde Kost vorzieht oder narkotische Gifte, ob jemand von unter dem Gesichtspunkt einer ethisch oder sonstwie wertenden Betrachtung noch so verkehrten Anschauungen beherrscht wird, kann sie nicht kümmern. Denn sie hat doch die Preisbildung des Marktes zu erklären; sie hat zu erklären, wie die Preise wirklich werden, nicht wie sie werden sollten. Die Alkoholgegner sehen im Genuß geistiger Getränke einen argen Mißgriff der Menschheit, den sie auf Irrtum, Charakterschwäche und Unmoral zurückführen. Für die Katallaktik gibt es nur die Tatsache, daß Alkohol begehrt wird; wer den Preis des Branntweins zu erklären hat, den kümmert es [91] nicht, ob es »rationell« oder sittlich ist, Branntwein zu trinken. Ich mag über Kinodramen denken wie ich will; als Katallaktiker habe ich die Gestaltung der Marktpreise für Filme, Darsteller und Theatersitze zu erklären, nicht über Filme zu Gericht zu sitzen. Ob die Verbraucher irren oder nicht, ob sie edel, großmütig, sittlich, weise, vaterlandsliebend, kirchengläubig sind oder nicht, prüft die Katallaktik nicht, sie kümmert sich nicht um die Beweggründe der Handelnden, sondern nur darum, wie sie handeln.
Die moderne subjektivistische Nationalökonomie die Grenznutzenlehre nimmt die alte Lehre von Angebot und Nachfrage wieder auf, die man ob der Unfähigkeit, die Wertantinomie zu lösen, einst hatte aufgeben müssen, und führt sie weiter. Wenn man, wie die moderne Lehre, den Sinn der Marktpreisbewegungen darin erblickt, daß Ruhe erst eintritt, bis Gesamtnachfrage und Gesamtangebot sich decken, so ist es klar, daß alle Momente, die das Verhalten der Marktparteien beeinflussen, mithin auch die »außerwirtschaftlichen« und »irrationalen«, wie Irrtum, Liebe oder Haß, Sitte, Gewohnheit, Edelmut, mit eingeschlossen sind.
Wenn daher SCHELTING behauptet, die theoretische Nationalökonomie »fingiert eine Gesellschaft, welche allein durch das Wirken wirtschaftlicher Faktoren sich gebildet hat« [132] ,so trifft das, wenn man den Ausdruck »wirtschaftliche Faktoren« im Sinne SCHELTINGS auffaßt, für die moderne Nationalökonomie nicht zu. Daß auch MENGER und BÖHM-BAWERK sich über diese logische Grundlage der von ihnen begründeten Lehre nicht ganz klar geworden sind, daß erst später die volle Tragweite des Überganges vom werttheoretischen Objektivismus zum Subjektivismus erkannt wurde, zeige ich an anderer Stelle [133]
Nicht minder unzutreffend ist es, wenn man der allgemein unter den Anhängern der historisch-realistischen Schule herrschenden Auffassung folgend behauptet, »die weiteren wichtigsten Fiktionen der abstrakten Theorie sind die freie Konkurrenz` und die absolute Bedeutungslosigkeit der staatlichen und anderen geltenden Ordnungen für den Verlauf des wirtschaftlichen Zusammenhandelns der Wirtschaftssubjekte« . [134] Das trifft auch für die klassische Nationalökonomie nicht zu. Daß die moderne Theorie dem Problem des Monopolpreises zu wenig Beachtung geschenkt hätte, wird wohl [92] kaum jemand behaupten wollen. Der Fall der beschränkten Konkurrenz auf der Käuferoder auf der Verkäuferseite stellt der Theorie keine besondere Aufgabe; sie hat es immer nur mit den auf dem Markte auftretenden und wirkenden Subjekten zu tun; von denjenigen, die auf den Markt noch kommen könnten, wenn nicht irgendwelche Faktoren sie zurückhalten würden, ist eben nichts anderes auszusagen, als daß ihr Hinzutreten die Marktlage verschieben würde. Die Theorie und auch dies gilt von der klassischen ebenso wie von der modernen fingiert auch nicht die »absolute Bedeutungslosigkeit der staatlichen und anderen geltenden Ordnungen«; sie widmet diesen »Eingriffen« sehr eindringliche Untersuchungen und stellt eine besondere Theorie der Preistaxen und des Interventionismus auf.
Auch MITSCHERLICH behauptet, die Grenznutzenlehre sei »am stärksten auf die freie Wirtschaft zugeschnitten«. Das Mittelalter hätte sich daher in sie »überhaupt nicht hineindenken können«, sie wäre da »gegenstandslos« gewesen. »Was«, meint er, »hätte wohl das Mittelalter zu der Aufstellung eines KARL MENGER gesagt, wenn er ausführt: Als Maß der Schätzung dient derjenige letzte Intensitätsgrad des Bedürfnisses, der durch den gegebenen Vorrat noch befriedigt werden kann: der Grenznutzen« [135]. Man darf vermuten, daß das Mittelalter die moderne Preistheorie ebensowenig begriffen hätte wie die NEWTONsche Mechanik oder die modernen Auffassungen von der Funktion des Herzens. Dennoch fielen im Mittelalter die Regentropfen nicht anders nieder als heute, und die Herzen schlugen auch nicht anders. Wenn die mittelalterlichen Menschen das Grenznutzengesetz auch nicht verstanden hätten, so haben sie doch nicht anders gehandelt und handeln können als so, wie es das Grenznutzengesetz beschreibt. Auch der Mensch des Mittelalters hat die ihm zur Verfügung stehenden Mittel so zu verteilen gesucht, daß er in jeder einzelnen Bedürfnisgattung das gleiche Niveau der Befriedigung erreichte. Auch im Mittelalter hat der Reichere sich vom Ärmeren nicht nur dadurch unterschieden, daß er mehr gegessen hat. Auch im Mittelalter hat niemand freiwillig ein Pferd gegen eine Kuh im Tausche hingegeben, wenn er nicht die Kuh höher schätzte als das Pferd. Auch damals haben die Eingriffe der Obrigkeit und anderer Zwangsgewalten keine anderen Wirkungen nach sich gezogen als die, die die moderne Lehre von den Preistaxen und Interventionen zeigt.
Wenn gegen die moderne nationalökonomische Theorie eingewendet [93] wird, daß »notwendig ihr Grundschema die Wirtschaft der freien Konkurrenz« bilde, daß sie aber »die organisierte Wirtschaft der Gegenwart, die Wirtschaft des geregelten Wettbewerbs« und die »gesamte Erscheinung des Imperialismus« theoretisch nicht erfassen könne [136] , so genügt es, einfach darauf hinzuweisen, daß dasjenige, was den Kampf gegen die Theorie historisch ausgelöst hat und was ihm seine Hartnäckigkeit und seine Volkstümlichkeit gegeben hat, der Umstand ist, daß gerade vom Boden der Theorie aus, und nur von ihm aus, eine genaue Beurteilung der Wirkungen sowohl jeder einzelnen interventionistischen Maßnahme als auch der Gesamterscheinung des Interventionismus in jeder seiner historischen Gestaltungen möglich ist. Es heißt die geschichtlichen Tatsachen geradezu auf den Kopf stellen, wenn man behauptet, die historische Schule lehne die Theorie ab, weil die Theorie nicht imstande gewesen wäre, die geschichtliche Erscheinung des Interventionismus zu erklären; in Wahrheit hat sie sie gerade darum abgelehnt, weil man vom Boden der Theorie aus zu einer Erklärung gelangen mußte, diese Erklärung aber einerseits den Anhängern der Schule politisch nicht genehm war, andererseits aber auch von ihnen nicht widerlegt werden konnte. Daß die moderne Theorie die Erscheinung des Imperialismus theoretisch nicht erfaßt hätte, kann nur behaupten, wer »theoretisch erfassen« mit »kritiklos verherrlichen« gleichsetzen will.
Übrigens wird wohl niemand, der die wirtschaftspolitischen Erörterungen der letzten Jahre auch nur mit einiger Aufmerksamkeit verfolgt hat, bestreiten können, daß alles, was zur Aufhellung der Probleme, die die »gebundene« Wirtschaft uns stellt, geschehen ist, ausschließlich mit den Mitteln der »reinen« Theorie von Theoretikern geleistet wurde; man denke doch nur, um von den Währungsproblemen und vom Monopolpreis ganz zu schweigen, an die Erörterungen über die Ursache der Arbeitslosigkeit als Dauererscheinung und an die Erörterung der Probleme des Protektionismus [137].
Drei Voraussetzungen, meint WEBER, liegen der abstrakten Wirtschaftstheorie zugrunde: tauschwirtschaftliche Gesellschaftsorganisation, freie Konkurrenz und streng rationales Handeln [138] Von der freien Konkurrenz und dem streng rationalen Handeln haben wir schon gesprochen. Für die dritte Voraussetzung sei einerseits auf den [94] Ausgangspunkt aller Untersuchungen der modernen Schule, auf die isolierte tauschlose Wirtschaft, die man als Robinsonade lächerlich zu machen gesucht hat, verwiesen, andererseits aber auf die Untersuchungen über die Wirtschaft des gedachten sozialistischen Gemeinwesens.
V. Geschichte ohne Soziologie.
Man kann MAX WEBER durchaus zustimmen, wenn er erklärt: »Wo immer die kausale Erklärung einer ‚Kulturerscheinung’ eines historischen ‚Individuums’ . . . in Betracht kommt, da kann die Kenntnis von Gesetzen der Verursachung nicht Zweck, sondern nur Mittel der Untersuchung sein. Sie erleichtert und ermöglicht uns die kausale Zurechnung der in ihrer Individualität kulturbedeutsamen Bestandteile der Erscheinungen zu ihren konkreten Ursachen. Soweit, und nur soweit, als sie dies leistet, ist sie für die Erkenntnis individueller Zusammenhänge wertvoll« [139]. MAX WEBER irrt aber, wenn er hinzufügt: »Je,allgemeiner’, d. h. abstrakter die Gesetze, desto weniger leisten sie für die Bedürfnisse der kausalen Zurechnung individueller Erscheinungen und damit indirekt für das Verständnis der Bedeutung der Kulturvorgänge. . . . Für die exakte Naturwissenschaft sind die ‚Gesetze’ umso wichtiger und wertvoller, je allgemeingültiger sie sind, für die Erkenntnis der historischen Erscheinungen in ihrer konkreten Voraussetzung sind die allgemeinsten Gesetze, weil die inhaltleersten, regelmäßig auch die wertlosesten. Denn je umfassender die Geltung eines Gattungsbegriffes sein Umfang ist, desto mehr führt er uns von der Fülle der Wirklichkeit ab, da er ja, um das Gemeinsame möglichst vieler Erscheinungen zu enthalten, möglichst abstrakt, also inhaltsarm sein muß« [140].
Obgleich WEBER in den Ausführungen, auf Grund deren er zu diesen Schlußfolgerungen gelangt, auch von »allen, sogenannten,wirtschaftlichen Gesetzen’ ohne Ausnahme« spricht, so hat er doch wohl nur die bekannten Versuche, Gesetze der historischen Entwicklung aufzustellen, im Auge haben können. Denkt man an HEGELs berühmten Satz: »Die Weltgeschichte . . . stellt die Entwicklung des Bewußtseins des Geistes von seiner Freiheit und der von solchem Bewußtsein hervorgebrachten Verwirklichung dar« [141] oder an einen [95] der BREYSIGschen Sätze, dann sind WEBERS Behauptungen ohne weiteres zu verstehen. Auf die Sätze der Soziologie angewendet, erscheinen sie unbegreiflich.
Wer die Geschichte des letzten Jahrzehnts zu schreiben versuchen wird, kann an dem Reparationsproblem nicht vorbeigehen [142]. Im Mittelpunkte dieses Problems aber steht das Problem des Transfer; sein Wesen ist die Frage, ob durch die Zahlung der Reparationsbeträge und besonders durch ihre Übertragung ins Ausland die Goldwertstabilität des deutschen Geldes berührt werden kann oder nicht. Man kann diese Frage nicht anders untersuchen als mit den Mitteln der nationalökonomischen Theorie. Jede andere Art, sie zu untersuchen, wäre einfach unsinnig. Wohlgemerkt: nicht nur ein Teil derer, die in dieser Erörterung das Wort ergriffen haben, sondern alle, ausnahmslos alle, greifen immerfort auf allgemeine Sätze nationalökonomischer Theorie zurück. Auch wer von der für die Wissenschaft abgetanen und erledigten Zahlungsbilanztheorie ausgeht, hält an einer Lehre fest, die logisch denselben Charakter der Allgemeingültigkeit trägt wie die von der modernen Wissenschaft als richtig anerkannte Lehre. Ohne Rückgriff auf solche allgemeine Sätze wäre eine Erörterung der Wirkungen, die unter bestimmten Voraussetzungen eintreten müssen, gar nicht zu führen. Ohne solchen Rückgriff wird der Geschichtsschreiber, gleichviel, ob die Zahlungen nach dem Dawesplan wirklich geleistet werden oder ob sie aus irgendeinem, heute noch nicht gegebenen Grunde entfallen werden, zu allen Dingen, die mit dem Transfer zusammenhängen, nichts sagen können. Gesetzt den Fall, die Zahlungen werden geleistet, und der Goldwert der Mark verändert sich nicht. Ohne Rückgriff auf den Grundsatz der Kaufkraftparitätentheorie könnte man daraus noch nicht folgern, daß die Leistung Deutschlands seine Währung nicht berührt habe. Es könnte ja sein, daß eine andere, gleichzeitig wirkende Kausalkette die Wirkung auf die Währung, deren Eintritt die Zahlungsbilanztheorie erwartet, nicht hat sichtbar werden lassen, und wenn dem so wäre, so würde der Historiker diese zweite Kausalkette entweder gar nicht bemerken oder ihre Wirkung nicht erfassen können.
Ohne Theorie ist Geschichte nicht zu denken. Der naive Glaube, man könnte, durch keine Theorie voreingenommen, unmittelbar aus den Quellen Geschichte gewinnen, ist nicht zu halten, Daß die Aufgabe der Historik nicht im Abbilden der Wirklichkeit, sondern in [96] einem Umbilden und Vereinfachen durch Begriffe besteht, hat RICKERT in unwiderlegbarer Weise auseinandergesetzt [143]. Wenn man darauf verzichtet, Theorien über den Zusammenhang der Erscheinungen auszubilden und zu verwenden, dann gelangt man keineswegs zu theoriefreier und darum der Wirklichkeit besser entsprechenden Lösung der Aufgaben. Ohne die Kategorie der Kausalität können wir nicht denken; jedes Denken, auch das des Historikers, postuliert das Kausalitätsprinzip. Es kann sich daher nur darum handeln, ob man die durch das wissenschaftliche Denken ausgearbeiteten und kritisch geprüften Kausaldeutungen oder kritiklos volkstümliche vorwissenschaftliche »Sätze« anwenden will. Aus den Tatsachen erschließen sich unmittelbar keine Deutungen. Selbst wenn man kritiklos: post hoc, ergo propter hoc schließen wollte, wäre man angesichts der verwirrenden Fülle und Mannigfaltigkeit der Erscheinungen ratlos. Gerade der »mehrseitige Kausalaufbau« der Prozesse, von dem MUHS spricht [144] , fordert Theorie.
Geschichtsforscher und Geschichtsschreiber verwenden seit alters her Theorien, die das außerwissenschaftliche Denken mit dem Anspruch auf Allgemeingültigkeit geschaffen hat. Man achte doch darauf, wieviel solcher Theorie in dem einfachen Satze steckt: Der besiegte König sah sich genötigt, unter ungünstigen Bedingungen Frieden zu schließen. Daß es sich hier um einfache und kaum bestrittene, ihrem Charakter nach außerwissenschaftliche Theorien handelt, ändert nichts daran, daß es doch Theorie, d. h. allgemeingültig verstandene Aussage, ist. Daneben verwendet die Geschichte Theorien aller anderen Wissenschaften, und es ist selbstverständlich, daß hier der Anspruch berechtigt ist, daß die Theorien, die zur Anwendung gelangen, dem gegenwärtigen Stande der Wissenschaft entsprechen, d. h. unserer Auffassung nach richtige Theorien sind. Der altchinesische Geschichtsschreiber durfte außerordentliche Dürre auf sittliche Verfehlungen des Kaisers zurückführen und berichten, daß nach Entsühnung des Herrschers wieder Regen fiel; der antike Historiker durfte den frühen Tod des Königssohns dem Neid der Götter zuschreiben. Wir werden heute bei dem gegenwärtigen Stande der Meteorologie und der Pathologie nach anderer Erklärung suchen. Wenn die Quellen uns in noch so bestimmter Weise vom Umgange [97] des Numa Pompilius mit der Camene Egeria berichten würden, wir könnten es nicht glauben und würden achtlos darüber hinweggehen. Der Verkehr der Hexen mit dem Teufel ist gerichtsordnungsmäßig erwiesen worden; wir bestreiten die Möglichkeit solchen Verkehrs, aller Akten ungeachtet, auf Grund unserer Theorien [145]. Der Geschichtsschreiber muß alle übrigen Wissenschaften als Hilfswissenschaften der Geschichte im weiteren Sinne ansehen und sich davon soviel zu eigen machen, als die besonderen Aufgaben, die er sich gesetzt hat, erfordern. Wer die Geschichte des julisch-claudischen Herrscherhauses bearbeitet, wird kaum ohne Vererbungslehre und Psychiatrie auskommen können. Wer eine Geschichte des Brückenbaues schreibt, wird vom Brückenbau, wer eine Geschichte der Kriegskunst schreibt, wird von der Kriegskunst gründliche Kenntnis benötigen.
Die Anhänger des Historismus geben das alles nun wohl zu, soweit alle übrigen Wissenschaften in Frage kommen, bestreiten es aber gerade in bezug auf die Soziologie. Hier scheint ihnen die Sache anders zu liegen. Ein sachlicher Grund für diese Verschiedenheit der Beurteilung ist nicht aufzufinden. Psychologisch ist der Widerstand mancher Historiker nicht schwer zu verstehen. Soweit die übrigen Wissenschaften in Frage kommen, handelt es sich entweder darum, daß der Historiker sich ein bescheidenes Maß von Kenntnissen aneignet, das über das Maß dessen, was bei jedem Gebildeten selbstverständlich ist, nicht hinausgeht, oder um die Lostrennung von Sondergebieten historischer Erkenntnis, die mit dem eigentlichen Arbeitsgebiete der Geschichte nur in einem losen Zusammenhang stehen. Um zu wissen, daß noch so arge Verfehlungen des Herrschers das Wetter nicht zu beeinflussen vermögen, braucht man kein Meteorologe zu sein, und auch wer von Deszendenzlehre nur recht wenig versteht, wird die göttliche Abstammung, die die Geschichtsquellen manchen Herrscherhäusern zuschreiben, entsprechend zu würdigen wissen. Die Verselbständigung der Geschichte der Heilkunde und ähnlicher Disziplinen berührt den Aufgabenkreis der Geschichte nur wenig. Die Ansprüche der Soziologie aber empfinden [98] manche Historiker, wenn auch nur infolge Verkennung der Grenzen soziologischer und historischer Arbeit, als Strittigmachung ihres ureigensten Gebietes.
In allem und jedem, was die Geschichte zu sagen hat, stecken implizite soziologische Theorien. Keine Aussage über die Wirkung politischer Maßnahmen ist denkbar, die auf den Rückgriff auf allgemeingültige Sätze über menschliches Handeln verzichten könnte. Ob nun von der »sozialen Frage«, von merkantilistischer Politik, vom Imperialismus, von Machtpolitik, von Kriegen und Revolutionen die Rede ist, immer wieder begegnen uns in den Ausführungen des Historikers Behauptungen, die Schlußfolgerungen aus allgemeingültigen soziologischen Sätzen sind. Wie Monsieur JOURDAIN erstaunt war, zu vernehmen, daß das, was er immer gesprochen hatte, Prosa war, so zeigen sich die Historiker überrascht, wenn man ihnen vorhält, daß sie immerfort soziologische Sätze anwenden. Bedauerlicherweise gehören aber mitunter diese Theorien, von denen sie unbedenklich Gebrauch machen, dem vorwissenschaftlichen Denken an; wer die Ergebnisse der modernen Soziologie nicht beachtet, arbeitet darum noch nicht »theoriefrei«; er verwendet die abgetane naive Theorie einer überwundenen Epoche des wissenschaftlichen Denkens oder gar die noch naivere des vorwissenschaftlichen Denkens. Geradezu grotesk wirkt dies in der Wirtschaftsgeschichte. Wirtschaftsgeschichte wurde erst möglich, als die klassische Nationalökonomie dem wirtschaftspolitischen Denken einen wissenschaftlichen Apparat geschaffen hatte; ältere Versuche, z. B. die über Handelsgeschichte, waren nichts als eine Sammlung von Notizen. Nun sucht der Wirtschaftshistoriker sich von der Theorie zu emanzipieren. Er verzichtet darauf, an seine Aufgabe mit dem logischen Rüstzeug der durchgebildeten wissenschaftlichen Lehre heranzutreten, und zieht es vor, sich mit dem bescheidenen Maß von theoretischen Kenntnissen zu begnügen, das heute jedermann durch die Zeitungslektüre und durch das Tagesgespräch zufliegt. Die Voraussetzungslosigkeit dieser Historiker ist in Wahrheit kritikloses Nachbeten der eklektischen, widerspruchsvollen, logisch unhaltbaren und durch die moderne Wissenschaft hundertmal widerlegten volkstümlichen Irrtümer [146]. So blieb die emsige Arbeit, die ganze Generationen von Forschern geleistet haben, unfruchtbar; gerade auf dem Gebiete der Sozialund Wirtschaftsgeschichte, das sie als ihre ureigene Domäne in Anspruch [99] genommen hat, hat die historische Schule versagt.
Nun behaupten die Vorkämpfer der theoriefreien Historik freilich, daß der Begriffsund Theorieapparat dem historischen Material selbst entnommen werden müsse, da es keine allgemeingültigen überzeitlichen Gesetze des menschlichen Handelns gebe. Wir haben schon gesehen, daß die These, es könnte auch irrationales Handeln geben und das rationale Handeln sei überhaupt erst das Ergebnis einer langen historischen Entwicklung, auf einem groben Mißverstehen beruht. Der Historismus geht aber noch weiter; er verwirft die Lehre von der Überzeitlichkeit der Vernunft als ein Vorurteil der Aufklärung. Die logische Struktur der menschlichen Vernunft habe sich im Laufe der Zeiten geradeso verändert wie etwa die technischen Kenntnisse und Fertigkeiten [147]. Auf das, was gegen dieses Postulat des Historismus vom Standpunkte der Erkenntnistheorie grundsätzlich zu bemerken ist, wollen wir hier nicht eingehen [148] ; der Historismus würde es wohl auch nicht gelten lassen, da er eben das Ausspielen der überzeitlichen Theorie gegen historische Erfahrung ablehnt. Wir müssen uns daher darauf beschränken, was auch der Historismus als immanente Kritik seiner These anerkennen muß. Da aber ist zunächst festzustellen, daß keine der uns erreichbaren Quellen geschichtlicher Kenntnis irgend etwas enthält, was die Annahme der Unveränderlichkeit der Vernunft erschüttern könnte. Niemals ist auch nur der Versuch gemacht worden, konkrete Behauptungen darüber aufzustellen, worin sich die logische Struktur der Vernunft im Laufe der Zeiten geändert haben könnte. Die Vertreter des Historismus würden in die größte Verlegenheit geraten, wenn man von ihnen verlangen wollte, sie mögen ihre These durch die Aufzeigung eines Beispiels erläutern. Die Ethnologie hat in diesem Punkte nicht weniger versagt als die Geschichte. WILHELM JERUSALEM hat zwar mit großem Nachdruck behauptet: »KANTS fester Glaube an eine zeitlose, ganz unveränderliche logische Struktur unserer Vernunft . . . ist durch die Ergebnisse der modernen Völkerkunde nicht nur nicht bestätigt, sondern geradezu als irrig erwiesen worden« [149]. Doch auch JERUSALEM hat in keinem einzigen Punkt den Versuch unternommen, uns zu zeigen, worin die Logik der Primitiven von unserer strukturell [100] verschieden wäre. Die allgemeine Berufung auf die Schriften der Ethnologen reicht da nicht hin. Die Ethnologie zeigt nur, daß die Schlüsse, zu denen das Denken der Primitiven gelangt, andere sind als die, zu denen wir gelangen, und daß der Umfang der Dinge, über die die Primitiven nachzudenken pflegen, von dem Kreis unserer geistigen Interessen verschieden ist. Wenn der Primitive magische und mystische Verknüpfungen annimmt, wo wir Verknüpfungen anderer Art annehmen oder keine Verknüpfung finden, oder wenn er keine Verknüpfung sieht, wo wir sie erkennen, so zeigt das nur, daß der Inhalt seines Denkens von dem unseres Denkens abweicht, nicht aber, daß sein Denken von anderer logischer Struktur wäre. JERUSALEM beruft sich zur Stützung seiner Behauptung immer wieder auf die Arbeiten von LÉVY-BRUHL. Doch nichts von dem, was LÉVY-BRUHL in seinen vortrefflichen Schriften ausführt, besagt etwas anderes als das, daß die Angehörigen der Naturvölker für die Probleme, mit denen sich bei den Kulturvölkern ein enger Kreis geistig hochstehender Menschen befaßt, kein Verständnis haben. »Der Afrikaner«, sagt LÉVY-BRUHL im Anschluß an BENTLEY, »denkt nichts bis zu Ende durch, wenn er nicht dazu gezwungen wird. Sie haben niemals die Ähnlichkeit zwischen ihrem eigenen Handel und einem Kontor an der Küste begriffen. Sie denken, daß wenn ein Weißer Stoff braucht, er nur einen Ballen aufzumachen braucht und daß er ihn dann darin findet. Aber woher kommen diese Ballen, warum und wie daran haben sie niemals gedacht.« Der Naturmensch habe die geistige Gewohnheit, »sich an den ersten Eindruck der Dinge zu halten und nicht zu überlegen, wenn er es irgend vermeiden kann« [150]. LÉVY-BRUHL und BENTLEY scheinen ihren Umgang auf die Angehörigen der Naturvölker beschränkt zu haben; hätten sie sich auch in Europa und gar erst unter europäischen Volkswirten und Wirtschaftspolitikern umgesehen, so hätten sie »nichts bis zu Ende durchdenken« und »nicht überlegen« gewiß nicht als Eigentümlichkeiten der Primitiven bezeichnet. Den Mossi am Niger mangelt, wie LÉVY-BRUHL nach einem Bericht von MANGIN sagt, die Reflexion. Daher fehle es ihnen auch an Ideen. »Ihre Unterhaltungen drehen sich fast ausschließlich um die Frauen, die Nahrung, und in der Regenzeit um die Landwirtschaft« [151]. Hätte man nicht dasselbe auch von den engeren Landsleuten und Zeitgenossen NEWTONs oder [101] KANTS behaupten können? Man muß übrigens feststellen, daß LÉVY-BRUHL aus seinen Zusammenstellungen keineswegs die Folgerungen zieht, die JERUSALEM aus ihnen ableiten will. Über das Kausaldenken der Naturvölker z. B. bemerkt er ausdrücklich zusammenfassend: »Die primitive Mentalität beschäftigt sich, wie die unsere, mit den Ursachen der Geschehnisse. Aber sie sucht sie nicht in derselben Richtung. Sie lebt in einer Welt, in der unzählige okkulte Mächte überall gegenwärtig und stets handelnd oder handlungsbereit sind« [152]. Auf Grund eindringlicher Untersuchungen gelangt CASSIERER zu dem Ergebnis: »Wenn man das empirisch-wissenschaftliche und das mythische Weltbild miteinander vergleicht, so wird alsbald deutlich, daß der Gegensatz zwischen beiden nicht darauf beruht, daß sie in der Betrachtung und Deutung des Wirklichen ganz verschiedene Kategorien verwenden. Nicht die Beschaffenheit, die Qualität dieser Kategorie, sondern ihre Modalität ist es, worin der Mythos und die empirischwissenschaftliche Erkenntnis sich unterscheiden. Die Verknüpfungsweisen, die beide gebrauchen, um dem sinnlich Mannigfaltigen die Form der Einheit zu geben, um das Auseinanderfließende zur Gestalt zu zwingen, zeigen eine durchgehende Analogie und Entsprechung. Es sind dieselben allgemeinsten Formen` der Anschauung und des Denkens, die die Einheit des Bewußtseins als solche, und die somit ebensowohl die Einheit des mythischen wie die des reinen Erkenntnisbewußtseins konstituieren« [153].
Der Historismus verkennt, daß auch Sätze von der Art wie: »Die Lehren der klassischen Nationalökonomie hatten für die Zeit, in der sie geschaffen wurden, (relative) Wahrheit« nur ausgesprochen werden können, wenn man sich eine überzeitliche allgemeingültige Theorie zu eigen gemacht hat. Ohne solche Theorie könnte der Historiker nichts anderes als seine Aufgabe ansehen als das Sammeln und Veröffentlichen von Material. So ist es denn kein zufälliges Zusammentreffen, sondern innere Notwendigkeit gewesen, daß das Zeitalter der Herrschaft des Historismus zu einem Niedergang der Geschichtsforschung und Geschichtsschreibung großen Formats geführt hat. Auf der einen Seite Quellenveröffentlichung, auf der anderen Seite dilettantische Konstruktionen von der Art CHAMBERLAINS und SPENGLERS, das ist, von rühmlichen Ausnahmen abgesehen, das Ergebnis des Historismus für die Historik.
[102]
Wenn Geschichte nicht ein sinnloses Unding werden soll, dann muß jede Aussage über einen Kausalzusammenhang, die sie bringt, bis zu Ende gedacht und auf ihre Verträglichkeit mit dem ganzen Bau unserer Erkenntnis geprüft werden. Das aber kann ohne soziologische Theorie nicht geleistet werden.
Wenn MAX WEBER meint, daß für die kausale Erklärung von Kulturerscheinungen »die Kenntnis von Gesetzen der Verursachung nicht Zweck, sondern nur Mittel der Untersuchung« sein kann, so muß man durchaus zustimmen. Für die Geschichte ist Soziologie eine Hilfswissenschaft, freilich eine unentbehrliche Hilfswissenschaft. In demselben Verhältnis steht die soziologische und besonders die nationalökonomische Theorie zur Politik. Selbstzweck ist jede Wissenschaft nur für den, den nach ihr dürstet.
VI. Allgemeine Geschichte und Soziologie.
MAX WEBER hat nicht nur ein Programm und eine Methodenlehre der Soziologie entwerfen wollen, er hat auch selbst, neben vortrefflichen historischen Untersuchungen, umfangreiche Arbeiten veröffentlicht, die er als soziologische bezeichnete. Wir können ihnen den Anspruch auf diesen Namen freilich nicht zuerkennen. Das soll keine abfällige Kritik sein. Die Untersuchungen, die MAX WEBERs nachgelassenes Hauptwerk »Wirtschaft und Gesellschaft« vereinigt, gehören zu dem Besten, was das deutsche wissenschaftliche Schrifttum der letzten Jahrzehnte hervorgebracht hat. Doch sie sind in ihren wichtigsten Teilen nicht soziologische Theorie in unserem Sinne. Sie sind auch nicht Geschichte in dem allgemein gebräuchlichen Sinn des Ausdrucks. Die Geschichte bringt uns die Geschichte einer Stadt oder die der deutschen Städte oder die der mittelalterlichen Städte Europas. Sie kannte aber bisher nichts, was gleich dem meisterhaften Kapitel in WEBERS Werk einfach von »der Stadt« im allgemeinen handelt, eine allgemeine Lehre von der städtischen Siedlung zu allen Zeiten und bei allen Völkern, die idealtypische Konstruktion der Stadt an sich. Für WEBER, der die auf allgemeingültige Begriffe und ausnahmslos geltende Sätze hinarbeitende Wissenschaft nicht gesehen hat, war das Soziologie. Wollten wir uns diesem Sprachgebrauch fügen und für das, was wir unter Soziologie verstehen, einen anderen Namen suchen, dann würden wir eine heillose Verwirrung stiften. Wir müssen also schon bei unserer Unterscheidung bleiben und trachten, dem, was WEBER als Soziologie angesehen hat, einen anderen Namen zu geben. Am zweckmäßigsten wäre da vielleicht die Bezeichnung: [103] Allgemeine Lehren der Geschichte oder kürzer Allgemeine Geschichte. Der Umstand, daß man als allgemeine Geschichte gewöhnlich Darstellungen der Geschichte aller Zeiten und Völker bezeichnet, muß uns daran nicht hindern. Denn solche Darstellungen können nicht anders vorgehen, als daß sie an die Darstellung des Verlaufes in einem Kulturkreise oder bei einem Volke die Darstellung des Verlaufes bei einer anderen historischen Individualität reihen. Allgemeine Geschichte in diesem Sinne ist mithin nur die Bezeichnung für eine Reihe von Arbeiten, die durch die Einreihung ihren ursprünglichen Charakter und ihre Selbständigkeit nicht einbüßen. Allgemeine Geschichte in unserem Sinn Soziologie in WEBERs Sinn wäre die Heraushebung und Sonderbearbeitung der von der Geschichte verwendeten idealtypischen Konstruktionen. Es entspräche das ungefähr, aber doch nur ungefähr, dem, was BERNHEIM in seiner thematischen Einteilung des Arbeitsfeldes der Geschichte als Universalgeschichte oder Kulturgeschichte im weiteren Sinne bezeichnet. BERNHEIM stellt nämlich der spezialisierten Geschichte die allgemeine Geschichte gegenüber, innerhalb der er zwei Gruppen unterscheidet: » 1. Universalgeschichte oder Kulturgeschichte im weiteren Sinne, auch Weltgeschichte genannt: die Geschichte der Menschen in ihren Betätigungen als soziale Wesen, zu allen Zeiten und an allen Orten, im einheitlichen Zusammenhang der Entwicklung. 2. Allgemeine Staatengeschichte, auch Weltgeschichte und früher auch Universalgeschichte genannt: eine kompendiumartige Aneinanderreihung der Geschichte aller namhaften Völker« [154]. Daß es natürlich nicht auf die Terminologie, sondern nur auf die logischbegriffliche Scheidung ankommt, braucht wohl nicht besonders hervorgehoben zu werden.
In der Ethnologie wären ähnlich allgemeine und besondere Ethnologie zu sondern.
Analog liegen die Dinge in der Bearbeitung wirtschaftlicher Probleme. Zwischen der nationalökonomischen Theorie auf der einen Seite und der Wirtschaftsgeschichte und der Wirtschaftsbeschreibung oder Wirtschaftskunde, die ja auch immer Wirtschaftsges chichte sein muß, auf der anderen Seite liegt die Allgemeine Wirtschaftskunde, die der Sonderbearbeitung der von der Wirtschaftsgeschichte verwendet-en idealtypischen Konstruktionen dient.
In der konkreten wissenschaftlichen Arbeit und in ihrer Darstellung [104] für die Öffentlichkeit werden die Grenzen zwischen diesen Gebieten nicht immer beachtet; es besteht auch kein Bedürfnis nach solcher Sonderung; der schaffende Geist bringt, was er zu geben hat, und wir danken es ihm. Doch auch wer die Grenzen, die die einzelnen Fächer sondern, nie zu überschreiten gedenkt, muß wissen, was jenseits der Grenzen vorgeht. Kein Soziologe kann die Geschichte, kein Historiker die Soziologie entbehren.
Der Historismus hat die historische Methode als die allein für die Behandlung der den Wissenschaften vom menschlichen Handeln gesetzten Probleme zulässige und angemessene erklärt; eine theoretische Wissenschaft vom menschlichen Handeln hielt ein Teil der Vertreter des Historismus überhaupt für unmöglich; andere wollten für eine ferne Zukunft, die über reichere historische Vorarbeiten verfügen wird, die Möglichkeit nicht ganz bestreiten. Die Gegner des Historismus haben natürlich niemals die Berechtigung, logische Zulässigkeit und Ersprießlichkeit der historischen Arbeit bestritten; im Methodenstreit wurde niemals die Geschichte, stets nur die Theorie in Frage gestellt. Vom wirtschaftspolitischen Standpunkte betrachtet, lag der verhängnisvolle Irrtum des Historismus in der Ablehnung der Theorie; das war ja auch der Sinn des Angriffes gegen die Theorie, bei dem es sich darum handelte, wirtschaftspolitische Ideen, die der Prüfung an der Hand der Wissenschaft nicht standhalten konnten, vor unliebsamer Kritik zu schützen. Vom Standpunkte der Wissenschaft betrachtet, wog schwerer als der Irrtum, man könne Geschichte (und Wirtschaftskunde) ohne Theorie betreiben, die Verkennung der Wahrheit, daß jede historische Untersuchung und jede Beschreibung gesellschaftlicher Zustände theoretische Begriffe und Sätze voraussetzen. Die dringendste Aufgabe der Logik der Geschichtswissenschaft ist die Bekämpfung dieses Irrtums.
VII. Soziologische Gesetze und historische Gesetze.
Die Methode wissenschaftlicher Arbeit, die ceteris paribus die Wirkung der Veränderung eines Faktors untersucht, nennen wir die statische Methode [155]. Nahezu alles, was die Soziologie und ihr am [105] besten ausgebauter Teil, die nationalökonomische Theorie, bisher geleistet haben, ist der Anwendung der statischen Methode zu danken. Die Annahme vollkommener Unveränderlichkeit aller übrigen Bedingungen, die wir hier machen, ist eine für das Denken und die Wissenschaft unentbehrliche Fiktion. Im Leben ist alles stets im Flusse, doch für das Denken müssen wir einen imaginären Zustand der Ruhe konstruieren [156]. Wir isolieren im Denken auf diese Weise die einzelnen Faktoren, um die Wirkung ihrer Veränderung studieren zu können. Das Wort »Statik« darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß es sich um eine Methode handelt, deren Ziel gerade die Untersuchung der Veränderung ist [157].
Es ist bei dem gegenwärtigen Stande der Wissenschaft noch nicht möglich, festzustellen, ob innerhalb des Systems der Katallaktik dynamische Gesetze möglich sind. Ein dynamisches Gesetz müßte aufzeigen können, wie aus den im statischen System wirkenden Kräften heraus Veränderungen auch dann eintreten müßten, wenn keine Veränderung der Daten von außen her erfolgt. Es ist bekannt, daß RICARDO und manche Epigonen der klassischen Schule, z. B. auch MARX, solche Versuche unternommen haben, und daß auch auf dem Boden der modernen Wissenschaft sich ähnliche Bestrebungen geltend machen. Wir können es uns ersparen, an dieser Stelle darauf näher einzugehen. Auch die Frage, ob außerhalb des engeren Rahmens der nationalökonomischen Theorie Gesetze soziologischer Dynamik aufgezeigt werden könnten, hat uns hier nicht zu beschäftigen. Wir müssen nur an dem Begriff des dynamischen Gesetzes festhalten, um ihn dem Begriff des historischen Gesetzes gegenüberzustellen.
Man hat es immer wieder als die Aufgabe der Geschichtswissenschaft bezeichnet, geschichtliche Gesetze, d. s. Gesetze des geschichtlichen Ablaufs, aufzustellen. Manche sind auch darangegangen, solche Gesetze aufzustellen. Freilich, den Anforderungen, die man an ein wissenschaftliches Gesetz zu stellen hat, haben diese Gesetze nicht entsprochen. Es fehlt ihnen die Allgemeingültigkeit.
Bei allen diesen »Gesetzen«, wie z. B. bei den BREYSIGschen [106] Gesetzen, von denen wir oben ein Beispiel gegeben haben [158] , liegt die Wurzel dieses Mangels darin, daß zum Aufbau des Gesetzes idealtypische Begriffe und Konstruktionen Verwendung gefunden haben. Da nun schon diesen die Allgemeingültigkeit fehlt, muß sie auch den auf ihnen aufgebauten Sätzen fehlen. Alle in dem zitierten einunddreißigsten der BREYSIGschen Gesetze vorkommenden Begriffe sind idealtypisch aufzufassen; nicht nur »Kaiserherrschaft«, »Volksherrschaft«, »Aufschwung im Handel und Gewerbe« sind so zu verstehen, sondern auch »Volkswirtschaft« in dem Sinne, in dem dieser Ausdruck von BREYSIG verwendet wird.
Eine besondere Stellung nehmen die Stufengesetze ein. Es wirden eine Reihe von Stufen geschichtlicher Entwicklung idealtypisch charakterisiert, und dann wird die Behauptung aufgestellt, daß die Geschichte in dem Fortschreiten von einer Stufe zur nächsten und dann weiter fort zur dritten usw. bestehe. Es ist klar, daß dies noch nicht die Aufweisung einer Gesetzlichkeit bedeutet, solange nicht die Notwendigkeit dieses Fortschreitens behauptet werden kann [159]. Wird aber diese Notwendigkeit behauptet, dann wäre dieser Ausspruch, nicht aber die idealtypische Konstruktion der Stufen, als Gesetz anzusehen, doch auch nur dann, wenn er inhaltlich von jeder Beziehung auf Idealtypen frei wäre.
Dieser Forderung wollen die Fortschrittsgesetze genügen. Sie stellen eine oder mehrere Kräfte fest, deren dauernder Einwirkung sie die Richtung, in der sich die gesellschaftlichen Veränderungen vollziehen, eindeutig zuordnen; ob diese Entwicklung zum Guten oder zum Bösen führt, ob sie Aufschwung oder Niedergang bedeutet, ist dabei unwesentlich; Fortschritt heißt hier: Fortschreiten auf dem notwendigen Wege. Nun ist es wohl richtig, daß alle bisher aufgestellten Fortschrittsgesetze, soweit sie nicht schon von vornherein als der Wirklichkeit in keiner Weise entsprechende Erdichtungen zurückzuweisen sind, durch Verbindung mit idealtypischen Begriffen den strengen Gesetzescharakter verlieren. Es müßte aber doch unschwer gelingen, das ihnen zugrunde liegende soziologische Gesetz rein herauszuschälen und auf seinen Gehalt zu prüfen. Würden wir dann auch dem historischen Gesetz den Gesetzescharakter absprechen, so würden wir doch in ihm ein Gesetz soziologischer Dynamik vorfinden.
Arbeitsteilig verrichtete Arbeit ist produktiver als ohne Arbeitsteilung [107] verrichtete Arbeit. Mit dem gleichen Aufwande an Arbeit und Gütern höherer Ordnung bringt sie der Menge nach mehr Produkte hervor und gestattet Leistungen zu vollbringen, die ein isolierter Arbeiter der Art nach nie zu verrichten in der Lage wäre. Ob dieser Satz der empirischen Technologie und Arbeitsphysiologie ausnahmslos gilt soweit wir bei einem empirischen Gesetz überhaupt berechtigt sind, von ausnahmsloser Geltung zu sprechen oder nicht, ist für uns belanglos, da jedenfalls feststeht, daß man, wenn überhaupt, gewiß nur mit Schwierigkeiten in der Lage ist, einen oder den anderen Fall aufzuweisen, für den er nicht Geltung hätte. Die höhere Ergiebigkeit der arbeitsteilig verrichteten Arbeit ist das treibende Element der Gesellschaftsbildung und der fortschreitenden Verdichtung der gesellschaftlichen Zusammenarbeit. Man hat nicht mit Unrecht bemerkt, der Umstand, dem wir die Entstehung und Entwicklung der menschlichen Gesellschaft und mithin der Kultur verdanken, sei die Tatsache, daß geteilte Arbeit produktiver ist als isoliert verrichtete. Die Geschichte der Gesellschaftslehre als Wissenschaft beginnt mit dem Erfassen der Bedeutung, die der höheren Ergiebigkeit der in Arbeitsteilung verrichteten Arbeit für die Gesellschaftsbildung zukommt. Doch Gesellschaftslehre im Allgemeinen und Nationalökonomie im Besonderen haben das Arbeitsteilungsgesetz als ein wenn auch nahezu immer oder, praktisch gesprochen, immer zutreffendes Datum, nicht als einen Bestandteil ihres eigenen Gedankenbaues betrachtet. Es ist nun lehrreich, zu sehen, wie die historische Schule der Staatswissenschaften hier zu einem »historischen Gesetze« zu gelangen suchte.
BÜCHERs Stufentheorie will »die gesamte wirtschaftliche Entwicklung, wenigstens für die zentralund westeuropäischen Völker, wo sie sich mit hinreichender Genauigkeit historisch verfolgen läßt«, unter einem »Gesichtspunkt, der mitten hineinführt in die wesentlichen Erscheinungen der Volkswirtschaft«, begreifen, und findet diesen Gesichtspunkt in dem Verhältnis, in welchem die Produktion der Güter zur Konsumtion derselben steht, erkennbar an der Länge des Weges, welchen die Güter vom Produzenten bis zum Konsumenten zurücklegen. Daraus ergebe sich die Einteilung in die drei Stufen der geschlossenen Hauswirtschaft, der Stadtwirtschaft und der Volkswirtschaft [160].
[108]
Davon, daß die Charakterisierung jeder einzelnen der drei Stufen nur idealtypisch erfolgt und erfolgen kann, soll nicht mehr gesprochen werden; das ist eben ein im Wesen aller dieser historischen »Gesetze« begründeter Mangel. Nur darauf sei besonders hingewiesen, daß die Freiheit, die die Denkform der idealtypischen Konstruktionen bietet, es BÜCHER ermöglicht, den naheliegenden, ihm aber offenbar aus politischen Gründen unsympathischen Gedanken zurückzuweisen, daß »die Menschheit eine neue Stufe der Entwicklung zu erklimmen im Begriffe steht, die unter dem Namen der Weltwirtschaft den drei früheren Stufen gegenübergestellt werden müßte« [161]. Es kann aber nicht unsere Aufgabe sein, die kleineren Schwächen und Fehler in BÜCHERs Schematisierung aufzuzeigen; uns handelt es sich hier ausschließlich um die logische Gestalt und nicht um den konkreten Gehalt der Lehre. Alles, was BÜCHER festzustellen vermag, ist, daß drei Stadien im bisherigen Verlaufe der geschichtlichen Entwicklung zu unterscheiden wären; über die causa movens der vollzogenen Veränderungen und über die künftige Entwicklung kann er keine Auskunft geben Es ist nicht einzusehen, wie BÜCHER aus seiner Theorie heraus dazu gelangen konnte, jede folgende Stufe der vorangegangenen gegenüber als die »nächsthöhere« zu bezeichnen, und wie er dazu kommt, ohne weiteres anzunehmen, daß »der Übergang von der Volkswirtschaft zur nächsthöheren Stufe . . . kommen wird«, wobei er ausdrücklich hinzufügt, daß man nicht wissen könne, wie »die wirtschaftliche Zukunft im einzelnen aussehen wird« [162]. Der metaphorische Gebrauch des Ausdrucks »Stufen« hätte ihn nicht dazu verleiten dürfen, statt »folgende« Stufe »höhere« Stufe zu sagen, und nichts kann ihn, aus seiner Theorie heraus, berechtigen, etwas darüber auszusagen, daß überhaupt noch eine weitere Veränderung eintreten werde und daß eine solche nicht etwa auch in einem Zurückgehen auf eine der verlassenen früheren Stufen bestehen könnte. Man kann mithin unmöglich in einer Stufentheorie dieser Art ein »Gesetz« erblicken; BÜCHER vermeidet auch mit Recht diese Bezeichnung [163]. Eine Frage, die aber jedenfalls viel wichtiger ist als die, ob man es hier mit einem »Gesetz« zu tun hat oder nicht, ist die, ob die Aufstellung [109] solcher Schemata für die Erweiterung und Vertiefung unserer Erkenntnis der Wirklichkeit ersprießlich ist.
Wir müssen diese Frage verneinen. Der Versuch, die wirtschaftsgeschichtliche Entwicklung in ein knappes Schema hineinzupressen, ist nämlich nicht nur, wie aus den vorstehenden Bemerkungen hervorgeht, für unsere Erkenntnis wertlos, er wirkt geradezu schädlich. Er hat BÜCHER dazu geführt, jene Verkürzung des Weges, den die Güter vom Produzenten bis zum Konsumenten zurücklegen, die sich im spätrömischen Reiche durch Rückbildung der Arbeitsteilung vollzogen hat, nicht zu sehen. Der Streit darüber, ob man die Wirtschaft der Alten einfach als geschlossene Hauswirtschaft aufzufassen habe oder nicht, mag uns müßig erscheinen, wenn wir BÜCHERs wie jede ähnliche Schematisierung ablehnen. Doch den Umstand, daß die Antike in der Arbeitsteilung, mithin, um BÜCHERs Ausdruck zu gebrauchen, in »der Länge des Weges, welchen die Güter vom Produzenten bis zum Konsumenten zurücklegen«, weiter gegangen war als die ersten Jahrhunderte des Mittelalters, darf man nicht verkennen, wenn man sich nicht die Möglichkeit verschließen will, eine der größten geschichtlichen Veränderungen, den Untergang der antiken Zivilisation, zu verstehen. Die Erkenntnis der höheren Ergiebigkeit arbeitsteilig verrichteter Arbeit stellt uns das unentbehrliche Mittel zur geistigen Erfassung dieses Geschehens und zum Aufbau der für diese Erfassung erforderlichen Idealtypen zur Verfügung. Als solche dem Gegenstand angemessene Idealtypen mögen sich gerade die Begriffsgebilde der geschlossenen Hauswirtschaft (reine Eigenproduktion, tauschlose Wirtschaft), Stadtwirtschaft (Kundenproduktion) und Volkswirtschaft (Warenproduktion) bewähren. Der entscheidende und verhängnisvolle Fehler liegt nicht in ihrer Aufstellung, sondern in ihrer Verknüpfung zu einem Stufenschema und in dem Versuch, dieses auf dem Gesetz der Arbeitsteilung zu fundieren.
Denn mit gutem Grunde hat BÜCHER darauf verzichtet, seine Stufentheorie an dem Satze von der höheren Ergiebigkeit arbeitsteilig verrichteter Arbeit zu verankern. Das Arbeitsteilungsgesetz gibt nämlich nur eine Aussage über den objektiven Erfolg, der durch Arbeitsteilung erzielt werden kann, nicht aber etwa die Aussage, daß darum immerfort die Tendenz zur weiteren Ausgestaltung der Arbeitsteilung wirksam ist. Wann immer und wo immer ein Wirtschaftssubjekt vor die Entscheidung gestellt ist, zwischen einem Verfahren mit weitergehender Arbeitsteilung und einem solchen mit weniger weitgehender Arbeitsteilung zu wählen, wird es den ersten Weg gehen, vorausgesetzt,[110] daß es den größeren objektiven Ertrag, den es hiermit erzielen kann, auch erkannt hat und diesen Ertragsunterschied höher wertet als die etwa mit dem Übergange zur stärkeren Arbeitsteilung verknüpften sonstigen Folgen. Ob aber und in welchem Umfange diese Erkenntnis und diese Bewertung tatsächlich gegeben sind, darüber kann das Gesetz als solches nichts aussagen. Es kann uns daher lehren, eine bereits eingetretene Veränderung wohlgemerkt, sowohl eine solche in der Richtung stärkerer Ausbildung der Arbeitsteilung als auch eine solche in der Richtung zu weniger weitgehender Arbeitsteilung zu begreifen und kausal zu erklären, es kann uns aber nicht zeigen, daß und warum die Arbeitsteilung immer stärker ausgebildet werden muß. Zu diesem Schluß können wir nur auf Grund einer historisch d. h. mit den begrifflichen Mitteln der Geschichte durchführbaren Beurteilung dessen gelangen, was Völker, Gruppen und Individuen unter der Einwirkung der ihr Sein determinierenden Faktoren angeborene Qualitäten (rassisches Erbgut), natürliche, soziale und geistige Umwelt wollen. Da wir aber nicht wissen, wie sich im Innern des Menschen diese äußeren Faktoren in Wollen umsetzen, um dann als Verhalten wieder nach außen wirksam zu werden, da wir dies nur ex post festzustellen, keineswegs aber aus erkannter Gesetzlichkeit im voraus abzuleiten vermögen, können wir aus dem Arbeitsteilungsgesetz noch nicht darauf schließen, daß die Arbeitsteilung immer weitere Fortschritte machen muß. Es kann sein, daß die Arbeitsteilung sich vorübergehend oder auch dauernd wieder rückbildet ; es kann sein, daß eine Ideologie die Herrschaft erlangt, die in der Rückkehr zur Autarkie das soziale Ideal erblickt. Man mag das für recht unwahrscheinlich halten, doch eine eindeutige bestimmte Aussage kann man aus den dargelegten Gründen darüber nicht machen. Jedenfalls darf man nicht außer acht lassen, daß in der äußeren Wirtschaftspolitik der Staaten heute eine die internationale Arbeitsteilung bekämpfende Ideologie mächtig zur Geltung kommt.
Das Arbeitsteilungsgesetz gehört eben nicht zum allgemeingültigen System der apriorischen Gesetze menschlichen Handelns; es ist ein Datum, kein nationalökonomisches Gesetz. Schon darum erscheint es unmöglich, auf ihm ein exaktes also von idealtypischen Begriffsbildungen freies Fortschrittsgesetz aufzubauen. Da waren die Optimisten unter den liberalen fortschrittszuversichtlichen Soziologen der Aufklärung, denen man doch immer »mangelnden historischen Sinn« vorgeworfen hat, logisch bei weitem korrekter; sie haben nie bestritten, daß sie ihren festen Glauben auf stetigen gesellschaft-
lichen Fortschritt nicht auf »Gesetze«, sondern auf die Annahme stützten, daß das »Gute« und »Vernünftige« schließlich siegen müsse. Dieselben Mängel lassen sich an jedem Versuch einer Stufentheorie aufweisen. Den Stufentheorien liegen meist, wenn auch nicht immer, an sich richtige Beobachtungen und Feststellungen zugrunde. Doch der Gebrauch, den sie davon machen, ist unzulässig. Auch dort, wo die Erfahrung, auf die sie sich beziehen, nicht lediglich eine einmalige Aufeinanderfolge von Erscheinungen aufweist, gehen sie weit über das hinaus, was logisch erlaubt ist. Eine soziologische Erkenntnis, von der ein gutes Stück schon vor den Anfängen einer selbständigen Gesellschaftswissenschaft den Historikern eigen war, zeigt uns, welche Bedeutung dem Standort für die Ergiebigkeit der Produktion zukommt; da sich die Bedingungen, die die Standorte als mehr oder weniger günstig erscheinen lassen, verändern, gewinnt man ein Mittel, die Standortsverschiebungen und die Wanderbewegungen historisch zu erklären. Die geographischen Stufentheorien sind dagegen, ganz abgesehen davon, daß sie das Standortsgesetz in rohester und unzulänglichster Weise bringen, ja es geradezu verballhornen, nur geeignet, den Zugang zum Verständnis dieser Probleme zu erschweren. HEGEL meinte: »Die Weltgeschichte geht von Osten nach Westen; denn Europa ist schlechthin das Ende der Weltgeschichte, Asien der Anfang. Für die Weltgeschichte ist ein Osten χατ΄ έξοχήν vorhanden, während der Osten an sich etwas ganz Relatives ist; denn obgleich die Erde eine Kugel bildet, so macht die Geschichte doch keinen Kreis um sie herum, sondern sie hat vielmehr einen bestimmten Osten, und das ist Asien. Hier geht die äußerliche physische Sonne auf, und im Westen geht sie unter: dafür steigt aber hier die innere Sonne des Selbstbewußtseins auf, die einen höheren Glanz verbreitete [164]. Nach MOUGEOLLE gibt es ein »Gesetz der Höhen«, daß nämlich im Laufe der Geschichte die Stadt immer mehr vom Berge in die Ebene herabgerückt ist, und ein »Gesetz der Breiten«, daß die Zivilisation immer von den Tropen nach den Polen gegangen ist [165]. Auch in diesen »Gesetzen« finden wir alle Mängel, die jeder Stufentheorie anhaften; die causa movens der Veränderungen wird nicht aufgewiesen, und die Präzision der geographischen Begriffe, die sie enthalten, kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß sie im übrigen auf idealtypischen Begriffsbildungen aufgebaut sind, und zwar auf solchen so unbestimmter [112] und darum unbrauchbarer Art wie »Weltgeschichte« und »Zivilisation«. Noch viel schwerer aber fällt ins Gewicht, daß sie ohne weiteres den Sprung von der Feststellung des Standortsgesetzes zu einem durch ihn ausgelösten eindeutigen Wollen machen.
BECHER begründet seine Meinung, prinzipiell könne die Möglichkeit historischer Gesetze nicht bestritten werden, folgendermaßen: »Man hat historische Gesetze nicht als solche anerkennen wollen, weil sie sekundärer, reduzierbarer, nicht fundamentaler Natur sind. Diese Ablehnung stützt sich auf einen unzweckmäßig eng gefaßten Begriff des Gesetzes, der uns bei konsequenter Anwendung auf die Naturwissenschaften zwingen würde, vielen Zusammenhängen, die jedermann als Naturgesetze bezeichnet, diesen Titel zu versagen. Denn die meisten naturwissenschaftlichen Gesetze, z. B. die KEPLERschen Gesetze, die Gesetze der Wellenlehre über Resonanz, Interferenz usw., die geometrisch-optischen Gesetze der Hohlspiegelund Linsenwirkung, sind von sekundärer, nicht fundamentaler Art, sind auf fundamentalere Gesetze zurückzuführen. So wenig alle Naturgesetze letzte, unreduzierbare oder Fundamentalgesetze sind, so wenig sind sie allsamt Elementargesetze, d. h. Gesetze für elementare, nicht komplexe Erscheinungen. . . . Wenn aber zahlreichen weder fundamentalen noch elementaren naturwissenschaftlichen ‚Gesetzen’ diese Bezeichnung ganz allgemein zuerkannt wird, dann geht es nicht an, historischen Gesetzen diesen Namen streitig zu machen, weil diese nicht von fundamentaler und elementarer Art sind« [166]. Diese Argumentation trifft m. E. nicht den Kern der Sache. Nicht darum handelt es sich, ob man die Bezeichnung Gesetz nur auf Fundamentaloder allein auf Elementargesetze anwenden soll; das ist schließlich eine gleichgültige terminologische Frage. An und für sich wäre es nicht undenkbar, wenn auch im höchsten Maße unzweckmäßig und aller Denkökonomie hohnsprechend, die akustischen Gesetze derart zu formulieren, daß sie von Konzerten und nicht von Schallwellen aussagen. Wohl aber wäre es nicht denkbar, in diese Gesetze, wenn sie den Charakter naturwissenschaftlicher Gesetze bewahren sollen, Aussagen über die Beschaffenheit und den Ausdruck des Spiels des Konzertgebers aufzunehmen; sie müßten sich auf das beschränken, was mit den Mitteln physikalischen Denkens ausgesprochen werden kann. Nicht weil die historischen Erscheinungen kompliziert und zahlreiche, voneinander unabhängige Faktoren und Bedingungen an [113] ihnen beteiligt sind, können wir ihren Gesamtverlauf nicht in Gesetze fassen, sondern weil an ihnen auch Faktoren beteiligt sind, deren Mitwirkung wir nicht exakt zu bestimmen vermögen. Soweit die Bestimmtheit grundsätzlich möglich ist, reicht die soziologische Begriffsbildung; jenseits dieser Grenzen liegt das Gebiet der Geschichte, die den von der Soziologie gegebenen Rahmen in idealtypischer Begriffsbildung mit den Gegebenheiten des geschichtlichen Lebens erfüllt.
VIII. Qualitative und quantitative Analyse in der Nationalökonomie.
Das menschliche Handeln kann von der Soziologie nicht restlos begriffen werden; sie muß die Wertungsakte der Individuen als gegeben hinnehmen, sie vermag sie nur qualitativ, nicht aber auch in ihrem Ausmaß und demgemäß auch nicht im Ausmaß ihrer Wirkung vorauszubestimmen. Das ist jener Tatbestand, den man ungefähr im Auge hatte, wenn man die Eigenart der Geschichte in der Befassung mit dem Individuellen, mit dem Irrationalen, mit dem Leben, mit der Sphäre der Freiheit erkennen wollte [167]. Die Wertentscheidungen, die im menschlichen Verhalten hervortreten, sind für die Soziologie Daten, die sie nicht vorauszubestimmen weiß. Darum ist der Geschichte Voraussage des Kommenden versagt, und darum ist es eine Illusion, zu glauben, man könnte einmal die qualitative Nationalökonomie durch eine quantitative ersetzen oder ergänzen [168]. Die Nationalökonomie als theoretische Wissenschaft kann keine andere als qualitative Erkenntnis vermitteln; quantitative Erkenntnis kann immer nur die Wirtschaftsgeschichte ex post geben.
Die Gesellschaftswissenschaft ist in dem Sinne exakt, als sie mit begrifflicher Strenge nach einem eindeutig bestimmten und beweisbaren System strebt. Der Streit darüber, ob man sich in der Soziologie und besonders in der Nationalökonomie mathematischer Darstellungsformen bedienen soll, ist müßig. Die Probleme, mit denen es die Soziologie in allen ihren Teilgebieten und auch in dem der Nationalökonomie zu tun hat, bieten so außerordentliche Schwierigkeiten, daß ihnen gegenüber in den Augen vieler selbst die höchsten [114] Aufgaben der Mathematik den Vorzug größerer Anschaulichkeit besitzen. Wer auf die Hilfe, die ihm die mathematische Denkund Ausdrucksform bei der Bewältigung der nationalökonomischen Aufgaben bieten mag, nicht verzichten zu können glaubt, möge sich ihrer nur immer bedienen. Vestigia terrent! Die Theoretiker, die man als die Heroen der mathematischen Nationalökonomie zu bezeichnen pflegt, haben das, was sie geleistet haben, ohne Mathematik geschaffen; nachträglich haben sie ihre Gedanken mathematisch darzustellen gesucht. Bisher hat der Gebrauch der mathematischen Form in der Nationalökonomie mehr Unheil als Nutzen gestiftet. Der metaphorische Charakter der Übertragung von relativ anschaulicheren Begriffen und Vorstellungen der Mechanik, die als didaktisches und mitunter auch als heuristisches Hilfsmittel gerechtfertigt sein mag, wurde mißverstanden; man ließ hier nur zu oft die jeder Analogie gegenüber erforderliche Kritik außer acht. Das, worauf es in erster Linie ankommt, ist der Ansatz, der den Ausgangspunkt für die weitere mathematische Behandlung zu liefern hat; das ansetzende Denken ist aber immer amathematisch [169]. Von der Richtigkeit des Ansatzes hängt es ab, ob die weitere mathematische Bearbeitung brauchbar sein kann oder nicht; sie könnte unter Umständen wenn sie nämlich mathematisch fehlerhaft wäre von einem richtigen Ansatz zu falschen Ergebnissen gelangen, sie kann aber niemals den Fehler, der durch falschen Ansatz gemacht wurde, aufdecken.
Auch die mathematische Naturwissenschaft verdankt ihre Theorien nicht dem mathematischen, sondern dem amathematischen, dem ansetzenden Denken. Das, was der Verwendung der mathematischen Form in den Naturwissenschaften eine ganz andere Bedeutung verleiht, als ihr in der Soziologie und Nationalökonomie zukommt, ist der Umstand, daß die Physik empirisch konstante Beziehungen zu ermitteln vermag, die sie in ihre Gleichungen einsetzt [170]. So wird die auf der Physik aufgebaute wissenschaftliche Technologie befähigt, gegebene Aufgaben mit quantitativer Bestimmtheit zu lösen. Der [115] Konstrukteur vermag zu errechnen, wie eine Brücke beschaffen sein muß, um eine gegebene Belastung zu ertragen. Diese konstanten Beziehungen sind in der Nationalökonomie nicht aufzuweisen. Die Quantitätstheorie z. B. zeigt, daß ceteris paribus Vergrößerung der Geldmenge zum Sinken der Kaufkraft der Geldeinheit führt; doch die Verdoppelung führt nicht etwa zum Rückgang der Kaufkraft auf die Hälfte, die Beziehung zwischen Geldmenge und Kaufkraft ist nicht konstant. Es ist ein Irrtum, wenn man glaubt, aus statistischen Untersuchungen über das Verhältnis von Angebot und Nachfrage bestimmter Waren quantitative Schlüsse auf die Gestaltung dieses Verhältnisses in der Zukunft ziehen zu können. Alles, was auf diesem Wege festgestellt werden kann, hat nur historischen Wert, wogegen z. B. die Ermittlung der spezifischen Gewichte allgemeinen Wert hat [171].
Auch die Nationalökonomie kann in dem Sinne voraussagen, in dem diese Fähigkeit der Naturwissenschaft zugeschrieben wird. Was Vermehrung der Geldmenge für die Gestaltung der Kaufkraft bedeutet oder welche Wirkungen die Setzung von Preistaxen nach sich ziehen muß, weiß und wußte der Nationalökonom schon im voraus. Für die Nationalökonomie brachten daher die Inflationen der Kriegsund Revolutionszeit und die in Verbindung mit ihnen erlassenen Taxgesetze keine unvorhergesehenen Folgen. Doch diesem Wissen fehlt die quantitative Bestimmtheit. Die Nationalökonomie ist z. B. nicht in der Lage, zu sagen, wie groß die Nachfrageeinschränkung sein wird, mit der der Konsum auf eine quantitativ bestimmte Preissteigerung reagieren wird. Für die Nationalökonomie kommen die konkreten Wertentscheidungen der Individuen nur als Daten in Betracht. Und keine andere Wissenschaft auch nicht die Psychologie kann hier mehr leisten.
Gewiß, auch die Wertungen der Individuen sind kausal determiniert. Wir verstehen auch, wie sie zustande kommen. Daß wir ihre konkrete Gestaltung nicht im voraus abzusehen vermögen, liegt darin, daß wir hier auf jene Grenze stoßen, über die hinaus uns jede wissenschaftliche Erkenntnis versagt ist; das Verhältnis der Welt in uns zur Außenwelt müßte kennen, wer Wertungen und Wollen voraussagen will. Das hat LAPLACE nicht beachtet, als er von seiner Weltformel träumte.
[116]
IX. Die Allgemeingültigkeit soziologischer Erkenntnis.
Erfaßt man mit KANT »Natur« als »das Dasein der Dinge, sofern es nach allgemeinen Gesetzen bestimmt ist« [172] , und sagt man demgemäß mit RICKERT: »Die empirische Wirklichkeit wird Natur, wenn wir sie betrachten mit Rücksicht auf das Allgemeine, sie wird Geschichte, wenn wir sie betrachten mit Rücksicht auf das Besondere und Individuelle« [173] , dann muß man notwendigerweise zu dem Schlusse gelangen, daß die Soziologie, falls solche überhaupt möglich ist, als Naturwissenschaft, d. i. als eine mit der naturwissenschaftlichen Methode arbeitende Wissenschaft, anzusehen ist; auf der anderen Seite muß man dann die Frage, ob historische Gesetze möglich sind, mit nein beantworten. Gewiß hat die Vorstellung, daß Naturwissenschaft und Gesetzeswissenschaft identische Begriffe sind, viele von denen beherrscht, die die Forderung nach einer Gesetzeswissenschaft vom menschlichen Handeln in die Worte gekleidet haben, man müsse anfangen, die naturwissenschaftlichen Methoden auf die Geschichte anzuwenden. Terminologische Mißverständnisse aller Art haben überhaupt die Erörterung aller dieser Fragen in größte Verwirrung gebracht.
KANTs und RICKERTs Terminologie ist wohl nur aus der Tatsache heraus zu verstehen, daß beiden nicht nur die Soziologie unbekannt geblieben ist, sondern daß ihnen selbst auch nur die Möglichkeit soziologischer Erkenntnis nie ernstlich zum Problem wurde. Für KANT bedarf das weiter keines Nachweises [174]. Was RICKERT anbelangt, so vergleiche man die spärlichen und unzulänglichen Bemerkungen, die er der Soziologie widmet. Wenn RICKERT auch zugeben muß, daß sich »unter logischen Gesichtspunkten gegen eine naturwissenschaftliche oder generalisierende Darstellung der gesellschaftlichen Wirklichkeit« nichts einwenden läßt [175] , so fällt es ihm nicht ein, sich den Weg zu den logischen Problemen der Soziologie durch Bekanntschaft mit der Soziologie selbst zu bahnen; er läßt den Grundsatz [117] außer acht, daß die »Beschäftigung mit der Philosophie der Wissenschaften die Kenntnis der Wissenschaften selber voraussetzt« [176]. Es wäre verfehlt, daraus RICKERT, dessen Verdienste um die Logik der Geschichte nicht zu bestreiten sind, einen Vorwurf zu machen. Doch man muß mit Bedauern feststellen, daß RICKERT hier weit hinter dem zurückbleibt, was MENGER, gleich im Eingange seines Werkes, über den auch innerhalb der Sozialwissenschaften auftretenden Gegensatz zwischen den historischen, auf das Individuelle der Erscheinungen, und den theoretischen, auf das Generelle der Erscheinungen gerichteten Wissenschaften ausführt [177].
Die letzte Stellung, die in dem hartnäckigen Kampfe gegen die Anerkennung der Soziologie noch gehalten wird, ist die der Begrenzung der Gültigkeit der soziologischen Gesetze auf eine bestimmte geschichtliche Zeit. Es war der Marxismus, der zuerst auf diesen Ausweg verfiel. Für den Interventionismus, dem die historische Schule in der praktischen Politik zum Siege verhelfen wollte, mußte jeder Versuch, eine Gesetzmäßigkeit im Ablauf der gesellschaftlichen Dinge aufzuzeigen, gefährlich erscheinen, da er die Lehre von der Allmacht des obrigkeitlichen Eingriffs nicht aufgeben durfte; er lehnte schlechthin jede Theorie ab. Für den Marxismus lagen die Dinge anders. Ihm fiel es, zumindest für den Bereich der Theorie (in der praktischen Politik wurde es freilich allmählich anders, da rückten die marxistischen Parteien Schritt für Schritt auf den Boden des Interventionismus) nicht ein, den Nachweis der klassischen Nationalökonomie, daß die »Eingriffe« sinnwidrig sind, weil mit ihnen das angestrebte Ziel nicht erreicht werden kann, in Frage zu stellen. Er machte sich diese Auffassung um so lieber zu eigen, als sie es ihm ermöglichte, die Nutzlosigkeit aller Reformen der bestehenden Gesellschaftsordnung darzulegen, und alle Unzufriedenen auf das kommende Reich des Sozialismus zu verweisen. Das, was der Marxismus brauchte, war eine Theorie, die es ermöglichte, die ihm höchst unbequeme nationalökonomische Erörterung der Verwirklichungsmöglichkeit des sozialistischen [118] Gemeinwesens, in die er mit sachlichen Argumenten nicht einzugreifen vermochte, niederzuschlagen. Das bot ihm die Lehre von den Wirtschaftssystemen. Im Laufe der Geschichte folgt ein Wirtschaftssystem auf das andere, wobei wie bei allen Stufentheorien das spätere immer als das »höhere« anzusehen ist. Die metaphysischteleologische Grundeinstellung, die die wissenschaftlichen Stufentheorien von LIST, HILDEBRAND, SCHMOLLER und BÜCHER zu verhüllen suchen, wird vom Marxismus, obwohl er für sich das Prädikat »wissenschaftlich« mit Emphase beansprucht, ganz naiv hervorgekehrt; Ziel und Ende aller Geschichte ist das sozialistische Reich der Verheißung. Da aber der Sozialismus ein neues, heute noch nicht ausgebildetes Wirtschaftssystem darstellt, wäre es utopisch das bedeutet in der Sprache des Marxismus: unwissenschaftlich -, schon heute zu versuchen, die Gesetze, unter denen Wirtschaft und Gesellschaft dieses Systems stehen werden, ausfindig zu machen. Aufgabe der Wissenschaft kann es nur sein, die Gesetze der gegenwärtigen und der vergangenen Wirtschaftssysteme zu erforschen. Für das gegenwärtige, das kapitalistische Wirtschaftssystem, wollte MARX im »Kapital« diesen Versuch unternehmen. Später hat man dann innerhalb der Epoche des Kapitalismus noch mehrere Unterepochen mit besonderen Wirtschaftssystemen (Frühkapitalismus, Hochkapitalismus, Spätkapitalismus, Übergangszeit) unterscheiden wollen, und man ging daran, die Ökonomik eines jeden einzelnen dieser Systeme darzustellen.
Von der Unzulänglichkeit der konkreten Bemühungen, die SOMBART, ROSA LUXEMBURG, HILFERDING, BUCHARIN u. a. diesen Aufgaben gewidmet haben, können wir hier absehen [178]. Die Frage, die uns hier allein beschäftigt, ist die: Wäre eine Theorie, die nur für die Bedingungen einer Geschichtsepoche Geltung hat, noch Theorie in dem Sinne, in dem wir Theorie und Geschichte unterscheiden ? Erinnern wir uns an das, was wir oben über den logischen Charakter der Stufengesetze gesagt haben, dann kann die Antwort nicht schwer fallen. Die Zerlegung des gesamten Geschichtsverlaufes in Epochen kann nur idealtypisch vorgenommen werden. Dem Begriffsgebilde der einzelnen Wirtschaftsepoche fehlt daher, da es auf Merkmalen aufgebaut ist, die nicht in jedem ihm zu subsumierenden Einzelfall gegeben sein müssen, von vornherein die Allgemeingültigkeit. Mithin kann auch ein »theoretischer Satz«, der nur im Rahmen der Wirtschaftsepoche gelten soll, gleichfalls nur idealtypisch gedacht [119] sein. Nimmt man etwa als das Kriterium des Kapitalismus das Vorwalten des »kapitalistischen Geistes« an, so behauptet man natürlich nicht, daß dieser, wie immer näher umschriebene Geist mit einem Schlage alle in dieser Zeit lebenden Menschen erfaßt hätte; mit der idealtypischen Konstruktion verträgt sich ganz gut die Vorstellung, daß daneben auch noch anderer »Geist« wirksam gewesen sei; es wird ja nicht behauptet, daß der kapitalistische Geist ausnahmslos geherrscht, sondern nur, daß er vorgewaltet habe. Stellt man dann aber etwa Preisgesetze der kapitalistischen Wirtschaft auf, dann können diese gewiß nicht ausnahmslos gemeint sein; zumindest dort, wo neben dem im übrigen vorwaltenden kapitalistischen Geist noch oder schon anderer Geist zu finden ist, können ganz wohl oder müssen gar wohl andere Preisgesetze gelten. Wer daher nur historisch bedingte Theorie gelten lassen will, der bestreitet in Wahrheit jeder allgemein-gültigen Theorie die Berechtigung; was er auf dem Gebiete menschlichen Handelns gelten läßt, ist nur Geschichte mit der ihr eigentümlichen Begriffsarbeit der idealtypischen Konstruktion.
Die Ablehnung der allgemeingültigen Theorie hat aber auch für diese Schule wie für alle anderen Richtungen innerhalb des Historismus nur akademische Bedeutung; sie bleibt in ihrer Wirkung auf das Programm beschränkt. In den Arbeiten selbst wird unbedenklich von Begriffen und Urteilen Gebrauch gemacht, die nur als allgemeingültige logisch verstanden werden können. Jener besondere »Geist«, der den einzelnen Epochen eigentümlich sein soll, entpuppt sich bei näherem Zusehen als ein die Mehrzahl der Individuen beherrschendes Ideal, die besondere Gestaltung der Wirtschaftsverfassung als eine durch die Besonderheit dieses Ideals und durch die vorwaltenden Auffassungen über den besten Weg zu seiner Verwirklichung gebotene Technik gesellschaftlicher Kooperation.
Man darf nicht einwenden, die Spezies homo sapiens sei nur eine zeitliche Erscheinung, und demgemäß könne eine Wissenschaft vom menschlichen Handeln schlechthin von einer Wissenschaft vom menschlichen Handeln innerhalb eines begrenzten geschichtlichen Zeitabschnitts nur dem Grade, nicht auch dem logischen Charakter nach verschieden sein. Dieser Einwand verkennt den Sinn, den man im Bereiche menschlicher Wissenschaft dem Begriffe der Allgemeingültigkeit allein beizulegen vermag. Allgemeingültig kann natürlich immer nur bedeuten: überall gültig, wo die vorausgesetzten, streng zu bestimmenden Bedingungen gegeben sind. Nicht darauf, daß wir den Menschen von seinen noch nicht menschlichen Vorfahren empirisch [120] sondern, vielmehr darauf, daß wir menschliches Handeln von dem bloß reaktiven Verhalten der Zellen begrifflich unterscheiden, baut sich die Objektbestimmung der Wissenschaft vom menschlichen Handeln auf.
Schluß.
So berechtigt und notwendig es war, die naturalistische Forderung zurückzuweisen, die Geschichte müßte, nach naturwissenschaftlicher Methode betrieben, »historische Gesetze« suchen, so verkehrt und unsinnig war der Kampf des Historismus gegen die Gesetzeswissenschaft vom menschlichen Handeln.
Die Geschichte kann ihre Aufgabe nicht erfüllen, wenn sie auf den Gebrauch schärfster Logik verzichtet. Sie muß bei jedem ihrer Schritte mit allgemeingültigen Begriffen und Sätzen arbeiten, sie muß die Vernunft die ratio gebrauchen, sie muß ob sie will oder nicht theoretisieren. Wenn sie das aber tut und tun muß, dann ist es klar, daß die beste Theorie für sie gerade gut genug ist. Sie darf keinen Begriff und kein Urteil aus dem naiven Bestand der volkstümlichen Denkgewohnheiten übernehmen; sie muß die Begriffe und Sätze zuvor einer scharfen kritischen Prüfung unterziehen. Sie muß jeden Gedanken bis zu Ende denken und immer wieder prüfen und anzweifeln. Sie muß die einzelnen Gedanken zu einem System verbinden. Kurz: sie muß entweder selbst Theorie treiben oder die Theorie dort nehmen, wo sie als wissenschaftliche Theorie mit allen dem menschlichen Geist zugänglichen Mitteln ausgebildet wird.
Daß mit aller Theorie für die Geschichte noch nichts geschehen ist, ist klar. Doch die Geschichte kann mit ihrer eigentlichen Aufgabe erst ansetzen, wenn die Mittel der Theorie ganz erschöpft sind. Dort erst beginnt ihr Reich, das des Individuellen, des Zeitlichen, des geschichtlichen Ganzen. Die Schwelle dieses Reiches kann sie nur überschreiten, wenn sie bis dorthin von der Kraft des rationalen Denkens gebracht wurde.
Das spezifische »Verstehen in den Geisteswissenschaften«, meint ROTHACKER, schreitet auf den beiden rationalen Wegen des Begreifens und Erklärens so lange weiter, bis schließlich ein Sprung »in eine irrationale Beziehung« den Weg zum geisteswissenschaftlichen Verstehen ebnet. »Wird ein Werk begriffen, so liegt kein Verstehen im strengen Sinne vor. Wird es erklärt, ebenfalls nicht. Wo wir uns aber genötigt sehen, in einem Werk ein nicht restlos im Begriffe auflösbares und nicht restlos erklärbares Individuallebendiges [121] zu suchen, da glauben wir Versuchen des echten Verstehens, des Verstehens im prägnanten Sinn, zu begegnen.« Vorausgegangen aber sind diesem Verstehen »rationale Maßnahmen«, die »restlos ausgenutzt« wurden [179].
Am Ausgangspunkt des Methodenstreits erklärte WALTER BAGEHOT, der 1876 als erster gegen die Verwerfung der Theorie durch den Historismus Einsprache erhob, eine wirtschaftsgeschichtliche Darstellung sei »no substitute for a preliminary theory. You might as well try to substitute a corollary for the proposition on which it depends. The history of . . . is the history of a confused conflict of many causes; and unless you know what sort of effect each cause is likely to produce, you cannot explain any part of what happens. It is trying to explain the bursting of a boiler without knowing the theory of steam. Any history . . . could not be usefully told, unless there was a considerable accumulation of applicable doctrine before existing. You might as well to try to write the ‘life’ of a ship, making as you went along the theory of naval construction. Clumsy dissertations would run over the narrative; and the result would be a perfect puzzle« [180]. Daß der Historismus das vergessen konnte, daß er »theorielos« Material sammeln wollte, hat die Arbeit seiner besten Vertreter unfruchtbar gemacht. Nur mit der geistigen Ausrüstung, die die Theorie des menschlichen Verhaltens liefert, kann Geschichte wirklich Geschichte sein. Nicht um sich ihren eigentlichen Aufgaben zu entfremden, vielmehr um sie erst recht in wahrhaft historischem Sinne zu erfüllen, muß die Geschichte sich auf die Theorie stützen.
Und niemals sollte man das Wort BAGEHOTs vergessen: »Rightly conceived, the Historical method is no rival to the abstract method rightly conceived« [181].
[122]
Begreifen und Verstehen.↩
I. Erkenntnis von außen und Erkenntnis von innen.
Wir erklären ein Geschehen, indem wir es auf allgemeine Regeln zurückführen. Solches Erklären und anderes bleibt uns versagt bedeutet nun keineswegs etwa Aufweisung der letzten Ursache, des Realgrundes, des Seins und Werdens; früher oder später muß es stets an einen Punkt gelangen, über den hinaus wir nicht weiter vorzudringen vermögen.
Der Umstand, daß es uns bisher nicht gelingen konnte, das Verhältnis, das zwischen dem Psychischen und dem Physischen besteht, irgendwie zu erfassen, daß wir darüber nichts auszusagen vermögen, was man als allgemeine Regeln ansehen könnte, macht, daß wir ungeachtet der Einheit der logischen Struktur unseres Denkens es mit zwei gesonderten Gebieten der wissenschaftlichen Erkenntnis zu tun haben: mit der Wissenschaft von der Natur und mit der Wissenschaft von dem menschlichen Verhalten.
An den Gegenstand der Naturwissenschaft treten wir von außen heran. Das Ergebnis unserer Beobachtung ist die Feststellung funktionaler Abhängigkeitsverhältnisse. Die Aussagen über diese Beziehungen sind die allgemeinen Regeln, durch die wir das Geschehen erklären. Mit der Bildung des Systems dieser Regeln ist alles, was wir zu tun vermögen, erschöpft. In der Wissenschaft vom menschlichen Verhalten erfassen wir das Geschehen von innen. Als Menschen sind wir in der Lage, den Sinn menschlichen Handelns zu erfassen, den Sinn, den der Handelnde mit dem Handeln verbunden hat. Dieses Sinnerfassen läßt uns die allgemeinen Regeln bilden, mit deren Hilfe wir das Geschehen erklären.
Was dieses sinnerfassende Betrachten des menschlichen Verhaltens leistet, erkennt man wohl am besten, wenn man ihm den Versuch des Behaviorismus entgegenhält, das Benehmen der Menschen nach dem Vorgang der Tierpsychologie von außen zu betrachten. [123]Die Behavioristen wollen darauf verzichten, das Verhalten des Menschen aus dem Sinn heraus zu erfassen; sie wollen in ihm nichts anderes sehen als Reaktionen zu bestimmten Situationen. Würden sie ihr Programm streng durchführen, so könnten sie zu nichts anderem gelangen als zur Registrierung von Geschehnissen, die sich einmal zugetragen haben, ohne daß es zulässig wäre, aus dem, was sich einmal ereignet hat, auf das zu schließen, was sich in anderen Fällen der Vergangenheit ereignet hat oder was sich in der Zukunft abspielen wird. Schon die Situation, auf die der Mensch bewußt reagiert, kann in der Regel nur sinnhaft bestimmt werden. Will man sie bestimmen, ohne dabei auf den Sinn, den der handelnde Mensch in ihr sieht, einzugehen, dann wird es nicht gelingen, das herauszuheben, was an ihr wesentlich ist und über die Art der Reaktion entscheidet. Das Verhalten eines Menschen, den ein anderer mit einem Messer schneiden will, wird ganz verschieden sein, je nachdem er in der beabsichtigten Operation eine Verstümmelung oder einen chirurgischen Eingriff erblicken will. Keiner Künstelei kann es gelingen, eine Situation, wie etwa die durch Erstellung eines Kaufangebotes entstandene, zu bestimmen, ohne auf den Sinn einzugehen. Die Reaktion bewußten Verhaltens ist ausnahmslos sinnerfüllt und nur durch Eingehen auf ihren Sinn zu erfassen; sie ist immer Ausfluß sowohl einer Theorie, also einer Lehre, die Ursache und Wirkung verknüpft, als auch des Willens, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Nur durch Erschleichung könnte der Behaviorismus dazu gelangen, über sie etwas auszusagen. Würde der Behaviorismus, seinem Vorsatz getreu, vollkommen darauf verzichten, auf den »Sinn« einzugehen, so könnte es ihm nicht einmal gelingen, aus all dem, was man an Verhaltungsweisen von Menschen und Tieren mit den Sinnen wahrzunehmen vermag, das auszusondern, was er zum Gegenstand seiner Forschung macht [182]. Es würde ihm nicht gelingen, seine Aufgabe von der der Physiologie abzugrenzen. Die Physiologie, meint WATSON, befaßt sich besonders mit dem Verhalten der Teile des Lebewesens, der Behaviorismus besonders mit dem Verhalten des ganzen Lebewesens [183]. Doch die Reaktion des Körpers auf eine Infektion oder die Erscheinungen des Wachstums und des Alterns sind gewiß nicht unter den Begriff »Verhalten von Teilen« zu bringen. Will man andererseits eine Handbewegung als Verhalten des »ganzen Lebewesens« ansehen, so kann das wohl unter keinem anderen Gesichtspunkt geschehen [124] als dem, daß in dieser Handbewegung etwas wirksam wird, was keinem Teil des Lebewesens zugeschrieben werden kann; dieses Etwas kann aber wohl nichts anderes sein als der »Sinn« oder das den »Sinn« Setzende. Wenn die Behavioristen es als Ziel ihrer Arbeit hinstellen, menschliches Verhalten vorauszusagen und damit auch beeinflussen zu können, so muß man wohl fragen, wie man, ohne auf den Sinn einzugehen, etwa das Verhalten eines Menschen, der von einem zweiten angeredet wurde, voraussagen könnte.
Die Erfolge, die der Behaviorismus in der Beobachtung des Verhaltens von Tieren und Kindern erzielt hat, verdankt er der freilich nur versteckten und verleugneten Einführung der Teleologie. Ohne sie wäre alles, was er hätte leisten können, nichts anderes geblieben als eine ungeheuere Sammlung von Fällen, die sich dort und damals zugetragen haben.
II. Begreifen und Verstehen.
Für das Verfahren der Wissenschaften vom menschlichen Verhalten, dessen Wesen in der Erfassung des Sinns des Verhaltens liegt, hat sich in der deutschen Logik und Wissenschaftslehre der Ausdruck »Verstehen« eingebürgert [184] Um diesen Ausdruck so zu nehmen, wie ihn die Mehrzahl jener, die ihn verwendet haben, genommen haben, muß man sich vor allem vor Augen halten, daß die Entwicklung und Ausbildung einer theoretischen, auf die Gewinnung allgemeingültiger Regeln des menschlichen Verhaltens hinarbeitenden Wissenschaft in Deutschland entweder überhaupt nicht beachtet oder aber leidenschaftlich bekämpft worden war. Der Historismus wollte nicht gelten lassen, daß es neben den mit den Mitteln der Geschichte und der Philologie arbeitenden Wissenschaften auch noch eine nach allgemeingültiger theoretischer Erkenntnis strebende Wissenschaft vom menschlichen Verhalten gibt; er wollte nur Geschichte (im weitesten Sinne) gelten lassen und bestritt der Soziologie im allgemeinen und der nationalökonomischen Theorie im besonderen die Existenzberechtigung und Existenzmöglichkeit. Er hat nicht gesehen, daß ohne Rückgriff auf solche als allgemeingültig hingenommene Sätze auch [125] Geschichte nicht betrieben werden kann und daß logisch vor der Geschichte die Theorie des menschlichen Handelns steht. Sein Verdienst liegt in der Zurückweisung der Bestrebungen des Naturalismus, der nicht weniger irrend als der Historismus, wenn auch in anderer Hinsicht wieder alle Geschichtswissenschaft ablehnte und an ihre Stelle eine Wissenschaft der Gesetze menschlicher Entwicklung setzen wollte, die nach dem Vorbild der NEWTONschen Mechanik oder nach dem der DARWINschen Deszendenzlehre zu gestalten wäre. Der Begriff des Verstehens ist vom Historismus nicht nur im Kampfe gegen den Naturalismus zur Umschreibung der Verfahrensart der Wissenschaften vom menschlichen Verhalten ausgebildet worden; er diente zugleich im Kampfe gegen die Gesetzeswissenschaft vom menschlichen Verhalten. Wenn heute im deutschen wissenschaftlichen Schrifttum vom »Verstehen« die Rede ist, dann wird zwar in der Regel versichert, daß damit das den Sinn erfassende Verfahren der »Geisteswissenschaften« gemeint ist im Gegensatz zu dem Verfahren des Erkennens von außen, das die Naturwissenschaft übt. Da aber, wie schon bemerkt, diesem Schrifttum nahezu durchwegs die Erkenntnis fehlt, daß auch eine theoretische Wissenschaft vom menschlichen Verhalten möglich ist, hat es das Verstehen in der Regel als das spezifische Erfassen des Individuellen und Irrationalen, als das intuitive Erschauen des Historisch-Einmaligen zu bestimmen gesucht und es dem durch rationale Denkmittel erreichbaren Begreifen geradezu entgegengestellt [185]. An und für sich wäre es denkbar gewesen, als Verstehen jedes auf die Erfassung des Sinns gerichtete Verfahren zu bestimmen. Wie die Dinge heute liegen, müssen wir uns dem herrschenden Sprachgebrauch fügen. Wir wollen daher innerhalb des auf Erfassung des Sinns gerichteten Verfahrens, dessen sich die Wissenschaften vom menschlichen Verhalten bedienen, das Begreifen und das Verstehen sondern. Das Begreifen sucht den Sinn durch diskursives Denken zu erfassen, das Verstehen sucht den Sinn in einfühlendem Sicheinleben in eine Totalität.
Das Begreifen hat dort, wo es überhaupt anwendbar ist, in jeder Beziehung Vorrang vor dem Verstehen. Niemals kann das, was das diskursive Denken ergibt, durch intuitive Erfassung eines Sinnzusammenhanges widerlegt oder auch nur berührt werden. Der logische Raum des Verstehens liegt allein dort, wohin das Begreifen und der Begriff nicht dringen können, im Erfassen der Qualität der Werte. [126] Soweit das Begreifen reicht, herrscht die Logik mit ihrer Strenge, kann man beweisen und widerlegen, hat es einen Sinn, mit anderen über »wahr« und »nicht wahre Zwiesprache zu pflegen, Probleme zu stellen und ihre Lösung zu erörtern. Was so gewonnen wurde, muß man als bewiesen anerkennen, oder aber man muß es entweder als unbewiesen oder als widerlegt erweisen; man kann ihm nicht ausweichen, und man kann es nicht umgehen. Wo das Verstehen einsetzt, beginnt das Reich der Subjektivität. Von dem intuitiv Geahnten und Erschauten, das nicht in der Schmiede des begrifflichen Denkens gehärtet wurde, können wir anderen keine sichere Kenntnis vermitteln. Die Worte, in die wir es fassen, laden dazu ein, uns zu folgen und den von uns erlebten Komplex nachzuerleben, doch ob und wie uns nachgefolgt wird, hängt von der Persönlichkeit und dem Willen der Geladenen ab. Wir können nicht einmal mit Gewißheit feststellen, ob wir so verstanden wurden, wie wir verstanden werden wollten, denn nur die scharfe Prägung des Begriffes sichert Eindeutigkeit, nur dem Begriffe kann man das Wort genau anpassen. Mit dem Verstehen geht es wie mit den anderen Versuchen, die Erfassung der Totalität wiederzugeben, wie mit der Kunst, mit der Metaphysik und mit der Mystik. Was da gegeben wird, sind Worte, die man verschieden aufnehmen kann, aus denen man das heraushört, was man selbst in sie hineinlegt. Soweit der Geschichtsschreiber die politischen und militärischen Taten Cäsars schildert, kann zwischen ihm und seinen Lesern kein Mißverständnis entstehen. Wo er von Cäsars Größe, von seiner Persönlichkeit, von seiner Sendung und von seinem Charisma spricht, können seine Ausdrücke verschieden aufgenommen werden. Um das Verstehen kann es keine Auseinandersetzung geben, weil das Verstehen stets subjektiv bedingt ist. Das Begreifen ist Denken, das Verstehen ist Schauen.
Das »Begreifen« des rationalen Verhaltens setzt sich nicht so weitgesteckte Ziele, wie sie das »Verstehen« verfolgt. Doch in seinem Rahmen kann es alles leisten, was es zu leisten verspricht. Denn das rationale Verhalten erfassen und begreifen wir durch die unwandelbare logische Struktur unseres Denkens, in der alle Rationalität ihre Wurzel hat. Das Apriori des Denkens ist zugleich das Apriori des rationalen Handelns. Das Begreifen menschlichen Verhaltens ist die γνώσις τού όµοίου τώ όµοίω des Empedokles.
[127]
III. Das Irrationale als Gegenstand der Erkenntnis.
Alle Versuche wissenschaftlicher Erklärung vermögen im besten Falle die Veränderung eines Gegebenen zu erklären. Das Gegebene selbst ist unerklärbar. Es ist; warum es ist, bleibt uns verborgen. Es ist das Irrationale, das, was das Denken nicht erschöpfen kann, was die Begriffe nicht restlos erfassen können. Der Wissenschaft vom menschlichen Handeln sind die menschlichen Wertungen und Zielsetzungen letzter Ordnung ein Gegebenes, das sie nicht weiter zu erklären vermag. Sie kann die Werte registrieren und klassifizieren, doch es ist ihr ebensowenig möglich, die Werte zu »erklären«, als es ihr möglich ist, Werte zu setzen, als richtig anzuerkennen oder als verkehrt zu verwerfen. Die intuitive Erfassung der Werte durch das Verstehen ist noch kein »Erklären«; sie versucht die Werte zu sehen und zu bestimmen, nicht mehr. Wo der Geschichtsschreiber darüber hinauszugehen versucht, wird er zum Apologeten oder zum Richter, zum Agitator und zum Politiker; er verläßt die Sphäre der betrachtenden, forschenden und erkennenden Wissenschaft und betritt selbst das Feld menschlichen Handelns und Wirkens.
Wissenschaft gehört ganz und gar dem Bereiche der Rationalität an. Eine Wissenschaft vom Irrationalen gibt es so wenig als es irrationale Wissenschaft geben kann. Das Irrationale liegt jenseits des Bereiches menschlichen Denkens und menschlicher Wissenschaft; das Denken und die Wissenschaft kommen registrierend und klassifizierend bis zu ihm; »tiefer« können sie nicht dringen, auch nicht mit dem »Verstehen«. Das ist ja eben das Kriterium des Irrationalen, daß es vom Denken nicht voll erfalßt werden kann. Wessen wir uns denkend ganz bemächtigen können, ist nicht mehr irrational.
Am reinsten tritt uns das Irrationale als Objekt wissenschaftlicher Arbeit in der Kunstwissenschaft entgegen. Kunstwissenschaft kann immer nur Geschichte der Künste und der Künstler, der Kunsttechnik, der von der Kunst behandelten Stoffe und Motive und der sie beherrschenden Ideen sein. Eine allgemeingültige Lehre vom Künstlerischen, vom Kunstwerte und von der künstlerischen Individualität gibt es nicht. Was die Kunstschriftsteller darüber aussagen, verleiht nur ihrem persönlichen Erlebnis am Kunstwerke Ausdruck, mag Verherrlichung oder Ablehnung sein, mag »Verstehen« genannt wirden, ist aber, soweit es die Feststellung des irrationalen Tatbestandes überschreitet, nichts weniger als Wissenschaft. Wer ein Kunstwerk analysiert, löst es im strengen Sinne des Wortes auf. Der spezifische [128] Kunstwert aber wirkt nur im Ganzen des Werks, nicht in seinen Teilen. Das Kunstwerk ist ein Versuch, das All als Ganzheit zu erleben; man kann es, ohne seinem Wesen Abbruch zu tun, nicht in Stücke zerlegen, nicht zergliedern und nicht kommentieren. Die Kunstwissenschaft muß daher immer an der Außenseite der Kunst und ihrer Werke haften, sie kann nie die Kunst als solche erfassen. Sie mag vielen als unentbehrlich erscheinen, weil sie ihnen den Zugang zum Genuß der Kunstwerke eröffnet; sie mag in den Augen anderer mit einer besonderen Würde umkleidet sein, die der Glanz der Kunstwerke auf sie zurückwirft. Wenn aber wieder andere feststellen, daß sie an das spezifisch Künstlerische nie heranzukommen vermag, so ist auch das wahr, mag es auch unberechtigt sein, Kunstgeschichte und Kunsthistoriker darum gering zu achten.
Nicht anders als zu den Kunstwerten stellt sich die Wissenschaft zu den übrigen Werten, die die handelnden Menschen gelten lassen. Auch hier kann sie den Werten selbst gegenüber nichts mehr tun als sie verzeichnen und höchstens noch ordnen. Alles, was sie mit dem »Begreifen« zu leisten vermag, betrifft die Mittel, die zu den Werten führen sollen, kurz das rationale Verhalten der der Verwirklichung von Werten zustrebenden Menschen. Geschichte und Soziologie unterscheiden sich darin nicht grundsätzlich. Was sie unterscheidet, ist allein das, daß die Soziologie als theoretische Wissenschaft nach den allgemeingültigen Gesetzen des rationalen Verhaltens strebt, daß hingegen die Geschichte, diese Gesetze anwendend, den zeitlichen Ablauf des menschlichen Handelns darstellt. Gegenstand der Geschichte ist das historisch gegebene Individuelle, das sie mit den von der Theorie gelieferten Mitteln zu bearbeiten hat, das sie aber solange sie nicht ihre Grenzen überschreitet und zur Verkünderin von Werten wird auch mit dem »Verstehen« nicht ausschöpfen kann. Man mag, wenn man durchaus will, die Geschichte als eine Wissenschaft vom Irrationalen bezeichnen, doch man darf nicht vergessen, daß sie an dieses Irrationale nur mit den Denkmitteln der rationalen Wissenschaft heranzukommen vermag und daß dort, wo diese Mittel versagen, ihr nichts weiter gelingen kann als Feststellung des irrationalen Tatbestandes durch das einfühlende Verstehen.
Da das Verstehen das Individuelle, das Persönliche, die Werte nicht erklärt, da es ihren Sinn nicht durch Begreifen erfaßt, sondern lediglich schaut, kann es, soweit das Verstehen in Frage kommt, in den historischen Wissenschaften keinen Fortschritt in dem Sinne geben, in dem es einen Fortschritt der Naturwissenschaft oder der [129] Soziologie gibt. Fortschritt in der Geschichtswissenschaft gibt es nur insofern, als das Begreifen in Frage kommt, d. h. insoferne, als Vervollkommnung der Quellenbehandlung und vertiefte soziologische Erkenntnis es uns ermöglichen, den Sinn der Geschehnisse besser zu erfassen als dies früher möglich war, wenn wir z. B. mit Hilfe der nationalökonomischen Theorie wirtschaftsgeschichtliche Vorgänge heute anders zu erfassen imstande sind, als dies den älteren Historikern vergönnt war. Immer wieder aber muß Geschichte neu geschrieben werden, weil das persönliche Element dem Verstehen im Wandel der Zeiten und der Persönlichkeiten immer neue Gesichtspunkte eröffnet.
Das subjektive Element, das dem Verstehen stets beigemengt ist, macht, daß Geschichte von verschiedenem Standpunkt aus geschrieben werden kann. Es gibt eine Geschichte der Reformation vom katholischen und eine solche vom protestantischen Standpunkt. Nur wer die grundsätzlichen Unterschiede, die zwischen Begreifen und Verstehen, zwischen Soziologie und Geschichte bestehen, verkennt, wird geneigt sein, diese Verschiedenheit des Standpunktes auch für das Gebiet der Soziologie anzunehmen, etwa eine deutsche Soziologie der englischen oder eine proletarische Nationalökonomie der bürgerlichen gegenüberzustellen.
IV. Sombarts Kritik der Nationalökonomie.
Es ist ganz und gar verfehlt, wenn man glaubt, die Lehren der Katallaktik irgendwie in Frage stellen zu können durch die Behauptung, daß sie »rationale Schemata« seien [186]. Welchen Mißverständnissen MAX WEBER in der logischen Behandlung der modernen Nationalökonomie verfiel, habe ich bereits an anderer Stelle ausführlich darzulegen versucht [187]. Soweit SOMBART ihm nachfolgt, erübrigt sich jede weitere Bemerkung.
SOMBART geht jedoch weit über WEBER hinaus: »Der Begriff,Tausch’ etwa besagt gar nichts. Er bekommt seinen,Sinn’ erst durch die Beziehung auf den geschichtlichen Zusammenhang, in dem der Tausch stattfindet. Tausch` in der primitiven Wirtschaft (stummer Tauschhandel!), in der handwerksmäßigen Wirtschaft und in der kapitalistischen Wirtschaft sind himmelweit voneinander verschiedene [130] Dinge« [188]. »Preis und Preis sind völlig verschiedene Dinge von Markt zu Markt. Die Preisbildung auf der Messe in Veracruz im 17. Jahrhundert und auf dem Weizenmarkt an der Chicagoer Börse im Jahre 1930 sind zwei überhaupt nicht vergleichbare Vorgänge« [189].
Daß es allgemeingültige Begriffe in der Nationalökonomie gibt, bestreitet auch SOMBART nicht. Er unterscheidet »drei verschiedene Arten nationalökonomischer Begriffe«: 1. die »allgemein-ökonomischen Hauptbegriffe, . . . die für alle Wirtschaft gelten«; 2. die »historisch-ökonomischen Hauptbegriffe, . . . die . . . nur für ein bestimmtes Wirtschaftssystem gelten«; 3. die »Hilfsbegriffe, . . . die im Hinblick auf eine bestimmte Arbeitsidee gebildet werden« [190]. Was es im einzelnen mit dieser Einteilung für eine Bewandtnis hat, kann hier außer Betracht bleiben. Wir haben uns nur mit der Frage zu befassen, ob die Zuweisung der Begriffe Tausch und Preis an die zweite Gruppe gebilligt werden kann. SOMBART gibt dafür keine Begründung, es sei denn, man wollte eine solche in Ausführungen folgender Art erblicken: »Es wäre Unsinn, für das Schachspiel und das Mühlespiel dieselben Aufgaben zu geben. So ist es ebenfalls Unsinn, für eine geschlossene Eigenwirtschaft eines Bauern und für die hochkapitalistische Wirtschaft dieselben Schemata zu bilden« [191].
Auch SOMBART geht nicht soweit, zu behaupten, daß das Wort »Tausch« in Anwendung auf die primitive Wirtschaft mit dem Wort »Tausch« in Anwendung auf die kapitalistische Wirtschaft oder das Wort »Preis« in Anwendung auf die Messe in Veracruz im 17. Jahrhundert und das Wort »Preis« in Anwendung auf den Weizenmarkt der Chicagoer Börse im Jahre 1930 nichts weiter als homonym seien, etwa wie der »Bauer« und das »Bauer« oder wie »Niederlage« (dépôt) und »Niederlage« (défaite). Er spricht wiederholt von Tausch und Preis und Preisbildung ohne näheren Beisatz, was ganz sinnlos wäre, wenn es sich hier um Homonyma handeln würde. Wenn er sagt, »eine Theorie der Marktbildung hat der Theorie der Preisbildung voraufzugehen« [192] , so stellt er selbst einen für alle Preisbildung gültigen Satz auf und widerspricht damit seiner Behauptung: »Der Begriff ‚Tausch’ etwa besagt gar nichts.« Wären Preisbildung und Preisbildung wirklich »zwei überhaupt nicht vergleichbare Vorgänge«, [131] so wäre es ebenso sinnlos diesen Satz auszusprechen wie etwa einen Satz, der von allen Bauern von den Landwirten und von den Vogelkäfigen gelten soll. Etwas muß also doch den beiden Vorgängen gemeinsam sein. In der Tat erfahren wir auch, daß es »Notwendigkeiten der Preisbildung« gibt, die sich »aus der wesensmäßigen, der mathematischen und der rationalen Gesetzmäßigkeit, der naturgemäß auch die Preisbildung unterliegt«, ergeben [193].
Ist aber einmal festgestellt, daß den Ausdrücken »Tausch«, »Preis«, »Preisbildung« eindeutige Begriffe entsprechen, dann nützt es nichts, zu sagen, daß es sich innerhalb des Begriffs »um himmelweit voneinander verschiedene Dinge« und um »überhaupt nicht vergleichbare Vorgänge« handle. Solche vage Wendungen genügen nur dann, wenn sie feststellen wollen, daß gleichlautende Wörter vorliegen, die verschiedene Begriffe ausdrücken. Haben wir aber einen Begriff vor uns, dann können wir nicht anders verfahren, als indem wir vorerst den Begriff genau bestimmen und dann sehen, wieweit er reicht, was er deckt und was er nicht erfaßt. Dieses Verfahren liegt aber SOMBART fern. Er fragt nicht, was Tausch und Preis sind; er gebraucht diese Ausdrücke unbefangen, wie sie ihm der unwissenschaftliche Sprachgebrauch des Alltags zur Verfügung stellt.
Die nationalökonomische Theorie des Grenznutzens, von der SOMBART, vom bitteren Ressentiment der im Methodenstreit und sonst überall wissenschaftlich unterlegenen Schule ganz erfüllt, nur in Ausdrücken der Verachtung spricht, sucht nun diese Begriffe, die SOMBART einfach aufliest und bedenkenlos verwendet, genau zu bestimmen. Sie analysiert sie und holt dabei aus ihnen alles heraus, was in ihnen steckt, und reinigt sie von allen wesensfremden Zutaten, die das unscharfe Denken ihnen beigemengt haben mag. Man kann den Begriff »Tausch« nicht denken, ohne dabei implicite alles das mitzudenken, was die Tauschlehre der nationalökonomischen Theorie vom Tausche lehrt. Es gibt keinen Tausch, der »mehr«, und keinen, der »weniger« dem Grenznutzengesetz entspricht. Es gibt »Tausch« und »nicht Tausch«, aber nicht Gradunterschiede des Tausches. Wer das mißversteht, hat sich nicht die Mühe genommen, die Arbeit der nationalökonomischen Theorie der letzten dreißig Jahre kennenzulernen.
Wenn ein Reisender, aus dem »hochkapitalistischen« Deutschland nach einem von Primitiven bewohnten Eiland verschlagen, dem [132] fremdartigen und ihm zunächst unbegreiflichen und unverständlichen Gehaben der Eingeborenen, deren Sprache er nicht kennt, zusieht und plötzlich erkennt, daß sie »tauschen«, dann hat er »begriffen«, was hier vorgeht, obwohl er doch nur den Tausch des »Hochkapitalismus« kennt. Wenn SOMBART einen Vorgang im Veracruz des 17. Jahrhunderts als Tausch bestimmt und von Preisbildung bei diesem Tausch spricht, dann hat er die Begriffe Tausch und Preisbildung zur Erfassung des Sinns dieses Vorgangs verwendet. In beiden Fällen dient das »rationale Schema« dem Begreifen eines Vorgangs, der anders überhaupt nicht erfaßt, weder begriffen noch verstanden wirden kann. SOMBART muß sich dieses rationalen Schemas bedienen, weil er sonst an den Vorgang mit dem Denken überhaupt nicht herankommen könnte. Aber er will das rationale Schema nur so ungefähr verwenden, er weicht den unentrinnbaren logischen Konsequenzen dieser Verwendung aus, er will die Tragweite seines Vorgehens nicht sehen. Doch das »rationale Schema« ist entweder zu verwenden oder nicht zu verwenden. Hat man sich einmal entschlossen, es zu verwenden, dann muß man alle Folgen dieses Schrittes auf sich nehmen, dann muß man alles, was in ihm steckt, mitnehmen.
SOMBART erhebt für sich und wohl auch für seine Anhänger den Anspruch, allein als Theoretiker »im echten Sinne« zu gelten. Die anderen die »Anfertiger rationaler Schemata« könne man nur in Anführungszeichen als »Theoretiker« bezeichnen [194]. Drei Dinge wirft er diesen »Theoretikern« vor: Zunächst hätten sie »dank des ihnen eigenen Mangels an nun wirklich theoretischer Bildung« in ihrer Mehrzahl »Sinn und Bedeutung der von ihnen hergestellten Schemata nicht richtig erfaßt«. Sie hätten »sie für Naturgesetze gehalten und auf sie ein naturwissenschaftlich gerichtetes Lehrgebäude aufgeführt« [195]. Da man, dem Vorgang KANTS folgend, in der deutschen Wissenschaftslehre die Wissenschaft vom Allgemeinen mit Naturwissenschaft gleichsetzte, mußten die, die die Möglichkeit einer nach allgemeingültiger Erkenntnis strebenden Wissenschaft vom menschlichen Verhalten behauptet haben, diese Wissenschaft als Naturwissenschaft klassifizieren [196]. Den Charakter und den Inhalt der von ihnen betriebenen Wissenschaft hat das nicht beeinflußt.
Der zweite Vorwurf, den SOMBART gegen die »Theoretiker« erhebt, ist der, daß sie »viel zu viel und oft viel zu komplizierte Produktionsmittel« [133] SOMBART bezeichnet die »Schemata« als »Produktionsmittel« geschaffen hätten, deren »Benutzung unmöglich ist und die den Produktionsprozeß eher erschweren als erleichtern (wie etwa ein Traktor in einem landwirtschaftlichen Betrieb, für den er nicht paßt)« [197]. Die bildhafte Sprache, die SOMBART hier gebraucht, lenkt die Aufmerksamkeit von dem Punkte ab, auf den es allein ankommt: entweder ist die Theorie richtig oder falsch. Zu viel an richtiger Theorie kann es nicht geben. Ist die Theorie richtig, dann kann sie auch nicht »zu kompliziert« sein; wer das behauptet, der hat sie durch eine richtige, jedoch einfachere Theorie zu ersetzen. Doch SOMBART versucht das gar nicht. Im Gegenteil. Er wirft an anderer Stelle der »Theorie« vor, daß sie zu einfach sei: »Die tatsächlichen Verhältnisse können so verwickelt sein und sind häufig so verwickelt, daß das Schema nur geringe Hilfe gewährt« [198].
Der dritte Vorwurf SOMBARTs gegen die »Theoretiker« ist der, daß »sie vielfach unpassende Schemata gebildet haben, das heißt also Produktionsmittel, mit denen nichts anzufangen ist, Maschinen, die nicht funktionieren«. Hierher rechnet er »zum großen Teil die Grenznutzenlehre, deren sehr bescheidener Erkenntniswert ja bereits eingesehen worden ist. Diese Ansicht näher zu begründen, ist jedoch hier nicht der Ort« [199]. Also: die »Theorie« ist falsch, weil sie falsch ist, und weil man es bereits eingesehen hat. Die Begründung bleibt SOMBART uns schuldig. Er gibt ein Werturteil über die Grenznutzenlehre ab. Was von solchen Werturteilen zu halten ist, hat er selbst treffend ausgeführt [200].
Ich habe schon so oft auseinandergesetzt, welche wirtschaftspolitische Gesinnung die Interventionisten und welche die Sozialisten zu dieser theoriefeindlichen Haltung veranlaßt hat, daß ich mir hier die Wiederholung ersparen kann [201]. Die historische Erklärung läßt uns übrigens den Irrtum, der hier vorliegt, mir in seiner vom Standpunkt der theoretischen Untersuchung gesehen zufälligen Verumständung verstehen; begreifen können wir den Irrtum SOMBARTs nur auf Grund der streng logischen Prüfung seines Gedankenganges.
Bei keinem zweiten Gegner der Katallaktik liegen die politischen [134] Beweggründe dieser Gegnerschaft so klar zutage wie bei SOMBART. In das System der Wissenschaftslehre, das er in seinem jüngsten Werke vorträgt, würde die unumwundene Anerkennung der modernen nationalökonomischen Theorie viel besser hineinpassen als ihre Ablehnung. Doch ein feuriges Temperament und das Empfinden, es seiner eigenen wissenschaftlichen Vergangenheit schuldig zu sein, lassen ihn immer wieder seinem Vorsatz, frei von Werturteilen zu forschen, untreu werden. SOMBART glaubt, unsere »Wirtschaftsepoche« mit ihrem »Wirtschaftssystem« glaubt den »modernen Kapitalismus« aus seinem Geist heraus verstanden zu haben. Kann diesen Anspruch wirklich erheben, wer das Zeitalter, »dessen Höhepunkt wir heute erst erleben«, bezeichnet als das Zeitalter »der Mittel, die ohne Sinn verwandt werden und deren reiche und kunstvolle Verwendung schließlich unmerklich zum Zwecke wird«? [202] Steht nicht damit in schroffstem Widerspruch, daß SOMBART selbst immer wieder Rationalisierung als das Wesen dieses Zeitalters bezeichnet? Rationalismus bedeutet doch genaues Abwägen der Mittel und der Ziele. Gewiß, SOMBART schwärmt für das Mittelalter und schätzt die Werte, die seiner Meinung nach dem mittelalterlichen Menschen gültig waren, besonders hoch. Die Menschen, meint er, haben seither ihr Blickfeld »von den ewigen Werten zu den Dingen dieser Welt« verschoben [203]. SOMBART tadelt das. Doch darf man darum sagen, daß die Mittel »ohne Sinn« verwandt werden ? Sie werden wir wollen das nicht näher prüfen vielleicht in anderem Sinn verwandt, doch wohl nicht »ohne Sinn«. Selbst wenn es wahr wäre, daß deren »reiche und kunstvolle Verwendung« zum »Zwecke« wurde, dann wäre die verstehende und nicht richtende, die wertfreie Wissenschaft nicht berechtigt, diesem Zweck den »Sinn« abzusprechen. Sie kann die Verwendung der Mittel im Hinblick auf ihre Zweckmäßigkeit d. h. ob sie geeignet sind, den Zweck zu erreichen, den die, die sie verwenden, erreichen wollen beurteilen, sie kann aber niemals über die Zwecke selbst zu Gericht sitzen.
Ungeachtet aller guten Vorsätze verfällt eben der Forscher nur zu leicht dem Werten und Richten, wenn er die geistige Hilfe, die ihm die »rationalen Schemata« der Theorie geben könnten, verschmäht.
[135]
V. Logik und Sozialwissenschaft.
Zwei Aufgaben waren der besonderen Logik der Sozialwissenschaften in den letzten Menschenaltern gestellt: Auf der einen Seite hatte sie die Eigenart, die Möglichkeit und die Notwendigkeit der Geschichte aufzuweisen, auf der anderen Seite hatte sie zu zeigen, daß und wie es eine nach allgemeingültiger Erkenntnis hinstrebende Wissenschaft vom menschlichen Verhalten gibt. Es ist nicht zu bestreiten; daß sie zur Lösung dieser beiden Aufgaben ganz außerordentlich viel geleistet hat. Daß diese Lösungen nicht »endgültig« und nicht »abschließend« sind, ist klar; »Endgültiges« und »Abschließendes« gibt es nicht, solange der menschliche Geist nicht aufgehört hat, zu denken, zu streben und zu forschen.
Wenn vom Boden bestimmter politischer Ideen, die man mit den Mitteln der allgemeinen Logik nicht zu vertreten vermag, immer wieder die Forderung erhoben wird, das sozialwissenschaftliche Denken von den allem Denken notwendigen Regeln zu befreien, so ist das eine Sache, mit der sich das wissenschaftliche Denken, das sich an diese logischen Regeln gebunden erachtet, nicht zu befassen vermag.
Als vor mehr als einem Jahrhundert SISMONDI gegen RICARDO auftrat, verkündete er, die politische Ökonomie sei keine »science de calcul«, sondern eine »science morale«, für die er den Satz aufstellte, »toute abstraction est toujours une déception« [204]. Das Geheimnis, wie man ohne abstrakte Begriffe Wissenschaft betreiben könnte, haben uns weder SISMONDI noch die vielen, die das Schlagwort von ihm übernommen haben, verraten. Heute wird uns als jüngstes Erzeugnis der sozialwissenschaftlichen Logik der »lebendige Begriff« empfohlen, der die Kraft hat, »neue Inhalte aufzunehmen«. Da lesen wir in den programmatischen Erklärungen, die eine von einem Kreise deutscher Hochschullehrer herausgegebene neue »Zeitschrift für geistige und politische Gestaltung« einleiten: »Begriffe sind lebendig, solange sie die Kraft haben, neue Inhalte aufzunehmen. Neue Inhalte aufnehmen heißt nicht, die alten abstoßen, heißt nicht, sich von den Ursprüngen losreißen, aus denen der Begriff einmal geboren ist. Neue Inhalte aufnehmen heißt vielmehr: Die Macht eines Begriffes und durch ihn hindurch die Macht seines Ursprunges daran zu erweisen, daß er jede ihm drohende Erstarrung zu durchbrechen vermag« [205]. [136] Daß man mit Begriffen von veränderlichem Inhalt trefflich streiten und ein System bereiten kann, ist wohl zuzugeben. Wir »Verstehen« das Bedürfnis bestimmter politischer Parteien nach solchen Gebilden sehr gut. Wir haben jedoch nur das eine festzustellen, daß hier nicht ein Bedürfnis des sozialwissenschaftlichen Denkens vorliegt, sondern das Bedürfnis politischer Parteien, die ihre Programme logisch nicht zu rechtfertigen vermögen.
Nur der Umstand, daß diese Parteien heute mit guter Aussicht auf Erfolg nach der Weltherrschaft streben, daß die Massen ihnen nachfolgen, daß der Staat ihnen alle Lehranstalten übergeben hat, daß die Literaten sie in den Himmel heben, läßt es zweckmäßig erscheinen, den Gemeinplatz zu wiederholen, daß es nur eine Logik gibt und daß alle Begriffe durch die Eindeutigkeit und Unwandelbarkeit ihres Inhaltes gekennzeichnet sind.
[137]
Vom Weg der subjektivistischen Wertlehre.↩
I. Die Umgrenzung des »Wirtschaftlichen«.
Den geschichtlichen Ausgangspunkt der Überlegungen, die zur Ausbildung der nationalökonomischen Theorie geführt haben, bildeten Untersuchungen über die Geldpreise der Güter und Dienstleistungen. Der erste Schritt, der diesen Forschungen den Weg zum Erfolge eröffnete, war die Einsicht, daß das Geld »nur« eine Vermittlerrolle spielt, daß durch seine Vermittlung in letzter Linie Waren und Dienste gegen Waren und Dienste ausgetauscht werden, und daß man daher logisch vor die Theorie des durch Geld vermittelten mittelbaren Tausches (Theorie des indirekten Tausches, auch Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel) die Theorie des direkten Tausches zu stellen habe, die mit der Fiktion arbeitet, daß alle Tauschhandlungen ohne Dazwischentreten eines Tauschvermittlers durchgeführt werden. Noch weitere Erkenntnismöglichkeiten wurden erschlossen, als man begriffen hatte, daß die Tauschhandlungen zwischen wirtschaftenden Individuen dem Wesen nach von dem, was der Einzelne auch ohne Hinausgreifen in die gesellschaftliche Sphäre in seinem Haushalte an Veränderungen vornimmt, nicht verschieden sind, daß also jede Verfügung über Güter auch die in den Produktionsprozessen ein Tauschen ist, und daß man somit das Grundgesetz des wirtschaftlichen Handelns schon an dem Verfahren des isolierten Wirts zu erfassen vermag. Damit hatte man die Grundlage gewonnen, auf der man erst das Problem der Abgrenzung des »wirtschaftlichen« Handelns vom »nichtwirtschaftlichen« Handeln korrekt stellen und einer befriedigenden Lösung zuführen konnte.
Auf zwei verschiedenen Wegen war man an dieses Problem schon früher herangekommen, freilich in einer Weise, die seine Lösung beträchtlich erschweren mußte. Der klassischen Nationalökonomie war es nicht gelungen, die Schwierigkeiten, die die scheinbare Antinomie der Werterscheinung bot, zu überwinden; sie mußte ihre Wert-und Preislehre vom Tauschwerte her aufbauen, sie mußte vom Handeln des Kaufmanns ausgehen, weil sie es nicht vermochte, von den Wertschätzungen der letzten Verbraucher aufsteigend ihr System aufzurichten. Das spezifische Verhalten des Kaufmanns ist durch das [138] Streben nach Erzielung des höchsten erreichbaren Geldgewinnes bestimmt, indem die Klassiker in diesem das Wesen des wirtschaftlichen Verhaltens erblickten, mußten sie »wirtschaftliches« und »nichtwirtschaftliches« Verhalten nach diesem Gesichtspunkt sondern. Diese Unterscheidung mulßte sich, weil dem Grundgedanken des Systems widersprechend, als ganz unbrauchbar, ja geradezu als sinnwidrig, erweisen, sobald man den Übergang zur subjektivistischen Wertlehre vollzogen hatte; es hat freilich geraumer Zeit bedurft, ehe man es erkannte.
Erwies sich die Scheidung des »Wirtschaftlichen« vom »Nichtwirtschaftlichen« von seiten der Motive und der nächsten Ziele des Handelnden her als unhaltbar, so ging es mit dem Versuche, die Objekte des Handelns zur Grundlage der Scheidung zu machen, nicht besser. Körperliche Dinge der Außenwelt werden nicht nur gegen andere Dinge dieser Art ausgetauscht, sondern auch gegen andere »immaterielle« Güter, wie Ehre, Ruhm und Anerkennung, hingegeben. Wollte man diese Handlungen aus dem Bereich des »Wirtschaftlichen« hinausweisen, dann ergibt sich eine neue Schwierigkeit. Denn ein großer Teil aller Tauschhandlungen, in denen materielle Güter umgesetzt werden, dient dem einen oder beiden Kontrahenten nur als Wegbereiter zur Erlangung solcher »immaterieller« Befriedigung. Jeder Versuch, hier scharf zu scheiden, mußte jedoch in scholastisch unfruchtbare und sich hoffnungslos in innere Widersprüche verwickelnde Erörterungen von der Art jener führen, die die Nachfahren der Klassiker den verwandten Bestrebungen zur Umgrenzung der Begriffe »Gut« und »Produktivität« gewidmet hatten. Doch auch wenn man davon ganz absehen wollte, durfte man sich nicht der Tatsache verschließen, daß das menschliche Verhalten eine unauflösbare Einheitlichkeit aufweist, und daß es, wenn es Sachgüter gegen nicht materiell verkörperte Güter umsetzt, sich in nichts von dem unterscheidet, was es im Umsatz von Sachgütern kennzeichnet.
Aus dem werttheoretischen Subjektivismus folgen zwei Sätze, die eine strenge Scheidung zwischen »Wirtschaftlichem« und »Nichtwirtschaftlichem«, wie sie die ältere Nationalökonomie suchte, als undurchführbar erscheinen lassen. Da ist zunächst die Erkenntnis, daß das wirtschaftliche Prinzip das Grundprinzip alles rationalen Verhaltens und nicht etwa eine Besonderheit einer bestimmten Art dieses Verhaltens ist; alles rationale Verhalten ist sohin ein Wirtschaften. Das zweite ist die Erkenntnis, daß jedes bewußte sinnvolle Verhalten rational ist. Jenseits der Rationalität stehen nur und zwar [139] immer und ausnahmslos die letzten Ziele (Werte, Zwecke), denen das Verhalten zustrebt. Mit dem Subjektivismus war es nicht mehr vereinbar, rational und irrational mit objektiv zweckmäßig und objektiv unzweckmäßig gleichzusetzen; es ging nicht mehr an, das »richtige« Handeln dem unrichtigen durch Irrtum, Unkenntnis, Unachtsamkeit vom besten Wege abgelenkten Verhalten als rational gegenüberzustellen. Ebensowenig war es weiterhin möglich, ein Verhalten, in dem Werte wie Ehre, Religiosität, politische Ziele berücksichtigt werden, irrational zu nennen. MAX WEBERS Versuch, eine Sonderung des zweckrationalen vom übrigen Verhalten auf solchen Unterscheidungen aufzubauen, war der letzte dieser Art; er mußte mißlingen [206].
Wenn aber alles bewußte Verhalten rationales Wirtschaften ist, dann muß man die Grundkategorien der Wirtschaft in jedem, also auch in dem vom Sprachgebrauch »nichtwirtschaftlich« genannten Verhalten aufweisen können. In der Tat gelingt es auch unschwer, in jedem denkbaren menschlichen bewußten Verhalten die Grundkategorien der Katallaktik (Wert, Gut, Tausch, Preis, Kosten) nachzuweisen. Das zeigt nicht nur die Wissenschaft von der Ethik. Auch der Sprachgebrauch des Alltags gibt uns dafür genug Beweise. Man beachte z. B., wie außerhalb jenes Bereiches, den man im Alltag als den der Wirtschaft zu bezeichnen pflegt, Ausdrücke und Wendungen gebraucht werden, in denen von diesen Kategorien die Rede ist.
II. Das Vorziehen als Grundelement des menschlichen Verhaltens.
Alles bewußte Verhalten von Menschen stellt sich als Vorziehen eines A einem B gegenüber dar. Es ist ein Wählen zwischen sich bietenden Möglichkeiten. Diese Wahlakte allein, diese in die Außenwelt hinauswirkenden inneren Entscheidungen, sind uns gegeben. Wir erfassen ihren Sinn, indem wir den Begriff der Wichtigkeit setzen. Wenn ein Individuum A dem B vorzieht, dann sagen wir, daß ihm im Augenblicke des Wahlaktes A wichtiger (wertvoller, begehrenswerter) erschien als B.
Wir pflegen auch zu sagen, daß das Bedürfnis nach A dringender war als das Bedürfnis nach B. Das ist eine Ausdrucksweise, die unter Umständen recht zweckmäßig sein mag. Doch sie ward als Hypostasierung des zu Erklärenden zur Quelle bösartiger Mißverständnisse. [140] Man vergaß, daß wir das Bedürfnis nur aus dem Verhalten zu erkennen vermögen, daß daher die Vorstellung eines nicht den Bedürfnissen entsprechenden Verhaltens unsinnig ist, und daß man in dem Augenblick, in dem man versucht, zwischen dem Bedürfnis und dem Verhalten zu unterscheiden und das Bedürfnis zum Richter über das Verhalten zu machen, den Boden der theoretischen wertfreien Wissenschaft verläßt. Hier tut es not, sich darauf zu besinnen, daß wir die Lehre vom menschlichen Verhalten vor uns haben und nicht etwa Psychologie und schon gar nicht eine Normenlehre, die gut und böse oder Wert und Unwert zu scheiden hat. Gegeben sind für uns die Handlungen, das Verhalten. Es mag dahingestellt bleiben, wieweit und in welcher Art wir uns mit dem, was dahinter steht Wertsetzungen, Wollungen -, in unserer Wissenschaft zu befassen haben. Denn nicht zu bezweifeln ist, daß wir uns mit dem gegebenen Verhalten, und nur mit ihm, zu befassen haben, und daß Verhalten, das sein sollte, aber nicht ist, für uns nicht in Betracht kommt.
Das wird uns am besten klar, wenn wir die Aufgabe der Katallaktik ins Auge fassen. Die Katallaktik hat zu erklären, wie aus dem Verhalten der am Tauschverkehr Beteiligten die Marktpreise entstehen. Sie hat die Marktpreise zu erklären, wie sie sind, und nicht, wie sie sein sollten. Wenn man dieser Aufgabe gerecht werden will, dann darf man keineswegs »wirtschaftliche« und »nichtwirtschaftliche« Preisbestimmungsgründe sondern und sich darauf beschränken, eine Theorie des Preises zu schaffen, die nur für eine Welt zutreffend wäre, die nicht ist. In dem berühmten BÖHM-BAWERKschen Beispiel von den fünf Kornsäcken des Kolonisten ist nicht von einer Rangordnung objektiver Richtigkeit, sondern von einer Rangordnung der subjektiven Begehrungen die Rede.
Die Grenze, die das Wirtschaften vom Nichtwirtschaften trennt, ist nicht innerhalb des Raumes des rationalen Handelns zu suchen; sie fällt mit der Linie zusammen, die das Handeln vom Nichthandeln sondert. Gehandelt wird nur dort, wo Entscheidungen zu treffen sind, wo die Notwendigkeit der Wahl zwischen möglichen Zielen besteht, weil alle Ziele entweder überhaupt nicht oder nicht zu gleicher Zeit erreicht werden können. Die Menschen handeln, weil sie dem Zeitwandel unterworfen sind und daher dem Zeitablauf gegenüber nicht indifferent sind. Sie handeln, weil sie nicht voll befriedigt und genußgesättigt sind, und weil sie handelnd den Grad der Befriedigung erhöhen können. Wo diese Voraussetzungen fehlen den »freien« Gütern gegenüber wird nicht gehandelt.
[141]
III. Eudämonismus und Wertlehre.
Die ärgerlichsten Mißverständnisse, die die Geschichte des philosophischen Denkens kennt, knüpfen sich an die Ausdrücke Lust und Unlust. Sie sind in das Schrifttum der Soziologie und Nationalökonomie übergegangen und haben auch hier Unheil gestiftet.
Die Ethik war vor Einführung dieses Begriffspaares eine Lehre von dem, was sein soll; sie suchte Ziele, die der Mensch sich stecken soll. Mit der Erkenntnis, daß der Mensch mit seinem Tun und Lassen Befriedigung sucht, war die Bahn eröffnet, auf der allein man zu einer Wissenschaft vom menschlichen Verhalten gelangen kann. Wenn EPIKUR in der άταραξία das Endziel sieht, so können wir, wenn wir wollen, darin jenen Zustand der Vollbefriedigung und Wunschlosigkeit erblicken, dem das menschliche Verhalten zustrebt, ohne ihn je erreichen zu können, und den grobmaterialistisches Denken in den Traumbildern des Paradieses und des Schlaraffenlandes zu umschreiben suchte. Ob man tatsächlich EPIKURs Worten diesen Sinn unterlegen darf, bleibt bei der Spärlichkeit der Überlieferung freilich ungewiß. Jedenfalls geschah es nicht ohne Verschulden EPIKURs und seiner Schule, daß man die Begriffe Lust und Unlust im engsten und grobmateriellen Sinne nahm, wenn man die Ideen des Hedonismus und Eudämonismus mißverstehen wollte. Und man wollte sie nicht nur mißverstehen; man wollte sie entstellen, karikieren, verspotten und verhöhnen. Erst das 17. Jahrhundert begann wieder Verständnis für die Lehren des Epikureismus zu zeigen. Auf den von ihm geschaffenen Grundlagen erwuchs der moderne Utilitarismus, der seinerseits wieder bald mit denselben Entstellungen der Gegner zu kämpfen hatte, die seinem antiken Vorläufer entgegengetreten waren. Hedonismus, Eudämonismus und Utilitarismus wurden verfehmt und geächtet, und wer nicht Gefahr laufen wollte, sich die ganze Welt zum Feind zu machen, mußte ängstlich darauf bedacht sein, dem Verdachte zu entgehen, daß er diesen ketzerischen Lehren zuneige. Man muß dies im Auge behalten, wenn man verstehen will, weshalb viele Nationalökonomen sich bestrebten, den Zusammenhang zwischen ihren Lehren und denen des Utilitarismus zu bestreiten. Selbst BÖHM-BAWERK glaubte, sich gegen den Vorwurf des Hedonismus verteidigen zu müssen. Den Kernpunkt dieser Verteidigung bildet die Feststellung, daß er schon in der ersten Darlegung seiner Wertlehre ausdrücklich bemerkt habe, daß er das Wort »Wohlfahrtszwecke« im weitesten Sinne gebrauche, in welchem es »nicht bloß die egoistischen Interessen eines Subjektes, sondern alles umfaßt, was diesem erstrebenswert [142] erscheint« [207]. BÖHM hat nicht bemerkt, daß er sich damit dieselbe Auffassung von dem formalen, inhaltlich indifferenten Charakter der eudämonistischen Grundbegriffe Lust und Unlust zu eigen machte, die alle fortgeschrittenen Utilitaristen vertreten haben. Man vergleiche etwa mit den angeführten Worten BÖHMs den Ausspruch JACOBIs: »Wir begehren oder wollen einen Gegenstand ursprünglich nicht darum, weil er angenehm oder gut ist, sondern wir nennen ihn angenehm oder gut, weil wir ihn begehren und wollen; und das tun wir, weil es unsere sinnliche oder übersinnliche Natur so mit sich bringt. Es gibt also keinen Erkenntnisgrund des Wünschenswerten und Guten außer dem Begehrungsvermögen dem ursprünglichen Begehren und Wollen selbst« [208].
Wir können es uns ersparen, näher darauf einzugehen, daß jede Ethik, mag sie auch zunächst noch so rigoros als Bekämpferin des Eudämonismus auftreten, irgendwie heimlich die Glückseligkeit in ihr Gedankengebilde einschmuggeln muß, und daß es, wie schon BÖHM gezeigt hat, mit der »ethischen« Nationalökonomie nicht anders steht [209]. Denn daß die Begriffe Lust und Unlust für die Lehre vom menschlichen Verhalten keine Aussage über den Inhalt des Angestrebten enthalten, dürfte denn doch wohl kaum noch verkannt werden können.
Mit dieser Feststellung erledigt man alle Einwendungen, die die »ethische« Nationalökonomie und alle verwandten Richtungen vorzubringen wußten. Es mag Menschen geben, die etwas anderes anstreben als die Menschen, die wir kennen, doch solange es Menschen sein werden, d. h. solange sie nicht bloß weiden wie die Tiere oder bloß vegetieren wie die Pflanzen, sondern Ziele suchend handeln, werden sie immer notwendigerweise der Logik des Handelns untertan sein, die zu erforschen Aufgabe unserer Wissenschaft ist. In diesem Sinne ist diese Wissenschaft allgemein menschlich und nicht national beschränkt, zeitgebunden oder klassenbedingt; in diesem Sinne ist sie logisch vor aller geschichtlichen und deskriptiven Forschung.
IV. Nationalökonomie und Psychologie.
Zur Bezeichnung der modernen subjektivistischen Nationalökonomie [143] verwendet man nicht selten den Ausdruck »psychologische« Schule; mitunter hebt man auch den Unterschied, der zwischen der österreichischen und der Lausanner Richtung im Verfahren besteht, dadurch hervor, daß man jener die »psychologische« Methode zuschreibt. Daß aus solcher Sprachgewohnheit die Vorstellung entstehen konnte, die Nationalökonomie sei so ungefähr ein Zweig der Psychologie oder angewandte Psychologie, ist nicht erstaunlich. Weder diese Mißverständnisse noch ihre Verwendung in dem Kampfe, der um die österreichische Schule geführt wurde, können heute anderes als literarhistorisches Interesse erwecken.
Doch das Verhältnis der Nationalökonomie zur Psychologie ist noch immer problematisch, die Stellung, die dem GOSSENschen Gesetze der Bedürfnissättigung zukommt, noch immer ungeklärt.
Vielleicht wird es nützlich sein, vorerst einen Blick zu werfen auf den Weg, den das Denken zurückzulegen hatte, um zur modernen Behandlung des Preisproblems zu gelangen. Wir werden so am ehesten dazu kommen, dem ersten GOSSENschen Gesetze seine Stellung im System zuzuweisen, die von der Stellung, die es in der Heuristik gespielt hat, verschieden ist.
Die älteren Versuche, die Gesetze der Preisbildung zu ergründen, scheiterten an der universalistischen Betrachtungsweise, der man sich unter der Herrschaft des Begriffsrealismus überließ. Man darf die Bedeutung, die dem nominalistischen Denken schon bei den Alten, im Mittelalter und in der beginnenden Neuzeit zukam, gewiß nicht unterschätzen. Doch sicher ist, daß nahezu alle Versuche, Probleme der gesellschaftlichen Sphäre zu erfassen, auf dem Boden des Universalismus angestellt wurden, auf dem sie hoffnungslos fehlschlagen mußten. Wer Preise erklären wollte, der sah auf der einen Seite die Menschheit, den Staat, den Stand, auf der anderen Seite hier die Gütergattungen und dort das Geld. Es gab auch nominalistische Versuche, und ihnen verdanken wir Ansätze subjektivistischer Werterklärung; doch sie wurden immer wieder von der Übermacht des herrschenden Begriffsrealismus unterdrückt.
Erst die Auflösung der universalistischen Denkungsart durch die individualistische Methode des 17. und 18. Jahrhunderts legt den Weg zur Ausbildung einer wissenschaftlichen Katallaktik frei. Nun sieht man, daß auf dem Markte nicht Menschheit, Staat oder Stand agieren, sondern einzelne Menschen und Menschengruppen, daß ihre Wertungen und ihr Handeln und nicht abstrakte Kollektiva entscheiden. Und es schien nun nahezuliegen, die kopernikanische Wendung [144] der Sozialwissenschaft zu vollenden durch die Einsicht, daß nicht Gütergattungen, sondern konkrete Güter stückweise umgesetzt wirden, um den Zusammenhang zwischen Wertung und Gebrauchsnutzen zu erkennen und so der Antinomie des Wertes beizukommen. Doch es bedurfte noch weiterer hundert und etlicher Jahre, um auch diesen Schritt zu machen. Das ist eine kurze Spanne Zeit, wenn wir die Dinge weltgeschichtlich betrachten und wenn wir die Schwierigkeit, die sich hier dem Denken bot, entsprechend würdigen. Für die Dogmengeschichte unserer Wissenschaft gewann aber gerade diese Zeit eine besondere Wichtigkeit, da in ihr jenes wundervolle Gebilde des ricardianischen Systems entstand, das ungeachtet des radikalen Fehlers, auf dem es aufgebaut war, so fruchtbar wurde, daß es mit vollem Rechte die Bezeichnung »klassisch« trägt.
Der Schritt, der von den Klassikern zu den Modernen führt, ist die Erkenntnis, daß niemals Gütergattungen in abstracto, sondern stets nur konkrete Stücke einer Gütergattung umgesetzt und gewertet wirden. Nicht was »Brot« für die Menschheit oder alles heute vorhandene Brot oder zehntausend Laib Brot wert sind, ziehe ich in Betracht, wenn ich einen Laib kaufen oder verkaufen will, sondern nur den einen in Frage stehenden Laib. Diese Erkenntnis ist nicht aus dem ersten GOSSENschen Gesetz abgeleitet; sie wird uns durch die Besinnung auf das Wesen unseres Handelns gegeben, oder, anders ausgedrückt, die Erfahrung unseres Handelns verbietet unserem Denken eine andere Annahme.
Aus diesem Satze und aus der weiteren, aus der Betrachtung unseres Handelns gewonnenen Erkenntnis, daß wir in unseren Wichtigkeitsskalen die einzelnen Güterstücke nicht nach Gütergattungen oder Bedürfnisgattungen, sondern nach den konkreten Bedürfnisregungen ordnen, d. h. daß wir, bevor noch eine Bedürfnisgattung voll befriedigt ist, bereits an die Deckung einzelner Bedürfnisse anderer Gattungen schreiten, die wir nicht befriedigen würden, wenn nicht vorher eine oder mehrere Regungen der ersten Gattung befriedigt worden wären, leiten wir das Gesetz der Bedürfnissättigung ab.
Das GOSSENsche Gesetz hat daher für uns nichts mit Psychologie zu tun; es wird von der Nationalökonomie abgeleitet aus Überlegungen, die nicht psychologischer Natur sind. Das Sättigungsgesetz der Psychologie ist von ihm unabhängig; daß es mit unserem Gesetz in Einklang steht, ist begreiflich, da es auf denselben Tatbestand gerichtet ist. Doch was die beiden trennt, ist die Verschiedenheit der Methode, auf der man zu ihnen gelangt; durch die Methode der [145] Betrachtung des Menschen scheiden sich eben Psychologie und Nationalökonomie.
Damit steht natürlich weder die Tatsache in Widerspruch, daß ein Mann, der zu den größten Geistern der Gesellschaftslehre zählt und auf der Höhe der Nationalökonomie seiner Zeit stand, BENTHAM, zu unserem Gesetz auf psychologischem Wege gelangt ist und von ihm keine nationalökonomische Anwendung zu machen wußte, noch der Umstand, daß das Gesetz in der Darstellung von GOSSEN als psychologisches erscheint, auf dem dann die nationalökonomische Lehre aufgebaut wird. BENTHAMs reicher Geist hat eben nicht nur einer Wissenschaft gedient. Wie GOSSEN zu seiner Erkenntnis kam, wissen wir nicht; es ist auch für die Entscheidung unserer Frage gleichgültig; es hat nur für die Geschichte, nicht auch für das System einer Wissenschaft Bedeutung, dem Wege nachzuspüren, auf dem man diese oder jene Wahrheit zuerst gefunden hat. Daß die Stellung, die GOSSEN dem Gesetze dann in seinem System zuwies, für uns nicht autoritative Geltung haben kann, ist wohl auch selbstverständlich. Und jedermann weiß, daß MENGER, JEVONS und WALRAS nicht auf dem Wege über das GOSSENsche Gesetz zur Überwindung der Wertantinomie gelangt sind.
V Nationalökonomie und Technologie.
Wie von der Psychologie ist das System der nationalökonomischen Theorie auch von anderen Wissenschaften unabhängig. Das gilt auch von dem Verhältnis zur Technologie. Wir wollen es beispielsweise am Ertragsgesetz zeigen.
Auch historisch kam das Ertragsgesetz nicht aus der Technologie her, sondern aus nationalökonomischen Erwägungen. Man interpretierte die Tatsache, daß der Landwirt, der mehr erzeugen will, auch die Anbaufläche ausdehnen will, und daß er dabei auch schlechteren Boden heranzieht. Würde das Ertragsgesetz nicht gelten, dann wäre es nicht zu erklären, daß es so etwas wie »Bodenhunger« geben kann, dann müßte der Boden freies Gut sein. Die naturwissenschaftliche Lehre vom Landbau konnte diese Erwägungen weder »empirisch« fundieren noch widerlegen. Die Erfahrung, von der sie ausging, war die Tatsache, daß Ackerland als wirtschaftliches Gut behandelt wird [210]. Daß auch hier letzten Endes Nationalökonomie und Naturwissenschaft sich treffen müssen, ist klar.
[146]
Man konnte nicht umhin, das Gesetz vom abnehmenden Bodenertrag schließlich zum allgemeinen Ertragsgesetz zu erweitern. Wird ein Gut höherer Ordnung als wirtschaftliches Gut behandelt, dann muß von diesem Gut das Ertragsgesetz Zunehmen des Ertrages bis zu einem bestimmten Punkte, darüber hinaus Abnehmen des Ertrages gelten. Eine einfache Überlegung zeigt, daß ein Produktivgut, für das das Ertragsgesetz nicht gilt, niemals als wirtschaftliches Gut angesehen werden könnte; es wäre ja für uns ohne Bedeutung, ob wir über größere oder kleinere Mengen dieses Gutes verfügen.
Das Bevölkerungsgesetz ist ein besonderer Fall des Ertragsgesetzes. Würde die Erhöhung der Arbeiterzahl stets proportionale Steigerung des Ertrages bewirken, dann würde die Vermehrung der Unterhaltsmittel mit der Vermehrung der Bevölkerung Schritt halten. Wer, wie HENRY GEORGE, FRANZ OPPENHEIMER u. a. m., behauptet, daß das Bevölkerungsgesetz praktisch bedeutungslos sei, nimmt an, daß mit jedem das Optimum übersteigenden Bevölkerungszuwachs notwendigerweise Veränderungen der Technologie oder der gesellschaftlichen Arbeitsorganisation Hand in Hand gehen, die es bewirken, daß, auf den Kopf der Gesamtbevölkerung berechnet, zumindest keine Ertragssenkung, vielleicht sogar eine Ertragssteigerung eintritt. Für diese Annahme gibt es keinen Beweis.
VI. Die Geldrechnung und das im engeren Sinne „Wirtschaftliche“.
Alles Handeln ist auf den Erfolg gerichtet, empfängt Sinn nur in der Ausrichtung auf den Erfolg. Das Vorziehen und Zurückstellen, das in ihm hervortritt, nimmt zum Richtmaß die Bedeutung des erwarteten Erfolgs für die Wohlfahrt des Handelnden. Was unmittelbar der Wohlfahrt dient, wird ohne Schwierigkeit der Wichtigkeit gemäß geordnet und gibt so die Rangordnung, in der die Ziele des Handelns im gegebenen Augenblicke stehen. Wieweit es möglich ist, die entfernteren Bedingungen (Mittel) des Wohlseins in die Rangordnung zu bringen, ohne zu verwickelteren Denkprozessen zu greifen, ist von der Intelligenz des Einzelnen abhängig. Sicher ist aber, daß auch für den Begabtesten die Schwierigkeiten der Abwägung von Mittel und Erfolg unüberwindbar werden, sobald man über die einfachsten, nur kurze Zeit und wenige Zwischenstufen beanspruchenden Produktionsumwege hinausgeht. Die kapitalistische Produktion (im Sinne BÖHM-BAWERKs, nicht in dem der Marxisten) erfordert vor allem anderen die Technik der Wirtschaftsrechnung, durch die [147] Sachaufwendungen und Arbeitsleistungen verschiedener Art vergleichbar werden. Die Wirtschafter müssen befähigt sein, zu erkennen, welcher Weg mit dem geringsten Aufwand zu dem angestrebten Ziel führt. Das ist die Funktion der Geldrechnung.
Das Geld, das ist das allgemein gebräuchliche Tauschmittel, wird damit zu einem unentbehrlichen geistigen Requisit des Wirtschaftens, das weiter ausgreifende Produktionsprozesse durchführen will. Ohne Geldrechnung, ohne Kalkulation, Buchführung und Gewinnund Verlustrechnung in Geld hätte die Produktionstechnik sich auf die einfachsten und daher am wenigsten ergiebigen Verfahren beschränken müssen. Würde heute etwa durch Vollsozialisierung die Geldrechnung aus der Produktion wieder verschwinden, dann würde das Gebilde der kapitalistischen Produktion sich in der kürzesten Zeit in ein wüstes Chaos verwandeln, aus dem es keinen anderen Ausweg geben könnte als die Rückbildung zu den Wirtschaftsgestaltungen primitivster Kulturen. Da Geldpreise der Produktionsmittel nur in einer Gesellschaftsordnung gebildet werden können, in der Sondereigentum an den Produktionsmitteln besteht, ergibt sich daraus der Beweis der Undurchführbarkeit des Sozialismus.
Dieser Nachweis ist wohl das wichtigste Ergebnis, das die nationalökonomische Theorie für die Politik und für die Geschichtswissenschaft zutage gefördert hat. Man kann seine praktische Bedeutung kaum hoch genug veranschlagen. Er allein gibt uns die Möglichkeit, in der Politik ein endgültiges Urteil über alle Arten von Sozialismus, Kommunismus und Planwirtschaft zu fällen, er allein wird künftige Geschichtsschreiber in die Lage versetzen, zu verstehen, wie es kam, daß der Sieg der sozialistischen Bewegung nicht zur Schaffung sozialistischer Gesellschaftsordnung geführt hat. Darauf haben wir hier nicht weiter einzugehen. Wir müssen das Problem der Geldrechnung in einer anderen Hinsicht betrachten, nämlich in seiner Bedeutung für die Sonderung des »Wirtschaftlichen im engeren Sinne« vom übrigen Handeln.
Die Eigenart der geistigen Technik, die die Geldrechnung darstellt, bewirkt es, daß uns jenes Gebiet, auf dem sie angewendet wird, als ein besonderer Bezirk innerhalb des weiteren Bereiches des gesamten Handelns erscheint. Soweit in Geld gerechnet wird, reicht für den Sprachgebrauch des Alltags das Gebiet des Wirtschaftlichen; was darüber hinausgeht, wird das Außerwirtschaftliche genannt. Wir können diesem Sprachgebrauch nicht folgen, wenn er wirtschaftliches und nichtwirtschaftliches Handeln als Gegensatz faßt; wir haben [148] gesehen, daß eine solche Sonderung nur irreführt. Doch gerade der Umstand, daß wir in der Wirtschaftsrechnung in Geld das wichtigste und unentbehrlichste geistige Hilfsmittel der weitausgreifenden Produktion erblicken, läßt uns eine terminologische Sonderung dieser beiden Gebiete als zweckmäßig erscheinen. Wir müssen die Ausdrücke »wirtschaftlich« und »nichtwirtschaftlich« oder »außerwirtschaftlich« im Hinblick auf die voranstehenden Ausführungen ablehnen, doch wir können die Ausdrücke »wirtschaftlich im engeren Sinn« und »wirtschaftlich im weiteren Sinn« hinnehmen, wenn man aus ihnen nicht eine Verschiedenheit des Umfanges des rationalen und des wirtschaftlichen Handelns herauslesen will.
(Eine Zwischenbemerkung: Die Geldrechnung ist keine »Funktion« des Geldes, so wenig die astronomische Ortsbestimmung eine »Funktion« der Gestirne ist.)
Die Wirtschaftsrechnung ist entweder Vorausberechnung künftiger Möglichkeiten (Vorkalkulation oder auch, kürzer, Kalkulation) als Grundlage der Entschließungen, die das Handeln leiten, oder nachträgliche Feststellung des erzielten Erfolges (Gewinn- und Verlustrechnung). In keiner Hinsicht kann man sie als »vollkommen« bezeichnen; ein Teil der Aufgaben der Theorie des indirekten Tausches (Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel) besteht gerade darin, die Unvollkommenheit oder richtiger gesagt die Grenzen der Leistungsfähigkeit dieser Methode aufzuweisen. Doch sie ist die einzige Methode, die einer arbeitteilenden Gesellschaft zur Verfügung steht, wenn sie Aufwand und Ertrag ihres Verfahrens vergleichen will. Alle Versuche der Apologeten des Sozialismus, eine »sozialistische Wirtschaftsrechnung« auszuklügeln, mußten daher notwendigerweise scheitern.
VII. Die Austauschverhältnisse und die Grenzen der Geldrechnung.
Die Geldpreise der Güter und Dienstleistungen, die wir feststellen können, sind die Verhältnisse, in denen diese in einem bestimmten Augenblick der näheren oder entfernteren Vergangenheit gegen Geld umgesetzt wurden. Sie sind immer Vergangenheit, gehören immer der Geschichte an. Sie haben einer Marktlage entsprochen, die nicht die von heute ist.
Die Wirtschaftsrechnung kann bis zu einem gewissen Grade die Preise des Marktes verwenden, weil sie sich in der Regel nicht so schnell verschieben, daß dadurch der Kalkul wesentlich verfälscht [149] werden könnte. Gewisse Abweichungen und Veränderungen können übrigens mit einer solchen Annäherung an das, was später wirklich eintritt, abgeschätzt werden, daß das Handeln die »Praxis« mit der Geldrechnung, ungeachtet aller ihrer Mängel, ganz gut auszukommen vermag.
Diese Praxis aber ist, und das kann nicht scharf genug betont werden, stets die im Rahmen einer auf dem Sondereigentum an den Produktionsmitteln beruhenden Gesellschaftsordnung sich abwickelnde Praxis des einzelnen Wirtschafters, der den Erfolg seines individuellen Handelns, soweit es das Gebiet des im engeren Sinne Wirtschaftlichen nicht verläßt, erkennen will. Sie ist Rentabilitätsrechnung des Händlers. Mehr kann sie nie werden.
Darum ist es verkehrt, die Elemente dieser Wirtschaftsrechnung auf andere Probleme anwenden zu wollen, als die es sind, die diesem Wirtschafter gegeben sind. Man darf sie auf res extra commercium nicht ausdehnen, man darf nicht versuchen, mit ihrer Hilfe mehr als das im engeren Sinne Wirtschaftliche zu erfassen. Das aber gerade wollen die, die den Wert des menschlichen Lebens, der gesellschaftlichen Einrichtungen, des Volksvermögens, der Kulturwerte oder dergleichen mehr in Geld ermitteln wollen, oder die scharfsinnig zu ergründen suchen, wie Austauschverhältnisse näherer oder gar entfernterer Vergangenheit »in unserem Gelde« ausgedrückt werden könnten.
Nicht minder verkehrt ist es, auf die Geldrechnung zurückzugreifen, wenn man der Rentabilität des Handelns die Produktivität gegenüberstellen will. Indem man Rentabilität und Produktivität des Handelns vergleicht, vergleicht man den Erfolg, wie er dem einzelnen Wirtschafter in der kapitalistischen Gesellschaftsordnung erscheint, mit dem Erfolg, wie er dem Zentraldirektor eines gedachten sozialistischen Gemeinwesens erscheinen würde. (Nebenbei bemerkt: auch das, daß dieser gar nicht rechnen könnte, wird dabei außer acht gelassen.)
Den Gipfel erreicht die Verwirrung der Begriffe, wenn man die Geldrechnung an das Problem heranbringt, das man das des Maximums nennt. Da wird der Zusammenhang mit der Rentabilitätsrechnung des Individuums bewußt aufgegeben, um über das »Individualistisch-Atomistische« hinaus zu »sozialen« Ergebnissen zu gelangen. Und wieder sieht man nicht und will nicht sehen, daß das Rechensystem untrennbar mit der Rentabilitätsrechnung des Individuums verbunden ist.
[150]
Die Geldrechnung ist eben nicht Wertrechnung und schon gar nicht Wertmessung. Ihre Grundlage ist die Vergleichung von Wichtigerem und Minderwichtigem, ist ein Nach-dem-Rang-Ordnen, ein Skalieren (ČUHEL), und nicht ein Messen. Das Suchen nach einem Maßstab des Güterwertes war ein Irrweg; die Wirtschaftsrechnung beruht in letzter Linie nicht auf Messung der Werte, sondern auf ihrer Einreihung in eine Rangordnung.
VIII. Datenänderungen.
Die allgemeingültige Lehre vom menschlichen Handeln ist notwendigerweise formal. Material sind die Gegebenheiten der menschlichen Verhältnisse, die das Handeln im einzelnen Falle auslösen: die Ziele, denen die Menschen zustreben, und die Mittel und Wege, durch die sie diesem Streben Erfolg zu verschaffen suchen [211]. Die Gleichgewichtslage des Marktes entspricht dem jeweiligen Stande der Daten: Verändern sich die Daten, dann verschiebt sich auch die Gleichgewichtslage. Wir begreifen die Wirkung der Datenänderung mit Hilfe unserer Theorie, wir können mit ihrer Hilfe auch die Qualität oder, besser gesagt, die Richtung der Veränderungen, die caeteris paribus auf bestimmte Datenänderung folgen müssen, voraussagen. Quantitativ diese Veränderungen aus dem bekannten Ausmaß der Datenänderungen vorauszubestimmen sind wir nicht imstande. Denn die Veränderungen der äußeren Verhältnisse müssen sich, um auf das Handeln wirksam zu werden, im Innern der Menschen in Wollen umsetzen. Über diesen Prozeß wissen wir nichts. Selbst der Materialismus, der das Verhältnis des Psychischen zum Physischen durch die berühmte einfache Formel gelöst zu haben glaubte, das Denken stehe in demselben Verhältnis zum Gehirn wie die Galle zur Leber, hat nicht einmal den Versuch unternommen, eine feste Beziehung zwischen bestimmten äußeren quantitativ und qualitativ erkennbaren Ereignissen und dem Denken und Wollen herzustellen.
Alle Bemühungen, die dem Aufbau einer quantitativen Theorie der Katallaktik gewidmet wurden und gewidmet werden, müssen daher scheitern. Alles, was auf diesem Gebiet geleistet werden kann, ist Wirtschaftsgeschichte, kann niemals über das da und damals Gegebene hinaus allgemeine Gültigkeit gewinnen [212].
[151]
IX. Die Zeit in der Wirtschaft.
Die klassische Nationalökonomie unterschied drei Produktionsfaktoren: Arbeit, Boden, Kapital. Da Kapital in Arbeit und Boden aufgelöst werden kann, bleiben zwei Produktionsfaktoren übrig: Arbeit und die von der Natur zur Verfügung gestellten »Bedingungen der Wohlfahrt«. Sie allein waren, wenn man von den Genußgütern absieht, nach der Auffassung der älteren Literatur Objekte der Bewirtschaftung.
Daß auch mit der Zeit hausgehalten wird, konnten die Klassiker, deren Aufmerksamkeit vor allem auf das Verhalten des Kaufmanns gerichtet war, nicht bemerken. In den kaufmännischen Büchern kommt ein Konto »Zeit« nicht vor, auf den Märkten wird für sie kein Preis gezahlt. Daß sie dennoch in jedem Umsatz berücksichtigt wird, konnte man von dem Standpunkte einer objektivistischen Wertlehre nicht sehen; man ließ sich auch nicht durch die im Sprichworte »Zeit ist Geld« enthaltene volkstümliche Lehre darauf hinleiten. Es war eine der Großtaten von JEVONS und BÖHM, daß sie in Fortführung der Gedankengänge von BENTHAM und RAE dem Zeitelement seine Stellung zugewiesen haben.
Die Klassiker haben die reguläre Bedeutung der Zeit, die in jedem Tauschakte mittelbar oder unmittelbar ihre Wirkung äußert, verkannt; sie haben nicht gesehen, daß im Handeln immer zwischen Gegenwart und Zukunft, zwischen gegenwärtigen und künftigen Gütern unterschieden wird. Doch die Zeitdifferenz hat noch in anderer Hinsicht für die Wirtschaft Bedeutung. Alle Datenänderungen können sich nur in der Zeit auswirken. Es muß kürzere oder längere Zeit vergehen, ehe nach Eintritt des neuen Faktums der neue Gleichgewichtszustand erreicht wird. Der statische oder, wie die Klassiker sagten, der natürliche Preis wird nicht sofort, sondern erst nach einiger Zeit erreicht. In der Zwischenzeit ergeben sich Abweichungen, die die Quelle besonderer Gewinne und Verluste werden. Diese Tatsache haben die Klassiker und ihre Epigonen nicht nur nicht verkannt, sie haben sie mitunter eher überschätzt. Auch die moderne Theorie hat ihr besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Das gilt vor allem auch von der Theorie des indirekten Tausches. Die Lehre von den Veränderungen der Kaufkraft des Geldes und von deren sozialen Begleiterscheinungen ist ganz darauf aufgebaut. Der Zirkulationskredittheorie des Konjunkturwechsels die man gewöhnlich als monetäre [152] Krisentheorie bezeichnet wollte man in merkwürdiger terminologischscholastischer Gewissenhaftigkeit vor kurzem ihren Namen mit der Begründung absprechen, daß sie auf dem »Zeit-Lag« aufgebaut ist [213].
Die Behauptung, die nationalökonomische Theorie hätte die Bedeutung des Umstandes verkannt, daß immer ein kürzerer oder längerer Zeitraum verstreichen muß, ehe das durch Auftreten neuer Daten gestörte Gleichgewicht des Marktes wieder hergestellt wird, wäre nie aufgestellt worden, wenn man nicht aus politischen Gründen die Erörterung nationalökonomischer Fragen immer wieder durch unsachliche Einwendungen hätte stören wollen. Die Verteidiger interventionistischer Wirtschaftspolitik haben mitunter versucht, den durch unwiderlegliche nationalökonomische Ableitungen gestützten Ausführungen der Kritiker des Interventionismus entgegenzuhalten, daß die Sätze der Nationalökonomie nur in the long run Geltung hätten; man könne daher aus ihnen noch nicht den zwingenden Schluß auf die Sinnund Zweckwidrigkeit der Eingriffe ziehen. Es würde den Rahmen dieser Untersuchung überschreiten, zu prüfen, welche Kraft diesem Argument in dem Streit um den Interventionismus zukommt. Es genügt hier, darauf hinzuweisen, daß die liberale Lehre den Nachweis der Sinnund Zweckwidrigkeit der Eingriffe auch direkt führt und nicht nur mittelbar durch Deduktion aus allgemeinen Grundsätzen, und daß man ihre Ausführungen nur dadurch widerlegen könnte, daß man Eingriffe aufweist, die nicht zu Wirkungen führen, die den Absichten derer, die eingegriffen haben, zuwiderlaufen.
X. Die »Widerstände«.
Der Nationalökonom pflegt bei seiner Arbeit oft nach der Mechanik hinüberzuschielen. Statt die Aufgaben, die ihm seine Wissenschaft stellt, mit den ihnen angemessenen Denkmitteln zu bearbeiten, holt er aus der Mechanik eine Metapher her, die er an die Stelle einer Lösung setzt. So entstand auch die Vorstellung, die Gesetze der Katallaktik hätten nur ideale Geltung, nämlich unter der Voraussetzung, daß die Menschen gewissermaßen im luftleeren Raume wirtschaften. Im Leben spiele sich dann alles ganz anders ab. Da gebe es »Reibungswiderstand« aller Art, der es bewirke, daß das Ergebnis anders sei, als unsere Gesetze erwarten ließen. Da man von vorn herein [153] keinen Weg sah, um diese Widerstände exakt zu messen, ja, auch nur, um sie qualitativ irgendwie vollständig zu erfassen, gab man resigniert zu, daß der Wert der nationalökonomischen Forschung für die Erkenntnis der Verhältnisse unseres Gesellschaftslebens und für die Praxis nur sehr gering sei. Alle die vielen, die die nationalökonomische Wissenschaft aus politischen und verwandten Erwägungen ablehnten, alle Etatisten, Sozialisten, Interventionisten stimmten freudig zu.
Hat man einmal die Unterscheidung zwischen wirtschaftlichem und nichtwirtschaftlichem Handeln fallen gelassen, dann ist es nicht schwer, zu erkennen, daß es sich in allen Fällen des »Widerstandes« um die konkreten Daten des Wirtschaftens handelt, die die Theorie voll erfaßt.
Ein Beispiel: Wenn die Preise eines Gutes steigen, dann wird, folgern wir aus unserer Theorie, die Produktion gesteigert werden. Doch wenn die Erweiterung der Produktion Neuinvestition von Kapital erfordert, die eine geraume Zeit in Anspruch nimmt, so wird eine gewisse Zeit verstreichen, ehe die Preissteigerung Erhöhung des Angebots bewirkt. Und wenn die Investition das Kapital in der Weise bindet, daß eine Überführung der angelegten Kapitalgüter in andere Produktionszweige entweder überhaupt nicht oder nur unter erheblichen Verlusten möglich ist, und wenn man der Meinung ist, daß die Preise bald wieder sinken werden, dann wird die Erweiterung der Produktion überhaupt unterbleiben. An dem allen ist nichts, was uns die Theorie nicht unmittelbar erklären könnte.
Daher ist es auch irrig, die Behauptung aufzustellen, die Sätze der Theorie hätten nur für den Fall vollkommen freier Konkurrenz Geltung. Dieser Einwand muß um so merkwürdiger erscheinen, als man eher noch behaupten könnte, die moderne Preistheorie hätte den Problemen des Monopolpreises zu viel Beachtung geschenkt. Daß man die Sätze der Theorie zuerst für den einfachsten Fall untersucht, ist doch wohl selbstverständlich. Man darf sich daher nicht darüber aufhalten, daß man bei Untersuchung des Konkurrenzpreises in der Regel von der Annahme ausgeht, daß alle Güter unbegrenzt teilbar sind, daß keine Hindernisse bestehen, die der Beweglichkeit von Kapital und Arbeit im Wege stehen, daß Irrtümer nicht begangen werden usw. Es bereitet dann keine Schwierigkeit, diese einfachen Annahmen Stück für Stück fallen zu lassen.
Richtig ist, daß die Klassiker aus ihrer Einsicht in die Probleme der Katallaktik für die wirtschaftspolitische Praxis die Folgerung [154] gezogen haben, daß alle Hindernisse, die der Interventionismus der Konkurrenz in den Weg legt, einerseits die Gesamtproduktion in Menge und Wert mindern und andererseits auch nicht zu den Zielen führen, die man durch ihre Setzung erreichen will. Die Untersuchungen, die die moderne Nationalökonomie denselben Problemen gewidmet hat, führen zu dem gleichen Ergebnis. Daß der Politiker aus den Lehren der nationalökonomischen Theorie die Folgerung ableiten muß, daß man der Konkurrenz keine Hindernisse in den Weg legen soll, es sei denn, man hätte gerade die Absicht, die Ergiebigkeit der Produktion herabzudrücken, besagt nicht, daß die Theorie mit der »gebundenen« Wirtschaft und mit den »Reibungswiderständen« nichts anzufangen wüßte.
XI. Die Kosten.
Unter Kosten verstand die klassische Nationalökonomie eine Güterund Arbeitsmenge. Für die moderne Theorie sind die Kosten die Bedeutung des nächstwichtigen nicht mehr zur Befriedigung gelangenden Bedürfnisses. Dieser Kostenbegriff tritt außerhalb des Bereiches des Wirtschaftlichen im engeren Sinne klar zum Ausdruck in einer Redewendung wie etwa: Die Arbeit für die Vorbereitung zur Prüfung kostete mich (brachte mich um) die Reise nach Italien. Hätte ich nicht für die Prüfung arbeiten müssen, so hätte ich eine Reise nach Italien unternommen.
Erst wenn man diesen Kostenbegriff verwendet, erkennt man, welche Bedeutung der Rentabilität zukommt. Daß jede Produktion dort abgebrochen wird, wo sie aufhört, rentabel zu sein, bedeutet, daß nur so weit produziert wird, als die für die Produktion erforderlichen Güter höherer Ordnung und Arbeitsleistungen nicht für eine andere Produktion dringender benötigt werden. Mit dieser Feststellung wird die beliebte Vorgangsweise, die Beschränkung der Produktion auf rentable Unternehmungen zu beanstanden, ohne dabei von jenen Unternehmungen zu sprechen, die unterbleiben müßten, wenn manche Unternehmungen über die Rentabilitätsgrenze hinaus fortgesetzt würden, als unzulässig erwiesen.
Damit erledigt sich aber auch die immer wieder vorgebrachte Behauptung, die subjektivistische Wertlehre werde nur der privatwirtschaftlichen Seite der Preisbildung, nicht auch der sozialwirtschaftlichen gerecht. Man könnte diesen Einwand eher umkehren und ausführen, daß wer die Preisbildung nur bis zu den Produktionskosten verfolgt, den Standpunkt des einzelnen Kaufmanns oder Erzeugers [155] nicht verläßt, und daß erst die Zurückbringung des Kostenbegriffs auf die letzte Wurzel, wie sie die Grenznutzentheorie durchführt, die sozialwirtschaftlichen Gesichtspunkte ganz in die Betrachtung einbezieht.
Die österreichische Richtung innerhalb der modernen Nationalökonomie hat sich der Lausanner und den dieser verwandten, die mathematische Darstellung bevorzugenden Richtungen nicht nur dadurch überlegen gezeigt, daß sie unter Meidung des in unserer Wissenschaft irreführenden Funktionsbegriffs das Kausalverhältnis zwischen Wert und Kosten klargestellt hat. Nicht weniger hoch muß man es ihr anrechnen, daß sie ihre Arbeit nicht beim Kostenbegriff enden läßt, vielmehr sie so weit fortsetzt, bis sie auch ihn auf die subjektiven Wertentscheidungen zurückzuführen vermag.
Hat man erst die Stellung des Kostenbegriffs im Rahmen der modernen Wissenschaft richtig erkannt, dann sieht man ohne Schwierigkeit, daß die Nationalökonomie eine Stetigkeit der Entwicklung aufweist, die jener, die die Geschichte anderer Wissenschaften zeigt, nicht nachsteht. Die volkstümliche Behauptung, daß es verschiedene Richtungen und Schulen der Nationalökonomie gebe, deren Lehren nichts gemein haben, und daß jeder Nationalökonom damit beginne, das Werk der Vorgänger zu zerstören, um auf seinen Trümmern seine eigene Lehre aufzubauen, ist so wenig wahr wie die übrigen Legenden, die Historismus, Sozialismus und Interventionismus über die Nationalökonomie verbreiten. Von dem System der Klassiker führt eine gerade Linie zur subjektivistischen Nationalökonomie der Gegenwart; sie ist nicht auf den Trümmern, sondern auf den Grundlagen des klassischen Systems aufgerichtet; sie hat von ihm das Beste genommen, was es zu geben vermochte. Ohne die Gedankenarbeit, die die Klassiker vollbracht hatten, wäre es nicht möglich gewesen, zu den Erkenntnissen der modernen Richtung vorzudringen; es war die Problematik der objektivistischen Schule selbst, die zu den Lösungen hinführen mußte, die der Subjektivismus gab. Keine Arbeit, die an die Probleme gewendet worden war, war vergebens geleistet worden. Alles, was den Späteren als Abweg oder doch zumindest als Umweg des Denkens erscheint, war notwendig, um alle Möglichkeiten zu erschöpfen und keiner Überlegung, zu der die Probleme führen mochten, auszuweichen, ohne sie bis ans Ende gedacht zu haben.
[156]
Bemerkungen zum Grundproblem der subjektivistischen Wertlehre.↩
Die nachstehenden Ausführungen erheben keinen Anspruch auf Originalität. Sie bringen nichts, was nicht schon in nuce wenigstens in den Schriften der Begründer der modernen Theorie und expressis verbis in den Arbeiten der heute wirkenden Theoretiker auch in meinen eigenen Schriften enthalten wäre. Nichtsdestoweniger glaube ich, daß das, was ich hier bringen will, noch einmal und gerade in dieser Weise gesagt werden muß, um schwere Mißverständnisse zu beseitigen, denen die moderne nationalökonomische Lehre noch immer begegnet.
An diesem Mißverstehen der Lehre tragen das muß mit besonderem Nachdruck festgestellt werden nicht minder als jene, die mißverstanden haben, jene Schuld, die mißverstanden wurden. MENGER und BÖHM-BAWERK haben in ihren Schriften Sätze und Auffassungen mitgeschleppt, die, von der objektivistischen Lehre überkommen, mit dem Subjektivismus der modernen Schule schlechterdings unvereinbar sind. Es waren das, da über den Grundgedanken ihres Systems kein Zweifel obwalten kann, nicht so sehr Mängel der Lehre als Schönheitsfehler der Darstellung; sie verunstalten nicht das System, sondern nur die Schriften, in denen das System vorgetragen wurde. Die Nachfahren hatten es nicht schwer, den rechten Weg zu finden und den Meistern gegenüber deren eigene Gedanken durch folgerichtige Entwicklung zu vertreten. Doch immerhin mag zugegeben werden, daß es nicht für jedermann leicht ist, hier den Irrtum zu meiden. Gar mancher, der, ohne gerade die Nationalökonomie zum Gegenstand seines besonderen Arbeitsund Forschungsgebietes zu machen, das System studieren will und zu den Werken seiner Meister greift, oder der gar die subjektivistische Nationalökonomie vom Parteistandpunkte ihrer Gegner betrachtet, ist ihm schon verfallen.
I.
Die subjektivistische Lehre führt die Austauschverhältnisse des Marktes auf die subjektive Wertung der wirtschaftlichen Güter durch die Mitglieder der Tauschgesellschaft zurück. Das Handeln dieser Subjekte, daß sie eine bestimmte Menge des Gutes A einer bestimmten Menge des Gutes B im Tausche vorziehen und so fort, ist die letzte für die Katallaktik relevante Ursache der Austauschverhältnisse [157] des Marktes. Aus welchen Gründen sie gerade so und nicht anders handeln, warum also jemand in einem gegebenen Augenblick Brot kauft und nicht Milch, ist für die Gestaltung der Marktpreise gleichgültig; entscheidend ist allein, daß die Marktparteien bereit sind, diesen Preis für Brot und jenen Preis für Milch zu bezahlen oder zu empfangen. Daß die einzelnen Individuen als Nachfragende in einem bestimmten Zeitpunkt die Güter gerade so und nicht anders werten, ist das Ergebnis des Wirkens der ihr Leben bestimmenden naturgegebenen und sozialen Kräfte. Die Aufspürung dieser Determinanten ist Aufgabe anderer Wissenschaften, nicht die der Nationalökonomie. Die Nationalökonomie, die Wissenschaft der Katallaktik, fragt nicht danach und kann von ihrem Standpunkte aus danach nicht fragen. Psychologie, Physiologie und Kulturgeschichte und manche andere Disziplin mögen es sich zur Aufgabe stellen, zu ergründen, warum die Menschen gerne Alkohol zu sich nehmen; für die Katallaktik ist das eine allein von Bedeutung, daß eine Nachfrage nach alkoholischen Getränken in bestimmtem Umfang und in bestimmter Stärke besteht. KANTs Werke mag der eine aus Wissensdurst, der andere aus Snobismus kaufen; für den Markt ist der Beweggrund des Handelns der Käufer gleichgültig; allein das, daß sie einen bestimmten Betrag aufzuwenden bereit sind, entscheidet.
Dies und nichts anderes ist das Wesentliche an dem, was uns das nationalökonomische Lehrstück von den Bedürfnissen bringt. Daß man den Sinn dieses Lehrstückes so sehr mißverstehen konnte, daß man es einerseits selbst aus der Katallaktik ausscheiden und der Psychologie zuweisen wollte und daß man es andererseits für eine materielle Wertund Nutzenlehre ansehen konnte, ist aus der geschichtlichen Entwicklung unserer Wissenschaft zu erklären. Das große Problem, das sie seit ihrer Begründung im 18. Jahrhundert unablässig beschäftigte, war die Herstellung einer Beziehung zwischen der menschlichen Wohlfahrt und der Schätzung der Objekte des wirtschaftlichen Handelns durch die wirtschaftenden Menschen. Da die ältere Theorie verkannte, daß das wirtschaftliche Handeln in der auf dem Sondereigentum beruhenden Gesellschaftsverfassung einerseits niemals ein Handeln der Gesamtheit, sondern stets das Handeln einzelner Wirtschafter ist, und daß es andererseits in der Regel nicht auf die Verfügung über alle Quantitäten eines Genus, sondern lediglich auf die Verfügung über eine bestimmte Teilmenge gerichtet ist, erwuchs ihr das Problem der Antinomie des Wertes, dem sie ratlos gegenüberstand. So geriet sie in der Behandlung des Wert- und [158] Preisproblems auf eine falsche Bahn, verwickelte sich immer mehr in ein Gestrüpp von unhaltbaren Theoremen und versagte schließlich vollkommen. Die große Leistung, die die moderne Nationalökonomie begründete, lag in der Überwindung der Wertantinomie durch die Erkenntnis, daß das wirtschaftliche Handeln stets nur auf die Verfügung über bestimmte Mengen eines Gutes gerichtet ist. »Habe ich ein Pferd zu kaufen«, sagt BÖHM-BAWERK, »so wird es mir nicht einfallen, mir ein Urteil zu bilden, wie viel hundert Pferde, oder wie viel alle Pferde der Welt für mich wert wären und danach etwa mein Kaufgebot zu bemessen; sondern ich werde natürlich ein Werturteil über ein Pferd fällen. Und so fällen wir kraft inneren Zwanges jederzeit gerade dasjenige Werturteil, welches die konkrete ökonomische Situation erfordert« [214]. Diese Erkenntnis, daß das wirtschaftliche Handeln sich stets nur nach der Bedeutung richtet, die das wirtschaftende Subjekt den Teilquantitäten, über die gerade zu verfügen ist, beimißt, und weder nach der Wichtigkeit, die der gesamte dem Wirtschafter zur Verfügung stehende Vorrat für ihn hat, noch nach dem ganz und gar unpraktischen Urteil des Sozialphilosophen über die Bedeutung des gesamten den Menschen erreichbaren Vorrates für die Menschheit, ist der Kern der modernen Lehre. Sie ist von allen psychologischen und ethischen Erwägungen unabhängig. Doch sie wurde gleichzeitig mit dem Gesetz der Bedürfnissättigung und des Sinkens des von der Einheit abhängigen Nutzens (Grenznutzens) bei steigendem Vorrat vorgetragen. Dieses Gesetz lenkte alle Aufmerksamkeit auf sich und wurde irrtümlich für das Hauptund Grundgesetz der neuen Lehre angesehen, die öfter die Grenznutzenlehre genannt wurde als die subjektivistische Schule, was zutreffender gewesen wäre und viele Mißverständnisse hätte vermeiden lassen.
II.
Daß die moderne subjektivistische Nationalökonomie von der subjektiven Wertschätzung der wirtschaftenden Subjekte und dem durch diese Wertschätzungen geleiteten Handeln ausgeht und nicht von irgendwelchen objektiv richtigen Wertskalen, ist für jeden, der die moderne Katallaktik auch nur einigermaßen kennt oder auch nur ein wenig über den Sinn der Ausdrücke »Nachfrage« und »Angebot« nachgedacht hat, so gewiß, daß es unangebracht wäre, darüber auch [159] nur ein Wort weiter zu verlieren. Daß es von Schriftstellern, die der subjektivistischen Nationalökonomie fernstehen, mitunter bestritten wird so z. B. neuerdings von DIEHL [215] beruht auf so krassem Mißverstehen der ganzen Lehre, daß man darüber ohne weiteres hinweggehen darf. Deutlicher als es durch den Ausdruck »subjektiver Gebrauchswert« ausgedrückt wird, kann man doch schließlich nicht mehr werden. Der Erklärung der Markterscheinungen durch die moderne Lehre liegt nicht »eine auf rationellen Grundsätzen aufgestellte Bedürfnisskala zugrunde«, wie DIEHL [216] meint. Die Bedürfnisskala oder Wertskala, von der die Lehre spricht, wird nicht »aufgestellt«; wir erschließen sie aus dem Handeln der Wirtschafter oder auch ob dies zulässig ist oder nicht, mag hier dahingestellt bleiben aus ihren Mitteilungen, wie sie unter bestimmten Voraus-setzungen handeln würden. Und wenn DIEHL es für offenbar wider-sinnig hält, die »launenhaften Wünsche, Begehrungen usw.« zur Erklärung heranzuziehen, und meint, daß dann »der Wert von der subjektiven Laune jedes Einzelnen« bestimmt wäre, womit »die Grenznutzentheorie allen Sinn verlöre« [217] , so hat ihn wohl die oft beklagte Vieldeutigkeit des Ausdruckes »Wert«, in dem die Erinnerung an die »absoluten« Werte der Ethik mitschwingt, irregeführt. Denn daß die Preise des Marktes, deren Bildung wir zu erklären haben, tatsächlich durch launenhafte Wünsche« geradeso beeinflußt werden wie durch solche, die in DIEHLs Augen als rationell erschein-en, wird doch niemand bezweifeln wollen. DIEHL möge einmal versuchen, die Preisbildung der dem Modewechsel unterliegenden Waren ohne Heranziehung der »launenhaften Wünsche und Begehrungen« zu erklären! Die Katallaktik hat die Aufgabe, die Bildung der Austauschverhältnisse der wirtschaftlichen Güter, die auf dem Markte tatsächlich beobachtet werden, zu erklären, und nicht das, was sich ereignen würde, wenn alle Menschen so handeln würden, wie irgendein Beurteiler es als »rationell« ansieht.
Das alles ist, wie gesagt, so klar, daß niemand daran zweifeln wird. Die Aufgabe unserer Ausführungen kann es nicht sein, durch den Versuch, es neuerdings umständlich zu erweisen, offene Türen einzurennen. Das, was wir vorhaben, ist vielmehr etwas ganz anderes. [160] Wir haben schon darauf hingewiesen, daß MENGER und BÖHMBAWERK an verschiedenen Stellen ihrer Schriften Behauptungen bringen, die mit den von ihnen aufgestellten Grundsätzen schlechterdings nicht zu vereinbaren sind. Man darf nicht vergessen, daß die beiden Meister, wie alle Erneuerer und Bahnbrecher, zuerst die altüberkommenen Auffassungen und Vorstellungen, die sie dann später durch befriedigendere ersetzt haben, in sich aufgenommen hatten. Es ist menschlich entschuldbar, wenn es auch sachlich nicht zu rechtfertigen ist, daß sie dann in der Durchführung ihrer großartigen Grundgedanken mitunter die Folgerichtigkeit vermissen ließen und in Einzelheiten an Behauptungen festhielten, die aus dem Gedankenbau der alten objektivistischen Lehre stammten. Eine kritische Betrachtung dieser Unzulänglichkeiten des Werkes der Begründer der »Österreichischen Schule« ist eine unabweisliche Notwendigkeit, da sie manchen Lesern beim Versuche, in den Geist der Lehre einzudringen, große Schwierigkeiten zu bereiten scheinen. Ich will zu diesem Zwecke aus dem Hauptwerke MENGERs und aus dem BÖHMBAWERKs je eine Stelle herausgreifen [218].
In der der ersten Auflage seiner »Grundsätze der Volkswirtschaftslehre« vorausgeschickten Vorrede umschreibt MENGER »das eigentliche Gebiet unserer Wissenschaft«, nämlich der theoretischen Volkswirtschaftslehre, als die Erforschung der »Bedingungen, unter welchen die Menschen die auf die Befriedigung ihrer Bedürfnisse gerichtete vorsorgliche Tätigkeit entfalten« und erläutert dies mit folgenden Worten: »Ob und unter welchen Bedingungen ein Ding mir nützlich, ob und unter welchen Bedingungen es ein Gut, ob und unter welchen Bedingungen es ein wirtschaftliches Gut ist, ob und unter welchen Bedingungen dasselbe Wert für mich hat, und wie groß das Maß dieses Wertes für mich ist, ob und unter welchen Bedingungen ein ökonomischer Austausch von Gütern zwischen zwei wirtschaftenden Subjekten statthaben, und die Grenzen, innerhalb welcher die Preisbildung hierbei erfolgen kann usw.« [219]. Man beachte, wie schon hier die Subjektivität der Werterscheinungen durch das reflexive Fürwort immer wieder betont wird: »mir nützlich«, »Wert für mich«, [161] »Maß dieses Wertes für mich«.
Leider hält MENGER gleich in der Umschreibung der Güterqualität der Dinge daran nicht fest. Obwohl er die schöne Definition von STORCH (l’arrêt que notre jugement porte sur l’utilité des choses . . . en fait des biens) anführt, erklärt er das Zusammentreffen folgender vier Voraussetzungen für erforderlich, damit ein Ding ein Gut werde:
- Ein menschliches Bedürfnis.
- Solche Eigenschaften des Dinges, welche es tauglich machen, in ursächlichen Zusammenhang mit der Befriedigung dieses Bedürfnisses gesetzt zu werden.
- Die Erkenntnis dieses Kausalzusammenhanges seitens des Menschen.
- Die Verfügung über dieses Ding, so zwar, daß es zur Befriedigung dieses Bedürfnisses tatsächlich herangezogen werden kann [220].
Die 4. Voraussetzung geht uns hier nichts an. An der 1. Voraussetzung ist nichts auszusetzen. Sie entspricht durchaus dem Grundgedanken des Subjektivismus, wofern man sie dahin auffaßt, daß darüber, was für den Einzelnen Bedürfnis ist oder nicht, eben er selbst entscheidet. Daß dies die Meinung MENGERs war, als er die erste Auflage schrieb, kann man freilich nur vermuten. Zu beachten ist, daß MENGER die Definition ROSCHERs (alles dasjenige, was zur Befriedigung eines wahren menschlichen Bedürfnisses anerkannt brauchbar ist) neben vielen Definitionen anderer Vorgänger anführt [221] , ohne auf sie weiter einzugehen.
Doch in der nachgelassenen zweiten Ausgabe seines Werkes, die mehr als ein halbes Jahrhundert später erschienen ist und, abgesehen von dem schon lange vorher im Handwörterbuch der Staatswissenschaften veröffentlichten Abschnitt über das Geld, keineswegs als Fortschritt gegenüber der genialen ersten Ausgabe zu bezeichnen ist, unterscheidet MENGER zwischen wahren und eingebildeten Bedürfnissen. Die eingebildeten Bedürfnisse sind die, »welche nicht in Wahrheit in der Natur des bedürfenden Subjekts, bzw. in seiner Stellung als Glied eines sozialen Verbandes begründet, sondern nur das Ergebnis mangelhafter Erkenntnis der Exigenzen seiner Natur und seiner Stellung in der menschlichen Gesellschaft sind« [222]. MENGER [162] fügt in einer Anmerkung hinzu: »Das praktische Wirtschaftsleben der Menschen wird nicht durch ihre Bedürfnisse, sondern durch ihre jeweiligen Meinungen über die Erfordernisse der Erhaltung ihres Lebens und ihrer Wohlfahrt, ja nicht selten unmittelbar durch ihre Triebe und Begierden bestimmt. Die rationelle Theorie und die praktische Wirtschaftslehre wird an die Untersuchung der wahren (der der objektiven Sachlage entsprechenden) Bedürfnisse anknüpfen müssen« [223].
Um diese offenkundige Entgleisung zu widerlegen, genügt es, MENGERs eigene Worte anzuführen, die einige Zeilen weiter stehen als die eben angeführten. Da heißt es: »Die Meinung, daß lediglich die physischen Bedürfnisse Gegenstände unserer Wissenschaft seien, ist irrig, die Auffassung unserer Wissenschaft als einer bloßen Theorie der physischen Wohlfahrt der Menschen unhaltbar. Wir vermöchten, wie wir sehen werden, die Erscheinungen der menschlichen Wirtschaft nur in höchst unvollständiger Weise, zum Teile überhaupt nicht zu erklären, falls wir uns auf die Betrachtung der physischen Bedürfnisse der Menschen beschränken wollten« [224]. Mit diesem letzten Satz ist wohl alles gesagt. Er gilt gerade so wie von der Scheidung der Bedürfnisse in physische und nichtphysische auch von deren Scheidung in wahre und eingebildete.
Die 2. und die 3. Voraussetzung hätten, das ergibt sich aus dem vorstehend Angeführten, zu lauten: die Meinung der Wirtschafter, daß das Ding tauglich sei, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Damit entfällt auch die Möglichkeit, von einer Kategorie der »eingebildeten Güter« zu sprechen. Der Fall der eingebildeten Güter sei, meint MENGER, dort zu beobachten, »wo Dinge, die in keinerlei ursächlichen Zusammenhang mit der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse gesetzt werden können, von den Menschen nichtsdestoweniger als Güter behandelt werden. Dieser Erfolg tritt ein, wenn Dingen irrtümlicherweise Eigenschaften und somit Wirkungen zugeschrieben werden, die ihnen in Wahrheit nicht zukommen, oder aber menschliche Bedürfnisse irrtümlicherweise vorausgesetzt werden, die in Wahrheit nicht vorhanden sind« [225]. Man muß nur die Beispiele, die MENGER anführt, betrachten, um zu erkennen, wie nichtig die Unterscheidung der wahren von den eingebildeten Gütern ist. Als eingebildete Güter bezeichnet MENGER u. a. die Gerätschaften für den Götzendienst, die [163] meisten Schönheitsmittel usw. Doch auch für diese Dinge werden Preise verlangt und geboten, und diese Preise haben wir zu erklären.
Ganz anders als MENGER, aber doch vollkommen im Sinne der von MENGER in den weiteren Abschnitten seines grundlegenden Werkes ausgeführten Lehren umschreiben wir die Wurzel des subjektiven Gebrauchswertes, wenn wir mit C. A. VERRIJN STUART sagen: Des Menschen Wertung der Güter wurzelt »in seiner Einsicht in ihre Nützlichkeit«, wobei jede Sache als nützlich aufzufassen ist, »auf die mit oder ohne Berechtigung irgendeine menschliche Begierde ausgeht, und welche deshalb einem menschlichen Bedürfnis Befriedigung schenken kann« [226].
III.
BÖHM-BAWERK gibt der Meinung Ausdruck, daß die Aufgabe der Preistheorie in zwei Teile zerfalle. »Ein erster Teil hat das Gesetz des Grundphänomens in seiner vollen Reinheit, d. i. die Gesetzmäßigkeiten zu entwickeln, welche sich an den Preiserscheinungen unter der Voraussetzung ergeben, daß bei sämtlichen am Tausche beteiligten Personen als einziges treibendes Motiv das Streben nach Erlangung unmittelbaren Tauschvorteils ins Spiel kommt. Dem zweiten Teil fällt die Aufgabe zu, die aus dem Hinzutreten anderer Motive und Tatumstände sich ergebenden Modifikationen des Grundgesetzes in dieses einzuweben. Hier wird der Platz sein, um … den Einfluß darzulegen, den die weit verbreiteten typischen Motive` der Gewohnheit, Sitte, Billigkeit, Humanität, Großmut, Bequemlichkeit, des Stolzes, des Nationalitäts- und Rassenhasses usw. auf die Preisbildung gewinnen« [227].
Um zur richtigen Beurteilung dieser Ausführungen zu gelangen, muß man den Unterschied beachten, der zwischen der klassischen und der modernen Nationalökonomie im Ausgangspunkte der Untersuchung besteht. Die klassische Nationalökonomie geht, indem sie den Tauschwert und nicht den Gebrauchswert in den Mittelpunkt ihrer Behandlung des Preisproblems stellt, vom Handeln des Kaufmanns aus. Sie mußte, da ihr die Überwindung der Wertantinomie nicht gelungen war, darauf verzichten, den Vorgang der Preisbildung weiter zurück zu verfolgen und das aufzudecken, was hinter dem Verhalten der Geschäftsleute steht und dieses Verhalten in allem leitet: das [164] Verhalten der letzten Verbraucher. Das Handeln der Verbraucher kann nur die Nutzentheorie erklären, und wenn man nicht imstande ist, eine Nutzentheorie aufzustellen, dann muß man auf jede Erklärung verzichten. Wenn man der klassischen Theorie vorgeworfen hat, sie gehe von der Annahme aus, alle Menschen wären Kaufleute und handelten wie die Besucher einer Börse, so war das gewiß nicht zutreffend; richtig aber ist, daß die klassische Lehre nicht imstande war, das erste und letzte der Wirtschaft, den Verbrauch und die unmittelbare Bedürfnisbefriedigung, in ihrer Theorie zu erfassen.
Weil nun die Klassiker nur das Handeln des Geschäftsmannes zu erklären vermochten und allem, was darüber hinausging, ratlos gegenüberstanden, war ihr Denken an der kaufmännischen Buchführung, dem vollendeten Ausdruck der Rationalität des Geschäfts mannes (nicht des Verbrauchers), orientiert. Was nicht durch kaufmännische Bücher durchgeführt werden kann, konnten sie in ihrer Lehre nicht unterbringen. Daraus erklärt sich manche ihrer Auffassungen, z. B. ihre Stellung zu den persönlichen Diensten; die Dienstleistung, die keine in kaufmännischen Büchern ausdrückbare Werterhöhung verursacht, mulßte ihnen unproduktiv erscheinen. Nur so erklärt es sich, daß sie die Erreichung des höchsten erzielbaren Geldgewinnes als Ziel des wirtschaftlichen Handelns ansehen konnten. Von der Einsicht, die sie ihrem Utilitarismus verdankten, daß das Ziel des Wirtschaftens Wohlfahrtsmehrung und Leidminderung sei, fanden sie, eben wegen der Schwierigkeiten, die ihnen die Antinomie des Wertes bot, keine Brücke zur Wert- und Preislehre. Sie konnten daher alle jene Wohlfahrtsänderungen, die nicht in kaufmännischen Büchern in Geld veranschlagt werden können, nicht erfassen.
Dieser Tatbestand führte notwendigerweise zu einer Unterscheidung des wirtschaftlichen und des nichtwirtschaftlichen Handelns. Wer die (in Geld) billigste Einkaufsgelegenheit aufspürt und ausnützt, hat wirtschaftlich gehandelt. Wer aber aus Irrtum, Unkenntnis, Unfähigkeit, Trägheit, Nachlässigkeit oder aus Rücksicht auf politische, nationalistische oder religiöse Zwecke teurer gekauft hat, als er hätte kaufen können, hat unwirtschaftlich gehandelt. Man sieht, wie diese Zensurierung des Handelns sogleich eine ethische Färbung erhält. Aus der Unterscheidung der beiden Motivgruppen entwickelt sich denn auch bald eine Norm: »Du sollst ‚ökonomisch’ handeln; Du sollst in Geld gerechnet so billig als möglich einkaufen und so teuer als möglich verkaufen; Du sollst im Kaufen und Verkaufen kein anderes Ziel kennen als höchsten Geldgewinn.«
[165]
Daß die Dinge für die subjektivistische Lehre ganz anders liegen, wurde schon gezeigt. Wie wenig es, wenn man vom Handeln des letzten Verbrauchers ausgeht und nicht von dem des Kaufmanns, angeht, in der Erklärung der Preisbildung zwischen wirtschaftlichen und anderen Motiven zu scheiden, wird noch klarer werden, wenn wir es an einem Beispiel erläutern, das aus den Verhältnissen eines nationalpolitisch umstrittenen Gebietes, etwa Böhmens, hergeholt ist. Ein Deutscher beabsichtigt, einer völkischen Turn- und Wehrvereinigung beizutreten und will die dazu erforderliche Gewandung und Ausrüstung erwerben. Gesetzt nun den Fall, daß er diesen Ankauf in einem von einem Tschechen geführten Laden billiger besorgen könnte, dann würden wir, wenn wir jene Unterscheidung der Motive anerkennen, sagen müssen, er habe wirtschaftlich gehandelt, wenn er hier einkauft. Kauft er aber um ein Geringes teurer in einem von einem Deutschen geführten Laden ein, um einem Volksgenossen den Verdienst zuzuführen, dann hätte er unwirtschaftlich gehandelt. Es ist klar, daß man dann schon den ganzen Einkauf als solchen unwirtschaftlich nennen müßte, da doch die Beschaffung der Ausrüstung als solcher gerade so einem nationalpolitischen Zwecke dienen soll wie die Förderung des Volksgenossen durch Nichtberücksichtigung der Möglichkeit billigeren Einkaufs beim Volksfremden. Dann aber müßte man auch viele andere Ausgaben je nach dem Geschmack des Beurteilers als unwirtschaftlich bezeichnen: Beiträge für alle Arten von kulturpolitischen Zwecken, Aufwendungen für Kirche und Bildung usf. Man sieht, wie widersinnig solche schulmäßige Distinktionen sind. Es geht eben nicht an, die durchaus aus der Betrachtung des Handelns des Geschäftsmannes gewonnene Maxime auf das Handeln der Verbraucher, das in letzter Linie alle Wirtschaft leitet, anzuwenden.
Dagegen ist es der subjektivistischen Lehre, gerade weil sie vom Handeln des Verbrauchers ausgeht, ohne weiteres möglich, von ihrem Standpunkt aus auch das Handeln des Geschäftsmannes (sei er nun Erzeuger oder bloß Händler) zu erfassen. Der Geschäftsmann muß, unter dem Zwange des Marktes, stets das tun, was im Sinne der Wünsche der letzten Verbraucher gelegen ist. So wenig er ohne Verlust Tücher erzeugen kann, die deren Geschmack nicht entsprechen, so wenig kann er ohne Verlust nationalpolitische Rücksichten üben, die von den Käufern nicht honoriert werden. Der Kaufmann muß daher ohne solche Rücksichtnahme bei der billigsten Bezugsquelle einkaufen, wenn die, deren Kundschaft er sucht, nicht bereit sind, ihm [166] aus nationalpolitischen Gründen die durch den teureren Einkauf beim Volksgenossen aufgelaufenen Mehrkosten zu ersetzen. Sind aber die Käufer etwa bei Markenartikeln dazu bereit, dann wird auch der Kaufmann entsprechend vorgehen.
Nehmen wir die anderen Beispiele, die BÖHM anführt, der Reihe nach durch, so finden wir überall dasselbe. Die Sitte erfordert es, daß der Mann der »guten« Gesellschaft am Abend im Abendanzug erscheint. Wenn nun in einem Orte die Anschauungen des Kreises, in dem er lebt, verlangen, daß der Anzug nicht aus der billiger liefernden Werkstatt eines im republikanischen Lager stehenden Schneiders, sondern aus der teureren eines konservativ denkenden Meisters bezogen werde, und wenn unser Mann dem Rechnung trägt, so folgt er dabei keinem anderen Motive als bei der Anschaffung des Anzugs überhaupt. Mit beidem, mit der Anschaffung des Abendanzuges und damit, daß er ihn gerade von dem konservativen Schneider bezieht, trägt er den Anschauungen der Kreise, die er für sich als maßgebend anerkennt, Rechnung.
Was ist jener »unmittelbare Tauschvorteil«, von dem BÖHM spricht? Wenn ich aus »Humanität« Bleistifte nicht im Laden des Schreibwarenhändlers kaufe, sondern bei dem kriegsbeschädigten Hausierer, der teurere Preise fordert, so verbinde ich zwei Ziele: die Beschaffung der Bleistifte und die Unterstützung des Invaliden. Würde ich diesen zweiten Zweck nicht eines Aufwandes wert erachten, dann würde ich eben im Laden kaufen. Ich befriedige mit dem teuereren Ankaufe zwei Bedürfnisse: das nach Bleistiften und das nach Unterstützung des Kriegskameraden. Wenn ich aus »Bequemlichkeit« in dem nahegelegenen Laden teurer kaufe statt billiger in einem weit entfernt gelegenen Laden, dann befriedige ich mein Streben nach »Bequemlichkeit« gerade so wie etwa durch Ankauf eines Lehnstuhls oder durch die Benützung einer Droschke oder durch Einstellung einer Hausgehilfin, die mir mein Zimmer in Ordnung hält. Daß ich aus all dem einen »unmittelbaren Tauschvorteil« im Sinne BÖHMs ziehe, ist nicht zu bestreiten; warum sollte es beim Einkauf im nahegelegenen Laden anders sein? Man kann eben BÖHMs Unterscheidung nur dann verstehen, wenn man sie als eine aus dem älteren, dem objektivistischen System der klassischen Nationalökonomie übernommene, in das System der subjektivistischen Nationalökonomie ganz und gar nicht hineinpassende Lehre erkennt. Dabei muß man aber mit besonderem Nachdruck feststellen, daß diese Unterscheidung auf BÖHMs Wert- und Preislehre nicht den geringsten Einfluß hatte und daß man [167] die Seiten, auf denen sie vorgetragen wird, aus seinem Werke ohne weiteres entfernen könnte. Sie stellt im Rahmen dieses Werkes nichts weiter dar als eine wie wir glauben gezeigt zu haben, wenig gelungene Zurückweisung von Einwendungen, die gegen die Möglichkeit einer Wert- und Preistheorie erhoben worden waren.
Systemgerechter als BÖHM-BAWERK drückt STRIGL den Sachverhalt aus, wenn er darauf hinweist, daß die Wertskala »grundsätzlich auch aus Elementen zusammengesetzt ist, welche der Sprachgebrauch als unwirtschaftliche dem wirtschaftlichen Prinzip gegenüberstellt.« Daher könne das »möglichst Viel an Gütern« nicht »an einem wirtschaftlichen` Maßstab gemessen werden, welcher trennbar wäre von ‚unwirtschaftlichen’ Zielen des Handelns« [228].
Es ist für das Verständnis der wirtschaftlichen Vorgänge durchaus angebracht, das »reinwirtschaftliche« Handeln, wofern man darunter jenes Handeln versteht, das der Geldrechnung zugänglich ist, von dem übrigen Handeln, das man, wenn man will, in der sprachüblichen Weise das »außerwirtschaftliche« oder »nichtwirtschaftliche« nennen mag, zu sondern. Es hat schon sowohl für die wissenschaftliche Betrachtung des Ablaufes der Dinge als auch für das Verhalten der Menschen selbst einen guten Sinn, diese Unterscheidung zu machen und etwa zu sagen, unter gegebenen Bedingungen sei es vom »reinwirtschaftlichen« Standpunkt nicht ratsam, eine bestimmte Gesinnung im Handeln zu bekunden; es sei dies »ein schlechtes Geschäft«, d. h., es könne »keinen Gewinn« bringen, sondern in Geld gerechnet nur Nachteile; wenn man dennoch so gehandelt habe und nicht anders, so sei es nicht des Geldvorteils halber, sondern aus Gründen der Ehre, der Treue oder anderer ethischer Werte geschehen. Nur gerade die Wert-und Preislehre, die Katallaktik, die theoretische Nationalökonomie, darf diese Scheidung nicht vornehmen. Denn für die Bildung der Austauschverhältnisse des Marktes, deren Erklärung ihre Aufgabe ist, ist es ebenso gleichgültig, ob die Nachfrage nach inländischen Erzeugnissen dadurch hervorgerufen wurde, daß sie selbstverständlich bei gleicher Qualität in Geld gerechnet billiger zu stehen kommen als die fremdländischen oder weil nationalistische Ideologie den Ankauf heimischer Erzeugnisse auch bei höherem Geldpreis als richtig erscheinen läßt, wie es etwa der Umstand ist, ob die Nachfrage nach Waffen von Ehrenmännern ausgeht, die das Recht schützen wollen, oder von Verbrechern, die Untaten planen.
[168]
IV.
Der vielberufene homo oeconomicus der klassischen Lehre ist die Verkörperung der Grundsätze des Kaufmannes. Der Kaufmann will jedes einzelne Geschäft mit dem höchsten erzielbaren Geldgewinn durchführen, er will so billig als möglich einkaufen, so teuer als möglich verkaufen. Er trachtet danach, durch Fleiß und Aufmerksamkeit alle Fehlerquellen auszuschalten, damit der Erfolg seines Handelns nicht durch Unkenntnis, Nachlässigkeit, Irrtum u. dgl. beeinträchtigt werde.
Der homo oeconomicus ist daher keine Fiktion im Sinne VAIHINGERS. Die klassische Nationalökonomie fingiert weder, daß der Wirtschafter als Erwerber, noch viel weniger, daß er als Konsument so vorgeht, als ob allein der höchste Geldgewinn die Richtschnur seines Handelns wäre. Auf den Verbrauch und den Verbraucher ist das klassische Schema überhaupt unanwendbar; der Verbrauchsakt und die Geldausgaben des Verbrauchers können damit überhaupt nicht erfaßt werden. Nur soweit kommt hier der Grundsatz des billigsten Einkaufs in Frage, als die Wahl zwischen mehreren gleichartigen Einkaufsmöglichkeiten gegeben ist; daß aber jemand den besseren Anzug kauft, wo der billigere dieselbe »objektive« Nützlichkeit hat, daß überhaupt mehr verbraucht wird als dem streng gefaßten physischen Existenzminimum entspricht, kann man von diesem Standpunkt aus überhaupt nicht fassen. Und daß der Wirtschafter als Erwerber dem kaufmännischen Grundsatz nicht stets treu bleibt und bleiben kann, daß er nicht allwissend ist, daß er irren kann und daß er auch bewußt unter Umständen seine Bequemlichkeit einem gewinnbringenden Geschäft vorzieht, ist den Klassikern auch nicht entgangen.
Eher könnte man schon sagen, mit dem Schema des homo oeconomicus habe die klassische Nationalökonomie nur die eine die ökonomisch-materielle Seite des Menschen erfaßt; sie betrachte ihn nur als Erwerber, nicht als Verbraucher von wirtschaftlichen Gütern. Das wäre insoferne zutreffend, als die Lehre der Klassiker auf das Verhalten der Konsumenten unanwendbar ist. Andererseits stimmt es insoferne nicht, als von ihr gar nicht behauptet wird, daß der Wirtschafter als Erwerber immer so handle. Behauptet wird nur, daß sein Streben im allgemeinen darauf gerichtet sei, so zu handeln, daß er sich aber (ohne oder mit Absicht) nicht immer diesem Grundsatz getreu verhält.
Der homo oeconomicus ist aber auch nicht Idealtypus im Sinne [169] MAX WEBERS. Die klassische Nationalökonomie wollte nicht einen bestimmten Menschentyp hervorheben etwa den englischen Kaufmann des 19. Jahrhunderts oder den Kaufmann überhaupt sondern sie strebte als echte Soziologie Nationalökonomie ist ein Teil der Soziologie ein allgemeines, alles wirtschaftliche Handeln umfassendes, zeitloses Verständnis an. (Daß ihr dies nicht gelingen konnte, ist eine andere Sache.) Das kann hier nur angedeutet werden. Um es ganz klar zu stellen, müßte man, was über den Rahmen dieser Ausführungen hinausgeht, ausführen, daß die Denkform des Idealtypus nicht die der Gesetzeswissenschaft Soziologie, sondern die der Sozialgeschichte ist [229].
Durch ihren Subjektivismus wird die moderne Theorie objektive Wissenschaft. Sie wertet das Handeln nicht, sie nimmt es so hin, wie es ist, und erklärt die Markterscheinungen nicht aus dem »richtigen« Handeln, sondern aus dem gegebenen Handeln. Sie strebt nicht danach, die Austauschverhältnisse zu erklären, die sich unter der Voraussetzung bilden würden, daß die Menschen sich ausschließlich von bestimmten Motiven leiten lassen und daß andere Motive, die sie tatsächlich leiten, nicht wirken, sondern sie will die Bildung der Austauschverhältnisse begreifen, die wirklich auf dem Markte erscheinen.
Die Preisbildung für die »eingebildeten« Güter MENGERs folgt denselben Gesetzen wie die der »wahren« Güter. BÖHM-BAWERKs »andere Motive« bewirken keine grundsätzliche Änderung des Marktprozesses; sie verändern nur die Daten.
Es war notwendig, auf diese Fehlgriffe MENGERs und BÖHMBAWERKs (denen wir, nebenbei bemerkt, auch bei anderen Schriftstellern begegnen) ausdrücklich hinzuweisen, um Mißdeutungen der Lehre zu verhüten. Um so nachdrücklicher aber muß man noch einmal feststellen, daß weder MENGER noch BÖHM-BAWERK sich in der Ausführung ihrer Preisund Zurechnungslehre irgendwie durch Rücksichtnahme auf die verschiedene Qualität der Motive des Handelns der Marktparteien haben beirren lassen. Die in den vorstehenden Bemerkungen als fehlerhaft bezeichneten Behauptungen haben den großen Zug ihrer Arbeit, die Preisbildung subjektivistisch zu erklären, nicht im Mindesten behindert.
[170]
Die psychologischen Wurzeln des Widerstandes gegen die nationalökonomische Theorie.↩
Einleitung.
Untersuchungen, die sich mit den Problemen der Nationalökonomie befassen, würden eine Lücke aufweisen, wenn sie sich nicht auch mit den Einwänden auseinandersetzen, die gegen die subjektivistische Nationalökonomie vom wirtschaftspolitischen und vom schulpolitischen Standpunkte erhoben werden.
Da ist zunächst die Behauptung, die subjektivistische Wertlehre sei »Klassenideologie der Bourgeoisie«. Für HILFERDING ist sie »das letzte Wort, das die bürgerliche Nationalökonomie dem Sozialismus antwortet« [230]. BUCHARIN will sie als »die Ideologie des Bourgeois, der aus dem Produktionsprozeß bereits hinausgedrängt ist«, brandmarken [231] Man mag über diese beiden Autoren denken, wie man will; doch es ist zu beachten, daß sie zu den Machthabern der beiden volkreichsten Staaten Europas gehörten und daher wohl imstande sind, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Die vielen Millionen, zu denen keine anderen Schriften dringen als die von der marxistischen Propaganda verbreiteten, erfahren über die moderne Nationalökonomie nichts weiter als diese und ähnliche Verdammungsurteile.
Dann haben wir die Richtung zu nennen, die glaubt, gegen die subjektivistische Nationalökonomie den Umstand ins Treffen führen zu dürfen, daß sie von den Lehrstühlen der Hochschulen ferngehalten wird. Selbst ADOLF WEBER, der doch die Vorurteile des Kathedersozialismus scharfsinnig zu kritisieren gewußt hat, kommt diesem Argument in seinem Lehrbuch sehr nahe [232]. Dem etatistisch gerichteten [171] Denken, das heute überall herrscht, entspricht es, eine Lehre schon darum für abgetan zu halten, weil die Behörden, die über Stellenbesetzungen verfügen, von ihr nichts wissen wollen, und das Kriterium der Wahrheit in der Anerkennung durch das Ministerium zu erblicken.
Niemand wird bestreiten können, daß man Anschauungen, die so weit verbreitet sind, nicht einfach mit Schweigen übergehen darf.
I. Das Problem.
Jede neue Lehre trifft zunächst auf Ablehnung und Widerspruch. Die Anhänger der alten, der herrschenden Auffassung treten ihr entgegen, verweigern ihr die Anerkennung, erklären sie für verfehlt und widersinnig. Es müssen Jahre, ja Jahrzehnte vergehen, ehe es dem Neuen gelingt, das Alte ganz zu verdrängen. Ein junges Geschlecht muß heranwachsen, bevor sein Sieg sich entscheidet.
Um dies zu verstehen, muß man sich darauf besinnen, daß die weitaus überwiegende Zahl der Menschen nur in der Jugend neuen Gedanken zugänglich ist. Mit dem Fortschreiten des Alters nimmt die Aufnahmsfähigkeit ab, und das früher erworbene Wissen erstarrt zum Dogma. Zu diesen inneren Widerständen treten solche, die aus der Rücksichtnahme auf äußere Verhältnisse entstehen. Das Prestige leidet, wenn man sich genötigt sieht, zuzugestehen, daß man lange Zeit einer nun als verfehlt erkannten Lehre angehängt hat; die Eitelkeit wird getroffen, wenn man zugeben muß, daß andere das Bessere gefunden haben, das man selbst nicht zu finden vermocht hat [233]. Mit der alten Lehre hat sich im Laufe der Zeit die Autorität der öffentlichen Zwangsanstalten, des Staates, der Kirche, der Parteien, irgendwie verschwistert; diese Gewalten, ihrem Wesen nach jeder Veränderung abhold, bekämpfen nun die neue Lehre, schon weil sie neu ist.
Wenn wir von den Widerständen, denen die subjektivistische [172] Wertlehre begegnet, sprechen, dann haben wir jedoch etwas anderes im Auge als diese Hindernisse, die jeder neue Gedanke findet. Es handelt sich uns nicht um die Erscheinung, die auf allen Teilgebieten des menschlichen Denkens und Wissens auftritt, nicht um den Widerstand gegen das Neue, sondern um eine Erscheinung, die wir nur in der Geschichte des soziologischen und insbesondere des nationalökonomischen Denkens festzustellen haben, um den Widerstand gegen die Wissenschaft als solche, um einen Widerstand, den die Jahre nicht nur nicht beseitigt oder geschwächt, sondern eher gestärkt haben.
Daß es hier in der Tat nicht um die subjektivistische Wertlehre allein, sondern überhaupt um die Katallaktik geht, ersieht man am besten daraus, daß heute keine andere Preistheorie mehr der des Subjektivismus entgegensteht. Ab und zu versucht ein marxistischer Parteibeamter noch die Arbeitswertlehre zu verfechten; im übrigen wagt es niemand mehr, eine von der subjektivistischen Lehre im Wesen abweichende Theorie vorzutragen. Alle Auseinandersetzungen über die Theorie des Preises stehen ganz auf dem Boden der subjektivistischen Lehre, mögen auch manche Schriftsteller wie z. B. LIEFMANN und CASSEL glauben, daß sie von ihr sehr weit entfernt sind. Wer die subjektivistische Wertlehre heute radikal ablehnt, der lehnt auch jede nationalökonomische Theorie radikal ab und will in der wissenschaftlichen Behandlung gesellschaftlicher Probleme nichts als Empirie und Geschichte gelten lassen.
Was Logik und Erkenntnistheorie über diese Haltung zu sagen haben, wurde schon in früheren Abschnitten dieses Buches ausgeführt, an dieser Stelle haben wir uns mit den psychologischen Wurzeln der Ablehnung der subjektivistischen Wertlehre zu befassen.
Daher haben für uns auch die Anfeindungen außer Betracht zu bleiben, denen die Wissenschaften von der Gesellschaft und von der Wirtschaft von außen her begegnen. Solche äußere Widerstände sind genug vorhanden. Doch sind sie wohl kaum imstande, den Fortschritt des wissenschaftlichen Denkens aufzuhalten. Man muß schon sehr stark in den etatistischen Vorurteilen befangen sein, wenn man glaubt, die Ächtung einer Lehre durch den Staatsapparat und die Fernhaltung ihrer Anhänger von staatlichen und kirchlichen Benefizien könnten ihrer Entwicklung und Verbreitung auf die Dauer Eintrag tun. Selbst Ketzerverbrennungen haben der modernen Naturwissenschaft den Weg nicht zu verlegen vermocht. Es ist für das Schicksal der Gesellschaftswissenschaft ziemlich gleichgültig, ob sie an den europäischen Beamtenschulen gelehrt wird, und ob die jungen Amerikaner des [173] College in den Stunden, die ihnen Sport und Vergnügen frei lassen, in ihr unterwiesen werden. Daß man es aber wagen durfte, Soziologie und Nationalökonomie an den meisten Lehranstalten durch Fächer zu ersetzen, die geflissentlich allem soziologischen und nationalökonomischen Denken aus dem Wege gehen, ist nur möglich gewesen, weil innere Widerstände vorhanden sind, die diesen Vorgang rechtfertigen. Wer die äußeren Schwierigkeiten unserer Wissenschaft untersuchen will, muß sich vorerst mit jenen befassen, die ihr in unserem Innern erwachsen.
Die eigenartige Erscheinung, daß die Ergebnisse der gesellschaftswissenschaftlichen Forschung eine Gegnerschaft finden, die sich in ihrer Gedankenführung über alle Logik und Erfahrung hinwegsetzt, läßt sich nicht einfach damit erklären, daß, wer seine Überzeugung zugunsten von Anschauungen, die den Machthabern lieb sind, opfert, in der Regel reichlich entschädigt wird. Eine wissenschaftliche Untersuchung darf nicht in jene Niederungen hinabsteigen, in die blinder Parteihaß den Kampf gegen die Wissenschaft der Nationalökonomie verlegt hat. Sie darf nicht einfach die Vorwürfe umkehren, die MARX erhob, wenn er den »bürgerlichen« Ökonomen, den »Vulgärökonomen« immer wieder als schurkischen Soldschreiber der »Bourgeoisie« bezeichnet hat, wobei er mit Vorliebe den offenbar von ihm ganz mißverstandenen Ausdruck »Sykophant« gebrauchte; sie darf auch die Kampfmethoden nicht übernehmen, mit denen die deutschen Kathedersozialisten jede Gegnerschaft zu unterdrücken suchten [234]. Gesetzt den Fall, man wäre berechtigt, allen Bekämpfern der Nationalökonomie und der subjektivistischen Preislehre den guten Glauben abzusprechen, so bliebe noch immer die Frage offen, wie es kommt, daß die öffentliche Meinung solche Wortführer duldet und nicht lieber den wahren Propheten Gefolgschaft leistet als den falschen [235].
II. Die marxistische (wissenssoziologische) Hypothese.
Wenden wir uns zunächst der Lehre zu, die die Abhängigkeit des Denkens von der Klassenlage des Denkers lehrt.
Nach der Auffassung des Marxismus gliedert sich die menschliche [174] Gesellschaft in der Zeit, die zwischen dem Untergange der Gentilverfassung der goldenen Urzeit und dem Umschlagen des Kapitalismus in das kommunistische Paradies der Zukunft liegt, in Klassen, deren Interessen sich in unüberbrückbarem Gegensatz befinden. Die Klassenlage das gesellschaftliche Sein eines Individuums bestimmt sein Denken; das Denken fördert daher Lehren zutage, die den Klasseninteressen des Denkers entsprechen. Sie bilden den »ideologischen Überbau« der Klasseninteressen, sie sind Apologien der Klasseninteressen, sie verhüllen ihre Nacktheit. Der einzelne Denker mag wohl subjektiv ehrlich sein; es ist ihm jedoch nicht gegeben, in seinem Denken die Schranken, die ihm durch seine Klassenlage gesetzt sind, zu übersteigen. Er vermag die Ideologien der anderen Klassen zu enthüllen und zu entlarven, bleibt aber doch zeitlebens in der Ideologie befangen, die seine eigene Klassenlage ihm vorschreibt. In den Bibliotheken, die zur Verteidigung dieser Lehre geschrieben wurden, wird bezeichnenderweise kaum die Frage gestreift, ob die Voraussetzung, daß die Gesellschaft in Klassen zerfällt, deren Interessen in unversöhnlichem Gegensatz stehen, wirklich zutrifft [236]. Für MARX lagen da die Dinge sehr einfach. Er fand die Lehre von der Gliederung der Gesellschaft in Klassen und von der Gegensätzlichkeit der Klasseninteressen in RICARDOs System der Katallaktik vor oder glaubte zumindest, sie daraus herauslesen zu dürfen. Heute ist die Wert-, Preisund Verteilungstheorie RICARDOS längst überholt, und die subjektivistische Verteilungslehre bietet uns nicht den geringsten Anhaltspunkt zur Stützung der Lehre vom unversöhnlichen Klassengegensatz. Wenn man die Bedeutung der Grenzproduktivität für die Einkommensbildung erkannt hat, kann man nicht länger an der
Vorstellung des unüberbrückbaren Klassengegensatzes festhalten.
Doch da Marxismus und Wissenssoziologie in der subjektivistischen Wertlehre eben nichts anderes als einen letzten ideologischen Versuch zur Rettung des Kapitalismus erblicken, wollen wir uns auf die immanente Kritik ihrer Thesen beschränken. Für den Proletarier gibt es, wie MARX selbst zugibt, nicht nur Klasseninteressen, sondern auch andere, dem Klasseninteresse entgegenstehende Interessen. So heißt es im Kommunistischen Manifest: »Die Organisation der Proletarier zur Klasse und damit zur politischen Partei wird jeden [175] Augenblick wieder gesprengt durch die Konkurrenz unter den Arbeitern selbst« [237]. Es ist also nicht so, daß der Proletarier nur Klasseninteressen hat; er hat auch andere Interessen. Welchen soll er folgen? Der Marxist wird antworten: Natürlich den Klasseninteressen; Klasseninteresse geht vor allem anderen. Doch das ist dann keineswegs mehr »natürlich«, ist eben, sobald man zugegeben hat, daß auch anderes Handeln möglich und den Interessen gemäß ist, kein »Sein«, sondern ein »Sollen«. Der Marxismus sagt nicht von den Proletariern, daß sie keinen anderen als ihren Klasseninteressen folgen können, sondern er sagt den Proletariern: Ihr seid eine Klasse und sollt eurem Klasseninteresse folgen; werdet eine Klasse, indem ihr dem Klasseninteresse gemäß denkt und handelt. Dann obliegt es ihm aber, zu beweisen, daß die Klasseninteressen den anderen Interessen voranstehen sollen.
Doch selbst wenn wir annehmen, daß die Gesellschaft in Klassen mit widerstreitenden Interessen zerfällt, und wenn wir zugeben wollten, daß jedermann die Pflicht habe, das Klasseninteresse und nichts als das Klasseninteresse wahrzunehmen, bleibt noch die Frage offen: Was dient dem Klasseninteresse am besten? Das ist der Punkt, wo »wissenschaftlicher« Sozialismus und »Wissenssoziologie« ihren Charakter als Parteimystik bewähren. Sie nehmen ohne weiteres an, daß das, was das Klasseninteresse erfordert, in jedem Augenblick eindeutig und evident ist [238]. Der Klassengenosse, der anderer Meinung ist, kann nur ein Klassenverräter sein.
Was vermag der marxistische Sozialismus dem zu erwidern, der gerade auch im Interesse der Proletarier das Sondereigentum an den Produktionsmitteln und nicht Vergesellschaftung der Produktionsmittel fordert ? Er kann ihn entweder, wenn er »Proletarier« ist, als Klassenverräter oder, wenn er kein »Proletarier« ist, als Klassenfeind brandmarken, oder aber er muß sich mit ihm in eine Erörterung der Probleme einlassen. Wählt er diesen Weg, dann hat er den Boden seiner Theorie verlassen; denn wie könnte man sich mit Klassenverrätern, denen ihre moralische Minderwertigkeit, oder mit Klassengegnern, denen ihre Klassenlage es verwehrt, die Ideologie der Proletarierklasse zu erfassen, geistig auseinandersetzen ?
[176]
Die geschichtliche Funktion der Klassentheorie erkennt man am besten, wenn man ihr die Theorie der Nationalisten gegenüberstellt. Auch Nationalismus und Rassenlehre verkünden, daß es unüberbrückbare Gegensätze der Interessen gibt sie sehen diese allerdings nicht zwischen den Klassen, sondern zwischen den Völkern und Rassen -, und daß das Denken durch das völkische und rassische Sein bestimmt ist. Die Nationalisten bilden Vaterlandsparteien und Nationalparteien, die es für sich in Anspruch nehmen, allein die Ziele zu verfolgen, die dem Wohle des Vaterlandes und des Volkes dienen. Wer nicht mit ihnen geht, gilt, je nachdem, ob man ihm die Volkszugehörigkeit aberkennt oder zuerkennt, als Feind oder als Verräter. Dem Nationalisten will es nicht eingehen, daß auch die Programme anderer Parteien dem Wohle des Vaterlandes und des Volkes dienen wollen. Er kann es nicht fassen, daß auch der, der mit Nachbarvölkern in Frieden leben will oder für Freihandel gegen Schutzzoll eintritt, diese Forderungen nicht im Interesse des Fremdvolkes stellt, sondern in dem des eigenen Volkes zu handeln glaubt und handeln will. Der Nationalist glaubt an sein Programm so felsenfest, daß er es gar nicht verstehen kann, daß ein anderes Programm zum Wohle seines Volkes noch denkbar sei. Wer anders denkt, kann nur Verräter oder volksfremder Feind sein.
Beiden Theorien, der marxistischen Wissenssoziologie und der nationalistisch-rassenpolitischen Lehre, ist mithin gemeinsam die Annahme, daß das Interesse der Klasse, der Nation, der Rasse eindeutig ein bestimmtes Handeln verlangt, und daß darüber, wie dieses Handeln beschaffen sein muß, für den Klassenangehörigen, für den Volksgenossen, für den Reinrassigen kein Zweifel bestehen kann. Eine Erörterung des Für und Wider verschiedener Programme mit geistigen Mitteln erscheint ihnen undenkbar. Die Klassenlage, die Volkszugehörigkeit, das Rassegut lassen dem Denker keine Wahl; er muß so denken, wie sein Sein es fordert. Solche Theorien sind natürlich nur dann möglich, wenn man von vornherein ein vollständiges Programm aufgestellt hat, an dem auch nur zu zweifeln verboten ist. Logisch und zeitlich vor der materialistischen Geschichtsauffassung steht MARXens Bekenntnis zum Sozialismus, steht vor dem nationalistischen Programm die militaristisch-protektionistische Lehre.
Beide Theorien sind auch aus der gleichen politischen Lage entsprungen. Gegen die von den Philosophen, Nationalökonomen und Soziologen des 18. und der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelten liberalen Lehren vermochte man und vermag man mit den [177] Waffen der Logik und der Wissenschaft nichts vorzubringen. Wer den Liberalismus bekämpfen will, dem bleibt eben nichts anderes übrig, als diese beiden Logik und Wissenschaft zu entthronen, ihnen ihren Anspruch, allgemeingültige Sätze zu lehren, zu bestreiten. Dem »Absolutismus« ihrer Lösungen wird entgegengehalten, daß sie nur »bürgerliche«, »englische«, »jüdische« Wissenschaft brächten; die »proletarische«, die »deutsche«, die »arische« Wissenschaft seien zu anderen Ergebnissen gelangt. (Daß die Marxisten von MARX und DIETZGEN bis herab zu MANNHEIM bestrebt sind, ihrer eigenen Lehre doch eine Ausnahmestellung zuzuerkennen, die sie über den Stand einer bloßen Klassenlehre hinausheben soll, ist inkonsequent genug, kann aber hier außer Betracht bleiben.) An die Stelle der Widerlegung der Lehren tritt die Entlarvung ihrer Schöpfer und ihrer Anhänger.
Das Bedenkliche an diesem Verfahren ist, daß es in folgerichtiger Anwendung jede Auseinandersetzung mit Argument und Gegenargument unmöglich macht. Der Kampf der Geister wird durch die Überprüfung des gesellschaftlichen, nationalen, rassenmäßigen Seins der Gegner ersetzt. Bei der Verschwommenheit der Begriffe Klasse, Volk und Rasse gelingt es immer, diese Überprüfung mit einer Entlarvung des Gegners abzuschließen. Es ist so weit gekommen, daß man als Klassengenossen, Volksgenossen, Rassebruder nur noch den anerkennt, der die solchem Sein vermeintlich allein adäquaten Ideen teilt. (Es ist ein besonderer Mangel an Folgerichtigkeit, daß man sich auf das Zeugnis von Anhängern der eigenen Ideologie, die außerhalb des Kreises der Angehörigen der eigenen Klasse, Nation und Rasse stehen, mit der Wendung beruft: selbst die Klassenfremden, Volksfremden, Fremdstämmigen müssen, wenn sie erleuchtet und ehrlich sind, unsere Auffassung teilen.) Ein Kriterium, an dem man die dem Sein adäquate Lehre erkennen könnte, wird leider nicht angegeben, kann auch gar nicht angegeben werden. Die Entscheidung durch die Mehrheit der diesem Sein Zugehörigen wird ausdrücklich abgelehnt.
Die drei Axiome, die diese antiliberalen Lehren voraussetzen, lauten: 1. Die Menschheit ist in Gruppen geschieden, deren Interessen in unversöhnlichem Widerstreit liegen. 2. Jeder Gruppe richtiger: jedem Angehörigen jeder Gruppe sind das Gruppeninteresse und das Handeln, das ihm am besten dient, unmittelbar evident. 3. Das Kriterium der Gruppenscheidung ist a) die Klassenzugehörigkeit, b) die Volkszugehörigkeit, c) die Rassenzugehörigkeit. Der erste und der zweite Satz sind allen diesen Lehren gemeinsam; durch den besonderen [178] Inhalt, den sie dem dritten geben, unterscheiden sie sich.
Es ist mißlich, daß jeder dieser drei Sätze für sich allein und alle drei als Einheit zusammengefaßt durchaus jene Denknotwendigkeit und Unmittelbarkeit der Evidenz entbehren, die der Charakter als Axiom erfordern würde. Man kann von ihnen nicht sagen, daß sie eines Beweises nicht benötigen, wenn man auch leider sagen muß, daß sie ein Beweises nicht fähig sind. Denn um Sie zu beweisen, müßte man ein ganzes System der Soziologie aufstellen, als dessen Abschluß sie zu erscheinen hätten. Wie sollte das aber möglich sein, da sie doch logisch vor jedem Denken, zumindest vor jedem soziologischen (die Wissenssoziologen sagen: seinsgebundenen) Denken stehen? Fängt man an, mit diesen Axiomen im Denken Ernst zu machen, dann gerät zu einem Skeptizismus, der den Standpunkt von PYRRHON und AENESIDEMUS an Radikalität weit übertrifft.
Doch diese drei Axiome bilden nur die Voraussetzung der Lehre, sie sind noch nicht die Lehre selbst, und, wie wir gleich sehen werden, mit ihrer Aufzählung sind noch nicht alle axiomatischen Voraussetzungen der Lehre erschöpft. Die marxistisch-wissenssoziologische Lehre, der wir uns wieder zuwenden und mit der wir uns in den weiteren Ausführungen allein befassen wollen, besagt, daß das Denken vom Sein (der Klassenzugehörigkeit) des Denkers dergestalt abhängig ist, daß alle von ihm erzeugten Theorien nicht allgemeingültige Wahrheit, wie ihre Urheber vermeinen, sondern eine den Klasseninteressen dienende Ideologie bringen. Nun aber kann kein Zweifel darüber bestehen, daß den Klassenangehörigen, die die Interessen ihrer eigenen Klasse so gut es geht wahrnehmen wollen, die durch keinerlei ideologische Irrtümer getrübte Erkenntnis des wahren Sachverhaltes ganz besonders dienlich sein müßte. Je besser sie ihn kennen, desto besser werden sie die Mittel zur Verfolgung ihrer Klasseninteressen zu wählen wissen. Freilich: wenn die Erkenntnis des Wahren zur Einsicht führen sollte, daß das Klasseninteresse anderen Werten geopfert werden soll, dann könnte sie den Eifer, mit dem die vermeintlichen Klasseninteressen vertreten werden, schwächen, und dann wäre eine falsche Lehre, die diesen Nachteil vermeidet, der wahren an Kampfwert überlegen. Doch wenn man diese Möglichkeit zugibt, hat man die Grundlage der ganzen Lehre aufgegeben.
Die Förderung, die die kämpfende Klasse durch die falsche Lehre erfährt, kann mithin nur darin bestehen, daß sie die Kampfkraft der gegnerischen Klassen schwächt. Die »bürgerliche« Nationalökonomie [179] z. B. fördert die Bourgeoisie einmal im Kampfe gegen die vorkapitalistischen Mächte und dann wieder im Widerstande gegen das Proletariat, indem sie diesen Gegnern die Überzeugung von der Notwendigkeit der Herrschaft des kapitalistischen Systems beibringt. Wir kommen damit zu der vierten und letzten der axiomatischen Voraussetzungen dieses Stückes der marxistischen Lehre: Die Förderung, die eine Klasse durch den Umstand, daß ihre Angehörigen nur in Apologien (Ideologien) und nicht in richtigen Theorien denken können, erfährt, überwiegt den Nachteil, der daraus erwächst, daß ihr eben dadurch die Vorteile entgehen, die der Besitz einer nicht durch das falsche Bewußtsein getrübten Erkenntnis des wahren Sachverhaltes im praktischen Handeln gewähren müßte.
Man muß sich darüber klar werden, daß die Lehre von der Abhängigkeit des Denkens von der Klassenlage des Denkers alle diese vier Axiome zur Grundlage hat. Diese Abhängigkeit erscheint als eine Förderung der Klasse im Klassenkampfe; daß ihr Denken nicht absolut richtig, sondern klassenbedingt ist, ist eben darauf zurückzuführen, daß das Interesse dem Denken den Weg vorzeichnet. Wir wollen hier nun gar nicht den Versuch machen, diese vier Axiome, die man gemeiniglich ohne Beweis gelten läßt, weil man sie eben auch gar nicht beweisen kann, irgendwie in Zweifel zu ziehen. Unsere Kritik hat allein der Beantwortung der Frage zu gelten, ob die Klassentheorie zur Entlarvung der modernen Nationalökonomie als Klassenideologie der Bourgeoisie herangezogen werden kann, und sie muß versuchen, ihre Aufgabe immanent zu lösen.
Man mag nun immerhin auf dem Standpunkte des vierten der oben dargelegten Axiome stehen, wonach es für eine Klasse vorteilhafter sei, einer den Sachverhalt entstellenden Lehre anzuhängen, als den Sachverhalt richtig zu erfassen und darnach zu handeln. Doch das kann zweifellos höchstens für die Zeit gelten, in der die anderen Klassen noch nicht über die ihrem Sein adäquaten Lehren verfügen; denn später würde doch zweifellos die Klasse, die ihr Handeln nach der richtigen Lehre einrichtet, überlegen sein den Klassen, die eine falsche wenn auch subjektiv ehrliche Lehre zugrunde legen, und der Vorteil, den die klassenbedingte Lehre sonst gewährt, indem sie den Widerstand der feindlichen Klassen schwächt, würde jetzt, da diese ihr Denken schon von dem der anderen Klassen emanzipiert haben, nicht mehr gegeben sein.
Wenden wir das auf unser Problem an.
Marxisten und Wissenssoziologen sagen: Diese moderne Schule [180] der subjektivistischen Nationalökonomie ist »bürgerliche« Wissenschaft, ein letzter aussichtsloser Versuch, die kapitalistische Ordnung der Dinge zu retten. Wenn man diesen Vorwurf gegen die klassische Nationalökonomie und ihre unmittelbaren Nachfolger erhoben hat, so hatte das immerhin noch Sinn. Damals, als es noch die proletarische »Nationalökonomie« nicht gegeben hat, konnte man meinen, daß das Bürgertum durch seine Wissenschaft das Proletariat am Erwachen zum Bewußtsein seiner Klassenlage hindern könne. Doch nun ist die »proletarische« Wissenschaft geboren, das Proletariat ist klassenbewußt. Wenn das Bürgertum heute mit einem neuen apologetischen Versuch kommt, mit neuer bürgerlicher Wissenschaft, mit neuer »Ideologie«, dann ist es zu spät; am Klassenbewußtsein des Proletariers, der nicht mehr anders als klassenmäßig denken kann, müssen alle Versuche, damit Erfolg zu erzielen, abprallen. Heute könnte es den Interessen des Bürgertums nur schaden, wenn sein Denken eine neue Klassenideologie ausbrüten würde. Die gegnerischen Klassen könnte man nicht mehr unter die Herrschaft dieser Lehre bringen. Daß aber das Handeln des Bürgertums durch diese falsche Lehre bestimmt wird, müßte den Erfolg seiner Kampfhandlungen gefährden. Wenn es das Klasseninteresse ist, das das Denken bestimmt, so müßte das Bürgertum heute zu einer Theorie gelangen, die, frei von jeder Trübung durch falsches Bewußtsein, ausspricht, was wirklich ist.
Dem marxistischen und wissenssoziologischen Kritiker könnte man also, wenn man sich auf seinen eigenen Standpunkt stellen wollte, sagen: Bis zum Auftreten von KARL MARX focht das Bürgertum mit einer »Ideologie«, dem System der Klassiker und der Vulgärökonomie. Als aber durch das Erscheinen des ersten Bandes des »Kapital« (1867) dem Proletariat die seinem gesellschaftlichen Sein entsprechende Lehre gegeben worden war, hat das Bürgertum seine Taktik geändert. Eine »Ideologie« konnte ihm nicht mehr länger dienlich sein, seit das Proletariat, zum Bewußtsein seines gesellschaftlichen Seins als Klasse erwacht, damit nicht mehr geködert und eingelullt werden konnte. Jetzt bedurfte das Bürgertum einer Lehre, die, frei von jeder ideologischer Trübung das wahre Sein der Dinge nüchtern erschauend, ihm die Möglichkeit bot, in dem großen Entscheidungskampf der Klassen stets das zweckmäßigste Mittel zu ergreifen. Schnell war die alte Ökonomik aufgegeben und seit 1870, zuerst durch JEVONS, MENGER, WALRAS, dann durch BÖHM, CLARK, PARETO, die neue, die richtige Lehre ausgebildet, die die veränderte Klassenlage der Bourgeoisie nun forderte. Denn die Klassenlage [181] der Bourgeoisie im Stadium ihres Kampfes gegen das zum Bewußtsein seiner Klassenlage bereits erwachte Proletariat bringt es mit sich, daß die dem Klassensein des Bürgertums adäquate Lehre, d. h. seinem Klasseninteresse am besten dienende Lehre, nicht »Ideologie«, sondern Erkenntnis des absolut Richtigen ist.
Mit Marxismus und Wissenssoziologie läßt sich eben alles beweisen und nichts.
III. Die Rolle des Ressentiments.
In der Schrift de officiis hat CICERO einen Kodex gesellschaftlicher Respektabilität und Ehrbarkeit niedergelegt, der die Auffassungen über Vornehmheit und Anständigkeit, die Jahrtausende hindurch in der abendländischen Zivilisation geherrscht haben, getreu widerspiegelt. CICERO hat in seinem Werke nichts Neues gebracht oder bringen wollen; er hat ältere griechische Vorbilder benützt, und die Ansichten, die er vorträgt, entsprachen durchaus dem, was schon seit Jahrhunderten in der Welt des Griechentums und des Hellenismus und im republikanischen Rom gegolten hatte. Roms republikanische Verfassung wich dem Kaisertum, Roms Götter dem Christengotte; das römische Weltreich brach zusammen, aus den Stürmen der Völkerwanderung entstand ein neues Europa, Papsttum und Kaisertum stürzten von ihrer Höhe, neue Mächte traten an ihre Stelle, doch die Geltung der sozialen Wertmaßstäbe CICEROs blieb unerschüttert. VOLTAIRE nannte die Schrift de officiis das nützlichste Handbuch der Moral [239] , und Friedrich der Große hielt es für das beste Werk auf dem Gebiete der ethischen Philosophie, das jemals geschrieben worden ist oder geschrieben werden wird [240].
In allem Wandel der gesellschaftlichen Schichtung blieb für den Moralphilosophen der Grundgedanken der CICEROnischen Lehre unerschüttert in Geltung: Gelderwerb befleckt. Das war die Auffassung der vornehmen Großgrundbesitzer und der fürstlichen Höflinge, Offiziere und Beamten, das war auch die Meinung der Literaten, sei es nun, daß sie als Almosenempfänger am Hofe eines Großen lebten oder als Inhaber kirchlicher Pfründen in gesicherter Stellung wirken durften. Die Säkularisierung der hohen Schulen und die Umwandlung der prekären Hofliteratenstellungen in aus öffentlichen Mitteln bestrittene Sinekuren hat das Mißtrauen des für sein Wirken als Lehrer, [182] Forscher und Schriftsteller besoldeten Intellektuellen gegen den unabhängigen Forscher, der von dem meist nur dürftigen Ertrage seiner Schriften oder von irgendwelcher anderer Tätigkeit seinen Unterhalt bestreiten muß, nur noch verschärft. Durch ihre Stellung in die Hierarchie von Kirche, Staatsverwaltung und Heeresdienst eingegliedert, blickten sie, wie alle durch Beteilung aus Steuereingängen dem Erwerbsleben Entrückten, mit Verachtung auf den Kaufmann, der dem Mammon dient. Diese Verachtung verwandelte sich in dumpfen Groll, als mit der Ausbreitung des Kapitalismus Unternehmer zu großem Reichtum und damit zu hohem Ansehen aufzusteigen begannen. Es wäre ein schwerer Irrtum, anzunehmen, daß das Ressentiment gegen Unternehmer und Kapitalisten, gegen Reichtum und ganz besonders gegen neuen Reichtum, gegen Gelderwerb und besonders gegen Handel und Spekulation, das heute unser ganzes öffentliches Leben, die Politik und das Schrifttum beherrscht, seinen Ursprung von Gefühlen der breiten Volksschichten herleitet. Es stammt gerade aus den Kreisen und Anschauungen der im öffentlichen Dielst mit festenSold und in Staatlich anerkanntem Range stehenden Gebildeten. Es ist demgemäß in einem Volke um so stärker, je williger es sich von der Obrigkeit und ihren Organen führen läßt; es ist in PreußenDeutschland und in Osterreich stärker als in England und schwächer noch in den Vereinigten Staaten, am schwächsten in den britischen Dominions.
Gerade der Umstand, daß viele dieser obrigkeitlich geeichten Gebildeten durch Beziehungen der Blutsverwandtschaft und Schwägerschaft, der Schulkameradschaft und des geselligen Umgangs mit den Angehörigen der Schicht der Erwerbenden enge verbunden sind, verschärft noch die Neidund Haßgefühle. Die Empfindung, daß sie den gering geschätzten Kaufleuten in vielem unterlegen sind, bringt in den Wirtschaftsfremden Minderwertigkeitskomplexe zur Entstehung, die das Ressentiment verstärken. Nicht der handelnde Mensch gestaltet die ethischen Wertmaßstäbe, sondern der procul negotiis lebende Schriftsteller. Eine Moral, deren Schöpfer in den Kreisen der Priester, Beamten, Professoren und Offiziere zu suchen sind, hat für Unternehmer, Kapitalisten und Spekulanten nur Abscheu und Verachtung übrig.
Und nun bringt man diesen von Haß und Neid erfüllten Gebildeten eine Lehre, die bewußt wertfrei die Markterscheinungen erklärt. Preisund Zinssteigerungen und Lohnsenkungen, die man sonst auf die Habsucht und Herzlosigkeit der Reichen zurückführte, [183] werden da ganz natürlich als Reaktion des Marktes auf Veränderungen von Angebot und Nachfrage zurückgeführt, und es wird gezeigt, daß eine arbeitteilende, auf dem Sondereigentum beruhende Gesellschaftsordnung ohne diese Regelung durch den Markt gar nicht bestehen könnte. Was als moralisches Unrecht, ja als strafwürdiges Verbrechen verdammt wurde, wird hier gewissermaßen als Naturerscheinung angesehen. Kapitalisten, Unternehmer und Spekulanten erscheinen nicht mehr als Schmarotzer und Ausbeuter, sondern als Organe der gesellschaftlichen Organisation, deren Funktion schlechthinhin unentbehrlich ist. Das Herantragen pseudo-moralischer Maßstäbe an Vorgänge des Marktes verliert jede Berechtigung, die Begriffe Wucher, Preistreiberei, Ausbeutung werden ihres ethischen Sinns entkleidet und damit ganz sinnlos. Und schließlich führt die Wissenschaft mit harter und unwiderlegbarer Logik den Nachweis, daß die Ideale der Gegner des Erwerbslebens hohl sind, daß sozialistische Gesellschaftsordnung unverwirklichbar und daß interventionistische Gesellschaftsordnung sinnund zweckwidrig, daß also die Marktwirtschaft die einzig mögliche Ordnung gesellschaftlicher Kooperation ist. Es ist nicht erstaunlich, daß diese Lehren in den Kreisen, deren Ethik in der Verurteilung des Erwerbstriebes gipfelte, auf heftigen Widerstand stoßen mußten.
Die Nationalökonomie hat den Glauben, der von der Überwindung des Sondereigentums und der Tauschund Marktwirtschaft das Heil erwartete, zerstört. Sie hat gezeigt, daß die Allmacht der gesellschaftlichen Gewalten, von der man Wunder erhoffte, ein Wahngebilde ist, und daß es für den die gesellschaftliche Kooperation aufbauenden Menschen, für das ζώον πολιτιχόν geradeso unüberschreitbare Grenzen gibt wie für den die organische und anorganische Natur in der Produktion lenkenden homo faber. Das mußten die Diener dieses Gewaltapparates, sowohl die im imperium als die im magisterium, auch als Herabsetzung ihrer persönlichen Geltung ansehen. Als Halbgötter, die Geschichte machen, oder zumindest als die Gehilfen dieser Halbgötter fühlten sie sich; nun sollten sie nichts als Vollstrecker einer unabänderlichen Notwendigkeit sein. Wie die deterministischen Lehren, auch ganz abgesehen von den kirchlichdogmatischen Bedenken, auf inneren Widerstand des sich frei fühlenden Menschen stießen, so stießen diese Lehren auf den Widerstand der sich in ihrer politischen Macht frei fühlenden Regierer und ihres Anhanges.
Der Macht einer herrschenden Ideologie kann sich niemand [184] entziehen. Auch Unternehmer und Kapitalisten stehen unter dem Einfluß der Moralanschauungen, die ihr Treiben verdammen. Mit schlechtem Gewissen treten sie zur Abwehr der wirtschaftspolitischen Forderungen an, die man aus den Grundsätzen der Beamtenmoral ableitet. Das Mißtrauen, das sie gegen alle Lehren erfüllt, die die Markterscheinungen ohne ethische Beurteilung betrachten, ist nicht geringer als das aller übrigen Schichten. Das Minderwertigkeitsgefühl, das in ihnen das Bewußtsein erweckt, daß ihr Tun unmoralisch sei, wird nicht allzuselten durch Übertreibung der Grundsätze der antichrematistischen Ethik überkompensiert. Von dem Anteil, den Millionäre und Söhne und Töchter von Millionären an der Bildung und Führung der sozialistischen Arbeiterparteien genommen haben, ist schon oft gesprochen worden. Aber auch außerhalb der sozialistischen Parteien begegnen wir derselben Erscheinung. Wenn die geistige Oberschicht des deutschen Volkes die auf dem Sondereigentum an den Produktionsmitteln beruhende Gesellschaftsordnung verwirft, so ist das nicht in letzter Linie der Erfolg des Lebens und Wirkens von zwei Unternehmern, ERNST ABBE und WALTHER RATHENAU.
IV Notwendigkeit und Freiheit.
Die letzte Aussage, bis zu der die Erkenntnistheorie vorzudringen vermag, ohne den festen Grund der Wissenschaft zu verlieren und sich in vage Spekulationen metaphysischer Begriffsdichtung einzulassen, lautet: Die Veränderungen des unserer Erfahrung Gegebenen vollziehen sich in einer Weise, die uns im Gang der Dinge das Walten allgemeiner Regeln, die keine Ausnahme zulassen, erkennen läßt.
Unser Denken ist nicht imstande, eine Welt zu denken, in der die Dinge nicht »nach ewigen, ehernen großen Gesetzen« ablaufen würden. So viel aber ist uns doch klar, daß in einer so beschaffenen Welt menschliches Denken und menschliches »rationales« Handeln nicht möglich wären, daß es also in einer so beschaffenen Welt weder Menschen noch logisches Denken geben könnte.
Die Gesetzmäßigkeit des Weltablaufes muß uns mithin als die Grundlage unseres menschlichen Daseins, als die letzte Wurzel unseres Menschentums erscheinen. An sie zu denken, kann uns nicht mit Angst erfüllen, muß uns vielmehr beruhigen und uns ein Gefühl der Sicherheit verleihen. Denn weil im Weltenlauf nicht Willkür herrscht, sondern Gesetze, von denen wir etwas zu erkennen vermögen, ist es uns gegeben, zu handeln, das heißt, unser Verhalten so einzustellen, daß von uns gewünschte Zwecke erreicht werden können. Wäre es [185] anders, dann wären wir durchaus Spielball eines uns nicht verständlichen Treibens.
Erfassen können wir nur die Regel, die in der Veränderung des Gegebenen zum Ausdruck kommt, das Gegebene selbst bleibt uns immer unerklärbar. Unser Handeln muß das Gegebene hinnehmen, wie es ist. Doch auch die Kenntnis der Regeln macht das Handeln nicht frei. Es vermag nie mehr, als bestimmte eng umgrenzte Ziele zu erreichen. Über die unübersteigbaren Schranken, die ihm gezogen sind, kann es nie hinausgehen, und auch innerhalb des ihm eingeräumten Spielraums hat es immer mit dem Einbruch unbeherrschbarer Kräfte, mit dem Schicksal zu rechnen.
Hier tritt uns nun eine eigenartige psychologische Tatsache entgegen. Mit dem Unbekannten, das schicksalhaft über uns kommt, rechten wir weniger als mit dem Ergebnis des Wirkens der Regeln, die wir erfaßt haben. Denn das Unbekannte ist auch das Unerwartete; wir können sein Herannahen nicht sehen, wir erfassen es erst, bis es schon da ist. Was aus der bekannten Regel fließt, können wir voraussehen und erwarten. Ist es unseren Wünschen widrig, dann liegt in diesem Warten auf das Unheil, das kommt, ohne daß wir es wenden können, arge Qual. Daß das Gesetz unerbittlich ist und keine Ausnahmen macht, wird uns ein unerträglicher Gedanke. Daß die Regel wider alles Erwarten diesmal, dies eine Mal, doch ausweichen möge, auf das Wunder bauen wir unsere Hoffnung; der Glauben an das Wunder wird zum einzigen Trost. Mit ihm lehnen wir uns gegen die Härte des Naturgesetzes auf, bringen wir die Stimme unseres Denkens zum Schweigen; vom Wunder erwarten wir, daß es den voraussichtlichen, uns jedoch nicht genehmen Gang der Dinge wenden soll.
Von der ehernen Unerbittlichkeit und Strenge des Gesetzes, die unser Denken und Handeln in der »Natur« längst schon zu erkennen genötigt wurden, glaubte man auf dem Gebiete menschlichen Verhaltens und demgemäß auch auf dem des gesellschaftlichen Lebens frei zu sein, bis seit dem 18. Jahrhundert die Ausbildung der Wissenschaft der Soziologie und insbesondere ihres bis heute am meisten ausgestalteten Teilstückes, der Nationalökonomie, auch hier das »Gesetz« erkennen ließ. Wie man, ehe die Einsicht in die Gesetzmäßigkeit des Naturgeschehens aufgedämmert war, sich in Abhängigkeit von übermenschlichen Wesen, von Gottheiten, fühlte, die man zuerst als ganz willensfrei, d. h. in ihrem Tun und Lassen über jede Bindung erhaben, dachte, und dann zumindest als Souveräne, die Ausnahmen von der sonst geltenden Regel in einzelnen Fällen zu verfügen befähigt sind, [186] so empfand der Mensch bis dahin im Gesellschaftlichen nichts als Abhängigkeit von Gewalten und Gewalthabern, deren gesellschaftliche Macht unbegrenzt erschien. Von ihnen, von den Großen und Erhabenen, konnte man alles erwarten; im Guten wie im Bösen gab es für sie keine irdischen Schranken, mochte man auch hoffen, daß das Gewissen im Hinblick auf die Vergeltung im Jenseits sie meist davon abhalten werde, ihre Macht zum Bösen zu mißbrauchen. Diese Denkungsart wurde von der individualistischen und nominalistischen Sozialphilosophie der Aufklärung in zweifacher Weise erschüttert. Sie deckte die ideologische [241] Grundlage aller gesellschaftlichen Macht auf, und sie zeigte, daß jede Macht durch eine im Gesellschaftlichen waltende Gesetzmäßigkeit in ihrer Auswirkung begrenzt sei.
Stärker noch als die Auflehnung gegen die Lehre von der Gesetzgebundenheit der Natur war das Aufbäumen gegen diese Lehren. Wie die Massen von der unerbittlichen Strenge des Naturgesetzes nichts wissen wollen und an die Stelle des Gottes der Theisten und Deisten, der an die Gesetze gebunden ist, wieder die freischaltende Gottheit treten lassen, von der Gnaden Wunder zu erhoffen sind, so lassen sie sich den Glauben an die unbegrenzte Allmacht der gesellchaftlichen Gewalten nicht rauben. Wie in der Not selbst der Weise sich bei der Hoffnung auf das Wunder ertappt, so bringt ihn Unzufriedenheit mit seiner gesellschaftlichen Lage zur Hoffnung auf eine Reform, die, durch keine Schranken beengt, alles leisten könnte.
Das Wissen um die Unerbittlichkeit der Naturgesetze ist immerhin schon so lange in das Bewusstsein, zumindest in das der Gebildeten, gedrungen, daß man in den Lehren der Naturwissenschaft eine eine Anweisung erblickt, wie man Ziele erreichen kann, die sonst unerreichbar blieben. Dagegen sind auch die Gebildeten noch immer so erfüllt von der Vorstellung, daß im Gesellschaftlichen alles erreicht werden könnte, wenn man genug Macht und Willensstärke aufbringt, daß sie aus den Lehren der Gesellschaftswissenschaft nur die düstere Botschaft herauslesen, daß viel von dem, was sie wollen, nicht erreicht werden kann. Die Naturwissenschaft, meint man, zeige, was gemacht werden könnte und wie es gemacht werden könnte; die Gesellschaftslehre, meint man hingegen, zeige nur, was nicht gemacht werden könne und warum es nicht gemacht werden könne. Die auf der Naturwissenschaft beruhende Technik wird allenthalben gepriesen; die wirtschaftspolitischen Lehren des Liberalismus werden abgelehnt [187] und die Nationalökonomie, auf der sie beruhen, als dismal science gebrandmarkt.
Kaum jemand wendet sein Interesse den Problemen des Gesellschaftslebens zu, ohne den Antrieb dazu von dem Willen, Reformen durchgeführt zu sehen, empfangen zu haben; vor der Beschäftigung mit der Wissenschaft steht der Entschluß, bestimmte Wege im Handeln zu gehen. Nur wenige haben die Kraft, die Erkenntnis, daß diese Wege ungangbar sind, hinzunehmen und daraus alle Folgerungen zu ziehen. Die meisten bringen leichter das Opfer des Intellekts als das Opfer ihrer Tagträume. Sie können es nicht ertragen, daß ihre Utopie an den unabänderlichen Bedingungen des menschlichen Daseins scheitern soll. Was sie ersehnen, ist eine andere Wirklichkeit als die in der Welt gegebene, ist »der Sprung der Menschheit aus dem Reiche der Notwendigkeit in das der Freiheit« [242]. Sie wollen frei sein von einem Kosmos, dessen Einrichtung sie ihren Beifall versagen.
Schluß.
Die romantische Auflehnung gegen Logik und Wissenschaft beschränkt sich nicht auf das Gebiet des Gesellschaftlichen und der Gesellschaftswissenschaft; sie ist Auflehnung gegen das Ganze unserer Kultur und Zivilisation. Abkehr vom Wissen und von der Technik, Rückkehr zum Glauben und zur Bukolik des Mittelalters fordern sowohl SPANN als auch SOMBART, und alle Deutsche, die nicht im Lager des Marxismus stehen, stimmen ihnen freudig zu. Die Marxisten aber sind eifrig dabei, ihren einst nüchternen »wissenschaftlichen« Sozialismus in einen den Massen mehr zusagenden romantischen und sentimentalen Sozialismus umzugestalten.
Der Wissenschaft wird vorgeworfen, daß sie nur zum Verstande spreche, das Gemüt aber leer und unbefriedigt lasse. Sie sei hart und kalt, wo Wärme verlangt wird; sie gebe nur Lehren und Technik, wo Tröstung und Erhebung gesucht werden. Daß es nicht die Aufgabe der Wissenschaft sein kann, religiöse und metaphysische Bedürfnisse zu befriedigen, ist nicht zu bestreiten. Sie darf die Grenzen, die ihr gezogen sind, nicht überschreiten, sie hat sich auf die Ausgestaltung unseres Begriffssystems zu beschränken, um dann mit seiner Hilfe die logische Verarbeitung der Erfahrung in die Hand zu nehmen; sie baut damit die Grundlagen, auf denen die wissenschaftliche Technologie - und dazu gehört auch alle Politik als Kunstlehre des Gesellschaftlichen [188] - ihr System errichtet.
Um Glauben und Seelenfrieden hat sich die Wissenschaft in keiner Weise zu kümmern. Die Versuche, Metaphysik wissenschaftlich zu begründen oder durch monistische Feiern, die dem Gottesdienst nachgebildet werden, eine Art Religionsersatz zu schaffen, haben mit Wissenschaft nichts zu tun. An das Transzendente, an das, was jenseits des Denkens und der Erfahrung für uns unzugänglich ruhen mag, kommt die Wissenschaft in keiner Weise heran; sie kann sich zu Lehren, die allein das Transzendente betreffen, weder ablehnend noch zustimmend äußern.
Ein Konflikt zwischen Glauben und Wissen entsteht erst, wenn Religion und Metaphysik aus ihrer Sphäre heraustreten und der Wissenschaft den Kampf ansagen; sie greifen an, teils aus dem Bedürfnis, Glaubenssätze zu verteidigen, die mit dem Stande der wissenschaftlichen Erkenntnis nicht vereinbar sind, öfter noch, um sich gegen die Anwendung der Wissenschaft im Leben zu kehren, wenn diese dem von ihnen empfohlenen Verhalten nicht entspricht. Es ist unschwer zu verstehen, warum dabei die subjektivistische Nationalökonomie am stärksten befehdet wird.
Man darf sich nicht darüber täuschen, daß heute nicht nur die Massen, sondern auch die Gebildeten, die, die man die Intellektuellen nennt, in dieser Auseinandersetzung nicht auf der Seite der Wissenschaft zu finden sind. Manchen mag diese Haltung Herzensbedürfnis sein. Sehr viele aber rechtfertigen ihre Stellungnahme damit, daß es im Zug der Zeit liege, daß man sich dem sehnsüchtigen Wunsch der Massen nicht verschließen dürfe, daß der Intellekt sich demütig vor dem Instinkt und der Einfalt des frommen Gemüts beugen müsse. So dankt der Intellektuelle freiwillig ab, verzichtet voll Selbstverleugnung auf seine Führerrolle und wird zum Geführten. Diese Umkehr nicht etwa der Wissenschaft, sondern derer, die sich als die Träger der Geisteskultur ansehen war weitaus das wichtigste geschichtliche Ereignis der letzten Jahrzehnte. Ihr Ergebnis ist eine Politik, deren Früchte wir mit Entsetzen reifen sehen.
Wissenschaftliches Denken hat zu allen Zeiten vereinsamt. Doch nie war es um eine Wissenschaft herum einsamer als um die moderne Nationalökonomie. Das Schicksal der Menschheit Fortschreiten auf dem Wege, den die Gesittung des Abendlandes seit Jahrtausenden geht, oder jäher Absturz in ein wüstes Chaos, aus dem es keinen Ausweg gibt, aus dem kein neues Leben je erstehen wird hängt davon ab, ob es dabei bleiben wird.
[189]
Der Streit um die Wertlehre [243].↩
Wenn wir hier zusammentreten, um eine Frage der nationalökonomischen Theorie in Wechselrede zu erörtern, so müssen wir zunächst über zwei Grundsätze einig werden, weil sonst jeder Versuch einer Verständigung von vornherein aussichtslos wäre. Wir müssen einmal, den Spuren KANTs folgend, den Gemeinspruch: »Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis« ablehnen. Ich glaube, daß über diesen Punkt nicht viel Worte zu verlieren sind. Wenn ich ihn dennoch erwähne, so gegeschieht es nur darum, weil auf der letzten Vollversammlung unseres Vereines in der Wechselrede der Ausdruck »Theoretiker« von einem der Redner, ohne daß sich sofort Widerspruch geltend gemacht hätte, mit einem höhnenden Beigeschmack verwendet wurde.
Weit wichtiger ist es, daß wir, um überhaupt verhandeln zu können, uns auch zu einem Grundsatz bekennen müssen, den KANT zwar nicht ausgesprochen, aber doch, wie alle seine Vorgänger, stillschweigend vorausgesetzt hat. Wir müssen annehmen, daß die logische Struktur des menschlichen Denkens im Ablauf der Zeiten unveränderlich und für alle Rassen, Völker und Klassen gleich ist. Wir wissen sehr wohl, daß die Mehrheit des deutschen Volkes diesen Standpunkt nicht teilt; wir wissen, daß insbesondere auch die Mehrheit der Gebildeten ihn nicht teilt, und ich glaube, daß man auch sagen darf, daß die Mehrheit der Studierenden unseres Faches heute an den Universitäten Vorlesungen hört, in denen dieser Standpunkt abgelehnt wird. Die Auseinandersetzung mit den Lehren, die die Klassen-, Zeitoder Rassengebundenheit des begrifflichen Denkens behaupten, gehört zweifellos zu den Aufgaben, denen wir uns nicht entziehen dürfen, wenn wir Gesellschaftslehre und Nationalökonomie treiben wollen. Doch diese Auseinandersetzung kann sinnvoll nur unter uns, d. h. nur unter denen vor sich gehen, die die Unabhängigkeit der Logik und des Denkens von Zeit, Rasse, Volkstum und Klasse annehmen. Wir können versuchen, die Einwendungen derer, die die Seinsgebundenheit des Denkens lehren, auf ihren Gehalt zu prüfen und bis ans Ende durchzudenken. Doch jene dürfen und können sich mit uns über unsere Einwendungen nicht auseinandersetzen, ohne ihren eigenen Standpunkt aufzugeben.
[190]
Das gilt nicht weniger als für die erkenntnistheoretische Auseinandersetzung über die Grundlagen soziawissenschaftlicher Erkenntnis für die Erörterung der einzelnen Probleme unserer Wissenschaft. Wir wollen doch Wissenschaft und nicht subjektive Werturteile, Erkenntnisfragen und nicht Fragen des Willens, Sein und nicht Sollen erörtern. Wenn wir von der Wertlehre sprechen wollen, dürfen wir das nicht in der Weise tun, daß wir jedem gestatten, sich auf die Berechtigung seiner Auffassung vom Standpunkte seines Volkes, seiner Rasse oder seiner Klasse zu berufen. Und wir dürfen es schon gar nicht dulden, daß jemand dem andern die Seinsbedingtheit seines Standpunktes vorhält, daß jemand etwa in der bekannten Weise BÖHM-BAWERKs Zinstheorie als die Zinstheorie der Phäakenstadt Wien oder die subjektivistische Wertlehre als die politische Ökonomie des Rentners kennzeichnet. Der Marxist möge, wenn er es kann, BÖHM-BAWERK als Repräsentanten »nach Vergnügung haschender Studenten« und »glänzender, doch stets an Geldmangel leidender Offiziere« entlarven [244] , aber dann möge er diese Entdeckung denen mitteilen, die er für seine Klassengenossen hält, nicht uns, die wir in seinen Augen auch nur Lebemänner, Phäaken und Rentner oder vielleicht noch Schlimmeres sind.
Ein Marxist ich verstehe unter diesem Ausdruck hier nicht etwa die Mitglieder einer der auf MARX schwörenden politischen Parteien, vielmehr alle, die sich in ihrem sozialwissenschaftlichen Denken auf MARX berufen der sich dazu herbeiläßt, mit Leuten, die nicht seine Klassengenossen sind, ein wissenschaftliches Problem zu erörtern, hat den ersten und wichtigsten Grundsatz seiner Theorie preisgegeben. Wenn das Denken seinsgebunden ist, wie kann er mich, wie kann ich ihn verstehen? Wenn es eine »bürgerliche« und eine »proletarische« Logik gibt, wie soll dann ich, der »Bürger«, mich mit ihm, dem »Proleten«, auseinandersetzen? Wem es um den marxistischen Standpunkt ernst ist und dasselbe gilt mutatis mutandis auch vom Standpunkte derer, die das Denken als durch die Rassenund Volkszugehörigkeit des Denkers bestimmt ansehen der muß für reinliche Scheidung der Wissenschaft eintreten. Ihm kann es nicht genügen, daß in den sportlichen Wettkämpfen die Klassen geschieden werden, daß es eine »bürgerliche« Olympiade und eine »proletarische« gibt; er muß diese Trennung vor allem für die wissenschaftliche Erörterung verlangen.
[191]
Die geringe Ergiebigkeit mancher Debatten, die hier im Verein für Sozialpolitik und in der Gesellschaft für Soziologie durchgeführt wurden, ist vor allem der Außerachtlassung dieses Grundsatzes zuzuschreiben. Der Standpunkt des starren Marxismus ist m. E. irrig, doch der Standpunkt des Marxisten, der sich mit dem, was er »bürgerliche Wissenschaft« nennt, in Erörterungen einläßt, ist konfus. Der folgerichtig denkende Marxist sucht die Gegner, die er »bürgerliche« nennt, nicht zu widerlegen; er sucht sie physisch und moralisch zu vernichten.
Der Marxist überschreitet die Schranken, die er sich durch sein Bekenntnis zu MARX selbst setzt, wenn er an unserer Erörterung teilnehmen wollte, ohne sich vorher vergewissert zu haben, daß wir alle seine Klassengenossen sind. Das Kernstück des Marxismus ist die Lehre von der Klassengebundenheit des Denkens. Man kann diese Lehre nicht zeitweilig in ein Futteral stecken, um sie nur gelegentlich nach Belieben und Bedarf zu verwenden. Marxistische Ökonomie ohne materialistische Geschichtsauffassung wäre nichts als Verballhornung des Ricardianismus. Daß wir uns mit RICARDO auseinandersetzen müssen, wenn etwa Verteidiger seiner Arbeitswertlehre hier auftreten sollten, ist natürlich unbestritten.
Es ist keineswegs die Aufgabe einer Diskussion, wie es die unsrige ist, die Verschiedenheit, die zwischen unseren Auffassungen besteht, irgendwie zu verkleinern oder zu verschleiern. Für politische Tagungen erscheint es erwünscht, den Gegensatz der Richtungen möglichst unbedeutend erscheinen zu lassen. Der Zweck solcher Veranstaltungen ist die Herbeiführung eines Entschlusses zu einheitlichem Handeln; dieser Zweck kann nur erreicht werden, wenn endlich alle in einer Linie stehen. Unsere Aufgabe ist nicht Handeln, sondern Erkennen; und Erkenntnis wird nur durch Klarheit und Schärfe, nie durch Kompromisse gefördert. Wir müssen uns bestreben, das, was uns trennt, möglichst scharf herauszuarbeiten.
Gerade wenn wir das tun, werden wir zu einem sehr wichtigen Ergebnis gelangen, nämlich zu der Feststellung, daß es auf dem Gebiete, das wir heute hier behandeln, viel weniger verschiedene Standpunkte gibt und geben kann, als es Etiketten und Parteien gibt.
Die Aufgabe, die wir uns setzen, ist die Erklärung der Markterscheinungen. Wir wollen die Gesetze erforschen, die die Bildung der Austauschverhältnisse der Güter und Dienstleistungen, das ist die Bildung der Preise, Löhne und Zinssätze, bestimmen. Ich weiß sehr wohl, daß auch dies bestritten wird. Die historische Schule der Staatswissenschaften glaubt, daß es allgemeingültige Marktund Tauschgesetze [192] nicht geben kann und daß es daher sinnlos wäre, nach ihnen zu forschen. Die Preisbildung werde, meint man, nicht durch »ökonomische Gesetze«, sondern durch die »sozialen Machtverhältnisse« bestimmt.
Daß man sich auch mit diesem Standpunkt auseinandersetzen muß, wenn man überhaupt Nationalökonomie betreiben will, ist klar, und wir alle kennen die unvergänglichen meisterhaften Arbeiten von MENGER, BÖHM-BAWERK und anderen, in denen dies versucht wurde. Man kann jedoch nicht alle wissenschaftliche Probleme gleichzeitig behandeln; wir haben uns mit dieser Leugnung der Möglichkeit nationalökonomischer Wissenschaft auf der Würzburger Tagung befaßt. Hier und heute darf davon nicht die Rede sein, soll unsere Aussprache nicht vom Ziele, das wir uns gesetzt haben, abirren.
Dieses Ziel ist die Erörterung der Markttheorie, und der erste Punkt, an dem unsere Arbeit einzusetzen hat, ist die Frage: sollen wir der Preislehre eine besondere Wertlehre unterbauen?
In der Wertlehre versuchen wir, die Preisbildung auf Faktoren zurückzuführen, die nicht nur in einer Gesellschaft wirksam sind, die das Sondereigentum und damit den Markt kennt, sondern in jeder denkbaren Gesellschaft, also auch in der tauschlosen Wirtschaft, d. h. in einer Wirtschaft, die den interpersonellen Tausch nicht kennt. Solche Wirtschaften sind auf der einen Seite die selbstgenügsame Wirtschaft des isolierten Wirts und auf der anderen Seite die Wirtschaft eines sozialistischen Gemeinwesens. Auf die Frage, ob diese beiden Wirtschaftsformen isolierte selbstgenügsame Wirtschaft und sozialistische Gemeinwirtschaft nur Denkgebilde sind oder ob sie auch historisch realisierbar sind, gehen wir dabei nicht ein. CASSEL hat den Sinn dieser Gedankenoperation verkannt, wenn er glaubt, daß man damit beabsichtigt habe, die Verhältnisse der primitiven Gesellschaft als den einfachsten Fall des Wirtschaftens zu studieren, um von da zu den nach CASSELs Meinung fälschlich für verwickelter angesehenen Verhältnissen einer Geldwirtschaft fortschreiten zu können [245]. Nicht den primitivsten oder den einfachsten, sondern den allgemeinsten Fall wollen wir mit diesem Denkgebilde studieren, um dann nicht etwa zu den historisch späteren und verwickelteren, sondern zu den spezielleren Fällen fortzuschreiten. Und wir wollen nicht wie CASSEL das Geld und den Geldgebrauch schon voraussetzen, [193] sondern wir wollen die Geldfunktion aus dem allgemeineren Fall einer geldlosen Wirtschaft heraus ableiten und erfassen.
Nur wenn der Katallaktik diese Zurückführung auf das Allgemeinste gelingt, wenn sie die Preisbildung zurückverfolgt hat bis zu dem Punkt, wo die Entscheidung der Handelnden fällt: ich ziehe A dem B vor, hat sie ihre Aufgabe ganz erfüllt.
Hier macht die Nationalökonomie aber auch halt. Sie geht nicht weiter zurück und fragt nicht nach dem, was hinter den Entscheidungen der handelnden Menschen steht, warum gerade so gehandelt wird und nicht anders. Diese Selbstbeschränkung der Nationalökonomie ist nicht etwa Willkür. Sie findet ihre Rechtfertigung in dem Umstand, daß die Motive, aus denen gehandelt wird, für die Gestaltung der Preise belanglos sind. Es ist ohne Belang, ob die Nachfrage, die sich auf dem Markte nach Waffen geltend macht, von Menschen ausgeht, die Gutes, oder von solchen, die Böses planen. Entscheidend ist allein das, daß eine Nachfrage in bestimmtem Umfang auftritt. Das scheidet eben die Nationalökonomie von der Psychologie, daß für sie allein das Handeln in Betracht kommt, und daß die seelischen Vorgänge, die zu diesem Handeln geführt haben, für sie bedeutungslos sind.
Es wird immer wieder hervorgehoben, daß der Ausdruck »Wert« mehrdeutig sei. Niemand wird das bestreiten wollen, niemand hat es je bestritten, und jeder Nationalökonom, der sich dieses Ausdruckes bedienen wollte, hat sich vor allem bemüht, die Vieldeutigkeit des Wortes Wert durch scharfe Begriffsbestimmung für den Bereich der wissenschaftlichen Arbeit zu beseitigen. Die Behauptung, daß die moderne Nationalökonomie den Wertbegriff nicht mit aller erforderlichen Schärfe festgelegt hätte, ist entschieden zu bestreiten. Wenn CASSEL meint, daß die Begriffe »Gebrauchswert« und »Tauschwert« genügend Zeugnis ablegen von der Zweideutigkeit in der Auffassung des »Wertes« [246] , so hat er, soweit das wissenschaftliche Schrifttum in Frage kommt, durchaus unrecht. Man hat zumindest seit der Mitte des 18. Jahrhunderts also seit es überhaupt Nationalökonomie gibt scharf zwischen diesen beiden Begriffen geschieden. Wenn man die Bedeutung, die jedem einzelnen dieser beiden Wertbegriffe für die Erklärung der Markterscheinungen beizulegen ist, verschieden beurteilt hat, so hatte dies mit Zweideutigkeit der Begriffsbildung nicht das mindeste zu tun. Es ist unzulässig, zu verkünden, die moderne Nationalökonomie hätte ihre Wertbegriffe [194] nicht mit voller Schärfe herausgearbeitet. Da muß man CASSEL, GOTTL und alle die anderen denn doch bitten, ihre Vorwürfe an Hand eingehender Kritik der modernen Autoren zu beweisen.
Man muß leider immer wieder feststellen, daß der größte Teil der an der modernen Wertlehre geübten Kritik auf krassen Mißverständnissen beruht oder sich auf Dinge bezieht, die einem älteren, heute schon lange überwundenen Stadium der Entwicklung der Lehre angehören. Man darf die Wissenschaft der letzten vierzig Jahre nicht einfach ignorieren, man darf sich heute nicht mehr damit begnügen, MENGER und BÖHM-BAWERK flüchtig anzusehen. Man ist heute nicht mehr auf der Höhe, wenn man nicht auch PARETO kennt oder wenn man, um von Erscheinungen der allerjüngsten Zeit ganz zu schweigen, nicht ĈUHEL und STRIGL gelesen hat. Die Kritik, die CASSEL vor 33 Jahren an einigen Eigenheiten der MENGERschen und BÖHMschen Darstellung geübt hat [247] , war in manchen Punkten berechtigt, wenn auch seine positiven Ausführungen durchaus irrten. Doch CASSEL geht fehl, wenn er glaubt, daß seine Kritik nicht nur die Darstellungsform, sondern auch das Wesen der Lehre berührt hätte, und es ist unverzeihlich, daß er an seinen Mißverständnissen noch heute festhält und dabei das ganze wissenschaftliche Schrifttum des letzten Menschenalters ignoriert. Alles, was CASSEL über das Problem der Wertmessung zu sagen hat, ist hinfällig, weil es die Leistungen der letzten Jahrzehnte nicht berücksichtigt.
Die jüngste und heftigste Kritik der subjektivistischen Wertlehre geht vom Universalismus aus. SPANN behauptet, daß sich ein Haushalt nur ändern könne, »wenn Erzeugung, Entlohnung, Verfrachtung, Verbrauch usw. usw. sich vorher änderte, d. h. aber streng genommen das Gesamtganze der Volkswirtschaft eine Veränderung erfuhr«. Kein Glied sei daher begriffsmäßig eine unabhängige Variable [248]. Was wir täglich sehen und was die Erfahrung uns täglich bestätigt, widerspricht dieser Auffassung. Wenn ich mein Handeln ändere und etwa weniger Fleisch und dagegen mehr Gemüse zu verbrauchen beginne, so muß sich das auf dem Markt auswirken, und diese Änderung geht von mir aus und hat nicht zur Voraussetzung, daß sich vorher der Verbrauch geändert hat. Die Änderung des Verbrauches besteht eben darin, daß ich meinen Verbrauch ändere. Daß [195] dies auf dem Markte in der Regel nur fühlbar wird, wenn nicht nur ein Mensch seinen Verbrauch geändert hat, sondern viele, ist eine Frage der Quantität, die mit dem prinzipiellen Problem nichts zu tun hat, und ebensowenig wird dieses prinzipielle Problem dadurch berührt, daß Änderungen des Verbrauches, die bei vielen auftreten, eine gemeinsame Ursache haben, daß etwa der Übergang vom Fleischverbrauch zum Gemüseverbrauch durch einen Wechsel der Anschauungen der Ernährungsphysiologie bewirkt sein mag. Das berührt die Motive, und warum die Motive für uns gleichgültig sind, haben wir bereits gesagt.
Das, was SPANN ausdrücklich als die wichtigste der Einwendungen des Universalismus bezeichnet, die Ablehnung der Annahmen der größenmäßigen Bestimmbarkeit der Änderungen, der Meßbarkeit der Bedürfnisse und der Quantifizierbarkeit des Wertes, kann schon darum nicht als eine Einwendung gegen die subjektivistische Wertlehre verwendet werden, weil ja die subjektivistische Wertlehre gerade davon ausgeht, daß die Werte nicht gemessen, sondern skaliert werden, was SPANN, in diesem Punkte den Ausführungen ĈUHELs und PARETOs folgend, übernimmt, wenn er von ihrer Rangordnung spricht. Es gibt zweifellos unwiederholbare und einzige Leistungen, aber man darf sich von den Tatsachen, die wir im Handeln des Menschen feststellen können, doch nicht soweit entfernen, daß man sagt, jede Leistung sei unwiederholbar und einzig und von besonderer Art [249]. Was wir tatsächlich beobachten können, ist, daß gewisse Leistungen als wiederholbare und vertretbare angesehen werden. Wenn SPANN glaubt, seine Stellungnahme damit bewiesen zu haben, daß er darlegt, eine Oper von MOZART sei zwar wertvoller, stehe im Range höher als eine Oper von FLOTOW, aber man könne nicht sagen, daß sie zehneinhalbmal wertvoller sei, so kann man nur bedauern, daß dieser geistvolle Kritiker seinen Scharfsinn an Theorien verschwendet, die längst vor ihm bereits von den Führern der subjektivistischen Wertlehre kritisiert und zurückgewiesen worden waren, und daß auch er leider bisher noch nicht dazu gekommen ist, sich mit jenen Arbeiten der subjektivistischen Wertlehre zu befassen, die in den letzten vier Jahrzehnten veröffentlicht wurden.
Alle Einwendungen, die SPANN gegen die subjektivistische Lehre vorzubringen weiß, zerfallen, wenn man sie dem einfachen Tatbestande gegenüberhält, daß die Menschen im Leben immer wieder zwischen verschiedenen Möglichkeiten zu wählen haben und wählen. [196] Der Rangunterschied, von dem SPANN spricht, tritt gerade darin und in nichts anderem zutage, daß der Mensch ein konkretes A einem konkreten B vorzieht; aus solchen Entscheidungen von auf dem Markte in Austausch tretenden Menschen heraus bildet sich der Marktpreis. Wenn die Katallaktik an diese Wahlhandlungen anknüpft, dann nimmt sie zu ihrem Ausgangspunkt einen Tatbestand, dessen Vorhandensein in nicht zu bezweifelnder Weise festzustellen ist und den jeder Mensch kennt und, weil er selbst handelt, auch in seinem Wesen begreift. Wenn sie, wie SPANN es will, von Ganzheiten und Gebilden ausgehen wollte, so wäre ihr Ausgangspunkt willkürlich gewählt. Denn Ganzheiten und Gebilde sind nicht eindeutig bestimmt und nicht in einer Weise erkennbar und feststellbar, daß über ihr Sein oder Nichtsein allgemeine Einigung erzielt werden könnte. Die Ganzheiten und Gebilde werden von SPANN ganz anders erschaut als von den Marxisten; COUDENHOVE-KALERGI sieht sie anders als FRIEDRICH NAUMANN sie sah.
SPANN hält freilich die Begriffe des werttheoretischen Subjektivismus für willkürlich gewählt; so z. B. den Begriff der »Anzahl«. Es gebe nur im uneigentlichen Sinne eine »Anzahl«, denn »welche Einheit soll gelten? Soll ein Sack Mehl, ein Ballen Baumwolle oder ein Gramm davon, ein Stück oder ein Schock die Mengeneinheit sein?« [250] Auf die erkenntnistheoretische Frage, wie es mit dem Begriff »Anzahl« bestellt sein mag, brauchen wir hier nicht einzugehen; denn nicht dies steht zur Erörterung, sondern die Frage, von welcher Mengeneinheit die Markttheorie auszugehen hat. SPANN hat leider nicht bemerkt, daß gerade auf diese Frage die subjektivistische Wertlehre mit der größten Präzision die Antwort erteilt. Wir haben stets von jener Menge auszugehen, über die in der betrachteten bestimmten Wahlhandlung entschieden wird. Ich muß es bei diesem Hinweis bewenden lassen, weil ich nicht das wiederholen will, was ich über Gesamtwert in meiner Geldtheorie gesagt habe [251].
Wo SPANN recht hat, bewegt er sich in den Bahnen, die die von ihm bekämpfte subjektivistische Lehre gewiesen hat. Wo er die subjektivistische Lehre angreift, verstrickt er sich in metaphysische Spekulationen, die ihn vielfach auch dort behindern, wo er an sich im Rechte ist, wie z. B. in der Zurückweisung der Irrtümer jener, die die Nationalökonomie mathematisieren wollen. Über diesen Punkt dürfen wir aber heute nicht sprechen. Sollte unsere heutige Aussprache erfolgreich [197] verlaufen und so den Beweis erbringen, daß der Verein für Sozialpolitik ein geeigneter Boden ist, um nationalökonomische Probleme zu erörtern, dann glaube ich, daß es kein zweites Problem gibt, das so dringend einer Aussprache bedarf wie das der mathematischen Methode. Man kann aber dieses Thema nicht so nebenbei abtun, man muß seiner Behandlung schon gründliche Vorbereitung widmen und seiner Besprechung ausreichende Zeit zur Verfügung stellen [252].
Mit SPANN werden wir leider nie zu einer Einigung gelangen können, weil er seiner Denkarbeit ein anderes Ziel stellt als wir unserer. SPANN kommt es nicht darauf an, das Sein zu erkennen und zu erklären, sondern er geht darauf aus, den richtigen, und daraus folgend, den gerechten Preis zu finden [253]. Darin gerade erblickt er das Versagen der alten Lehrbegriffe, daß sie dieses Ziel nicht anstreben und daher auch nicht erreichen können. Wir gehen darauf aus, zu erkennen, was ist, weil wir uns darüber klar sind, daß dies die einzige Aufgabe ist, die sich die Wissenschaft setzen kann, und daß allein darüber eine Einigung erzielt werden kann. SPANN geht darauf aus, zu erkennen, was sein soll. Und wenn jemand kommt und der Meinung ist, daß etwas anderes sein soll, so steht der Universalismus hilflos da und kann immer nur wiederholen: ich aber halte meine Auffassung für richtig und will meine Lösungen für gerecht ansehen. Der Universalismus kann seinem Gegner nur sagen: du bist eben minderwertig und deine Minderwertigkeit macht es dir unmöglich, das Richtige und Gerechte so zu erkennen, wie ich, der Höherwertige, es tue. Daß bei solcher grundsätzlicher Verschiedenheit des Standpunktes eine wissenschaftliche Auseinandersetzung niemals fruchtbar werden könnte, ist wohl klar.
Will man erkennen, was die Grenznutzenlehre für uns bedeutet, dann sehe man eine beliebige Darstellung der Marktlehre in einem der heute gangbaren Lehrbücher an und versuche es, alles das auszuscheiden, was darin an Gedanken enthalten ist, die wir der modernen Theorie des werttheoretischen Subjektivismus verdanken. Man nehme die führenden Werke der Betriebswirtschaftslehre etwa die Arbeiten SCHMALENBACHs zur Hand, und man wird erkennen, wie fruchtbar für dieses Fach die Denkarbeit des Subjektivismus geworden ist. Man wird dann zugestehen müssen, daß es heute nur noch eine Nationalökonomie gibt. Das gilt, wie ich ausdrücklich feststellen [198] möchte, auch für das deutsche Sprachgebiet. Der Lösung der Grundaufgabe der Katallaktik stand die längste Zeit hindurch die scheinbare Antinomie der Werterscheinungen entgegen. Erst als es gelungen war, diese Schwierigkeit aus dem Wege zu räumen, konnte man eine geschlossene Wert- und Preislehre aufstellen, die, von dem Handeln des Einzelnen ausgehend, zur Erklärung aller Markterscheinungen fortschreitet. Mit der Überwindung der Wertantinomie durch MENGER, JEVONs und WALRAS beginnt die Geschichte der modernen Nationalökonomie. Es gibt keinen wichtigeren Einschnitt in der Geschichte der Nationalökonomie als es der ist, der durch das Auftreten dieser Männer gekennzeichnet wird. Doch deutlicher, als es noch vor einem Menschenalter möglich war, erkennen wir heute, daß die Arbeit der Klassiker nicht nutzlos gewesen ist, und daß der Kern dessen, was sie geleistet haben, in das moderne System übernommen werden konnte. Der Gegensatz von Subjektivismus und Objektivismus, von Nutzentheorie und Kostentheorie in der Wertlehre hat an Schärfe nichts verloren. Wir sehen ihn aber doch in einem anderen Lichte, seit wir es verstanden haben, dem Kostenbegriff in neuer Fassung die Stellung im System der subjektivistischen Nationalökonomie einzuräumen, die ihm gebührt.
In der klassischen Theorie nahm die Geldlehre eine Sonderstellung ein. Es ist weder RICARDO noch seinen Nachfolgern gelungen, eine Erklärung der Markterscheinungen zu geben, in der für die Erklärung der Geldpreise von denselben Grundsätzen Anwendung gemacht werden konnte, die für die Erklärung der Austauschverhältnisse im direkten Tausch gebraucht wurden. Wenn man von einer Kostentheorie, wie es die der Klassiker ist, ausgeht, und wenn man auf dem Boden der Arbeitswertlehre steht, kann man begreiflicherweise die Probleme des indirekten Tausches nicht meistern. So ergab sich die auffällige Sonderstellung der Geldund Banktheorie und damit auch der Krisentheorie. Der Triumph der subjektivistischen Wertlehre liegt darin, daß sie diese Sonderstellung beseitigt hat, daß es ihr gelungen ist, die Theorie des indirekten Tausches auf dem Boden der des direkten Tausches aufzubauen, ohne Hypothesen zu Hilfe nehmen zu müssen, die nicht schon in den Grundgedanken ihres Systems enthalten sind. Mit der Sonderstellung der Geldund Umlaufsmitteltheorie fiel auch die Sonderbehandlung der Krisenlehre. Auch hier haben wir wieder festzustellen, daß die subjektivistische Lehre von dem von den Klassikern hinterlassenen Geistesgut den größten Nutzen gezogen hat. Die moderne Bankund Konjunkturlehre ist durchaus als Nachfahre der Currency-Theorie zu bezeichnen, die [199] ihrerseits wieder auf RICARDOschen Gedanken aufgebaut ist.
Innerhalb der modernen subjektivistischen Nationalökonomie unterscheiden wir mehrere Richtungen. Wir sprechen gewöhnlich von der österreichischen, von der Lausanner und von der angloamerikanischen Schule. Darüber, daß es sich hier nur um eine andere Darstellungsweise desselben Grundgedankens handelt und daß die drei Typen mehr durch ihre Terminologie und durch Eigenheiten der Darstellung als durch den Inhalt ihrer Lehre geschieden sind, hat die Arbeit von MORGENSTERN [254] , die Ihnen vorliegt, das Notwendigste gesagt.
Es wird immer wieder die Behauptung aufgestellt, daß es nicht eine, sondern viele Nationalökonomien gibt. SOMBART kennt drei Nationalökonomien. Andere kennen noch mehr Nationalökonomien, und manche gehen soweit, zu sagen, es gebe so viele Nationalökonomien als es Nationalökonomen gibt. Das ist ebenso unrichtig wie SOMBARTs Behauptung, die Nationalökonomie wisse nicht, wo auf dem globus intellectualis ihr Feld liege. Daß die Probleme der Katallaktik das Feld unserer Wissenschaft sind, daß sie uns gegeben sind und von uns gelöst werden sollen, kann doch wohl niemand bestreiten. Der Historismus bestreitet es zwar, aber nur im Prinzipe. Sobald er daran geht, Wirtschaftsgeschichte zu treiben, umgrenzt er sein Feld doch wieder in der Weise, daß er aus dem Gesamtgebiet der geschichtlichen Erscheinungen die katallaktischen für sich in Anspruch nimmt.
Für die Lösung der Probleme der Katallaktik haben wir heute nur eine Theorie, mag sie sich auch verschiedener Ausdrucksformen bedienen und in verschiedenem Gewand auftreten. Daß es auch Gegner gibt, die diese Theorie ablehnen oder meinen, etwas ganz anderes als sie lehren zu können, ist nicht zu bestreiten. Gerade dieser Umstand, daß angesehene Männer wie CASSEL, OTTO CONRAD, DIEHL, DIETZEL, GOTTL, LIEFMANN, OPPENHEIMER, SPANN, VEBLEN glauben, gegen sie auftreten zu müssen, macht unsere Erörterung notwendig. Ihre Aufgabe ist nicht die einer mittelalterlichen Disputation, die rechte Lehre festzustellen und zu kanonisieren, sondern Klärung der Gegensätze durch scharfe und genaue Herausarbeitung. Wir werden am Ende unserer Wechselrede nicht abstimmen, wir werden unbekehrt auseinandergehen, wenn auch vielleicht nicht unbelehrt. Wenn unsere Verhandlung heute und die Verhandlungsschrift künftig den Jüngern unserer Wissenschaft bei der [200] Gewinnung ihres Standpunktes Hilfe leisten mag, dann ist alles erreicht, was eine Tagung wie diese fruchtbar machen kann.
Der Herr Vorsitzende des Unterausschusses hat mir die Aufgabe zugedacht, die Erörterung einzuleiten. Ich betrachte mich nicht als Referenten, werde daher auch kein Schlußwort sprechen, was ja bei einer Erörterung wie der unsrigen wohl auch sinnlos wäre, werde aber für mich in Anspruch nehmen, unter Umständen wie jeder der Anwesenden in die Wechselrede einzugreifen. Daß meine einleitenden Ausführungen nicht farblos waren, daß die Gegner der subjektivistischen Wertlehre sie nicht als unparteiisch ansehen werden, weiß ich recht wohl. Vielleicht aber werden auch sie mir zustimmen, wenn ich am Schlusse sage: Ist es nicht merkwürdig, daß diese subjektivistische Wertlehre, die in deutschen Landen von allen Parteien verdammt und verketzert wird, die schon tausendmal totgesagt wurde, doch nicht aufhört, im Mittelpunkt der wissenschaftlichen Erörterung zu stehen? Ist es nicht erstaunlich, daß die Gedanken von MENGER und JEVONS das allgemeine Interesse erwecken, wogegen alle ihre Zeitgenossen längst vergessen sind? Wagt es heute noch jemand, neben Namen wie GOSSEN, MENGER oder BÖHM jene Zeitgenossen zu nennen, die bei Lebzeiten viel berühmter waren? Daß heute immer noch Bücher erscheinen, die dem Kampfe gegen die Lehren von MENGER und BÖHM-BAWERK gewidmet sind, empfinden wir als eine des großen Gegenstandes durchaus würdige Behandlung; denn diese immer wieder totgesagten Lehren leben, und Lebendes bewährt sich eben darin, daß es Widersacher findet. Würden wir es nicht als einen Kampf gegen Windmühlen ansehen, wollte jemand seine Arbeit der Widerlegung der längst abgestorbenen Lehren der seinerzeit viel berühmteren Zeitgenossen dieser Männer widmen? Wenn es wahr ist, daß die Bedeutung eines Schriftstellers in seiner Wirkung auf die Nachwelt liegt, dann haben die Begründer der Grenznutzenschule wohl größere Bedeutung erlangt als irgendein anderer Nationalökonom der nachklassischen Zeit. Wer auch immer sich heute an die Probleme der Nationalökonomie heranwagt, kann die Auseinandersetzung mit der viel gelästerten subjektivistischen Wertlehre nicht umgehen. In diesem Sinne kann man sie, ungeachtet des Umstandes, daß, wer sich in deutschen Landen zu ihr bekennt, viel Feindschaft und noch Ärgeres in Kauf nehmen muß, die herrschende Lehre nennen. Das vornehmste Attribut der Herrscherstellung einer Lehre ist, Ziel vieler Angriffe zu sein. Die Grenznutzenschule bewährt ihre Herrschaft über die Geister, indem sie sich vor Ihnen auf der Anklagebank niederläßt.
[201]
Das festangelegte Kapital.↩
I. Die Determinante »Vergangenheit« in der Produktion.
Würden wir heute, ausgerüstet mit unserem ganzen Schatze an technologischem Können und an geographischem Wissen, daran gehen, die Erdoberfläche frisch zu besiedeln und für die Produktion einzurichten und stünde uns hierfür der gesamte Kapitalreichtum der Gegenwart in einer Form zur Verfügung, die uns gestatten würde, die als zweckmäßigst angesehenen Anlagen zu schaffen, dann würde die Welt ein Aussehen erhalten, das sich von dem, das sie bietet, sehr beträchtlich unterscheiden würde. Weite Gebiete würden weniger dicht, andere wieder dichter besiedelt werden als es heute der Fall ist. Boden, der heute bebaut wird, würde brach liegen gelassen werden, auf anderem Boden wieder, der heute brach liegt, würde landwirtschaftliche Tätigkeit eingegerichtet werden. Viele Mineralvorkommen, die heute ausgebeutet werden, würde man ungenutzt liegen lassen. Die Betriebsstätten der verarbeitenden Gewerbe würden in geringerer Zahl als heute und vielfach an anderen Standorten entstehen, die großen Verkehrswege würden einen anderen Lauf nehmen. In den Betrieben selbst würden nur die modernsten Maschinen arbeiten. Die Wirtschafts- und Verkehrsgeographie müßte ganz neu geschrieben werden, und viele Maschinen und Apparate, die heute noch benützt werden, könnte man nur noch in Museen finden.
Daß die gegebene Wirtschaft diesem Idealbild, das wir uns mit Hilfe unserer technologischen Einsicht und unserer Kenntnis der Erde erbauen, durchaus nicht entspricht, daß sie nicht »durchrationalisiert« ist, wird immer wieder getadelt. Man erblickt darin Rückständigkeit und Verschwendung, die das Gesamtwohl beeinträchtigen. Die herrschende Ideologie, die für alle Mißstände den Kapitalismus verantwortlich macht, sieht hier ein neues Argument zugunsten des Interventionismus und des Sozialismus, und allenthalben errichtet man Kommissionen und Ämter »für Wirtschaftlichkeit«. Eine reiche Literatur befaßt sich mit den »Wirtschaftlichkeitsfragen«, und »Rationalisierung« wurde zu einem der beliebtesten Schlagwörter der Zeit. Die Behandlung, die man der Sache zuteil werden läßt, hat die Probleme, die hier liegen, freilich kaum berührt.
Jene Beweglichkeit des Kapitals, die die Katallaktik zunächst [202] ihren Erwägungen zugrunde legen muß, kommt nur dem »wahren Kapital« im Sinne CLARKs, nicht aber auch den einzelnen Kapitalgütern zu [255]. Die Kapitalgüter sind als produzierte sachliche Produktionsmittel immer schon auf dem Wege zu bestimmten Verbrauchszwecken. Von diesem Wege können sie durch nachträgliche Änderungen in den Absichten der Unternehmer, die durch Veränderung der Daten bewirkt wurden, nicht mehr beliebig abgelenkt werden. Das gilt sowohl von den Gütern des stehenden als auch von denen des umlaufenden Kapitals, wenn ihm auch begreiflicherweise bei jenen höhere Bedeutung zukommt. Beweglich ist das Kapital soweit, als technisch eine Überführung der einzelnen Kapitalgüter von einem Produktionszweig in den anderen oder von einem Ort in den anderen möglich ist. Wo diese Möglichkeit fehlt, kann das »wahre Kapital« nur in der Weise von Ort zu Ort und von Branche zu Branche verschoben werden, daß die Erneuerung der abgenutzten Teile unterbleibt und an ihrer Statt anderswo andere Kapitalgüter geschaffen werden.
Dem Zwecke unserer Untersuchung entsprechend, wollen wir die Frage der Beweglichkeit der Kapitalgüter des umlaufenden Kapitals nicht weiter berühren und bei der Behandlung der Beweglichkeit des stehenden Kapitals von dem Falle des Sinkens der Nachfrage nach dem Endprodukt vorerst absehen. Die beiden Fragen, die uns angehen, lauten: welche Wirkungen löst die Behinderung der Beweglichkeit des stehenden Kapitals bei Änderung der Standortsverhältnisse der Produktion und bei technischem Fortschritt aus?
Zunächst der zweite, der einfachere Fall. Ein neues, wirtschaftlicheres Maschinenmodell kommt auf den Markt. Ob die Fabriken, die mit dem älteren, weniger leistungsfähigen Modell ausgerüstet sind, die noch gebrauchsfähigen alten Maschinen vorzeitig außer Dienst stellen und durch neue ersetzen werden, hängt davon ab, ob die Überlegenheit des neuen Modells so groß ist, daß sie den durch die Ausmusterung der in Gebrauch stehenden Maschinen entstehenden Verlust wettmacht. Ist p der Preis der neuen Maschine, q der durch Veräußerung der alten (als Altmaterial) zu erzielende Erlös, a die Kosten einer Einheit der mit der alten Maschine gewonnenen Produktmenge, b der entsprechende Wert für die neue Maschine, jedoch ohne Rücksicht auf die durch die Anschaffung entstandenen Kosten, und nehmen wir an, daß der Vorzug des neuen Modells lediglich in besserer [203] Auswertung des umlaufenden Kapitals, etwa durch Arbeitsersparnis, nicht auch in Verarbeitung einer größeren Menge liegt, so daß die Menge der in einem Jahre erzeugten Einheiten (z) unverändert bleibt, dann erfolgt der Ersatz, wenn der Jahresertrag z (a-b) groß genug ist, um die Aufwendung eines Kapitals von p-q bezahlt zu machen. Von den Amortisationsquoten sehen wir dabei ab, indem wir annehmen wollen, daß die neue Maschine keine höheren Abschreibungen verlangt als die alte. Es kann mithin sehr gut der Fall eintreten, daß die mit dem älteren Modell ausgerüsteten Betriebe den Wettbewerb mit den mit dem besseren jüngeren Modell ausgerüsteten aufnehmen können. Jeder Geschäftsmann wird dies bestätigen.
Ganz so liegen die Dinge auch in dem ersten Falle. Wenn günstigere natürliche Bedingungen der Produktion zugänglich gemacht wurden, wechseln die Betriebe nur dann den Standort, wenn die Differenz im Erträgnis die Übersiedlungskosten übersteigt. Was diesem Fall sein besonderes Gepräge verleiht, ist der Umstand, daß in ihm auch die Hemmnisse, die der Beweglichkeit des Arbeiters im Wege stehen, eine Rolle spielen. Wenn die Arbeiter nicht mitwandern und an den von der Natur begünstigten Orten keine Arbeiter verfügbar sind, kann auch die Produktion nicht abwandern. Doch darauf haben wir hier, wo uns nur die Frage der Beweglichkeit des Kapitals interessiert, nicht weiter einzugehen. Wir haben nur festzustellen, daß die Produktion auch dann, wenn die Arbeiter vollkommen beweglich wären, den Standort nur bei Zutreffen der oben bezeichneten Voraussetzung wechseln würde. Auch diese Feststellung wird durch die Erfahrung immer wieder bestätigt.
In beiden besprochenen Fällen haben wir es damit zu tun, daß die Rücksicht auf die in der Vergangenheit festangelegten Kapitalgüter die Produktionsweise, die in bezug auf Standortswahl und technologische Durchführung für Neuanlagen bei der gegenwärtigen Lage als die wirtschaftlichste erscheint, unter Umständen als unwirtschaftlich erscheinen läßt. Die Vergangenheit, die Geschichte, wirkt sich aus. Ein wirtschaftlicher Kalkül, der sie nicht miteinschließen wollte, wäre fehlerhaft. Wir sind nicht erst von heute, wir sind Erben der Vergangenheit, von ihr stammt unser Kapitalreichtum, und dieser Umstand tut seine Wirkung. Es handelt sich hier nicht um das Hineinspielen irrationaler Faktoren in die Rationalität der Wirtschaft, wie man, einer wenig empfehlenswerten wissenschaftlichen Mode folgend, vielleicht geneigt wäre zu sagen; es handelt sich auch nicht um vermeintliche »außerwirtschaftliche« Motive; es ist vielmehr gerade [204] die strenge Rationalität, die den Unternehmer zur Fortführung der Produktion am ungünstigeren Standort oder mit überholter technischer Ausstattung veranlaßt. Es wäre daher auch verfehlt, hier von »Reibungserscheinungen« zu sprechen. Wollen wir für die Erscheinung eine Bezeichnung wählen, so würde es am zweckmäßigsten sein, von der Auswirkung der Determinante »Vergangenheit« in der Produktion zu sprechen [256].
Werden die technisch überholten Maschinen beibehalten und wird die Produktion am ungünstigeren Standort fortgesetzt, dann ist es unter Umständen auch noch rentabel, neues Kapital in diesen Betrieben zu investieren, um ihre Wirtschaftlichkeit soweit zu erhöhen, als es die Verhältnisse zulassen. Der Betrieb, der rein technologisch gesehen als minderwertig erscheint, kann dann wirtschaftlich noch lange Zeit konkurrenzfähig bleiben.
Die bloß die technologischen Gesichtspunkte ins Auge fassende Betrachtung, die die Entwicklung der Determinante »Vergangenheit« außer acht läßt, findet es vom rationalen Standpunkt unerklärlich, wie die rückständige Produktionsweise neben der fortgeschritteneren bestehen bleiben konnte. Sie mußte zu mancherlei unzulänglichen Erklärungsversuchen greifen. Es ist charakteristisch, daß die historische Schule, der doch die Heranziehung des Faktors »Vergangenheit« besonders nahe hätte liegen müssen, auch hier vollkommen versagt hat. Sie hat nichts anderes aus dem Problem herauszuholen gewußt als Anklagematerial gegen den Kapitalismus.
Dieses Material kam den Sozialisten aller Richtungen sehr gelegen. In dem Maße, als einerseits die Erkenntnis wuchs, daß der Sozialismus sein Versprechen, alle reicher zu machen, nur halten könnte, wenn die sozialistische Produktion ergiebiger wäre als die kapitalistische, und als andererseits immer klarer wurde, daß man von der Durchführung sozialistischer Planwirtschaft mit Bestimmtheit scharfen Rückgang der Ergiebigkeit zu erwarten habe, mußte es den Sozialisten wichtig werden, Scheinargumente zusammenzutragen, mit denen man die Prophezeiung vom Reichtum des kommenden sozialistischen Gemeinwesens verteidigen konnte. Für diesen Zweck schien es dienlich, immer wieder darauf hinzuweisen, daß es im [205] Kapitalismus allenthalben noch viel technische Rückständigkeit gibt. Daß die Ausrüstung der Betriebe vielfach hinter dem Idealbild, das man dem fortgeschrittensten Betrieb entnahm, zurückblieb, wurde nicht dem Wirken der Determinante »Vergangenheit« und der Begrenztheit der zur Verfügung stehenden Kapitalmenge zugeschrieben, sondern der kapitalistischen Produktionsweise. Ihr stellte man das Idealbild einer sozialistischen Planwirtschaft entgegen, von der man ohne weiteres als selbstverständlich annahm, daß in ihr alle Betriebe mit den modernsten besten Hilfsmitteln ausgerüstet sind und am günstigsten Standort betrieben werden. Woher für die Anlagen die Mittel genommen werden sollten, wurde freilich nicht gesagt. Sehr charakteristisch für diese Art, die höhere Produktivität sozialistischer Produktionsweise durch Erschleichung zu beweisen, ist die Schrift von ATLANTICUS-BALLOD, die, wohl weil sich in ihr bürokratischer Beamtensozialismus und Marxismus harmonisch vereinigen, in einer kaum überwundenen Vergangenheit zu großem Ansehen gelangte [257]. Hier wird einfach der Versuch gemacht, »annäherungsweise festzustellen, was mit den heutigen Mitteln der Wissenschaft und Technik, unter den heute gegebenen natürlichen Bedingungen in einem sozialistisch geleiteten Gemeinwesen geleistet werden könnte« [258]. Um das Verfahren, das BALLOD dabei einschlägt, zu kennzeichnen, sei nur erwähnt, daß er meint, dem Sozialstaat werde in der deutschen Landwirtschaft »wohl nichts übrigbleiben, als fast sämtliche Wirtschaftshöfe neu zu erbauen«. An Stelle der bestehenden Höfe sollen 36000 neue, je einer für einen Betrieb mit ungefähr 400 Hektar Ackerfläche, errichtet werden [259]. Ähnlich soll in der Industrie vorgegangen werden. Wie einfach sich in den Augen BALLODs die Frage der Kapitalbeschaffung löst, zeigt die Bemerkung: »Daß der Individualstaat die Kosten für die Elektrisierung der Bahnen aufbringt, ist sonach ziemlich ausgeschlossen, der Sozialstaat kann es ohne große Schwierigkeiten« [260]. Der ganzen Arbeit geht das Verständnis dafür ab, daß die Kapitalinvestition nur innerhalb gegebener Grenzen möglich ist und daß es angesichts der Knappheit des verfügbaren Kapitals höchste Verschwendung wäre, noch verwendungsfähige Anlagen, die aus älterer Zeit stammen, schon aus dem Grunde allein aufzulassen, weil [206] man sie anders eingerichtet hätte, wenn man sie erst heute anlegen würde.
Auch ein sozialistisches Gemeinwesen könnte nicht anders vorgehen als die Kapitalisten der auf dem Sondereigentum beruhenden Wirtschaftsordnung. Auch der Leiter des sozialistischen Gemeinbetriebs könnte von der Tatsache der Begrenztheit der zur Verfügung stehenden Produktionsmittel nicht absehen und müßte es sich, ehe er daran geht, eine noch leistungsfähige Anlage aufzulassen, um an ihrer Stelle eine vollkommenere zu setzen, genau überlegen, ob es keine dringendere Verwendung für die Mittel gibt, die die Neuanlage beanspruchen muß. Daß ein sozialistisches Gemeinwesen diese rechnerische Gegenüberstellung von Aufwand und Erfolg, von Kosten und Ertrag gar nicht durchführen könnte, weil in einem solchen Gemeinwesen Wirtschaftsrechnung nicht möglich ist, kommt hier nicht weiter in Betracht. Die Unmöglichkeit der Wirtschaftsrechnung macht sozialistische Wirtschaftsführung arbeitteilender Gesellschaft unmöglich; nur in Gedanken kann vollsozialisiert werden, nicht auch im Leben. Wenn man aber ungeachtet dieses Umstandes in einem fiktiven Denkgebilde das kommunistische Paradies zu beschreiben sucht, dann muß man, wenn man nicht zu widersinnigen Faseleien gelangen will, der Kapitalsknappheit die gleiche Rolle zuweisen, die sie im Wirtschaftsleben des Kapitalismus spielt.
In der Praxis der Geschäfte tritt das Problem, das wir vor Augen haben, mitunter als Gegensatz zwischen dem Standpunkt des Kaufmanns, der die Wirtschaftlichkeit der Anlagen kühl rechnend prüft, und dem des romantischen Ingenieurs zutage, der sich für die »technisch vollkommenste« Anlage ausspricht, auch wenn sie unter den gegebenen Verhältnissen unwirtschaftlich ist. Wo der Gesichtspunkt des Nur-Technikers siegt, wird Kapital fehlangelegt, wird Kapital verschwendet.
II. Die Determinante »Vergangenheit« und die Handelspolitik.
Die aussichtslosen Versuche, die Schutzzölle rein ökonomisch, also ohne Rücksichtnahme auf die national- und staatspolitischen Gesichtspunkte zu rechtfertigen, klammern sich mit Vorliebe an die Lehre vom Erziehungszoll (protection to infant industries). Daß es ein arger Denkfehler ist, das politische Moment in dem Verlangen nach Erziehungszöllen zu verkennen, zeigt schon der Umstand, daß alle jene ökonomischen Argumente, die zugunsten des Schutzes einer [207] inländischen Erzeugung gegenüber dem Auslande geführt werden, auch zugunsten des Schutzes der Erzeugung in einem Landesteil eines Zollgebietes gegenüber den übrigen Teilen geltend gemacht werden könnten. Daß nichtsdestoweniger der Schutz nur gegenüber dem ausländischen, nicht aber auch gegenüber dem inländischen Wettbewerb gefordert wird, weist deutlich auf die wahre Natur der Beweggründe des Verlangens hin.
Es mag in einer Reihe von Fällen durchaus zutreffen, daß die schon bestehende Industrie nicht auf dem günstigsten unter den dermalen zugänglichen Standorten arbeitet. Ob aber die Verlegung nach dem günstigeren Standort so große Vorteile bietet, daß sie den Preis der Auflassung der schon bestehenden Anlagen lohnt, das ist die Frage. Wird diese Frage bejaht, dann ist die Verlegung rentabel und wird auch ohne Intervention der Zollpolitik durchgeführt werden. Ist sie nicht schon an und für sich rentabel und wird es erst durch den Schutzzoll, dann hat der Schutzzoll dazu geführt, daß Kapitalgüter aufgewendet wurden, um Anlagen zu schaffen, die man sonst nicht errichtet hätte, und daß sie nun dort fehlen, wo sie wenn der Staat nicht interveniert hätte angelegt worden wären.
Jeder Zoll, unter dessen Schutz neue Anlagen entstehen, die sonst nicht gebaut worden wären, solange die anderwärts bestehenden alten Anlagen noch verwendbar sind, führt zu Kapitalverschwendung. Die Rationalisierungsfanatiker diesseits und jenseits des Ozeans wollen das freilich nicht sehen.
Unter dem Schutze der Zölle (und anderer interventionistischer Maßnahmen, die dieselbe Wirkung hervorrufen) sind Anlagen an Orten entstanden, an denen man sie in einer freihändlerischen Welt nicht errichtet hätte. Würden nun mit einem Schlage alle Zollmauern fallen, dann würden sich diese Anlagen als Fehlanlagen erweisen; es würde klar werden, daß es zweckmäßiger gewesen wäre, sie an günstigeren Standorten zu errichten. Doch nun sind sie einmal da, und die Frage, ob man sie auflassen soll, um neue Anlagen an günstigeren Orten zu errichten, ist wieder so zu entscheiden, daß man prüft, ob gerade das die lohnendste Betätigung für die Verwendung des für Neuanlagen verfügbaren Kapitals wäre. Das Ergebnis wird nun sein, daß die Abwanderung der Produktion von den Standorten, auf die sie das Eingreifen der Schutzpolitik gebracht hat, nach den Standorten, die sie in einer freien Wirtschaft gewählt hätte und die auch noch jetzt als die von der Natur aus günstigsten anzusehen sind, nur allmählich erfolgt, daß also die Wirkungen der Schutzpolitik auch nach Aufhebung der [208] protektionistischen Maßnahmen noch andauern und erst im Laufe der Zeiten verschwinden.
Hebt ein einzelner Staat die Zölle auf, während alle übrigen Staaten beim Schutzsystem und bei der Einwanderungssperre verbleiben, dann müßte sich seine Wirtschaft in der Weise umstellen, daß sie sich auf jene Produktionszweige wirft, für die im Lande verhältnismäßig die günstigsten Bedingungen gegeben sind. Die Umstellung erfordert Kapitalsinvestition, und für deren Rentabilität ist wieder die Frage entscheidend, ob die Differenz der Produktionskosten zwischen den aufzulassenden und den neuzuerrichtenden Unternehmungen groß genug ist, um die Kapïtalsaufwendung schon jetzt zu rechtfertigen. Auch in diesem Falle dauern die Wirkungen der Schutzpolitik noch eine gewisse Zeit.
Alles, was vom Schutze gegenüber dem Auslande gesagt wurde, gilt natürlich auch vom Schutze einer Gruppe von inländischen Betrieben gegen eine andere. Werden z. B. Sparkassen gegenüber Banken, Konsumvereine gegenüber Kaufleuten, landwirtschaftliche Spirituserzeuger gegenüber gewerblichen, Kleinbetriebe gegenüber Großbetrieben in der Steuer bevorzugt, so stellen sich alle jene Folgen ein, die der Schutz des minderwirtschaftlichen Inlandsbetriebs gegenüber dem wirtschaftlicheren Auslandsbetrieb hervorruft.
III. Die Fehlverwendung von Kapital.
Die Fehlanlage von Kapitalgütern kann auf verschiedene Weise entstanden sein:
1. Die Anlage war zur Zeit ihrer Errichtung durchaus wirtschaftlich. Sie ist es nicht mehr, weil seither neue Verfahrensarten bekannt wurden oder weil heute andere Standorte günstiger sind.
2. Die ursprünglich wirtschaftliche Anlage ist durch Änderung anderer ökonomischer Daten etwa Rückgang der Nachfrage unwirtschaftlich geworden.
3. unwirtschaftlich; sie konnte nur im Hinblick auf interventionistische Maßnahmen, die nun wieder beseitigt wurden, errichtet werden.
4. Die Anlage war von vornherein unwirtschaftlich; ihre Errichtung war eine Fehlspekulation.
5. Die Fehlspekulation (Fall 4), die zur Fehlanlage führte, ist durch jene Verfälschung der Geldrechnung herbeigeführt worden, die Geldwertveränderungen auslösen. Hierher gehört jener Ablauf, den die monetäre Konjunkturtheorie (die Zirkulationskredittheorie der [209] Konjunkturschwankungen) beschreibt.
Wird die Fehlanlage erkannt und erweist es sich doch als rentabel, den Betrieb fortzuführen, weil der Bruttoertrag den laufenden Aufwand übersteigt, dann pflegt man den Ansatz, mit dem die Anlage zu Buch steht, soweit herabzusetzen, daß er dem nun erzielbaren Ertrage entspricht; ist die erforderliche Abschreibung im Verhältnis zum Geschäftskapital beträchtlich, dann wird es bei Aktiengesellschaften nicht ohne Herabsetzung des Stammkapitals abgehen. Dabei wird der Kapitalverlust, den die Fehlanlage bewirkt hat, sichtbar und kann von der Statistik erfaßt werden. Noch leichter ist seine Feststellung, wenn die Unternehmungen ganz zusammenbrechen. Auch die Statistik der Konkurse, Zahlungseinstellungen und Ausgleiche kann hier manche Aufschlüsse geben. Ein nicht unbeträchtlicher Teil der fehlgeschlagenen Anlagen entzieht sich jedoch der statistischen Erfassung. Gesellschaften, die über beträchtliche stille Reserven verfügen, können unter Umständen über die Tatsache, daß eine Anlage nur Mißerfolg gebracht hat, selbst die zunächst Beteiligten, die Aktionäre, im Unklaren lassen. Regierungen und Stadtverwaltungen entschließen sich nur dann, der Öffentlichkeit über ihre Fehler zu berichten, wenn die Verluste unverhältnismäßig groß wurden. Unternehmungen, die nicht zur öffentlichen Rechnungslegung verpflichtet sind, suchen Verluste schon im Hinblick auf ihren Kredit zu verheimlichen. Das mag erklären, warum man geneigt ist, den Umfang der Verluste, die durch Fehlanlage von stehendem Kapital bewirkt wurden, zu unterschätzen.
Man muß das besonders hervorheben angesichts der herrschenden Neigung, die Bedeutung des »erzwungenen Sparens« für die Kapitalbildung zu überschätzen und, von dieser Überschätzung ausgehend, in der Geldentwertung im allgemeinen und in der durch bankpolitische Maßnahmen (Ausdehnung des Umfanges von Zirkulationskrediten durch Darlehensgewährung unter dem Satze, der sich auf dem von den Banken nicht beeinflußten Markte gebildet hätte) bewirkten im besonderen, die Kraft zu erblicken, der der Fortschritt der Wirtschaft durch steigende Kapitalbildung zuzuschreiben sei. Es sei dabei ganz davon abgesehen, daß die Geldentwertung zwar das »erzwungene Sparen« auslösen kann, aber durchaus nicht immer muß, da es von den besonderen Daten des einzelnen Falles abhängt, ob Vermögens- und Einkommensverschiebungen, die zu erhöhter Spartätigkeit [210] und Kapitalbildung führen, wirklich eintreten [261] Jedenfalls aber muß die Ausdehnung des Umfanges des Zirkulationskredits den Prozeß auslösen, der über den Aufschwung und die Hochkonjunktur schließlich in die Krise und die Depression einmündet. Das Wesen dieses Prozesses aber liegt in der Fehlleitung der Kapitalveranlagung. Wenn also auch zunächst mehr Kapital gebildet wird, als ohne Dazwischentreten der Bankpolitik gebildet worden wäre, so geht anderseits Kapital durch Veranlagung am unrechten Ort und in unrechter Weise verloren. Ob diese Verluste jenen Zuwachs an Kapital nicht wettmachen oder gar übersteigen, ist quaestio facti und kann gewiß nicht so ohne weiteres im Sinne der Zunahme des Kapitals beantwortet werden, wie die Befürworter der Erweiterung des Zirkulationskredits es tun. Es mag richtig sein, daß manche dieser Anlagen nur vorzeitig und nicht auch der Art nach verfehlt errichtet wurden und daß man sie, wäre nicht die Konjunkturwelle gekommen, zwar später, aber doch nicht anders angelegt hätte. Es mag auch zutreffen, daß gerade in den letzten sechzig bis achtzig Jahren im Aufstieg der Konjunktur vor allem Anlagen gebaut wurden, die man später gewiß gebaut hätte, besonders Eisenbahnen und Elektrizitätswerke, daß also die Fehler, die gemacht worden waren, durch den Zeitablauf wieder behoben wurden. Bei den schnellen Fortschritten, die die Technik im kapitalistischen Wirtschaftssystem macht, ist jedoch die Annahme nicht von der Hand zu weisen, daß die spätere Errichtung der Anlage auch ihren technischen Charakter beeinflußt hätte, da man den mittlerweile aufgetretenen technischen Neuerungen Rechnung zu tragen genötigt gewesen wäre. Der Verlust, der aus der vorzeitigen Errichtung der Anlage entstand, ist dann doch größer als jene optimistische Beurteilung annimmt. Sehr viele von den Anlagen, deren Entstehung der Verfälschung der Kalkulationsgrundlagen, die das Wesen des durch die Bankpolitik künstlich inaugurierten Aufschwungs ausmacht, zu danken ist, wären aber überhaupt nie gebaut worden.
Der Kapitalsbetrag, über dessen Verwendung jeweils verfügt werden kann, setzt sich aus drei Teilen zusammen: aus dem umlaufenden Kapital, aus dem neugebildeten Kapital und aus jenem Teil des stehenden Kapitals, der zur Reinvestition gelangt. Da das umlaufende Kapital in der Regel nicht nur in seinem Bestande erhalten, sondern auch noch durch Zuweisung eines Teils des neugebildeten Kapitals erweitert werden muß eine Verschiebung des Verhältnisses des [211] umlaufenden Kapitals zum stehenden würde, wenn sie nicht durch die Marktlage gerechtfertigt ist, schon selbst eine Fehlleitung von Kapital darstellen bleibt für die Investitionstätigkeit nur ein Betrag übrig, der im Vergleich mit dem Gesamtkapital recht bescheiden ist. Das muß man beachten, wenn man die quantitative Bedeutung der Fehlanlage von Kapital beurteilen will. Sie ist nicht zu messen durch Vergleich mit der gesamten Kapitalmenge, sondern durch Vergleich mit der für feste Neuanlage zur Verfügung stehenden Kapitalmenge.
Zweifellos sind in den Jahren, die seit dem Ausbruch des Weltkrieges verstrichen sind, sehr beträchtliche Kapitalmengen bei der Festanlage fehlgeleitet worden. Die Unterbindung des Weltverkehrs im Kriege und die Hochschutzzollpolitik, die seit dem Kriege herrscht, haben die Errichtung von Fabriken an Orten, die für die Produktion gewiß nicht die günstigsten Bedingungen bieten, gefördert; in gleichem Sinne wirkte die Inflation. Nun stehen diese neuen Fabriken im Wettbewerb mit den schon früher, meist an günstigeren Standorten angelegten, in einem Wettbewerb, den sie nur unter dem Schutz von Zöllen und anderen interventionistischen Maßnahmen aushalten können. Diese umfangreichen Fehlanlagen wurden gerade in einer Zeit errichtet, in der Krieg, Revolutionen, Geldentwertung und verschiedene mißglückte Eingriffe der politischen Machthaber in das Wirtschaftsleben Kapital in sehr großem Umfange aufgezehrt haben.
Man darf alle diese Dinge nicht außer acht lassen, wenn man den Ursachen der Störungen im Wirtschaftsleben der Gegenwart nachforscht.
Ihren weithin sichtbaren Ausdruck findet die Tatsache der Fehlleitung von Kapital in der großen Anzahl von Betrieben, die entweder ganz stillgelegt wurden oder nur mit Ausnutzung eines Teiles ihrer Leistungsfähigkeit arbeiten.
IV Die Umstellung der Arbeiter.
Der wirtschaftliche Fortschritt im engeren Sinne ist das Werk der kapitalbildenden Sparer und der das Kapital neuen Verwendungen zuführenden Unternehmer. Die übrigen Glieder der Gesellschaft genießen zwar die Vorteile des Fortschritts, sie tragen aber nicht nur nichts dazu bei, sie legen ihm selbst Schwierigkeiten in den Weg. Als Konsumenten treten sie jeder Neuerung mit Mißtrauen entgegen, so daß das neue Erzeugnis zunächst nicht jenen Preis erzielen kann, den es bei weniger konservativen Neigungen der Käufer erreichen könnte. Daraus ergeben sich die nicht unbeträchtlichen Kosten der Einführung [212] neuer Artikel. Als Arbeiter widersetzen sie sich jeder Änderung des eingelebten Erzeugungsverfahrens, mag auch dieser Widerstand heute nur selten bis zur offenen Sabotage oder gar bis zur Zerstörung der neuen Maschinen gehen.
Jede industrielle Neuerung muß damit rechnen, daß sie ein Geschlecht trifft, das sich an sie nicht leicht gewöhnen kann. Dem Arbeiter fehlt eben die Beweglichkeit des Geistes, die dem Unternehmer nicht fehlen darf, wenn er im Wettbewerb nicht unterliegen soll. Der Arbeiter ist nicht fähig und oft auch nicht gewillt, sich dem Neuen anzupassen und die Anforderungen zu erfüllen, die das Neue stellt. Gerade weil ihm diese Fähigkeit abgeht, ist er Arbeitnehmer und nicht Unternehmer. Diese Schwerfälligkeit der Massen wirkt als Hemmnis jeder Verbesserung der wirtschaftlichen Einrichtungen entgegen. Auch sie, die die Auswirkung der Determinante »Vergangenheit« in bezug auf den Produktionsfaktor Arbeit darstellt, muß von jeder Kalkulation neuer Unternehmungen berücksichtigt werden. Wurde sie nicht berücksichtigt, so liegt darin geradeso eine Fehlanlage wie in allen übrigen Fällen, in denen ein Unternehmen sich als unrentabel erweist. Jedes Unternehmen hat sich den gegebenen Verhältnissen anzupassen, nicht aber mit Verhältnissen zu rechnen, wie es sie gerne haben wollte.
Das gilt besonders für Unternehmungen, die in Gegenden errichtet wurden, in denen entsprechend geschulte Arbeiter nicht aufzutreiben sind. Es gilt aber auch nicht minder für Unternehmungen, die gerade auf dem Umstand der Minderwertigkeit von Arbeiterschichten aufgebaut waren, von dem Augenblick an, in dem diese Minderwertigkeit fortfällt, d, h. in dem »billige Arbeitskraft« nicht mehr zur Verfügung steht. Ein großer Teil der europäischen Landwirtschaft war nur solange imstande, den Wettbewerb mit den auf besserem Boden arbeitenden Landwirten des Auslandes auszuhalten, als man kulturell rückständige Massen als Arbeiter verwenden konnte. In dem Maße, in dem die Industrie diese Arbeiter an sich heranziehen konnte, in dem die »Landflucht« einsetzte und die Löhne der Landarbeiter erhöht werden mußten, um ihnen das Verbleiben in der Landwirtschaft anziehender zu gestalten, schwand die Rentabilität dieser Betriebe, und die großen Kapitalien, die im Laufe der Zeiten in ihnen angelegt wurden, erweisen sich nun als fehl angelegt.
[213]
V Die Fehlanlage von Kapital im Urteil des Unternehmers.
Das Verhalten der einzelnen Unternehmer und der einzelnen Kapitalisten gegenüber den Nachteilen, die durch die Bindung des festangelegten Kapitals an Unternehmungen, in die man es heute in voller Kenntnis aller in Betracht kommenden Umstände nicht mehr hineinstecken würde, entstehen, ist durch das früher Dargelegte vollkommen klargelegt. Doch die Ausdrucksweise, in der die Geschäftsleute und die Handelspresse von diesen Dingen zu reden pflegen, weicht davon in mancher Beziehung so stark ab, daß es notwendig ist zu zeigen, daß nur die Auffassung der Verhältnisse durch den Kaufmann eine andere ist, sein Verhalten aber durchaus so gestaltet ist, wie wir es geschildert haben.
Kommt bei einem Unternehmen zutage, daß die Ertragsfähigkeit in Hinkunft dauernd geschmälert sein wird oder daß eine Ertragsschmälerung, die man bisher als eine vorübergehende angesehen hatte, andauern wird, dann wird dies besonders bei Aktiengesellschaften und ähnlichen Kapitalassoziationen verschieden beurteilt, je nachdem, ob es erforderlich ist, den eingetretenen Verlust an Anlagekapital in den Büchern ersichtlich zu machen oder ob dies vermieden werden kann, weil die Anlagen ohnehin nicht mit höheren Ansätzen in den Büchern erscheinen, als ihren nun verminderten Werten entspricht. Es ist wohl überflüssig, noch besonders festzustellen, daß diese Auffassung mit der Frage, ob der Betrieb angesichts der neuen Sachlage überhaupt noch weiter fortgeführt werden soll, nichts zu tun hat, und daß es lediglich die Rücksichten auf die Beurteilung der Leistung der verantwortlichen Leiter durch die Aktionäre, auf den Kredit der Gesellschaft und auf die Kursgestaltung ihrer Aktien sind, die jenem nebensächlichen Moment so große Bedeutung verschaffen.
Nicht selten hört man die Auffassung vertreten, daß allein der Umstand, daß ein Unternehmen seine Anlagen schon stark abgeschrieben hat, ihm die Möglichkeit biete, mit anderen Unternehmungen, die unter günstigeren Bedingungen arbeiten, in Wettbewerb zu treten. Auch hier liegt die Sache nicht anders als in dem eben erwähnten Fall. Für die Frage, ob ein Unternehmen den Wettbewerb mit einem anderen aushalten kann, ist die Frage, wie hoch seine Anlagen zu Buch stehen, ohne Bedeutung. Entscheidend ist allein die Frage, ob nach Deckung aller Geschäftsunkosten und nach Verzinsung des umlaufenden Kapitals noch soviel vom Bruttoertrag erübrigt, daß etwas mehr als eine angemessene Rentabilität für jenen Wert der [214] festen Anlagen, der ihnen nach Einstellung des Betriebes im Hinblick auf ihre Verwendbarkeit für andere Produktionsmöglichkeiten (mitunter wird dies nur der Altmaterialwert der Maschinen und Ziegel sein) zukommt, herausgewirtschaftet werden kann. Dann ist die Fortführung des Betriebes rentabler als seine Einstellung. Stehen die Anlagen mit höheren Ansätzen in den Büchern, als ihrer gegenwärtigen und voraussichtlichen künftigen Ertragsfähigkeit entspricht, dann müssen die Ansätze auf das entsprechende Ausmaß herabgesetzt werden.
Das, was der Geschäftsmann mit seiner Redeweise ausdrücken will, ist nichts anderes, als daß ein Unternehmen, dessen Anlagen schon aus älteren Erträgnissen zum großen Teil oder ganz abgeschrieben wurden, sich, im Hinblick auf seine ganze Lebensdauer betrachtet, auch dann noch als rentabel herausstellt, wenn es in den späteren Abschnitten seines Bestandes nur noch das umlaufende Kapital zu verzinsen vermag.
Ähnlich ist es dort, wo, wie man zu sagen pflegt, der Wettbewerb mit den im übrigen unter günstigeren Bedingungen arbeitenden Betrieben möglich ist, weil eine diesen nicht erreichbare Quelle besonderer Vorteile zur Verfügung steht, etwa der Wert einer beliebten Marke oder dgl. m. Wären die übrigen Produktionsbedingungen vollkommen gleich, dann würde dieser Vorzug Quelle einer Differentialrente bilden. Wie die Dinge liegen, werden aus ihm die Mittel geschöpft, die benötigt werden, um einen vorhandenen Nachteil auszugleichen.
Endnotes
[1] BERGSON über den Tausch: „et l’on ne peut le pratiquer sans s’être demandé si les deux objets échangés sont bien de même valeur, c’est-à-dire échangeables contre un même troisième.“ (BERGSON, Le deux sources de la Morale et de la Religion, Paris 1932, S. 68.)
[2] Erst als dieses Buch schon im Druck war, kam mir das WERNER SOMBART zum 70. Geburtstage dargebrachte Heft von SCHMOLLERS Jahrbuch (56. Jahrgang, 6. Heft) zu, dessen erster Teil der Behandlung des Problems »Theorie und Geschichte« gewidmet ist. Die Aufsätze dieser Festgabe bewegen sich in der Bearbeitung der logischen und methodologischen Fragen in den herkömmlichen Bahnen des Historismus und Empirismus und übergehen die Argumente, die gegen die Auffassung der historischen Schule sprechen, mit Schweigen. Das gilt auch von dem wichtigsten Beitrag, dem SPIETHOFFs (Die Allgemeine Volkswirtschaftslehre als geschichtliche Theorie), der die Verfahrenslehre der Schule in glänzender Darstellung gestaltet. Wie die übrigen Mitarbeiter des Heftes setzt sich auch SPIETHOFF nur mit den Ideen der Anhänger der historischen Schule auseinander; selbst das bedeutende Werk von ROBBINS scheint er nicht zu kennen. Wenn SPIETHOFF sagt: »Die Theorie der kapitalistischen Marktwirtschaft geht davon aus, daß die Wirte vom Eigennutz geleitet werden. Wir wissen, daß auch Nächstenliebe geübt wird und noch andere Beweggründe wirksam sind, aber wir sehen das als für das Ganze so geringfügig an, daß es als unwesentlich zu werten ist.« (S. 900), so zeigt das, daß das, was er als Theorie im Auge hat, von dem Sinn dessen, was die moderne subjektivistische Nationalökonomie lehrt, weit abliegt, und daß er den status controversiae noch immer so auffaßt, wie er sich in den achtziger und neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts darstellte. SPIETHOFF sieht nicht, daß es der Nationalökonomie nicht um die Lehre von der Wirtschaft, sondern um die vom Wirtschaften (Handeln) der Menschen geht, daß die apriorische allgemeingültige Theorie kein »unwirkliches Gebilde« (wohl aber ein begriffliches Gebilde) ist und daß es andere Theorie als apriorische und allgemeingültige (d. i. unabhängig von Raum, Zeit, Volkstum, Rasse u. dgl. Geltung beanspruchende) nicht geben kann, weil es dem menschlichen Denken verwehrt ist, aus der geschichtlichen Erfahrung a posteriori theoretische Sätze zu gewinnen. In den Untersuchungen dieses Buches werden alle diese Auffassungen SPIETHOFFS und der historischen Schule im einzelnen kritisch geprüft und zurückgewiesen.
[3] Der folgerichtige Historismus dürfte übrigens auch diesen Satz nicht zugeben. Vgl. weiter unten S. 5 f.
[4] Ich danke dem Verlage von DUNCKER & HUMBLOT für die Erlaubnis, die im 183. Bande der Schriften des Vereins für Sozialpolitik veröffentlichten Aufsätze abdrucken zu dürfen.
[5] Man kann es doch kaum als ausreichende Kritik würdigen, daß SOMBART GOSSEN »der geniale Idiot« nennt. (Vgl. SOMBART, Die drei Nationalökonomien, München 1930, S. 4).
[6] Vgl. RICKERT, Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft, 3. Auflage, Tübingen 1915, S. 28 ff.
[7] Vgl. weiter unten S. 70.
[8] Vgl. SOMBART, Die drei Nationalökonomien, München und Leipzig 1930, S. 253.
[9] Ebendort.
[10] Vgl. SOMBART, a. a. O., S. 247.
[11] Vgl. SOMBART, a. a. O., S. 298.
[12] Vgl. KNIES, Die politische Ökonomie vom geschichtlichen Standpunkte, Neue Auflage, Braunschweig 1883, S. 24.
[13] Vgl. LEXIS, Allgemeine Volkswirtschaftslehre, Berlin und Leipzig, 3. Aufl., 1926, S. 14.
[14] Zur Kritik dieses zweiten Standpunktes vgl. weiter unten S. 24 ff. u. S. 117 ff.
[15] Vgl. SCHMOLLER, Artikel »Volkswirtschaft, Volkswirtschaftslehre und -methode« im »Handwörterbuch der Staatswissenschaften«, 3. Auflage, VIII. Bd., S. 464.
[16] Über historische Gesetze vgl. weiter unten S. 104 ff.
[17] Vgl. weiter unten S. 124 ff.
[18] Manche große Nationalökonomen waren zugleich große Logiker: HUME, WHATELY, JOHN STUART MILL, STANLEY JEVONS.
[19] Vgl. SLUTSKY, Ein Beitrag zur formal-praxeologischen Grundlegung der Ökonomik. (Extrait des »Annales de la Classe des Sciences Sociales-Économiques«, Tome IV, Académie Oukraïenne des Sciences, Kiew 1926.)
[20] Darüber vgl. meine Gemeinwirtschaft, 2. Auflage, Jena 1932, S. 299 ff.
[21] Über die universalistische Auffassung vgl. weiter unter S. 143 ff. Eine spezielle Anwendung des im Texte skizzierten Gedankenganges auf die Lehre vom Kapital vgl. weiter unten S. 201 ff.
[22] Vgl. SENIOR, Political Economy, Sixth Edition, London 1872, S. 5.
[23] Ebendort S. 3.
[24] Vgl. J. ST. MILL, Essays on some Unsettled Questions of Political Economy, Third Edition, London 1877, S. 143.
[25] Vgl. J. ST. MILL, System der deductiven und inductiven Logik, Übers. von GOMPERZ, Leipzig 1872, I. Bd., S. 272 ff.
[26] Vgl. J. St. MILL, Some Unsettled Questions, a. a. O., S. 144.
[27] Vgl. J. ST. MILL, Some Unsettled Questions, a. a. O., S. 146 ff.
[28] Vgl. CAIRNES, The Character and Logical Method of Political Economy, 3. Ausgabe, London 1888, S. 83.
[29] Ebendort S. 87.
[30] Ebendort S. 88.
[31] Ebendort S. 89 f.
[32] MENGERs bahnbrechende Untersuchungen leiden noch stärker unter der Abhängigkeit vom MILLschen Empirismus und Psychologismus. Ich muß dabei betonen, daß die Ausdrücke Empirismus, Historismus u. dgl. von mir ohne jede abschätzende Färbung verwendet werden; vgl. HUSSERL, Logische Untersuchungen, 3. Auflage, Halle 1922, I. Bd., S. 52 Anm.
[33] Vgl. WIESER, Theorie der gesellschaftlichen Wirtschaft (Grundriß der Sozialökonomik, I. Abteilung, Tübingen 1914), S. 133.
[34] Vgl. WIESER, Das Wesen und der Hauptinhalt der theoretischen Nationalökonomie (Gesammelte Abhandlungen, herausgeg. von HAYEK, Tübingen 1929), S. 17.
[35] Aus dem jüngsten, den Fragen der Logik und Methodik der Wissenschaft vom menschlichen Handeln gewidmeten Schrifttum sind bemerkenswert die Arbeiten von ENGLIŠ (Grundlagen des wirtschaftlichen Denkens, übers. von SAUDEK, Brünn 1925, Begründung der Teleologie als Form des empirischen Erkennens, Brünn 1930 und Teleologische Theorie der Staatswirtschaft, Brünn 1933). Der Widerstreit von Kausalität und Teleologie, der ENGLIŠ in erster Linie beschäftigt, liegt nicht in der Ebene der Probleme, die wir hier behandeln.
[36] Vgl. weiter unten S. 99 ff.
[37] Vgl. oben S. 9 ff.
[38] Vgl. WIESER, Über den Ursprung und die Hauptgesetze des wirtschaftlichen Wertes, Wien 1884, S. 1 ff.
[39] Vgl. KANT, Kritik der reinen Vernunft (Sämtliche Werke, Inselausgabe, III. Bd.), S. 286.
[40] Vgl. J. ST. MILL, Principles of Political Economy, Book III, Chapter I., § 1. (Ausgabe London 1867, S. 265.)
[41] Vgl. oben S. 14 ff.
[42] Vgl. ROBBINS, An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, London 1932, S. 23 ff.
[43] Vgl. FREUD, Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, XVII. Vorlesung (Taschenausgabe S. 263).
[44] Vgl. WICKSTEED, The Common Sense of Political Economy, ed. by ROBBINS, London 1933, I. Bd.. S. 28.
[45] So VLEUGELS, »Probleme der Wertlehre« (Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 68. Bd., S. 227 f.). Dem Liberalismus fällt es nicht ein, zu bestreiten, daß es Servilismus und servile Weltanschauung gibt. Er bemüht sich nur zu zeigen, daß die Erreichung der Ziele des Servilismus notwendig Folgen nach sich ziehen müßte, die auch in den Augen jener, die ihn in Unkenntnis der Unvermeidlichkeit dieser Folgen anstreben, als zu hoher Preis für die Erreichung ihres Ideals erscheinen würden.
[46] Vgl. SOMBART, Der proletarische Sozialismus, 10. Auflage, Jena 1924, I. Bd., S. 31.
[47] Vgl. SPANN, Artikel »Soziologie« im Handwörterbuch der Staatswissenschaften, 4. Auflage, VII. Bd., S. 655.
[48] Ebendort.
[49] Vgl. DEUSSEN, Vedânta, Platon und Kant, Wien 1917, S. 67.
[50] Vgl. BERGSON, L’évolution créatrice, Septième Edition, Paris 1911, S. 1 ff.
[51] Das ist nie bestritten worden, auch nicht vom naturwissenschaftlichen Empirismus. So schrieb ERASMUS DARWIN: Following life, in creatures we dissect, We lose it, in the moment we detect. (Zitiert bei MILL, Logik, a. a. O., II. Bd., S. 163.)
[52] Leipzig 1908.
[53] Vgl. SCHOPENHAUER, Die Welt als Wille und Vorstellung (Sämtliche Werke, herausgeg. von FRAUENSTADT, 2. Auflage, Leipzig 1916, II. Bd., S. 531).
[54] SULZBACH, Die Grundlagen der politischen Parteibildung, Tübingen 1921, S. V f.
[55] Zitiert bei FREYER, Die Bewertung der Wirtschaft im philosophischen Denken des 19. Jahrhunderts, Leipzig 1921, S. 48.
[56] Vgl. VIERKANDT, Gesellschaftslehre, 2. Auflage, Stuttgart 1928, S. 243.
[57] Ebendort.
[58] Vgl. VIERKANDT, a. a. O., S. 37.
[59] Vgl. WIESE, in den Kölner Vierteljahrsheften für Soziologie, 3. Jahrgang, 1923, S. 179.
[60] Vgl. VIERKANDT, a. a. O., S. 61.
[61] Vgl. FEUERBACH, Sämtliche Werke, neu herausgeg. von BOLIN und JODL, Stuttgart 1907, X. Bd., S. 231. »Glückseligkeit«, sagt FEUERBACH (ebendort), ist »nichts anderes als der gesunde, normale Zustand eines Wesens.«
[62] Vgl. VIERKANDT, a. a. O., S. 48.
[63] Vgl. VIERKANDT, a. a. O. S. 31 f.
[64] Vgl. VIERKANDT, a. a. O., S. 47.
[65] Vgl. VIERKANDT, a. a. O., S. 60.
[66] Vgl. VIERKANDT, a. a. O., S. 41.
[67] Vgl. VIERKANDT, a. a. O., S. 63.
[68] Vgl. auch VIERKANDT, Artikel »Kultur des 19. Jahrhunderts und der Gegenwart« im »Handwörterbuch der Soziologie«, S. 141 ff.
[69] Vgl. MYRDAL, Das politische Element in der nationalökonomischen Doktrinbildung, übers. von MACKENROTH, Berlin 1932, S. 299 f.
[70] Vgl. MYRDAL, a. a. O., S. 299.
[71] Vgl. MYRDAL, a. a. O., S. 300.
[72] Vgl. BÖHM-BAWERK, Kapital und Kapitalzins, 4. Auflage, Jena 1921, II. Abteilung, I. Bd., S. 236 Anm.
[73] Vgl. HAHN, Die Entstehung der Pflugkultur, Heidelberg 1909, S. 40 ff., 105 ff., 139 ff., 152 ff.; FROBENIUS, Paideuma, Umrisse einer Kultur- und Seelenlehre, München 1921, S. 72 f.
[74] Vgl. HAHN, Die Entstehung der wirtschaftlichen Arbeit, Heidelberg 1908, 102 ff.
[75] Vgl. HAHN, Die Entstehung der Pflugkultur, a. a. O., S. 63.
[76] Ebendort S. 86.
[77] Ebendort S. 87.
[78] Ebendort S. 117 ff.
[79] Vgl. FROBENIUS, Paideuma, a. a. O., S. 70 ff.
[80] Vgl. HAHN, Die Entstehung der Pflugkultur, a. a. O., S. 87.
[81] Einige Schlagwörter aus einer Zusammenstellung von HAHN (Die Entstehung der Pflugkultur, a. a. O., S. 118 ff.): sakrale Prostitution; Zoten bei agrarischen Festen besonders der Frauen; Absingung schandbarer Lieder durch die vornehmsten Frauen Bautzens; nacktes Laufen ums Feld der wendischen Flachswieterinnen noch um 1882 herum.
[82] Vgl. KRACAUER, Soziologie als Wissenschaft, Dresden 1922, S. 20 ff.
[83] Vgl. POHLE, Die gegenwärtige Krisis in der deutschen Volkswirtschaftslehre, 2. Ausgabe, Leipzig 1921, S. 86 ff., 116 ff.
[84] Vgl. meine Kritik des Interventionismus, Jena 1929, S. 2 ff., 57 ff.
[85] Vgl. Fürst BISMARCKS Reden, herausgegeben v. STEIN (Reclam), VII. Bd., S. 202.
[86] Auch MENGER geht in seinen berühmten »Untersuchungen über die Methode der Sozialwissenschaften« nicht von den modernen Formulierungen der subjektivistischen Nationalökonomie aus, sondern von dem System, der Methodik und der Logik der klassischen Nationalökonomie. Der Übergang vom klassischen zum modernen System vollzog sich nicht mit einem Schlage, sondern allmählich; es brauchte geraume Zeit, bis er auf allen Teilgebieten des nationalökonomischen Denkens wirksam ward und noch längere Zeit, bis man sich der ganzen Bedeutung des vollzogenen Umschwungs bewußt wurde. Erst dem rückschauenden Dogmenhistoriker erscheinen die Jahre, in denen MENGER, JEVONS und WALRAS mit ihren Lehren hervortraten, als der Beginn einer neuen Epoche der Geschichte unserer Wissenschaft.
[87] Die Frage, um die es sich im Streit um die Wertfreiheit der Sozialwissenschaften handelte, war schon lange vorher entschieden; sie hatte überhaupt niemals ein Problem gebildet, dessen Lösung irgendwelche Schwierigkeiten hätte bereiten können. Vgl. CANTILLON, Abhandlung über die Natur des Handels im allgemeinen, übersetzt von H. HAYEK, Jena 1931, S. 56; RICARDO, Notes on Malthus’ »Principles of Political Economy« ed. by Hollander and Gregory, Baltimore 1928, S. 180; J. ST. MILL, Logik, a. a. O., III. Bd., S. 367 ff.; CAIRNES, Essays in Political Economy Theoretical and Applied, London 1873, S. 256 ff.; SIDGWICK, The Principles of Political Economy, Second Edition, London 1887, S. 12 ff.
[88] Vgl. darüber BERNHEIM, Lehrbuch der historischen Methode, 6. Auflage, Leipzig 1908, S. 101 ff.; ROTHACKER, Einleitung in die Geisteswissenschaften, Tübingen 1920, S. 195.
[89] Vgl. BREYSIG, Der Stufenbau und die Gesetze der Weltgeschichte, 2. Auflage, Berlin 1927, S. 165.
[90] Über Bemerkungen RICKERTS, in denen er die Möglichkeit »einer naturwissenschaftlichen oder generalisierenden Darstellung« der »Schicksale der Kulturmenschheit« zugibt, vgl. weiter unten S. 116.
[91] JASPERS (Max Weber, Oldenburg 1932, S. 43) nennt WEBER einen »Universalhistoriker« und fügt bei: »Seine Soziologie ist Universalhistorie«. Vgl. über WEBER als Nationalökonom meine Kritik des Interventionismus, a. a. O., S. 85 ff.
[92] Vgl. MAX WEBER, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Tübingen 1922, S. 172 .
[93] Ebendort S. 178.
[94] Ebendort S. 181.
[95] Ebendort S. 185.
[96] Ebendort S. 189 f.
[97] Ebendort S. 190.
[98] Ebendort S. 191.
[99] Ebendort S. 190.
[100] Ebendort S. 191.
[101] Ebendort S. 193.
[102] Ebendort S. 193.
[103] Ebendort S. 520 f.
[104] Ebendort S. 184.
[105] Nämlich in den idealtypischen Konstruktionen.
[106] Ebendort S. 195.
[107] Treffend sagt SCHELTING: »Mit dem Begriff des ‚Idealtypus’ hat MAX WEBER zuerst klar und deutlich eine spezifische Form der Begriffsbildung erkannt. Der ‚Idealtypus’ ist eine logische Entdeckung. Keine ‚Erfindung’. MAX WEBER wollte der Wissenschaft in keiner Weise etwas anempfehlen, was sie noch nicht getan hätte. Er wollte einen schon vorhandenen, weil im Wesen der kulturwissenschaftlichen Erkenntnis liegenden logischen Sachverhalt klären.« Vgl. SCHELTING, Die logische Theorie der historischen Kulturwissenschaft von MAX WEBER und im besonderen sein Begriff des Idealtypus (Archiv für Sozialwissenschaft, 49. Bd.), S. 174. Vgl. ferner PFISTER, Die Entwicklung zum Idealtypus, Tübingen 1928, S. 131 ff.
[108] MAX WEBERS Wissenschaftslehre wurde von ALFRED SCHÜTZ (Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt, Wien 1932) in einer Weise fortgeführt und umgestaltet, die auch die von mir beanstandete Beurteilung des logischen Charakters der nationalökonomischen Sätze zu beseitigen sucht. (Vgl. insbesondere S. 277 ff.) Die scharfsinnigen, am HUSSERLschen System geschulten Untersuchungen von SCHÜTZ führen zu Ergebnissen, deren Bedeutung und Fruchtbarkeit sowohl für die Wissenschaftslehre als auch für die Wissenschaft selbst ganz besonders hoch veranschlagt werden müssen. Eine Würdigung des von SCHÜTZ neu gefaßten Begriffs des Idealtypus würde jedoch den Rahmen dieser Abhandlung überschreiten und den Aufgaben, die sie sich gesetzt hat, nicht dienen. Ich muß die Auseinandersetzung mit seinem Ideengang einer anderen Arbeit vorbehalten.
[109] Vgl. MAX WEBER, Wissenschaftslehre, a. a. O., S. 191.
[110] Vgl. GOTTL, Die Herrschaft des Wortes, 1901 (jetzt in: Wirtschaft als Leben, Jena 1925), S. 165 f.
[111] Vgl. WEBER, Wissenschaftslehre, a. a. O., S. 117 Anm. 2. Man halte dagegen WEBERs Umschreibung des »grundlegenden Tatbestandes, an den sich alle jene Erscheinungen knüpfen, die wir im weitesten Sinne als,sozialökonomische’ bezeichnen« (ebendort S. 161).
[112] Vgl. meine Gemeinwirtschaft, 2. Auflage, Jena 1932, S. 90. Vgl. ferner HECKSCHER, A Plea for Theory in Economic History (Economic History, Vol. I), S. 527.
[113] Über die Hypostasierung, die im Begriffe »Bedürfnis« steckt, vgl. FELIX KAUFMANN, Logik und Wirtschaftswissenschaft (Archiv für Sozialwissenschaft, 54. Bd.), S. 620 f.
[114] Vgl. HALBERSTÄDTER, Die Problematik des wirtschaftlichen Prinzips, Berlin und Leipzig 1925, S. 61.
[115] Vgl. LEXIS, a. a. O., S. 14.
[116] Vgl. SCHELER, Der Formalismus in der Ethik und die formale Wertethik, 2. Auflage, Halle 1921, S. 104.
[117] Vgl. MAX WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft (Grundriß der Sozialökonomik, III. Abteilung), Tübingen 1922, S. 12.
[118] Ebendort S. 2.
[119] Ebendort S. 1.
[120] Ebendort S. 13.
[121] Ebendort S. 12.
[122] Ebendort S. 9.
[123] Ebendort S. 5.
[124] Vgl. meine Kritik des Interventionismus, a. a. O., S. 123 ff.
[125] Vgl. weiter unten S. 166.
[126] Vgl. KARL MUHS, Die »wertlose« Nationalökonomie (Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 129. Bd.), S. 808.
[127] Vgl. darüber weiter unten S. 163 ff.
[128] Ich habe mit Absicht hier als Beispiel nicht einen Satz der mathematischen Naturwissenschaft, sondern eine Aussage der Biologie gewählt, die in der Form, in der ich sie bringe, unpräzise ist und in keiner denkbaren Form den strengen Charakter eines Gesetzes annehmen kann, weil es mir darum ging, zu zeigen, daß mit dem Argument der Vielheit der Ursachenkomplexe nicht einmal einer Aussage dieser Art der Charakter strengster Gesetzmäßigkeit bestritten werden kann.
[129] Von einem Fall, in dem das offen zugegeben wurde, berichtet FREUD, Zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung (Sammlung kleiner Schriften zur Neurosenlehre, 4. Folge, 2. Auflage, Wien 1922), S. 57.
[130] Vgl. MAX WEBER, Wissenschaftslehre, a. a. O., S. 503.
[131] Ebendort S. 370.
[132] Vgl. SCHELTING, a. a. O., S. 721.
[133] Vgl. weiter unten S. 160 ff..
[134] Vgl. SCHELTING, a. a. O., S. 721.
[135] Vgl. MITSCHERLICH, Wirtschaftswissenschaft als Wissenschaft (Schmollers Jahrbuch, 50. Jahrgang), S. 397.
[136] Vgl. SALIN, Geschichte der Volkswirtschaftslehre, 2. Auflage, Berlin 1929, 5. 97 f.
[137] Vgl. HECKSCHER, a. a. O., S. 525.
[138] Vgl. MAX WEBER, Wissenschaftslehre, a. a. O., S. 190.
[139] Ebendort S. 178.
[140] Ebendort S. 178 ff.
[141] Vgl. HEGEL, Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte, Ausgabe von LASSON, I. Bd. (Philosophische Bibliothek, Bd. 171a), Leipzig 1917, S. 148.
[142] Zur Beurteilung dieses Beispiels beachte man, daß es aus der 1929 erfolgten ersten Veröffentlichung dieses Stückes unverändert übernommen wurde.
[143] Vgl. RICKERT, Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft, a. a. O., S. 28 ff. Vgl. ferner SOMMER, Zur Methode der exakten und historischen Nationalökonomie (Schmollers Jahrbuch, 52. Jahrgang), S. 647.
[144] Vgl. MUHS, a. a. O., S. 808.
[145] »Historiquement le diable est beaucoup plus solidement prouvé que Pisistrate: nous n’avons pas un seul mot d’un contemporain qui dise avoir vu Pisistrate; des milliers des ‘temoins oculaires’ déclarent avoir vu le diable, il y a peu de faits historiques établis sur un pareil nombre de témoignages indépendants. Pourtant nous n’hésitons plus à rejeter le diable et à admettre Pisistrate. C’est que l’existence du diable serait inconciliable avec les lois de toutes les sciences constituées.« (LANGLOIS SEIGNOBOS, Introduction aux Études historiques, 3ème Éd., Paris 1905, S. 177 f.)
[146] Vgl. BOUGLÉ, Qu’est-ce que la Sociologie? 5ème Éd., Paris 1925, S. 54 ff.
[147] Vgl. MANNHEIM, Historismus (Archiv für Sozialwissenschaft, 52. Bd.), S. 9.
[148] Vgl. HUSSERL, Logische Untersuchungen, a. a. O., I. Bd., S. 136 ff.
[149] Vgl. JERUSALEM, Die soziologische Bedingtheit des Denkens und der Denkformen (Versuche zu einer Soziologie des Wissens, herausgegeben von MAX SCHELER), München und Leipzig 1924, S. 183.
[150] Vgl. LÉVY-BRUHL Die geistige Welt des Primitiven, übersetzt von HAMBURGER, München 1927, S. 12 f.
[151] Ebendort S. 11.
[152] Ebendort S. 343.
[153] Vgl. CASSIERER, Philosophie der symbolischen Formen, Berlin 1925, II. Bd., S. 78.
[154] Vgl. BERNHEIM, a. a. O., S. 53. KRACAUER (a. a. O., S. 24 ff.) spricht von vergleichender Gesellschaftsgeschichte und vergleichender Kulturgeschichte.
[155] Die Unterscheidung von Statik und Dynamik, wie ich sie vornehme, weicht von der Unterscheidung, die AMONN vornimmt, ab; auf diese Verschiedenheit kann hier nicht näher eingegangen werden. Wohl aber muß ich nachdrücklich auf das verweisen, was AMONN über die ganz andere Bedeutung, die dem Begriffspaar in der Mechanik und in der Nationalökonomie zukommt, ausführt. Es handelt sich bei den Begriffen Statik und Dynamik keineswegs um die Anwendung einer mechanischen Analogie, sondern um die Ausbildung einer dem Wesen der nationalökonomischen Wissenschaft entsprechenden Denkform, für die nur die Bezeichnung der Mechanik entlehnt wurde. Vgl. AMONN, Grundzüge der Volkswohlstandslehre, I. Teil, Jena 1926, S. 275 ff.
[156] Vgl. CLARK, Essentials of Economic Theory, New York 1907, S. 130 ff.
[157] Es ist ein arges Mißverstehen, wenn man, wie z. B. FLÜGGE (»Institutionalismus in der Nationalökonomie der Vereinigten Staaten« in den Jahrbüchern für Nationalökonomie und Statistik, N. F., 71. Bd., S. 339), glaubt, die Konstruktion eines statischen Zustandes wäre nicht geeignet, zum Verständnisse der volkswirtschaftlichen Veränderungen zu führen.
[158] Vgl. oben S. 70.
[159] Vgl. SIMMEL, Die Probleme der Geschichtsphilosophie, 4. Auflage, München und Leipzig 1922, S. 107 f.
[160] Vgl. BÜCHER, Die Entstehung der Volkswirtschaft, Erste Sammlung, 10. Auflage, Tübingen 1917, S. 91. BÜCHERs Stufentheorie wird hier als repräsentativ für eine ganze Klasse solcher Theorien genommen, zu denen z. B. auch die SCHMOLLERs zählt. Der Prioritätsstreit, der sich an BÜCHERs Lehre knüpfte, ist für uns gegenstandslos.
[161] Ebendort S. 149.
[162] Ebendort S. 150.
[163] Dagegen ist BECHER (Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften, München und Leipzig 1921, S. 139, 171 f.) geneigt, in diesen Stufentheorien »allgemeine Gesetze oder, wenn man vorsichtiger sprechen will, Regeln der wirtschaftsgeschichtlichen Entwicklung« zu erblicken.
[164] Vgl. HEGEL, a. a. O., S. 232 f.
[165] Vgl. MOUGEOLLE, Les Problèmes de l’Histoire, Paris (1886), S. 98 ff., 121 ff.
[166] Vgl. BECHER, a. a. O., S. 175.
[167] In geistreicher Weise sucht SIMMEL dieser Besonderheit des Historischen in seinen Ausführungen über individuelle Kausalität Ausdruck zu verleihen. Vgl. SIMMEL, a. a. O., S. 100 ff.
[168] Diese Illusion teilt mit vielen anderen MITCHELL, Quantitative Analysis in Economic Theory (American Economic Review, Vol. XV, S. 1 ff.).
[169] Vgl. DINGLER, Der Zusammenbruch der Wissenschaft, München 1926, S. 63 ff.; SCHAMS, Die CASSELschen Gleichungen und die mathematische Wirtschaftstheorie (Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, III. Folge, 72. Bd.), S. 386 ff. Eine treffende Ablehnung der mathematischen Behandlung der Nationalökonomie gibt PAINLEVÉ in seiner Vorrede zur französischen Ausgabe der Principles von JEVONS (Paris 1909), S. V ff.
[170] Vgl. CAIRNES, The Character and Logical Method of Political Economy, a. a. O., S. 118 ff.; EULENBURG, Sind historische Gesetze möglich? (Hauptprobleme der Soziologie, Erinnerungsgabe für MAX WEBER, München 1923), I. Bd., S. 43.
[171] Darum wäre es auch verfehlt, die Behauptung im Text mit dem Hinweis darauf bekämpfen zu wollen, daß die Naturwissenschaft der Soziologie das statistische Verfahren entlehnt habe und es nun ihren Zwecken dienstbar zu machen sucht.
[172] Vgl. KANT, Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik usw., § 14 (Insel-Ausgabe, IV. Bd., S. 417).
[173] Vgl. RICKERT, Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung, 2. Auflage, Tübingen 1913, S. 224; RICKERT, Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft, a. a. O., S. 60.
[174] Vgl. über KANTS soziale Grundanschauungen meine Gemeinwirtschaft, a. a. O., S. 268 f., 399 ff.
[175] Vgl. RICKERT, Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung, a. a. O., S. 196 f.; ähnlich S. 174. Dem Schlüsse, zu dem Rickert schließlich gelangt, daß die Soziologie nie an die Stelle der Geschichte treten dürfe, ist natürlich zuzustimmen.
[176] Vgl. WEYL, Philosophie der Mathematik und Naturwissenschaft (Handbuch der Philosophie), München und Berlin 1927, S. 3. WUNDT hat sich bemüht, seine Untersuchungen auf Grund eingehenderen Studiums der Gesellschaftswissenschaften aufzubauen. (Vgl. WUNDT, Logik, 3. Auflage, Stuttgart 1908, III. Bd., S. 458 ff.) Daß er dabei die moderne subjektivistische Nationalökonomie mißverstanden hat, erklären Zeit und Umwelt seines Wirkens; er konnte, wie schon erwähnt, auch nicht durch MENGERS Methodenbuch auf diesen Mangel aufmerksam gemacht werden.
[177] Vgl. MENGER, Untersuchungen über die Methode der Sozialwissenschaften und der politischen Ökonomie insbesondere, Leipzig 1883, S. 3 ff.
[178] Darüber, daß man zu einer solchen Theorie auf keinem der uns zur Verfügung stehenden Denkverfahren gelangen könnte, vgl. oben S. 9 ff., 24 ff.
[179] Vgl. ROTHACKER, Logik und Systematik der Geisteswissenschaften (Handbuch der Philosophie), München und Berlin 1927, S. 123 f.
[180] Vgl. BAGEHOT, The Postulates of English Political Economy (Works, Edited by Russel Barrington, London 1915, Vol. VII), S. 103-104. Daß BAGEHOT auf den folgenden Seiten seiner Abhandlung den Einwendungen des Historismus in unhaltbarer Weise entgegenkommt und auch für Gesetze, die nur für eine bestimmte Epoche Geltung haben sollen, eintritt, kann hier außer Betracht bleiben. Vgl. darüber auch JOHN NEVILLE KEYNES, The Scope and Method of Political Economy, London 1891 S. 289 ff.
[181] Vgl. BAGEHOT, a. a. O., S. 104.
[182] Vgl. BÜHLER, Die Krise der Psychologie, Jena 1927, S. 46.
[183] Vgl. WATSON, Behaviorism, New York 1924, S. 11.
[184] Breit angelegte dogmengeschichtliche Untersuchungen über die Entwicklung der Theorie des Verstehens in der deutschen Wissenschaft unternimmt WACH in seinem Werk: Das Verstehen, Grundzüge einer Geschichte der hermeneutischen Theorie im 19. Jahrhundert (3 Bände, Tübingen 1926 – 1933). Wollte man auch die Geschichte des »Begreifen« in dem Sinne, in dem dieser Ausdruck in den nachstehenden Ausführungen gebraucht wird, darstellen, dann müßte man vor allem auf das Schrifttum des Utilitarismus zurückgehen.
[185] Vgl. ROTHACKER, Logik und Systematik der Geisteswissenschaften, a. a. O., S. 119 ff.
[186] Vgl. SOMBART, Die drei Nationalökonomien, a. a. O., S. 259.
[187] Vgl. oben S. 71 ff.; das über die fehlerhafte Identifizierung des »rationalen« und des »richtigen« Verhaltens (so vor allem auf S. 89 ff.) Gesagte enthält auch schon die Erwiderung auf SOMBARTs Ausführungen, a. a. O., S. 261.
[188] Vgl. SOMBART, a. a. O., S. 211.
[189] a. a. O., S. 305.
[190] a. a. O., S. 247.
[191] a. a. O., S. 301.
[192] a. a. O., S. 305.
[193] Ebendort.
[194] Vgl. SOMBART, a. a. O., S. 303.
[195] Ebendort.
[196] Vgl. oben S. 116.
[197] Vgl. SOMBART, a. a. O., S. 303.
[198] a. a. O., S. 301.
[199] a. a. O., S. 304.
[200] a. a. O., S. 289 f.
[201] Vgl. oben S. 65; ferner meine Kritik des Interventionismus, a. a. O., S. 24 ff., 68 ff.
[202] Vgl. SOMBART, a. a. O., S. 87.
[203] a. a. O., S. 85. a. a. O., S. 85.
[204] Vgl. SISMONDI, Nouveaux principes d’économie politique, Paris 1819, I. Bd.., S. 288.
[205] Vgl. TILLICH, Sozialismus (Neue Blätter für den Sozialismus, I. Jahrgang, 1930 S. 1).
[206] Vgl. darüber oben S. 79 ff.
[207] Vgl. BÖHM-BAWERK, Kapital und Kapitalzins, a. a. O., II. Abteilung, I. Bd., S. 236, Anm.
[208] Nach FR. A. SCHMID, zitiert bei JODL, Geschichte der Ethik, 2. Auflage, II. Bd., S. 661.
[209] Vgl. BÖHMs Bemerkungen über SCHMOLLER, a. a. O., S. 239, Anm.; über VIERKANDT vgl. oben S. 52.
[210] Vgl. BÖHM-BAWERK, Gesammelte Schriften, herausgeg. von F. N. WEISS, I. Bd., Wien 1924, S. 193 ff.
[211] Vgl. die gedankenreichen Untersuchungen von STRIGL, Die ökonomischen Kategorien und die Organisation der Wirtschaft, Jena 1923.
[212] Das gilt z. B. besonders auch von den Versuchen von MOORE (Synthetic Economics, New York 1929). Vgl. darüber die Kritik von RICCI (Zeitschr. f. Nationalökonomie, I., S. 694 ff.).
[213] Vgl. BURCHARDT, Entwicklungsgeschichte der monetären Konjunkturtheorie (Weltwirtschaftliches Archiv, 28. Bd.), S. 140; LÖWE, Über den Einfluß monetärer Faktoren auf den Konjunkturzyklus (Schriften des Vereins für Sozialpolitik, 173. Bd.), S. 362.
[214] Vgl. BÖHM-BAWERK, Grundzüge der Theorie des wirtschaftlichen Güterwerts ( Jahrb. f. Nationalökonomie und Statistik, N. F., Bd. XIII, S. 16), ferner Kapital und Kapitalzins, 3. Auflage, Innsbruck 1909, 2. Abt., S. 228.
[215] Vgl. DIEHL, Theoretische Nationalökonomie, I. Bd., Jena 1916, S. 287; III. Bd., Jena 1927, S. 82-87. Vgl. dagegen meine Ausführungen im Arch. für Geschichte des Sozialismus, X. Bd., S. 93 ff.
[216] a. a. O., III. Bd., S. 85.
[217] Ebendort.
[218] Für das Problem der Wertmessung und des Gesamtwerts, das hier nicht weiter behandelt werden soll, habe ich eine kritische Prüfung der Arbeiten einiger älterer Vertreter der modernen Lehre in meiner Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel (2. Auflage, München 1924, S. 10-22) versucht.
[219] Vgl. MENGER, Grundsätze der Volkswirtschaftslehre, Wien 1871, S. IX (2. Auflage, Wien 1923, S. XXI).
[220] Vgl. MENGER, a. a. O., 1. Auflage, S. 3.
[221] a. a. O., S. 2.
[222] Vgl. MENGER, a. a. O., 2. Auflage, S. 4.
[223] Ebendort S. 4 f.
[224] Ebendort S. 5.
[225] Vgl. MENGER, a. a. O., 1. Auflage, S. 4 (2. Auflage, S. 16 f.).
[226] Vgl. C. A. VERRIJN STUART, Die Grundlagen der Volkswirtschaft, Jena 1923, S. 94.
[227] Vgl. BÖHM-BAWERK, Kapital und Kapitalzins, a. a. O. II., S. 354.
[228] Vgl. STRIGL, Die ökonomischen Kategorien und die Organisation der Wirtschaft, Jena 1923, S. 75 f.; vgl. ferner ebendort S. 146 ff.
[229] Vgl. oben S. 71 ff.
[230] Vgl. HILFERDING, Böhm-Bawerks Marx-Kritik (Marx-Studien, I. Bd., Wien 1904), S. 61.
[231] Vgl. BUCHARIN, Die politische Ökonomie des Rentners, Berlin 1926, S. 27.
[232] ADOLF WEBER, Allgemeine Volkswirtschaftslehre, München u. Leipzig 1928, S. 211. Die bezogene Stelle ist in der jüngsten (vierten) Auflage dieses hervorragenden Lehrbuches nicht mehr enthalten. Daß diese Fernhaltung der nationalökonomischen Theorie von den Hochschulen nicht zu Ergebnissen geführt hat, die die »Praxis« befriedigen, beweisen die Ausführungen des Legationsrates Dr. BÜCHER auf der Frankfurter Tagung des Reichsverbandes der Deutschen Industrie. BÜCHER erhob gegen die Universitäten des Deutschen Reiches den Vorwurf, daß die Volkswirte »falsch ausgebildete werden, weil »die deutsche Nationalökonomie das Gefühl für die tatsächlichen Aufgaben der Gegenwart verloren und sich vielfach das praktische ökonomische Denken abgewöhnt hat.« Sie habe sich »in Einzelaufgaben zersplittert und den Blick auf die Zusammenhänge verloren.« (Siehe den Bericht in der »Frankfurter Zeitung« vom 4. September 1927.) Dieses vernichtende Urteil ist um so bemerkenswerter, als BÜCHER wirtschaftspolitisch, wie aus den übrigen Ausführungen dieser Rede hervorgeht, ganz auf dem Boden der Gegner des laissez-faire und der Befürworter der »durchorganisierten Wirtschaft« steht, mithin eines Sinnes ist mit der interventionistisch-etatistischen Richtung der deutschen Volkswirte.
[233] Vgl. zur psychoanalytischen Beurteilung der ablehnenden Stellung gegenüber der Annahme neuer Erkenntnis JONES, Zur Psychoanalyse der christlichen Religion, Leipzig 1928, S. 25.
[234] Vgl. die Kennzeichnung dieser Methoden durch POHLE, Die gegenwärtige Krisis in der deutschen Volkswirtschaftslehre, z. Auflage, Leipzig 1921, S. 116 ff.
[235] Die Widerstände, von denen wir sprechen, sind nicht nur bei e inem Volke aufgetreten; sie sind in den Vereinigten Staaten oder in England gerade so, wenn vielleicht auch in geringerer Stärke, zu finden wie in Deutschland oder in Italien.
[236] Das gilt vor allem auch von denen, die, wie z. B. die »Wissenssoziologen« und die Schule von MAX ADLER, den Marxismus »soziologisch«, d. h. losgelöst von aller Nationalökonomie betrachten wollen. Für sie ist die Unüberbrückbarkeit des Gegensatzes der Klasseninteressen ein Dogma, an dessen Wahrheit nur Verworfene zweifeln können.
[237] Vgl. das Kommunistische Manifest, 7. autorisierte deutsche Ausgabe, Berlin 1906, S. 30.
[238] »Der Einzelne irrt häufig in der Wahrung seiner Interessen: eine Klasse i r r t niemals auf die Dauer !« sagt F. OPPENHEIMER (System der Soziologie, II. Bd., Jena 1926, S. 559). Das ist Metaphysik und nicht Wissenschaft.
[239] Vgl. ZIELINSKI, Cicero im Wandel der Jahrhunderte, 4. Auflage, Leipzig 1929, S. 246.
[240] Ebenda S. 248.
[241] Der Ausdruck »ideologisch« ist hier natürlich nicht im marxistischen (wissenssoziologischen), sondern im wissenschaftlichen Sinne gebraucht.
[242] Vgl. ENGELS, Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft, 7. Auflage, Stuttgart 1910, S. 306.
[243] Rede zur Einleitung der am 30. September 1932 in Dresden im Fachausschuß für Theorie des Vereins für Sozialpolitik durchgeführten Wechselrede über das Problem der Wertlehre. (Schriften des Vereins für Sozialpolitik, 183. Bd., II. Teil.)
[244] Vgl. TOTOMIANZ, Geschichte der Nationalökonomie und des Sozialismus, 2. Auflage, Berlin 1929, S. 132.
[245] Vgl. CASSEL, Grundgedanken der theoretischen Ökonomie, Vier Vorlesungen, Leipzig 1926, S. 27.
[246] Vgl. CASSEL, a. a. O., S. 24.
[247] Vgl. CASSEL, Grundriß einer elementaren Preislehre (Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, 1899).
[248] Vgl. SPANN in seinem Beitrag zum 183. Band, I. Teil, der Schriften des Vereins für Sozialpolitik, S. 204. Die Beiträge zu diesem Bande werden im Weiteren als »Schriftenband« mit der Seitenzahl zitiert.
[249] Vgl. SPANN, Schriftenband, S. 217.
[250] Vgl. SPANN, Schriftenband, S. 222.
[251] Vgl. meine »Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel«, a. a. O., S. 18-20.
[252] Über die mathematische Methode vgl. oben S. 113 ff.
[253] Vgl. SPANN, Schriftenband. S. 250.
[254] Vgl. Schriftenband, S. 3 ff.
[255] Vgl. CLARK, The Distribution of Wealth, New York 1908, S. 118.
[256] Auch in den beiden von uns außer acht gelassenen Fällen (Behinderung der Beweglichkeit des umlaufenden Kapitals und Sinken der Nachfrage nach dem Endprodukt) ist der Faktor »Vergangenheit« wirksam. Doch soll darauf nicht näher eingegangen werden, da der Zusammenhang ohne weiteres aus dem Gesagten erhellt. Ebenso einfach ist die Anwendung auf die »ausdauernden Güter« im Sinne BÖHM-BAWERKs.
[257] Vgl. BALLOD (ATLANTICUS), Der Zukunftsstaat, Produktion und Konsum im Sozialstaat, 2. Aufl., Stuttgart 1919.
[258] Ebendort S. 1.
[259] Ebendort S. 69.
[260] Ebendort S. 213.
[261] Vgl. meine Geldwertstabilisierung und Konjunkturpolitik, a. a. O., S. 45 f.
[215]
Register.
Allgemeingültigkeit der nationalökonomischen Sätze 129 ff.
aposteriorische nationalökonomische Theorie, Problem der Möglichkeit einer XI, 8 ff., 18 ff.
apriorischer Charakter der nationalökonomischen Theorie 5 ff., 12 f., 78.
Arbeitsteilung 106 ff.
Attitüden 59.
Bedürfnis 77, 57 f.
Bedürfnisse, eingebildete 161 f.
Begreifen 46, 124 ff.
Begriffsrealismus 143.
Behaviorismus 63, 122 ff.
Beweglichkeit des Kapitals 201 f.
CAIRNES, seine Verfahrenslehre 20.
CASSELs Kritik der Wertlehre 192 ff.
Datenänderung 150.
Denken, Abhängigkeit von der Klassenlage des Denkers 177 ff., 189 ff.
Dynamik 105.
Empirismus 8.
Erfahrung und apriorische Theorie 14 f., 26 ff.
Erlebnis und Wissenschaft 42 ff.
Ertragsgesetz 2, 145 f.
Eudämonismus und Wertlehre 141 f.
FROBENIUS, Lehre vom Ideal und Kritik des Utilitarismus 61 ff.
Ganzheit, Erfassen der 42 ff. Geldlehre 198.
Geldrechnung 146 ff. Geschichte, Allgemeine 102 f.
Gesellschaftslehre (Soziologie) und Nationalökonomie 12, 17, 64 f.
Gesetze, historische VII f., 4, 70, 104 ff.
– soziologische und nationalökonomische, mit zeitlich begrenzter Geltung 117 ff.
Gesetzmäßigkei im sozialen Geschehen 184 ff.
GOSSENsches Gesetz, Erstes 144 f.
GRESHAMsches Gesetz 83 ff.
HAHN, EDUARD, Lehre vom Ideal und Kritik des Utilitarismus 59 ff.
Handeln, rationales menschliches 17, 22 ff.
Historische Schule der wirtschaftlichen Staatswissenschaften VI ff., 68 ff.
Historismus 5, 8, 77 ff. homo oeconomicus 168 f.
Idealtypus VII, 71 ff., 168 f.
Induktion XI, 67 f.
„irrationales“ Handeln 79 ff., 89 ff.
Irrationalität 32 f.
Kapital, Fehlleitung von 208 ff. Klassische Nationalökonomie, Ausgangspunkt ihres Denkens 90 ff.
Kollektivismus 39 ff.
komplexer Charakter der Erfahrung 86 ff.
Konkurrenz, freie 91 f., 153 f.
Konstante 10, 114 f:
Kosten 154 ff.
Leben und Wissenschaft 42 ff., 88 f.
Logik, Auflehnung gegen die 187.
— und Sozialwissenschaft 134 ff.
Marxistische Wissenschaftslehre 170 ff.
Mathematik, Verwendung in der Nationalökonomie 113 f.
Metaphysik und Wissenschaft 48 ff.
MILL, J. ST., seine Verfahrenslehre 19.
Mittel 30 ff.
Moderne Nationalökonomie, Voraussetzung ihres Systems 91 ff.
Motive des Handelns 33.
[216]
MYRDALs Attitüdenlehre 56 ff.
Nationalökonomie, Entstehung der 3, 137 ff.
— Gegner der 3 f., 65 f., 88 ff., 170 ff.
— und Geschichte VIII f., 94 ff.
Naturalismus 4 f., 7.
Naturwissenschaft, Anwendbarkeit des Ausdrucks auf Soziologie und Nationalökonomie 116, 132.
„nichtwirtschaftliche“ Motive des Handelns 163 ff.
Nutzbarmachung der Ergebnisse der Wissenschaft 36 ff.
Praktik 14.
Psychologie, Verhältnis zur Nationalökonomie 2, 10 f., 143 ff.
Quantitative Analyse in der Nationalökonomie 113, 150 f.
Ressentiment 181 ff.
RICKERT über die Möglichkeit einer Soziologie 116 f.
Rückständigkeit, technische 205.
Schutzzoll 89, 206 ff.
Seinsgebundenheit des Denkens 177 ff.
SENIOR, seine Verfahrenslehre 18 f.
SOMBARTs Kritik der nationalökonomischen Theorie 129 ff.
SPANNs Kritik der Wertlehre 194. ff.
— Universalismus 41 f. Standpunkt des Forschers in der Geisteswissenschaft und in der Soziologie 129.
Wirtschaftsstil VII f.
Statik 104 f.
Stufentheorien 106 ff.
Technologie, Verhältnis zur NationalÖkonomie 145 f.
— und Wirtschaftlichkeit 202 ff.
Theorie, geschichtlich gebundene 24 ff., 117 f.
Theorie und Geschichte, Abgrenzung VII ff., 30, 128.
Triebe 50 ff.
Universalismus 39 ff., 143 f.
Verifikation 26 ff.
Vernunft, Unveränderlichkeit ihrer logischen Struktur 99 ff.
Verstehen 11 f., 124 ff.
VIERKANDTs Triebsoziologie 50 ff.
Voraussage in der Nationalökonomie 115.
Vorziehen 139 ff.
Wahlakte 76.
WEBER, MAX, Verhältnis zur Nationalökonomie und Soziologie VI ff., 70 f., 74 f.
Weltanschauung und Nationalökonomie 37 f., 49.
Wertbegriff 193.
Wertfreiheit der Wissenschaft 34 ff., 197.
Wertlehre, Aufgabe der, 192 f.
Widerstände 152 ff.
WIESER, seine Verfahrenslehre 21 f.
wirtschaftlich im engeren Sinne 146 ff.
wirtschaftliches und „nichtwirtschaftliches“ Handeln 137 ff., 146 ff.
Wirtschaftsgeschichte und Nationalökonomie 98, 121.
Wirtschaftskunde 103.
Wirtschaftsstil VII f.
Wissenschaft und das Irrationale 127 ff.
Wissenssoziologie 274 ff.
Zeit in der Wirtschaft 23 f., 151 ff.
Zielsetzungen, weitgehende Übereinstimmung der menschlichen, 36 ff.
Zurechnungsproblem 15 f.
Zweck 30 ff.