CARL MENGER,
Grundsätze der Volkswirthschaftslehre (1871)
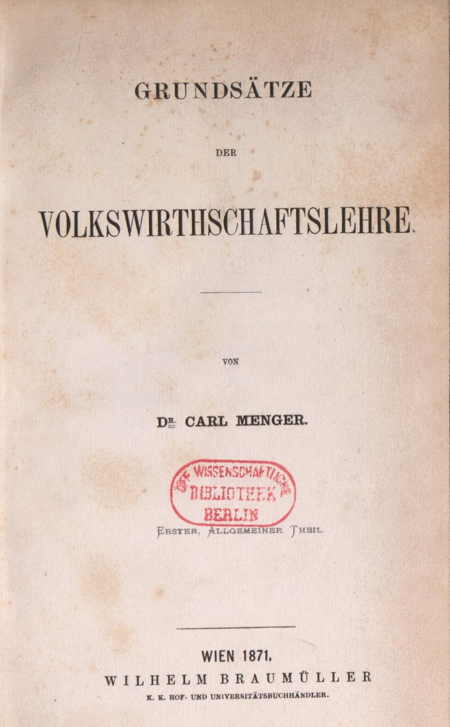 |
[Created: 18 January, 2021]
[Updated: 2 April, 2024] |
 |
This is an e-Book from |
Source
, Grundsätze der Volkswirthschaftslehre. (Wien: Braumüller, 1871).http://davidmhart.com/liberty/Books/1871-Menger_Grundsaetze/Menger_Grundsaetze1871-ebook.html
Carl Menger, Grundsätze der Volkswirthschaftslehre. (Wien: Braumüller, 1871).
Editor's Introduction
To make this edition useful to scholars and to make it more readable, I have done the following:
- inserted and highlighted the page numbers of the original edition
- not split a word if it has been hyphenated across a new line or page (this will assist in making word searches)
- added unique paragraph IDs (which are used in the "citation tool" which is part of the "enhanced HTML" version of this text)
- retained the spaces which separate sections of the text
- created a "blocktext" for large quotations
- moved the Table of Contents to the beginning of the text
- placed the footnotes at the end of the book
- reformatted margin notes to float within the paragraph
- inserted Greek and Hebrew words as images
[xi]
Table of Contents / Inhalt
- Vorrede.
- Erstes Capitel. Die allgemeine Lehre vom Gute
- §. 1. Ueber das Wesen der Güter
- §. 2. Ueber den Causal-Zusammenhang der Güter
- §. 3. Die Gesetze, unter welchen die Güter in Rücksicht auf ihre Güterqualität stehen
- a. (Die Güter höherer Ordnung sind in ihrer Guterqualität dadurch bedingt, dass wir auch über die entsprechenden complemtaren Güter verfügen.)
- b. (Die Güter höherer Ordnung sind in ihrer Güterqualität durch jene der entsprechenden Güter niederer Ordnung bedingt.)
- §. 4. Zeit—Irrthum
- §. 5. Ueber die Ursachen der fortschreitenden Wohlfahrt der Menschen
- §. 6. Der Güterbesitz
- Zweites Capitel. Die Wirthschaft und die wirthschaftlichen Güter
- Einleitung
- §. 1. Der menschliche Bedarf
- a) Der Bedarf an Gütern erster Ordnung (an Genussmittein)
- b) Der Bedarf an Gütern höherer Ordnung (an Productionsmitteln)
- c) Die Zeitgrenzen, innerhalb welcher sich die menschlichen Bedürfnisse geltend machen
- §. 2. Die verfügbaren Quantitäten
- §. 3. Ueber den Ursprung der menschlichen Wirthschaft und die wirthschaftlichen (ökonomischen) Güter
- a) Die wirthschaftlichen Güter
- b) Die nicht ökonomischen Güter
- c) Verhältniss zwischen den ökonomischen und den nicht ökonomischen Gütern
- d) Die Gesetze, unter welchen die Güter in Rücksicht auf ihren ökonomischen Charakter stehen
- §. 4. Das Vermögen
- Drittes Capitel. Die Lehre vom Werthe
- §. 1. Ueber das Wesen und den Ursprung des Güterwerthes
- §. 2. Ueber das ursprünglichste Mass des Güterwerthes
- a) Verschiedenheit der Grösse der Bedeutung der einzelnen Bedürfnissbefriedigungen. (Subjectives Moment.)
- b) Abhängigkeit der einzelnen Bedürfnissbefriedigungen von den concreten Gütern. (Objectives Moment.)
- c) Einfluss der verschiedenen Qualität der Güter auf ihren Werth
- d) Subjectiver Charakter des Werthmasses.—Arbeit und Werth.—Irrthum
- §. 3. Die Gesetze, nach welchen sich der Werth der Güter regelt
- a) Ueber das massgebende Princip des Werthes der Güter höherer Ordnung
- b) Ueber die Productivität des Capitals
- c) Ueber den Werth der complementären Quantitäten von Gütern höherer Ordnung
- d) Ueber den Werth, welchen die einzelnen Güter höherer Ordnung für uns haben
- e) Ueber den Werth der Boden- und Capitalnutzung und der Arbeitsleistungen insbesondere
- Viertes Capitel. Die Lehre vom Tausche
- Fünftes Capitel. Die Lehre vom Preise
- Einleitung
- §. 1. Die Preisbildung beim isolirten Tausche
- §. 2. Die Preisbildung im Monopolhandel
- a) Preisbildung und Gütervertheilung bei der Concurrenz mehrerer Personen um ein einzelnes untheilbares Monopolgut
- b) Preisbildung und Gütervertheilung bei der Concurrenz um Quantitäten eines Monopols
- c) Einfluss der von dem Monopolisten fixirten Preise auf die in den Verkehrtretenden Quantitäten des Monopolgutes und auf die Vertheilung derselben unter die Concurrenten
- d) Die Grundsätze des Monopolhandels, (Monopolisten-Politik.)
- §. 3. Preisbildung und Gütervertheilung bei beiderseitiger Concurrenz
- a) Die Entstehung der Concurrenz
- b) Wirkung der von den Concurrenten im Anbote zur Veräusserung gebrachten Quantitäten einer Waare auf die Preisbildung, und bestimmter von ihnen fixirten Preise auf den Absatz und in beiden Fällen auf die Vertheilung der Waare unter die Concurrenten um dieselbe
- c) Rückwirkung der Concurrenz im Anbote eines Gutes auf die zur Veräusserung gelangenden Quantitäten desselben, beziehungsweise auf die Anbotpreise (Concurrenz-Politik.)
- Sechstes Capitel. Gebrauchswerth und Tauschwerth
- Siebentes Capitel. Die Lehre von der Waare
- §. 1. Ueber den Begriff der Waare im populären und wissenschaftlichen Sinne
- §. 2. Ueber die Absatzfähigkeit der Waaren
- Achtes Capitel. Die Lehre vom Gelde
- §. 1. Ueber das Wesen und den Ursprung des Geldes
- §. 2. Ueber das jedem Volke und Zeitalter eigenthümliche Geld
- §. 3. Das Geld als Massstab der Preise
- §. 4. Die Münze
- Fußnoten
Dem
Königlich Sächsischen Hofrathe
Dr. Wilhelm Roscher
Professor der Staats- und Cameralwisssenschaften an der Universität in Leipzig etc.
Zugeeignet
vom Verfasser
[v]
Vorrede.↩
Wenn unsere Zeit den Fortschritten auf dem Gebiete der Naturwissenschaften eine so allgemeine und freudige Anerkennung entgegenbringt, während unsere Wissenschaft eben in jenen Lebenskreisen, welchen sie die Grundlage practischer Thätigkeit sein sollte, so wenig beachtet und ihr Werth so sehr in Frage gestellt wird, so kann der Grund hievon keinem Unbefangenen zweifelhaft erscheinen. Nie hat es ein Zeitalter gegeben, welches die wirthschaftlichen Interessen höher stellte, als das unsere, niemals war das Bedürfniss nach einer wissenschaftlichen Grundlage des wirthschaftlichen Handelns ein allgemeineres und tiefer gefühltes, niemals auch die Fähigkeit der Practiker auf allen Gebieten menschlichen Schaffens, die Errungenschaften der Wissenschaft sich nutzbar zu machen, grösser, als in unseren Tagen. Nicht die Folge des Leichtsinnes oder der Unfähigkeit der Practiker kann es demnach sein, wenn dieselben, unbekümmert um die bisherigen Entwickelungen unserer Wissenschaft, bei ihrer wirthschaftlichen Thätigkeit lediglich die eigenen Lebenserfahrungen zu Rathe ziehen, nicht die Folge eines hochmüthigen Zurückweisens der tieferen Einsicht, welche die wahre Wissenschaft dem Practiker über die den Erfolg seiner Thätigkeit bestimmenden Thatsachen und [vi] Verhältnisse bietet. Der Grund einer so auffälligen Gleichgiltigkeit kann vielmehr nirgends anders gesucht werden, als in dem gegenwärtigen Zustande unserer Wissenschaft selbst, in der Unfruchtbarkeit der bisherigen Bemühungen, die empirischen Grundlagen derselben zu gewinnen.
Ein jeder neue Versuch in dieser Richtung, mit so schwachen Kräften er auch unternommen werden mag, trägt desshalb seine Berechtigung in sich selbst. Die Erforschung der Grundlagen unserer Wissenschaft anstreben, heisst seine Kraft der Lösung einer mit der Wohlfahrt der Menschen im engsten Zusammenbange stehenden Aufgabe widmen, einem öffentlichen Interesse von höchster Wichtigkeit dienen und einen Weg betreten, auf welchem selbst der Irrthum nicht ganz ohne Verdienst ist.
Damit ein solches Unternehmen aber nicht dem gerechten Misstrauen der Sachkundigen begegne, dürfen wir es einerseits nicht verabsäumen, allen Richtungen, in welchen der Forschergeist auf dem Gebiete unserer Wissenschaft bisher vorgedrungen ist, eine sorgfältige Beachtung zuzuwenden, andererseits aber auch nicht davor zurückschrecken, mit der vollen Selbstständigkeit des Urtheiles an die Kritik der Ansichten unserer Vorgänger und selbst jener Lehrmeinungen zu schreiten, welche bisher für fest stehende Errungenschaften unserer Wissenschaft galten. Durch das erstere würden wir uns der ganzen Summe von Erfahrungen freiwillig begeben, welche so viele ausgezeichnete Geister aller Völker und Zeiten auf dem Wege zum gleichen Ziele gesammelt haben, durch das letztere auf jede Hoffnung einer tiefer gehenden Reform der Grundlagen unserer Wissenschaft von vornherein verzichten. Wir weichen diesen Gefahren [vii] aus, indem wir die Ansichten unserer Vorgänger zu unserem geistigen Besitze machen, aber nirgends davor zurückschrecken, dieselben zu prüfen, von Lehrmeinungen an die Erfahrung, von Menschengedanken an die Natur der Dinge zu appelliren.
Auf diesem Boden stehen wir. Wir waren in dem Nachfolgenden bemüht, die complicirten Erscheinungen der menschlichen Wirthschaft auf ihre einfachsten, der sicheren Beobachtung noch zugänglichen Elemente zurück-zuführen, an diese letztern das ihrer Natur entsprechende Mass zu legen und mit Festhaltung desselben wieder zu untersuchen, wie sich die complicirteren wirthschaftlichen Erscheinungen aus ihren Elementen gesetzmässig entwickeln.
Es ist dies jene Methode der Forschung, welche, in den Naturwissenschaften zur Geltung gelangt, zu so grossen Resultaten führte und desshalb in missverständlicher Weise auch die naturwissenschaftliche genannt wird, während sie doch allen Erfahrungswissenschaften gemeinsam ist und richtiger die empirische genannt werden sollte. Es ist diese Unterscheidung aber desshalb von Wichtigkeit, weil jede Methode durch die Natur des Wissensgebietes, auf welchem sic zur Anwendung kommt, ihren besonderen Charakter erhält und demnach von einer naturwissenschaftlichen Richtung in unserer Wissenschaft füglich nicht die Rede sein kann.
Die bisherigen Versuche, die. Eigenthümlichkeiten der naturwissenschaftlichen Methode der Forschung kritiklos auf die Volkswirthschaftslehre zu übertragen, haben denn auch zu den schwersten methodischen Missgriffen und zu einem leeren Spiele mit äusserlichen Analogien zwischen den Erscheinungen der Volkswirthschaft und jenen der Natur geführt, Magna cum vanitate [viii] et desipientia inanes similitudines et sympathias rerum describunt atque etiam quandoque affingunt [*], sagt Baco von Forschern dieser Art, ein Satz, der auch heute noch und zwar seltsamerweise eben von jenen Bearbeitern unserer Wissenschaft gilt, die sich unablässig die Schüler Baco's nennen, während sie den Geist seiner Methode doch so sehr verkennen.
Wenn zur Rechtfertigung solcher Bestrebungen angeführt wird, dass es die Aufgabe unserer Zeit sei, den Zusammenhang aller Wissenschaften und die Einheit ihrer höchsten Principien festzustellen, so möchten wir den Beruf unserer Zeit zur Lösung dieses Problems denn doch in Frage stellen. Nie werden, so glauben wir, die Forscher auf den verschiedenen Gebieten der Wissenschaft dies gemeinsame Endziel ihrer Bestrebungen ohne Nachtheil aus dem Auge verlieren, mit Erfolg wird jedoch an die Lösung dieser Aufgabe erst dann geschritten werden können, wenn die einzelnen Wissensgebiete auf das Sorgfältigste durchforscht und die ihnen eigenthümlichen Gesetze gefunden sein werden.
Zu welchen Resultaten uns die obige Methode der Forschung geführt hat und ob es uns gelungen ist, durch den Erfolg darzuthun, dass die Erscheinungen des wirthschaftlichen Lebens sich strenge nach Gesetzen regeln, gleich jenen der Natur, dies zu beurtheilen ist nun Sache unserer Leser. Verwahren möchten wir uns nur gegen die Meinung Jener, welche die Gesetzmässigkeit der volkswirthschaftlichen Erscheinungen mit dem Hinweise auf die Willensfreiheit des Menschen läugnen, weil hiedurch die Volkswirthschaftslehre als exacte Wissenschaft überhaupt negirt wird.
[ix]
Ob und unter welchen Bedingungen ein Ding mir nützlich, ob und unter welchen Bedingungen es ein Gut, ob und unter welchen Bedingungen es ein wirthschaftliches Gut ist, ob und unter welchen Bedingungen dasselbe Werth für mich hat, und wie gross das Mass dieses Werthes für mich ist, ob und unter welchen Bedingungen ein ökonomischer Austausch von Gütern zwischen zwei wirthschaftenden Subjecten statthaben, und die Grenzen, innerhalb welcher die Preisbildung hiebei erfolgen kann u. s. f., all' dies ist von meinem Willen ebenso unabhängig, wie ein Gesetz der Chemie von dem Willen des practischen Chemikers. Die obige Ansicht beruht demnach auf einem leicht ersichtlichen Irrthume über das eigentliche Gebiet unserer Wissenschaft. Die theoretische Volkswirthschaftslehre be schäftigt sich nicht mit praktischen Vorschlägen für das wirthschaftliche Handeln, sondern mit den Bedingungen, unter welchen die Menschen die auf die Befriedigung ihrer Bedürfnisse gerichtete vorsorgliche Thätigkeit entfalten.
Die theoretische Volkswirthschaftslehre verhält sich zu der practischen Thätigkeit der wirthschaftenden Menschen somit nicht anders, als etwa die Chemie zur Thätigkeit des practischen Chemikers, und der Hinweis auf die Freiheit des menschlichen Willens kann wohl als ein Einwand gegen die volle Gesetzmässigkeit der wirthschaftlichen Handlungen, niemals aber als ein solcher gegen die Gesetzmässigkeit der von dem menschlichen Willen gänzlich unabhängigen Erscheinungen gelten, welche den Erfolg der wirthschaftlichen Thätigkeit der Menschen bedingen. Es sind aber eben diese Letzteren der Gegenstand unserer Wissenschaft.
Eine besondere Aufmerksamkeit haben wir der Erforschung des ursächlichen Zusammenhanges zwischen [x] den wirthschaftlichen Erscheinungen an den Producten und den bezüglichen Productions-Elementen zugewandt und zwar nicht nur wegen der Feststellung einer der Natur der Dinge entsprechenden, alle Preiserscheinungen (somit auch den Kapitalzins, den Arbeitslohn, den Grundzins u. s. f.) unter einem einheitlichen Gesichtspunkte zusammenfassenden Preistheorie, sondern auch wegen der wichtigen Aufschlüsse, welche wir hiedurch über manche andere bisher völlig unbegriffene wirthschaftliche Vorgänge erhalten. Es ist aber eben dieses Gebiet unserer Wissenschaft dasjenige, auf welchem die Gesetzmässigkeit der Erscheinungen des wirthschaftlichen Lebens am deutlichsten zu Tage tritt.
Eine besondere Freude war es uns, dass das hier von uns bearbeitete, die allgemeinsten Lehren unserer Wissenschaft umfassende Gebiet zum nicht geringen Theile so recht eigentlich das Besitzthum der neueren Lntwickelungen der deutschen National-Oekonomie ist und die hier versuchte Reform der höchsten Principien unserer Wissenschaft demnach auf der Grundlage von Vorarbeiten erfolgt, welche fast ausnahmslos deutscher Forscherfleiss geschaffen hat.
Möge diese Schrift desshalb auch als ein freundlicher Gruss eines Mitstrebenden aus Oesterreich betrachtet werden, als ein schwacher Widerhall der wissenschaftlichen Anregungen, welche uns Oesterreichern von Deutschland aus durch so viele ausgezeichnete Gelehrte, die es uns sandte, und durch seine vortrefflichen Schriften in so reichlichem Masse zu Theil geworden sind.
Dr. Carl Menger.
[1]
Erstes Capitel.
Die allgemeine Lehre vom Gute.↩
§. 1.
Ueber das Wesen der Güter.
Alle Dinge stehen unter dem Gesetze von Ursache und Wirkung. Dieses grosse Princip hat keine Ausnahme und vergebens würden wir im Bereiche der Empirie nach einem Beispiele von seinem Gegentheile suchen. Die fortschreitende menschliche Entwicklung hat nicht die Tendenz, dies Princip zu erschüttern, sondern vielmehr den Erfolg, dasselbe zu befestigen, die Erkenntniss des Gebietes seiner Geltung immer mehr zu erweitern und die unerschütterte und wachsende Anerkennung desselben ist somit geknüpft an den menschlichen Fortschritt.
Auch unsere eigene Persönlichkeit und jeder Zustand derselben sind Glieder dieses grossen Weltzusammenhanges und der Uebergang unserer Person aus einem Zustande in emen hievon verschiedenen ist in anderer Weise undenkbar, als unter dem Gesetze der Causalität. Wenn demnach unsere Person aus dem Zustande des Bedürfens in jenen des befriedigten Bedürfnisses treten soll, so müssen ausreichende Ursachen hiefür vorhanden sein, das ist, es müssen entweder die in unserem Organismus waltenden Krüfte unseren gestörten Zustand beseitigen, oder aber äussere Dinge auf uns einwirken, welche ihrer Natur nach geeignet sind, jenen Zustand herbeizuführen, welchen wir die Befriedigung unserer Bedürfnisse nennen.
Diejenigen Dinge, welche die Tauglichkeit haben, in Causal-Zusammenhang [2] mit der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse gesetzt zu werden, nennen wir Nützlichkeiten, wofern wir diesen Causal-Zusammenhang aber erkennen und es zugleich in unserer Macht haben, die in Rede stehenden Dinge zur Befriedigung unserer Bedürfnisse thatsächlich heranzuziehen, nennen wir sie Güter [1].
[3]
Damit ein Ding ein Gut werde, oder mit andern Worten, damit es die Güterqualität erlange, ist demnach das Zusammentreffen folgender vier Voraussetzungen erforderlich:
1. Ein menschliches Bedürfniss.
2. Solche Eigenschaften des Dinges, welche es tauglich machen, in ursächlichen Zusammenhang mit der Befriedigung dieses Bedürfnisses gesetzt zu werden.
3. Die Erkenntniss dieses Causal-Zusammenhanges Seitens der Menschen.
4. Die Verfügung über dies Ding, so zwar, dass es zur Befriedigung jenes Bedürfnisses thatsächlich herangezogen werden kann.
Nur wo diese Voraussetzungen zusammentreffen, kann ein Ding zum Gute werden, wo immer aber auch nur eine derselben mangelt, kann kein Ding die Güterqualität erlangen; besässe es aber bereits dieselbe, so müsste sie doch sofort verloren gehen, wenn auch nur eine jener vier Voraussetzungen entfallen würde [2].
Es verliert demnach ein Ding seine Güterqualität, erstens, wenn durch eine Veränderung im Bereiche der menschlichen Bedürfnisse der Erfolg herbeigeführt wird, dass kein Bedürfniss, zu dessen Befriedigung jenes Ding die Tauglichkeit hat, vorhanden ist.
Der gleiche Erfolg tritt, zweitens, überall dort ein, wo durch eine Veränderung in den Eigenschaften eines Dinges die Tauglichkeit desselben, in ursachlichen Zusammenhang mit der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse gesetzt zu werden, verloren geht.
Die Güterqualität eines Dinges geht, drittens, dadurch verloren, dass die Erkenntniss des ursächlichen Zusammenhanges zwischen demselben und der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse untergeht.
Viertens büsst endlich ein Gut seine Güterqualität ein, wenn die Menschen die Verfügung über dasselbe verlieren, so [4] zwar, dass sie es zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse weder unmittelbar heranziehen können, noch auch die Mittel besitzen, um dasselbe wieder in ihre Gewalt zu bringen.
Ein eigenthümliches Verhältniss ist überall dort zu beobachten, wo Dinge, die in keinerlei ursächlichem Zusammenhange mit der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse gesetzt werden können, von den Menschen nichts destoweniger als Güter behandelt werden. Dieser Erfolg tritt ein, wenn Dingen irrthülicherweise Eigenschaften, und somit Wirkungen zugeschrieben werden, die ihnen in Wahrheit nicht zukommen, oder aber menschliche Bedürfnisse irrthümlicherweise vorausgesetzt werden, die in Wahrheit nicht vorhanden sind. In beiden Fällen liegen demnach unserer Beurtheilung Dinge vor, die zwar nicht in der Wirklichkeit, wohl aber in der Meinung der Menschen in jenem eben dargelegten Verhaltnisse stehen, wodurch die Güterqualität der Dinge begründet wird. Zu den Dingen der ersteren Art gehören die meisten Schönheitsmittel, die Amulette, die Mehrzahl der Medicamente, welche den Kranken bei tief stehender Cultur, bei rohen Völkern auch noch in der Gegenwart gereicht werden, Wünschelruthen, Liebestränke u. dgl. m., denn alle diese Dinge sind untauglich, diejenigen menschlichen Bedürfnisse, welchen durch dieselben genügt werden soll, in der Wirklichkeit zu be friedigen. Zu den Dingen der zweiten Art gehören Medicamente für Krankheiten, die in Wahrheit gar nicht bestehen, die Geräthschaften, Bildsäulen, Gebäude etc. wie sie von heidnischen Völkern für ihren Götzendienst verwandt werden, Folterwerkzeuge u. dgl. m. Solche Dinge nun, welche ihre Güterqualität lediglich aus eingebildeten Eigenschaften derselben, oder aber aus eingebildeten Bedürfnissen der Menschen herleiten, kann man füglich auch eingebildete Güter nennen [3].
Je höher die Cultur bei einem Volke steigt, und je tiefer die Menschen das wahre Wesen der Dinge und ihrer eigenen Natur erforschen, um so grösser wird die Zahl der wahren, um so geringer, wie begreiflich, die Zahl der eingebildeten Güter, und es ist kein geringer Beweis für den Zusammenhang zwischen [5] wahrer Erkenntniss, das ist, zwischen Wissen und Wohlfahrt der Menschen, dass erfahrungsmässig bei denjenigen Völkern, welche an wahren Gütern die ärmsten sind, die Zahl der sogenannten eingebildeten Güter die grösste zu sein pflegt.
Von einem eigenthümlichen wissenschaftlichen Interesse sind noch jene Güter, welche von einigen Bearbeitern unserer Wissenschaft unter der Bezeichnung „Verhältnisse“ als eine besondere Güter-Kategorie zusammengefasst werden. Es werden hiezu Firmen, Kundschaften, Monopole, Verlagsrechte, Patente, Realgewerberechte, Autorrechte, von einigen Schriftstellern auch die Verhältnisse der Familie, der Freundschaft, der Liebe, kirchliche und wissenschaftliche Gemeinschaften u. s. f. gerechnet. Dass ein Theil dieser Verhältnisse die strenge Prüfung derselben auf ihre Güterqualität nicht zulässt, mag immerhin zugestanden werden, dass aber ein anderer Theil, z. B. Firmen, Monopole und Verlagsrechte, Kundenkreise und dergleichen Dinge mehr, thatsächlich Güter sind, dafür spricht schon der Umstand, dass wir denselben in zahlreichen Fällen im Verkehre begegnen. Wenn nichts destoweniger derjenige Theoretiker, welcher sich am eingehendsten mit diesem Gegenstand beschäftigt hat [4], zugesteht, [6] dass die Existenz dieser Verhältnisse als Güter etwas Auffälliges an sich habe und dem unbefangenen Auge wie eine Anomalie erscheine, so liegt der Grund hievon, wie ich glaube, in der That etwas tiefer, als in dem unbewusst auch hier wirkenden realistischen Zuge unserer Zeit, welche nur Stoffe und Kräfte (Sachgüter und Arbeitsleistungen) als Dinge, und somit auch nur solche als Güter anerkennt.
Es ist von juristischer Seite schon mehrfach hervorgehoben worden, dass unsere Sprache keinen Ausdruck für „nützliche Handlungen“ im Allgemeinen, sondern nur einen solchen für „Arbeitsleistungen“ habe. Nun giebt es aber eine Reihe von Handlungen, ja selbst von blossen Unterlassungen, welche, ohne dass man sie Arbeitsleistungen nennen kann, doch für bestimmte Personen entschieden nützlich sind, ja einen sehr bedeutenden wirthschaftlichen Werth haben. Der Umstand, dass Jemand bei mir seine Waaren einkauft, oder meine Dienste als Advocat in Anspruch nimmt, ist sicherlich keine Arbeitsleistung desselben, aber eine mir nützliche Handlung, und der Umstand, dass ein wohlhabender Arzt, der in einem kleinen Landstädtchen wohnt, wo sich ausser ihm nur noch ein anderer Arzt befindet, die Praxis auszuüben unterlässt, ist noch viel weniger eine Arbeitsleistung des Ersteren zu nennen, aber jedenfalls eine für den Letzteren, der hierdurch zum Monopolisten wird, sehr nützliche Unterlassung. Der Umstand, dass eine grössere oder kleinere Anzahl von Personen (z. B. eine Anzahl von Kunden) solche irgend einer Person (z. B. einem Krämer) nützliche Handlungen regelmässig ausübt, verändert die Natur dieser letzteren nicht, so wie der Umstand, dass von Seiten einiger oder sämmtlicher Bewohner eines Ortes, beziehungsweise eines Staates, gewisse einer Person nützliche Unterlassungen freiwillig oder durch rechtlichen Zwang erfolgen (natürliche oder rechtliche Monopole, Verlagsrechte, Markenschutz etc.), die Natur dieser nützlichen Unterlassungen durchaus nicht ändert. Was man demnach Kunden-Kreise, Publicum, Monopole etc. nennt, sind, vom wirthschaftlichen Standpunkte aus betrachtet, nützliche Handlungen, beziehungsweise Unterlassungen anderer Personen, oder aber, wie dies zum Beispiel bei Firmen der Fall zu sein pflegt, Gesammtheiten von Sachgütern, Arbeitsleistungen und sonstigen nützlichen Handlungen, [7] beziehungsweise Unterlassungen. Selbst Freundschafts- und Liebesverhältnisse, religiöse Gemeinschaften u. dgl. m. bestehen offenbar in solchen uns nützlichen Handlungen oder Unterlassungen anderer Personen. Sind nun diese nützlichen Handlungen oder Unterlassungen derart, dass wir über dieselben verfügen können, wie dies zum Beispiel bei Kundenkreisen, Firmen, Monopolrechten etc. thatsächlich der Fall ist, so ist kein Grund zu erkennen, weshalb wir denselben die Güterqualität nicht zuerkennen sollten, ohne doch zu dem dunkeln Begriffe der „Verhältnisse“ greifen und diese letztern den übrigen Gütern als eine besondere Kategorie entgegenstellen zu müssen. Ich glaube vielmehr, dass die Gesammtheit der Güter sich in die beiden Kategorien der Sachgüter (einschliesslich aller Naturkräfte, so weit sie Güter sind) und in nützliche menschliche Handlungen (beziehungsweise Unterlassungen), deren wichtigste die Arbeitsleistungen sind, einordnen lassen.
§. 2.
Ueber den Causal-Zusammenhang der Güter.
Es scheint mir nun vor Allem von der höchsten Wichtigkeit zu sein, dass man in unserer Wissenschaft sich klar werde über den ursächlichen Zusammenhang der Güter; denn wie in allen anderen Wissenschaften, so wird auch in der unseren der wahre und dauernde Fortschritt erst dann beginnen, wenn wir die Objecte unserer wissenschaftlichen Beobachtung nicht mehr lediglich als vereinzelte Erscheinungen betrachten, sondern uns bemühen werden, den Causal-Zusammenhang derselben zu erforschen und die Gesetze, unter welchen sie stehen. Das Brot, das wir geniessen, das Mehl, aus welchen wir das Br ot bereiten, das Getreide, das wir zu Mehl vermahlen, der Acker, auf welchem das Getreide wächst, alle diese Dinge sind Güter. Es ist diese Erkenntniss jedoch für unsere Wissenschaft nicht ausreichend, vielmehr ist es nothwendig, dass wir, wie dies in allen übrigen Erfahrungswissenschaften geschehen ist, uns bemühen, die Güter nach inneren Gründen zu ordnen, die Stelle kennen zu lernen welche jedes derselben in dem Causalnexus der Güter einnimmt und schliesslich die Gesetze zu erforschen, unter welchen sie in dieser Rücksicht stehen.
[8]
Unsere Wohlfahrt, so weit dieselbe von der Befriedigung unserer Bedürfnisse abhängt, ist gesichert, wenn wir jeweilig über die zur unmittelbaren Befriedigung derselben nöthigen Güter verfügen. Besitzen wir z. B. die nöthige Quantität Brot, so haben wir es unmittelbar in unserer Gewalt, unser Nahrungsbedürfniss zu stillen; der ursächliche Zusammenhang zwischen dem Brote und der Befriedigung eines unserer Bedürfnisse ist demnach ein unmittelbarer und die Prüfung der Güterqualität desselben nach den von uns im vorigen Capitel dargelegten Grundsätzen ohne jede Schwierigkeit. Einer gleichen Beurtheilung unterliegen nun aber auch alle übrigen Güter, die wir unmittelbar zur Befriedigung unserer Bedürfnisse zu verwenden vermögen, gleichwie die Getränke, die Kleidungsstücke, die Schmuckgegenstände u. dgl. m.
Der Kreis der Dinge, deren Güterqualität wir anerkennen, ist jedoch hiemit nicht abgeschlossen. Neben diesen Gütern, die wir um der Kürze des Ausdruckes willen im weiterea Verlauf der Darstellung: „Güter der ersten Ordnung“ nennen werden, begegnen wir vielmehr in der Wirthschaft der Menschen einer grossen Anzahl anderer Dinge, die in keinerlei unmittelbaren Causal-Zusammenhang mit der Befriedigung unserer Bedürfnisse gesetzt werden können, und deren Güterqualität doch nicht minder feststeht als jene der Güter erster Orduung. So sehen wir auf unseren Märkten neben dem Brote, und unter anderen zur unmittelbaren Befriedigung menschlicher Bedürfnisse tauglichen Gütern, auch Quantitäten von Mehl, Brennstoffen, Salz; wir sehen auch die Vorrichtungen und Werkzeuge zur Broterzeugung im Verkehre stehen und nicht minder die qualificirten Arbeitsleistungen, die hiebei erforderlich sind. Alle diese Dinge, oder doch die weitaus grössere Mehrzahl dersolben, sind untauglich, menschliche Bedürfnisse in unmittelbarer Weise zu befriedigen; denn welches menschliche Bedürfniss liesse sich mit der specifischen Arbeitsleistung eines Bäckergesellen, mit einer Backvorrichtung und selbst mit einer Quantität rohen Mehles in unmittelbarer Weise befriedigen? Wenn nun diese Dinge nichts destoweniger in der menschlichen Wirthschaft ebensowohl als Güter behandelt werden, wie die Güter erster Ordnung, so findet dies seine Begründung darin, dass sie zur Hervorbringung [9] von Brot und andern Gütern erster Ordnung dienen und solcher Art—obzwar der Regel nach untauglich, menschliche Bedürfnisse in unmittelbarer Weise zu befriedigen—doch mittelbar hiezu geeignet sind. In gleicher Weise verhält es sich aber mit tausend anderen Dingen, die ohne die Tauglichkeit zu besitzen, in unmittelbarer Weise menschliche Bedürfnisse zu befriedigen, doch zur Hervorbringung von Gütern erster Ordnung dienen und so in einen mittelbaren Causal-Zusammenhang mit der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse gesetzt werden können. Es ist aber damit zugleich auch dargethan, dass das Verhätniss, welches die Güterqualität dieser und ähnlicher Dinge, die wir Güter zweiter Ordnung nennen, begründet, seinem Wesen nach ganz dasselbe ist, wie das der Güter erster Ordnung, denn der hier obwaltende Unterschied, dass die Güter erster Ordnung in unmittelbarer, die Güter zweiter Ordnung aber in mittelbarer Causal-Beziehung zur Befriedigung unserer Bedürfnisse stehen, bewirkt keinen Unterschied in dem Wesen jenes Verhältnisses, weil die Voraussetzung der Güterqualität wohl der Causal-Zusammenhang, nicht aber nothwendigerweise der unvermittelte Causalnexus zwischen den Dingen und der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse ist.
Es wäre nun leicht, zu zeigen, dass auch mit diesen Gütern der Kreis der Dinge, deren Güterqualität wir anerkennen, nicht abgeschlossen ist und dass, um bei dem oben gewählten Beispiele zu bleiben, sich uns Getreidemühlen, Weizen, Roggen, die bei der Erzeugung des Mehles in Verwendung kommenden Arbeitsleistungen u. s. f. als Güter dritter; Getreideäcker, die zur Bearbeitung derselben erforderlichen Werkzeuge und Vorrichtungen, die specifischen Arbeitsleistungen der Landleute, als Güter vierter Ordnung darstellen. Ich glaube indess, dass der Gedanke, der hier zum Ausdruck gelangen soll, bereits genügend ersichtlich ist.
Wir haben im vorigen Abschnitte gesehen, dass die ursächliche Beziehung eines Dinges zu der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse eine der Vorbedinguugen der Güterqualität ist. Der Gedanke, den wir in diesem Abschnitte darzulegen bemüht waren, lässt sich nun dahin zusammenfassen, dass es keine Voraussetzung der Güterqualität eines Dinges ist, dass es im unmittelbaren [10] Causal-Zusammenhang mit der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse gesetzt werden könne. Es ist aber auch zugleich gezeigt worden, dass unter den Gütern, die in einem so vermittelten Verhältnisse zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse stehen, ein allerdings das Wesen ihrer Güterqualität nicht berührender Unterschied obwaltet, indem dieselben bald in einer näheren, bald in einer entfernteren ursächlichen Beziehung zur Befriedigung unserer Bedürfnisse stehen, und wir haben in Rücksicht hierauf: Güter erster, zweiter, dritter, vierter Ordnung u. s. w. unterschieden.
Auch hier ist es jedoch nöthig, dass wir uns von vorneherein gegen eine fehlerhafte Auffassung des Gesagten versichern. Wir haben schon dort, wo wir von der Güterqualität überhaupt sprachen, darauf hingewiesen, dass diese keine den Gütern anhaftende Eigenschaft sei. Dieselbe Erinnerung muss nun auch hier gemacht werden, wo es sich um die Ordnung handelt, welche ein Gut im Causalnexus der Güter einnimmt. Auch diese zeigt nur an, dass ein Gut sich mit Rücksicht auf eine bestimmte Verwendung desselben in einer bald näheren, bald entfernteren ursächlichen Beziehung zur Befriedigung eines menschlichen Bedürfnisses befinde und ist demnach nichts dem Gute Anhaftendes am wenigsten eine Eigenschaft desselben.
Nicht die Ordnungsziffern sind es denn auch, auf welche wir hier, sowie in der nachfolgenden Darstellung der Gesetze, unter welchen die Güter stehen, das Gewicht legen, obzwar dieselben uns hiebei, wofern sie richtig verstanden werden, ein erwünschtes Hilfsmittel bei Darlegung eines ebenso schwierigen, als wichtigen Gegenstandes darbieten werden; das, worauf wir aber insbesondere Gewicht legen, ist der Einblick in den Causal-Zusammenhang zwischen den Gütern und der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse und die je nach der Bestimmung der ersteren, mehr oder minder vermittelte ursächliche Beziehung derselben zu dieser letzteren.
[11]
§. 3.
Die Gesetze, unter welchen die Güter in Rücksicht auf ihre Güterqualität stehen.
a. (Die Güter höherer Ordnung sind in ihrer Guterqualität dadurch bedingt, dass wir auch über die entsprechenden complemtaren Güter verfügen.)
Verfügen wir über Güter erster Ordnung, so liegt es in unserer Macht, dieselben unmittelbar zur Befriedigung unserer Bedürfnisse zu verwenden. Verfügen wir über die entsprechenden Güter zweiter Ordnung, so liegt es in unserer Macht, dieselben in Güter erster Ordnung umzugestalten, und in so vermittelter Weise der Befriedigung unserer Bedürfnisse zuzuführen. Verfügen wir aber auch nur über Güter dritter Ordnung, so haben wir es in unserer Macht, dieselben in die entsprechenden Güter zweiter Ordnung, diese aber wieder in die entsprechenden Güter erster Ordnung umzugestalten, und so die Güter dritter Ordnung, allerdings in einer mehrfach vermittelten Weise, zur Befriedigung unserer Bedürfnisse heranzuziehen. In gleicher Weise verhält es sich nun mit allen Gütern höherer Ordnung, und wir können an ihrer Güterqualität nicht zweifeln, wofern wir es nur in unserer Macht haben, dieselben der Befriedigung unserer Bedürfnisse thatsächlich zuzuführen.
In diesem letzten Umstande liegt aber, mit Rücksicht auf die Güter höherer Ordnung, eine Beschränkung von nicht geringer Wichtigkeit. Es steht namlich durchaus nicht in unserer Macht, ein einzelnes Gut höherer Ordnung zur Befriedigung unserer Bedürfnisse heranzuziehen, wofern wir nicht zugleich über die übrigen (die complementären) Güter höherer Ordnung verfügen.
Setzen wir zum Beispiele den Fall, es verfüge ein wirthschaftendes Individuum zwar nicht unmittelbar über Brot, wohl aber über sämmtliche zur Erzeugung desselben nöthigen Güter zweiter Ordnung, so ist kein Zweifel, dass dasselbe nichtsdestoweniger es in seiner Macht hatte, sein Bedürfniss nach Brotnahrung zu befriedigen. Setzen wir nun aber den Fall, dasselbe Subject würde wohl über Mehl, über Salz, über die nöthigen Gährstoffe, die bei der Broterzeugung erforderlichen Arbeitsleistungen und selbst über sämmtliche hier erforderliche Vorrichtungen [12] und Werkzeuge, aber über keinerlei Feuerung und über kein Wasser verfügen, so ist klar, dass dasselbe in diesem Falle nicht mehr die Macht hätte, die obigen Güter zweiter Ordnung zur Befriedigung seines Bedürfnisses nach Brotnahrung heranzuziehen, denn ohne Feuerung und ohne Wasser kann kein Brot bereitet werden, selbst wenn man über alle übrigen hiezu erforderlichen Güter verfügt. Es würden demnach in diesem Falle die Güter zweiter Ordnung, in Rücksicht auf das Bedürfniss nach Brotnahrung, sofort ihre Güterqualität einbüssen, da eine der vier Voraussetzungen derselben (in diesem Fall die vierte Voraussetzung) mangeln würde.
Damit wäre durchaus nicht ausgeschlossen, dass die Dinge, deren Güterqualität hier in Frage ist, selbst unter den obigen Verhältnissen ihre Güterqualität mit Rücksicht auf andere Bedürfnisse jenes Individuums, in dessen Verfügung sie sich befinden, aufrecht erhalten könnten, in sofern dasselbe die Macht besässe, diese Güter zur Befriedigung anderer Bedürfnisse als jenes nach Brotnahrung heranzuziehen, oder aber trotz des Mangels des einen oder des anderen complementären Gutes doch die übrigen auch für sich geeignet wären, ein menschliches Bedürfniss in mittelbarer oder unmittelbarer Weise zu befriedigen. Würden aber die vorhandenen Güter zweiter Ordnung wegen des Mangels an einem oder mehreren complementären Gütern weder für sich allein, noch aber in Verbindung mit anderen verfügbaren Gütern zur Befriedigung irgend eines menschlichen Bedürfnisses herangezogen werden können, so würden jene Güter allerdings durch den Mangel der complementären Güter allein schon ihre Güterqualität vollständig einbüssen, denn die wirthschaftenden Menschen besässen dann nicht weiter die Gewalt, sie zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse heranzuziehen und es entfiele somit eine der wesentlichen Voraussetzungen der Güterqualität.
Als Resultat unserer bisherigen Untersuchung ergiebt sich demnach vorerst der Satz, dass die Güter zweiter Ordnung in ihrer Güterqualität dadurch bedingt sind, dass zugleich die complementaren Güter derselben Ordnung zum mindesten mit Rücksicht auf die Hervorbringung irgend eines Gutes erster Ordnung der menschlichen Verfügung unterworfen sind.
[13]
Mehr Schwierigkeit bietet die Beurtheilung der Frage, in wiefern auch die Güter höherer als der zweiten Ordnung in ihrer Güterqualität dadurch bedingt seien, dass die complementären Güter der Verfügung der Menschen unterworfen sind. Diese Schwierigkeit liegt nun aber durchaus nicht in dem Verhältniss der Güter höherer zu den entsprechenden Gütern der nächst niederen Ordnung, also z. B. der Güter dritter Ordnung zu den entsprechenden Güter der zweiten, der Güter der fünften Ordnung zu jenen der vierten, denn die blosse Betrachtung des Causal-Verhältnisses zwischen diesen Gütern ergibt eine vollständige Analogie desselben mit dem so eben dargelegten Verhältnisse der Güter zweiter Ordnung zu den entsprechenden Gütern der nächst niederen, das ist der ersten Ordnung, so zwar, dass sich der obige Grundsatz in ganz natürlicher Weise zu dem Satz erweitert, dass die Güter höherer Ordnung in ihrer Güterqualität zunächst dadurch bedingt sind, dass der Verfügung der Menschen auch die complementären Güter derselben Ordnung zum mindesten mit Rücksicht auf die Hervorbringung irgend eines Gutes der nächst niederen Ordnung unterstehen.
Die Schwierigkeit, von der wir bei den Gütern höherer, als zweiter Ordnung sprachen, liegt vielmehr darin, dass selbst die Verfügung über sämmtliche zur Hervorbringung eines Gutes der nächst niederen Ordnung, erforderliche Güter diesen nicht nothwendigerweise die Güterqualität sichert, wofern nicht die Menschen zugleich auch noch über die sämmtlichen complementären Güter dieser letzten Ordnung und aller niederen Ordnungen zu verfügen vermögen. Setzen wir den Fall, dass Jemand über sämmtliche Güter dritter Ordnung verfügen könnte, die erforderlich sind, um ein Gut zweiter Ordnung herzustellen, nicht aber zugleich über die übrigen complementären Güter zweiter Ordnung, so würde ihm selbst die Verfügung über sämmtliche, zur Hervorbringung eines einzelnen Gutes zweiter Ordnung erforderlichen Güter dritter Ordnung nicht die Macht gewähren, dieselben thatsächlich der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse zuzuführen, denn er hätte wohl die Macht, die Güter dritter Ordnung (deren Güterqualität hier in Frage ist) zu Gütern zweiter Ordnung, nicht aber auch die Macht, jene Güter [14] zweiter Ordnung in die entsprechenden Güter erster Ordnung umzugestalten. Er hätte demnach auch nicht die Macht, die in Rede stehenden Güter dritter Ordnung der Befriedigung seiner Bedürfnisse zuzuführen und es würden beim Eintritte eines solchen Verhältnisses jene Güter sofort ihre Güterqualität einbüssen.
Es leuchtet somit ein, dass der oben ausgesprochene Grundsatz: „Die Güter höherer Ordnung sind in ihrer Güterqualität zunächst dadurch bedingt, dass der Verfügung der Menschen auch die complementären Güter derselben Ordnung zum mindesten zum Zwecke der Hervorbringung irgend eines Gutes der nächst niederen Ordnung unterstehen,“ nicht die ganze Summe der Voraussetzungen umfasst, welche in Bezug auf die Güterqualität der Dinge daraus entspringen, dass nur die Verfügung über die complementären Güter höherer Ordnung uns die Macht gewährt, dieselben zur Befriedigung unserer Bedürfnisse heranzuziehen. Wenn wir über Güter dritter Ordnung verfügen, so ist ihre Güterqualität allerdings zunächst dadurch bedingt, dass wir dieselben zu Gütern zweiter Ordnung gestalten können, eine weitere Bedingung ihrer Güterqualität liegt aber dann noch darin, dass wir es in unserer Macht haben, die Güter zweiter Ordnung zu Gütern erster Ordnung zu gestalten, was die Verfügung über gewisse complementäre Güter zweiter Ordnung zur weiteren Voraussetzung hat.
In ganz analoger Weise stellt sich das Verhältniss bei den Gütern vierter, fünfter und höherer Ordnung dar. Auch hier ist die Güterqualität der in so entfernter Beziehung zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse stehenden Dinge zunächst dadurch bedingt, dass wir über die complementären Güter derselben Ordnung verfügen; die Güterqualität derselben ist aber dann auch noch dadurch bedingt, dass wir auch über die complementären Güter der nächst niederen Ordnung, ferner über die complementären Güter der hierauf folgenden Ordnung verfügen u. s. w., so zwar, dass wir es thatsächlich in unserer Macht haben, jene Güter höherer Ordnung zur Hervorbringung eines Gutes erster Ordnung und in letzter Reihe zur Befriedigung eines menschlichen Bedürfnisses heranzuziehen. Nennt man die Gesammtheit der Güter, welche erforderlich sind, um ein Gut [15] höherer Ordnung zur Hervorbringung eines Gutes erster Ordnung heranzuziehen, dessen complementare Güter im weiteren Sinne des Wortes, so ergibt sich demnach der allgemeine Grundsatz, dass die Güterqualität der Güter höherer Ordnung dadurch bedingt ist, dass wir über deren complementäre Güter im obigen Sinne des Wortes zu verfügen vermögen.
Nichts vermag uns den grossen ursächlichen Zusammenhang der Güter lebendiger vor die Augen zu stellen, als dieses Gesetz der gegenseitigen Bedingtheit der Güter.
Als im Jahre 1862 der nordamerikanische Bürgerkrieg Europa die wichtigste Bezugsquelle von Baumwolle verschloss, ging auch die Güterqualität tausend anderer Güter, deren complementäres Gut jene Baumwolle war, verloren. Ich meine die Arbeitsleistungen der englischen und continentalen in der Baumwollfabrication thätig gewesenen Arbeiter, die nunmehr zum grossen Theile feiern und die öffentliche Mildthätigkeit in Anspruch nehmen mussten. Die Arbeitsleistungen, (über welche diese tüchtigen Arbeiter verfügen konnten,) waren die gleichen geblieben und doch verloren dieselben in grossen Quantitäten ihre Güterqualität, denn das complementäre Gut, die Baumwolle, blieb aus, und die specifischen Arbeitsleistungen konnten für sich im Grossen und Ganzen zur Befriedigung keines menschlichen Bedürfnisses herangezogen werden. Es wurden diese Arbeitsleistungen aber sofort wieder Güter, als das complementäre Gut derselben, das ist die nothige Baumwolle, zum Theile durch gesteigerte Zufuhr aus andern Bezugsorten, zum Theile nach Beendigung des amerikanischen Bürgerkrieges auch aus der alten Bezugsquelle wieder disponibel wurde.
Umgekehrt verlieren nicht selten Güter ihre Güterqualität dadurch, dass die nöthigen Arbeitsleistungen, die zu ihnen in dem Verhältniss von complementären Gütern stehen, der Verfügung der Menschen nicht unterworfen sind. In Ländern mit dünner Bevölkerung und zumal in solchen, in welchen vorwiegend eine einzelne Gattung von Culturpflanzen, z. B. Weizen, gebaut wird, pflegt nach besonders reichen Ernten ein sehr grosser Mangel an Arbeitsleistungen zu entstehen, indem die ländlichen Arbeiter, an und für sich in geringer Anzahl vorhanden, in [16] Zeiten des Ueberflusses zumeist noch zur Arbeit eine geringe Nöthigung finden und die Erntearbeiten wegen des einseitigen Weizenbaues auf einen sehr kurzen Zeitraum zusammengedrängt sind. Unter solchen Verhältnissen (z. B. in den fruchtbaren Ebenen Ungarns), wo der Bedarf an Arbeitsleistungen innerhalb eines kurzen Zeitraumes ein sehr grosser ist, die verfügbaren Arbeitsleistungen aber nicht ausreichen, pflegen grosse Quantitäten Getreide auf den Feldern zu verderben; der Grund hievon liegt aber darin, dass die complementären Güter der auf den Feldern stehenden Früchte, (die zu ihrer Einbringung nöthigen Arbeitsleistungen,) mangeln, und so jene Feldfrüchte selbst ihre Güterqualität einbüssen.
Wenn die wirthschaftlichen Verhältnisse eines Volkes hoch entwickelt sind, so sind der Regel nach die verschiedenen complementären Güter höherer Ordnung in den Händen verschiedener Personen. Die Producenten jedes einzelnen Artikels führen der Regel nach in mechanischer Weise ihr Geschäft fort, während die Producenten der complementären Güter ebensowenig sich es in den Sinn kommen lassen, dass die Güterqualität der Dinge, die sie produciren oder verarbeiten, durch das Vorhandensein anderer Güter bedingt sei, die sich gar nicht in ihrem Besitze befinden, und es kann der Irrthum, dass die Güter höherer Ordnung auch für sich und ohne alle Rücksicht auf das Vorhandensein complementärer Güter die Güterqualität besitzen, in der That am leichtesten in Ländern entstehen, wo durch einen regen Verkehr und eine hochentwickelte Volkswirthschaft fast jedes Product unter der stillschweigenden, ja der Regel nach dem Producenten gar nicht bewussten Voraussetzung entsteht, dass andere mit ihm durch Verkehr verbundene Personen für die complementären Güter rechtzeitig vorsorgen werden. Erst wenn diese stillschweigende Voraussetzung bei einem Wechsel der Verhältnisse nicht zutrifft, und die Gesetze, unter welchen die Güter stehen, ihre Einwirkung bis auf die Oberfläche der Erscheinungen erstrecken, pflegt dann der gewohnte mechanische Geschäftsbetrieb unterbrochen zu werden, und die öffentliche Aufmerksamkeit sich solchen Erscheinungen und ihren tiefer liegenden Ursachen zuzuwenden.
[17]
b. (Die Güter höherer Ordnung sind in ihrer Güterqualität durch jene der entsprechenden Güter niederer Ordnung bedingt.)
Die Beobachtung des Wesens und des Causal-Zusammenhanges der Güter, wie wir dieselben in den beiden ersten Abschnitten dargelegt haben, führt uns zur Erkenntniss eines weiteren Gesetzes, unter welchem die Güter als solche, das ist ohne Rücksicht auf ihren ökonomischen Charakter, stehen.
Wir haben gezeigt, dass das Vorhandensein von menschlichen Bedürfnissen eine der wesentlichen Voraussetzungen der Güterqualität ist, und dass im Falle die menschlichen Bedürfnisse, mit deren Befriedigung ein Gut in ursächlichen Zusammenhang gesetzt werden kann, vollständig entfallen, ohne dass neue Bedürfnisse nach demselben entstehen, seine Güterqualität sofort verloren geht.
Dass demnach die Güter erster Ordnung, wofern die Bedürfnisse, zu deren Befriedigung sie bisher dienten, insgesammt entfallen, ohne dass neue Bedürfnisse nach denselben entstehen, sofort ihre Güterqualität einbüssen, ist nach dem, was wir über das Wesen der Güter gesagt haben, unmittelbar einleuchtend. Verwickelter wird diese Frage, wenn wir die Gesammtheit der im Causalnexus mit der Befriedigung eines menschlichen Bedürfnisses stehenden Güter ins Auge fassen, und nunmehr darnach fregen, welche Wirkung das Entfallen dieses Bedürfnisses auf die Güterqualität der zur Befriedigung desselben in ursächlicher Beziehung stehenden Güter höherer Ordnung äussert.
Setzen wir den Fall, dass durch eine Aenderung in der Geschmacksrichtung der Menschen das bedürfniss nach dem Genusse von Tabak vollständig beseitigt würde und zugleich alle übrigen Bedürfnisse, zu deren Befriedigung der zum Genusse der Menschen bereits zubereitete Tabak etwa noch dienlich ist, gleichfalls entfallen würden. Dass in einem solchen Falle aller Tabak, welcher sich in der Form, in der diese Pflanze von den Menschen genossen wird, in dem Besitze derselben befande, sofort seine Güterqualität einbüssen würde, ist sicher. Wie ver hielte es sich nun aber in diesem Falle mit den entsprechenden Gütern höherer Ordnung? Wie mit den rohen Tabakblättern, den bei der Erzeugung der verschiedenen Tabaksorten verwendeten [18] Werkzeugen und Vorrichtungen, den hier zur Verwendung kommenden qualificirten Arbeitsleistungen, kurz mit sämmtlichen zur Hervorbringung des zum menschlichen Genusse dienenden Tabaks vorhandenen Gütern zweiter Ordnung? Wie ferner mit dem Tabaksamen, den Tabakplantagen, den bei der Erzeugung von rohem Tabak zur Verwendung kommenden Arbeitsleistungen und den hier zur Anwendung kommenden Werkzeugen und Vorrichtungen, und all' den übrigen Gütern, die wir mit Rücksicht auf das Bedürfniss des Menschen nach dem Tabakgenusse als Güter der dritten Ordnung bezeichnen können? Wie würde es sich endlich mit den entsprechenden Gütern der vierten und füften Ordnung u. s. w. verhalten?
Die Güterqualität eines Dinges ist, wie wir sahen, dadurch bedingt, dass es in ursächlichen Zusammenhang mit der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse gesetzt werden kann. Wir haben aber auch gesehen, dass der unmittelbare Causalnexus zwischen Gut und Bedürfnissbefriedigung keineswegs eine nothwendige Voraussetzung der Güterqualität eines Dinges ist, dass vielmehr eine grosse Anzahl von Dingen die Güterqualität lediglich daraus herleitet, dass sie sich in einem mehr oder minder vermittelten Causal-Zusammenhange mit der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse befinden.
Steht es nun fest, dass das Vorhandensein zu befriedigender menschlicher Bedürfnisse die Voraussetzung aller und jeder Güterqualität ist, so ist damit zugleich der Grundsatz dargethan, dass die Güter, ob sie nun unmittelbar in ursächlichen Zusammenhang mit der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse gesetzt werden können, oder ihre Güterqualität aus einem mehr oder minder vermittelten Causalnexus mit der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse herleiten, doch ihre Güterqualität sofort einbüssen, wenn die Bedürfnisse, zu deren Befriedigung sie bisher dienten, insgesammt verschwinden. Es ist nämlich klar, dass mit den entsprechenden Bedürfnissen die ganze Grundlage jenes Verhältnisses entfällt, das, wie wir sahen, die Güterqualität der Dinge begründet.
Die Chinarinde würde dadurch, dass die Krankheiten, zu deren Heilung sie dient, vollständig verschwinden würden, aufhören, ein Gut zu sein, da das einzige Bedürfniss zu dessen Befriedigung dieselbe [19] in ursächlicher Beziehung steht, dann nicht weiter vorhanden wäre. Aber dies Entfallen des Gebrauchszweckes der Chinarinde hätte zur weiteren Folge, dass auch ein grosser Theil der entsprechenden Güter höherer Ordnung seine Güterqualität einbüssen würde. Die Bewohner der Chininländer, welche sich durch das Aufsuchen und Schälen der Chinabäume gegenwärtig hren Lebensunterhalt erwerben, würden plötzlich finden, dass nicht nur ihre Vorräthe von Chinarinde, sondern in naturgemässer Folge hievon auch ihre Chinabäume, die Werkzeuge und Vorrichtungen, welche nur bei der Chinin-Production verwendbar sind, und zumal jene specifischen Arbeitsleistungen, mit welchen sie sich bisher ihren Lebensunterhalt erwarben, plötzlich ihre Güterqualität einbüssen würden, denn dieselben würden unter den geänderten Verhältnissen nicht weiter in irgend einer ursächlichen Beziehung zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse stehen. Wenn durch eine Geschmacksänderung das Bedürfnisse mach dem Genusse von Tabak vollständig entfallen würde, so hätte dies nicht nur zur Folge, dass die gesammten Tabakvorräthe, die sich in der Form, in welcher die Menschen diese Pflanze zu geniessen pflegen, in ihrer Verfügung befänden, die Güterqualität einbüssen würden; es hätte dies vielmehr die weitere Folge, dass auch die rohen Tabakblätter, die ausschliesslich zur Verarbeitung derselben tauglichen Maschinen, Werkzeuge und Vorrichtungen, die bei jener Fabrication zur Verwendung Kommenden specifischen Arbeitsleistungen, die vorhandenen Vorräthe von Tabaksamen u. s. w. ihre Güterqualität verlören. Die gegenwärtig so gut bezahlten Leistungen jener Agenten, welche in Cuba, Manila, Portorico, Havannah u. s. w, in der Prüfung der Qualität des Tabaks und im Einkaufe desselben eine besondere Geschicklichkeit besitzen, würden aufhören, Güter zu sein, nicht minder aber die specifischen Arbeitsleistungen der zablreichen, in jenen fernen Ländern und in Europa in der Cigarren-Fabrication beschäftigten Personen. Selbst zahlreiche, gegenwärtig für Practiker höchst nützliche Bücher über den Tabakbau und die Tabakindustrie würden dann aufhören, Güter zu sein und ihren Verlegern unverkäuflich am Lager bleiben. Nicht genug daran, würden selbst die Tabaksdosen [20] Cigarrenetuis und alle Arten von Tabakspfeifen, Pfeifenröhren u. s. w. ihre Güterqualität einbüssen.
Diese scheinbar sehr complieirte Erscheinung fände aber darin ihre Erklärung, dass alle obengenannten Güter ihre Güterqualität aus ihrem ursächlichen Zusammenbange mit der Befriedigung des Bedürfnisses der Menschen nach dem Genusse von Tabak herleiten, und mit dem Entfallen dieses Bedürfnisses eine der Grundlagen beseitigt würde, welche die Güterqualität derselben begründet.
Die Güter erster Ordnung leiten übrigens nicht selten, die der höheren Ordnung sogar der Regel nach, ihre Güterqualität nicht lediglich aus einer vereinzelten, sondern aus mehr ode minder zahlreichen Causal-Beziehungen zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse her, und ihre Güterqualität geht demnach in diesem letzteren Falle nicht schon dadurch verloren, dass ein einzelnes, oder überhaupt nur ein Theil dieser Bedürfnisse entfällt. Es ist vielmehr klar, dass dieser Erfolg erst dann eintritt, wenn die sämmtlichen Bedürfnisse, zu deren Befriedigung die Güter in ursächlicher Beziehung standen. beseitigt erscheinen, indem diese Güter im entgegengesetzten Falle ihre Güterqualität mit Rücksicht auf die auch dann noch vorhandenen Bedürfnisse, zu deren Befriedigung sie auch unter den geänderten Verhältnissen in ursächlicher Beziehung stehen, und zwar in ganz gesetzmässiger Weise aufrecht erhalten. Auch in diesem Falle bleibt nämlich ihre Güterqualität nur in sofern erhalten, als sie auch dann noch in ursächlicher Beziehung zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse stehen, und dieselbe verschwindet sofort, wenn auch diese letzteren Bedürfnisse entfallen.
Würde der oben angeführte Fall eintreten, und das Bedürfniss der Menschen nach dem Genusse von Tabak vollständig entfallen, so würden z. B. der zum Gebrauche der Menschen bereits zubereitete Tabak, und wohl auch die Vorräthe an rohen Tabakblättern, an Tabaksamen und so viele andere mit der Befriedigung des obigen Bedürfnisses der Menschen in ursächlicher Beziehung stehende Güter höherer Ordnung, ihre Güterqualität vollständig einbüssen, dieser Erfolg würde aber nicht nothwendigerweise bei allen hier einschlägigen Gütern höherer Ordnung eintreten, indem zum Beispiel die zur Tabakcultur [21] geeigneten Grundstücke und die hiebei in Anwendung kommenden landwirthschaftlichen Geräthe, wohl auch viele in der Tabakindustrie zur Verwendung kommende Werkzeugo und Maschinen, mit Rücksicht auf andere menschliche Bedürfnisse, zu deren Befriedigung sie auch nach dem Entfallen des Bedürfnisses nach dem Tabaksgenusse in ursächlicher Beziehung stünden, in ihrer Güterqualität erhalten bleiben würden.
Nicht als eine das Wesen des obigen Grundsatzes berührende Modification, sondern lediglich als eine concretere Form desselben, ist das Gesetz zu betrachten, dass die Güter höherer Ordnung in Rücksicht auf ihre Güterqualität durch jene der Güter niederer Ordnung bedingt sind, zu deren Hervorbringung sie dienen.
Haben wir nämlich bisher die sämmtlichen, mit der Befriedigung eines menschlichen Bedürfnisses im Causal Zusammenhange stehenden Güter im Grossen und Ganzen in Betracht gezogen, und war demnach die ganze Causalkette bis auf die letzte Einwirkung, die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse, der Gegenstand unserer Untersuchung, so fassen wir, indem wir den obigen Grundsatz aufstellen, nunmehr nur einige Glieder derselben ins Auge, indem wir zum Beispiel von dem Causalnexus der Güter dritter Ordnung mit der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse zunächst absehen, und nur den Causal-Zusammenhang der Güter dieser Ordnung mit den entsprechenden Gütern irgend einer willkurlich zu wählenden höheren Ordnung im Auge behalten.
§. 4.
Zeit—Irrthum.
Der Process, durch welchen die Güter höherer Ordnung stufenweise in solche niederer Ordnung umgestaltet und diese schliesslich der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse zugeführt werden, ist, wie wir in den vorangehenden Abschnit en gesehen haben, kein regelloser, sondern steht gleich allen übrigen Wandlungsprocessen unter den Gesetzen der Causalität. Die Idee der Causalität ist nun aber unzertrennlich von der Idee der Zeit. Ein jeder Wandlungsprocess bedeutet ein Entstehen, ein Werden, ein solches ist jedoch nur denkbar in der Zeit. Es ist aber darum auch sicher, dass wir den Causalnexus der einzelnen Erscheinungen [22] in diesem Processe und diesen selbst nie vollständig zu erfassen vermögen, wofern wir denselben nicht in der Zeit betrachten und das Mass derselben an ihn legen. Auch bei dem Wandlungsprocesse, durch welchen die Güter höherer Ordnung stufenweise in solche niederer Ordnung verwandelt werden, bis diese schliesslich jenen Zustand bewirken, den wir die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse nennen, ist deshalb die Zeit ein wesentliches Moment unserer Beobachtung.
Wenn wir über die complementären Güter irgend einer höheren Ordnung verfügen, so müssen diese Güter vorerst in solche der nächst niederen und so stufenweise fort verwandelt werden, bis dieselben zu Gütern erster Ordnung gestaltet sind, welche letzteren wir erst der Befriedigung unserer Bedürfnisse in unmittelbarer Weise zuführen können. Die Zeiträume, welche zwischen den einzelnen Phasen dieses Processes liegen, mögen in manchen Fällen noch so kurz erscheinen und die Fortschritte in der Technik und im Verkehrswesen immerhin die Tendenz haben, dieselben mehr und mehr abzukürzen—ein vollständiges Verschwinden derselben ist indess undenkbar. Es ist unmöglich, Güter irgend einer höheren Ordnung durch einen blossen Wink in die entsprechenden Güter niederer Ordnung zu verwandeln; vielmehr ist nichts sicherer, als dass derjenige, der über Güter höherer Ordnung verfügt, erst nach einem gewissen, je nach der Natur des Falles bald kürzerem, bald längerem Zeitraume über die entsprechenden Güter der nächst niederen Ordnung zu verfügen in der Lage sein wird. Was nun aber hier von dem einzelnen Gliede der Causalkette gesagt wird, gilt im erhöhten Masse von dem ganzen Processe.
Der Zeitraum, welchen dieser Process in den einzelnen Fällen ausfüllt, ist je nach der Natur dieser letzteren sehr verschieden. Wer über die sämmtlichen zur Hervorbringung eines Eichenwaldes nöthigen Grundstücke, Arbeitsleistungen, Werkzeuge und Samenfrüchte verfügt, wird an hundert Jahre warten müssen, ehe er über einen schlagbaren Hochwald selbst zu verfügen in der Lage sein wird, und in den meisten Fällen wird dies wohl erst bei den Erben oder sonstigen Rechtsnachfolgern desselben der Fall sein, dagegen mag derjenige, der über die Ingredienzien von Speisen oder Getränken und die zu ihrer Erzeugung [23] nöthigen Werkzeuge, Arbeitsleistungen u. dgl. m. verfügt, in einzelnen Fällen in wenigen Augenblicken schon über die Speisen und Getränke selbst zu verfügen in der Lage sein;—wie gross dieser Unterschied aber auch immer sein mag, eines ist sicher, dass der Zeitraum, welcher zwischen der Verfügung über Güter höherer Ordnung und jener über die entsprechenden Güter niederer. Ordnung liegt, niemals völlig beseitigt erscheint. Die Güter höherer Ordnung erlangen und behaupten demnach ihre Güterqualität nicht mit Rücksicht auf Bedürfnisse der unmittelbaren Gegenwart, sondern lediglich im Hinblicke auf Bedürfnisse, welche sich menschlicher Voraussicht zufolge erst in solchen Zeitpunkten geltend machen werden, in welchen der Productionsprocess, von dem wir oben sprachen, bereits vollendet sein wird.
Ist es nach dem Gesagten sicher, dass wofern wir einen bestimmten Gebrauchszweck im Auge haben, sich die Verfügung über Güter höherer Ordnung von jener über die entsprechenden Güter niederer Ordnung zunächst dadurch unterscheidet, dass wir von den letzteren sofort den bezüglichen Gebrauch machen können, während die ersteren eine frühere Stufe im Processe der Güterbildung repräsentiren, und uns demnach erst nach dem Verlauf eines gewissen, je nach der Natur des Falles, bald längeren, bald kürzeren Zeitraums diesen unmittelbaren Gebrauch gestatten, so fordert noch ein anderer höchst wichtiger Unterschied zwischen der unmittelbaren Verfügung über ein Gut und der mittelbaren Verfügung über dasselbe, (durch den Besitz von entsprechenden Gütern höherer Ordnung,) uns zu Betrachtungen heraus.
Wer über gewisse Güter unmittelbar verfügt, ist der Quantität und Qualität derselben sicher. Wer indess über jene Güter nur mittelbar, das ist durch den Besitz der entsprechenden Güter höherer Ordnung verfügt, kann nicht mit gleicher Sicherheit die Quantität und Qualität der Güter niederer Ordnung bestimmen, über welche er am Schlusse des Processes der Gütererzeugung zu verfügen in der Lage sein wird.
Wer hundert Metzen Korn besitzt, verfügt über diese Güter mit Rücksicht auf Quantität und Qualität mit jener Sicherheit, die der unmittelbare Besitz von Gütern überhaupt zu bieten [24] vermag. Wer dagegen über eine solche Quantität von Grundstücken, Samen, Dünger, Arbeitsleistungen, landwirthschaftlichen Geräthen u. s. w. verfügt, als der Regel nach zur Herstellung von hundert Metzen Getreide erforderlich sind, steht der Eventualität gegenüber, mehr, aber auch weniger als die obige Quantität von Getreide zu ernten, und es ist für denselben selbst die Eventualität einer völligen Missernte nicht ansgeschlossen; er wird überdies auch in Rücksicht auf die Qualität des Productes einer gewissen Unsicherheit preisgegeben sein.
Diese Unsicherheit in Rücksicht auf Quantität und Qualität des Productes, über welches man durch die entsprechenden Güter höherer Ordnung verfügt, ist bei einigen Productionszweigen grösser, bei anderen geringer. Wer über die zur Erzeugung von Schuhen nöthigen Materialien, Werkzeuge und Arbeitsleistungen verfügt, der wird aus der Quantität und Qualität dieser seiner Verfügung unterstehenden Güter höherer Ordnung mit einer ziemlich grossen Bestimmtheit auf die Quantität und Qualität der Schube einen Rückschluss ziehen können, über welche er am Ende des Productions-Processes zu verfügen in der Lage sein wird. Wer dagegen über die Benützung eines für die Cultur von Raps geeigneten Feldes und der entsprechenden landwirthschaftlichen Werkzeuge, ferner über die erforderlichen Arbeitsleistungen, Samenfrüchte, Dungstoffe u. s. w. verfügt, wird über die Quantität der Oelfrüchte, die er am Endedes Productions-Processes ernten wird, und eben sowohl über deren Qualität sich ein vollständig sicheres Urtheil nicht bilden können. Und doch wird er in den beiden obigen Rücksichten immer noch einer geringeren Unsicherheit preisgegeben sein, als ein Hopfengärtner, ein Jäger oder gar ein Perlfischer. So gross aber dieser Unterschied bei den verschiedenen Productionszweigen auch immer sein mag, und obzwar die fortschreitende Cultur die Tendenz hat, die hier in Rede stehende Unsicherheit unablässig zu vermindern, so viel ist sicher, dass ein gewisser, je nach der Natur des Falles allerdings bald höherer, bald geringerer Grad von Unsicherheit über die Quantität und Qualität des schliesslich zu erzielenden Productes allen Productionszweigen gemein ist.
Die letzte Ursache dieser Erscheinung liegt in der eigenthümlichen [25] Stellung des Menschen zu jenem Causal-Processe, den wir die Gütererzeugung nennen. Die Güter höherer Ordnung werden nach den Gesetzen der Causalität zu solchen der nächst niederen, diese so fort, bis sie zu Gütern erster Ordnung werden, und schliesslich jenen Zustand bewirken, den wir die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse nennen. Die Güter höherer Ordnung sind die wichtigsten Elemente dieses Causal-Processes—aber durchaus nicht die Gesammtheit derselben. Ausser diesen der Güterwelt angehörigen Elementen wirken auf die Qualität und Quantität des Productes jener Causal Processe, welche wir die Güter-Production nennen, auch Elemente ein, deren ursächlichen Zusammenhang mit unserer Wohlfahrt wir entweder noch nicht erkannt haben, oder aber solche Elemente, deren Einfluss auf das Product wir wohl kennen, die aber aus irgend welchen Gründen unserer Verfügung entrückt sind.
So kannten die Menschen bis vor Kurzem nicht den Einfluss der verschiedenen Erdarten, Bodensalze und Düngungsstoffe auf das Wachsthum verschiedener Pflanzen, so zwar, dass die erstern eine bald mehr, bald minder günstige oder ungünstige Einwirkung auf das Endresultat des Productions Processes in quantitativer und qualitativer Beziehung äusserten. Durch die Forschungen auf dem Gebiete der Agricultur-Chemie ist nun aber gegenwärtig ein gewisser Theil jener Unsicherheit hereits beseitigt und es nunmehr in die Hand der Menschen gegeben, so weit die Forschungen reichen, die günstigen Einüüsse mit Rücksicht auf jeden besonderen Fall herbeizuführen, die schädlichen aber zu beseitigen.
Ein Beispiel für den zweiten Fall bietet uns der Witterungswechsel. Die Landwirthe sind zwar in den meisten Fällen wohl darüber im Klaren, welche Witterung für das Wachsthum der Pflanzen die günstigste wäre, da sie es aber nicht in ihrer Macht haben, die günstige Witterung herbeizuführen, oder aber die den Saaten verderbliche zu verhindern, so sind sie in Rücksicht auf die Qualität und Quantität des Ernteergebnisses in nicht geringem Masse von Einflüssen abhängig, welche, obzwar sie sich gleich allen übrigen auf der unabweisbaren Grundlage der Causal-Gesetze geltend machen, doch um dessentwillen, weil sie ausserhalb [26] der Machtsphäre der wirthschaftenden Menschen liegen, diesen Letzteren als Zufälle erscheinen.
Der grosse oder geringere Grad von Sicherheit in der Voraussicht der Qualität und Quantität des Productes, über welches die Menschen durch den Besitz der zu seiner Hervorbringung erforderlichen Güter höherer Ordnung verfügen, hängt von der mehr order minder vollständigen Erkenntniss der im ursächlichen Zusammenhange mit der Production jener Güter stehenden Elemente des Causal-Processes und der mehr oder minder vollständigen Unterwerfung derselben unter die Verfügung der Menschen ab. Der Grad der Unsicherheit in den beiden obigen Rücksichten ist durch das Gegentheil bedingt. Je mehr Elemente bei dem Causal-Processe der Güterentstehung mitwirken, die wir nicht kennen, oder über die wir, wofern wir sie kennen, nicht zu verfügen vermögen, das ist, eine je grössere Anzahl dieser Elemente keine Güterqualität besitzt, um so grösser ist auch die menschliche Unsicherheit über die Qualität und Quantität des Productes des ganzen Causal-Processes, nämlich der entsprechenden Güter niederer Ordnung.
Diese Unsicherheit ist nun eines der wesentlichsten Momente der ökonomischen Unsicherheit der Menschen und wie wir in der Folge sehen werden, von der grössten practischen Bedeutung für die menschliche Wirthschaft.
§. 5.
Ueber die Ursachen der fortschreitenden Wohlfahrt der Menschen.
„Die grösste Zunahme in der hervorbringenden Kraft der Arbeit,“ sagt Adam Smith, „und die Vermehrung der Geschicklichkeit, Fertigkeit und Einsicht, womit die Arbeit überall geleitet oder verrichtet wird, scheint eine Wirkung der Arbeitstheilung gewesen zu sein“ [5]und „die grosse, durch die Arbeitstheilung herbeigeführte Vermehrung der Producte in den verschiedenen Gewerben bewirkt in einer gut regierten Gesellschaft jene allgemeine Wohlhabenheit, welche sich bis in die untersten Volksschichten erstreckt“ [6].
[27]
Adam Smith hat solcherart die fortschreitende Arbeitstheilung zum Angelpuncte des wirthschaftlichen Fortschrittes der Menschen gemacht, und zwar im Einklange mit der überwiegenden Bedeutung, welche er dem Arbeitselemente in der menschlichen Wirthschaft einräumt. Ich glaube indess, dass der ausgezeichnete Forscher, von dem hier die Rede ist, in seinem Capitel über die Arbeitstheilung nur eine einzelne Ursache des fortschreitenden Wohlstandes der Menschen an's Licht gezogen hat, andere nicht minder wirksame jedoch seiner Beobachtung entgangen sind.
Man denke sich die, der Hauptsache nach, occupatorische Arbeit eines australischen Volksstammes noch so zweckmässig unter die einzelnen Mitglieder desselben vertheilt, eine Anzahl davon als Jäger, andere als Fischer, noch andere ausschliesslich mit der Occupation wild wachsender Pflanzenkost, die Weiber zum Theile ausschliesslich mit der Zubereitung der Speisen, zum anderen Theile mit der Anfertigung von Kleidungsstücken beschäftigt, ja man führe die Arbeitstheilung bei diesem Volke in Gedanken noch weiter, so zwar, dass jede Verrichtung besonderer Art auch durch besondere Functionäre ausgeführt würde, und frage sich nun, ob eine, wenn auch noch so weit getriebene Theilung der Arbeit jene vermehrende Wirkung auf die den Mitgliedern des Volkes verfügbaren Genussmittel haben würde, welche Adam Smith als eine Folge der fortschreitenden Arbeitstheilung bezeichnet. Offenbar wird jenes Volk, und so jedes andere, auf dem obigen Wege die bisherige Arbeitswirkung mit geringerer Anstrengung und mit der bisherigen Anstrengung eine grössere Arbeitswirkung erzielen, also seine Lage, so weit dies auf dem Wege einer zweckmässigeren und wirksameren Verrichtung der occupatorischen Arbeiten überhaupt möglich ist, verbessern; diese Verbesserung wird indess doch gar sehr verschieden sein von jener, welche wir bei wirthschaftlich fortschreitenden Völkern thatsächlich beobachten können. Greift dagegen ein Volk, anstatt sich lediglich auf die occupatorische Thätigkeit, das ist auf das Aufsammeln der vorhandenen Güter niederer Ordnung, (in den rohesten Zuständen der Menschen zumeist Güter erster und etwa zweiter Ordnung,) zu beschränken, zu den Gütern dritter. vierter und höherer Ordnung und schreitet dasselbe in der Heranziehung von Gütern zur Befriedigung seiner [28] Bedürfnisse zu immer höheren Ordnungen fort, so werden wir, zumal bei zweckmässiger Theilung der Arbeit, allerdings jenen Fortschritt in seinem Wohlstande wahrnehmen können, welchen Adam Smith ausschliesslich dem letztern Umstande zuzuschreiben geneigt war.
Wir werden den Jäger, der das Wild mit einer Keule verfolgt, zur Jagd mit Bogen und Netz, zur Viehzucht, in weiterer Folge zu immer intensiveren Formen dieser letztern, wir werden die von wild wachsender Pflanzenkost lebenden Menschen zu immer intensiveren Formen des Ackerbaues übergehen, Gewerbe entstehen, sich durch Werkzeug und Maschine vervollkommnen und in engstem Zusammenhange damit den Wohlstand dieses Volkes sich mehren sehen.
Je weiter die Menschen in dieser Richtung fortschreiten, um so vielfältiger werden die Güterarten, um so vielfältiger in Folge dessen die Verrichtungen, um so nothwendiger und ökonomischer auch die fortschreitende Theilung der Arbeit. Es ist indess klar, dass die wachsende Vermehrung der den Menschen verfugbaren Genussmittel nicht die ausschliessliche Wirkung dieses letztern Umstandes ist, ja dass derselbe nicht einmal als die wichtigste Ursache des ökonomischen Fortschrittes der Menschen bezeichnet werden kann, sondern richtig nur als ein Factor jener grossen Einwirkungen aufgefasst werden darf, welche das Menschengeschlecht aus der Rohheit und dem Elende zur Cultur und zum Wohlstande führen.
Die Erklärung der vermehrenden Wirkung, welche die fortschreitende Heranziehung von Gütern höherer Ordnung auf die den Menschen verfügbaren Genussmittel (Güter erster Ordnung) äussert, ist nun aber unschwer zu finden.
Die roheste Form der occupatorischen Wirthschaft ist auf die Aufsammlung der jeweilig von der Natur dargebotenen Güter niederster Ordnung beschränkt. Die wirthschaftenden Menschen nehmen auf die Hervorbringung derselben keinen Einfluss, ihr Entstehen ist unabhängig von den Wünschen und Bedürfnissen der Menschen und diesen gegenüber ein zufälliges. Wenn nun aber die Menschen diese roheste Form der Wirthschaft verlassen, die Dinge erforschen, durch deren Verbindung im Causalprocesse die Genussmittel entstehen und dieselben in [29] ihre Gewalt nehmen, das ist zu Gütern höherer Ordnung gestalten, so erfolgt die Entstehung der Genussmittel zwar vor wie nach auf Grundlage des Causal-Gesetzes, aber ihr Entstehen ist den Wünschen und Bedürfnissen der Menschen gegenüber nicht mehr etwas Zufälliges, sondern ein Process, der in der Gewalt der Menschen ist und sich innerhalb der durch die Naturgesetze gezogenen Schranken nach menschlichen Zwecken regelt. Die Genussmittel, welche früher das Product eines zufälligen Zusammentreffens der Bedingungen ihrer Entstehung waren, sind, sobald die Menschen diese letztern erkannt und in ihre Gewalt genommen haben, innerhalb der durch die Naturgesetze gezogenen Grenzen ein Product ihres Willens. und die den Menschen verfügbaren Quantitäten derselben finden ihre Grenze nur in den Grenzen ihrer Einsicht in dem ursächlichen Zusammenhang der Dinge und in dem Umfang ihrer Macht über diese letztern. Die fortschreitende Erkenntniss des ursächlichen Zusammenhanges der Dinge mit ihrer Wohlfahrt und die fortschreitende Bemächtigung der entfernteren Bedingungen derselben haben demnach die Menschen aus dem Zustande der Rohheit und des tiefsten Elendes emporgeführt zu der gegenwärtigen Stufe ihrer Cultur und Wohlfahrt, haben weite, von wenigen, mühselig und doch in äusserster Armuth lebenden Menschen bewohnte Landstriche in dicht bevölkerte Culturländer umgewandelt und es ist nichts sicherer, als dass auch der wirthschaftliche Fortschritt der Menschen in Kommenden Zeitepochon sein Mass in den obigen Fortschritten finden wird.
§. 6.
Der Güterbesitz
Die Bedürfnisse der Menschen sind mannigfach und das Leben und die Wohlfahrt derselben ist nicht gesichert, wenn ihrer Verfügung lediglich die Mittel zur Befriedigung irgend eines ihrer Bedürfnisse, wenn auch in noch so reichlichem Masse unterworfen sind. Die Art und Weise, in welcher die Menschen ihre Bedürfnisse befriedigen, kann demnach in Bezug auf Vollständigkeit im Grossen und Ganzen eine nahezu unbegrenzte Verschiedenheit aufweisen; eine gewisse Harmonie in der Befriedigung [30] derselben ist indess bis zu einem gewissen Punkte zur Erhaltung ihres Lebens und ihrer Wohlfahrt geradezu unerlässlich. Der Eine mag Paläste bewohnen, die ausgesuchtesten Gerichte consumiren und sich mit den kostbarsten Gewändern bekleiden, der Andere den dunkeln Winkel einer elenden Hütte zu seinem Nachtlager aufsuchen, sich von Abfällen ernähren und in Lumpen hüllen—aber jeder von Beiden wird dahin streben müssen, sowohl sein Bedürfniss nach Wohnung und Kleidung, als auch jenes nach Nahrung zu befriedigen. Es ist nämlich klar, dass selbst die vollständigste Befriedigung eines einzelnen Bedürfnisses unser Leben und unsere Wohlfahrt nicht zu erhalten vermag.
In diesem Sinne lässt sich nicht mit Unrecht sagen, dass die sämmtlichen, einem wirthschaftenden Subjecte verfügbaren Güter in ihrer Güterqualität gegenseitig bedingt sind, denn ein jedes einzelne derselben vermag den Gesammtzweck, dem sie alle dienen, die Erhaltung unseres Lebens und unserer Wohlfahrt, nicht für sich allein, sondern nur im Vereine mit den übrigen Gütern zu verwirklichen.
In der isolirten Wirthschaft, und selbst noch überall dort, wo der Verkehr der Menschen ein geringfügiger ist, tritt uns diese Zusammengehörigkeit der zur Erhaltung des Lebens und der Wohlfahrt der Menschen erforderlichen Güter auch äusserlich in der Gesammtheit der den einzelnen wirthschaftenden Individuen verfügbaren Güter entgegen und selbst die Harmonie, mit welcher sie ihre Bedürfnisse zu befriedigen bemüht sind, wiederspiegelt sich in ihrem Güterbesitze [7]. Bei höherer Cultur und zumal unter unseren entwickelten Verkehrsverhältnissen, wo der ausreichende Besitz einer Quantität irgend eines ökonomischen Gutes uns die Verfügung über entsprechende Quantitäten aller anderen verschafft, verwischt sich scheinbar das obige Bild bezüglich der Wirthschaft des Einzelnen, es tritt uns aber dann um so deutlicher in der Volkswirthschaft entgegen.
Ueberall sehen wir, dass nicht einzelne Güter, sondern eine Gesammtheit von Gütern verschiedener Art den Zwecken der wirthschaftenden Menschen dienen, eine Gesammtheit von [31] Gütern, welche entweder, gleich wie in der isolirten Wirthschaft direct, oder wie dies unter unseren entwickelten Verhältnissen der Fall ist, zum Theile in directer, zum Theile in indirecter Weise den einzelnen wirthschaftenden Individuen verfügbar ist, und nur in dieser Gesammtheit jenen Erfolg herbeiführt, den wir die Deckung des Bedarfs und in weiterer Folge die Sicherung des Lebens und der Wohlfahrt der Menschen nennen.
Die Gesammtheit der einem wirthschaftenden individuum für die Befriedigung seiner Bedürfnisse verfügbaren Güter nennen wir seinen Güterbesitz, und stellt sich uns derselbe demnach nicht als eine willkürlich zusammengefügte Quantität von Gütern, sondern als das Spiegelbild seiner Bedürfnisse, als ein gegliedertes Ganzes dar, das in keinem wesentlichen Theil gemindert oder vermehrt werden kann, ohne dass die Verwirklichung des Gesammtzweckes, dem es dient, dadurch berührt würde.
[32]
Zweites Capitel.
Die Wirthschaft und die wirthschaftlichen Güter.↩
Die Bedürfnisse entspringen unseren Trieben, diese aber wurzeln in unserer Natur; die Nichtbefriedigung der Bedürfnisse hat die Vernichtung, die mangelhafte Befriedigung die Verkümmerung unserer Natur zur Folge; seine Bedürfnisse befriedigen, heisst aber leben und gedeihen. Die Sorge für die Befriedigung unserer Bedürfnisse ist demnach gleichbedeutend mit der Sorge für unser Leben und unsere Wohlfahrt; sie ist die wichtigste aller menschlichen Bestrebungen, denn sie ist die Voraussetzung und die Grundlage aller übrigen.
Diese Sorge ässert sich im practischen Leben der Menschen dadurch, dass sie darauf bedacht sind, alles dasjenige in ihrer Gewalt zu haben, wovon die Befriedigung ihrer Bedürfnisse abhängt. Verfügen wir nämlich über die zur Befriedigung unserer Bedürfnisse erforderlichen Güter, so hängt diese letztere dann lediglich von unserem Willen ab; damit ist aber unserem prac tischen Zwecke vollkommen Genüge gethan, denn unser Leben und unsere Wohlfahrt sind dann in unsere eigene Hand gegeben. Die Quantität von Gütern, welche ein Mensch zur Befriedigung seiner Bedürfnisse benöthigt, nennen wir seinen Bedarf. Die Sorge der Menschen für die Aufrechterhaltung ihres Lebens und ihrer Wohlfahrt wird demnach zur Sorge für die Deckung ihres Bedarfes.
Nun wäre aber die Befriedigung der Bedürfnisse und somit das Leben und die Wohlfahrt der Menschen sehr schlecht gesichert, würden sie erst dann darauf bedacht sein, ihren Bedarf an Gütern zu decken, wenn die Bedürfnisse nach diesen letzteren sich bereits unmittelbar geltend machen.
Man setze den Fall, dass die Bewohner eines Landes beim Einbruche der rauhen Jahreszeit ohne alle Vorräthe von Nahrungsmitteln und Bekleidungsstoffen wären, so ist kein Zweifel, dass [33] die Mehrzahl derselben, selbst bei den angestrengtesten aut die Befriedigung ihrer Bedürfnisse gerichteten Thätigkeit, sich vom Untergange nicht zu retten vermöchte. Je weiter aber die Cultur fortschreitet und je mehr die Menschen angewiesen sind, die zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse nöthigen Güter durch einen langen Productionsprocess zu gewinnen (S. 21 ff.), um so zwingender wird für dieselben die Nothwendigkeit, für die Befriedigung ihrer Bedürfnisse von vorn herein zu sorgen, das ist, ihren Bedarf für kommende Zeiträume zu decken.
So geht selbst der australische Wilde nicht erst dann auf die Jagd, wenn ihn bereits hungert und er baut nicht erst dann seine Behausung, wenn die rauhe Jahreszeit eingetreten und er den schädlichen Einflüssen der Witterung bereits ausgesetzt ist [1]. Die Culturmenschen zeichnen sich aber dadurch vor allen andern wirthschaftenden Individuen aus, dass sie nicht nur für eine kurze Spanne Zeit, sondern weit hinaus für die Befriedigung ihrer Bedürfnisse sorgen, die Sicherstellnng derselben für sorgen, die Sicherstellnng derselben für viele Jahre, ja für ihr ganzes Leben anstreben und der Regel nach noch darüber hinaus dafür Sorge tragen, dass es auch ihren Nachkommen an den zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse erforderlichen Mitteln nicht fehle.
Ueberall wo wir unsere Blicke hinwenden, sehen wir bei Culturvölkern ein System grossartiger Vorsorge für die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse.
Während wir uns zum Schutze gegen die Winterkälte noch in unsere Winterkleider hüllen, sind schon die fertigen Frühjahrsstoffe am Wege in die Läden der Detailhändler, und in den Fabriken werden bereits die leichten Stoffe gewebt, mit welchen wir uns im nächsten Sommer, und die Garne für die Stoffe gesponnen, mit welchen wir uns im nächsten Winter bekleiden werden. Wenn wir erkranken, bedürfen wir der Dienstleistungen eines Arztes, und bei Rechtsstreitigkeiten des Beirathes eines Rechtskundigen. Tritt nun für Jemanden ein solcher Fall ein, dann wäre es für ihn viel zu spät, wollte er sich die medicinischen oder juridischen Kenntnisse und Fertigkeiten selbst aneignen, [34] oder andere Personen für seinen Dienst besonders ausbilden lassen, selbst wenn er die Mittel hiefür besässe. Auch ist in Culturländern für die Bedürfnisse der Gesellschaft nach solchen und ähnlichen Dienstleistungen von langer Hand bereits vorgesorgt, indem erfahrene und bewährte Männer, welche sich bereits vor vielen Jahren für ihren Beruf herangebildet und inzwischen durch ihre practische Thätigkeit reiche Erfahrungen gesammelt haben, der Gesellschaft ihre Dienste zur Verfü gung stellen. Während wir aber solcherart die Früchte der Vorsorge vergangener Zeiten geniessen, bilden sich an unseren Hochschulen bereits zahlreiche Männer heran, um den Bedürfnissen der Gesellschaft nach ähnlichen Dienstleistungen in der Zukunft gerecht zu werden.
Die Sorge der Menschen für die Befriedigung ihrer Bedürfnisse wird demnach zur Vorsorge für die Deckung ihres Bedarfes an Gütern für kommende Zeiträume, und wir nennen dann den Bedarf eines Menschen jene Quantität von Gütern, die erforderlich ist, um seine Bedürfnisse innerhalb jenes Zeitraumes, auf welchen sich seine Vorsorge erstreckt, zu befriedigen [2].
Die Vorsorge der Menschen für die Befriedigung ihrer Bedürfnisse, soll sie anders eine erfolgreiche sein, hat nun aber [35] eine doppelte Erkenntniss zu ihrer Voraussetzung. Wir müssen uns klar werden:
a) über unseren Bedarf, das ist, über die Güterquantitäten, die wir in jenen Zeiträumen, auf welche sich unsere Vorsorge erstreckt, zur Befriedigung unserer Bedürfnisse benöthigen werden, und
b) über die Güterquantitäten, die uns für den obigen Zweck zur Verfügung stehen.
Die gesammte auf die Befriedigung ihrer Bedürfnisse gerichtete vorsorgliche Thätigkeit der Menschen beruht auf der Erkenntniss dieser beiden Grössen. Ohne die erstere Erkenntniss wäre sie eine blinde, denn die Menschen wären sich des Zieles derselben nicht bewusst, ohne die zweite Erkenntniss wäre sie eine planlose, denn sie wären ohne Einblick in die verfügbaren Mittel.
Wir werden aber in dem Nachfolgenden zunächst darthun, wie die Menschen zur Erkenntniss ihres Bedarfes in kommenden Zeiträumen gelangen, hierauf, wie sie die ihnen für diese Zeiträume verfügbaren Güterquantitäten berechnen, und endlich jene Thätigkeit derselben zum Gegenstande unserer Darstellung machen, durch welche sie die ihnen verfügbaren Güterquantitäten (Genuss- und Productionsmittel) der Befriedigung ihrer Bedürfnisse auf das zweckentsprechendste zuzuführen bemüht sind.
§. 1.
Der menschliche Bedarf.
a) Der Bedarf an Gütern erster Ordnung (an Genussmittein).
Die Menschen empfinden zunächst und unmittelbar nur Bedürfnisse nach Gütern erster Ordnung, das ist nach solchen Gütern, welche unmittelbar zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse herangezogen werden können. (S. 8.) Besteht kein Bedarf an Gütern dieser Art, so kann auch ein Bedarf an Gütern höherer Ordnung nicht entstehen. Der Bedarf an Gütern höherer Ordnung ist also durch unseren Bedarf an Gütern erster Ordnung bedingt und die Untersuchung über diesen letzteren die Grundlage unserer Untersuchungen auf dem Gebiete des menschlichen Bedarfes überhaupt. Wir werden uns demnach zuerst mit dem [36] Bedarfe der Menschen an Gütern erster Ordnung beschäftigen und hierauf die Grundsätze darlegen, nach welchen sich der menschliche Bedarf an Gütern höherer Ordnung regelt.
Die Quantität eines Gutes erster Ordnung, welche zur Befriedigung eines concreten menschlichen Bedürfnisses und somit auch die Quantität, die zur Befriedigung der gesammten, innerhalb eines gegebenen Zeitraumes nach einem Gute erster Ordnung sich geltend machenden Bedürfnisse erforderlich ist, ist durch das Bedürfniss, beziehungsweise durch die Bedürfnisse selbst in unmittelbarer Weise gegeben und findet in denselben ihr Mass. Würden demnach die Menschen rücksichtlich jener Zeiträume, auf welche sich ihre Vorsorge erstreckt, darüber immer genau und vollständig unterrichtet sein, welche concreten Bedürfnisse sie haben und mit welcher Itensität sich dieselben geltend machen werden, so würden sie an der Hand der bisherigen Erfahrungen, über die ihnen zur Befriedigung derselben erforderlichen Güterquantitäten, das ist über die Grösse ihres Bedarfes an Gütern erster Ordnung niemals in Zweifel sein können.
Nun lehrt uns aber die Erfahrung, dass es mit Rücksicht auf kommende Zeiträume nicht selten mehr oder minder ungewiss ist, ob sich gewisse Bedürfnisse innerhalb derselben überhaupt geltend machen werden. Dass wir innerhalb eines gegebenen kommenden. Zeitraumes Speise, Trank, Kleidung, Wohnung, u. dgl. m. benöthigen werden, ist uns von vornherein bekannt; nicht dasselbe ist aber rücksichtlich vieler anderen Güter der Fall, z. B. rücksichtlich ärztlicher Dienstleistungen, Medicamente u. dgl. m., da die Geltendmachung unserer Bedürfnisse nach diesen Gütern nicht selten von Einflüssen auf unsere Personen abhängig ist, welche wir nicht mit Bestimmtheit voraus zu sehen vermögen.
Hiezu tritt nun noch der Umstand, dass selbst bei jenen Bedürfnissen, von welchen wir von vornherem wissen, dass sie sich innerhalb jenes Zeitraumes, auf welchen sich unsere Vorsorge erstreckt, geltend machen werden, doch in quantitativer Beziehung eine Unbestimmtheit vorhanden sein kann, indem wir wohl die Thatsache, dass jene Bedürfnisse sich geltend maehen werden, nicht aber von vornherein eben so genau das Mass der [37] letztern, das ist die Güterquantitäten kennen, die zur Befriedigung derselben erforderlich sein weren. Es sind aber hier eben diese Quantitäten in Frage.
Was nun vorerst unsere Ungewissheit über den Umstand betrifft, ob sich gewisse Bedürfnisse in dem Zeitraume, auf welchen sich unsere Vorsorge erstreckt, überhaupt geltend machen werden, so lehrt uns die Erfahrung, dass durch diese mangelhafte Erkenntniss die Vorsorge der Menschen für die eventuelle Befriedigung dieser Bedürfnisse durchaus nicht ausgeschlossen wird. Selbst gesunde Personen, die am Lande wohnen, sind, wofern es ihre Mittel erlauben, im Besitze einer Hausapotheke, oder doch einer Anzahl von Heilmitteln für unvorhergesehene Fälle, vorsorgliche Hauswirthe besitzen Löschapparate. um für den Fall einer Feuersbrunst ihr Eigenthum conserviren, und Waffen, um dasselbe nöthigenfalls vertheidigen zu können, auch wohl noch feuer- und einbruchsichere Schränke und so viele andere ähuliche Güter mehr. Ja, ich glaube, dass selbst unter den Gütern der ärmsten Personen sich irgend welche vorfinden, welche denselben nur für gewisse unvorhergesehene Fälle dienen sollen.
Der Umstand, dass es ungewiss ist, ob ein Bedürfniss nach einem Gute innerhalb jenes Zeitraumes, auf welchen sich unsere Vorsorge erstreckt, sich überhaupt geltend machen wird, schliesst demnach die Vorsorge für die eventuelle Befriedigung desselben nicht aus, und es hat demnach dieser Umstand auch nicht zur Folge, dass unser Bedarf an den zur Befriedigung dieser Bedürfnisse erforderlichen Gütern in Frage steht. Vielmehr sorgen die Menschen, wofern die ihnen verfügbaren Mittel hiezu ausreichen, auch für die eventuelle Befriedigung dieser Bedürfnisse vor, und rechnen überall dort, wo es sich um die Bestimmung ihres vollen Bedarfes handelt, auch die für die obigen Zwecke erforderlichen Güter in denselben ein [3].
Was nun aber hier von jenen Bedürfnissen gesagt wurde, von welchen es unbestimmt ist, ob sich dieselben überhaupt geltend machen werden, gilt in gleichem Masse überall dort, [38] wo über das Bedürfniss nach einem Gute kein Zweifel obwaltet und nur ungewiss ist, in welchem Masse sich dasselbe geltend machen werde, denn auch in diesem Falle halten die Menschen, und zwar mit Recht, ihren Bedarf erst dann für vollständig gedeckt, wenn sie über die für alle voraussichtlichen Fälle ausreichenden Güterquantitäten zu verfügen vermögen.
Ein weiterer Umstand, der hier erwogen werden muss, ist die Entwicklungsfähigkeit der menschlichen Bedürfnisse. Sind nämlich die Bedürfnisse der Menschen entwicklungsfähig und, wie bisweilen bemerkt wird, sogar in's Unendliche entwicklungsfähig, so könnte es scheinen, als ob dadurch die Grenzen der zu ihrer Befriedigung nöthigen Güterquantitäten fortwährend, ja sogar bis in's völlig Unbestimmte ausgedehnt und demnach jede Voraussicht der Menschen in Bezug auf ihren Bedarf gänzlich unmöglich gemacht würde.
Was nun zunächst die unendliche Entwicklungsfähigkeit der menschlichen Bedürfnisse betrifft, so scheint mir hier der Begriff der Unendlichkeit nur auf den unbegrenzten Fortschritt der Entwickelung menschlicher Bedürfnisse anwendbar, nicht aber auf die zur Befriedigung derselben innerhalb eines bestimmten Zeitraumes erforderlichen Güterquantitäten. Zugegeben, die Reihe sei eine unendliche, so ist doch jedes einzelne Glied dieser Reihe ein endliches. Mögen die menschlichen Bedürfnisse auch in den entferntesten Zeiträumen in ihrer Entwickelung nicht gehemmt gedacht werden, so sind sie doch für alle gegebenen und insbesondere für die in der Wirthschaft der Menschen practisch in Betracht kommenden Zeiträume quantitative bestimmbar. Selbst unter der Annahme eines ununterbrochenen Fortschrittes in der Entwickelung menschlicher Bedürfnisse, haben wir es demnach, wofern wir nur bestimmte Zeiträume in's Auge fassen, mit endlichen und niemals mit unendlichen und deshalb völlig unbestimmbaren Grössen zu thun.
Wenn wir die Menschen bei der auf die Befriedigung ihrer Bedürfnisse in kommenden Zeiträumen gerichteten vorsorglichen Thätigkeit beobachten, können wir denn auch leicht wahrnehmen, dass sie, fern davon die Entwickelungsfähigkeit ihrer Bedürfnisse ausser Acht zu lassen, vielmehr auf das Eifrigste bemüht sind, dieser letzteren Rechnung zu tragen. [39] Wer eine Vermehrung seiner Familie, oder eine höhere gesellschaftliche Stellung zu erwarten hat, wird bei dem Baue und der Einrichtung von Wohngebäuden, bei der Anschaffung von Wagen u. dgl. Gütern von grösserer Dauerhaftigkeit mehr auf die Steigerung seiner Bedürfnisse in kommenden Zeiträumen gebührende Rücksicht nehmen und der Regel nach, so weit seine Mittel reichen, nicht nur in einer einzelnen Beziehung, sondern in Bezug auf seinen Güterbesitz überhaupt, den höheren Ansprüchen der Zukunft Rechnung zu tragen suchen. Eine analoge Erscheinung können wir im communalen Leben beobachten. Wir sehen die Stadtgemeinden: Wasserleitungen, öffentliche Gebäude (Schulen, Spitäler etc.), Gartenanlagen, Strassen u. dgl. m. nicht nur mit Rücksicht auf die Bedürfnisse der Gegenwart, sondern auch mit gebührender Rücksichtsnahme auf die gesteigerten Bedürfnisse der Zukunft anlegen, eine Tendenz, welche in der auf die Befriedigung der staatlichen Bedürfnisse gerichteten Thätigkeit der Menschen naturgemäss noch deutlicher zu Tage tritt.
Fassen wir das Gesagte zusammen, so ergiebt sich, dass der Bedarf des Menschen an Genussmitteln eine Grösse ist, deren quantitativer Bestimmung, mit Rücksicht auf kommende Zeiträume, keine principiellen Schwierigkeiten entgegenstehen, eine Grösse, über welche die Menschen bei der auf die Befriedigung ihrer Bedürfnisse gerichteten Thätigkeit denn auch thatsächlich innerhalb der Grenzen der Möglichkeit, und soweit eine practische Nöthigung hiezu vorliegt, also einerseits mit der Beschränkung auf jene Zeiträume, auf welche sich ihre Vorsorge jeweilig erstreckt, andererseits mit der Beschränkung auf jenen Grad von Genauigkeit, welcher für den practischen Erfolg ihrer Thätigkeit ausreichend ist, zur Klarheit zu gelangen bemüht sind.
b) Der Bedarf an Gütern höherer Ordnung (an Productionsmitteln).
Ist mit Rücksicht auf einen kommenden Zeitraum unser Bedarf an Gütern erster Ordnung bereits unmittelbar durch, Quantitäten dieser letzteren gedeckt, so kann von einer weitern Deckung des obigen Bedarfes durch Güter höherer Ordnung nicht die Rede sein. Ist aber dieser Bedarf durch Güter erster Ordnung, das ist in unmittelbarer Weise, nicht, oder doch nicht vollständig gedeckt, so entsteht allerdings für den in Rede [40] stehenden Zeitraum ein Bedarf an Gütern höherer Ordnung, und findet dieser letztere sein Mass in den, nach dem jeweiligen Stande der Technik der betreffenden Productionszweige, zur vollen Deckung unseres Bedarfes an Gütern erster Ordnung noch erforderlichen Gütern höherer Ordnung.
Dies einfache Verhältniss, das wir mit Rücksicht auf unseren Bedarf an Productionsmitteln soeben dargestellt haben, liegt nun aber, wie wir sofort sehen werden, nur in seltenen Fällen unserer Beobachtung vor, vielmehr bewirkt ein aus dem Causalnexus der Güter sich ergebender Umstand eine wichtige Modification desselben.
Wir haben (S. 11) eines weiteren dargethan, dass es den Mensehen unmöglich ist, irgend ein Gut höherer Ordnung zur Hervorbringung der entsprechenden Güter niederer Ordnung zu verwenden, wenn sie nicht zugleich über die complementären Güter zu verfügen vermögen. Was wir nun oben von den Gütern im Allgemeinen sagten, erhält hier seine schärfere Präcision, wenn wir die Güter in Rücksicht auf die verfügbaren Quantitäten derselben in Betracht ziehen. Haben wir früher gesehen, dass wir Güter höherer Ordnung nur dann in Güter niederer Ordnung verwandeln, und solcherart zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse heranziehen können, wenn wir zugleich über die complementären Güter zu verfügen vermögen, so stellt sich uns dieser Grundsatz unter dem obigen Gesichtspunkte in der Weise dar,dass wir Quantitäten von Gütern höherer Ordnung zur Hervorbringung bestimmter Quantitäten von Gütern niederer Ordnung und somit schliesslich zur Deckung unseres Bedarfes nicht anders heranziehen können, als wenn wir zugleich über die complementären Quantitäten der übrigen Güter höherer Ordnung zu verfügen in der Lage sind. So können wir zum Beispiel selbst die grösste Quantität von Grundstücken zur Hervorbringung selbst der geringsten Quantität von Getreide nicht heranziehen, wofern wir nicht über die zur Hervorbringung dieser geringen Güterquantität erforderlichen (complementären) Quantitäten von Samengetreide, Arbeitsleistungen u. dgl. m. verfügen können.
Es tritt demnach auch niemals ein Bedarf an einem einzelnen [41] Gute höherer Ordnung auf, vielmehr ist wohl zu beachten, dass, so oft der Bedarf an einem Gute niederer Ordnung nicht, oder nur unvollständig gedeckt ist, der Bedarf an jedem einzelnen der entsprechenden Güter höherer Ordnung stets nur zugleich mit dem quantitativ entsprechenden Bedarfe an den complementären Gütern höherer Ordnung sich thatsächlich geltend macht.
Setzen wir z. B. den Fall, dass wir bei einem noch ungedeckten Bedarfe von 10.000 Paar Schuhen für einen gegebenen Zeitraum wohl über die zur Herstellung einer solchen Quantität von Schuhen erforderliche Quantität von Werkzeugen, Arbeitsleistungen etc. aber nur über die zur Hervorbringung von 5000 Paar Schuhen nöthigen Lederquantitäten, oder umgekehrt über die sämmtlichen übrigen zur Herstellung von 10.000 Paar Schuhen erforderlichen Güter höherer Ordnung, aber nur über die zur Hervorbringung von 5000 Paar Schuhen erforderlichen Arbeitsleistungen verfügen könnten, so ist kein Zweifel, dass sich, mit Rücksicht auf den obigen Zeitraum, unser Gesammtbedarf vor wie nach auf solche Quantitäten der einzelnen zur Hervorbringung von Schuhen erforderlichen Güter höherer Ordnung erstrecken-würde, die zur Production der obigen Quantität von Schuhen ausreichen, unser effectiver Bedarf würde sich jedoch auch rücksichtlich der übrigen complementären Gütern nur auf solche Quantitäten erstrecken, die zur Herstellung von 5000 Paar Schuhen erforderlich sind, der übrige Bedarf aber ein latenter sein und erst dann ein effectiver werden, wenn auch die obigen uns mangelnden complementären Quantitäten uns verfügbar würden.
Es ergiebt sich aber aus dem Gesagten das Gesetz, dass, mit Rücksicht auf gegebene kommende Zeiträume, unser effectiver Bedarf an den einzelnen Gütern höherer Ordnung dadurch bedingt ist, dass wir über die complementären Quantitäten der entsprechenden Güter höherer Ordnung zu verfügen vermögen.
Als in Folge des nordamerikanischen Bürgerkrieges die Baumwollzufuhren nach Europa sich beträchtlich verminderten, blieb der Bedarf an Baumwollstoffen offenbar ziemlich unverändert, [42] indem der obige Krieg das Bedürfniss nach diesen Gütern nicht wesentlich ändern konnte. In soweit nun dieser Bedarf an Baumwollstoffen für gegebene Zeiträume nicht bereits durch fertige Manufacturproducte gedeckt war, entstand folgerecht ein Bedarf an den entsprechenden Quantitäten der zur Hervorbringung von Baumwollstoffen erforderlichen Gütern höherer Ordnung und es ist klar, dass auch dieser Bedarf im Grossen und Ganzen durch den Bürgerkrieg in keinerlei Weise beträchtlich alterirt werden konnte. Da indess die verfügbare Quantität eines der hier erforderlichen Güter höherer Ordnung, der rohen Baumwolle nämlich, sich beträchtlich verminderte, so hatte dies zur naturgemässen Folge, dass ein Theil des bisherigen Bedarfes an den mit Rücksicht auf die Erzeugung von Baumwollstoffen complementären Gütern der Baumwolle (Arbeitsleistungen, Maschinen etc.) latent wurde, der effective Bedarf an den complementären Gütern der rohen Baumwolle sich aber bis auf die zur Verarbeitung der verfügbaren Quantität von roher Baumwolle erforderlichen Quantitäten herabminderte Sobald indess die Zufuhr von roher Baumwolle wieder einen Aufschwung nahm, musste auch sofort der effective Bedarf an diesen Gütern eine Steigerung erfahren, und zwar in dem Verhältnisse, als der latente Bedarf sich verminderte.
Auswanderer verfallen in Folge der Anschauungen, die sie aus hochentwickelten Mutterländern mitbringen, nicht selten in den Fehler, zunächst und mit Hintansetzung wichtigerer Rücksichten, nach einem ausgedehnten Grundbesitze zu streben, selbst ohne Rücksicht darauf, ob ihnen die entsprechenden Quantitäten der übrigen complementären Güter jener Ländereien verfügbar sind. Und doch ist nichts sicherer, als dass sie in der Heranziehung von Grundstücken zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse nur in dem Masse fortschreiten können, als sie sich die entsprechenden complementären Quantitäten von Samen - Getreide, Vieh, Ackerbauwerkzeugen, landwirthschaftlichen Arbeitsleistungen u. dgl. m. zu verschaffen im Stande sind. Es liegt aber in ihrer Handlungsweise ein Verkennen des obigen Gesetzes, das sich unabweisbar geltend macht und dem sich die Menschen in seinem Geltungsgebiete entweder fügen, oder aber die verderblichen Folgen seiner Ausserachtlassung tragen müssen.
[43]
Je weiter die Menschen in der Cultur fortschreiten, um so mehr pflegen bei hoch entwickelter Arbeitstheilung einzelne Personen Quantitäten von Gütern höherer Ordnung unter der stillschweigenden und, der Regel nach, auch zutreffenden Voraussetzung zu produciren, dass andere Personen die entsprechenden Quantitäten der complementären Güter ihrerseits hervorbringen werden. Diejenigen, welche Operngläser verfertigen, produciren in den seltensten Fällen die Glaslinsen, die Elfenbein-oder Schildkrötendecken und die Bronce, aus welchen diese Operngläser zusammengesetzt sind. Vielmehr ist bekannt, dass die Verfertiger dieser Gläser der Regel nach die einzelnen Theile derselben von besonderen Fabrikanten oder Künstlern beziehen, diese Theile nur zusammensetzen und etwa noch die letzte Hand an dieselben legen. Der Glasschleifer, welcher die Linsen, der Galanteriewaaren-Arbeiter, der die Elfenbein- oder Schildkrötendecken, und der Broncearbeiter, welcher das Broncewerk verfertigt, alle diese Personen sind unter der stillschweigenden Voraussetzung thätig, dass ein Bedarf an ihren Producten vorhanden ist und doch ist nichts sicherer, als dass der effective Bedarf an den Producten eines jeden einzelnen derselben durch die Production der complementären Quantitäten bedingt ist, so zwar, dass wenn die Production der Glaslinsen eine Unterbrechung erleidet, auch der effective Bedarf an den übrigen zur Production von Fernröhren, Operngläsern und dergleichen Güter mehr erforderlichen Gütern höherer Ordnung latent wird und dann wirthschaftliche Störungen zu Tage treten, welche man im gewöhnlichen Leben als völlig abnorm zu bezeichnen pflegt, die in Wahrheit aber ganz gesetzmässig sind.
c) Die Zeitgrenzen, innerhalb welcher sich die menschlichen Bedürfnisse
geltend machen.
Es erübrigt uns nur noch bei der gegenwärtigen Untersuchung das Moment der Zeit in Betracht zu ziehen und darzuthun, innerhalb welcher Zeitgränzen unser Bedarf an Gütern thatsächlich hervortritt.
Hier ist nun zunächst klar, dass unser Bedarf an Gütern erster Ordnung, mit Rücksicht auf einen gegebenen kommenden Zeitraum, gedeckt erscheint, wofern wir innerhalb dieses Zeitraumes [44] über die bezügliche Quantität der in Rede stehenden Güter erster Ordnung unmittelbar zu verfügen vermögen. Anders verhält sich dies, wofern wir unseren Bedarf an Gütern erster, oder überhaupt niederer Ordnung mittelbar, d. i. durch Quantitäten der betreffenden Güter höherer Ordnung decken sollen, und zwar wegen des Zeitaufwandes, welcher, wie wir oben sahen, von jedem Productionsprocesse unzertrennlich ist. Nennen wir den der Gegenwart zunächstliegenden, bis zu dem Zeitpuncte, wo aus den in unserer Verfügung befindlichen Gütern zweiter Ordnung bereits die entsprechenden Güter erster Ordnung hergestellt sein können, reichenden Zeitraum die Periode I, den sich hieranschliessenden, bis zu dem Zeitpuncte, wo aus den uns verfügbaren Gütern dritter Ordnung bereits Güter erster Ordnung hergestellt sein können, reichenden Zeitraum die Periode II, und so fort die folgenden Zeiträume die Perioden III, IV u. s. w., so ergibt sich mit Rücksicht auf jede besondere Güterart eine Reihenfolge von Zeiträumen, für welche wir zunächst und unmittelbar einen Bedarf an Gütern erster Ordnung haben, einen Bedarf, der dadurch, dass wir innerhalb dieser Zeiträume über die bezüglichen Quantitäten von Gütern erster Ordnung unmittelbar verfügen, auch thatsächlich gedeckt ist.
Setzen wir nun aber den Fall, wir wollten unsern Bedarf an Gütern erster Ordnung innerhalb der Periode II durch Güter vierter Ordnung decken, so ist klar, dass dies physisch unmöglich wäre, und eine Deckung des diesbezüglichen Bedarfes an Gütern erster Ordnung innerhalb der gedachten Zeitperiode nur durch Güter erster oder zweiter Ordnung erfolgen könnte.
Die obige Beobachtung gilt nicht nur für unseren Bedarf an Gütern erster, sondern für unseren Bedarf an allen Gütern niederer Ordnung im Gegenhalte zu den uns verfügbaren Gütern höherer Ordnung. Wir können zum Beispiel unsern Bedarf an Gütern dritter Ordnung innerhalb der Periode V nicht dadurch decken, dass wir innerhalb dieser Periode über die entsprechenden Quantitäten von Gütern sechster Ordnung verfügen, es ist vielmehr ersichtlich, dass wir zu diesem Zwecke über die letzteren Güter bereits innerhalb der Periode II verfügen müssten.
Wenn der Bedarf eines Volkes an Getreide für die laufende [45] Jahresperiode im Spätherbste nicht unmittelbar durch Quantitäten von solchem gedeckt wäre, so würde es dann viel zu spät sein, zu diesem Zwecke die verfügbaren Grundstücke, landwirthschaftlichen Geräthe, Arbeitsleistungen u. dgl. m. heranziehen zu wollen, wohl aber wäre dies der rechte Zeitpunkt, um mittelst der obigen Güter höherer Ordnung den Getreidebedarf der nächsten Jahresperiode zu decken, und, um unseren Bedarf an den Arbeitsleistungen intelligenter Schullehrer in dem nächsten Decennium seinerzeit decken zu können, müssen wir schon in der Gegenwart taugliche Individuen hiefür heranbilden.
Der menschliche Bedarf an Gütern höherer Ordnung ist demnach, gleich wie jener an Gütern erster Ordnung, nicht nur eine Grösse, welche sich in quantitativer Beziehung in streng gesetzmässiger Weise regelt und von den Menschen, so weit die practische Nöthigung hiezu vorliegt, vorausberechnet werden kann, sondern zugleich ein solcher, welcher innerhalb bestimmter Zeitgrenzen zu Tage tritt, so zwar, dass die Menschen, auf Grundlage ihrer Erfahrungen über ihre Bedürfnisse und den Process der Gütererzeugung, die Quantitäten der einzelnen Güter sowohl, deren sie zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse benöthigen werden, als auch die Zeiträume, innerhalb welcher ihr Bedarf an den einzelnen Gütern zu Tage treten wird, mit einer für ihre praktischen Bestrebungen ausreichenden, überdies aber, wie die Erfahrung lehrt, sich stets vervollkommnenden Genauigkeit voraus zu berechnen im Stande sind.
§. 2.
Die verfügbaren Quantitäten.
Ist es anders richtig, dass bei jeder Thätigkeit des Menschen die Klarheit des Handeluden über das Ziel seiner Bestrebungen ein wesentliches Moment des Erfolges ist, so ist auch sicher, dass die Erkenntniss des Güterbedarfes in kommenden Zeiträumen sich uns als die erste Voraussetzung aller auf die Befriedigung der Bedürfnisse gerichteten vorsorglichen Thätigkeit der Menschen darstellt. Wie immer demnach die äussern Verhältnisse sein mögen, unter welchen sich die obige Thätigkeit der Menschen entwickelt, der Erfolg derselben wird durch [46] die richtige Voraussicht der ihnen in kommenden Zeiträumen erforderlichen Güterquantitäten, das ist ihres Bedarfes, wesentlich mitbedingt sein, und es ist klar, dass der völlige Mangel dieser Voraussicht jede auf die Befriedigung ihrer Bedürfnisse gerichtete vorsorgliche Thätigkeit überhaupt unmöglich machen würde.
Das zweite Moment, welches den Erfolg der menschlichen Thätigkeit bestimmt, ist der Einblick des Handelnden in die zur Erreichung der angestrebten Zwecke ihm verfügbaren Mittel. Wo immer demnach die Menschen ihre auf die Befriedigung der Bedürfnisse gerichtete Thätigkeit entfalten, dort sehen wir sie eifrig darauf bedacht, einen möglichst genauen Einblick in die ihnen für den obigen Zweck verfügbaren Güterquantitäten zu gewinnen. Die Art und Weise, in welcher sie hiebei vorgehen, ist der Gegenstand, der uns in diesem Abschnitte beschäftigen wird.
Die Grösse der den einzelnen Mitgliedern eines Volkes verfügbaren Güterquantitäten ist jeweilig durch die Sachlage selbst gegeben und dieselben haben bei Feststellung der in Rede stehenden Quantitäten keine andere Aufgabe, als die ihnen verfügbaren Güter zu inventarisiren und zu messen. Das ideale Ziel dieser beiden Akte der vorsorglichen Thätigkeit der Menschen ist die vollständige Aufnahme der ihnen in einem gegebenen Zeitpunkte verfügbaren Güter, die Classificirung derselben in vollkommen gleichartige Quantitäten und die genaue Bestimmung der Grösse dieser letzteren. Im practischen Leben pflegen jedoch die Menschen, fern davon dies ideale Ziel zu verfolgen, meist nicht einmal die volle Genauigkeit anzustreben, welche nach dem jeweiligen Stande der Kunst des Inventarisirens und Messens der Güter zulässig ist und sich mit jenem Grade der Genauigkeit zu begnügen, welchen ihre practischen Zwecke eben erfordern. Bezeichnend bleibt es indess jedenfalls für die hohe practische Wichtigkeit, welche die genaue Kenntniss der jeweilig einer Person verfügbaren Güterquantitäten für dieselbe hat, dass wir eine solche in ganz vorzüglichem Masse bei Kaufleuten, Industriellen und überhaupt bei solchen Personen finden, deren vorsorgliche Thätigkeit eine hoch entwickelte ist. Einer gewissen Kenntniss der verfügbaren Güterquantitäten begegnen wir indess [47] selbst auf den tiefsten Culturstufen, denn es ist klar, dass der völlige Mangel derselben jede auf die Befriedigung ihrer Bedürfnisse gerichtete vorsorgliche Thätigkeit der Menschen überhaupt unmöglich machen würde.
Sind solcherart die Menschen nach Massgabe der Entwicklung ihrer auf die Befriedigung ihrer Bedürfnisse gerichteten vorsorglichen Thätigkeit bemüht, über die Grösse der ihnen jeweilig verfügbaren Güterquantitäten zur Klarheit zu gelangen, so können wir überall dort, wo bereits ein nennenswerther Güterverkehr besteht, gleichzeitig das Bestreben derselben wahrnehmen, auch über die jeweilig den übrigen Mitgliedern des Volkes, mit welchen sie durch den Verkehr verbunden sind, verfügbaren Güterquantitäten sich ein Urtheil zu bilden.
So lange die Menschen keinen nennenswerthen Verkehr mit einander treiben, hat Jedermann selbstverständlich nur ein geringes Interesse daran, zu wissen, welche Güterquantitäten sich in den Händen anderer Personen befinden. Sobald indess, zumal in Folge der Theilung der Arbeit, sich ein ausgedehnter Verkehr entwickelt, und die Menschen sich rücksichtlich der Deckung ihres Bedarfes zum grossen Theile auf den Austausch angewiesen sehen, gewinnen dieselben naturgemäss ein sehr naheliegendes Interesse daran, nicht nur über ihren eigenen Güterbesitz, sondern auch über jenen aller andern mit ihnen im Tauschverkehre stehenden Personen unterrichtet zu sein, denn der Güterbesitz dieser Letztern ist ihnen dann, zum nicht geringen Theile, wenn auch nicht direct, so doch indirect (auf dem Wege des Tausches) verfügbar.
Sobald die Cultur eines Volkes eine gewisse Höhe erreicht hat, pflegt indess mit der wachsenden Arbeitstheilung eine besondere Berufsclasse zu entstehen, welche den Verkehr vermittelt und den übrigen Mitgliedern der Gesellschaft nicht nur die Sorge für den mechanischen Theil der Verkehrs-Operationen (Verfrachtung, Theilung, Conservirung der Güter etc.), sondern auch für die Evidenzhaltung der verfügbaren Quantitäten abnimmt, und so gelangen wir zu der Erscheinung, dass eine gewisse Classe von Personen ein specielles, mit ihrem Berufe verknüpftes Interesse daran hat, neben manchen anderen allgemeinen Verhältnissen, über welche wir uns später zu äussern Gelegenheit haben [48] werden, auch den jeweiligen Stand der den einzelnen Volkstheilen oder Völkern, deren Verkehr sie vermitteln, verfügbaren Güterquantitäten, der sogenannten Stocks im weitesten Sinne dieses Wortes, in Evidenz zu halten, eine Thätigkeit, die sich nach Massgabe der Stellung, welche die in Rede stehenden Mittels personen im Verkehrsleben einnehmen, auf engere oder weitere Verkehrsgebiete, auf einzelne Kreise, Provinzen, oder aber auf ganze Länder und Welttheile erstreckt.
Dieser Evidenzhaltung, so weit sie sich auf die, grösse ren Gruppen von Individuen, oder gar ganzen Völkern und Völkergruppen jeweilig verfügbaren Güterquantitäten bezieht, stellen sich indess nicht geringe Schwierigkeiten entgegen, indem die genaue Feststellung der hier in Rede stehenden Stocks doch nur auf dem Wege der Erhebung stattfinden könnte, dieser Weg indess einen complicirten, über ganze Verkehrsgebiete ausgedehnten Apparat von öffentlichen, mit den nöthigen Vollmachten versehenen Beamten zur Voraussetzung hat, wie ein solcher nur von Staatsregierungen und auch von diesen nur innerhalb ihrer Territorien beigestellt werden kann, ein Apparat, dessen Wirksamkeit selbst innerhalb dieser Grenzen noch überdies, wie jedem Sachverständigen bekannt ist, überall dort versagt, wo es sich um Güter handelt, deren verfügbare Quantität der öffentlichen Controle nicht leicht zugänglich ist.
Auch können dergleichen Erhebungen füglich doch nur von Zeit zu Zeit, und zwar meist nicht anders, als in längern Zwischenräumen vorgenommen werden, so zwar, dass die für bestimmte Zeitpunkte gewonnenen Angaben, selbst wenn sie auf Verlässlichkeit Anspruch machen können, doch bei allen Gütern, deren verfügbare Quantität einem starken Wechsel unterworfen ist, ihren practischen Werth nicht selten schon dann eingebüsst haben, wenn sie an die Oeffentlichkeit gelangen.
Die auf die Feststellung der einem Volke oder einem Volkstheile jeweilig verfügbaren Güterquantitäten gerichtete staatliche Thätigkeit beschränkt sich demnach naturgemäss auf solche Güter, deren Quantitäten, wie dies bei Grundstücken, Gebäuden, Hausthieren, Verkehrsmitteln etc. der Fall ist, nicht allzusehr dem Wechsel unterliegen, so zwar, dass zeitweilig mit Rücksicht auf bestimmte Zeitpunkte vorgenommene Erhebungen auch für [49] spätere Zeitpunkte ihren Werth behaupten und auf Güter andererseits, deren verfügbare Quantität der öffentlichen Controlle in so weit unterworfen ist, dass die Richtigkeit der gewonnenen Ziffern hiedurch doch einigermassen verbürgt wird.
Bei dem hervorragenden Interesse, welches unter den oben gezeichneten Verhältnissen die Geschäftswelt an der möglichst genauen Kenntniss der in gewissen Verkehrsgebieten verfügbaren Quantitäten von Gütern hat, ist es jedoch begreiflich, dass dieselbe sich mit den lückenhaften Ergebnissen der diesbezüglichen, meist von geringem kaufmännischen Verständnisse geleiteten Thätigkeit der Regierungen, welche sich überdies doch immer nur auf bestimmte Länder oder Landestheile, nicht aber auf ganze Verkehrsgebiete erstreckt nicht begnügt, sondern sich selbstständig, nicht selten mit grossen Opfern, eine allseitige und möglichst genaue Kenntniss der in Rede stehenden Quantitäten zu verschaffen sucht und dies Bedürfniss zahlreiche, den speciellen Interessen der Geschäftswelt dienende Organe hervorgerufen hat, deren Aufgabe nicht zum geringsten Theile darin besteht, die Mitglieder jeder Geschäfts-Branche über den jeweiligen Stand der Stocks in den verschiedenen Verkehrsgebieten zu unterrichten [4].
[50]
Diese Berichte beruhen auf öffentlichen Erhebungen aller Art, welche die Geschäftswelt, wofern sie sich nur irgendwie als verlässlich erweisen, sofort sich dienstbar zu machen bestrebt ist, auf den Informationen, welche an Ort und Stelle von sachverständigen Correspondenten eingezogen werden, zum Theile auch auf Combinationen erfahrener Geschäftsleute von altbewährter Verlässlichkeit und erstrecken sich nicht nur auf die jeweilig verfügbaren Stocks, sondern auch auf jene Güterquantitäten, welche voraussichtlich in kommenden Zeiträumen in die Verfügung der Menschen treten werden [5].
Es sind diese Angaben aber zumeist ausreichend, um die Geschäftswelt über die in engeren oder weiteren Verkehrsgebieten jeweilig verfügbaren Quantitäten bestimmter Güter aufzuklären und ihr ein Urtheil über die voraussichtlichen Aenderungen der Stocks zu ermöglichen, wo aber thatsächlich Unbestimmtheiten [51] vorliegen, dieselbe auf diesen Umstand aufmerksam zu machen, um überall dort, wo in einem solchen Falle von der grösseren oder geringeren verfügbaren Quantität eines Gutes der Erfolg gewisser Geschäftsoperationen abhängt, der Geschäftswelt den gewagten Charakter dereselben bemerklich zu machen.
§. 3.
Ueber den Ursprung der menschlichen Wirthschaft und die wirthschaftlichen (ökonomischen) Güter.
a) Die wirthschaftlichen Güter.
Wir haben in den beiden vorangehenden Abschnitten gesehen, wie die einzelnen Individuen sowohl, als auch die durch den Verkehr verbundenen Bewohner ganzer Länder und Ländergruppen bemüht sind, sich einerseits über ihren Bedarf in kommenden Zeiträumen und andererseits über die ihnen zur Deckung desselben verfügbaren Güterquantitäten ein Urtheil zu bilden, um solcherart die unentbehrliche Grundlage für ihre auf die Befriedigung der Bedürfnisse gerichtete Thätigkeit zu gewinnen. Die Aufgabe, an welche wir nunmehr schreiten, ist, darzuthun, wie die Menschen, auf Grundlage der obigen Erkenntnisse, die ihnen verfügbaren Güterquantitäten (Genussmittel und Productionsmittel) der mölichst vollständigen Befriedigung ihrer Bedürfnisse zuführen.
Das Resultat der obigen Untersuchung über Bedarf und verfügbare Quantität der Güter kann ein dreifaches sein:
a) Der Bedarf ist grösser, als die verfügbare Quantität.
b) Der Bedarf ist geringer, als diese letztere.
c) Bedarf und verfügbare Quantität decken sich.
Nun können wir das erste dieser Verhältnisse, wobei nothwendigerweise ein Theil der Bedürfnisse nach den betreffenden Gütern unbefriedigt bleiben muss, bei der weitaus grössern Mehrzahl der Güter fortdauernd beobachten. Ich will hier nicht auf die Luxusgegenstände hinweisen, weil bei diesen das obige Verhältniss von selbst klar zu Tage tritt. Aber auch die gröbsten Kleidungsstücke, die gewöhnlichsten Wohnräume und Einrichtungsstücke, die gemeinsten Nahrungsmittel u. s. f. sind Güter dieser Art. Selbst Erden, Steine und die unscheinbarstch Ahfälle [52] sind uns, der Regel nach, nicht in so grosser Quantität verfügbar, dass wir nicht noch weitere Quantitäten derselben verwenden könnten.
Wo immer nun dies Verhältniss, im Hinblick auf einen gegebenen Zeitraum, zu Tage tritt, d. i., von den Menschen erkannt wird, dass der Bedarf an einem Gute grösser ist, als die ihnen verfügbare Quantität, überall dort ergibt sich für dieselben die weitere Erkenntniss, dass kein irgend wie practisch bedeutender Theil der verfügbaren Quantität seine nützlichen Eigenschaften einbüssen, oder der Verfügung der Menschen entzogen werden kann, ohne dass irgend welche concrete menschliche Bedürfnisse unbefriedigt bleiben müssten, für welche bis dahin vorgesorgt war, oder dieselben doch nur minder vollständig befriedigt werden könnten, als dies sonst der Fall gewesen wäre.
Die nächste Folge, welche diese Erkenntniss auf die der möglichst vollständigen Befriedigung ihrer Bedürfnisse zugewendete Thätigkeit der Menschen äussert, ist, dass dieselben bemüht sind:
1. jede Theilquantität der in dem obigen Quantitäten-verhältnisse stehenden Güter in ihrer Verfügung zu erhalten.
2. dieselbe in ihren nützlichen Eigenschaften zu conserviren.
Eine weitere Folge der Erkenntniss des obigen Verhältnisses zwischen Bedarf und verfügbarer Quantität ist, dass die Menschen sich einerseits bewusst werden, dass unter allen Umständen ein Theil ihrer Bedürfnisse nach den in Rede stehenden Gütern unbefriedigt bleiben wird und andererseits, dass jede unzweckmässige Verwendung von Theilquantitäten dieser Güter zur nothwendigen Folge haben muss, dass selbst ein Theil jener Bedürfnisse, für welche bei zweckmässiger Verwendung der gesammten verfügbaren Gütermenge noch vorgesorgt sein würde, unbefriedigt bleiben müsste.
Die Menschen sind bei der auf die Befriedigung ihrer Bedürfnisse gerichteten vorsorglichen Thätigkeit, rücksichtlich der im obigen Quantitätenverhältnisse stehenden Güter, demnach bemüht:
3. eine Wahl zu treffen zwischen den wichtigeren Bedürfnissen. welche sie mit den ihnen verfügbaren Quantitäten der in Rede stehenden Güter befriedigen, und jenen, welche, unbefriedigt zu lassen, sie sich bescheiden werden.
[53]
4. mit jeder gegebenen Theilquantität der im obigen Quantitätenverhältnisse stehenden Güter durch zweckmässige Verwendung einen möglichst grossen Erfolg und einen bestimmten Erfolg mit einer möglihst geringen Quantität zu erzielen, oder mit anderen Worten, die ihnen verfügbaren Quantitäten von Genussmitteln, zumal aber die ihnen verfügbaren Quantitäten von Productionsmitteln, in zweckmässigster Weise der Befriedigung ihrer Bedürfnisse zuzuführen.
Die auf die eben genannten Zwecke gerichtete Thätigkeit der Menschen in ihrer Gesammtheit nennen wir nun aber ihre Wirthschaft und die in dem obigen Quantitätenverhältnisse stehenden Güter als die ausschliesslichen Objecte derselben: die wirthschaftlichen Güter, im Gegensatze zu jenen, bei welchen die Menschen keine practische Nöthigung zur wirthschaftlichen Thätigkeit finden, und zwar aus Ursachen, die, wie wir weiter unten sehen werden, ebensowohl auf ein der exactesten Bestimmung zugängliches Quantitätenverhältniss zurückgeführt werden können wie wir dies bei den wirthschaftlichen Gütern soeben gezeigt haben [6].
[54]
Bevor wir jedoch an die Darlegung dieses Verhältnisses und der Lebenserscheinungen schreiten, welche in demselben, [55] ihre letzte Begründung finden, wollen wir noch einer Erscheinung des socialen Lebens gedenken, die von unermesslicher Bedeutung für die Wohlfahrt der Menschen geworden ist, und in ihren letzten Ursachen demselben Quantitätenverhältnisse entspringt, das wir oben kennen gelernt haben.
Wir haben bisher die Lebenserscheinungen, welche daraus resultiren, dass bei einer Gruppe von Gütern der Bedarf der Menschen grösser ist, als die ihnen verfügbare Quantität derselben, ganz im Allgemeinen, ohne besondere Rücksichtnahme auf die sociale Gliederung der Menschen dargestellt, so zwar, dass das bisher Gesagte, ebensowohl für das isolirte Individuum, als für eine Gesellschaft in ihrer Gesammtheit, wie immer sie auch organisirt sein mag, seine Geltung hat. Das Zusammenleben von Menschen, welche ihre individuellen Interessen auch als Glieder der Gesellschaft verfolgen, fördert indess bei allen jenen Gütern, welche in dem mehrerwähnten Quantitätenverhältnisse stehen, eine besondere Erscheinung zu Tage, deren Darstellung hier ihre Stelle finden mag.
Tritt nämlich das obige Quantitätenverhältniss mit Rücksicht auf eine Gesellschaft ein, das ist, steht dem grösseren Bedarfe einer Gesellschaft an einem Gute eine geringere verfügbare Quantität desselben gegenüber, so ist, nach dem was wir oben sagten, unmöglich, dass die bezüglichen Bedürfnisse aller Individuen, aus welchen die Gesellschaft zusammengesetzt ist, ihre vollständige Befriedigung finden, vielmehr ist nichts sicherer, als dass die Bedürfnisse eines Theiles der Mitglieder dieser Gesellschaft nicht, oder doch nur in unvollständiger Weise zur Befriedigung gelangen werden. Da findet denn der menschliche Egoismus einen Antrieb, sich geltend zu machen, und es wird jedes Individuum bemüht sein, dort, wo die verfügbare Quantität nicht für Alle ausreicht, seinen eigenen Bedarf mit Ausschluss der Andern möglichst vollständig zu decken.
[56]
Bei diesem Bestreben werden die einzelnen Individuen sehr verschiedene Erfolge erzielen. Wie immer aber auch die Vertheilung der in dem obigen Quantitätenverhältnisse stehenden Güter erfolgen mag, stets wird der Bedarf eines Theiles der Mitglieder der Gesellschaft nicht, oder doch nur unvollständig gedeckt sein, und es werden diese letztern demnach mit Rücksicht auf jede Theilquantität der verfügbaren Gütermenge ein Interesse haben, welches dem der jeweiligen Besitzer entgegengesetzt ist. Damit ist aber auch die Nothwendigkeit ausgesprochen, dass die einzelnen Individuen in dem Besitze der in dem obigen Quantitätenverhältnisse stehenden Güter durch die Gesellschaft gegen allfällige Gewaltthätigkeiten anderer Individuen geschützt werden, und so gelangen wir denn zu dem ökonomischen Ursprunge unserer gegenwärtigen Rechtsordnung und zunächst des sogenannten Besitzschutzes, der Grundlage des Eigenthums.
Es haben demnach die menschliche Wirthschaft und das Eigenthum einen gemeinsamen wirthschaftlichen Ursprung, denn beide haben ihren letzten Grund darin, dass es Güter gibt, deren verfügbare Quantität geringer ist, als der Bedarf der Menschen, und ist das Eigenthum somit, gleich wie die Wirthschaft der Menschen, keine willkürliche Erfindung, sondern vielmehr die einzig mögliche practische Lösung jenes Problems, das uns die Natur der Dinge, das obige Missverhältniss zwischen Bedarf und verfügbarer Gütermenge, bei allen wirthschaftlichen Gütern aufdrängt.
Es ist demnach auch unmöglich, die Institution des Eigenthums zu beseitigen, ohne die Ursachen aufzuheben, die mit Nothwendigkeit dazu führten, das ist, ohne zugleich die verfügbare Quantität sämmtlicher ökonomischen Güter so weit zu vermehren, dass der Bedarf aller Mitglieder der Gesellschaft vollständig gedeckt sei, oder aber die Bedürfnisse der Menschen so weit zu veringern, dass die ihnen verfügbaren Güter zur vollständigen Befriedigung ihrer Bedürfnisse ausreichen würden. Ohne dass solcherart das Gleichgewicht zwischen Bedarf und verfügbarer Menge hergestellt werden würde, könnte eine neue sociale Ordnung wohl bewirken, dass andere Personen die verfügbaren Quantitäten ökonomischer Güter zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse verwenden würden, als dies gegenwärtig der [57] Fall ist, niemals könnte aber hierdurch verhindert werden, dass es Personen gäbe, deren Bedarf an den ökonomischen Gütern nicht, oder nur unvollständig gedeckt wäre, und denen gegenüber die Besitzer ökonomischer Güter gegen allfällige Gewaltthätigkeiten geschützt werden müssten. Das Eigenthum in dem obigen Sinne ist demnach unzertrennbar von der menschlichen Wirthschaft in ihrer socialen Gestalt und alle socialen Reformpläne können vernünftigerweise nur auf eine zweckmässige Vertheilung der ökonomischen Güter, nicht aber auf die Aufhebung der Institution des Eigenthums selbst. gerichtet sein.
b) Die nicht ökonomischen Güter.
Wir haben in dem vorhergehenden Abschnitte die Lebenserscheinungen dargethan, welche in Folge des Umstandes zu Tage treten, dass der Bedarf an gewissen Gütern grösser ist, als die verfügbare Quantität derselben. Wir gelangen nunmehr zur Darlegung jener Thatsachen, welche in Folge des entgegengesetzten Verhältnisses zur Erscheinung gelangen, des Verhältnisses nämlich, wornach der Bedarf der Menschen an einem Gute geringer ist, als die ihnen verfügbare Quantität desselben.
Die nächste Folge dieses Verhältnisses ist die Erkenntniss Seitens der Menschen, dass nicht nur für die Befriedigung aller ihrer Bedürfnisse nach den betreffenden Gütern vollständig vorgesorgt ist, sondern dass sie die ganze ihnen verfügbare Quantität der in dem obigen Verhältnisse stehenden Güter zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse aufzubrauchen nicht in der Lage sein werden. Setzen wir den Fall. ein Gebirgsbach, der an einem Dorfe vorbeifliesst, führe während eines Tages 200.000 Eimer Wasser, mit dem Unterschiede jedoch, dass er zur Zeit von Regengüssen und im Frühjahre, wenn der Schnee der Berge schmilzt, bis zu 300.000, zur Zeit der grössten Dürre aber nur 100.000 Eimer Wasser führt. Setzen wir nun weiter den Fall, dass die Bewohner jenes Dorfes an Trink- und sonstigem Nutzwasser, bei vollständiger Befriedigung ihrer Bedürfnisse nach diesem Gute, der Regel nach 200, höchstens aber 300 Eimer täglich benöthigen, so steht ihrem höchsten Bedarfe von 300 Eimern die Verfügung über wenigstens 100.000 Eimer täglich gegenuber. In diesem und so in jedem anderen Falle, in [58] welchem das obige Quantitätenverhältniss vorliegt, ist nun klar, dass nicht nur für die Befriedigung sämmtlicher Bedürfnisse nach dem in Rede stehenden Gute vollständig vorgesorgt ist, sondern die wirthschaftenden Subjecte die ihnen verfügbare Quantität sogar nur theilweise zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse aufzubrauchen in der Lage sind. Auch ist ersichtlich, dass Theilquantitäten dieser Güter ihrer Verfügung entzogen werden, oder aber ihre nützlichen Eigenschaften einbüssen können, ohne dass hiedurch die Befriedigung ihrer Bedürfnisse irgendwie beeinträchtigt würde, wofern nur das obige Quantitätenverhältniss hiedurch nicht etwa in sein Gegentheil umgewandelt wird. Es haben demnach die wirthschaftenden Menschen, rücksichtlich dieser Güter weder die practische Nöthigung, jede Theilquantität derselben in ihrer Verfügung zu erhalten, noch auch jede dieser letztern in ihren nützlichen Eigenschaften zu conserviren.
Auch die dritte und vierte der oben erwähnten Erscheinungsformen der wirthschaftlichen Thätigkeit der Menschen kann bei den Gütern nicht beobachtet werden, deren verfügbare Quantität grösser ist, als der Bedarf an denselben. Welchen Sinn hätte nämlich, bei dem Vorhandensein dieses Verhältnisses, das Bestreben der Menschen, eine Wahl zu treffen zwischen jenen Bedürfnissen, welche sie mit der ihnen verfügbaren Quantität befriedigen, und jenen, die unbefriedigt zu lassen, sie sich bescheiden werden, dort, wo sie selbst bei vollständiger Befriedigung ihrer Bedürfnisse die ganze ihnen verfügbare Quantität aufzubrauchen ausser Stande sind? Und was könnte die Menschen bewegen, mit jeder gegebenen Quantität dieser Güter, einen möglichst grossen Erfolg, und jeden gegebenen Erfolg mit einer möglichst geringen Quantität derselben erzielen zu wollen?
Es ist somit klar, dass alle jene Formen, in welchen die wirthschaftliche Thätigkeit der Menschen zur Erscheinung gelangt, bei jenen Gütern, deren verfügbare Quantität grösser ist, als der Bedarf an denselben, in eben so naturgemässer Weise ausgeschlossen sind, als dieselben bei den im entgegengesetzten Quantitätenverhältnisse stehenden Güter nothwendigerweise zu Tage treten; sie sind denn auch keine Objecte der menschlichen Wirthschaft und wir nennen sie desshalb die nicht ökonomischen Güter.
Wir naoen bisher das Verhältniss, welches den nicht ökonomischen [59] Charakter der Güter begründet, im Allgemeinen, also ohne besondere Rücksichtsnahme auf den gegenwärtigen socialen Zustand der Menschen betrachtet. Es erübrigt uns nur noch, auf die besonderen socialen Erscheinungen hinzuweisen, welche in Folge des obigen Quantitätenverhältnisses zu Tage treten.
Das Bestreben der einzelnen Mitglieder einer Gesellschaft, mit Ausschluss aller übrigen Mitglieder derselben über correcte Güterquantitäten zu verfügen, hat, wie wir sahen, darin seinen Ursprung, dass die der Gesellschaft verfügbare Quantität gewisser Güter geringer ist, als der Bedarf und dass demnach, bei dem Umstande, als die vollständige Deckung des Bedarfes aller Individuen unter dem Vorwalten eines solchen Verhältnisses unmöglich ist, jedes einzelne Individuum den Antrieb hat, seinen Bedarf mit Anschluss aller anderen wirthschaftenden Subjecte zu decken. Bei der Concurrenz sämmtlicher Mitglieder der Gesellschaft um eine Güterquantität, die unter allen Umständen nicht ausreicht, um alle Bedürfnisse der einzelnen Individuen vollständig zu befriedigen, ist aber, wie wir sahen, eine practische Lösung des hier obwaltenden Widerspruches der Interessen nicht anders denkbar, als dadurch, dass die einzelnen Theilquantitäten der gesammten der Gesellschaft verfügbaren Quantität in den Besitz der einzelnen wirthschaftenden Subjecte gelangen und diese letzteren, bei gleichzeitigem Ausschlusse aller übrigen wirthschaftenden Individuen, in ihrem Besitze durch die Gesellschaft geschützt werden.
Wesentlich anders verhält sich nun dies bei jenen Gütern, die keinen ökonomischen Charakter haben. Hier ist die der Gesellschaft verfügbare Güterquantität grösser, als ihr Bedarf, so zwar, dass, selbst wenn alleIndividuen ihre bezüglichen Bedürfnisse vollständig befriedigen, doch noch Theilquantitäten der verfügbaren Gütermenge erübrigen, die völlig nutzlos für die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse verloren gehen Unter solchen Umständen liegt für kein Individuum die practische Nöthigung vor, sich eine für die Deckung seines Bedarfes ausreichende Theilquantität sicher zu stellen, denn die blosse Erkenntniss jenes Quantitäten-verhältnisses, das den nicht ökonomischen Charakter der betreffenden Güter begründet, ist ihm Bürgschaft zur Genüge, dass, selbst wenn alle übrigen Mitglieder der Gesellschaft ihren [60] nBedarf an diese Gütern vollständig decken, doch noch mehr als ausreichende Quantitäten davon für die Befriedigung seiner Bedürfnisse erübrigen werden.
Das Bestreben der einzelnen Individuen ist, wie die Erfahrung lehrt, denn auch nicht darauf gerichtet, Theilquantitäten der nicht ökonomischen Güter und zwar mit Ausschluss aller übrigen Individuen für die Befriedigung ihrer individuellen Bedürfnisse sich zu sichern, und es sind diese Güter, wie sie überhaupt kein Gegenstand der Wirthschaft sind, so zunächst auch kein Gegenstand des Eigenthumswillens der Menschen. Wir können vielmehr bei allen Gütern, welche in dem den nicht ökonomischen Charakter begründenden Verhältnisse stehen, auch thatsächlich ein Bild des Communismus beobachten, denn die Menschen sind Communisten überall, wo dies mit Rücksicht auf die vorhandenen natürlichen Grundlagen möglich ist. In Ortschaften, welche an Flüssen liegen, die mehr Wasser führen, als die Bewohner derselben zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse nach diesem Gute zu verwenden vermögen, geht jedes Individuum zum Flusse, um eine beliebige Quantität Wasser zu schöpfen; in Urwäldern holt sich jeder ungehindert die ihm nöthige Quantität Holz, auch lässt Jedermann soviel Luft und Licht in seine Wohnung, als ihm gut dünkt. Dieser Communismus findet aber in dem obigen Quantitätenverhältnisse seine ebenso naturgemässe Begründung, als das Eigenthum in dem entgegengesetzten Verhältnisse.
c) Verhältniss zwischen den ökonomischen und den nicht ökonomischen Gütern.
Wir haben in den beiden vorangehenden Abschnitten das Wesen und den Ursprung der menschlichen Wirthschaft in den Kreis unserer Betrachtungen gezogen und dargethan, dass der Unterschied zwischen den ökonomischen und den nicht ökonomischen Gütern in letzter Reihe in einer der exactesten Auffassung zugänglichen Verschiedenheit im Verhältnisse zwischen Bedarf und verfügbarer Quantität dieser Güter begründet ist.
Steht dies nun aber fest, so ist auch klar, dass der ökonomische, beziehungsweise der nicht ökonomische Charakter der Güter nichts ihnen Anhaftendes, keine Eigenschaft derselben ist, und dass desshalb jedes Gut, ohne Rücksicht auf innere [61] Eigenschaften, oder äusserliche Momente [7]den ökonomischen Charakter erlangt, falls es in das oben dargelegte Quantitätenverhältniss tritt und denselben ein büsst, wofern dies Verhältniss in sein Gegentheil verwandelt wird.
Die Erfahrung lehrt uns denn auch, dass Güter derselben Art, welche an bestimmten Orten keinen okonomischen Charakter aufweisen, an andern ökonomische Güter sind, ia dass Güter derselben Art an demselben Orte mit dem Wechsel der Verhältnisse auch den ökonomischen Charakter erlangen und einbüssen.
Während in quellenreichen Gegenden Quantitäten guten Trinkwassers, in Urwäldern rohe Baumstämme, in manchan [62] Ländern selbst Grundstücke keinen ökonomischen Charakter haben, weisen dieselben Güter gleichzeitig an anderen Orten den ökonomischen Charakter auf, und die Beispiele sind nicht minder zahlreich, dass Güter, welche zu einer gewissen Zeit und an einem bestimmten Orte keinen ökonomischen Charakter hatten, an demselben Orte, aber zu einer anderen Zeit den ökonomischen Charakter erlangten. Diese Verschiedenheiten und dieser Wechsel der Güter kann demnach in den Eigenschaften derselben nicht begründet sein. Wir können uns vielmehr bei genauer und sorgfältiger Prüfung der vorliegenden Verhältnisse in allen Fällen die Ueberzeugung verschaffen, dass dort, wo Güter derselben Art gleichzeitig an zwei verschiedenen Orten einen verschiedenen Charakter haben, das Verhältniss zwischen Bedarf und verfügbarer Gütermenge an den beiden Orten ein verschiedenes ist, und überall dort, wo an dem nämlichen Orte Güter, die ursprünglich den nicht ökonomischen Charakter aufwiesen, zu ökonomischen wurden, oder der umgekebrte Fall eintrat, ein Wechsel in dem obigen Quantitätenverhältnisse stattgefunden hat.
Die Ursachen, aus welchen nicht ökonomische Güter zu ökonomischen werden, können nach dem, was wir oben sagten, nur doppelter Art sein. Entweder hat diese Erscheinung ein Steigen des Bedürfnisses, oder eine Verminderung der verfügbaren Quantität zur Voraussetzung.
Die wichtigsten Ursachen, aus welchen sich eine Steigerung des Bedarfes ergibt, sind:
1. die Vermehrung der Bevölkerung, zumal die locale Anhäufung derselben,
2. die Entwickelung der menschlichen Bedürfnisse, wodurch der Bedarf derselben Volksmenge ein wachsender wird,
3. Fortschritte der Menschen in der Erkenntniss des ursächlichen Zusammenhanges der Dinge mit ihrer Wohlfahrt, wodurch neue Gebrauchszwecke der Güter entstehen.
Es sind dies aber, wie wir wohl nicht besonders zu betonen brauchen, durchaus Erscheinungen, welche den Uebergang der menschen aus niederen in höhere Culturstufen begleiten und es ergibt sich daraus die naturgemässe Folge, dass mit der wachsenden [63] Cultur die nicht ökonomischen Güter die Tendenz haben, den ökonomischen Charakter anzunehmen, und zwar hauptsächlich desshalb, weil das eine der hier Einfluss nehmenden Momente, der menschliche Bedarf nämlich, mit der Culturentwickelung sich steigert. Tritt nun noch die Verminderung der verfügbaren Quantität jener Güter, die bisher den nicht ökonomischen Charakter aufwiesen, hinzu (z. B. beim Holze durch Ausrodung, oder Devastirung von Wäldern, wie sie gewissen Culturentwicklungen eigenthümlich sind), so ist nichts natürlicher, als dass Güter, deren verfügbare Quantität auf einer frühern Culturstufe den Bedarf weit überragte und die demnach den nicht ökonomischen Charakter aufwiesen, im Laufe der Zeit zu ökonomischen werden. An vielen Orten, zumal in der neuen Welt, lässt sich dieser Uebergang des nicht ökonomischen Charakters in den ökonomischen bei einigen Gütern, zumal beim Holze und bei den Grundstücken historisch nachweisen, ja noch in der Gegenwart beobachten und ich glaube, obzwar die Nachrichten in dieser Beziehung nur mangelhafte sind, dass sich in dem einst so waldreicheu Deutschland doch nur wenige Orte finden werden, in welchen die Bewohner jenen Uebergang, z. B. beim Holze, dereinst nicht erfahren hätten.
Es ist aber nach dem Gesagten klar, dass auch aller Wechsel, wodurch ökonomische Güter zu nicht ökonomischen, und umgekehrt, diese letzten zu ökonomischen werden, lediglich auf einen Wechsel des Verhältnisses zwischen Bedarf und verfügbarer Quantität zurückzuführen ist.
Ein eigenthümliches wissenschaftliches Interesse nehmen die Güter in Anspruch, welche rücksichtlich der bei denselben zu Tage tretenden Erscheinungen eine Mittelstellung zwischen den ökonomischen und den nicht ökonomischen Gütern einnehmen.
Zu diesen sind zunächst die Güter zu zählen, welche bei bochentwickelter Cultur, um ihrer besondern Wichtigkeit willen, Seitens der Gesellschaft in so grosser Quantität producirt und der öffentlichen Benützung dargeboten werden, dass dieselben auch dem ärmsten Gesellschaftsmitgliede in beliebiger Quantität zur Verfügung stehen und somit für die Consumenten den nicht ökonomischen Charakter erlangen.
[64]
Solch ein Gut pflegt bei hoher Cultur z. B. der Volksschulunterricht zu sein. Auch gutes gesundes Trinkwasser gilt den Bewohnern vieler Städte für ein so wichtiges Gut, dass sie dasselbe, wo es nicht in natürlicher Fülle vorhanden ist, mittelst Wasserleitungen in die öffentlichen Brunnen führen und zwar in so grossen Quantitäten, dass der Bedarf der Bewohner an Trinkwasser nicht nur vollständig gedeckt ist, sondern der Regel nach noch bedeutende Quantitäten über diesen Bedarf hinaus verfügbar sind. Während auf niederen Culturstufen die Unterweisung eines Lehrers für den dieser Unterweisung Bedürftigen ein ökonomisches Gut ist, wird dies Gut bei hoch entwickelter Cultur, Dank der Vorsorge der Gesellschaft, für jeden einzelnen Bewohner des Landes zu einem nicht ökonomischen und nicht minder in vielen grossen Städten gutes und gesundes Trinkwasser, wo es bisher für die Consumenten einen ökonomischen Charakter hatte, zu einem nicht ökonomischen Gute.
Umgekehrt können Güter, welche den Menschen von Natur aus in einer ihren Bedarf übersteigenden Quantität verfügbar sind, doch für die Consumenten derselben den ökonomischen Charakter erlangen, wenn ein Gewalthaber die übrigen wirthschaften Subjecte von der freien Verfügung über diese Güter ausschliesst. In waldreichen Ländern sind die Ortschaften sehr zahlreich, die von Natur aus von holzreichen Wäldern umgeben sind, so zwar, dass die verfügbare Holzquantität den Bedarf der Bewohner weitaus übersteigt und demnach das Holz in rohen Baumstämmen dem natürlichen Laufe der Dinge nach keinen ökonomischen Charakter haben würde. Dadurch aber, dass ein Gewalthaber sich des ganzen Waldes, oder doch des weitaus grösseren Theiles desselben bemächtigt, kann er die Holzquantitäten, die den Bewohnern der betreffenden Ortschaft thatsächlich verfügbar sind, derart reguliren, dass das Holz für dieselben nichtsdestoweniger einen ökonomischen Charakter gewinnt. In den waldreichen Karpathen gibt es z. B. zahlreiche Ortschaften, in welchen die Kleingrundbesitzer, die ehemaligen Grundholden, von den Grossgrundbesitzern dass ihnen nöthige Holz kaufen müssen, während diese Letzteren selbst jährlich viele tausende Baumstämme im Walde vermodern lassen, da die ihnen verfügbaren Quantitäten weitaus grösser sind als der vorhandene [65] Bedarf. Es ist dies aber ein Fall, in welchem Güter, die dem natürlichen Laufe der Dinge nach keinen ökonomischen Charakter haben würden, für die Consumenten künstlicherweise zu ökonomischen werden, und bei welchen denn auch thatsächlich alle jene Erscheinungen des wirthschaftlichen Lebens beobachtet werden können, die den ökonomischen Gütern eigenthümlich sind [8].
Endlich sind auch noch jene Güter hieher zu rechnen, welche zwar mit Rücksicht auf die Gegenwart noch den nicht ökonomischen Charakter aufweisen, im Hinblick auf küftige Entwickelungen jedoch von den wirthschaftenden Menschen in mancher Beziehung bereits den ökonomischen Gütern gleichgeachtet werden. Wenn nämlich die verfügbare Quantität eines nicht ökonomischen Gutes sich fortauernd verringert, beziehungsweise der Bedarf an demselben sich fortdauernd vermehrt, und das Verhältniss zwischen beiden ein solches ist, dass der endliche Uebergang des nicht ökonomischen Charakters des in Rede stehenden Gutes in den ökonomischen vorausgesehen werden kann, so pflegen die wirthschaftenden Individuen concrete Theilquantitäten desselben, auch wenn das den nicht ökonomischen Charakter des Gutes begründende Quantitätenverhältniss noch thatsächlich vorliegt, mit Rücksicht auf künftige Zeiträume, doch bereits zu Gegenständen ihrer Wirthschaft zu machen und unter socialen Verhältnissen sich ihren individuellen Bedarf durch Besitzergreifung entsprechender Quantitäten sicherzustellen. Ein gleiches gilt von jenen nicht ökonomischen Gütern, deren verfügbare Quantität einem sehr starken Wechsel unterliegt, so zwar, dass nur die Verfügung über einen gewissen Ueberfluss in gewöhnlichen Zeitläufen die Verfügung über den Bedarf in Zeiten des Mangels sichert, und ebenso von allen jenen nicht ökonomischen Gütern, bei welchen die Grenze zwischen Bedarf und verfügbarer Quantität bereits so nahe gerückt ist (hieher gehört vor Allem der S. 51 erwähnte dritte Fall), dass Missbrauch oder Missverstand einzelner [66] wirthschaftenden Individuen den Uebrigen leicht verderblich werden kann, oder besondere Rücksichten (z. B. der Bequemlichkeit, Reinlichkeit etc.) die Besitzergreifung concreter Theilquantitäten der nicht ökonomischen Güter räthlich erscheinen lassen. Es kann demnach aus diesen und ähnlichen Gründen die Erscheinung des Eigenthums auch bei solchen Gütern beobachtet werden, welche rücksichtlich der übrigen Erscheinungen des wirthschaftlichen Lebens sich uns noch als nicht ökonomische Güter darstellen.
Noch möchten wir die Aufmerksamkeit unserer Leser auf einen Umstand lenken, welcher von grosser Wichtigkeit für die Beurtheilung des ökonomischen Charakters der Güter ist, wir meinen die Verschiedenheit der Qualität derselben. Wenn nämlich die gesammte verfügbare Quantität eines Gutes den Bedarf an demselben nicht zu decken vermag, so wird jede einzelne concrete Theilquantität dieses Gutes zu einem Gegenstande der menschlichen Wirthschaft, das ist, zu einem ökonomischen Gute, und zwar ohne Rücksicht auf die höhere oder geringere Qualität. Ist dagegen die verfügbare Quantität eines Gutes grösser, als der Bedarf an demselben und giebt es demnach auch Theilquantitäten, die zur Befriedigung keines wie immer gearteten Bedürfnisses herangezogen werden, so müssten nach dem, was wir oben über das Wesen der nicht ökonomischen Güter gesagt haben, alle Theilquantitäten dieses Gutes den nicht ökonomischen Charakter erlangen, wofern diese letzteren insgesammt von gleicher Beschaffenheit wären. Dadurch aber, dass Theilquantitäten der verfügbaren Menge eines Gutes gewisse Vorzüge vor den übrigen haben, so zwar, dass mittelst derselben die bezüglichen Bedürfnisse der Menschen besser, oder überhaupt vollständiger befriedigt werden können, als mittelst der letztern, kann bewirkt werden, dass die betreffenden höher qualificirten Güter den ökonomischen Charakter erlangen, während die übrigen, minder qualificirten Güter noch den nicht ökonomischen Charakter aufweisen. So können zum Beispiel in einem Lande, in dem ein Ueberfluss an Grundstücken besteht, die der Bodenbeschaffenheit oder Lage nach vorzüglicheren Grundstücke bereits den ökonomischen Charakter erlangt haben, während die minderen noch den nicht ökonomischen [67] Charakter aufweisen, und in einer Stadt, die an einem Strome liegt, der trinkbares Wasser minderer Qualität führt, können Quantitäten von Quellwasser bereits Gegenstand der Individualwirthschaft sein, während das Stromwasser noch keinen ökonomischen Charakter aufweist.
Tritt uns demnach bisweilen die Erscheinung entgegen, dass verschiedene Theilquantitäten eines Gutes gleichzeitig einen verschiedenen Charakter haben, so liegt der Grund hievon doch auch in diesem Falle immer nur darin, dass die verfügbare Quantität der höher qualificirten Güter geringer als der Bedarf ist, während die minder qualificirten Güter in einer den (durch die Güter besserer Qualität nicht bereits gedeckten) Bedarf übersteigenden Quantität verfügbar sind, und es bilden solche Fälle demnach nicht Ausnahmen, sondern vielmehr eine Bestätigung der hier dargelegten Grundsätze.
d) Die Gesetze, unter welchen die Güter in Rücksicht auf ihren ökonomischen
Charakter stehen.
Wir sind in unseren Untersuchungen über die Gesetze, nach welchen der menschliche Bedarf sich regelt, zu dem Resultate gelangt, dass derselbe, so weit er sich auf Güter höherer Ordnung bezieht, zunächst durch unseren Bedarf an den entsprechenden Gütern niederer Ordnung, überdies aber auch noch dadurch bedingt ist, dass unser Bedarf an diesen letzteren nicht, oder doch nur zum Theile gedeckt ist. Die Güter, deren verfügbare Quantität den Bedarf nicht vollständig deckt, haben wir aber die ökonomischen genannt und es ergibt sich sonach der Grundsatz, dass unser Bedarf an Gütern höherer Ordnung durch den ökonomischen Charakter der entsprechenden Güter niederer Ordnung bedingt ist.
In Ortschaften, in welchen gutes und gesundes Trinkwasser in einer den Bedarf der Bevölkerung übersteigenden Quantität vorhanden ist und dies Gut demnach den nicht ökonomischen Charakter aufweist, kann kein Bedarf an allen jenen Vorrichtungen oder Transportmitteln entstehen, welche ausschliesslich zur Herleitung und Filtrirung, beziehungsweise zur Zufuhr von Trinkwasser dienlich sind, und in Gegenden, in welchen ein natürlicher Ueberfluss an Brennholz (eigentlich an Baumstämmen) [68] besteht, dieses Gut demnach den nicht ökonomischen Charakter hat, ist offenbar jeder Bedarf an den ausschliesslich zur Hervorbringung von Brennholz tauglichen Gütern höherer Ordnung von vornherein ausgeschlossen, während in Gegenden, wo das Trinkwasser, beziehungsweise das Brennholz den ökonomischen Charakter aufweisen, ein Bedarf an den obigen Gütern höherer Ordnung allerdings zu Tage tritt.
Ist es nun aber sicher, dass der menschliche Bedarf an Gütern höherer Ordnung durch den ökonomischen Charakter der entsprechenden Güter niederer Ordnung bedingt ist, und dass ein Bedarf an Gütern höherer Ordnung, wofern dieselben nicht zur Hervorbringung ökonomischer Güter verwendbar sind, gar nicht entstehen kann, so kann dieser letztere in diesem Falle auch nie grösser werden, als die etwa verfügbare, wenn auch noch so geringfügige Quantität der betreffenden Güter höherer Ordnung und ist somit der ökonomischen Charakter dieser letztern von vornherein ausgeschlossen.
Es ergibt sich aber hieraus der allgemeine Grundsatz, dass der ökonomische Charakter der Güter höherer Ordnung durch jenen der Güter niederer Ordnung bedingt ist, zu deren Hervorbringung sie dienen, oder mit andern Worten, dass kein Gut höherer Ordnung den ökonomischen Charakter erlangen, oder behaupten kann, es wäre denn zur Hervorbringung ökonomischer Güter niederer Ordnung tauglich.
Wenn demnach Güter niederer Ordnung, welche den ökonomischen Charakter aufweisen, unserer Beurtheilung vorliegen und die Frage nach den letzten Ursachen des ökonomischen Charakters derselben entsteht, so hiesse es das wahre Verhältniss geradezu verkehren, wollte man annehmen, dass dieselben desshalb ökonomische Güter sind, weil die zu ihrer Hervorbringung verwendeten Güter, ehe sie dem Productionsprocesse unterzogen wurden, den ökonomischen Charakter aufwiesen. Eine solche Annahme würde zunächst aller Erfahrung widersprechen, welche uns lehrt, dass aus Gütern höherer Ordnung deren ökonomischer Charakter ausser allem Zweifel steht, doch gänzlich unbrauchbare Dinge, demnach auch solche hervorgebracht werden können, und in Folge ökonomischen Universtands thatsächlich [69] hervorgebracht werden, die nicht einmal die Güterqualität, geschweige denn den ökonomischen Charakter aufweisen. Es lassen sich aber auch Fälle denken, wo aus ökonomischen Gütern höherer Ordnung Dinge producirt werden könnten, die zwar Güterqualität, aber keinerlei ökonomischen Charakter hätten. Man denke nur an Personen, die in Urwädern mit dem Aufwande von ökonomischen Gütern Holz produciren, in Gegenden, die Ueberfluss an Trinkwasser haben, solches mit dem Aufwande von ökonomischen Gütern herbeischaffen, oder aber mit Aufwendung kostbarer Stoffe Luft u. dgl. m. hervorbringen würden.
Der ökonomische Charakter eines Gutes kann demnach nicht die Folge des Umstandes sein, dass dasselbe aus ökonomischen Gütern höherer Ordnung hervorgebracht wurde, und wäre demnach diese Erklärung der obigen Erscheinung des wirthschaftlichen Lebens der Menschen unter allen Umständen und selbst dann zu verwerfen, wenn sie nicht auch sonst noch einen inneren Widerspruch in sich trüge. Die Erklärung des ökonomischen Charakters der Güter niederer Ordnung durch jenen der Güter höherer Ordnung ist nämlich nur eine scheinbare und erfüllt, abgesehen von ihrer Unrichtigkeit, und dem Widerspruche, in welchem sie zu aller Erfahrung steht, nicht einmal die formellen Bedingungen der Erklärung einer Erscheinung. Dadurch nämlich, dass wir den ök nomischen Charakter der Güter erster Ordnung durch jenen der Güter zweiter Ordnung, diesen durch den ökonomischen Charakter der Güter dritter Ordnung, diesen durch jenen der Güter vierter Ordnung und so fort erklären, wird die Lösung der Frage, im Grunde genommen, auch nicht um einen Schritt gefördert, indem ja dann doch noch immer die Frage nach der letzten und eigentlichen Ursache des ökonomischen Charakters der Güter unbeantwortet bleibt.
Aus unserer bisherigen Darstellung geht aber hervor, dass der Mensch mit seinen Bedürfnissen und seiner Gewalt über die Mittel zur Befriedigung derselben der Ausgangspunkt und Zielpunkt aller menschlichen Wirthschaft ist. Der Mensch empfind et zunächst Bedürfnisse nach Gütern erster Ordnung und macht diejenigen, deren ihm verfügbare Menge geringer ist, als sein Bedarf, zu Gegenständen seiner wirthschaftlichen Thätigkeit, zu [70] wirthschaftlichen Gütern, während er die übrigen in den Kreis seiner ökonomischen Thätigkeit einzubeziehen keine practische Veranlassung findet.
Später führen Nachdenken und Erfahrung die Menschen zu immer tieferer Erkenntniss des ursächlichen Zusammenhanges der Dinge und zumal des Zusammenhanges derselben mit ihrer Wohlfahrt, und sie lernen die Güter zweiter, dritter und höherer Ordnung kennen. Aber auch bei diesen Gütern finden sie, gleichwie bei den Gütern erster Ordnung, dass einige derselben ihnen in einer den Bedarf übersteigenden Quantität verfügbar sind, während bei den übrigen das entgegengesetzte Verhältniss obwaltet, und sie scheiden auch diese Güter in solche, die sie in den Kreis ihrer wirthschaftlichen Thätigkeit einbeziehen, und in andere, bei welchen sie hiezu keine practische Nöthigung empfinden. Dies ist aber der Ursprung des ökonomischen Charakters der Güter höherer Ordnung.
§. 4.
Das Vermögen.
„Die Gesammtheit der einer Person verfugbaren Guter“ haben wir oben (S. 31) den Güterbesitz derselben genannt, die Gesammtheit der einem wirthschaftenden Subjecte verfügbaren [9] ökonomischen Güter nennen wir dagegen sein Vermögen [10]und sind demnach die in der Verfügung eines wirthschaftenden Subjectes befindlichen nicht ökonomischen Güter, wie sie überhaupt nicht Gegenstände seiner Wirthschaft sind, so auch nicht als Theile seines Vermögens zu betrachten. [71] Nun haben wir gesehen, dass die ökonomischen Güter diejenigen sind, deren verfügbare Quantität geringer ist, als der Bedarf an denselben. Das Vermögen liesse sich demnach auch definiren als „die Gesammtheit der einem wirthschaftenden Subjecte verfügbaren Güter, deren Quantität geringer ist, als der [72] Bedarf an denselben“, und gäbe es somit in einer Gesellschaft, welcher alle Güter in einer ihren Bedarf übersteigenden Menge verfügbar wären, weder ökonomische Güter, noch auch „Vermögen“ Das Vermögen ist demnach wohl ein Massstab für den Grad der Vollständigkeit, mit welcher eine Person ihre Bedürfnisse im Vergleiche mit andern Personen, die unter gleichen Verhältnissen ihre wirthschaftliehe Thätigkeit entwickeln, befriedigen kann, aber durchaus nicht ein absoluter Massstab derselben [11], denn die höchste Wohlfahrt aller Individuen und der Gesellschaft wäre dann erreicht, wenn die der Gesellschaft verfügbaren Güterquantitäten so gross wären, dass Niemand eines Vermögens bedürfte.
Es sollen aber diese Bemerkungen die Lösung eines Problems einleiten, welches, wegen der scheinbaren Antinomien, zu welchen es führt, geeignet ist, Misstrauen gegen die Richtigkeit der Grundsätze unserer Wissenschaft hervorzurufen. Es wurde nämlich darauf hingewiesen, dass durch eine fortgesetzte Vermehrung der den wirthschaftenden Subjecten verfügbaren ökonomischen Güter, diese letzteren schliesslich nothwendigerweise den ökonomischen Charakter einbüssen und solcherart die Vermögensbestandtheile eine Verminderung erfahren müssten. Es würde demnach der eigenthümliche Widerspruch zu Tage treten, dass eine fortgesetzte Vermehrung der Vermögens-Objecte schliesslich eine Verminderung der Vermögens-Objecte zur nothwendigen Folge hätte [12].
[73]
Die verfügbare Quantität irgend eines Mineralwassers sei beispielsweise bei einem Volke geringer, als der Bedarf. Die in der Verfügung der einzelnen wirthschaftenden Personen befindlichen Theilquantitäten dieses Gutes, sowie die einzelnen Quellen, sind demnach ökonomische Güter, Vermögensbestandtheile. Setzen wir nun den Fall. dass plötzlich einige Bäche dies Heilwasser zu führen begännen, und zwar in so reichlichem Masse, dass dasselbe dadurch seinen bisherigen ökonomischen Charakter einbüssen würde. In diesem Falle ist nichts sicherer, als dass die oben erwähnten, bis zum Eintritte des eben gedachten Ereignisses den wirthschaftenden Individuen verfügbaren Quantitäten von Mineralwasser, so wie die Mineralquellen selbst, aufhören würden Vermögens-Bestandtheile zu sein, und es würde demnach allerdings der Fall eintreten, dass die fortgesetzte Vermehrung von Vermögensbestandtheilen schliesslich und endlich eine Verminderung derselben zur Folge haben würde.
Dieses Paradoxon ist auf den ersten Blick höchst auffällig, erweist sich indess bei genauerer Betrachtung nur als ein scheinbares. Die ökonomischen Güter sind, wie wir oben sahen, solche, deren verfügbare Quantität geringer ist, als der Bedarf an denselben, also jene Güter, an welchen ein partieller Mangel besteht, und das Vermögen der wirthschaftenden Individuen ist nichts Anderes, als die Gesammtheit dieser Güter. Wird nun die verfügbare Quantität derselben fortschreitend vermehrt, bis diese Güter ihren ökonomischen Charakter endlich einbüssem, so existirt dann eben nicht weiter Mangel an denselben und sie treten aus dem Kreise jener Güter, welche Theile des Vermögens der wirthschaftenden Menschen bilden, das ist aus dem Kreise jener Güter, an welchen partieller Mangel besteht. In dem Umstande, dass die fortgesetzte Vermehrung eines Gutes, an welchem Mangel besteht, schliesslich und endlich bewirkt, dass dasselbe aufhört, ein solches zu sein, darin liegt nun aber doch sicherlich kein Widerspruch.
Dass die fortgesetzte Vermehrung der ökonomischen Güter schliesslich eine Verminderung jener Güter zur Folge haben muss, an welchen bis dahin Mangel bestand, ist vielmehr ein Satz, der Jedermann ebenso unmittelbar einleuchtet, als der entgegengesetzte, dass eine durch längere Zeit fortgesetzte Verminderung [74] der im Ueberflusse vorhandenen (der nicht ökonomischen Güter) schliesslich bewirken muss, dass dieselben zu solchen werden, an welchen theilweiser Mangel besteht, das ist zu Vermögensbestandtheilen und der Kreis dieser letzteren daher eine Erweiterung erfährt.
Das obige Parodoxon, das übrigens nicht nur hier, wo es sich lediglich um den Umfang der Vermögensobjecte handelt, sondern in analoger Weise auch rücksichtlich des Werthes und Preises der ökonomischen Güter aufgestellt wurde [13], ist demnach nur ein scheinbares und beruht auf der Verkennung des Wesens des Vermögens und seiner Bestandtheile.
Wir haben das Vermögen als die Gesammtheit der einem wirthschaftenden Subjecte verfügbaren ökonomischen Güter bezeichnet. Ein jedes Vermögen setzt demnach ein wirthschaftendes Subject, oder doch ein solches voraus, für welches gewirthschaftet wird. Die einem bestimmten Zweck gewidmeten Quantitäten ökonomischer Güter sind demnach kein Vermögen im ökonomischen Sinne des Wortes, da die Fiction einer juristischen Person wohl für die Zwecke der practischen Rechtspflege, oder aber selbst zum Zweck juristischer Constructionen gelten mag, für unsere Wissenschaft aber, die jede Fiction zurückweist, entschieden nicht vorhanden ist. Die sogenannten „Zweckvermögen“ sind demnach Quantitäten ökonomischer Güter, welche bestimmten Zwecken gewidmet sind, aber nicht Vermögen im ökonomischen Sinne des Wortes.
Die obige Frage führt uns zu jener über das Wesen des Volksvermögens. Staaten, einzelne Landestheile, Gemeinden und Gesellschaften verfügen der Regel nach über Quantitäten ökonomischer Güter, um ihre Bedürfnisse befriedigen, um ihre Zwecke verwirklichen zu können. Hier ist die Fiction einer juristischen Person für den Nationalökonomen nicht erforderlich. Für den existirt ohne jede Fiction ein wirthschaftendes Subject, eine Gesellschaft, welche gewisse, ihr für den Zweck der Befriedigung ihrer Bedürfnisse verfügbare ökonomische Güter durch ihre Organe verwaltet und dieser Bestimmung zuführt. Niemand wird demnach auch Anstand nehmen, die Existenz von [75] Staats-, Landes-, Gemeinde- und Gesellschafts- Vermögen anzuerkennen.
Anders verhält es sich mit dem, was man mit dem Ausdrucke „Volksvermögen“ bezeichnet. Hier handelt es sich nicht' um die Gesammtheit der einem Volke zur Befriedigung seiner Bedürfnisse verfügbaren, von dessen Organen verwalteten und der obigen Bestimmung zugeführten ökonomischen Güter, sondern um die Gesammtheit derjenigen, welche den einzelnen wirthschaftenden Individuen und Gesellschaften in einem Volke und diesem selbst für ihre individuellen Zwecke verfügbar sind, also um einen Begriff, der von dem, was wir ein Vermögen nennen, in manchen wesentlichen Punkten abweicht.
Greift man zu der Fiction, dass man sich die Gesammtheit der für die Befriedigung ihrer speciellen Bedürfnisse ökonomisch thätigen, nicht selten von entgegengesetzten Interessen geleiteten Personen in einem Volke als Ein grosses wirthschaftendes Subject denkt, nimmt man ferner an, dass die den einzelnen wirthschaftenden Personen verfügbaren Quantitäten von ökonomischen Gütern nicht für die Befriedigung der speciellen Bedürfnisse dieser letzteren, sondern für die Bedürfnisse der Gesammtheit der wirthschaftenden Individuen, aus welchen ein Volk besteht, bestimmt sind, dann gelangt man allerdings zu dem Begriffe einer Gesammtheit von ökonomischen Gütern, welche einem wirthschaftenden Subjecte (hier einem Volke) für die Zwecke der Befriedigung seiner Bedürfnisse verfügbar sind, also zum Begriffe dessen, was man ganz richtig ein Volksvermögen nennen würde. Unter unseren gegenwärtigen socialen Verhältnissen bildet jedoch die Gesammtheit der den wirthschaftenden Personen in einem Volke zum Zwecke der Befriedigung ihrer speciellen Bedürfnisse verfügbaren ökonomischen Güter offenbar kein Vermögen in dem ökonomischen Sinne des Wortes, sondern vielmehr einen durch den menschlichen Verkehr verknüpften Complex von solchen [14].
Das Bedürfniss nach einer wissenschaftlichen Bezeichnung für die eben erwähnte Gütergesammtheit ist indess ein so berechtigtes [76] und der Ausdruck „Volksvermögen“ für den obigen Begriff ein so allgemeiner und durch den Gebrauch sanctionirter, dass es um so weniger einem Bedürfnisse entspräche, denselben fallen zu lassen, je klarer wir uns über das eigentliche Wesen des sogenannten Volksvermögens werden.
Nur ist es dann nothwendig, dass wir uns vor den Irrthümern bewahren, welche aus einer den obigen Unterschied ausser Acht lassenden Argumentation sich ergeben müssten. Bei allen Fragen, wo es sich lediglich um die quantitative Bestimmung des sogenannten Volksvermögens handelt, mag die Gesammtheit der Individualvermögen eines Volkes immerhin als Volksvermögen gelten. Wo es sich aber um den Rückschluss von der Grösse des Volksvermögens auf die Wohlfahrt des Volkes, oder aber um jene Erscheinungen handelt, welche die Wirkung des Contactes der einzelnen Wirthschaften sind, müsste die Auffassung des Volksvermögens im buchstäblichen Sinne des Wortes nothwendigerweise zu häufigen Irrthümern führen. In allen diesen Fällen werden wir vielmehr das Volksvermögen als Complex der Individualvermögen eines Volkes zu betrachten und auch dem verschiedenen Masse dieser letztern unsere Aufmerksamkeit zuzuwenden haben.
[77]
Drittes Capitel.
Die Lehre vom Werthe.↩
§. 1.
Ueber das Wesen und den Ursprung des Güterwerthes.
Wenn der Bedarf an einem Gute innerhalb eines Zeitraumes, auf welchen sich die vorsorgliche Thätigkeit der Menschen erstreckt, grösser ist, als die ihnen für diesen Zeitraum verfügbare Quantität desselben, so empfinden die Menschen in dem Streben, ihre Bedürfnisse so vollständig zu befriedigen, als dies bei der gegebenen Sachlage möglich ist, rücksichtlich des in Rede stehenden Gutes den Antrieb zu der von uns oben dargelegten Thätigkeit, welche wir ihre Wirthschaft nannten. Die Erkenntniss des obigen Verhältnisses fördert indess noch eine andere Erscheinung zu Tage, deren tieferes Verständniss von massgebender Wichtigkeit für unsere Wissenschaft ist—wir meinen den Güterwerth.
Ist nämlich der Bedarf an einem Gute grösser, als die verfügbare Quantität desselben, so steht zugleich fest, dass, nachdem ein Theil der bezüglichen Bedürfnisse ohnehin wird unbefriedigt bleiben müssen, die verfügbare Quantität des in Rede stehenden Gutes um keine irgendwie practisch beachtenswerthe Theilquantität verringert werden kann, ohne dass hiedurch irgend ein Bedürfniss, für welches bis dahin vorgesorgt war, nicht, oder doch nur minder vollständig befriedigt werden könnte, als dies ohne den Eintritt der obigen Eventualität der Fall sein würde. Bei allen Gütern, welche in dem obigen Quantitäten-Verhältnisse stehen, ist demnach von der Verfügung über jede concrete, practisch noch beachtenswerthe Quantität derselben die Befriedigung irgend eines menschlichen Bedürfnisses abhängig. Werden sich nun die wirthschaftenden Menschen dieses Umstandes [78] bewusst, erkennen sie nämlich, dass von der Verfügung über jede Theilquantität der in Rede stehenden Güter, beziehungsweise von jedem concreten, in dem obigen Quantitäten-Verhältnisse stehenden Gute, die Befriedigung eines ihrer Bedürfnisse, oder doch die grössere oder geringere Vollständigkeit derselben abhängig ist, so gewinnen diese Güter für sie jene Bedeutung, die wir den Werth nennen, und es ist somit der Werth die Bedeutung, welche concrete Güter oder Güterquantitäten für uns dadurch erlangen, dass wir in der Befriedigung unserer Bedürfnisse von der Verfügung über dieselben abhängig zu sein uns bewusst sind [1].
[79]
Es entspringt demnach jene Lebenserscheinung, die wir den Güterwerth nennen, aus derselben Quelle, wie der ökonomische [80] Charakter der Güter, das ist aus dem oben dargelegten Verhältnisse zwischen Bedarf und verfügbarer Gütermenge [2]. Der Unterschied zwischen beiden Erscheinungen liegt aber darin, dass die Erkenntniss jenes Quantitäten-Verhältnisses einerseits unsere vorsorgliche Thätigkeit auregt, und somit die Güter, welche in [81] diesem letzten stehen, Gegenstände unserer Wirthschaft, das ist ökonomische Güter werden, andererseits aber die Erkenntniss desselben Verhältnisses uns auch die Bedeutung zum Bewusstsein führt, welche die Verfügung über jede concrete [3]Theilquantität der uns verfügbaren Gütermenge für unser Leben, beziehungsweise für unsere Wohlfahrt hat, und die im obigen Verhältnisse stehenden Güter demnach für uns Werth erlangen [4].
Es ist desshalb aber auch klar, warum nur die ökonomischen Güter für uns Werth haben, während diejenigen Güter, welche in dem den nicht ökonomischen Charakter der Güter begründenden Quantitätenverhältnisse stehen, gar keinen Werth für uns erlangen können.
Das Verhältniss, welches den nicht ökonomischen Charakter [82] der Güter begründet, besteht darin, dass der Bedarf an den betreffenden Gütern geringer ist, als die verfügbare Quantität. Es giebt somit immer Theilquantitäten der nicht ökonomischen Güter, welchen kein zu befriedigendes menschliches Bedürfniss gegenübersteht und welche demnach ihre Güterqualität einbüssen können, ohne dass dadurch die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse irgendwie gefährdet würde. Es hängt somit von unserer Verfügung über concrete Güter, die keinen ökonomischen Charakter haben, keine Bedürfnissbefriedigung ab, und so kommt es, dass concrete Quantitäten der im obigen Verhältnisse stehenden, das ist der nicht ökonomischen Güter, auch keinen Werth für uns haben.
Wenn der Bewohner eines Urwaldes über einige hunderttausend Baumstämme verfügt, während er doch nur etwa zwanzig Baumstämme jährlich zur vollen Deckung seines Holzbedarfes benöthigt, so wird er sich in der Befriedigung seiner Bedürfnisse keineswegs geschädigt erachten, wenn durch einen Waldbrand etwa tausend dieser Baumstämme zu Grunde gehen würden, insolange er eben mit dem Reste derselben seine Bedürfnisse so vollständig, wie früher, zu befriedigen in der Lage ist. Von der Verfügung über einen einzelnen Baumstamm hängt demnach unter solchen Verhältnissen die Befriedigung keines seiner Bedürfnisse ab und hat ein solcher für ihn desshalb auch keinen Werth. Würden sich dagegen im Urwalde auch zehn wilde Obstbäume befinden, deren Früchte das obige Subject geniesst, und wäre das Verhältniss ein solches, dass die ihm verfügbare Menge von Baumfrüchten nicht grösser wäre, als sein Bedarf an diesem Gute, so könnte allerdings kein einzelner dieser letztern Bäume zu Grunde gehen, ohne dass er in Folge dieses Umstandes Hunger leiden, oder sein Bedürfniss nach Baumfrüchten doch nur minder vollständig, als bis dahin, befriedigen könnte, und jeder einzelne dieser Obstbäume hätte desshalb für ihn Werth.
Wenn die Bewohner eines Dorfes täglich tausend Eimer Wasser benöthigen, um ihren Bedarf an diesem Gute vollständig zu decken, und über einen Bach verfügen, der täglich hunderttausend Eimer Wasser führt, so hat für dieselben eine concrete Theilquantität dieses Wassers, z. B. ein Eimer, keinen Werth, weil sie ihr Bedürfniss nach Wasser auch dann [83] noch ebenso vollständig befriedigen können, wenn diese Theilquantität ihrer Verfügung entzogen, oder dieselbe überhaupt ihre Güterqualität einbüssen würde. Ja, sie werden täglich viele tausend Eimer dieses Gutes dem Meere zufliessen lassen, ohne um dessentwillen in der Befriedigung ihres Bedürfnisses nach Wasser irgendwie geschädigt zu werden. Es wird demnach, so lange das den nicht ökonomischen Charakter des Wassers begründende Verhältniss erhalten bleibt, die Befriedigung keines ihrer Bedürfnisse von der Verfügung über einen Eimer Wasser in der Weise abhängig sein, dass diese Bedürfnissbefriedigung nicht erfolgen würde, wofern sie über jenes Gut nicht verfügen könnten und dies der Grund, warum eine solche Quantität Wasser für dieselben keinen Werth hat. Würde dagegen die Quantität Wasser, welche jener Bach führt, in Folge einer aussergewöhnlichen Dürre, oder eines anderen Naturereignisses bis auf fünfhundert Eimer täglich sinken, und wäre den Bewohnern des Dorfes, von dem wir hier sprechen, keine andere Bezugsquelle von Wasser zugänglich, so zwar, dass die gesammte denselben verfügbare Quantität nicht ausreichen würde, um ihr Bedürfniss nach Wasser vollständig zu befriedigen, so würden dieselben keinen irgendwie practisch bedeutenden Theil der ihnen dann noch verfügbaren Quantität, z. B. einen Eimer, sich entgehen lassen dürfen, ohne in der Befriedigung ihrer Bedürfnisse geschädigt zu sein und jeder concrete Theil dieser ihnen verfügbaren Quantität würde dann allerdings für sie Werth haben.
Die nicht ökonomischen Güter haben demnach nicht nur, wie dies bisher angenommen wurde, keinen Tauschwerth, sondern überhaupt keinen Werth, und somit auch keinen Gebrauchswerth. Wir werden weiter unten, sobald wir noch einige wissenschaftliche Voraussetzungen gewonnen haben werden, das Verhältniss zwischen dem Gebrauchswerthe und dem Tauschwerthe eines weiteren darzulegen versuchen. Hier sei vorläfig nur bemerkt, dass der Tauschwerth sowohl als der Gebrauchswerth zwei dem allgemeinen Begriffe des Werthes subordinirte, also in ihrem Verhältnisse zu einander coordinirte Begriffe sind, und demnach Alles das, was wir oben vom Werthe im Allgemeinen sagten, eben sowohl vom Gebrauchswerthe als vom Tauschwerthe gilt.
[84]
Wenn nun eine grosse Anzahl von Volkswirthschaftslehrern den nicht ökonomischen Gütern zwar keinen Tauschwerth, wohl aber Gebrauchswerth zuschreibt, ja einige neuere englische und französische Nationalökonomen den Begriff des Gebrauchswerthes überhaupt aus unserer Wissenschaft verbannt und an dessen Stelle den Begriff der Nützlichkeit gesetzt sehen wollen; so beruht dies auf einer Verkennung des wichtigen Unterschiedes zwischen den beiden obigen Begriffen und den ihnen zu Grunde liegenden Lebenserscheinungen.
Nützlichkeit ist die Tauglichkeit eines Dinges, der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse zu dienen, und demnach (und zwar die erkannte Nützlichkeit) eine allgemeine Voraussetzung der Güterqualität. Auch nicht ökonomische Güter sind nützlich, indem dieselben zur Befriedigung unserer Bedürfnisse ebenso wohl tauglich sind, als die ökonomischen, und diese Tauglichkeit muss auch bei ihnen eine von den Menschen erkannte sein, sonst könnten sie überhaupt nicht die Güterqualität erlangen. Was aber ein nicht ökonomisches Gut von einem solchen unterscheidet, welches in dem den ökonomischen Charakter begründenden Quantitätenverhältnisse steht, das ist der Umstand, dass nicht von der Verfügung über concrete Quantitäten des erstern, wohl aber von einer solchen über concrete Quantitäten des letztern die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse abhängig ist, und somit die ersteren wohl Nützlichkeit, nur die letzteren aber neben ihrer Nützlichkeit auch jene Bedeutung für uns haben, die wir Werth nennen.
Allerdings hat der Irrthum, welcher der Verwechsluug von Nützlichkeit und Gebrauchswerth zu Grunde liegt, auf die practische Thätigkeit der Menschen keinen Einfluss gehabt. Vor wie nach hat kein wirthschaftendes Subject unter gewöhnlichen Verhältnissen einem Cubikfuss Luft, oder in quellenreichen Gegenden einem Schoppen Wasser Werth beigelegt, und der Practiker unterscheidet die Tauglichkeit einer Sache, zur Befriedigung eines seiner Bedürfnisse zu dienen, gar sehr von ihrem Werthe; wohl aber ist der obige Irrthum ein arges Hemmniss für die Ausbildung der allgemeineren Lehren unserer Wissenschaft geworden [5].
[85]
Der Umstand, dass ein Gut für uns Werth hat, liegt, wie wir sahen, darin, dass die Verfügung darüber für uns die Bedeutung einer Bedürfnissbefriedigung hat, da für dieselbe ohne unsere Verfügung über das Gut nicht vorgesorgt wäre. Nun mögen unsere Bedürfnisse immerhin zum Theile, wenigstens so weit es sich um ihre Entstehung handelt, auch von unserem Willen oder von unserer Gewöhnung abhängen, sind sie aber einmal vorhanden, so ist der Werth, den die Güter für uns haben, dann nichts willkürliches mehr, sondern die zwingende Folge der Erkenntniss ihrer Bedeutung für unser Leben oder unsere Wohlfahrt. Vergeblich würden wir uns demnach bemühen, ein Gut für werthlos zu halten, von dem uns bewusst ist, dass von der Verfügung über dasselbe die Befriedigung eines unserer Bedürfnisse abhängt, vergeblich würden wir uns aber auch bemühen, Gütern, von denen in unserer Bedürfnissbefriedigung nicht abhängig zu sein wir uns bewusst sind, Werth zuzuschreiben. Der Güterwerth ist demnach nichts willkürliches, sondern überall die nothwendige Folge der Erkenntniss des Menschen, dass von der Verfügung über ein Gut, oder einer Güterquantität die Aufrechterhaltung seines Lebens, seiner Wohlfahrt, oder doch eines, wenn auch noch so geringfügigen Theiles derselben abhängig ist.
Was aber diese Erkenntniss anbelangt, so können die Menschen in Bezug auf den Werth der Güter ebensowohl irren, wie bei allen übrigen Objecten menschlicher Erkenntniss, und sie können demnach Dingen Werth zuschreiben, welche einen solchen der ökonomischen Sachlage nach in Wahrheit nicht haben, wofern sie nämlich irrthümlicherweise annehmen, dass von einem Gute oder einer Güterquantität die mehr oder minder vollständige Befriedigung ihrer Bedürfnisse abhängt, während dies Verhältniss in Wirklichkeit nicht vorhánden ist, und es tritt uns dann die Erscheinung des eingebildeten Werthes entgegen.
Der Güterwerth ist in der Beziehung der Güter zu unseren Bedürfnissen begründet, nicht in den Gütern selbst. Mit dem Wechsel dieses Verhältnisses muss auch der Werth entstehen oder vergehen. Für die Bewohner einer Oase, welchen eine Quelle zu Gebote steht, die ihren Bedarf an Wasser vollauf deckt, wird eine bestimmte Quantitä davon an der [86] Quelle selbst keinen Werth haben. Wenn jedoch die Quelle plötzlich durch ein Erdbeben ihren Wasserreichthum so weit einbüssen würde, dass für die Befriedigung der Bedürfnisse der Bewohner jener Oase nicht mehr vollständig vorgesorgt wäre, so zwar, dass die Befriedigung eines jeden concreten Bedürfnisses von der Verfügung über eine bestimmte Quantität abhängig würde, so würde eine solche auch sofort für jeden Bewohner Werth erlangen. Dieser Werth würde aber sogleich schwinden, sobald das alte Verhältniss wieder platzgreifen und die Quelle wieder ihren alten Wasserreichthum zurückerlangen würde. Ein Aehnliches würde stattfinden, wenn die Bewohnerzahl der Oase sich derart vermehren würde, dass das Wasser der Quelle nicht mehr zur Befriedigung aller Bedürfnisse ausreichen würde. Ein solcher Wechsel, herbeigeführt durch die vermehrte Zahl der Consumenten, könnte sogar mit einer gewissen Regelmässigkeit, und zwar zu solchen Zeiten stattfinden, wo die Oase von zahl reichen Karawanen besucht wäre.
Der Werth ist demnach nichts den Gütern Anhaftendes. keine Eigenschaft derselben, eben so wenig aber auch ein selbstständiges, für sich bestehendes Ding. Derselbe ist ein Urtheil, welches die wirthschaftenden Menschen uber die Bedeutung der in ihrer Verfügung befindlichen Güter für die Aufrechthaltung ihres Lebens und ihrer Wohlfahrt fällen, und demnach ausserhalb des Bewusstseins derselben nicht vorhanden. Es ist demnach auch durchaus irrig, wenn ein Gut, welches für die wirthschaftenden Subjecte Werth hat, ein „Werth“ genannt wird, oder aber die Volkswirthe gar von „Werthen“, gleichwie von selbstständigen realen Dingen sprechen, und der Werth solcherart objectivirt wird. Denn das, was objectiv besteht, sind doch immer nu die Dinge, beziehungsweise die Quantitäten derselben, und ihr Werth ist etwas von denselben wesentlich verschiedenes, ein Urtheil nämlich, welches sich die wirthschaftenden Individuen über die Bedeutung bilden, welche die Verfügung über dieselben für die Aufrechterhaltung ihres Lebens, beziehungsweise ihrer Wohlfahrt hat. Es hat aber die Objectivirung des seiner Natur nach durchaus subjectiven Güterwerthes gleichfalls sehr viel zur Verwirrung der Grundlagen unserer Wissenschaft beigetragen.
[87]
§. 2.
Ueber das ursprünglichste Mass des Güterwerthes.
Wir haben bisher das Wesen und die letzten Ursachen des Werthes, somit die allem Werthe gemeinsamen Momente in den Kreis unserer Betrachtungen gezogen. Nun tritt uns aber im Leben der Werth der einzelnen Güter als eine sehr verschiedene, ja bei demselben Gute nicht selten wechselnde Grösse entgegen. Die Untersuchung über die Ursachen der Verschiedenheit des Güterwerthes und über das Mass desselben ist nun der Gegenstand, der uns in diesem Abschnitte beschäftigen wird. Der Gang unserer Untersuchung ergibt sich aber aus der nachfolgenden Betrachtung.
Die Güter, die unserer Verfügung unterworfen sind, haben nicht um ihrer selbst willen für uns Werth. Wir haben vielmehr gesehen, dass zunächst nur die Befriedigung unserer Bedürfnisse für uns eine Bedeutung hat, weil unser Leben und unsere Wohlfahrt dadurch bedingt sind. Wir haben aber auch dargelegt, dass die Menschen diese Bedeutung auf die ihrer Verfügung unterworfenen Güter, wofern sie ihnen die Befriedigung von Bedürfnissen sichern, für welche ohne die Verfügung über dieselben nicht vorgesorgt sein würde, also auf die ökonomischen Güter, übertragen. In allem Güterwerth tritt uns demnach lediglich die Bedeutung entgegen, welche wir der Befriedigung unserer Bedürfnisse, also unserem Leben und unserer Wohlfahrt beimessen. Haben wir damit das Wesen des Güterwerthes erschöpfend bezeichnet, und steht es fest, dass in letzter Reihe nur die Befriedigung unserer Bedürfnisse für uns eine Bedeutung hat und aller Güterwerth lediglich eine Uebertragung dieser Bedeutung auf die wirthschaftlichen Güter ist, so kann die Verschiedenheit der Grösse des Werthes der einzelnen Güter, wie wir dieselbe im Leben zu beobachten vermögen, auch nur in der Verschiedenheit der Grösse der Bedeutung begründet sein, welche jene Bedürfnissbefriedigungen für uns haben, in Rücksicht auf welche wir von der Verfügung über diese Güter abhängig sind. Um die Verschiedenheit der Grösse des Werthes der einzelnen Güter, wie wir dieselbe im Leben zu beobachten [88] vermögen, auf ihre letzten Ursachen zurückzuführen, wird unsere Aufgabe demnach eine doppelte sein. Wir werden zu untersuchen haben:
Erstens: In wiefern die Befriedigung verschiedener concreter Bedürfnisse für die Menschen eine verschiedene Bedeutung hat? (subjectives Moment) und
Zweitens: Welche concrete Bedürfnissbefriedigungen in jedem einzelnen Falle von unserer Verfügung über ein bestimmtes Gut abhängig sind? (objectives Moment).
Wird sich nun bei dieser Untersuchung herausstellen, dass die einzelnen concreten Bedürfnissbefriedigungen für die Menschen eine verschiedene Bedeutung haben, und ferner, dass von unserer Verfügung über die einzelnen ökonomischen Güter Bedürfnissbefriedigungen von so verschiedener Bedeutung abhängig sind, so wird damit auch unsere obige Aufgabe gelöst, das ist, jene Erscheinung des wirthschaftlichen Lebens auf ihre letzten Ursachen zurückgeführt sein, deren Erklärung wir als Problem an die Spitze dieser Untersuchung gestellt haben, wir meinen die Verschiedenheit der Grösse des Güterwerthes.
Mit der Beantwortung der Frage nach den letzten Ursachen der Verschiedenheit des Güterwerthes ist aber auch die Lösung des Problems gegeben, wieso es kommt, dass der Werth der einzelnen Güter selbst ein wechselnder ist. Aller Wechsel ist nichts anderes, als eine Verschiedenheit in der Zeit und mit der Erkenntniss der letzten Ursachen der Verschiedenheit einer Kategorie von Grössen überhaupt ist demnach auch das tiefere Verständniss des Wechsels derselben gegeben.
a) Verschiedenheit der Grösse der Bedeutung der einzelnen Bedürfnissbefriedigungen.
(Subjectives Moment.)
Was nun vorerst die Verschiedenheit der Bedeutung anbelangt, welche die einzelnen Bedürfnissbefriedigungen für uns haben, so ist es eine Thatsache der gewöhnlichsten Erfahrung, dass jene Bedürfnissbefriedigungen für die Menschen von der höchsten Bedeutung zu sein pflegen, von welchen die Erhaltung [89] ihres Lebens abhängt, und dass das Mass der Bedeutung der übrigen Bedürfnissbefriedigungen sich für dieselben je nach dem Grade (Dauer und Intensivität) der Wohlfahrt abstuft, welche von denselben abhängig ist. Sind demnach wirthschaftende Menschen in der Lage, eine Wahl treffen zu müssen zwischen der Befriedigung eines Bedürfnisses, von welcher die Erhaltung ihres Lebens, und einer anderen, von welcher lediglich ihr grösseres oder geringeres Wohlbefinden abhängt, so pflegen sie der ersteren den Vorzug einzuräumen, und nicht minder Bedürfnissbefriedigungen, von welchen ein höherer Grad ihres Wohlbefindens, also bei gleicher Intensivität ein länger andauerndes, bei gleicher Dauer ein intensiveres Wohlbefinden abhängig ist, solchen vorziehen, bei welchen das entgegengesetzte Verhältniss obwaltet.
Von der Befriedigung des Nahrungsbedürfnisses, und unter unseren klimatischen Verhältnissen wohl auch von der Bekleidung unseres Körpers und der Verfügung über einen Wohnraum, hängt die Erhaltung unseres Lebens ab, während von der Verfügung über eine Carosse, ein Spielbrett u. dgl. m. lediglich ein höherer Grad unseres Wohlbefindens abhängig ist. Demgemäss können wir denn auch beobachten, dass die Menschen den Mangel an Nahrung, Bekleidung und an einem Wohnraume viel mehr fürchten, als den Mangel an einer Carosse, einem Spielbrette u. dgl. m., und der Sicherstellung der Befriedigung der ersteren Bedürfnisse eine ungleich höhere Bedeutung beimessen, als der Befriedigung jener, von welchen, wie zum Beispiel in den oben erwähnten Fällen, nur ein vorübergehender Genuss, oder erhöhter Comfort, also lediglich ein höherer Grad ihres Wohlbefindens abhängig ist. Aber auch diese letzteren Bedürfnissbefriedigungen haben eine sehr ungleiche Bedeutung für die Menschen. Weder von der Verfügung über ein bequemes Nachtlager, noch auch von jener über ein Spielbrett hängt die Erhaltung unseres Lebens ab, wohl aber trägt die Benutzung dieser Güter—allerdings in sehr ungleichem Grade—zur Erhöhung unseres Wohlbefindens bei. Eben deshalb kann aber auch kein Zweifel darüber entstehen, dass die Menschen, wenn sie die Wahl haben, entweder die Benützung eines bequemen Nachtlagers, [90] oder die eines Spielbrettes zu entbehren, dieses letztere viel leichter entbehren, als das erstere.
Haben wir solcherart gesehen, dass die Bedeutung, welche die verschiedenen Bedürfnissbefriedigungen für die Menschen haben, eine sehr ungleiche ist, indem es Bedürfnissbefriedigungen gibt, welche für dieselben die volle Bedeutung der Erhaltung ihres Lebens haben, andere, von denen ihre Wohlfahrt im höheren, noch andere, von denen sie in geringerem Masse bedingt ist und so hinab bis zu jenen Bedürfnissbefriedigungen, von welchen irgend ein geringfügier flüchtiger Genuss abhängt, so zeigt uns eine sorgfältige Betrachtung der Lebenserscheinungen, dass diese Verschiedenheit in der Bedeutung der einzelnen Bedürfnissbefriedigungen nicht nur bei der Befriedigung verschiedener Bedürfnisse im Grossen und Ganzen, sondern auch bei der mehr oder minder vollständigen Befriedigung ein und desselben Bedürfnisses zu beobachten ist.
Von der Befriedigung unseres Nahrungsbedürfnisses im Allgemeinen hängt unser Leben ab. Es wäre nun aber sehr irrig, wollte man alle Nahrungsmittel, welche die Menschen zu sich zu nehmen pflegen, als solche bezeichnen, welche zur Erhaltung ihres Lebens, oder auch nur ihrer Gesundheit, das ist, ihres dauernden Wohlbefindens, erforderlich sind Jedermann weiss, wie leicht es ist, ohne das Leben, ja auch nur die Gesundheit zu gefährden, eine der gewohnten Mahlzeiten ausfallen zu lassen, ja die Erfahrung lehrt, dass die eben nur zur Erhaltung des Lebens erforderliche Menge von Nahrungsmitteln nur den kleineren Theil dessen ausmacht, was wohlhabende Personen der Regel nach verzehren und dass die Menschen sogar weit mehr Speise und Trank zu sich nehmen, als zur vollständigen Aufrechterhaltung ihrer Gesundheit erforderlich sind. Die Menschen nehmen daher Nahrungsmittel zu sich, zunächst um ihr Leben zu erhalten, hierauf weitere Quantitäten, um ihre Gesundheit zu bewahren, indem eine allzu karge Ernährung, bei welcher eben nur das Leben erhalten bleibt, erfahrungsgemäss von Störungen unseres Organismus begleitet ist, endlich consumiren die Menschen aber auch noch Nahrungsmittel, nachdem sie bereits die zur Erhaltung ihres Lebens und zur Aufrechthaltung iher Gesundheit nöthigen Quantitäten derselben genossen [91] haben, lediglich um des Genusses willen, welcher mit der Verzehrung derselben verbunden ist.
Demgemäss ist auch die Bedeutung, welche die einzelnen concreten Acte der Befriedigung des Nahrungsbedürfnisses für die Menschen haben, eine sehr ungleiche. Die Befriedigung des Nahrungsbedürfnisses bis zu jenem Puncte, wo biedurch das Leben gesichert ist, hat für jeden Menschen die volle Bedeutung der Erhaltung seines Lebens, die darüber hinausgehende Consumtion hat bis zu einem gewissen Puncte für die Menschen die Bedeutung der Erhaltung ihrer Gesundheit, das ist ihrer dauernden Wohlfahrt, die auch noch darüber hinausreichende Consumtion hat für dieselben lediglich die Bedeutung eines—wie die Beobachtung lehrt—noch überdiess sich immer mehr abschwächenden Genusses, bis die Consumtion endlich an eine gewisse Grenze gelangt, wo die Befriedigung des Nahrungsbedürfnisses bereits eine so vollständige ist, dass jede weitere Aufnanme von Nahrungsmitteln weder zur Erhaltung des Lebens, noch zu jener der Gesundheit beiträgt, noch auch dem Consumenten einen Genuss gewährt, sondern ihm gleichgiltig zu werden beginnt, um bei der etwaigen Fortsetzung derselben zur Pein zu werden, die Gesundheit und schliesslich das Leben zu gefährden.
Aehnliche Beobachtungen können wir mit Rücksicht auf die mehr oder minder vollständige Befriedigung jedes anderen menschlichen Bedürfnisses anstellen. Ein Wohnraum, zum mindesten irgend eine gegen die Einflüsse der Witterung geschützte Schlafstelle, ist bei unseren klimatischen Verhältnissen zur Erhaltung des Lebens, eine Wohnung von einer gowissen Geräumigkeit zur Aufrechthaltung unserer Gesundheit nöthig. Ausserdem pflegen die Menschen indess, sofern sie über die Mittel hiezu verfügen, noch weitere Räumlichkeiten lediglich zu Genusszwecken zu besitzen, (Empfangszimmer, Festsäle, Spielzimmer, Pavillons, Jagdschlösser u. dgl. m.) Auch bei der Befriedigung des Wohnungsbedürfnisses der Menschen ist demnach unschwer zu erkennen, dass die Bedeutung, welche die einzelnen concreten Acte dieser Befriedigung für die Menschen haben, sehr ungleich ist. Von der Befriedigung unseres Wohnungsbedürfnisses bis zu einem gewissen Puncte hängt unser Leben, von einer darüber [92] hinausgehenden vollständigeren Befriedigung desselben unsere Gesundheit, von einer auch darüber hinausgehenden Befriedigung noch immer ein bald grösserer bald geringerer Genuss ab, bis sich endlich mit Rücksicht auf jede Person ein Punct denken lässt, wo derselben die weitere Benützung von ihr verfügbaren Wohnräumen völlig gleichgiltig, schliesslich sogar lästig werden müsste.
Wir können demnach mit Rücksicht auf die grössere oder geringere Vollständigkeit der Befriedigung eines und desselben Bedürfnisses eine ähnliche Beobachtung anstellen, wie dies oben mit Rücksicht auf die verschiedenen Bedürfnisse der Menschen geschehen ist. Haben wir nämlich oben gesehen, dass die Befriedigung der verschiedenen Bedürfnisse der Menschen für dieselben eine sehr ungleiche Bedeutung hat und diese letztere sich von der Bedeutung, welche unser Leben für uns hat, bis zu jener hinab, welche wir einem flüchtigen geringfügigen Genusse beilegen, abstuft, so sehen wir nunmehr, dass die Befriedigung irgend eines bestimmten Bedürfnisses bis zu einem gewissen Grade der Vollständigkeit für uns die relativ höchste, die darüber hinausgehende Befriedigung aber eine immer geringere Bedeutung hat, bis zuletzt ein Stadium eintritt, wo eine noch vollständigere Befriedigung des betreffenden Bedürfnisses den Menschen gleichgiltig ist und schliesslich ein solches, wo jeder Act, welcher die äussere Erscheinung der Befriedigung des betreffenden Bedürfnisses hat, nicht nur keine Bedeutung mehr für die Menschen besitzt, sondern ihnen vielmehr zur Last, zur Pein wird.
Um nun zum Zwecke der Erleichterung des Verständnisses der nachfolgenden schwierigen Untersuchungen zu einem ziffermässigen Ausdruck der verschiedenen Grössen zu gelangen, von welchen wir soeben gesprochen haben, wollen wir die Bedeutung jener Bedürfnissbefriedigungen, von welchen unser Leben abhängt, mit 10, und die stufenweise sich herabmindernde Bedeutung der übrigen Bedürfnissbefriedigungen mit 9, 8, 7, 6 u. s. f. bezeichnen, so zwar, dass wir eine Scala der Bedeutung der verschiedenen Bedürfnissbefriedigungen erlangen, welche mit 10 beginnt und mit 1 endet.
Bringen wir nun die, in dem Masse, als das einzelne Bedürfniss [93] bereits befriedigt ist, sich herabmindernde Bedeutung der ferneren Acte der Befriedigung desselben bei jeder einzelnen der obigen verschiedenen Bedürfnissbefriedigungen gleichfalls zum ziffermässigen Ausdruck, so ergiebt sich für jene Bedürfnissbefriedigungen, von welchen bis zu einem gewissen Punkte unser Leben, hierauf ein mit dem Grade der Vollständigkeit der erfolgten Bedürfnissbefriedigung sich herabminderndes Wohlbefinden abhängig ist, eine Scala, die mit 10 beginnt und mit 0 endet, für jene Bedürfnissbefriedigungen, deren höchste Bedeutung gleich 9 ist, eine Scala, die mit dieser Ziffer beginnt, und gleichfalls mit 0 endet u. s. f.
Die zehn Scalen, die sich solcherart ergeben, sind in dem Folgenden veranschaulicht:
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | 0 | ||||||||
| 0 |
Nehmen wir an, Scala I drücke die sich je nach dem Grade der bereits erfolgten Befriedigung herabmindernde Bedeutung der Befriedigung des Nahrungsbedürfnisses, Scala V aber des Bedürfnisses nach dem Tabakgenusse bei irgend einem Individuum aus, so ist klar, dass die Befriedigung des Nahrungsbedürfnisses bis zu einem gewissen Grade der Vollständigkeit eine entschieden höhere Bedeutung für jenes Individuum hat, als die Befriedigung des Bedürfnisses nach dem Tabakgenusse. Wofern aber das Nahrungsbedürfniss bereits bis zu einem gewissen Grade der Vollständigkeit befriedigt ist, so zwar, dass zum Beispiel die weitere Befriedigung desselben für jenes Individuum lediglich jene Bedeutung hat, welche wir durch die Zahl 6 ziffermässig bezeichnet haben, so beginnt der Tabakgenuss [94] bereits dieselbe Bedeutung für dies Individuum zu gewinnen, wie die fernere Befriedigung des Nahrungsbedürfnisses, und dasselbe wird daher bemüht sein, von da ab die Befriedigung seines Bedürfnisses nach Tabak mit jenem nach Nahrungsmitteln in das Gleichgewicht zu bringen. Obzwar nämlich die Befriedigung des Nahrungsbedürfnisses im Allgemeinen eine ungleich höhere Bedeutung, als die Befriedigung des Bedürfnisses nach dem Tabaksgenusse, für das in Rede stehende Individuum hat, so tritt doch bei fortgesetzter Befriedigung des ersteren, wie in der obigen Tabelle veranschaulicht ist, ein Stadium ein, wo die weiteren Acte der Befriedigung des Nahrungsbedürfnisses doch für jenes Individuum eine geringere Bedeutung besitzen, als die ersten Acte der Befriedigung des im Allgemeinen minder wichtigen, aber noch gänzlich unbefriedigten Bedürfnisses nach dem Tabakgenusse.
Wir glauben, durch diesen Hinweis auf eine gewöhnliche Lebenserscheinung den Sinn der obigen, lediglich um der Erleichterung der Demonstration eines eben so schwierigen, als bisher unbearbeiteten Gebietes der Psychologie gewählten Ziffern zur vollen Genüge erklärt zu haben.
Die verschiedene Bedeutung, welche die Befriedigung der einzelnen concreten Bedürfnisse für die Menschen hat, ist, so wenig auch bisher die Aufmerksamkeit der Forscher auf die hier behandelten Erscheinungen gelenkt war, doch dem Bewusstsein keines wirthschaftenden Menschen fremd. Wo immer Menschen wohnen, und welche Stufe der Culturentwickelung sie auch immer einnehmen, überall können wir beobachten, wie die wirthschaftenden Individuen die Bedeutung der Befriedigung ihrer verschiedenen Bedürfnisse im Allgemeinen und jene der Einzelnen zur mehr oder minder vollständigen Befriedigung derselben führenden Acte insbesondere gegen einander abwägen, und sich schliesslich von dem Resultate dieser Prüfung in der auf die möglichst vollständige Befriedigung ihrer Bedürfnisse gerichteten Thätigkeit (Wirthschaft) bestimmen lassen. Ja, es ist dies Abwägen der verschiedenen Bedeutung der Bedürfnisse, die Wahl zwischen jenen, welche unbefriedigt bleiben, und jenen, welche, je nach den verfügbaren Mitteln, zur Befriedigung gelangen, und die Bestimmung des Grades, bis zu welchem [95] diese letzteren ihre Befriedigung finden sollen, jener Theil der ökonomischen Thätigkeit der Menschen, welcher ihre Geister mehr als irgend ein anderer erfüllt, auf ihre ökonomischen Bestrebungen den weittragendsten Einfluss nimmt, und von jedem wirthschaftenden Subjecte fast ununterbrochen geübt wird. Die Erkenntniss der verschiedenen Bedeutung, welche die Befriedigung der verschiedenen Bedürfnisse und der einzelnen Acte derselben für die Menschen hat, ist aber zugleich die erste Ursache der Verschiedenheit des Werthes der Güter.
b) Abhängigkeit der einzelnen Bedürfnissbefriedigungen von den concreten Gütern. (Objectives Moment.)
Stünde nun jedem einzelnen, concreten Bedürfnisse der Menschen nur die Verfügung über ein einziges, ausschliesslich zur Befriedigung dieses Bedürfnisses taugliches Gut gegenüber, so zwar, dass einerseits die Befriedigung jenes Bedürfnisses nicht erfolgen würde, wofern wir über dies bestimmte Gut nicht zu verfügen vermöchten, andererseits aber auch dies Gut eben nur die Tauglichkeit hätte, zur Befriedigung jenes concreten Bedürfnisses und keines anderen zu dienen, so wäre die Bestimmung des Werthes dieses Gutes sehr leicht. Er wäre nämlich gleich der Bedeutung, welche die Befriedigung jenes Bedürfnisses für uns hätte, denn es ist klar, dass, wofern wir in der Befriedigung irgend eines Bedürfnisses von der Verfügung über ein bestimmtes Gut in der Weise abhängig sind, dass diese Bedürfnissbefriedigung nicht erfolgen würde, wofern wir über dasselbe nicht verfügen könnten, dies Gut aber zugleich zu keinem anderen Gebrauchszwecke tauglich ist, als zur Befriedigung des in Rede stehenden Bedürfnisses, dasselbe für uns zwar die volle, aber jedenfalls auch keine andere Bedeutung gewinnen kann, als diejenige, welche die gedachte Bedürfnissbefriedigung für uns hat. Je nachdem also die Bedeutung, welche jene Bedürfnissbefriedigung für uns hätte, eine grössere oder geringere wäre, würde auch der Werth des betreffenden Gutes in solch' einem Falle für uns ein grösserer oder geringerer sein. Würde z. B. ein kurzsichtiges Individuum auf eine einsame Insel verschlagen, und fände sich unter den Gütern, die es gerettet hätte, eine seine Kurzsichtigkeit behebende Brille und keine zweite, so ist kein Zweifel, dass dieselbe [96] für jenes Individuum die volle Bedeutung hätte, welche dieses letztere einem geschärften Sehvermögen zuschreiben würde, aber eben so sicher auch keine höhere, indem eine Brille zur Befriedigung anderer Bedürfnisse nicht wohl verwendbar ist.
Im gewöhnlichen Leben ist nun aber das Verhältniss zwischen den verfügbaren Gütern und unseren Bedürfnissen der Regel nach ein viel complicirteres. Hier steht zumeist: nicht einem einzelnen concreten Bedürfnisse, sondern einem Complexe von solchen; nicht ein einzelnes Gut, sondern eine Quantität von solchen gegenüber, so zwar, dass eine bald grössere, bald geringere Anzahl in ihrer Bedeutung höchst verschiedener Bedürfnissbefriedigungen von unserer Verfügung über eine Quantität von Gütern abhängt, deren jedes einzelne wieder die Tauglichkeit hat, die obigen in ihrer Bedeutung sehr verschiedenen Bedürfnissbefriedigungen herbeizuführen.
Ein isolirt wirthschaftender Landmann verfügt nach einer reichen Ernte über zweihundert Metzen Korn. Ein Theil hievon sichert ihm die Erhaltung seines Lebens und jenes seiner Familie bis zur nächsten Ernte, ein anderer die Erhaltung der Gesundheit, ein dritter Theil sichert ihm das Saamenkorn für die nächste Saat, einen vierten vermag er zur Erzeugung von Bier, Branntwein und zu anderen Luxuszwecken, einen fünften noch zur Mästung seines Viehes zu verwenden, einige erübrigende Metzen jedoch, die er für andere wichtigere Bedürfnissbefriedigungen nicht mehr verwenden kann, hat er für die Ernährung von Luxusthieren bestimmt, um dies Getreide doch irgendwie nutzbar zu machen.
Es sind demnach Bedürfnissbefriedigungen von höchst verschiedener Wichtigkeit, in Rücksicht auf welche der Landmann von dem in seinen Händen befindlichen Getreide abhängt. Er sichert damit zunächst sein und seiner Familie Leben, hierauf sein und seiner Familie Gesundheit, er sichert damit ferner den Fortbetrieb seiner Wirthschaft, also eine wichtige Grundlage seiner dauernden Wohlfahrt, er verwendet endlich einen Theil seines Getreides zu Genusszwecken und zwar wieder zu solchen, die von höchst verschiedener Bedeutung für ihn sind.
Es liegt somit unserer Betrachtung ein Fall vor—es ist dies aber das gewöhnliche Lebensverhältniss—in welchem Bedürfnissbefriedigungen [97] von sehr verschiedener Bedeutung von der Verfügung über eine Güter-Quantität abhängen, welche, wie wir hier um der grösseren Einfachheit willen annehmen wollen, in allen ihren Theilen von völlig gleicher Beschaffenheit ist und es fragt sich nun: Welchen Werth hat unter solchen Umständen eine bestimmte Theilquantität des Getreides für unseren Landwirth? Werden diejenigen Metzen Getreide, welche ihm sein oder seiner Familie Leben sichern, für ihn einen höheren Werth haben, als diejenigen Metzen Getreide, die ihm seine und der Seinen Gesundheit sichern, und diese einen höheren Werth, als jene, welche ihm die Bestellung seiner Aecker ermöglichen und diese letzteren einen höheren Werth, als diejenigen Metzen Getreide, die er zu Luxuszwecken verwenden wird? u. s. f.
Niemand wird läugnen, dass die Bedeutung der Bedürfnissbefriedigungen, die hier durch die einzelnen Theilquantitäten des verfügbaren Getreides gesichert erscheinen, eine sehr ungleiche ist, und sich von jener, die wir oben mit 10 bezeichnet haben, bis zu jener abstuft, die wir mit 1 bezifferten, und doch wird Niemand zu behaupten vermögen, dass einige Metzen Getreide (z. B. jene, mit welchen der Landwirth sich und seine Familie bis zur nächsten Ernte ernähren will) eine höhere, andere von gleicher Qualität (z. B. jene, aus welchen er Luxusgetränke erzeugen will) einen geringeren Werth für ihn haben werden.
In diesem und so in jedem andern Falle, wo von der Verfügung über gewisse Güterquantitäten Bedürfnissbefriedigungen abhängen, deren Bedeutung eine verschiedene ist, tritt an uns nun zunächst die schwierige Frage heran, welche concrete Bedürfnissbefriedigung von einer concreten Theilquantität der in Rede stehenden Güter abhängig ist?
Die Lösung dieser wichtigsten Frage der Werththeorie ergiebt sich aber aus der Betrachtung der menschlichen Wirthschaft und jener des Wesens des Güterwerthes.
Wir haben gesehen, dass das Bestreben der Menschen dahin geht, ihre Bedürfnisse vollständig, wo dies aber unthunlich erscheint, doch so vollständig als möglich zu befriedigen. Steht nun eine Quantität von Gütern Bedürfnissen gegenüber, deren Befriedigung für die Menschen eine verschiedene Bedeutung hat, so werden sie zunächst jenen Bedürfnissen genügen, oder [98] aber dafür vorsorgen, deren Befriedigung für sie die höchste Bedeutung hat. Bleibt ihnen ein Ueberschuss, so werden sie denselben der Befriedigung derjenigen Bedürfnisse zuführen, welche im Grade der Bedeutung jenen obigen Bedürfnissbefriedigungen zunächst stehen, und so fort den allfälligen Rest der Befriedigung der dem Grade nach nächst wichtigen Bedürfnisse [6].
Fragen wir nun, welchen Werth für einen wirthschaftenden Menschen, der sich im Besitze einer Güterquantität befindet, irgend eine Theilquantität hievon hat, so präcisirt sich die Frage, mit Rücksicht auf das Wesen des Werthes, dahin: Welche Bedürfnissbefriedigung würde nicht erfolgen, wofern das wirthschaftende Subject über jene Theilquantität nicht verfügen könnte, das ist, nur die ihm verfügbare Gesammtquantität nach Abzug jener Theilquantität in seiner Gewalt hätte? Die Antwort hierauf ergibt sich aus der obigen Darlegung des Wesens der menschlichen Wirthschaft und lautet dahin, dass eine jede wirthschaftende Person in diesem Falle mit der ihr dann noch erübrigenden Güterquantität jedenfalls ihre wiehtigeren Bedürfnisse mit Hintansetzung der minder wichtigen befriedigen würde, und demnach nur jene der bisher gesicherten Bedürfnissbefriedigungen nicht erfolgen würden, welche für dieselbe die geringste Bedeutung haben.
Es sind demnach in jedem concreten Falle von der Verfügung über eine bestimmte Theilquantität der einer wirthschaftenden Person verfügbaren [99] Gütermenge nur jene der durch die Gesammtquantität noch gesicherten Bedürfnissbefriedigungen abhängig, welche für diese Person die geringste Bedeutung unter diesen letztern haben und der Werth einer Theilquantität der verfügbaren Gütermenge ist für jene Person demnach gleich der Bedeutung, welche die am wenigsten wichtige der durch die Gesammtquantität noch gesicherten und mit einer gleichen Theilquantität herbeizuführenden Bedürfnissbefriedigungen für sie haben. [7]
[100]
Die Untersuchung einiger concreter Fälle wird die hier dargelegten Grundsätze vollständig ins Licht stellen, und ich möchte mich dieser wichtigen Aufgabe nicht entziehen, so wohl ich auch weiss, dass ich dadurch Einzelnen langweilig erscheinen werde. Ich will es nämlich, nach dem Grundsatze Adam Smith's, immerhin mit etwas Langweile wagen, wenn dadurch die Klarheit der Darlegungen gewinnt.
Denken wir uns, um mit dem einfachsten Falle zu beginnen, ein isolirt wirthschaftendes Subject, das eine felsige Meeresinsel bewohnt, auf welcher sich eine einzige Quelle befindet, auf die es in der Befriedigung seines Bedürfnisses nach Süsswasser ausschliesslich angewiesen ist. Setzen wir nun den Fall, dieser isolirte Mensch hätte, um sein Leben zu erhalten, täglich eine Mass Wasser für sich und neunzehn Mass für diejenigen Thiere nöthig, deren Milch und Fleisch ihm den nothdürftigsten Lebensunterhalt gewähren. Setzen wir weiter den Fall, er hätte überdies vierzig Mass Wasser nöthig, theils um die volle, zur Erhaltung nicht nur seines Lebens, sondern auch seiner Gesundheit nöthige Quantität hievon zu sich nehmen zu können, theils zum Zwecke der Reinigung seines Körpers, seiner Kleider und Geräthschaften, theils für die Erhaltung einiger Thiere, deren Milch und Fleisch er benöthigt, alles dies, in soweit die Erhaltung seiner Gesundheit und überhaupt seiner dauernden Wohlfahrt davon abhängig ist; schliesslich bedarf derselbe noch weiterer vierzig Mass Wasser täglich, theils für seinen Blumengarten, theils für einige Thiere, die er, ohne ihrer zur Erhaltung seines Lebens und seiner Gesundheit zu bedürfen, lediglich um der [101] Genüsse willen hält, welche ihm eine reichlichere Nahrung, oder aber ihre blosse Gesellschaft bietet. Eine weitere Quantität, das ist mehr als hundert Mass Wasser, wüsste er aber nicht zu verwenden.
So lange nun die Quelle so reich an Wasser ist, dass er nicht nur alle seine Bedürfnisse nach Wasser befriedigen, sondern täglich einige tausend Eimer ins Meer fliessen lassen kann, kurz, so lange davon, ob er über eine bestimmte Quantität, z. B. einen Eimer Wasser mehr oder weniger verfügt, die Befriedigung keines seiner Bedürfnisse abhängig ist, wird, wie wir sahen, eine solche Quantität für ihn weder den ökonomischen Charakter, noch auch Werth haben, und es kann somit auch von einem Masse des letztern nicht die Rede sein. Würde nun aber durch ein Naturereigniss bewirkt, dass die Quelle plötzlich so weit versiegen würde, dass unser Inselbewohner nur über 90 Mass Wasser täglich zu verfügen vermöchte, während ihm, wie wir sahen, 100 Mass zur vollständigen Befriedigung seiner Bedürfnisse erforderlich sind, so wäre klar, dass von der Verfügung über jede Theilquantität dieses Wassers für ihn dann bereits eine Bedürfnissbefriedigung abhängig wäre, und somit jede concrete Quantität hievon für ihn jene Bedeutung erlangen würde welche wir Werth nennen.
Fragen wir nun aber, welche seiner Bedürfnissbefriedigungen in dem vorliegenden Falle von einer bestimmten Theilquantität der ihm verfügbaren 90 Mass Wasser z. B. von 10 Mass abhängig sind, so stellt sich uns die Frage auch so dar: Welche Bedürfnissbefriedigungen unseres isolirten Subjectes würden nicht erfolgen, wenn dasselbe über diese Theilquantität nicht, d. i. statt über 90 Mass nur über 80 Mass verfügen würde.
Nun ist nichts sicherer, als dass das obige wirthschaftende Subject, auch wenn es nur über 80 Mass Wasser täglich verfügen könnte, vor wie nach täglich die zur Erhaltung seines Lebens nöthige Quantität Wasser zu sich nehmen, ferner so viel Thiere erhalten würde, als ihm zur Erhaltung seines Lebens unumgänglich erforderlich sind. Es würde, da diese Gebrauchszwecke nur 20 Mass Wasser täglich erfordern, die ihm erübrigenden 60 Mass dazu verwenden, um zunächst alle jene Bedürfnisse zu befriedigen, von deren Befriedigung seine Gesundheit [102] und dauernde Wohlfahrt überhaupt bedingt sind. Da es zu diesem Zwecke im Ganzen nur 40 Eimer Wasser benöthigt, würde ihm noch ein Quantum von 20 Mass täglich erübrigen, die es zu blossen Genusszwecken verwenden könnte. Es könnte demnach entweder seinen Blumengarten, oder diejenigen Thiere erhalten, welche es bloss um des Vergnügens willen besitzt und es würde jedenfalls die Wahl zwischen diesen beiden Bedürfnissbefriedigungen so treffen, dass die ihm wichtigere, mit Hintansetzung der ihm minder wichtig erscheinenden, erfolgen würde.
Ob desshalb unser Robinson bei einer ihm täglich verfügbaren Quantität von 90 Mass Wasser über 10 Mass mehr, oder weniger verfügt, ist eine Frage, die für ihn gleichbedeutend mit jener ist, ober in der Lage sein wird, die am wenigsten wichtigen der bisher mit 10 Mass Wasser täglich befriedigten Bedürfnisse weiter zu befriedigen, oder nicht, und es werden demnach zehn Mass Wasser, insolange er über die Gesammtquantität von 90 Mass Wasser täglich verfügt, für ihn nur jene Bedeutung haben, welche diese letzteren Bedürfnissbefriedigungen für ihn besitzen, also nur die Bedeutung relativ unwichtiger Genüsse.
Setzen wir nun deu Fall, die Quelle, welche das Subject der isolirten Wirthschaft, von welchem wir hier sprechen, mit Wasser versorgt, würde noch weiter versiegen, so zwar, dass es nur über vierzig Mass Wasser täglich zu verfügen vermöchte. Auch jetzt noch, gleich wie vorhin, werden von der Verfügung über diese Quantität Wasser in ihrer Gesammtheit die Erhaltung seines Lebens und seiner Wohlfahrt bedingt sein; die Sachlage hätte sich indess in einem wichtigen Punkte geändert. War früher von jeder irgendwie practisch bedeutenden Theilquantität, z. B. einer Mass, ein Genuss oder irgend eine Annehmlichkeit der wirthschaftenden Persönlichkeit abhängig, so ist die Frage: ob eine Mass Wasser täglich mehr oder weniger? für unseren Robinson jetzt bereits eine solche der mehr oder minder vollständigen Erhaltung seiner Gesundheit, oder überhaupt seiner Wohlfahrt, so zwar dass, wofern ihm eine solche Quantität entgehen würde, dadurch bewirkt würde, dass er einigen seiner Bedürfnisse nicht mehr genügen könnte, von deren Befriedigung [103] die Erhaltung seiner Gesundheit und dauernden Wohlfahrt überhaupt bedingt ist. Hatte für unseren Robinson, so lange er über viele hundert Eimer Wasser verfügen konnte, ein einzelner Eimer dieses Gutes gar keinen Werth, später, als er noch über neunzig Mass täglich verfügen konnte, jede Mass doch nur die Bedeutung eines Genusses, der von ihr abhing, so hat jetzt jede Theilquantität der ihm noch verfügbaren vierzig Mass für ihn die Bedeutung viel wichtigerer Bedürfnissbefriedigungen, denn es hängt jetzt von jeder Theilquantität jener vierzig Mass bereits die Befriedigung von Bedürfnissen ab, deren Nichtbefriedigung seine Gesundheit und seine dauernde Wohlfahrt gefährdet. Der Werth einer jeden Güterquantität ist aber gleich der Bedeutung derjenigen Bedürfnissbefriedigungen, die davon abhängen. War der Werth einer Mass Wasser für unseren Robinson anfangs gleich Null, im zweiten Falle z. B. gleich eins, so findet derselbe seinen ziffermässigen Ausdruck jetzt z. B. bereits in der Zahl sechs.
Wenn nun aber bei fortgesetzter Dürre die Quelle immer mehr versiegen und schliesslich in derselben sich täglich nur noch so viel Wasser ansammeln würde, als eben erforderlich wäre, um das Leben jenes isolirten Menschen zu fristen, (also in unserem Falle circa 20 Mass, denn so viel braucht er für sich und jenen Theil seiner Heerde, ohne dessen Milch und Fleisch er nicht leben kann;) so wäre klar, dass in einem solchen Falle jede practisch noch beachtenswerthe Quantität Wasser, über die er zu verfügen vermöchte, für ihn die volle Bedeutung der Erhaltung seines Lebens, somit einen abermals erhöhten Werth hätte, der bereits in der Zahl 10 seinen ziffermässigen Ausdruk fände.
Wir haben demnach gesehen, dass im ersten Falle, insolange nämlich dem in Rede stehenden Subjecte viele tausend Eimer Wasser täglich zur Verfügung standen, eine Theilquantität hievon z. B. ein Eimer gar keinen Werth hatte—weil keinerlei Bedürfnissbefriedigung von einem einzelnen Eimer abhängig war, wir sahen im zweiten Falle, dass eine concrete Theilquantität der ihm verfügbaren 90 Mass für ihn bereits die Bedeutung von Genüssen erhielt, denn die am mindesten wichtigen Bedürfnissbefriedigungen, die in diesem Falle von jener Quantität von [104] 90 Mass abhingen, waren Genüsse, wir sahen, dass im dritten Falle, wo nur 40 Mass Wasser täglich zu seiner Verfügung standen, bereits wichtigere Bedürfnissbefriedigungen von der Verfügung über jede concrete Theilquantität abhängig waren und demgemäss sahen wir auch den Werth der Theilquantitäten steigen, welcher im vierten Falle, als noch wichtigere Bedürfnissbefriedigungen von jeder concreten Theilquantität abhängig wurden, sich abermals erhöhte.
Setzen wir nun, um zu complicirteren (socialen) Verhältnissen zu übergehen, den Fall, dass auf einem Segelschiffe, das noch 20 Tagreisen vom Lande entfernt wäre, durch irgend einen Unfall die Vorräthe an Nahrungsmitteln bis auf einen kleinen Rest verloren gehen würden, so zwar, dass für jeden der Mitreisenden nur eine solche Quantität irgend eines Nahrungsmittels, z. B. von Zwieback, erhalten bliebe, die eben zur Fortfristung seines Lebens während dieser 20 Tage erforderlich wäre. Dies würde ein Fall sein, in welchen bestimmten Bedürfnissen der auf dem Segelschiffe weilenden Personen eben nur die Verfügung über bestimmte Güter gegenüber stehen würde, so zwar, dass die Befriedigung jener Bedürfnisse vollständig von der verfügbaren Gütermenge abhängig wäre. Vorausgesetzt nun das Leben der Reisenden würde nur dann erhalten bleiben können, falls jeder derselben täglich ein halbes Pfund Zwieback zu sich nehmen würde, und es verfügte jeder der Reisenden thatsächlich nur über zehn Pfund Zwieback, so würde diese Quantität von Nahrungsmitteln für jeden der Schiffsbewohner die volle Bedeutung der Erhaltung seines Lebens haben. Unter solchen Verhältnissen würde Niemand, für den sein Leben überhaupt Bedeutung hätte, sich bewegen lassen, diese Güterquantitat, oder auch nur einen irgendwie beachtenswerthen Theil davon, gegen irgend welche andere Güter, die nicht Nahrungsmittel wären, ja selbst gegen die im gemeinen Leben sonst werthvollsten Güter hinzugeben. Wollte z. B. ein reicher Mann, der sich auf dem Schiffe befände, um die Pein des Hungers zu mildern, welcher von so schmaler Kost unzertrennlich wäre, für ein Pfund Zwieback die gleiche Gewichtsmenge Gold hingeben, so würde er keinen der Mitreisenden bereit finden, auf ein solches Anerbieten einzugehen.
[105]
Setzen wir nun aber den Fall, die Bewohner des Schiffes verfügten ausser den obigen zehn Pfund Schiffszwieback noch über je fünf weitere Pfunde dieses Nahrungsmittels. In diesem Falle würde das Leben dieser Personen nicht mehr von der Verfügung über ein einzelnes Pfund hievon abhängen, denn ein solches könnte ihrer Verfügung entrückt, oder aber von ihnen auch gegen andere Güter, als Nahrungsmittel, veräussert werden, ohne dass dadurch ihr Leben gefährdet werden möchte. Würde nun aber unter solchen Verhältnissen auch nicht ihr Leben von der Verfügung über ein Pfund dieses Nahrungsmittels abhängen, so würde doch diese Quantität für sie nicht nur ein Mittel gegen viele Schmerzen, sondern auch ein solches zur Erhaltung ihrer Gesundheit sein, da eine durch zwanzig Tage fortgesetzte, so ausserordentlich karge Ernährung, wie sie bei allen Jenen statt fände, die nur über zehn Pfund verfügen könnten, jedenfalls einen verderblichen Einfluss auf ihr Wohlbefinden haben müsste, und ein einzelnes Pfund Zwieback hätte unter solchen Verhältnissen für sie zwar nicht mehr die Bedeutung der Erhaltung ihres Lebens, wohl aber immer noch diejenige Bedeutung, welche jeder Einzelne derselben der Bewahrung seiner Gesundheit, beziehungsweise seines Wohlbefindens, so weit es von dieser Quantität abhängt, beilegen würde.
Setzen wir nun endlich den Fall, der Restaurant des Schiffes, von dem hier die Rede ist, verlöre alle seine Vorräthe an Nahrungsmitteln und die Reisenden wären gleichfalls ohne alle eigenen Vorräthe an solchen, das Schiff wäre aber mit einigen tausend Centnern Zwieback beladen und der Capitän des Schiffes würde mit Rücksicht auf die peinliche Lage, in welcher sich die Schiffsbewohner in Folge dieses Ereignisses befänden, Jedermann freistellen, sich nach Belieben mit Zwieback zu ernähren. Die Reisenden würden selbstverständlich zum Zwieback greifen, um damit - ihren Hunger zu stillen; Niemand wird aber daran zweifeln, dass in solch einem Falle wohl ein Stück geniessbares Fleisch für jeden der Reisenden, die durch zwanzig Tage auf blosse Zwiebackkost gesetzt wären, einen ziemlich grossen Werth, ein Pfund Zwieback jedoch nur einen ausserordentlich geringen, wohl auch gar keinen Werth haben würde.
Was ist nun der Grund davon, dass im ersten Falle die [106] Verfügung über ein Pfund Zwieback für jeden der Reisenden die volle Bedeutung der Erhaltung seines Lebens, im zweiten Falle noch eine sehr hohe, im dritten Falle aber gar keine, oder doch nur eine höchst geringe Bedeutung hat?
Die Bedürfnisse der Schiffsbewohner sind in allen drei Fällen dieselben geblieben, denn ihre Persönlichkeit und somit auch ihr Bedarf haben sich nicht geändert. Was sich aber geändert hat, war die diesem Bedarfe in jedem einzelnen Falle gegenüberstehende Quantität des obigen Nahrungsmittels, indem dem gleichen Bedarf der Schiffsbewohner nach Nahrungsmitteln in dem ersten Falle nur je zehn Pfund, im zweiten eine grössere, im dritten Falle aber eine noch grössere Quantität gegen. überstand und somit von Fall zu Fall die Bedeutung jener Bedürfnissbefriedigungen sich verminderte, welche von concreten Theilquantitäten jenes Nahrungsmittels abhängig waren.
Was wir nun aber hier zuerst an einem isolirten Individuum und hierauf an einer kleinen, von den übrigen Menschen zeitweilig abgeschiedenen Gesellschaft beobachten konnten, das gilt in gleicher Weise auch für die complicirteren Verhältnisse eines Volkes und der menschlichen Gesellschaft überhaupt. Der Zustand der Bewohner eines Landes nach einer schweren Miss ernte, nach einer Mittelernte und endlich in Jahren, die auf sehr günstige Ernten folgen, weist Verhältnisse auf, welche den oben gezeichneten dem Wesen nach analog sind, denn auch hier steht einem bestimmten Bedarfe in dem ersten Falle eine geringere verfügbare Quantität von Nahrungsmitteln gegenüber, als im zweiten, im zweiten aber eine geringere, als im dritten, so zwar, dass auch hier die Bedeutung der Bedürfnissbefriedigungen, welche von concreten Theilquantitäten abhängen, eine sehr verschiedene ist. Wenn in einem Lande nach einer überreichen Ernte ein Magazin mit 100.000 Metzen Korn verbrennt, so wird in Folge dieses Unglücksfalles höchstens weniger Alkohol erzeugt werden, oder aber der ärmere Theil der Bewohner jenes Landes im äussersten Falle etwas weniger vollständig sich ernähren können, ohne um dessentwillen Noth zu leiden; wenn dagegen ein solcher Unfall nach einer Mittelernte zustösst, werden sich schon viele Menschen viel wichtigere Bedürfnissbefriedigungen versagen müssen, trifft indess ein solcher [107] Unfall mit einer Hungersnoth zusammen, so werden zahlreiche Menschen dem Hungertode anheimfallen. In jedem der drei Fälle sind nämlich von jeder concreten Theilquantität des dem betreffenden Volke verfügbaren Getreides, dem Grade der Wichtigkeit nach sehr verschiedene Bedürfnissbefriedigungen abhängig und somit ist denn auch der Werth solcher Quantitäten in allen drei Fällen ein sehr verschiedener.
Fassen wir das Gesagte zusammen, eso ergeben sich als Resultat unserer bisherigen Untersuchungen die nachfolgenden Grundsätze:
1. Die Bedeutung, welche die Güter für uns haben, und welche wir Werth nennen, ist lediglich eine übertragene. Ursprünglich haben nur die Bedürfnissbefriedigungen für uns eine Bedeutung, weil von ihnen die Aufrechterhaltung unseres Lebens und unserer Wohlfahrt abhängt, wir übertragen aber in logischer Consequenz diese Bedeutung auf jene Güter, von deren Verfügung wir in der Befriedigung dieser Bedürfnisse abhängig zu sein uns bewusst sind.
2. Die Grösse der Bedeutung, welche die verschiedenen concreten Bedürfnissbefriedigungen (die einzelnen Acte derselben, welche eben durch concrete Güter herbeigeführt werden können) für uns haben, ist eine ungleiche und das Mass derselben liegt in dem Grade ihrer Wichtigkeit für die Aufrechterhaltung unseres Lebens und unserer Wohlfahrt.
3. Die Grösse der auf die Güter übertragenen Bedeutung unserer Bedürfnissbefriedigungen, das ist die Grösse des Werthes, ist somit gleichfalls eine verschiedene und das Mass derselben liegt in dem Masse der Bedeutung, welche die von den betreffenden Gütern abhängigen Bedürfnissbefriedigungen für uns haben.
4. In jedem concreten Falle sind von der Verfügung über eine bestimmte Theilquantität der einem wirthschaftenden Subjecte verfügbaren Gesammtquantität eines Gutes nur jene der durch die letztere noch gesicherten Bedürfnissbefriedigungen abhängig, welche für dies Subject die geringste Bedeutung unter diesen letzteren haben.
5. Der Werth eines concreten Gutes, oder einer bestimmten Theilquantität der einem wirthschaftenden Subjecte verfügbaren [108] Gesammtquantität eines Gutes ist für dasselbe demnach gleich der Bedeutung, welche die wenigst wichtigen von den durch die verfügbare Gesammtquantität noch gesicherten und mit einer solchen Theilquantität herbeizuführenden Bedürfnissbefriedigungen für das obige Subject haben. Diese Bedürfnissbefriedigungen sind es nämlich, rücksichtlich welcher das in Rede stehende wirthschaftende Subject von der Verfügung über das betreffende concrete Gut, beziehungsweise die betreffende Güterquantität abhängt [8].
[109]
Wir haben demnach in unseren bisherigen Untersuchungen einerseits die Verschiedenheit des Güterwerthes auf ihre letzten [110] Ursachen zurückgeführt, andererseits aber auch das letzte und ursprünglichste Mass gefunden, nach welchem aller Güterwerth von den Menschen gemessen wird.
[111]
Bei richtiger Auffassung des Gesagten kann es nunmehr auch nicht schwer werden, jedes Problem, bei welchem es sich [112] um die Erklärung der Ursachen der Verschiedenheit des Werthes zweier oder mehrerer concreter Güter oder Güterquantitäten handelt, seiner Lösung zuzuführen.
[113]
Fragen wir zum Beispiel darnach, warum ein Pfund Trinkwasser für uns unter gewöhnlichen Verhältnissen gar keinen Werth hat, während ein sehr geringer Bruchtheil eines Pfundes Gold oder Diamanten für uns der Regel nach einen sehr hohen Werth aufweist, so ergiebt sich die Beantwortung dieser Frage aus der nachfolgenden Betrachtung.
Diamanten und Gold sind so selten, dass sich die den Menschen verfügbaren Quantitäten der erstern insgesammt in einer Kiste, das den Menschen verfügbare Gold, wie eine einfache Berechnung lehrt, in einem einzigen grossen Saal verwahren liessen. Trinkwasser ist dagegen in so grossen Quantitäten auf der Erde vorhanden, dass sich kaum ein Reservoir denken lässt, der gross genug wäre, dasselbe zu umfassen. Demgemäss vermögen die Menschen auch nur den wichtigsten Bedürfnissen, zu deren Befriedigung Gold und Diamanten dienlich sind, Genüge zu thun, während sie ihr Bedürfniss nach Trinkwasser der Regel nach nicht nur vollständig zu befriedigen vermögen, sondern auch noch überdies sehr grosse Quantitäten dieses Gutes unbenützt sich entgehen lassen, weil sie die ganze ihnen verfügbare Quantität aufzubrauchen nicht im Stande sind. Von concreten Quantitäten Trinkwasser ist demnach unter gewöhnlichen Verhältnissen kein mensch liches Bedürdniss in seiner Befriedigung derart abhängig, dass es unbefriedigt bleiben müsste, wofern die Menschen über diese concrete Quantität nicht zu verfügen vermöchten, während bei dem Golde und den Diamanten selbst die geringfügigsten unter den durch die verfügbare Gesammtquantität gesicherten Bedürfnissbefriedigungen, [114] noch immer eine relativ hohe Bedeutung für die wirthschaftenden Menschen haben. Concrete Quantitäten von Trinkwasser haben somit für die wirthschaftenden Menschen der Regel nach keinen, solche von Gold oder Diamanten aber einen hohen Werth.
Dies alles gilt nur für die gewöhnlichen Lebensverhältnisse, wo uns das Trinkwasser in Ueberfülle, Diamanten und Gold aber in sehr geringen Quantitäten verfügbar sind. In der Wüste aber, wo von einem Trunke Wasser nicht selten das Leben eines Reisenden abhängt, lässt sich dagegen allerdings der Fall denken, dass für ein Individuum von einem Pfunde Wasser wichtigere Bedürfnissbefriedigungen abhängen würden, als selbst von einem Pfunde Gold. In diesem Falle müsste folgerecht der Werth eines Pfundes Wasser für das betreffende Individuum grösser sein, als der eines Pfundes Gold. Die Erfahrung lehrt uns aber auch, dass ein solches, oder doch ein ähnliches Verhältniss in der That überall dort einzutreten pflegt, wo die ökonomische Sachlage eine derartige ist, wie wir sie soeben gezeichnet haben.
c) Einfluss der verschiedenen Qualität der Güter auf ihren Werth.
Die menschlichen Bedürfnisse können nicht selten durch Güter verschiedener Art, noch häufiger aber durch Güter befriedigt werden, welche zwar nicht der Art, wohl aber der Species nach verschieden sind. Dort, wo es sich um bestimmte Complexe menschlicher Bedürfnisse einerseits, und die zu ihrer Befriedigung verfügbaren Güterquantitäten andererseits handelt (S. 96), stehen den ersteren demnach nicht immer völlig homogene Güterquantitäten gegenüber, sondern nicht selten Güter verschiedener Art, noch häufiger aber solche, deren Species eine verschiedene ist.
Nun haben wir, um der grössern Einfachheit der Darlegung willen, bisher von der Verschiedenheit dieser Güterquantitäten abstrahirt, und in dem Vorangehenden nur jene Fälle in das Auge gefasst, in welchen Bedürfnissen bestimmter Art (auf deren, je nach dem Vollständigkeitsgrade der bereits erfolgten Bedürfnissbefriedigung, sich abschwächende Bedeutung wir insbesondere hingewiesen haben) völlig gleichartige Güterquantitäten gegenüberstehen, um solcherart den Einfluss, welchen die Verschiedenheit der [115] verfügbaren Quantitäten auf den Werth der Güter äussert, desto deutlicher hervortreten lassen zu können.
Es erübrigt uns nunmehr, noch jene Fälle unserer Betrachtung zu unterziehen, in welchen bestimmte menschliche Bedürfnisse durch Güter verschiedener Art oder Species befriedigt werden können und somit einem gegebenen menschlichen Bedarfe verfügbare Güterquantitäten gegenüber stehen, deren concrete Theilquantitäten von verschiedener innerer Beschaffenheit sind.
Hier ist nun zunächst zu bemerken, dass eine Verschiedenheit der Güter, möge dieselbe eine solche der Art, oder der Species sein, den Werth concreter Theilquantitäten der bezüglichen Güter nicht tangiren kann, wenn durch dieselbe die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse in keinerlei Weise berührt wird. Güter, welche die menschlichen Bedürfnisse in völlig gleicher Weise befriedigen, werden deshalb in wirthschaftlicher Beziehung mit Recht als völlig homogen betrachtet, wenngleich auch dieselben ihrer äusseren Erscheinung nach verschiedenen Arten oder Species angehören.
Damit die Verschiedenheit der Art, beziehungsweise der Species zweier Güter, auch eine Verschiedenheit ihres Werthes begründe, ist zugleich eine verschiedene Tauglichkeit derselben, menschliche Bedürfnisse zu befriedigen, also was wir, vom wirthschaftlichen Standpunkte aus, eine verschiedene Qualität derselben nennen, erforderlich, und die Untersuchung über den Einfluss, welchen diese letztere auf den Werth der concreten Güter äussert, ist demnach der Gegenstand der nachfolgenden Untersuchung.
Die Verschiedenheit der Qualität der Güter kann in wirthschaftlicher Beziehung eine doppelte sein: Entweder können mittelst gleicher Quantitäten verschieden qualificirter Güter menschliche Bedürfnisse in quantitativ, oder aber in qualitativ verschiedener Weise befriedigt werden. So kann zum Beispiel mittelst einer bestimmten Quantität Buchenholz das Wärmebedürfniss der Menschen in quantitativ viel intensiverer Weise befriedigt werden, als mit einer gleichen Quantität Tannenholz, während zwei gleiche Quantitäten von Nahrungsmitteln, deren Nährkraft dieselbe ist, doch das Nahrungsbedürfniss in qualitativ verschiedener Weise befriedigen [116] können, indem z. B. mit der Verzehrung des einen ein Genuss, mit jener des andern aber ein solcher entweder nicht, oder doch nicht in gleichem Masse verbunden ist. Bei den Gütern er erstern Kategorie kann die geringere Qualität durch diez grössere Quantität vollständig ersetzt werden, bei den Gütern der letztern Art ist dies nicht möglich. Buchenholz kann zu Heizzwecken durch Tannenholz, Erlenholz durch Fichtenhloersetzt werden und Steinkohlen von geringerer Heizkraft, Eichen lohe von geringerem Tanningehalte, die gewöhulichen Arbeitsleistungen träger, oder minder leistungsfähiger Taglöhner können der Regel nach, wofern sie nur den wirthschaftenden Menschen in entsprechend grössern Quantitäten verfügbar sind, die höher qualificirten Güter vollständig ersetzen; unschmackhafte Speisen oder Getränke dagegen, dunkle und feuchte Wohnräume, die Arbeitsleistungen unintelligenter Aerzte u. dgl. m. können, selbst wenn sie uns in den grössten Quantitäten verfügbar sind, unsere Bedürfnisse doch qualitativ nie so vollständig befriedigen, als die entsprechenden höher qualificirten Güter.
Da es nun bei der Werthschätzung der Güter Seitens der wirthschaftenden Menschen, wie wir sahen, lediglich auf die Bedeutung der Befriedigung jener Bedürfnisse ankommt, rücksichtlich welcher sie von der Verfügung über ein Gut abhängig sind (S. 88), die Quantität eines Gutes, wodurch eine bestimmte Bedürfnissbefriedigung herbeigeführt werden kann, hiebei aber ein secundäres Moment ist, so ist auch klar, dass geringere Quantitäten eines höher qualificirten Gutes, wofern sie, für sich allein, ein menschliches Bedürfniss genau in derselben (also in quantitativ und qualitativ gleicher) Weise befriedigen, wie grössere Quantitäten des minder qualificirten Gutes, auch den eleichen Werth für die wirthschaftenden Menschen haben, wie diese letztern, und demnach gleiche Quantitäten der verschieden qualificirten Güter, nach Massgabe des obigen Verhältnisses, ginen verschiedenen Werth aufweisen. Wenn demnach z. B. be der Werthschätzung von Eichenlohe lediglich die Gärbkraft der-i selben in Betracht kommt, so werden 7 Centner der einen Sorte, welche eben so viel Wirksamkeit haben, wie 8 Centner der andern, für die betreffenden Handwerker auch einen gleichen Werth haben und die blosse Reduction der obigen Güter auf [117] Quantitäten von gleicher ökonomischer Wirksamkeit, (ein Mittel, das im wirthschaftlichen Leben der Menschen thatsächlich in allen ähnlichen Fällen zur Anwendung kommt,) behebt demnach vollständig die Schwierigkeit, welche aus der verschiedenen Qualität der Güter, (sofern ihre Wirksamkeit lediglich eine quantitativ verschiedene ist,) für die Werthschätzung concreter Quantitäten derselben entstehen, indem hiedurch der in Rede stehende complicirtere Fall auf das einfache Verhältniss, wie wir dasselbe oben (S. 89 ff.) dargestellt haben, zurückgeführt wird.
Verwickelter ist die Frage nach dem Einflusse, welchen die verschiedene Qualität auf den Werth concreter Güter oder Güterquantitäten äussert, wenn in Folge der verschiedenen Qualität der Güter die Bedürfnisse in qualitativ verschiedener Weise zur Befriedigung gelangen. Dass auch hier die Bedeutung jener Bedürfnisse, welche unbefriedigt bleiben müssten, wofern wir über ein seiner Art, aber auch seiner besondern Qualität nach bestimmtes Gut nicht zu verfügen vermöchten, das massgebende Moment seines Werthes ist, steht nach dem, was wir oben über das allgemeine Princip der Werthbestimmung der Güter sagten, zwar ausser allem Zweifel (S.88). Die Schwierigkeit, von der wir hier sprechen, liegt denn auch nicht in dem allgemeinen Principe der Werthbestimmung der obigen Güter, sondern vielmehr in der Bestimmung jener Bedürfnissbefriedigung, welche eben von einem bestimmten concreten Gute unter Umständen abhängig ist, wo einer Gesammtheit von Bedürfnissen Güter gegenüberstehen, deren Theilquantitäten die obigen Bedürfnisse in qualitativ verschiedener Weise zu befriedigen geeignet sind, also in der practischen Anwendung des obigen Principes im wirthschaftlichen Leben der Menschen. Die Lösung dieses Problems ergiebt sich nun aber aus den nachfolgenden Betrachtungen.
Die wirthschaftenden Menschen verwenden die Quantitäten der ihnen verfügbaren Güter nicht ohne Rücksicht auf die verschiedene Qualität derselben, wo immer eine solche vorhanden ist. Der Landwirth, welcher über Getreide von verschiedener Qualität verfügt, verwendet z. B. nicht etwa das schlechteste zur Aussaat, das Getreide mittlerer Qualität zur Viehmästung und das vorzüglichste zu Nahrungszwecken und zur Erzeugung [118] von Getränken, oder aber das verschieden qualificirte Getreide ohne Wahl für den einen oder den andern Zweck, sondern das vorzüglichste nach Massgabe des Bedarfes für den ersten, das vorzüglichere von dem erübrigenden Reste für den letzten, das Getreide mindester Qualität aber für den Zweck der Viehmästung
Während demnach bei Gütern, deren Theilquantitäten keine verschiedene Qualität aufweisen, die gesammte verfügbare Quantität derselben der Gesammtheit jener concreten Bedürfnisse gegenübersteht, welche mittelst dieser Güter befriedigt werden können; steht in dem Falle, wo die Theilquantitäten eines Gutes menschliche Bedürfnisse in qualitativ verschiedener Weise befriedigen, nicht mehr die Gesammtheit der verfügbaren Quantität den bezüglichen Bedürfnissen in ihrer Gesammtheit, sondern jede verfügbare Quantität von besonderer Qualität auch besondern Bedürfnissen der wirthschaftenden Menschen gegenüber.
Können nun Güter einer bestimmten Qualität mit Rücksicht auf gegebene Gebrauchszwecke durch anders qualificirte Güter überhaupt nicht ersetzt werden, so findet das oben (S.99) dargelegte Gesetz der Werthbestimmung auf die concreten Quantitäten dieser Güter schon an und für sich seine volle Anwendung. Der Werth concreter Quantitäten derselben ist nämlich gleich der Bedeutung der mindest wichtigen Bedürfnissbefriedigung, für welche durch die gesammte verfügbare Quantität des bestimmt qualificirten Gutes noch vorgesorgt ist, denn diese Bedürfnissbefriedigung ist es, rücksichtlich welcher wir von der Verfügung über ein concretes Gut der obigen Qualität thatsächlich abhängig sind.
Können-dagegen menschliche Bedürfnisse durch verschieden qualificirte Güter, wenngleich auch in qualitativ verschiedener Weise befriedigt werden, so zwar, dass Güter der einen Qualität durch solche einer andern, wenngleich auch nicht mit derselben Wirksamkeit, ersetzt werden können, so ist der Werth eines concreten bestimmt qualificirten Gutes, oder einer solchen Theilquantität, gleich der Bedeutung der am wenigsten wichtigen Bedürfnissbefriedigung, für welche durch Güter der in Rede stehenden Qualität vorgesorgt ist, abzüglich einer um so grössern Werthquote, je geringer der Werth der Güter minderer Qualität [119] ist, durch welche sich das bezügliche Bedürfniss gleichfalls befriedigen lässt und je geringer zugleich die Differenz zwischen der Bedeutung ist, welche die Befriedigung des bezüglichen Bedürfnisses mit dem höher, und die Befriedigung desselben Bedürfnisses mit dem niederer qualificirten Gute für die Menschen hat.
Wir gelangen somit zum Resultate, dass auch überall dort, wo einem Complexe von Bedürfnissen eine Quantität von Gütern verschiedener Qualität gegenübersteht, doch von jeder concreten Theilquantität dieser letztern, beziehungsweise von jedem concreten Gute, Bedürfnissbefriedigungen von bestimmter Intensivität abhängig sind, und demnach auch in allen hier einschlägigen Fällen das oben von uns aufgestellte Princip der Bestimmung des Werthes concreter Güter seine volle Anwendbarkeit behält.
d) Subjectiver Charakter des Werthmasses.—Arbeit und Werth.—Irrthum.
Wir haben bereits oben, wo wir von dem Wesen des Werthes sprachen, darauf hingewiesen, dass derselbe nichts den Gütern Anhaftendes, keine Eigenschaft derselben, noch viel weniger aber ein selbstständiges Ding sei und nichts dem entgegenstehe, dass ein Gut für ein wirthschaftendes Subject Werth habe, für ein anderes unter anderen Verhältnissen aber keinen Werth aufweise. Aber auch das Mass des Werthes ist durchaus subjectiver Natur und ein Gut kann desshalb, je nach Verschiedenheit des Bedarfes und der verfügbaren Menge, für ein wirthschaftendes Subject einen grossen, für ein anderes einen geringen, für ein drittes sogar keinen Werth haben. Was der eine verschmäht, oder gering achtet, wird von dem andern gesucht, was der eine preisgiebt, nicht selten von einem andern aufgelesen, und während ein wirthschaftendes Subject eine gewisse Quantität des einen Gutes einer grössern eines andern Gutes gleichschätzt, ist bei einem andern wirthschaftenden Subjecte nicht selten gerade das umgekehrte Verhältniss der Werthschätzung zu beobachten.
Der Werth ist demnach nicht nur seinem Wesen, sondern auch seinem Masse nach subjectiver Natur. Die Güter haben „Werth“ stets für bestimmte wirthschaftende Subjecte, aber auch nur für solche einen bestimmten Werth.
[120]
Der Werth, welchen ein Gut für ein wirthschaftendes Individuum hat, ist der Bedeutung jener Bedürfnissbefriedigung gleich, rücksichtlich welcher das betreffende Individuum von der Verfügung über das in Rede stehende Gut abhängig ist. Ob und welche Quantitäten von Arbeit, oder von anderen Gütern höherer Ordnung zur Hervorbringung des Gutes, dessen Werth in Frage ist, verwendet wurden, hat mit der Grösse dieses letzteren keinen nothwendigen und unmittelbaren Zusammenhang. Ein nicht ökonomisches Gut (z. B. eine Quantität Holz in einem Urwalde) gewinnt deshalb keinen Werth für die Menschen, weil grosse Quantitäten von Arbeit, oder von sonstigen ökonomischen Gütern zur Hervorbringung desselben verwandt wurden, und ob ein Diamant zufällig gefunden, oder mit einem Aufwande von tausend Arbeitstagen in einer Diamantengrube gewonnen wurde, ist für seinen Werth gänzlich gleichgiltig, wie denn überhaupt im practischen Leben Niemand nach der Geschichte der Entstehung eines Gutes fragt, sondern bei Beurtheilung des Werthes desselben lediglich die Dienste im Auge hat, welche ihm dasselbe leisten wird, und deren er entbehren müsste, wofern er über das betreffende Gut nicht verfügen könnte. Es haben demnach nicht selten Güter, auf die viel Arbeit verwandt wurde, keinen, andere, auf welche keine Arbeit verwandt wurde, einen grossen, solche, auf welche viel und andere, auf welche wenig, oder keine Arbeit verwandt wurde, einen gleichen Werth für die wirthschaftenden Menschen, und es können somit die auf Herstellung eines Gutes verwandten Quantitäten von Arbeit, oder von sonstigen Productionsmitteln, nicht das massgebende Moment seines Werthes sein. Wohl zeigt uns die Vergleichung des Werthes des Productes mit dem Werthe der zur Hervorbringung desselben verwandten Productionsmittel, ob und in wie weit die Production desselben, also ein der Vergangenheit angehörender Act menschlicher Thätigkeit, ein zweckmässiger, ein ökonomischer war; auf den Werth des Productes selbst haben die auf seine Hervorbringung verwandten Güterquantitäten aber weder einen nothwendigen, noch auch einen unmittelbar massgebenden Einfluss.
Auch die Meinung, dass die zur Reproduction der Güter nöthige Quantität von Arbeit, oder von sonstigen Productionsmitteln [121] das massgebende Moment des Güterwerthes hilde, ist eine unhaltbare. Es giebt eine grosse Anzahl von Gütern, die sich nicht reproduciren lassen (z. B. Antiquitäten, Gemälde alter Meister etc.). Es giebt demnach eine Anzahl von Erscheinungen der Volkswirthschaft, bei welchen wir wohl den Werth, nicht aber die Möglichkeit der Reproduction beobachten können, und kann somit ein mit dieser letztern zusammenhängendes Moment nicht das massgebende Princip des Werthes überhaupt sein. Auch lehrt die Erfahrung, dass der Werth der zur Reproduction zahlreicher Güter (z. B. aus der Mode gekommener Kleider, veralteter Maschinen etc.) erforderlichen Productionsmittel ein weit höherer, als der Werth des Productes selbst, in manchen Fällen aber auch ein niederer ist, als der Werth dieses letzten. Weder die zur Production eines Gutes verwendete, noch die zur Reproduction eines Gutes erforderliche Quantität von Arbeit, oder sonstigen Gütern, ist demnach das massgebende Moment des Güterwerthes, sondern vielmehr die Grösse der Bedeutung jener Bedürfnissbefriedigungen, rücksichtlich welcher wir von der Verfügung über ein Gut abhängig zu sein uns bewusst sind, denn dies Princip der Werthbestimmung gilt für alle Fälle der Wertherscheinung und ist keine Ausnahme hievon im Bereiche der menschlichen Wirthschaft vorhanden.
Die Bedeutung, welche eine Bedürfnissbefriedigung für uns hat, findet ihr Mass nicht in unserer Willkür, sondern vielmehr in der von unserer Willkür unabhängigen Bedeutung, welche jene Bedürfnissbefriedigung für unser Leben, oder für unsere Wohlfahrt hat. Die Bedeutung der verschiedenen Bedürfnissbefriedigungen, beziehungsweise der einzelnen Acte derselben, ist indess ein Gegenstand der Beurtheilung Seitens der wirthschaftenden Menschen, und die bezügliche Erkenntniss somit unter Umständen auch dem Irrthume unterworfen.
Wir haben oben gesehen, dass für die Menschen jene Bedürfnissbefriedigungen die höchste Bedeutung haben, von welchen ihr Leben abhängt, dass im Grade der Bedeutung hierauf jene folgen, von welchen ihre Wohlfahrt bedingt ist, und zwar in der Weise, dass diejenigen Bedürfnissbefriedigungen, von welchen für die Menschen ein höherer Grad der Wohlfahrt abhängt (bei gleicher Intensivität eine länger dauernde, bei gleicher Dauer [122] eine intensivere) eine höhere Bedeutung für dieselben haben, als jene, von welchen ein geringerer Grad ihrer Wohlfahrt abhängig ist.
Damit ist nun aber durchaus nicht ausgeschlossen, dass thörichte Menschen in Folge ihrer mangelhaften Erkenntniss die Bedeutung der einzelnen Bedürfnissbefriedigungen nicht bisweilen in entgegengesetzter Weise schätzen, und selbst Individuen, deren wirthschaftliche Thätigkeit eine verständige ist, die also jedenfalls bemüht sind, die wahre Bedeutung der Bedürfnissbefriedigungen zu erkennen, um solcherart eine richtige Grundlage für ihre ökonomische Thätigkeit zu gewinnen, nicht dem Irrthume ausgesetzt sind, der ja von aller menschlichen Erkenntniss unzertrennlich ist. Insbesondere lassen sich die Menschen leicht verleiten, die Bedeutung von Bedürfnissbefriedigungen, welche in intensiver, wenn gleich auch nur rasch vorübergehender Weise ihr Wohlbefinden fördern, höher anzuschlagen, als solche Bedürfnissbefriedigungen, von welchen ein zwar minder intensives, aber über lange Zeitperioden sich erstreckendes Wohlbefinden abhängig ist, das ist, sie pflegen nicht selten vorübergehende intensive Genüsse höher zu achten, als ihre dauernde Wohlfahrt, ja bisweilen höher sogar, als ihr Leben.
Verfallen demnach die Menschen schon in Bezug auf die Erkenntniss des subjectiven Momentes der Werthbestimmung nicht selten dem Irrthume, wo es sich doch lediglich um die Betrachtung ihrer persönlichen Zustände handelt, so liegt der Irrthum noch viel näher überall dort, wo es sich um die Erkenntniss des objectiven Momentes der Werthbestimmung, zumal um die Erkenntniss der Grösse der ihnen verfügbaren Quantitäten und die verschiedenen Qualitäten der Güter handelt. Eben deshalb ist es aber auch klar, warum gerade das Gebiet der Werthbestimmung der concreten Güter im wirthschaftlichen Leben so mannigfaltigen Irrthümern ausgesetzt ist, und wir nicht selten, abgesehen von jenen Schwankungen des Werthes, welche einem Wechsel im Bereiche der menschlichen Bedürfnisse, oder der den Menschen verfügbaren Güterquantitäten, oder aber endlich einem solchen der innern Beschaffenheit der Güter entspringen, auch solche beobachten können, welche die letzte Ursache lediglich in einer modificirten Erkenntniss der [123] Bedeutung haben, welche die bezüglichen Güter für unser Leben und unsere Wohlfahrt besitzen.
§. 3.
Die Gesetze, nach welchen sich der Werth der Güter höherer Ordnung regelt.
a) Ueber das massgebende Princip des Werthes der Güter höherer Ordnung.
Unter den grundlegenden Irrthümern, welche von der weittragendsten Bedeutung für die bisherige Entwicklung unserer Wissenschaft waren, steht in erster Reihe der Grundsatz: dass die Güter desshalb für uns Werth erlangen, weil zur Hervorbringung derselben Güter verwandt wurden, welche Werth für uns hatten. Wir werden dort, wo wir von dem Preise der Güter höherer Ordnung sprechen werden, auf die besonderen Ursachen hinweisen, welche den obigen Irrthum zu Tage förderten und bewirkten, dass derselbe in einer allerdings mehrfach verclausulirten Form die Grundlage der herrschenden Preistheorien wurde. Hier sei zunächst constatirt, dass der obige Grundsatz so sehr aller Erfahrung widerstreitet (S. 120), dass derselbe unbedingt auch dann verworfen werden müsste, wenn das Problem der Feststellung eines Principes des Güterwerthes durch denselben eine formell richtige Lösung fände.
Nun wird aber durch den obigen Grundsatz selbst dieser Zweck nicht erreicht, denn er bietet uns wohl einen Erklärungsgrund für den Werth jener Güter, welche wir als „Producte“ bezeichnen können, nicht aber für jenen aller übrigen Güter, welche sich uns als die ursprünglichsten Elemente der Production darstellen, also zumal für den Werth aller uns von der Natur unmittelbar dargebotenen Güter, insbesondere der Bodennutzungen, ferner für den Werth der Arbeitsleistungen, und wie wir in Folge sehen werden, auch der Capitalnutzungen. Der Werth aller dieser Güter kann durch den obigen Grundsatz nicht erklärt werden, ja er wird durch denselben geradezu unbegreiflich.
Durch den obigen Grundsatz wird demnach das Problem, einen für alle Fälle geltenden Erklärungsgrund des Güterwerthes festzustellen, weder sachlich noch auch formell richtig gelöst, denn einerseits steht er im Widerspruche zur Erfahrung, und andererseits ist seine Anwendbarkeit überall dort ausgeschlossen, [124] wo Güter unserer Beobachtung vorliegen, welche nicht das Product der Verbindung von Gütern höherer Ordnung sind. Der Werth, welchen die Güter niederer Ordnung für uns haben, kann demnach nicht durch den Werth der Güter höherer Ordnung bedingt sein, welche bei der Production derselben verwendet wurden, vielmehr ist es klar, dass umgekehrt der Werth der Güter höherer Ordnung stets und ausnahmslos durch den voraussichtlichen Werth jener Güter niederer Ordnung bedingt ist, zu deren Hervorbringung sie dienen [9].
Steht dies nun aber fest, so ist auch klar, dass der Werth der Güter höherer Ordnung auch nicht das massgebende Moment des voraussichtlichen Werthes der entsprechenden Güter niederer Ordnung, oder aber der Werth der zur Hervorbringung eines Gutes bereits verwendeten Güter höherer Ordnung das massgebende Moment seines effectiven Werthes sein kann, sondern umgekehrt unter allen Umständen der Werth der Güter höherer Ordnung sich nach dem vorraussichtlichen Werthe der Güter niederer Ordnung richtet, zu deren Hervorbringung dieselben von den wirthschaftenden Menschen bestimmt sind, oder voraussichtlich werden bestimmt werden.
Dieser voraussichtliche Werth der Güter niederer Ordnung ist—was wohl beobachtet werden muss — nicht selten von jenem, welchen ähnliche Güter in der Gegenwart für uns haben, sehr verschieden, und finden desshalb die Güter höherer Ordnung, [125] durch welche wir über Güter niederer Ordnung doch nur mit Rücksicht auf einen künftigen Zeitraum verfügen (S. 21 ff.), das Mass ihres Werthes keineswegs in dem letztern, sondern in dem erstern.
Wenn wir z. B. über Salpeter, Schwefel, Kohle, die zur Schiesspulvererzeugung erforderlichen Arbeitsleistungen, Vorrichtungen etc. und mittelbar durch dieselben über eine Quantität Schiesspulver nach drei Monaten verfügen, so ist klar, dass der Werth, welchen das in Rede stehende Schiesspulver voraussichtlich für uns nach drei Monaten haben wird, nicht nothwendigerweise gleich sein muss, sondern grösser oder geringer sein kann, als der Werth, welchen eine gleiche Quantität dieses Gutes in der Gegenwart für uns hat und demgemäss auch der Werth der obigen Güter höherer Ordnung sein Mass nicht in dem Werthe des Schiesspulvers in der Gegenwart, sondern in jenem findét, welchen das bezügliche Product voraussichtlich nach Ablauf der Productionsfrist für uns haben wird. Ja, es ist der Fall denkbar, dass eine bestimmte Quantität eines Gutes niederer, beziehungsweise erster Ordnung, in der Gegenwart gänzlich werthlos ist (z. B. Eis im Winter), während doch die uns gleichzeitig verfügbaren entsprechenden Güter höherer Ordnung, welche uns Quantitäten des obigen Gutes in kommenden Zeiträumen sicherstellen (z. B. die zur künstlichen Eisproduction erforderlichen Materialien und Vorrichtungen in ihrer Gesammtheit) mit Rücksicht auf diese letztern Zeiträume allerdings Werth für uns haben und so umgekehrt.
Zwischen dem Werthe, welchen Güter niederer, beziehungsweise erster Ordnung, für uns in der Gegenwart haben, und dem Werthe der zur Hervorbringung solcher Güter uns in der Gegenwart verfügbaren Güter höherer Ordnung, besteht demnach kein nothwendiger Zusammenhang, vielmehr ist es klar, dass die erstern ihren Werth aus dem Verhältnisse zwischen Bedarf und verfügbarer Quantität in der Gegenwart herleiten, die letztern aber aus dem voraussichtlichen Verhältnisse zwischen Bedarf und verfügbarer Quantität mit Rücksicht auf jenen kommenden Zeitraum, für welchen die bezüglichen Producte uns mittelst der in Rede stehenden Güter höherer Ordnung verfügbar sein [126] werden. Steigt der voraussichtliche Werth eines Gutes niederer Ordnung in einem kommenden Zeitraume, so steigt auch unter sonst gleichen Verhältnissen der Werth derjenigen Güter höherer Ordnung, deren Besitz uns die Verfügung über die obigen Güter in dem in Rede stehenden Zeitraume sichert, während das Steigen oder Fallen des Werthes eines Gutes niederer Ordnung in der Gegenwart in keinem nothwendigen ursächlichen Zusammenhange mit dem Steigen oder Fallen des Werthes der entsprechenden uns in der Gegenwart verfügbaren Güter höherer Ordnung steht.
Es ist demnach auch nicht der Werth der Güter niederer Ordnung in der Gegenwart, wornach sich der Werth der entsprechenden Güter höherer Ordnung richtet, sondern vielmehr unter allen Umständen der voraussichtliche Werth des Productes, welcher das massgebende Princip des Werthes der bezüglichen Güter höherer Ordnung ist [10].
[127]
b) Ueber die Productivität des Capitals.
Die Umgestaltung von Gütern höherer in solche niederer Ordnung erfolgt gleich jedem andern Wandlungsprocesse in der Zeit und die Zeiträume, für welche wir über Güter erster Ordnung mittelbar durch unsern Besitz von Güter höherer Ordnung verfügen, liegen um so ferner ab, je höher die Ordnung dieser letztern ist. Die fortschreitende Heranziehung von Gütern höherer Ordnung zur Befriedigung unserer Bedürfnisse hat demnach, wie wir oben sahen (S. 26 ff.), allerdings den Erfolg, die Quantitäten der uns verfügbaren Genussmittel fortschreitend zu vermehren, sie ist aber nur unter der Voraussetzung möglich, dass die vorsorgliche Thätigkeit der Menschen sich auf immer entferntere Zeiträume erstreckt. Ein wilder Indianer ist ohne Unterlass damit beschäftigt, den Bedarf der nächsten Tage zu decken, der Nomade, welcher die ihm verfügbaren Nutzthiere nicht consumirt, sondern zur Aufzucht von Jungen bestimmt, producirt schon Güter, die ihm erst nach einigen Monaten verfügbar sein werden, bei Culturvölkern aber ist ein nicht geringer Theil der Mitglieder der Gesellschaft sogar mit der Hervorbringung von Gütern beschäftigt, welche erst nach Jahren, ja nicht selten erst nach Jahrzehnten, zur unmittelbaren Befriedigung menschlicher Bedürfnisse beitragen werden.
Die wirthschaftenden Menschen können demnach dadurch, dass sie die occupatorische Wirthschaft verlassen und zur Heranziehung von Gütern der höheren Ordnungen zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse fortschreiten, allerdings die ihnen verfügbaren Genussmittel nach Massgabe dieses ihres Fortschrittes vermehren, aber nur mit der Beschränkung, dass sie in demselben Masse, als sie zu Gütern höherer Ordnung fortschreiten, die Zeiträume hinausrücken, auf welche sich ihre vorsorgliche Thätigkeit erstreckt.
In diesem Umstande liegt nun aber eine wichtige Schranke des wirthschaftlichen Fortschrittes. Auf die Sicherstellung der den Menschen zur Erhaltung ihres Lebens und ihrer Wohlfahrt in der Gegenwart, oder der nächsten Zukunft erforderlichen Genussmittel ist stets ihre ängstlichste Sorge gerichtet, eine Sorge, die sich in dem Grade abschwächt, je ferner der Zeitraum ist, auf [128] welchen sie sich erstreckt. Diese Erscheinung ist keine zufällige, sondern im Wesen der menschlichen Natur tief begründet. Soweit nämlich von der Befriedigung unserer Bedürfnisse die Erhaltung unseres Lebens abhängig ist, muss die Sicherstellung der Befriedigung der Bedürfnisse früherer Zeiträume nothwendigerweise jener der spätern vorangehen. Auch dort, wo von unserer Verfügung über eine Güterquantität nicht unser Leben, sondern lediglich unsere dauernde Wohlfahrt, (also zumal unsere Gesundheit,) abhängig ist, ist die Erhaltung dieser letztern in einem vorangehenden Zeitraume der Regel nach die Vorbedingung derselben in einem nachfolgenden. Die Verfügung über die Mittel zur Erhaltung unserer Wohlfahrt in einem entfernten Zeitraume nützt uns nämlich wenig, wenn Noth und Mangel unsere Gesundheit in einem vorangehenden bereits zerrüttet, oder unsere Entwickelung behindert haben. Aehnlich verhält es sich selbst in Rücksicht auf solche Bedürfnissbefriedigungen, welche für uns blos die Bedeutung von Genüssen haben. Ein Genuss pflegt den Menschen, wie alle Erfahrung lehrt, in der Gegenwart, oder in einer nähern Zukunft wichtiger zu erscheinen, als ein solcher von gleicher Intensität in einem entfernteren Zeitpuncte.
Das Leben der Menschen ist ein Process, in welchem die kommenden Entwickelungsphasen stets durch die vorangehenden bedingt sind, ein Process, welcher, wenn einmal unterbrochen, nicht wieder fortgesetzt, wenn einmal essentiell gestört, nicht wieder vollständig hergestellt werden kann. Die Vorsorge für die Erhaltung unseres Lebens und für unsere Entwickelung in kommenden Lebensepochen hat demnach die bezügliehe Vorsorge für die vorangehenden Lebensepochen zur nothwendigen Voraussetzung und so können wir denn auch in der That, von krankhaften Erscheinungen der Wirthschaft abgesehen, die allgemeine Beobachtung machen, dass die wirthschaftenden Menschen zunächst bemüht sind, die Befriedigung der Bedürfnisse der nächsten Zukunft und hierauf erst die ferner liegenden Zeiträume nach Massgabe der Zeitfolge sicherzustellen.
Der Umstand, welcher den wirthschaftenden Menschen in ihrem Bestreben nach fortschreitender Heranziehung von Gütern höherer Ordnungen eine Schranke setzt, ist demnach die Nöthigung, mit den ihnen jeweilig verfügbaren Gütern zunächst für [129] die Befriedigung ihrer Bedürfnisse in der nächsten Zukunft, und erst hierauf für jene der ferneren Zeiträume Vorsorge zu treffen, oder mit andern Worten, der wirthschaftliche Nutzen, welcher sich für die Menschen aus der fortschreitenden Heranziehung von Gütern höherer Ordnung zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse erzielen lässt, ist dadurch bedingt, dass sie nach erfolgter Deckung des Bedarfes der nächsten Zukunft auch noch Quantitäten von Gütern für die entfernteren Zeiträume verfügbar haben.
In den Anfängen der Culturentwickelung und beim Beginne einer jeden neuen Phase derselben, wo erst einzelne wirthschaftende Individuen zu der Heranziehung von Gütern der nächst höheren Ordnung übergehen, (die ersten Entdecker, Erfinder, beziehungsweise Unternehmer,) pflegt jener Theil der Güter dieser Ordnung, welcher bisher noch keinerlei Verwendung in der menschlichen Wirthschaft fand, nach welchem demnach auch kein Bedarf bestand, naturgemäss den nicht ökonomischen Charakter zu haben. Grundstücke pflegen bei einem Jägervolke, das zum Ackerbaue übergeht, Materialien irgend welcher Art, welche bisher ungenützt waren und nunmehr zum erstenmale zur Befriedigung irgend eines menschlichen Bedürfnisses herangezogen werden, (z. B. Kalk, Sand, Bauholz, Bausteine etc.,) selbst nach dem Eintritt dieser letztern Eventualität, durch einige Zeit den nicht ökonomischen Charakter zu bewahren. Diese Güter sind es demnach nicht, deren begrenzte Quantität in den Anfängen der Cultur die wirthschaftenden Menschen von der fortschreitenden Heranziehung von Gütern höherer Ordnung zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse abhält.
Ein anderer Theil der complementären Güter höherer Ordnung ist indess der Regel nach ein solcher, welcher bereits vor der Heranziehung einer neuen Ordnung von Gütern in irgend einem Productionszweige zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse diente und den ökonomischen Charakter aufwies. Das Saamengetreide und die Arbeitsleistungen, deren ein Individuum, das von der occupatorischen Wirthschaft zum Ackerbaue übergehen möchte, benöthigt, sind z. B. Güter dieser Art.
Diese Güter nun, welche das in Rede stehende Individuum bisher als Güter niederer Ordnung verwendete und auch fernerbinals [130] solche gebrauchen könnte, ist es als Güter höherer Ordnung zu verwenden genöthigt, wofern dasselbe an dem wirthschaftlichen Nutzen participiren will, von welchem wir oben sprachen, oder mit andern Worten, es kann diesen letzteren sich nur auf dem Wege zuwenden, dass es Güter, welche ihm auch je nach seiner Wahl für die Gegenwart, beziehungsweise für eine nähere Zukunft verfügbar sind, zur Befriedigung der Bedürfnisse einer ferneren Zeitperiode verwendet.
Mit der steigenden Culturentwickelung und der fortschreitenden Heranziehung neuer Quantitäten von Gütern höherer Ordnung Seitens der wirthschaftenden Subjecte gewinnt indess auch ein grosser Theil der erstgenannten Güter höherer Ordnung (zum Beispiel: Grundstücke, Kalksteine, Sand, Bauholz etc.) den ökonomischen Charakter (S. 62 ff.) und die Möglichkeit, an den wirthschaftlichen Vortheilen zu participiren, welche mit der Heranziehung von Gütern höherer Ordnung, im Gegenhalte zu der rein occupatorischen Thätigkeit, ja bei höherer Culturentwickelung überhaupt mit der Heranziehung voh Gütern höherer Ordnung, im Gegenhalte zu der Beschränkung auf Productionsmittel niederer Ordnung, verbunden sind, ist demnach für jedes Individium dadurch bedingt, dass dasselbe über Quantitäten von ökonomischen Gütern höherer Ordnung, (überall dort, wo sich aber bereits ein lebhafter Verkehr entwickelt hat, und Güter jeder Art gegen einander ausgetauscht werden können, über Quantitäten von ökonomischen Gütern überhaupt,) bereits in der Gegenwart für kommende Zeiträume verfüge, oder mit andern Worten: Capital [11]besitze.
[131]
Wir sind aber damit zu einer der wichtigsten Wahrheiten unserer Wissenschaft gelaugt, zu dem Satze von der „Productivität [132] des Capitals,“ ein Satz, welcher indess nicht in der Weise aufgefasst werden darf, als ob die Verfügung über Quantitäten ökonomischer Güter (für entferntere Zeiträume bereits in vorangehenden Zeitperioden, also) innerhalb bestimmter Zeiträume an und für sich etwas zur Vermehrung der den Menschen verfügbaren Genussmittel beitragen könnte, sondern lediglich den Sinn hat, dass die Verfügung über Quantitäten ökonomischer Güter innerhalb bestimmter Zeiträume für wirthschaftende Subjecte ein Mittel zur bessern und vollständigeren Befriedigung ihrer Bedürfnisse, demnach ein Gut und zwar ein wirthschaftliches Gut ist, überall dort, wo die uns verfügbaren Quantitäten von Capitalnutzungen geringer sind, als der Bedarf an denselben.
[133]
Von der Verfügung über Quantitäten ökonomischer Güter innerhalb bestimmter Zeiträume (von Capitalnutzungen) ist demnach die mehr oder minder vollständige Befriedigung unserer Bedürfnisse nicht minder abhängig, als von unserer Verfügung über andere ökonomische Güter, und dieselben werden demnach Objecte unserer Werthschätzung, und wie wir in der Folge sehen werden, auch Objecte des menschlichen Verkehres [12].
c) Ueber den Werth der complementären Quantitäten von Gütern höherer Ordnung.
Um Güter höherer Ordnung [13]in solche niederer Ordnung umzugestalten, ist der Ablauf eines gewissen Zeitraumes, also überall dort, wo es sich um Hervorbringung ökonomischer Güter handelt, die Verfügung über Capitalnutzungen von bestimmter Zeitdauer erforderlich. Diese letztere ist je nach der Natur der Productionsprocesse verschieden und, mit [134] Rücksicht auf denselben Productionszweig, um so grosser, je höher die Ordnung der Güter ist, welche zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse herangezogen werden sollen; sie ist indess von jeder Production unzertrennlich.
Innerhalb dieser Zeiträume ist die Quantität von ökonomischen Gütern, von welcher wir hier sprechen (das Capital), gebunden, für andere Productionszwecke nicht verfügbar. Um demnach über ein Gut niederer Ordnung, beziehungsweise eine Quantität von solchen, in einem kommenden Zeitpuncte zu verfügen, genügt es nicht, dass wir die entsprechenden Güter höherer Ordnung in irgend einem Zeitpunkte vorübergehend in unserm Besitz haben, sondern es ist diess von der Voraussetzung abhängig, dass wir die in Rede stehenden Güter höherer Ordnung während eines, je nach der Natur des Productionsprocesses bald längern, bald kürzern Zeitraumes in unserer Verfügung behalten und in dem Productionsprocesse binden.
Nun haben wir im vorigen Abschnitte gesehen, dass die Verfügung über Quantitäten ökonomischer Güter innerhalb gegebener Zeiträume für die wirthschaftenden Menschen Werth hat, gleich andern ökonomischen Gütern, und es ist demnach klar, dass überall dort, wo es sich um den Werth handelt, welchen die Gesammtheit der zur Hervorbringung eines Gutes niederer Ordnung erforderlichen Güter höherer Ordnung für die wirthschaftenden Menschen mit Rücksicht auf die Gegenwart hat, dieser letztere dem voraussichtlichen Werthe des Productes nur insoferne gleich gesetzt werden kann, als in denselben auch der Werth der bezüglichen Capitalnutzung inbegriffen ist.
Fragt es sich demnach z. B. um den Werth derjenigen Güter höherer Ordnung, durch welche wir über eine bestimmte Quantität von Getreide nach Ablauf eines Jahres verfügen werde, so wird der Werth des Samengetreides, der Bodenbenützung, der bezüglichen landwirthschaftlichen Arbeitsleistungen etc., das ist der zur Hervorbringung des obigen Getreides erforderlichen Güter höherer Ordnung in ihrer Gesammtheit, allerdings sein Mass in dem voraussichtlichen Werthe dieses letztern nach Ablauf eines Jahres finden (S. 124), aber nur unter der Voraussetzung, dass in den Werth der erstern auch jener inbegriffen ist, welchen die Verfügung über die bezüglichen ökonomischen Güter innerhalb [135] eines Jahres für die betreffenden wirthschaftenden Subjecte hat, während der Werth der in Rede stehenden Güter höherer Ordnung in der Gegenwart an und für sich nur dem Werthe des voraussichtlichen Productes nach Abzug des Werthes der bezüglichen Capitalnutzung gleich gesetzt werden kann.
Setzen wir, um zu einem ziffermässigen Ausdruck des oben Gesagten zu gelangen, den voraussichtlichen Werth des nach einem Jahre verfügbaren Productes gleich 100, den Werth der Verfügung über die Quantität der bezüglichen ökonomischen Güter höherer Ordnung innerhalb eines Jahres (den Werth der Capitalbenützung) gleich 10, so ist klar, dass der Werth, welchen die Gesammtheit der complementären zur Hervorbringung des obigen Productes erforderlichen Quantitäten von Gütern höherer Ordnung mit Ausschluss der in Rede stehenden Capitalnutzung für das wirthschaftende Subject mit Rücksicht auf die Gegenwart hat, nicht gleich 100, sondern nur gleich 90 und, wenn der Werth der bezüglichen Capitalbenützung 15 betrüge, gar nur gleich 85 wäre.
Der Werth, welchen die Güter für die einzelnen wirthschaftenden Individuen haben, ist, wie bereits mehrfach erwähnt, die wichtigste Grundlage der Preisbildung. Wenn wir nun im Leben sehen, dass die Käufer von Gütern höherer Ordnung für die complementären, zur Hervorbringung eines Gutes niederer Ordnung erforderlichen technischen Productionsmittel [14]niemals den ganzen voraussichtlichen Preis der erstern bezahlen, sondern stets nur solche Preise zu bewilligen in der Lage sind und thatsächlich bewilligen, welche in etwas tiefer stehen, als derselbe, also der Verkauf von Gütern höherer Ordnung eine gewisse Aehnlichkeit mit dem Escomptiren hat [15], wobei der voraussichtliche [136] Preis des Productes die Grundlage der Berechnung bildet, so findet diese Erscheinung in dem obigen ihre Erklärung [16].
Der Process der Umgestaltung von Gütern höherer Ordnung in solche niederer Ordnung, beziehungsweise in Güter erster Ordnung, soll er anders ein ökonomischer sein, ist ferner unter allen Umständen dadurch bedingt, dass ein wirthschaftendes Subject denselben vorbereite und in ökonomischem Sinne leite, also die ökonomischen Berechnungen, von welchen wir oben sprachen, anstelle und die Güter höherer Ordnung, einschliesslich der technischen Arbeitsleistungen, dem Processe thatsächlich zuführe, oder zuführen lasse. Diese sogenannte Unternehmerthätigkeit [17], welche in den Anfängen der Cultur und auch später noch [137] beim Kleingewerbe der Regel nach von demselben wirthschaftenden Subjecte entwickelt wird, welches auch durch seine technischen Arbeitsleistungen in den Productionsprocess eingreift, bei fortschreitender Theilung der Arbeit und Vergrösserung der Unternehmungen jedoch nicht selten die volle Zeit des betreffenden wirthschaftenden Subjectes in Anspruch nimmt, ist desshalb ein eben so nothwendiges Element der Gütererzeugung, wie die technischen Arbeitsleistungen und hat den Charakter eines Gutes höherer Ordnung und zwar, da dieselbe gleich den letztern der Regel nach ein ökonomisches Gut ist, auch Werth. Ueberall dort, [138] wo der Werth in Frage ist, welchen complementäre Quantitäten von Gütern höherer Ordnung für uns mit Rücksicht auf die Gegenwart haben, ist demnach allerdings der voraussichtliche Werth des entsprechenden Productes massgebend für den Werth der Gesammtheit derselben, aber doch nur unter der Voraussetzung, dass in diesem letztern auch der Werth der Unternehmerthätigkeit mit inbegriffen ist.
Fassen wir das hier Gesagte zusammen, so ergibt sich, dass der Werth, welchen die Gesammtheit der zur Hervorbringung eines Gutes niederer, beziehungsweise erster Ordnung erforderlichen complementären Quantitäten von Gütern höherer Ordnung, (also die Gesammtheit von Rohstoffen, Arbeitsleistungen, Benützungen von Grundstücken, Maschinen, Werkzeugen etc.,) für uns mit Rücksicht auf die Gegenwart hat, sein Mass in dem voraussichtlichen Werthe des entsprechenden Productes findet, zu den erstern indess nicht bloss die zur technischen Production erforderlichen Güter höherer Ordnung, sondern auch die Capitalsnutzungen und die Unternehmerthätigkeit gerechnet werden müssen, indem diese letzteren eben so unausweichliche Vorbedingungen jeder ökonomischen Gütererzeugung sind, als die obigen technischen Erfordernisse derselben, und desshalb - der Werth, welchen die technischen Elemente der Production an und für sich mit Rücksicht auf die Gegenwart haben, nicht gleich dem ganzen voraussichtlichen Werthe des Productes ist, sondern sich stets in solcher Weise regelt, dass zugleich eine Marge für den Werth der Capitalbenützung und der Unternehmerthätigkeit offen bleibt.
d) Ueber den Werth, welchen die einzelnen Güter höherer Ordnung für uns haben.
Wir haben gesehen, dass der Werth eines concreten Gutes, beziehungsweise einer concreten Güterquantität, für das wirthschaftende Subject, das darüber verfügt, gleich ist der Bedeutung jener Bedürfnissbefriedigungen, welche das erstere entbehren müsste, wofern es über das betreffende Gut, beziehungsweise die betreffende Güterquantität, nicht zu verfügen vermöchte, und wir könnten ohne Schwierigkeit zum Schlusse gelangen, dass auch bei Gütern höherer Ordnung der Werth einer jeden Theilquantität derselben gleich der Bedeutung ist, welche jene Bedürfnissbefriedigungen [139] für uns haben, deren Sicherstellung von unserer Verfügung über die in Rede stehende Quantität abhängen, wenn dem nicht der Umstand entgegenstünde, dass ein Gut höherer Ordnung nicht für sich allein, sondern nur im Vereine mit andern (den complementären) Gütern höherer Ordnung zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse herangezogen werden kann und demgemäss die Meinung Platz greifen könnte, als ob wir in der Befriedigung concreter Bedürfnisse nicht wohl von der Verfügung über ein einzelnes concretes Gut höherer Ordnung, beziehungsweise eine concrete Quantität eines solchen, sondern nur von der Verfügung über complementäre Quantitäten solcher Güter in ihrer Gesammtheit abhängig sein und somit auch nur solche für ein wirthschaftendes Subject einen selbstständigen Werth erlangen könnten.
Nun ist es allerdings richtig, dass wir nur mittelst complementärer Quantitäten von Gütern höherer Ordnung über Quantitäten von Gütern niederer Ordnung verfügen, ebenso sicher ist es aber auch, dass nicht nur festbestimmte Quantitäten der einzelnen Güter höherer Ordnung mit einander im Productionswege in Verbindung gebracht werden können, etwa in der Weise, wie dies bei chemischen Verbindungen zu beobachten ist, wo nur eine gewisse Anzahl von Gewichtseinheiten des einen Stoffes sich mit einer ebenso genau begrenzten Anzahl von Gewichtseinheiten anderer Stoffe zu einem bestimmten chemischen Producte verbinden. Vielmehr lehrt uns die allgemeinste Erfahrung, dass eine bestimmte Quantität irgend eines Gutes niederer Ordnung aus Gütern höherer Ordnung, welche in sehr verschiedenen Quantitätenverhältnissen zu einander stehen, hervorgebracht werden kann, ja nicht selten ein, oder mehrere Güter höherer Ordnung, welche den complementären Charakter mit Rücksicht auf eine Gruppe von gewissen Gütern höherer Ordnung haben, gänzlich entfallen können, ohne dass die übrigen Güter dadurch die Tauglichkeit zur Hervorbringung des Gutes niederer Ordnung, bezüglich dessen sie den complementären Charakter besitzen, einbüssen würden. Um Getreide zu erzeugen, kommen Bodennutzungen, Samenfrüchte, Arbeitsleistungen, Düngstoffe, Benützungen von landwirthschaftlichen Geräthen etc. zur Anwendung. Niemand wird indess in Abrede [140] stellen können, dass sich eine bestimmte Quantität Getreide auch ohne Düngungsmittel und ohne die Anwendung eines grossen Theiles der gebräuchlichen landwirthschaftlichen Geräthe hervorbringen lässt, wofern man nur über die übrigen zur Erzeugung des Getreides erforderlichen Güter höherer Ordnung in entsprechend grösseren Quantitäten verfügt.
Lehrt uns solcherart die Erfahrung, dass einzelne complementäre Güter höherer Ordnung bei der Production von Gütern niederer Ordnung nicht selten gänzlich wegfallen können, so können wir noch viel häufiger die Beobachtung anstellen, dass nicht lediglich aus bestimmten Quantitäten von Gütern höherer Ordnung bestimmte Producte hervorgebracht werden können, sondern vielmehr der Regel nach ein sehr weiter Spielraum besteht, innerhalb welches die Production sich bewegen kann, und sich thatsächlich bewegt. Jedermann ist bekannt, dass sich, selbst bei gleicher Qualität der Aecker, eine bestimmte Quantität Getreide auf Grundstücken von sehr verschiedener Ausdehnung erzeugen lässt, je nachdem man dieselben mehr oder minder intensiv bewirthschaftet, das ist, je nachdem eine grössere, oder geringere Quantität der übrigen complementären Güter höherer Ordnung in Anwendung gebracht wird. So lässt sich zumal eine schwächere Düngung durch Herbeiziehung einer grösseren Quantität von Grundstücken, durch bessere Maschinen, oder intensivere Anwendung von landwirthschaftlichen Arbeitsleistungen ersetzen und so die verminderte Quantität fast jedes einzelnen Gutes höherer Ordnung durch eine entsprechende Mehrverwendung der übrigen complementären Güter.
Aber selbst dort, wo die einzelnen Güter höherer Ordnung durch Quantitäten anderer complementärer Güter nicht ersetzt werden können und durch eine Minderung der verfügbaren Quantität irgend eines einzelnen Gutes höherer Ordnung eine entsprechende Minderung des Productes herbeigeführt wird, (z. B. bei der Production mancher Chemikalien,) werden durch den Mangel des einen Productionsmittels die entsprechenden Quantitäten der übrigen Productionsmittel doch nicht nothwendigerweise werthlos, denn diese letztern können der Regel nach doch zur Hervorbringung anderer Güter und somit in letzter Reihe zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse, wenngleich [141] auch der Regel nach minder wichtiger, verwendet werden, als dies der Fall sein würde, wenn die mangelnde Quantität des complementären Gutes, das hier in Rede ist, verfügbar wäre.
Von einer bestimmten Quantität eines Gutes höherer Ordnung hängt demnach der Regel nach nicht die Verfügung über eine genan entsprechende Quantität des Productes ab, zu dessen Erzeugung jenes Gut dient, sondern lediglich eine Theilquantität dieses letztern, nicht selten blos die höhere Qualität des Productes, und der Werth einer Quantität eines einzelnen Gutes höherer Ordnung ist demnach auch nicht gleich der Bedeutung der Bedürfnissbefriedigungen, welche von dem ganzen Producte abhängen, zu dessen Hervorbringung es dient, sondern lediglich der Bedeutung jener Bedürfnissbefriedigungen, für welche durch die Theilquantität des Productes vorgesorgt ist, um welche sich das letztere mindern würde, wofern wir über die in Rede stehende Quantität des Gutes höherer Ordnung nicht zu verfügen vermöchten; dort aber, wo nicht eine Minderung der Quantität, sondern lediglich eine solche der Qualität des Productes die Folge einer Verminderung der verfügbaren Quantität eines Gutes höherer Ordnung wäre, ist der Werth der Quantitat eines einzelnen Gutes höherer Ordnung gleich der Differenz zwischen der Bedeutung jener Bedürfnissbefriedigungen, welche mit dem höher, und jenen, welche mit dem niederer qualificirten Producte herbeigeführt werden können. In beiden Fällen sind nämlich nur Bedürfnissbefriedigungen von solcher Bedeutung von der Verfügung über die in Rede stehende Quantität eines einzelnen Gutes höherer Ordnung abhängig.
Aber selbst in dem Falle, dass durch die Minderung der verfügbaren Quantität eines einzelnen Gutes höherer Ordnung eine verhältnissmässige Minderung des Productes bedingt ist, (z. B. bei manchen chemischen Producten,) selbst in diesem Falle werden die übrigen complementären Quantitäten von Gütern höherer Ordnung, für welche das eine complementäre Element der Production nunmehr mangelt, doch nicht werthlos, indem dieselben zur Production anderer Güter niederer Ordnung und somit zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse, wenngleich auch vielleicht in etwas minder wichtiger, als diess sonst der Fall gewesen wäre, herangezogen werden können. Auch in diesem [142] Falle ist demnach nicht der volle Werth des Productes, welches durch den Mangel eines einzelnen Gutes höherer Ordnung uns entgehen würde, massgebend für den Werth dieses letzteren, sondern lediglich die Differenz zwischen der Bedeutung jener Bedürfnissbefriedigungen, welche sichergestellt sind, wofern wir über die Quantität des Gutes höherer Ordnung, dessen Werth in Frage ist, verfügen, und jener der Bedürfnissbefriedigungen, welche im entgegengesetzten Falle erfolgen würden.
Fassen wir die drei obigen Fälle zusammen, so ergibt sich als allgemeines Gesetz der Werthbestimmung einer concreten Quantität eines Gutes höherer Ordnung, dass der Werth derselben gleich ist der Differenz zwischen der Bedeutung jener Bedürfnissbefriedigungen, welche im Falle unserer Verfügung über die Quantität des Gutes höherer Ordnung, dessen Werth in Frage ist, und jener, welche im entgegengesetzten Falle, bei jedesmaliger ökonomischer Verwendung der Gesammtheit der uns verfügbaren Güter höherer Ordnung, erfolgen würden.
Es entspricht aber das obige Gesetz genau dem allgemeinen Gesetze der Werthbestimmung (S. 87 ff.), denn die durch das obige Gesetz ausgedrückte Differenz kennzeichnet eben die Bedeutung jener Bedürfnissbefriedigungen, welche von unserer Verfügung über ein concretes Gut höherer Ordnung abhängig ist.
Fassen wir dies Gesetz mit Rücksicht auf dasjenige ins Auge, was wir oben (S. 133 ff.) rücksichtlich des Werthes der zur Hervorbringung eines Gutes erforderlichen complementären Quantitäten von Gütern höherer Ordnung gesagt haben, so ergibt sich der weitere Grundsatz, dass der Werth eines Gutes höherer Ordnung um so grösser ist, je grösser der voraussichtliche Werth des Productes bei gleichem Werthe der übrigen zur Hervorbringung desselben erforderlichen complementären Güter, oder je niedriger der letztere unter sonst gleichen Verhältnissen ist.
[143]
e) Ueber den Werth der Boden- und Capitalnutzung und der Arbeitsleistungen insbesondere [18].
Die Grundstücke haben keine exceptionelle Stellung im Kreise der übrigen Güter. Werden dieselben zu Genusszwecken [144] verwendet, (als Lustgärten, Rennbahnen etc.,) so sind sie Güter erster, werden sie zur Hervorbringung anderer Güter benützt, Güter höherer Ordnung, gleich vielen anderen. Wo immer es sich desshalb um die Bestimmung ihres Werthes, oder jenes der Bodenbenützungen handelt, sind sie den Gesetzen der Werthbestimmung überhaupt und, wofern sie den Charakter von Gütern höherer Ordnung haben, insbesondere auch jenen unterworfen, welche wir soeben bezüglich der Güter höherer Ordnung entwickelt haben.
Eine verbreitete Schule von Volkswirthen hat nun zwar ganz richtig erkannt, dass der Werth von Grund und Boden sich füglich nicht auf Arbeit, oder auf Capitalsaufwendungen zurückführen lasse, aber daraus die Berechtigung hergeleitet, den Grundstücken eine exceptionelle Stellung im Bereiche der Güter einzuräumen. Der methodische Missgriff, welcher in diesem Vorgehen liegt, ist indess leicht ersichtlich. Dass eine grosse und wichtige Gruppe von Erscheinungen sich unter die allgemeinen Gesetze einer Wissenschaft, welche sich mit denselben befasst, [145] nicht einordnen lässt, ist ein deutlicher Beweis für die Reformbedürftigkeit dieser letztern, nicht aber ein Grund, der zu dem bedenklichsten methodischen Hilfsmittel berechtigen würde, zu der Absonderung einer Gruppe von Erscheinungen von den übrigen, ihrer allgemeinen Natur nach völlig gleichartigen Objecten der Beobachtung, und zur Aufstellung besonderer höchster Principien für jede der beiden Gruppen.
Diese Erkenntniss hat denn auch in neuerer Zeit zu mannigfachen Versuchen geführt, die Bodenbenützungen und die Grundstücke, gleich allen andern Gütern, in den Rahmen der volkswirthschaftlichen Systeme einzuordnen und den herrschenden Principien gemäss, ihren Werth, beziehungsweise die Preise, welche für dieselben erzielt werden können, auf menschliche Arbeit, oder auf Capitalsaufwendungen zurückzuführen [19].
Die Gewaltsamkeiten, zu welchen dieser Versuch bei den Gütern im Allgemeinen und bei den Grundstücken insbesondere führen muss, sind indess offenliegend. Ob ein Grundstück mit dem grössten Aufwande menschlicher Arbeit dem Meere abgerungen, oder ohne jede Arbeit angeschwemmt, ob dasselbe ursprünglich mit Urwald bewachsen und mit Steinen überät und erst in der Folge mit grosser Anstrengung und ökonomischen Opfern gerodet, gereinigt und mit fruchtbaren Erden bedeckt wurde, oder aber von vornherein waldfrei und fruchtbar war, ist für die Beurtheilung seiner natürlichen Fruchtbarkeit, auch wohl für die Frage von Interesse, ob die Verwendungen von ökonomischen Gütern auf dies Grundstück (die Ameliorirungen) zweckmässig und ökonomisch waren, nicht aber dort, wo es sich um die allgemeinen wirthschaftlichen Beziehungen desselben und insbesondere um seinen Werth, also um die Bedeutung handelt, welche Güter für uns lediglich mit Rücksicht auf die der Zukunft angehörigen Bedürfnissbefriedigungen [20]erlangen.
[146]
Sind solcherart die neuern Versuche, den Werth der Bodenbenutzungen, beziehungsweise der Grundstücke selbst, auf Arbeits-oder Capitalsaufwendungen zurückzuführen, lediglich als ein Ausfluss des Bestrebens zu betrachten, die herrschende Grundrententheorie, also einen Theil unserer Wissenschaft, welcher verhältnissmässig noch am wenigsten im Widerspruche mit den Erscheinungen des wirklichen Lebens steht, den gangbaren Irrthümern in den höchsten Principien unserer Wissenschaft conform zu gestalten, so muss gegen dieselbe, zumal in jener Form, in welcher Ricardo [21]sie ausgesprochen hat, doch der Vorwurf erhoben werden, dass hiedurch nicht das Princip des Werthes, welchen Bodenbenützungen für die wirthschaftenden Menschen haben [22], sondern lediglich ein vereinzelntes Moment seiner Verschiedenheit ans Licht gebracht und dasselbe irrthümlicherweise zum Principe erhoben wird.
Die verschiedene Beschaffenheit und Lage der Grundstücke ist unzweifelhaft eine der wichtigsten Ursachen der Verschiedenheit des Werthes der Bodenbenützungen und der Grundstücke selbst, es sind aber ausser ihr noch andere Ursachen der Verschiedenheit des Werthes dieser Güter vorhanden. Sie ist demnach nicht einmal das massgebende Princip dieser letztern, noch viel weniger aber das Princip des Werthes der Bodenbenützungen und der Grundstücke überhaupt. Wären alle Grundstücke von gleicher Beschaffenheit und gleich günstiger Lage, so würden sie nach Ricardo gar keine Rente abwerfen können, während doch nichts sicherer ist, als dass in solch einem Falle [147] wohl ein einzelnes Moment der Verschiedenheit der Rente, welche die Grundstücke abwerfen, aber weder die Gesammtheit dieser letztern, noch aber auch die Rente selbst entfallen müsste. Andererseits ist nicht minder klar, dass in einem Lande, wo grosser Mangel an Boden besteht, auch die ungünstigst gelegenen und qualificirten Grundstücke eine Rente abwerfen würden, ohne dass dieselbe in der Theorie Ricardo's ihre Erklärung finden könnte.
Die Grundstücke und Bodenbenützungen in ihrer concreten Erscheinungsform sind Objecte unserer Werthschätzung gleich allen anderen Gütern; auch sie erlangen nur insofern Werth, als wir in der Befriedigung unserer Bedürfnisse von der Verfügung über dieselben abhängig sind und die massgebenden Factoren ihres Werthes sind keine anderen, als jene, welche wir oben (Seite 87 und 114) rücksichtlich der Güter überhaupt kennen gelernt haben [23]. Auch das tiefere Verständniss der Verschiedenheit ihres Werthes ist desshalb nur auf dem Wege erreichbar, dass wir die Bodenbenützungen und die Grundstücke selbst unter den allgemeinen Gesichtspunkten unserer Wissenschaft und, so weit sie Güter höherer Ordnung sind, zumal auch in ihren Beziehungen zu den entsprechenden Gütern niederer Ordnung und insbesondere zu den complementären Gütern ins Auge fassen.
Wir sind oben zu dem Resultate gelangt, dass die Gesammtheit der zur Hervorbringung eines Gutes erforderlichen Güter höherer Ordnung (die Capitalbenützung und die Unternehmerthätigkeit [148] mit inbegriffen) das Mass ihres Werthes in dem voraussichtlichen Werthe des Productes findet. Wo immer Bodenbenützungen zur Hervorbringung von Gütern niederer Ordnung herangezogen werden, finden demnach auch sie im Vereine mit den übrigen complementären Gütern das Mass des Werthes in dem voraussichtlichen Werthe des Gutes niederer, beziehungsweise erster Ordnung, zu dessen Hervorbringung sie bestimmt sind, und je nachdem dieser letztere grösser oder geringer ist, bestimmt sich auch unter sonst gleichen Verhältnissen der höhere oder geringere Werth derselben. Was aber den Werth betrifft, welchen concrete Bodennutzungen, beziehungsweise concrete Grundstücke an und für sich für die wirthschaftenden Menschen haben, so regelt sich derselbe eben so wohl, wie jener aller andern Güter höherer Ordnung, nach dem Grundsatze, dass der Werth eines Gutes höherer Ordnung um so grösser ist, je grösser der Werth des voraussichtlichen Productes und je geringer unter sonst gleichen Verhältnissen der Werth der complementären Güter höherer Ordnung ist [24].
Die Bodennutzungen stehen demnach rücksichtlich ihres Werthes unter keinen anderen allgemeinen Gesetzen, als z. B. die Nutzungen von Maschinen, Werkzeugen, Wohnhäusern, Fabriken, ja als alle übrigen ökonomischen Güter, welcher Art sie auch immer sein mögen.
Damit sollen die besonderen Eigenthümlichkeiten, welche die Bodennützungen, beziehungsweise die Grundstücke, gleichwie viele andere Güterarten aufweisen, durchaus nicht negirt werden. Die in Rede stehenden Güter sind einem Volke der Regel nach [149] nur in bestimmten, nicht leicht vermehrbaren Quantitäten verfügbar, dieselben sind unbeweglich und von ausserordentlich verschiedener Qualität. Auf diese drei Ursachen können alle Eigenthümlichkeiten der Wertherscheinungen, wie wir sie bei Bodennutzungen und Grundstücken zu beobachten vermögen, zurückgeführt werden. Es sind dies aber insgesammt solche Eigenthümlichkeiten, welche sich lediglich auf die den wirthschaftenden Menschen überhaupt, und den Bewohnern bestimmter Territorien insbesondere verfügbaren Quantitäten und auf die Qualität derselben beziehen, demnach Momente der Werthbestimmung, welche nicht nur den Werth der Bodennutzungen und Grundstücke, sondern, wie wir sahen, jenen aller Güter beeinflussen, und haben die bezüglichen Wertherscheinungen desshalb keinen exceptionellen Charakter.
Der Umstand, dass auch der Preis der Arbeitsleistungen [25][150] sich, gleichwie jener der Bodenbenützungen, nicht ohne die grössten Gewaltsamkeiten auf den Preis der Productionskosten derselben zurückführen lässt, hat rücksichtlich dieser Kategorie von Preiserscheinungen gleichfalls zur Aufstellung besonderer Grundsätze geführt. Die gemeinste Arbeit, wird gesagt, müsse den Arbeiter sammt Familie ernähren, sonst könnte sie der Gesellschaft nicht dauernd geleistet werden; die Arbeit könne aber dem Arbeiter auch nicht viel mehr bieten, als die Subsistenzmittel, sonst würde eine Vermehrung der Arbeiter eintreten, welche den Preis ihrer Arbeitsleistungen wieder auf das obige Niveau herabdrücken würde. Das Subsistenzminimum im obigen Sinne sei deshalb das Princip, nach welchem sich der Preis der gemeinsten Arbeit regle, während der höhere Preis der übrigen Arbeitsleistungen auf Capitalsanlagen, beziehungsweise auf Talentrenten u. dgl. m., zurückgeführt werden müsse.
Nun lehrt uns aber die Erfahrung, dass es concrete Arbeitsleistungen giebt, welche für die wirthschaftenden Menschen völlig nutzlos, ja schädlich, also keine Güter sind, andere, welche trotz ihrer Güterqualität doch keinen ökonomischen Charakter und keinen Werth aufweisen, und somit gleichwie die ersteren (wie wir in der Folge sehen werden) gar keinen Preis haben können. (Hiezu gehören alle Arbeitsleistungen, welche aus irgend welchen Gründen der Gesellschaft in so grossen Quantitäten verfügbar sind, dass sie den nichtökonomischen Charakter erlangen, z. B. die mit manchen unbesoldeten Aemtern verbundenen Arbeitsleistungen etc.). Die Arbeitsleistungen sind demnach nicht an und für sich und unter allen Umständen Güter, oder gar ökonomische Güter, sie haben nicht nothwendigerweise Werth, und lässt sich desshalb nicht für jede Arbeitsleistung ein Preis überhaupt, am wenigsten aber ein bestimmter Preis erzielen.
Die Erfahrung lehrt uns denn auch, dass viele Arbeitsleistungen [151] von dem Arbeiter nicht einmal gegen die nothdürftigsten Subsistenzmittel ausgetauscht werden können [26], während für andere Arbeitsleistungen die zehn-, zwanzig- und selbst hundertfache Quantität der zur Subsistenz eines Menschen erforderlichen Güter leicht zu erlangen ist. Wo immer jedoch die Arbeitsleistungen eines Menschen thatsächlich gegen die Subsistenzmittel desselben ausgetauscht werden, ist dies doch nur die Folge des zufälligen Umstandes, dass dieselben nach den allgemeinen Grundsätzen der Preisbildung eben nur gegen einen solchen Preis und keinen anderen ausgetauscht werden konnten. Die Subsistenzmittel des Arbeiters, beziehungsweise die Subsistenzminima können demnach weder die unmittelbare Ursache, noch auch das massgebende Princip des Preises der Arbeitsleistungen sein [27].
In Wahrheit regelt sich denn auch der Preis concreter Arbeitsleistungen, wie wir sehen werden, gleich jenem aller anderen Güter nach ihrem Werthe. Dieser letztere aber regelt sich, wie oben dargelegt wurde, nach der Grösse der Bedeutung jener Bedürfnissbefriedigungen, welche wir entbehren müssten, wofern wir über die betreffenden Arbeitsleistungen nicht zu verfügen vermöchten; wofern diese letztern aber Güter höherer Ordnung sind, zunächst und unmittelbar nach dem Grundsatze, dass Güter höherer Ordnung einen um so grösseren Werth für die wirthschaftenden Menschen haben, je grösser der voraussichtliche Werth des Productes bei gleichem Werthe der complementären Güter höherer Ordnung, beziehungsweise je niedriger der Werth dieser letztern ist.
Die Unzulänglichkeit der Theorie, wornach der Preis der [152] Güter durch jenen der Güter höherer Ordnung erklärt wird, welche zur Hervorbringung derselben dienten, musste sich naturgemäss auch überall dort geltend machen, wo der Preis von Capitalnutzungen in Frage kam. Wir haben die letzten Ursachen des ökonomischen Charakters, beziehungsweise des Werthes der Güter dieser Art bereits oben eines Weitern dargelegt, und auch auf die Irrthümlichkeit jener Theorie hingewiesen, welche den Preis der Capitalnutzungen als eine Entschädigung der Enthaltsamkeit des Capitalbesitzers hinstellt. In Wahrheit ist der Preis, welcher für Capitalnutzungen erlangt werden kann, wie wir sehen werden, nicht minder eine Folge ihres ökonomischen Charakters und ihres Werthes, als wie jener aller übrigen Güter, das massgebende Princip ihres Werthes aber wiederum kein anderes, als jenes der Güter überhaupt [28].
[153]
Viertes Capitel.
Die Lehre vom Tausche.↩
§. 1.
Die Grundlagen des ökonomischen Tausches.
„Ob der Hang der Menschen, zu tauschen, zu handeln und eine Sache gegen eine andere hinzugeben, einer von den ursprünglichen Principien der menschlichen Natur ist, oder ob die nothwendige Folge der Vernunft und des Sprachvermögens der Menschen,“ oder welche Ursachen sonst die Menschen zum Austausche ihrer Güter führen, diese Frage hat Adam Smith unbeantwortet gelassen. Sicher sei nur so viel, bemerkt der ausgezeichnete Denker, dass die Lust am Tausche allen Menschen gemein ist und bei keiner Thiergattung sich vorfindet [1].
Setzen wir nun, um zunächst das obige Problem vollkommen klar zu stellen, den Fall, zwei benachbarte Landleute hätten nach einer günstigen Ernte einen grossen Ueberfluss an Gerste derselben Art, und es würde dem thatsächlichen Austausche von Quantitäten derselben kein Hinderniss entgegenstehen. In diesem Falle könnten die beiden Landleute sich der Lust am Tausche in unbeschränkter Weise hingeben und z. B. je 100 Metzen ihrer Gerste, oder sonst beliebige Quantitäten dieses Gutes gegeneinander austauschen und wieder austauschen. Obzwar nun aber nicht abzusehen ist, warum sie nicht auch in diesem Falle tauschen sollten, wofern der Austausch von Gütern an und für sich für die Tauschenden mit einer Lust verbunden wäre, so ist, wie ich glaube, doch nichts sicherer, als dass dieselben in dem obigen Falle sich jedes Austausches enthalten, und falls sie nichtsdestoweniger einen solchen Tausch vornehmen würden, in die Gefahr kämen, von den übrigen wirthschaftenden Individuen, um solcher Lust am Tausche willen, geradezu für unsinnig erklärt zu werden.
[154]
Setzen wir nun aber gar den Fall, dass ein Jäger einen grossen Ueberfluss an Thierfellen, also an Stoffen zur Bekleidung, aber nur einen sehr geringen Vorrath an Nahrungsmitteln besässe, so zwar, dass für sein Bedürfniss nach Bekleidung vollauf, für sein Nahrungsbedürfniss aber nur in sehr mangelhafter Weise vorgesorgt wäre, während bei einem ihm benachbarten Ackerbauer gerade das umgekehrte Verhältniss obwalten würde, und nehmen wir weiter an, dass auch in diesem Falle dem Vollzuge eines Austausches von Nahrungsmitteln des Jägers gegen Bekleidungsstoffe des Ackerbauers keinerlei Hinderniss entgegenstünde, so ist doch nicht minder klar, dass in diesem Falle ein solcher Austausch von Gütern zwischen den beiden obigen Subjecten noch viel weniger stattfinden wird, als in dem obigen. Würde nämlich der Jäger seinen geringen Vorrath von Nahrungsmitteln gegen den eben so geringfügigen Vorrath des Ackerbauers an Thierfellen umtauschen, so würde der Ueberfluss des Jägers an Bekleidungsstoffen und zugleich der Ueberfluss des Ackerbauers an Nahrungsmitteln zwar noch in etwas grösser werden, als vor dem Tausche. Da aber nunmehr für die Befriedigung des Nahrungsbedürfnisses des Jägers und für die Befriedigung des Bedürfnisses des Landmannes nach Kleidung gar nicht vorgesorgt wäre, die wirthschaftliche Lage der Tauschenden sich somit entschieden verschlechtert hätte, so könnte doch Niemand behaupten, dass diese beiden wirthschaftenden Subjecte an solch einem Tausche eine Lust empfinden würden; vielmehr ist nichts sicherer, als dass sowohl der Jäger, als auch der Landwirth sich gegen solch' einen Tausch, durch welchen ihre Wohlfahrt entschieden beeinträchtigt, vielleicht gar ihr Leben in Gefahr gesetzt würde, auf das Entschiedenste sträuben würden, und wäre er dennoch erfolgt, nichts Eiligeres zu thun hätten, als denselben wieder rückgängig zu machen.
Der Hang der Menschen zum Tausche muss demnach einen anderen Grund haben, als die Lust an dem Tausche selbst, denn wäre der Tausch an und für sich eine Lust, also Selbstzweck, und nicht vielmehr eine, nicht selten mühselige und mit Gefahren und ökonomischen Opfern verbundene Thätigkeit, so wäre in der That nicht abzusehen, warum die Menschen nicht auch in den obigen und so in tausend anderen Fällen tauschen, [155] ja den Tausch bis ins Unbegrenzte fortsetzen würden, während wir doch im Leben überall zu beobachten vermögen, dass die wirthschaftenden Menschen sich jeden Tausch vorher wohl überlegen und schliesslich für jeden gegebenen Zeitpunct eine Grenze eintritt, über welche hinaus zwei Individuen nicht weiter tauschen.
Ist es nun sicher, dass der Tausch für die Menschen kein Selbstzweck, noch weniger an und für sich eine Lust ist, so wird es nunmehr unsere Aufgabe sein, Wesen und Ursprung des Tausches in dem Nachfolgenden darzulegen.
Denken wir uns, um mit dem einfachsten Falle zu beginnen, zwei Landleute A und B, von welchen jeder bisher eine isolirte Wirthschaft führte und von denen der erstere nach einer aussergewöhnlich reichen Ernte so viel Getreide besässe, dass er nach einer noch so reichlichen Vorsorge für die Befriedigung aller seiner Bedürfnisse einen gewissen Theil davon für sich und sein Hauswesen nicht mehr zu verwenden vermöchte. Der zweite Landwirth B, ein Nachbar des ersten, hätte wiederum, wie wir annehmen wollen, eine so gute Weinernte gehabt, dass er aus Mangel an Gefässen und weil sein Keller ohnehin noch von früheren Jahrgängen her gefüllt ist, schon nahe daran wäre, einen Theil des eingelagerten älteren Weines, der von einem schlechteren Jahrgange herrührt, auszuschütten. Diesem Ueberflusse auf der einen Seite könnte der grösste Mangel auf der andern Seite gegenüberstehen. Der Landmann, der einen Ueberfluss an Getreide hat, muss den Genuss des Weines vollständig entbehren, weil er überhaupt keine Weinberge besitzt, und der zweite Landwirth von dessen Ueberfluss an Wein wir hörten, leidet Mangel an Nahrungsmitteln. Während demnach der erste Landwirth viele Metzen Korn auf seinen Aeckern verderben lassen kann, würde ihm ein Eimer Wein viele Genüsse verschaffen, die er jetzt entbehren muss; während der zweite Landwirth daran ist, nicht nur einen, sondern mehrere Eimer Wein dem Verderben Preis zu geben, könnte er doch einige Metzen Getreide in seiner Wirthschaft sehr wohl verwenden. Der erste Landmann dürstet, der zweite hungert, während doch schon durch jenes Getreide, das A auf seinen Aeckern verfaulen zu lassen und durch jenen Wein, den B auszuschütten entschlossen [156] ist, beiden Theilen geholfen wäre. Der erste Landwirth könnte dann vor wie nach sein Nahrungsbedürfniss und jenes seiner Familie vollständig befriedigen, abor nebenbei sich auch noch den Genuss des Weintrinkens gewähren, während der zweite Landwirth vor wie nach Wein in Fülle geniessen könnte, aber nicht zu hungern brauchte. Es ist demnach klar, dass uns hier ein Fall vorliegt, wo dadurch, dass die Verfügung über concrete Güter des A an B und umgekehrt concreter Güter des B an A übergehen würde, die Bedürfnisse beider wirthschaftenden Subjecte besser befriedigt werden könnten, als dies ohne eine solche gegenseitige Uebertragung der Fall sein würde.
Der eben dargelegte Fall, in welchem durch die wechselseitige Uebertragung von Gütern, die für keinen der beiden Tauschenden Werth haben, also ohne jedwedes ökonomische Opfer, die Bedürfnisse derselben besser befriedigt werden können, als ohne eine solche Uebertragung der Fall wäre, ist allerdings ge eignet, uns das Wesen jenes ökonomischen Verhältnisses auf's Einleuchtendste vor das Bewusstsein zu führen, dessen Ausbeutung der Tausch ist. Wir würden jedoch das hier vorliegende Verhältniss viel zu enge auffassen, wollten wir es lediglich auf jene Fälle beschränken, wo der Verfügung einer Person, Quantitäten eines Gutes unterstehen, die grössër sind, als selbst ihr voller Bedarf, und diese Person doch zugleich Mangel an einem anderen Gute leidet, während eine zweite Person wiederum einen eben so grossen Ueberfluss an diesem letzteren und Mangel an dem ersteren Gute hat; jenes Verhältniss liegt vielmehr schon überall dort unserer Beobachtung vor, wo sich in dem Besitze einer Person Güter befinden, von welchen bestimmte Quantitäten für dieselbe überhaupt einen geringeren Werth haben, als Quantitäten eines anderen im Besitze einer zweiten Person befindlichen Gutes, während bei dieser letzteren Person das umgekehrte Verhältniss statt hat. Nehmen wir z. B. an, dass in dem obigen Falle der erstere Landmann zwar nicht so viel Getreide, und der zweite Landmann nicht so viel Wein geerntet hätte, dass der erstere einen Theil hievon auf seinen Aeckern verderben, der letztere aber einen Theil seines Weines wegschütten [157] könnte, ohne in der Befriedigung seiner Bedürfnisse geschädigt zu werden, nehmen wir vielmehr an, dass jeder der beiden Landleute die gauze seiner Verfügung unterstehende Quantität des betreffenden Gutes doch irgendwie nutzbringend für sich und sein Hauswesen verwenden könnte.
Setzen wir z. B. den Fall, dass der erstere Landwirth seinen ganzen Vorrath an Getreide dadurch nutzbringend machen könnte, dass er nach der vollständigen Vorsorge für die Befriedigung seiner wichtigeren Be ürfnisse nach diesem Gute, eine gewisse Quantität hievon zur Mästung seines Viches verwenden würde, während der zweite Landwirth nicht einen so grossen Ueberfluss an Wein hätte, dass er etwa einen Theil hievon wegschütten müsste, vielmehr die ihm verfügbare Quantität dieses Gutes nur eben noch ausreichen würde, um Theilquantitäten hievon an seine Sclaven zur Anreizung ihrer Arbeitskraft zu verabfolgen: so ist kein Zweifel, dass ein bestimmtes Quantum, z. B. ein Metzen Getreide für den ersten, ein bestimmtes Quantum, z. B. ein Eimer Wein für den zweiten Landwirth, zwar nur einen geringen, aber doch immerhin irgend einen Werth hätte, weil in mittelbarer oder unmittelbarer Weise von einem solchen Quantum in beiden Fällen eine gewisse Bedürfnissbefriedigung der beiden Landleute abhängen würde. Hat nun aber in einem solchen Falle für den ersten Landwirth eine bestimmte Quantität, z. B. ein Metzen Getreide, einen gewissen Werth, so ist dadurch doch keineswegs ausgeschlossen, dass eine bestimmte Quantität, z. B. ein Eimer Wein, für ihn nicht einen höheren Werth hätte, (indem die Genüsse, die er sich hiedurch zu verschaffen vermöchte, für ihn eine viel höhere Bedeutung haben würden, als die mehr oder minder reichliche Mästung seines Viehes mit Getreide;) während wiederum für den zweiten Landwirth ein Eimer Wein zwar gleichfalls einen gewissen Werth hat, damit aber durchaus nicht ausgeschlossen ist, dass ein Metzen Getreide für ihn nicht einen viel höheren Werth haben kann, indem derselbe ihm und seiner Familie eine reichlichere Ernährung, vielleicht gar die Vermeidung der Qualen des Hungers sichert.
Die allgemeinste Fassung jenes Verhältnisses, das wir hier als die wichtigste Grundlage alles menschlichen Güterverkehres [158] zur Darlegung bringen, ist demnach die folgende: Ein wirthschaftendes Subject A verfügt über concrete Quantitäten eines Gutes, welche für dasselbe einen geringeren Werth haben, als gewisse Quantitäten eines anderen Gutes, die sich in der Verfügung eines anderen wirthschaftenden Subjectes B befinden, während bei diesem letzteren in Rücksicht auf die Werthschätzung derselben Güterquantitäten das umgekehrte Verhältniss eintritt, so zwar, dass die gleiche Quantität des zweiten Gutes für ihn einen geringeren Werth hat, als jene des ersteren in der Verfügung des A befindlichen Gutes [2].
Tritt nun zu diesem Verhältnisse noch
a) die Erkenntniss desselben Seitens beider wirthschaftenden Subjecte, die hier in Rede sind, und
b) die Macht, jene Güterübertragung, von welcher wir oben sprachen, thatsächlich zu bewerkstelligen,
so liegt unserer Beobachtnng ein Verhältniss vor, wobei es lediglich von dem übereinstimmenden Willen zweier wirthschaftender Subjecte abhängt, für die Befriedigung ihrer Bedürfnisse besser oder vollständiger vorzusorgen, als dies ohne die Ausbeutung jenes Verhältnisses der Fall wäre.
Dasselbe Princip nun, welches die Menschen in ihrer wirthschaftlichen Thätigkeit überhaupt leitet, das Bestreben, ihre Bedürfnisse möglichst vollständig zu befriedigen, dasselbe Princip also, das die Menschen dazu führt, die Nützlichkeiten in der äusseren Natur zu erforschen und ihrer Verfügung zu unterwerfen, dieselbe Sorge nach Verbesserung [159] ihrer wirthschaftlichen Lage, führt nun dieselben auch dazu, die obigen Verhältnisse, wo immer sie vorliegen, auf das Eifrigate zu erforschen und zum Zwecke der besseren Befriedigung ihrer Bedürfnisse auszubeuten, das ist, in unserem Falle zu bewirken, dass jene Güterübertragung, von der wir oben sprachen, auch thatsächlich erfolge. Es ist dies aber die Ursache aller jener Erscheinungen des wirthschaftlichen Lebens, welche wir mit dem Worte „Tausch“ bezeichnen, ein Begriff, welcher in diesem unserer Wissenschaft eigenthümlichen Sinne viel weiter, als im populären, oder insbesondere auch im juristischen Sinne des Wortes ist, indem er im erstern Sinne auch den Kauf und alle partiellen Uebertragungen ökonomischer Güter, so weit sie gegen Entgelt erfolgen, (Pachtung, Miethe etc.) umfasst.
Fassen wir das Gesagte zusammen, so ergibt sich als Resultat unserer bisherigen Untersuchung: dass das Princip, welches die Menschen zum Tausche führt, kein anderes ist, als dasjenige, dass sie bei ihrer gesammten ökonomischen Thätigkeit überhaupt leitet, d. i. das Streben nach der möglichst vollständigen Befriedigung ihrer Bedürfnisse. Die Lust, welche die Menschen bei dem ökonomischen Austausche von Gütern empfinden, ist aber jenes allgemeine Gefühl der Freude, welches die Menschen empfinden, wofern durch irgend ein Ereigniss für die Befriedigung ihrer Bedürfnisse besser vorgesorgt wird, als dies ohne den Eintritt desselben der Fall gewesen wäre. Dieser Erfolg ist jedoch mit Rücksicht auf die gegenseitige Uebertragung von Gütern, wie wir sahen, an drei Voraussetzungen gebunden:
a) Es müssen sich in der Verfügung des einen wirthschaftenden Subjectes Güterquantitäten befinden, welche für dasselbe einen geringeren Werth haben, als andere Güterquantitäten, über welche ein anderes wirthschaftendes Subject verfügt, während bei diesem letzteren das umgekehrte Verhältniss der Werthschätzung derselben Güter stattfindet.
b) Die beiden wirthschaftenden Subjecte müssen zur Erkenntniss dieses Verhältnisses gelangt sein und
c) dieselben müssen es in ihrer Gewalt haben, den obigen Güteraustausch auch thatsächlich zu vollziehen.
Wo auch nur eine dieser drei Vorbedingungen mangelt, fehlen die Grundlagen zu einem ökonomischen Tausche und ist [160] ein solcher dadurch in Rücksicht auf die bezüglichen wirthschaftenden Subjecte und Güter ökonomisch ausgeschlossen.
§. 2.
Die Grenzen des ökonomischen Tausches.
Würden die einzelnen wirthschaftenden Subjecte von jeder Güterart nur über je ein einzelnes, im Hinblick auf seine Güterqualität untheilbares Gut verfügen, so böte die Erforschung der Grenze, bis zu welcher dieselben in jedem gegebenen Falle die Tauschoperationen vorzunehmen haben würden, um sich den höchsten ökonomischen Nutzen zuzuwenden, welcher sich unter den obwaltenden Verhältnissen erzielen liesse, keinerlei Schwierigkeit. Setzen wir den Fall, A besitze einen gläsernen Becher und B einen Schmuckgegenstand aus dem gleichen Stoffe und sowohl der erstere, als auch der letztere würde über kein weiteres Gut derselben Art verfügen, so wären nach dem, was wir im vorhergehenden Capitel sagten, nur zwei Eventualitäten denkbar: Entweder würden in Rücksicht auf die beiden obigen Güter die Grundlagen für einen ökonomischen Tausch zwischen den beiden in Rede stehenden Subjecten vorhanden sein, oder sie würden mangeln. In dem letzteren Falle würde ein Austausch jener Güter vom ökonomischen Standpunkte aus gar nicht in Frage kommen, im ersteren aber ebensowenig ein Zweifel darüber entstehen können, dass mit dem thatsächlich erfolgten Austausche der beiden obigen Güter jedem weiteren Austausche von Gütern derselben Art zwischen A und B eine natürliche Grenze gesetzt wäre.
Anders verhält es sich überall dort, wo sich Quantitäten von Gütern in der Verfügung verschiedener Personen befinden, die sich in beliebige Theilquantitäten sondern lassen, oder aber aus mehreren wenngleich auch ihrer Natur oder Bestimmung nach untheilbaren concreten Stücken bestehen.
Setzen wir den Fall, A, ein amerikanischer Blockhausbesitzer, verfüge über mehrere Pferde, besässe aber keine Kuh, während B, ein Nachbar desselben, eine Anzahl von Kühen, aber kein Pferd besässe. Dass in einem solchen Falle, wofern A einen Bedarf an Milch und Milchproducten und B einen solchen an Zugthieren hat, die Grundlagen ökonomischer Tauschoperationen [161] vorhanden sein können, ist naheliegend. Niemand wird aber in diesem Falle behaupten, dass z. B. schon durch den Austausch eines Pferdes des A gegen eine Kuh des B die etwa vorhandenen Grundlagen ökonomischer Tauschoperationen zwischen A und B mit Rücksicht auf die in Rede stehenden Güter erschöpft sein müssten. Ebenso unzweifelhaft ist es aber auch, dass diese Grundlagen nicht nothwendigerweise für die obigen Güterquantitäten in ihrer Gesammtheit vorhanden sein müssen. A, der z. B. sechs Pferde hat, würde seine Bedürfnisse besser befriedigen können, falls er ein, zwei, oder vielleicht selbst drei seiner Pferde gegen Kühe des B umtauschen würde; daraus folgt aber keineswegs, dass er nothwendigerweise auch dann einen ökonomischen Nutzen aus dem Tauschgeschäfte ziehen würde, falls er seine sämmtlichen Pferde gegen die sämmtlichen Kühe des B im Tausche hingeben würde. In diesem Falle könnte es nämlich geschehen, dass, obzwar der ökonomischen Sachlage nach die Grundlagen für ökonomische Tauschoperationen zwischen A und B vorlagen, doch wegen des zu weit getriebenen Tausches für die Bedürfnisse beider Contrahenten nach Vollzug desselben sogar schlechter vorgesorgt wäre, ale vor demselben.
Das obige Vorhältniss, wornach nicht lediglich einzelne concrete Güter, sondern Quantitäten von solchen der Verfügung der Menschen unterstehen, ist nun aber der Regel nach in der Wirthschaft der Menschen zu beobachten und es liegt demnach unserer Beobachtung eine Unzabl von Fällen von, in welchen zwei wirthschaftende Individuen über Quantitäten verschiedener Güter verfügen, auch die Grundlagen zu ökonomischen Tauschoperationen vorhanden sind, aber der Nutzen, der sich aus der Ausbeutung derselben ziehen lässt, einerseits nur unvollständig ausgebeutet werden würde, falls die beiden wirthschaftenden Subjecte zu geringe Theilquantitäten der betreffenden Güter gegeneinander austauschen würden, andererseits aber dieser Nutzen wieder gemindert, ja völlig aufgehoben und sogar in sein Gegentheil verwandelt werden möchte, falls dieselben ihre Tauschoperationen zu weit treiben, das ist zu grosse Theilquantitäten der ihrer Verfügung unterstehenden Güter gegen einander austauschen würden.
Liegen nun aber unserer Beobachtung Fälle vor, wo ein [162] „zu wenig“ des Tausches nicht den vollen ökonomischen Nutzen gewährt, der sich aus der Ausbeutung eines vorliegenden Verhältnisses erzielen lässt, ein „zu viel“ desselben aber die gleiche Wirkung, ja nicht selten sogar eine Verschlechterung der ökonomischen Lage der beiden Tauschenden zur Folge hat, so muss es eine Grenze geben, wo der volle ökonomische Nutzen, der sich aus der Ausbeutung eines gegebenen Verhältnisses erzielen lässt, bereits erreicht ist und jeder weitere Austausch von Theilquantitäten unökonomisch zu werden beginnt. Die Bestimmung dieser Grenze ist nun der Gegenstand der nachfolgenden Untersuchung.
Zu diesem Zwecke wollen wir einen einfachen Fall zur Darstellung bringen, an welchen wir das hier obwaltende Verhältniss, ungestört durch nebensächliche Einflüsse, auf das sorgfältigste beobachten können.
Setzen wir den Fall, in einem Urwalde wohnten fern von den übrigen wirthschaftenden Individuen zwei Blockhausbesitzer, die mit einander im friedlichen Verkehre stünden und deren Bedürfnisse ihrem Umfange und ihrer Intensität nach vollständig gleich wären. Jeder derselben hätte zur Bearbeitung seiner Grundstücke mehrere Pferde nöthig, wovon eines ganz unumgänglich, falls er für sich und die Seinen den nöthigen Lebensbedarf an Nahrungsmitteln hervorbringen will, das andere um einen Ueberschuss über diese letztern, das ist solche Nahrungsmittel zu erzeugen, die ihm zur ausreichenden Ernährung seiner Person und seiner Familie erforderlich sind. Um das ihm nöthige Bau- und Brennholz aus dem Walde bis zum Blockhause zu schaffen, Steine, Sand u. dgl. m. zuführen und endlich ein Grundstück zu bearbeiten, auf welchem er einige Genussmittel für sich und seine Familie hervorbringt, kann jeder der beiden Landwirthe ein drittes Pferd, ein viertes aber wohl noch zu Vergnügungszwecken verwenden, ein fünftes Pferd hätte für jeden der Beiden nur noch die Bedeutung, dass es ihnen als Reserve für den Fall dienen würde, dass eines der übrigen Pferde leistungsunfähig würde, ein sechstes Pferd aber wüsste keiner der beiden Blockhausbesitzer in seiner Wirthschaft zu verwenden. Ferner bedarf ein jeder der beiden Blockhausbesitzer, um seinen Bedarf an Milch und Milchproducten zu decken, fünf Kühe und zwar [163] mit der gleichen Abstufung der Wichtigkeit der diesbezüglichen Bedürfnisse, so zwar, dass er eine sechste Kuh nicht mehr zu verwenden wüsste.
Bringen wir nun, um der grössern Anschaulichkeit willen, das obige Verhältniss zum ziffermässigen Ausdruck (S. 92 ff.), so können wir uns die sich abstufende Bedeutung der obigen Bedürfnissbefriedigungen für die beiden Blockhausbesitzer durch eine Reihe von Ziffern [3]veranschaulichen, welche im arithmetischen Verhältnisse abnehmen, z. B. durch die Reihe: 50, 40, 30, 20, 10, 0.
Setzen wir nun den Fall, A, der erste der beiden Blockhausbesitzer, besässe 6 Pferde, aber nur eine Kuh, während bei B, dem zweiten Blockhausbesitzer, das umgekehrte Verhältniss obwalten würde, so können wir uns die sich abstufende Bedeutung der Bedürfnissbefriedigungen, für welche durch den Güterbesitz der beiden obigen Personen vorgesorgt ist, durch die nachfolgende Tabelle versinnbildlichen:
| A | 379.B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pf. | K. | Pf. | K. | ||
| 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 40 | 40 | ||||
| 30 | 30 | ||||
| 20 | 20 | ||||
| 10 | 10 | ||||
| 0 | 0 | ||||
Dass hier die Grundlagen zu ökonomischen Tauschoperationen vorhanden sind, ist nach dem, was wir im vorigen Abschnitte dieses Capitels gesagt haben, leicht ersichtlich. Die Bedeutung, welche für A ein Pferd hat, ist gleich 0, die Bedeutung, welche für ihn eine zweite Kuh haben würde, gleich 40, während umgekehrt für B eine Kuh einen Werth hat, der gleich 0, ein zweites Pferd aber einen solchen haben würde, der gleich 40 ist, (S. 98). Es können demnach, sowohl A, als auch B, für die [164] Befriedigung ihrer Bedürfnisse beträchtlich besser vorsorgen, wenn A dem B ein Pferd und B dem A eine Kuh im Austausche hingiebt, und es ist kein Zweifel, dass dieselben, wofern sie wirthschaftende Subjecte sind, diesen Tausch auch thatsächlich vornehmen werden.
Nach diesem ersten Tausche wird sich aber die Bedeutung der Bedürfnissbefriedigungen, für welche durch den Güterbesitz der beiden obigen Personen vorgesorgt ist, in der nachfolgenden Weise darstellen:
| A | 383.B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pf. | K. | Pf. | K. | ||
| 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 30 | 30 | ||||
| 20 | 20 | ||||
| 10 | 10 | ||||
und es ist somit leicht ersichtlich, dass durch den obigen Tausch jedem der beiden Tauschenden ein eben so grosser ökonomischer Vortheil zugewachsen ist, als wenn sich sein Vermögen um ein Gut, dessen Werth für jede der beiden hier in Rede stehenden Personen gleich 40 ist, vermehrt hätte [4]. Ebenso sicher ist aber auch, dass mit diesem ersten Tausche die Grundlagen ökonomischer Tauschoperationen keineswegs erschöpft sind, vielmehr ist für A ein Pferd immer noch viel weniger werth, als eine neu in seinen Güterbesitz tretende Kuh für ihn werth sein würde, (10 das erste, 30 die zweite), während für B umgekehrt eine Kuh nur 10, ein neu in seine Wirthschaft tretendes Pferd aber 30 (also dreimal so viel) werth wäre. Es liegt demnach in dem ökonomischen Interesse der beiden wirthschaftenden Individuen, noch eine zweite Tauschoperation vorzunehmen.
[165]
Die Sachlage nach dem zweiten Tausche lässt sich wie folgt darstellen:
| A | 387.B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pf. | K. | Pf. | K. | ||
| 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 20 | 20 | ||||
und ist demnach ersichtlich, dass auch durch diesen Tausch jeder der beiden obigen Personen ein ökonomischer Nutzen und zwar kein geringerer zugewachsen ist, als wenn ihr Vermögen sich um ein Gut von einem Werthe gleich 20 vermehrt hätte.
Untersuchen wir nun, ob auch bei der obigen Sachlage noch die Grundlagen zu weiteren ökonomischen Tauschoperationen vorliegen. Ein Pferd hat für A die Bedeutung von 20, eine neu hinzutretende Kuh gleichfalls eine Bedeutung von 20, und was B betrifft, so liegt für denselben genau dasselbe Verhältniss vor. Es steht aber nach dem, was wir sagten, fest, dass ein Austausch eines Pferdes des A gegen eine Kuh des B unter solchen Verhältnissen gänzlich müssig, das ist ohne allen ökonomischen Nutzen, sem würde.
Setzen wir nun aber den Fall, A und B würden nichtsdestoweniger einen dritten Tausch eingehen, so ist klar, dass, falls die Effectuirung desselben keine nennenswerthen ökonomischen Opfer erfordern würde (Transportskosten, Zeitverlust etc.), durch einen solchen Tausch die ökonomische Lage der beiden Contrahenten zwar nicht verschlechtert, aber auch nicht verbessert werden würde [5]. Ihre Lage nach diesem Tausche wäre nämlich die folgende:
| A | 392.B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pf. | K. | Pf. | K. | ||
| 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 20 | 20 | ||||
[166]
Fragen wir nun weiter nach dem ökonomischen Erfolge noch weitergehender Täusche eines Pferdes des A gegen eine Kuh des B. Die Sachlage nach einem vierten Tausche wäre die folgende:
| A | 395.B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pf | K. | Pf. | K. | ||
| 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 30 | 30 | ||||
| 20 | 20 | ||||
| 10 | 10 | ||||
Wie man sieht, ist die ökonomische Sachlage nach dem vierten Tausche sowohl für A, als auch für B eine ungünstigere, als vor demselben. A hat wohl eine fünfte Kuh erlangt und sich dadurch die Befriedigung eines Bedürfnisses gesichert, welche für ihn eine Bedeutung gleich 10 hat, aber dafür ein Pferd hingegeben, das für ihn die Bedeutung von Bedürfnissbefriedigungen hatte, die wir gleich 30 schätzten und seine ökonomische Lage nach diesem Tausche ist demnach keine andere, als wäre ein Gut von einem Werthe gleich 20 ohne jede Gegenleistung seinem Vermögen entzogen worden. Ganz dasselbe ist aber auch bei B zu beobachten und somit der ökonomische Nachtheil aus der vierten Tauschoperation ein beiderseitiger. Anstatt demnach durch diesen Austausch zu gewinner würden A und B in Folge desselben einen ökonomischen Verlust erleiden.
Würden nun die beiden Personen A und B den Austausch von Pferden gegen Kühe auch noch über diese vierte Tauschoperation hinaus fortsetzen, so würde sich die Sachlage nach dem fünften Tausche folgendermassen darstellen:
| A | 399.B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pf. | K. | Pf. | K. | ||
| 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 40 | 40 | ||||
| 30 | 30 | ||||
| 20 | 20 | ||||
| 10 | 10 | ||||
| 0 | 0 | ||||
nach dem sechsten Tausche aber in folgender Weise:
[167]
| A | 402.B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pf. | K. | Pf. | K. | ||
| — | 50 | 50 | — | ||
| 40 | 40 | ||||
| 30 | 30 | ||||
| 20 | 20 | ||||
| 10 | 10 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
und es ist leicht ersichtlich, dass die beiden tauschenden Subjecte nach dem fünften Tausche eines Pferdes des A gegen eine Kuh des B, rücksichtlich der Vollständigkeit, mit welcher für die Befriedigung ihrer Bedürfnisse vorgesorgt sein würde, dorthin gelangen würden, wo sie beim Anfange des Tauschgeschäftes standen, während sie nach dem sechsten Tausche ihre ökonomische Lage noch darüber hinaus beträchtlich verschlechtert hätten und nichts Besseres thun könnten, als so unökonomische Tauschoperationen wieder rückgängig zu machen.
Was wir nun hier an einem einzelnen concreten Falle dargelegt haben, das lässt sich überall dort beobachten, wo sich Quantitäten verschiedener Güter in dem Bestize verschiedener Personen befinden und die Grundlagen zu ökonomischen Tauschoperationen vorliegen, und wir würden bei der Wahl anderer Beispiele wohl Verschiedenheiten in Rücksicht auf nebensächliche Umstände, nicht aber in Rücksicht auf das Wesen des obigen Verhältnisses vorfinden.
Ueberall würden wir zunächst für jeden gegebenen Zeitpunkt eine Grenze wahrnehmen, bis zu welcher zwei Personen ihre Güter zu ihrem beiderseitigen ökonomischen Nutzen gegen einander austauschen können, eine Grenze, welche sie aber auch nicht überschreiten dürfen, ohne sich hiedurch in eine ungünstigere ökonomische Lage zu versetzen, kurz, wir würden überall eine Grenze wahrnehmen, wo der ökonomische Gesammtnutzen, welcher sich aus der Ausbeutung des vorliegenden Verhältnisses erzielen lässt, erschöpft ist, und von da ab sich durch fortgesetzte Tauschoperationen wieder mindert, also eine Grenze, über welche hinaus jeder weitere Austausch von Theilquantitäten als unökonomisch erscheint. Diese Grenze ist aber dann [168] erreicht, wenn sich keine Güterquantität mehr in dem Besitze des einen der beiden Contrahenten befindet, die für ihn einen geringeren Werth hätte, als eine Quantität eines andern in der Verfügung des zweiten Contrahenten befindlichen Gutes, während zugleich bei dieser letzteren Person das umgekehrte Verhältniss der Werthschätzung stattfindet.
Und so sehen wir denn auch in der That, dass die Menschen im practischen Leben nicht ins Unbestimmte und Unbegrenzte hinein tauschen, sondern bestimmte Personen für jeden gegebenen Zeitpunkt und mit Rücksicht auf bestimmte Güterarten und jede gegebene ökonomische Sachlage zu einer gewissen Grenze gelangen, bei der sie mit jedem weiteren Tausche einhalten [6].
In dem Verkehre der Einzelnen, noch mehr aber in dem Verkehre ganzer Völker miteinander, macht sich allerdings der Regel nach der Umstand bemerkbar, dass der Werth, welchen die concreten Güter für die Menschen haben, einem steten Wechsel unterliegt, hauptsächlich deshalb, weil durch den Productionsprocess immer neue Güterquantitäten in die Verfügung der einzelnen wirthschaftenden Individuen treten und hiedurch die Grundlagen ökonomischer Täusche fortdauernd erneuert werden, und es bietet sich deshalb unserem Auge die Erscheinung einer fortlaufenden Reihe von Tauschoperationen dar. Aber auch in dieser Kette von Transactionen können wir bei genauer Beobachtung für gegebene Zeitpunkte Personen und Güterarten stets Ruhepunkte finden, in welchen ein Austausch von Gütern [169] nicht stattfindet, weil die ökonomische Grenze desselben bereits eingetreten ist.
Eine weitere Beobachtung, die wir oben machten, betraf den sich stufenweise mindernden ökonomischen Nutzen, der sich aus der Ausbeutung einer gegebenen Tauschgelegenheit für bestimmte wirthschaftende Individuen ergiebt. Die erste Berührung der wirthschaftenden Subjecte im Tauschverkehre pflegt für dieselben stets die ökonomisch vortheilhafteste zu sein und erst später pflegen auch jene Tauschgelegenheiten ausgebeutet zu werden, welche minderen ökonomischen Vortheil versprechen. Dies gilt nicht nur von dem Verkehre der Individuen, sondern ebensowohl von dem ganzer Nationen. Wenn zwei Völker, deren Häfen oder Grenzen für den gegenseitigen Verkehr bisher überhaupt, oder doch durch längere Zeit verschlossen waren, dieselben plötzlich dem Verkehre öffnen, oder auch nur einige der bisherigen Hindernisse fortgeräumt werden, so entwickelt sich sofort ein sehr reger Güterverkehr, denn die Zahl der auszubeutenden Tauschgelegenheiten und der hier zu erzielende ökonomische Vortheil sind gross. Später tritt ein solcher Verkehr in das Geleise gewöhnlicher, nutzbringender Geschäfte. Wenn aber der volle Nutzen eines solchen jungen Verkehres bisweilen nicht sofort an den Tag tritt, so hat dies seinen Grund darin, dass die zwei anderen Voraussetzungen des ökonomischen Tausches, die Erkenntniss der Tauschgelegenheiten und die Macht, die als ökonomisch erkannten Tauschoperationen auszuführen, der Regel nach erst nach Verlauf eines gewissen Zeitraumes für die tauschenden Individuen vorhanden sind. Es ist aber denn auch eine der eifrigsten Bemühungen handel treibender Nationen, in diesen beiden Richtungen alle dem Verkehre entgegenstehenden Hindernisse zu überwinden, (durch genaues Studium der commerciellen Verhältnisse, durch Bau guter Strassen und sonstiger Verkehrswege etc.).
Bevor ich diese Untersuchung über die Grundlagen und die Grenzen des ökonomischen Tausches schliesse, möchte ich noch auf einen Umstand hinweisen, desseh Berücksichtigung für die richtige Auffassung der hier dargelegten Grundsätze von nicht geringer Wichtigkeit ist, ich meine die ökonomischen Opfer, welche die Tauschoperationen erfordern.
[170]
Wären die Menschen und ihr Güterbesitz (die menschlichen Wirthschaften) nicht räumlich getrennt, und hätte somit die gegenseitige Uebertragung der Güter aus der Verfügung eines wirthschaftenden Subjectes in jene eines anderen nicht der Regel nach eine Güterbewegung und noch viele andere ökonomische Opfer zu ihrer Voraussetzung, so würde der ganze aus dem Tauschgeschäfte resultirende ökonomische Nutzen, wie wir ihn oben dargelegt haben, den beiden Tauschenden zufallen. Dieser Fall ist aber jedenfalls nur selten vorhanden. Wir können uns nämlich wohl Fälle denken, wo die ökonomischen Opfer einer Tauschoperation auf ein Minimum herabsinken, so zwar, dass sie im practischen Leben nicht beachtet werden, nicht leicht wird sich aber in der Wirklichkeit ein Fall finden lassen, wo sich eine Tauschoperation gänzlich ohne ökonomische Opfer, und beschränkten sich dieselben auch nur auf einen Zeitverlust, bewerkstelligen liesse. Frachtkosten, Primagen, Mauthgebühren, Havarien, Kosten der Correspondenz, Assecuranzen, Provisionen und Commissionsgebühren, Courtagen, Waggelder, Kosten der Emballagen, Lagergelder, ja die Ernährung der Handelsleute [7]und ihrer Hilfsarbeiter überhaupt, die ganzen Kosten des Geldwesens u. s. f. sind nichts anderes, als die verschiedenen ökonomischen Opfer, welche die Tauschoperationen verlangen und die einen Theil des ökonomischen Nutzens absorbiren, welcher aus der Ausbeutung der vorhandenen Tauschgelegenheiten resultirt, ja nicht selten diese letztere dort unmöglich machen, wo sie, falls jene „Spesen,“ im allgemeinen volkswirthschaftlichen Sinne des Wortes, nicht beständen, noch möglich wäre.
Die Entwicklung der Volkswirthschaft hat die Tendenz, diese ökonomischen Opfer herabzumindern, und solcherart werden ökonomische Täusche nach und nach selbst zwischen den entferntesten Ländern und überhaupt dort möglich, wo sie bis dahin nicht statthaben konnten.
[171]
Es liegt in dem obigen aber zugleich auch die Erklärung der Quelle, aus welcher alle jene tausende von Personen, welche den Verkehr vermitteln, ihr Einkommen beziehen, trotzdem dass sie zur physischen Vermehrung der Güter nicht unmittelbar beitragen und ihre Thätigkeit desshalb nicht selten für unproductiv gehalten wurde. Ein ökonomischer Tausch trägt, wie wir sahen, zur besseren Befriedigung menschlicher Bedürfnisse und zur Vermehrung des Vermögens der Tauschenden eben so wohl bei, als die physische Vermehrung der ökonomischen Güter und alle jene Personen, die ihn vermitteln, sind desshalb—immer vorausgesetzt, dass die Tauschoperationen ökonomische sind—ebensowohl productiv, als die Ackerbauer und Fabrikanten, denn das Ziel aller Wirthschaft ist nicht die physische Vermehrung der Güter, sondern die möglichst vollständige Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse und zur Erreichung dieses Zieles tragen die Handelsleute nicht minder bei, wie jene Personen, welche man bis lange, von einem höchst einseitigen Standpunkte aus, ausschliesslich die productiven nannte.
[172]
Fünftes Capitel.
Die Lehre vom Preise.↩
Die Preise, oder mit andern Worten, die im Tausche zur Erscheinung gelangenden Güterquantitäten, so sehr sie sich auch unseren Sinnen aufdrängen und desshalb den gewöhnlichsten Gegenstand der wissenschaftlichen Beobachtung bilden, sind doch nichts weniger als das Wesentliche der ökonomischen Erscheinung des Tausches. Dieses liegt vielmehr in der durch den Tausch herbeigeführten besseren Vorsorge für die Befriedigung der Bedürfnisse der beiden Tauschenden. Die wirthschaftenden Menschen haben das Bestreben, ihre ökonomische Lage nach Möglichkeit zu verbessern. Zu diesem Zwecke setzen sie ihre wirthschaftliche Thätigkeit überhaupt in Bewegung und zu diesem Zwecke tauschen sie auch die Güter aus, wo immer hiedurch derselbe erreicht werden kann. Die Preise sind hiebei aber lediglich accidentielle Erscheinungen, Symptome des ökonomischen Ausgleiches zwischen den menschlichen Wirthschaften.
Wenn man die Schleussen zwischen zwei ruhig stehenden Gewässern, deren Niveau ein verschiedenes ist, wegräumt, so werfen sie Wellen, so lange, bis der Spiegel sich schliesslich wieder glättet. Diese Wellen sind aber nur ein Symptom der Einwirkung jener Kräfte, die wir die Schwere und die Trägheit nennen. Solchen Wellen gleichen auch die Güterpreise, diese Symptome des ökonomischen Ausgleiches des Güterbesitzes zwischen den Wirthschaften. Die Kraft, die sie aber an die Oberfläche der Erscheinung treibt, ist die letzte und allgemeine Ursache aller wirthschaftlichen Bewegung, das Bestreben der Menschen, ihre Bedürfnisse möglichst vollständig zu befriedigen, ihre ökonomische Lage zu verbessern. Weil aber die Preise die einzigen sinnlich wahrnehmbaren Erscheinungen des ganzen Processes sind, ihre Höhe sich genau messen lässt und das tägliche [173] Leben uns dieselben ohne Unterlass vor Augen führt, so war der Irrthum naheliegend, die Grösse derselben als das Wesentliche am Tausche, und, in weiterer Consequenz dieses Irrthums, die im Austausch erscheinenden Güterquantitäten als Aequivalente zu betrachten. Hiedurch wurde aber der unberechenbare Nachtheil für unsere Wissenschaft herbeigeführt, dass sich die Forscher auf dem Gebiete der Preiserscheinungen auf die Lösung des Problems verlegten, die angebliche Gleichheit [1]zwischen zwei Güterquantitäten auf ihre Ursachen zurückzuführen und die einen dieselben in gleichen auf diese Güter verwandten Arbeitsquantitäten, die andern in gleichen Productionskosten suchten, ja sogar darüber Streit entstand, ob die Güter gegen einander hingegeben werden, weil sie Aequivalente [174] sind, oder ob die Güter Aequivalente sind, weil sie im Austausche gegen einander hingegeben werden, während eine solche Gleichheit des Werthes zweier Güterquantitäten (eine Gleichheit im objectiven Sinne) in Wahrheit nirgends besteht.
Der Irrthum, welcher den obigen Theorien zu Grunde liegt, wird sofort ersichtlich, wenn wir uns von der Einseitigkeit frei machen, welche bisher in der Beobachtung der Preiserscheinungen zu Tage getreten ist. Aequivalente (im objectiven Sinne der Wortes) könnten nur solche Güterquantitäten genannt werden, welche sich in einem gegebenen Momente in beliebiger Weise umsetzen liessen, so zwar, dass, falls die eine angeboten würde, die andere dafür zu erwerben wäre, und so umgekehrt. Solche Aequivalente sind nun aber im wirthschaftlichen Leben der Menschen nirgends vorhanden. Gäbe es nämlich Aequivalente in diesem Sinne, so wäre nicht abzusehen, warum nicht jeder Tausch, insolange die Conjunctur noch unverändert ist, rückgängig gemacht werden könnte. Man setze den Fall, A habe sein Haus dem B gegen dessen Landgut, oder gegen eine Summe von 20.000 Thalern, hingegeben. Wären nun die obigen Güter durch das Tauschgeschäft Aequivalente im objectiven Sinne des Wortes geworden, oder vor dem Tausche schon solche gewesen, so wäre nicht abzusehen, warum die beiden Tauschenden nicht bereit sein sollten, den Tausch sofort wieder rückgängig zu machen, während doch die Erfahrung lehrt, dass in solch einem Falle der Regel nach Keiner von Beiden einem solchen Arrangement seine Zustimmung geben würde.
Die gleiche Beobachtung kann ebensowohl unter den entwickeltesten Verkehrsverhältnissen und zwar selbst rücksichtlich der absatzfähigsten Waaren gemacht werden. Man versuche, auf einem Getreidemarkte, oder auf einer Effectenbörse Getreide, beziehungsweise Effecten, zu kaufen und, ehe die Conjunctur eine Veränderung erfahren, dieselben wieder zu veräussern, oder im selben Momente eine Waare zu verkaufen und eine gleiche zu kaufen, und man wird leicht zur Ueberzeugung gelangen, dass die Differenz, welche zwischen den Preisen beim Anbote und jenen bei der Nachfrage besteht, keine blosse Zufälligkeit, sondern eine allgemeine Erscheinung der Volkswirthschaft ist.
Waaren, welche gegeneinander in bestimmten Quantitäten [175] ausgetauscht werden könnten, also z. B. eine Geldsumme und eine Quantität eines andern ökonomischen Gutes, welche ebensowohl im Kaufe als im Verkaufe beliebig gegeneinander umgesetzt werden könnten, kurz, Aequivalente im objectiven Sinne des Wortes, existiren desshalb—selbst mit Rücksicht auf einen bestimmten Markt und einen bestimmten Zeitpunkt—nicht, ja, was viel wichtiger ist, das tiefere Verständniss der Ursachen, welche zum Gütertausche und zum menschlichen Verkehre überhaupt führen, lehrt uns, dass solche Aequivalente durch die Natur des Verhältnisses selbst völlig ausgeschlossen sind und in Wirklichkeit gar nicht bestehen können.
Eine richtige Theorie der Preise kann demnach nicht die Aufgabe haben, jene angebliche, in Wahrheit aber nirgends bestehende „Werthgleichheit“ zwischen zwei Güterquantitäten zu erklären, eine Aufgabe, bei welcher der subjective Charakter des Werthes und die Natur des Tausches völlig verkannt werden, sondern muss darauf gerichtet sein, zu zeigen, wie die wirthschaftenden Menschen bei ihrem auf die möglichst vollständige Befriedigung ihrer Bedürfnisse gerichteten Streben dazu geführt werden, Güter, und zwar bestimmte Quantitäten derselben gegeneinander hinzugeben. Wir werden aber bei den hier einschlägigen Untersuchen, nach der in diesem Werke überhaupt befolgten Methode, mit der Beobachtung der einfachsten Erscheinungsform der Preisbildung beginnen und allmählig zu den complicirteren Erscheinungsformen derselben übergehen.
§. 1.
Die Preisbildung beim isolirten Tausche.
Wir haben in dem vorigen Capitel gesehen, dass die Möglichkeit eines ökonomischen Austausches von Gütern an die Bedingung geknüpft ist, dass sich in der Verfügung eines wirthschaftenden Subjectes Güter befinden, welche für dasselbe einen geringern Werth haben, als andere in der Verfügung eines andern wirthschaftenden Subjectes befindliche Güter, während bei diesem letztern das umgekehrte Verhältniss der Werthschätzung stattfinden muss. Hierin liegt nun aber bereits eine streng gezogene [176] Grenze, innerhalb welcher die Preisbildung in jedem gegebenen Falle erfolgen muss.
Setzen wir z. B. den Fall, es hätten für A 100 Mass seines Getreides einen eben so grossen Werth, als 40 Mass Wein, so ist zunächst sicher, dass A unter keinen Umständen mehr als 100 Mass Getreide für jene Quantität Wein im Austausche hinzugeben bereit sein wird, da nach einem solchen Tausche für seine Bedürfnisse schlechter vorgesorgt sein würde, als vor demselben; ja er wird sich sogar nur dann zu dem Austausche verstehen, wenn er durch denselben für seine Bedürfnisse besser vorzusorgen vermag, als dies ohne den Austausch der Fall sein würde. Er wird desshalb nur dann bereit sein, Wein gegen sein Getreide einzutauschen, wenn er für 40 Mass Wein weniger, als 100 Mass Getreide hinzugeben hätte. Wie immer sich demnach der Preis von 40 Mass Wein bei einem allfälligen Austausche des Getreides des A gegen den Wein irgend eines andern wirthschaftenden Subjectes stellen wird, so viel ist sicher, dass er in unserem Falle, schon um der ökonomischen Lage des A willen, 100 Mass Getreide nicht wird erreichen dürfen.
Findet nun A kein anderes wirthschaftendes Subject, für welches eine geringere Quantität von Getreide, als 100 Mass, eine höhere Bedeutung hat, als 40 Mass Wein, so wird er überhaupt nicht in die Lage kommen, sein Getreide gegen Wein auszutauschen, indem dann die Grundlagen für einen ökonomischen Tausch rücksichtlich der in Rede stehenden Güter für ihn nicht vorhanden sind. Findet aber A ein zweites wirthschaftendes Subject B, für welches z. B. schon 80 Mass Getreide einen eben so hohen Werth haben, als 40 Mass Wein, so ist, wofern die beiden hier in Rede stehenden Subjecte dies Verhältniss erkennen und dem Vollzuge des Tausches keine Hindernisse entgegenstehen, für A und B allerdings die Voraussetzung eines ökonomischen Tausches vorhanden, damit aber zugleich eine zweite Grenze für die Preisbildung gegeben. Folgt nämlich aus der ökonomischen Lage des A, dass der Preis für 40 Mass Wein sich unter 100 Mass Getreide wird stellen müssen, (indem er sonst keinen ökonomischen Nutzen aus dem Tauschgeschäfte ziehen würde,) so folgt aus jener des B, dass ihm für seine 40 Mass Wein eine grössere Quantität Getreide, als 80 Mass, [177] geboten werden muss. Wie immer sich demnach der Preis von 40 Mass Wein bei einem ökonomischen Tausche zwischen A und B stellen wird, so viel ist sicher, dass er sich zwischen den Grenzen von 80 und 100 Mass Getreide, und zwar jedenfalls über 80 und unter 100 Mass Getreide, wird bilden müssen.
Nun ist es unschwer, zu erkennen, dass A in dem obigen Falle selbst dann für die Befriedigung seiner Bedürfnisse besser vorsorgen würde, falls er sogar 99 Mass Getreide für jene 40 Mass Wein hingeben, so wie andererscits B gleichfalls ökonomisch handeln möchte, falls er auch nur 81 Mass Getreide für seine 40 Mass Wein im Austausche annehmen würde. Da nun aber in dem vorliegenden Falle die Gelegenheit zur Ausbeutung eines weit grösseren ökonomischen Vortheiles für beide wirthschaftende Subjecte vorhanden ist, so wird das Bestreben jedes derselben darauf gerichtet sein, so viel als möglich von jenem ökonomischen Nutzen sich zuzuwenden. Es wird aber dadurch jene Erscheinung hervorgerufen werden, die wir im Leben das Feilschen nennen. Jeder der beiden Tauschenden wird bestrebt sein, einen möglichst grossen Antheil an dem bei Ausbeutung dieser Tauschgelegenheit sich ergebenden ökonomischen Nutzen zu erlangen und selbst beim Bestreben, sich auch nur einen billigen Antheil an dem in Rede stehenden Gewinne zuzueignen, zu um so höheren Preisforderungen geneigt sein, je weniger er die ökonomische Lage des andern Tauschenden und die äusserste Grenze kennt, bis zu welcher derselbe zu gehen vermag.
Welches wird nun aber das ziffermässige Resultat dieses Preiskampfes sein?
Sicher ist, wie wir sahen, dass der Preis von 40 Mass Wein höher, als 80, und niedrieger als 100 Mass Getreide sein wird. Eben so gewiss scheint mir aber auch, dass, je nach der verschiedenen Individualität der Tauschenden, ihrer grösseren, oder geringeren Kenntniss des Geschäftslebens und der Lage des anderen Contrahenten, das Resultat des Tausches bald mehr zu Gunsten des einen, bald mehr zu Gunsten des andern ausfallen wird. Da indess bei der Aufstellung allgemeiner Principien kein Grund zur Annahme vorhanden ist, dass der eine oder der andere der beiden Contrahenten eine überwiegende [178] ökonomische Tüchtigkeit besitze, oder die sonstigen Umstände einem derselben günstiger seien, als dem andern, so werden wir, unter der Annahme ökonomisch gleich tüchtiger Individuen und gleicher sonstiger Verhältnisse, als allgemeine Regel aufstellen dürfen, dass das Bestreben beider Contrahenten, einen möglichst grossen ökonomischen Vortheil zu erzielen, sich gegenseitig paralysiren wird, und demnach auch die Preise von den beiden Extremen, innerhalb welcher sie sich bilden können, gleich weit entfernt bleiben werden.
In unserem Falle wird demnach der Preis einer Quantität Wein von 40 Mass, über welchen sich die beiden Tauschenden schliesslich einigen werden, jedenfalls innerhalb der Grenzen von 80 und 100 Mass Getreide liegen, und zwar mit der weiteren Beschränkung, dass er unter allen Umständen höher als 80 und niedriger als 100 Mass sein wird. Was aber dessen Fixirung innerhalb dieser Grenzen anbetrifft, so wird er sich, unter sonst gleichen Verhältnissen der beiden Contrahenten, auf 90 Mass Getreide stellen, ohne dass, falls die eben erwähnte Voraussetzung nicht eintrifft, ein Austausch zu andern, aber innerhalb der obigen Grenzen liegenden Preisen ökonomisch ausgeschlossen wäre.
Was nun von der Preisbildung in dem einen Falle gesagt wurde, gilt in gleicher Weise von jeder andern. Ueberall, wo die Grundlagen eines ökonomischen Austausches zwischen zwei wirthschaftenden Subjecten rücksichtlich zweier Güter vorhanden sind, sind durch die Natur des Verhältnisses selbst bestimmte Grenzen gegeben, innerhalb welcher die Preisbildung erfolgen muss, wofern der Austausch der Güter überhaupt einen ökonomischen Charakter haben soll. Diese Grenzen sind durch die verschiedenen Quantitäten der Tauschgüter gegeben, welche für die beiden Contrahenten Aequivalente sind (Aequivalente im subjectiven Sinne.) (In unserem obigen Beispiele sind zum Beispiele 100 Mass Getreide das Aequivalent von 40 Mass Wein für A, 80 Mass Getreide das Aequivalent derselben Quantität Weines für B.) Innerhalb dieser Grenzen tendirt indess die Preisbildung gegen den Durchschnitt der beiden Aequivalente, (im obigen Falle gegen 90 Mass Getreide, als dem Durchschnitte zwischen 80 und 100 Mass.)
[179]
Die Güterquantitäten, die beim ökonomischen Tausche gegeneinander hingegeben werden, sind demnach durch die jeweilig gegebene ökonomische Sachlage genau determinirt und, wenn auch die menschliche Willkür hier einen gewissen Spielraum hat, indem innerhalb gewisser Grenzen verschiedene Güterquantitäten usgetauscht werden können, ohne dass darum die bezüglichen Tauschoperationen ihren ökonomischen Charakter einbüssen würden, so ist doch eben so gewiss, dass das beiderseitige Bestreben der Contrahenten, einen möglichst grossen Gewinn aus dem Tauschgeschäfte zu ziehen, sich in den meisten Fällen paralysirt und somit die Preise gegen den oben erwähnten Durchschnitt tendiren. Treten nun individuelle, oder sonstige in den äusseren Verhältnissen, unter welchen die beiden wirthschaftenden Subjecte das Tauschgeschäft vornehmen, be gründete Momente hinzu, so können die Preise von diesem ihrem natürlichen Mittelpunkte, innerhalb der oben dargelegten Grenzen, abweichen, ohne dass die Tauschoperationen desshalb den ökonomischen Charakter einbüssen würden. Es sind aber diese Abweichungen dann auch nicht ökonomischer Natur, sondern in individuellen, oder in besonderen äusseren Ursachen begründet, die keinerlei ökonomischen Charakter haben.
§. 2.
Die Preisbildung im Monopolhandel.
Wir haben in dem vorigen Abschnitte auf die Gesetzmässigkeit der Preisbildung und Gütervertheilung hingewiesen, indem wir vorerst jenen einfachsten Fall unserer Betrachtung unterzogen, in welchem ein Austausch von Gütern zwischen zwei wirthschaftenden Subjecten, ohne die Einflussnahme der ökonomischen Thätigkeit anderer Personen, stattfindet. Dieser Fall, den man den isolirten Tausch nennen könnte, ist in den Anfängen der Culturentwicklung die gewöhnlichste Form des menschlichen Verkehrs, behält seine Bedeutung auch späterhin in dünn bevölkerten Landstrichen bei schwach entwickelter Cultur und ist selbst unter fortgeschrittenen wirthschaftlichen Verhältnissen nicht völlig ausgeschlossen, denn wir können ihn auch bei hochentwickelter Volkswirthschaft überall dort beobachten, [180] wo ein Austausch von Gütern stattfindet, welche einen auf zwei wirthschaftende Individuen beschränkten Werth haben, oder aber sonstige eigenthümliche Verhältnisse die beiden Tauschenden ökonomisch isoliren.
Je höher nun aber die Cultur eines Volkes sich entwickelt, um so seltener wird der Fall, dass die Grundlagen eines ökonomischen Austausches von Gütern lediglich für zwei wirthschaftende Subjecte vorhanden sind. A besitzt z. B. ein Pferd, das für ihn einen Werth hat, welcher dem von 10 Metzen Getreide gleichkommt, die neu in seine Verfügung treten würden, so zwar, dass er für die Befriedigung seiner Bedürfnisse besser vorsorgen würde, falls er dies Thier auch nur gegen 11 Metzen Getreide austauschen möchte. Für den Landwirth B dagegen, der über einen grossen Vorrath von Getreide verfügt, aber Mangel an Pferden hat, ist ein neu in seinen Besitz tretendes Pferd ein Aequivalent für 20 Metzen seines Getreides, so zwar, dass er für die Befriedigung seiner Bedürfnisse bessere Vorsorge treffen würde, wenn er für das Pford des A selbst 19, der Landwirth B2 auch dann, wenn er dafür z. B. 29, und der Landwirth B3 selbst dann, wenn er dafür 39 Metzen Getreide im Austausche hingeben möchte. In diesem Falle sind, nach dem, was wir oben sagten, rücksichtlich der in Rede stehenden Güter die Grundlagen des ökonomischen Tausches offenbar nicht nur für A und einen einzelnen der obigen Landwirthe vorhanden, sondern A kann sein Pferd jedem derselben im ökonomischen Austausche hingeben und jeder dieser letzteren dasselbe im ökonomischen Austausche übernehmen.
Anschaulicher noch wird das Gesagte, wenn wir den Fall in Betracht ziehen, dass nicht nur für A, sondern auch noch für mehrere andere Pferdebesitzer A2, A3 u. s. f. die Grundlagen für ökonomische Tauschoperationen mit den obigen Landwirthen bestehen würden. Setzen wir z. B. den Fall, dass für A2 schon 8, für A3 gar schon 6 neu in ihre Verfügung tretende Metzen Getreide einen ebenso grossen Werth haben würden, wie eines ihrer Pferde, so besteht kein Zweifel darüber, dass hier sogar die Grundlagen ökonomischer Tausche zwischen jedem einzelnen der obigen Viehzüchter und jedem einzelnen der obigen Landwirthe vorhanden wären.
[181]
In diesen beiden Fällen, also sowohl in dem ersten, wo die Grundlagen ökonomischer Tauschoperationen zwischen einem Monopolisten im weitesten Sinne dieses Wortes und jedem einzelnen von mehreren andern wirthschaftenden Subjecten bestehen und diese letzteren in ihrem Bestreben, diese Verhältnisse auszubeuten, um den Erwerb der Monopolgüter mit einander in Concurrenz treten, als auch in dem zweiten Falle, wo auf der einen Seite für jeden einzelnen von mehreren Besitzern irgend eines bestimmten Gutes, und auf der anderen Seite für jeden einzelnen von mehreren Besitzern irgend eines anderen Gutes, gleichzeitig die Grundlagen zu ökonomischen Tauschoperationen vorhanden sind und diese Personen demnach beiderseitig mit einander concurriren, in beiden Fällen haben wir es mit viel complicirteren Verhältnissen zu thun, als dasjenige es war, welches wir im ersten Abschnitte dieses Capitels zur Darstellung gebracht haben.
Wir werden aber mit dem einfacheren der beiden Fälle, der Mitbewerbung mehrerer wirthschaftenden Personen um Monopolgüter beginnen und hierauf zu dem verwickelteren Falle, der Preisbildung bei der Mitbewerbung auf beiden Seiten, übergehen.
a) Preisbildung und Gütervertheilung bei der Concurrenz mehrerer Personen um ein einzelnes untheilbares Monopolgut.
Wir haben bei Darlegung der Grundsätze der Preisbildung beim isolirten Tausche (S. 175 ff.) gesehen, dass, je nach den vorliegenden Grundlagen desselben, ein bald grösserer bald geringerer Spielraum vorhanden ist, innerhalb welches in jedem einzelnen Falle die Preisbildung erfolgen kann, ohne dass dadurch der Tausch seinen ökonomischen Charakter einbüssen würde. Zwar haben wir bemerkt, dass die Preisbildung die Tendenz hat, den ökonomischen Nutzen, welcher sich aus der Ausbeutung des vorliegenden Verhältnisses erzielen lässt, nach beiden Seiten hin gleich zu vertheilen, und dass sich demnach in jedem gegebenen Falle ein gewisser Durchschnitt ergibt, nach welchem die Preise hinstreben, indess haben wir hiebei betont, dass keinerlei ökonomische Einwirkungen den Punkt fixiren, auf welchem innerhalb des oben bezeichneten Spielraumes [182] die Preisbildung nothwendigerweise erfolgen müsste. Wenn demnach z. B. in einem gegebenen Falle für ein wirthschaftendes Individuum A ein Pferd, dass sich in seiner Verfügung befindet, keinen grössern Werth hat, als 10 Metzen Getreide, die neu in seine Verfügung treten würden, während für B, der eine reiche Getreideernte hatte, erst 80 Metzen Getreide einen gleichen Werth haben, wie ein in seinen Güterbesitz tretendes Pferd, so ist zunächst klar, dass, wofern A und B dies Verhältniss erkennen und auch die Macht haben, den Austausch der bezüglichen Güter thatsächlich zu bewerkstelligen, die Grundlagen eines ökonomischen Tausches des Pferdes des A gegen Getreide des B vorhanden sind. Es ist aber auch eben so sicher, dass sich der Preis des Pferdes zwischen den weiten Grenzen von 10 und 80 Metzen Getreide wird bilden können, ohne dass dadurch, dass der Preis sich mehr dem einen, oder dem anderen Extreme nähern würde, der ökonomische Charakter des Tausches verloren gehen möchte. Allerdings mag es höchst unwahrscheinlich sein, dass in dem obigen Falle sich der Preis jenes Pferdes etwa auf 11, oder 12, oder aber wiederum auf 78 oder 79 Metzen Getreide stellen wird, sicher ist jedoch, dass keinerlei ökonomische Ursachen vorhanden sind, die selbst eine solche Preisbildung völlig ausschliessen würden. Zugleich ist aber auch klar, dass insolange B in seinem Bestreben, das Pferd des A einzutauschen, keinen Concurrenten findet, das Tauschgeschäft naturgemäss nur zwischen A und B stattfinden kann.
Setzen wir nun aber den Fall, B1 erhalte einen Concurrenten B2, der, ohne einen so grossen Ueberfluss an Getreide zu besitzen, wie B1, oder aber einen so dringenden Bedarf an einem Pferde zu haben, wie dieser letztere, ein Pferd doch immer noch so hoch, wie 30 Metzen Getreide, schätzen würde, so zwar, dass er für die Befriedigung seiner Bedürfnisse schon besser vorsorgen möchte, wofern er selbst 29 Metzen Getreide für A's Pferd hingeben würde, so ist klar, dass sowohl zwischen B1 und A, als auch zwischen B2 und A die Grundlagen für einen ökonomischen Austausch rücksichtlich des Pferdes und einer Quantität Getreide vorhanden sind. Da nun aber doch nur einer von den beiden Concurrenten um A's Pferd dasselbe thatsächlich erstehen kann, so treten an uns zwei Fragen heran:
[183]
a) Mit welchem der beiden Concurrenten wird der Monopolist A das Tauschgeschäft abschliessen? und
b) innerhalb welcher Grenzen wird die Preisbildung in diesem Falle erfolgen?
Die Beantwortung der ersten Frage ergiebt sich aus der nachfolgenden Betrachtung. Für B2 hat das Pferd des A einen Werth, der 30 Metzen seines Getreides gleichkommt. Er würde demnach selbst dann noch für die Befriedigung seiner Bedürfnisse besser vorsorgen, wenn er auch 29 Metzen seines Getreides dem A für sein Pferd hingeben würde. Nun ist damit keineswegs gesagt, das B2 dem A sofort 29 Metzen für sein Pferd bieten wird, so viel ist aber sicher, dass er, um der Concurrenz des B1 nach Möglichkeit zu begegnen, selbst zu diesem Anbote sich entschliessen wird, da er höchst unökonomisch handeln würde, wofern er im äussersten Falle sich nicht selbst mit einem so geringen Tauschnutzen begnügen würde, als bei einem Austausche von 29 Metzen Getreide gegen A's Pferd sich für ihn ergeben möchte. B1 würde dagegen offenbar unökonomisch handeln, wenn er bei dem Wettbewerb um das Pferd des A zuliesse, dass B2 dasselbe selbst um den Preis von 29 Metzen Getreide ersteben würde, denn sein ökonomischer Nutzen ist ja immer noch ein beträchtlicher, selbst dann, wenn er 30 Metzen Getreide und mehr für jenes Pferd hingiebt, das ist B2 von jenem Tauschgeschäfte ökonomisch ausschliesst [2].
Der Umstand also, dass das Tauschgeschäft noch innerhalb eines Spielraumes der Preisbildung, wo dasselbe für B2 bereits unökonomisch wäre, für B1 noch immer seinen ökonomischen Charakter beibehält, ermöglicht es diesem letzteren, [184] sich des aus dem Tausche resultirenden Nutzens zu bemächtigen, indem er das Geschäft zugleich für seinen Concurrenten ökonomisch unmöglich macht.
Da nun aber A jedenfalls unökonomisch handeln würde, falls er sein Monopolgut nicht demjenigen Concurrenten überlassen würde, welcher ihm dafür den grössten Preis zu bieten vermag, so ist nichts sicherer, als dass bei der oben gegebenen ökonomischen Sachlage das Tauschgeschäft zwischen A und B1 statthaben wird.
Was nun aber die zweite Frage, jene nach den Grenzen betrifft, innerhalb welcher die Preisbildung in diesem Falle erfolgen wird, so steht zunächst fest, dass der Preis, den B1 dem A gewähren wird, 80 Metzen Getreide nicht erreichen darf, indem sonst das Tauschgeschäft für B1 den ökonomischen Charakter einbüssen würde. Es wird der Preis aber jedenfalls auch nicht unter 30 Metzen Getreide sinken können, denn sonst würde die Preisbildung innerhalb jener Grenzen fallen, wo das Tauschgeschäft auch für B2 noch vortheilhaft wäre und dieser demnach ein ökonomisches Interesse hätte, so lange mitzubieten, bis der Preis jene Grenze wieder erreichen würde. Es wird sich demnach der Preis in unserem Falle nothwendigerweise innerhalb der Grenzen von 30 und 80 Metzen Getreide bilden müssen [3].
Die Concurrenz des B2 bewirkt demnach, dass die Preisbildung beim Gütertausche zwischen A und B nicht mehr, wie dies sonst der Fall gewesen wäre, innerhalb der weiten Grenzen [185] von 10 und 80, sondern in den engeren Grenzen von 30 und 80 Metzen Getreide erfolgen wird, denn nur bei einer innerhalb dieser Grenzen erfolgenden Preisbildung erwächst den beiden Tauschenden ein ökonomischer Nutzen aus dem Tauschgeschäfte, während doch zugleich die Concurrenz des B2 ökonomisch ausgeschlossen ist. Damit ist aber dann das einfache Verhältniss des isolirten Tausches wieder hergestellt, mit dem einzigen Unterschiede, dass die Grenzen der Preisbildung engere geworden sind, und finden die oben hinsichtlich des isolirten Tausches dargelegten Grundsätze (S. 178) im Uebrigen denn auch hier ihre volle Anwendung.
Setzen wir nun weiter den Fall, dass zu den beiden bisherigen Concurrenten um das Pferd des A, nämlich zu B1 und B2, noch ein dritter Concurrent B3 hinzutreten würde, für welchen jenes Pferd einen Werth von 50 Metzen Getreide hätte, so ist nach dem, was wir soeben sagten, klar, dass das Tauschgeschäft zwar gleichfalls zwischen A und B1 stattfinden, die Preisbildung hiebei indess innerhalb der Grenzen von 50 und 80 Metzen, bei einem vierten Concurrenten, B4 für welchen das Pferd des A einen Werth von 70 Metzen Getreide hätte, das Tauschgeschäft nicht minder zwischen A und B1 stattfände, aber die Preisbildung innerhalb der Grenzen von 70 und 80 Metzen erfolgen müsste.
Erst wenn ein Concurrent, z. B. das wirthschaftende Subject B5, auftreten würde, für welchen das in Rede stehende Monopolgut gar einen Werth von 90 Metzen Getreide hätte, würde das Tauschgeschäft zwischen A und diesem letzteren stattfinden, der Preis des Pferdes sich hiebei aber zwischen 80 und 90 Metzen Getreide fixiren. Es ist nämlich klar, dass der in Rede stehende Concurrent die vorhandene Tauschgelegenheit zu seinem ökonomischen Nutzen auszubeuten, und doch sämmtliche übrige Concurrenten (einschliesslich B1) von demselben ökonomisch auszuschliessen in der Lage wäre. Die Preisbildung zwischen 80 und 90 Metzen Getreide fände aber darin ihre Begründung, dass einerseits der Concurrent B1 nur durch einen Preis von mindestens 80 Metzen Getreide von dem Tauschgeschäfte ökonomisch ausgeschlossen werden könnte, also der Preis nicht unter diese Höhe sinken, andererseits aber auch [186] nicht 90 Metzen Getreide erreichen, oder gar übersteigen dürfte, indem sonst das Tauschgeschäft für B5 den ökonomischen Charakter einbüssen möchte.
Fassen wir das Gesagte, das ebensowohl für jeden andern Fall gilt, in welchem zwischen einem Monopolisten, rücksichtlich eines untheilbaren Gutes, und mehreren anderen wirthschaftenden Subjecten, rücksichtlich eines ardern Gutes, die Grundlagen zu ökonomischen Tauschoperationen vorliegen, zusammen, so erhalten wir die nachfolgenden Grundsätze:
1. Ein untheilbares Monopolgut fällt bei der Concurrenz mehrerer wirthschaftender Subjecte, für welche die Grundlagen des ökonomischen Tausches rücksichtlich des in Rede stehenden Monopolgutes vorhanden sind, demjenigen Concurrenten zu, für welchen dasselbe das Aequivalent der grössten Quantität des dagegen im Austausche zu bietenden Gutes ist.
2. Die Preisbildung erfolgt in diesem Falle innerhalb der Grenzen, welche durch die Aequivalente des in Rede stehenden Monopolgutes für die beiden tauschlustigsten, beziehungsweise tauschkräftigsten Concurrenten gegeben sind.
3. Die Fixirung des Preises innerhalb der obigen Grenzen der Preisbildung erfolgt aber nach den beim isolirten Tausche dargelegten Grundsätzen.
b) Preisbildung und Gütervertheilung bei der Concurrenz um Quantitäten eines Monopols.
Wir haben in dem Vorangehenden jenen einfachsten Fall des Monopolhandels zum Gegenstande unserer Untersuchung gemacht, in welchem ein Monopolist ein einzelnes, untheilbares Gut zu Markte bringt und die Preisbildung unter dem Einflusse der Concurrenz mehrerer wirthschaftenden Subjecte um dasselbe erfolgt.
Der complicirtere Fall, den wir nunmehr zu behandeln gedenken, ist derjenige, in welchem zwischen einem Monopolisten, welcher über Quantitäten eines Monopolgutes verfügt, einerseits, und mehreren wirthschaftenden Subjecten, welche über Quantitäten eines andern Gutes verfügen, andererseits, gleichzeitig die Grundlagen zu ökonomischen Tauschoperationen bestehen.
[187]
Setzen wir den Fall, dass für den Landwirth B1, der über eine grosse Quantität Getreide, aber über keine Pferde verfügt, ein in seinen Besitz tretendes Pferd einen so hohen Werth hätte, wie 80 Metzen seines Getreides, für einen zweiten Landwirth B2 ein in seinen Besitz tretendes Pferd 70, für B3 60, für B4 50, für B5 40, für B6 30, für B7 20, für B8 gar nur 10 Metzen Getreide werth wäre, ein zweites Pferd aber für jeden dieser Landwirthe, so weit sie eines solchen überhaupt bedürfen, um 10 Metzen weniger werth als das erste, ein drittes um 10 Metzen weniger als das zweite u. s. f. jedes weitere um 10 Metzen weniger als das vorangehende, so lässt sich die eben dargelegte ökonomische Sachlage in ihren wesentlichen Momenten durch die nachfolgende Tabelle veranschaulichen:
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Für | B1 | 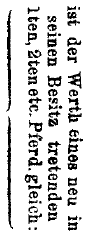 |
80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | Metz. | Getr. |
| Für | B2 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | Metz. | Getr. | ||
| Für | B3 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | Metz. | Getr. | |||
| Für | B4 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | Metz. | Getr. | ||||
| Für | B5 | 40 | 30 | 20 | 10 | Metz. | Getr. | |||||
| Für | B6 | 30 | 20 | 10 | Metz. | Getr. | ||||||
| Für | B7 | 20 | 10 | Metz. | Getr. | |||||||
| Für | B8 | 10 | Metz. | Getr. |
Wenn nun in diesem Falle der Monopolist A nur ein Pferd zu Markte bringt, so ist nach dem, was wir im vorigen Abschnitte sagten, sicher, dass B1 dasselbe erstehen wird, und zwar zu einem Preise, der sich zwischen 70 und 80 Metzen Getreide fixiren muss.
Setzen wir nun aber den Fall, der Monopolist A bringe nicht nur ein einzelnes Pferd, sondern 3 Pferde zu Markte, so sind wir bei jenem Falle angelangt, der hier den Gegenstand unserer speciellen Untersuchung bildet, und es fragt sich nun: Welcher von den obigen acht Landleuten, beziehungsweise welche von diesen letzteren werden die vom Monopolisten zur Veräusserung gebrachten Pferde erstehen, und welche Preise werden hiebei zur Erscheinung gelangen?
Fassen wir zu diesem Zwecke die obige Tabelle in's Auge, so ist zunächst ersichtlich, dass ein erstes, in den Besitz des B1 tretendes Pferd für denselben einen Werth von 80, ein [188] zweites nur noch einen solchen von 70, ein drittes von 60 Metzen Getreide haben würde. Bei dieser Sachlage könnte B1 zwar ein Pferd in ökonomischer Weise zu einem Preise von 70–80 Metzen Getreide erstehen und dadurch seine sämmtlichen Concurrenten vom Tausche ökonomisch ausschliessen, in Rücksicht auf das zweite Pferd würde er indess bereits unökonomisch handeln, falls er dafür 70 Metzen Getreide, oder mehr bieten würde, da durch einen solchen Tausch für die Befriedigung seiner Bedürfnisse nicht besser vorgesorgt wäre, als vorher. Beim dritten Pferde wäre aber, bei einem Preise, welcher B2 noch vom Tausche ausschliessen sollte, also jedenfalls zum mindesten 70 Metzen Getreide betragen müsste, der ökonomische Nachtheil für B1, und somit der nicht ökonomische Charakter des bezüglichen Tauschgeschäftes, noch viel einleuchtender.
Die ökonomische Sachlage ist demnach in dem obigen Falle eine solche, dass B1, rücksichtlich aller drei zu Markte gebrachten Pferde, seine sämmtlichen Mitconcurrenten um dieselben einerseits nur dann ausschliessen kann, wenn er für jedes derselben einen Preis von 70 Metzen Getreide, oder mehr bewilligen würde, andererseits aber bei diesem Preise nur ein Pferd in ökonomischer Weise erstehen, den Eintausch der beiden anderen Pferde zu dem obigen Preise jedoch nicht ohne seinen ökonomischen Nachtheil bewirken könnte.
Da wir uns nun aber unter B1 ein ökonomisch handelndes Subject denken, also B1 seine Concurrenten nicht zwecklos, oder gar zum eigenen Schaden, sondern lediglich in der Absicht und in so weit von dem Erwerbe von Quantitäten des Monopolgutes ausschliesst, als er sich hiedurch selbst eines ökonomischen Vortheiles bemächtigen kann, der ihm entgehen würde, falls er die übrigen Concurrenten zum Austausche von Quantitäten des Monopolgutes zulassen würde, so besteht auch kein Zweifel darüber, dass derselbe in unserem Falle, wo ein Ausschluss sämmtlicher Concurrenten um das Monopolgut nach der ökonomischen Sachlage für ihn ökonomisch unmöglich ist, zunächst den Concurrenten B2 an dem Eintausche von Quantitäten des Monopolgutes participiren zu lassen sich genöthigt sehen und sogar das gemeinschaftliche Interesse mit diesem Letzteren haben wird, [189] dass der Preis der einzelnen Theilquantitäten des Monopolgutes, hier eines Pferdes, sich so niedrig stelle, als unter den gegebenen Verhältnissen nur immer möglich ist. Fern davon also, den Preis eines Pferdes auf 70 Metzen Getreide und darüber zu treiben, wird demnach B1 sowohl, als B2 ein Interesse daran haben, zu bewirken, dass dieser Preis so tief unter 70 Metzen Getreide sich fixire, als der ökonomischen Sachlage nach nur immer zulässig ist.
In diesem Bestreben werden B1 und B2 jedoch in der Mitbewerbung der übrigen Concurrenten, also zunächst in jener des B3 eine Grenze finden, und demnach doch zu solchen Preisen sich verstehen müssen, bei welchen die übrigen Concurrenten um das Monopolgut (einschliesslich des B3) vom Tausch geschäfte ökonomisch ausgeschlossen sein werden. Der Preis wird in unserem Falle sich demnach zwischen 60 und 70 Metzen Getreide bilden müssen. Zu einem innerhalb dieser Grenzen gelegenen Preise kann sich nämlich B1 mit zwei, B2 mit einem Pferde, und zwar in allen einzelnen Fällen in ökonomischer Weise versorgen, während doch gleichzeitig sämmtliche übrige Concurrenten um das Monopolgut von dem Erwerbe von Quantitäten desselben ausgeschlossen sind.
Die Preisbildung innerhalb dieser Grenzen ist aber auch die einzig mögliche. Würde nämlich dieselbe unter der Grenze von 60 Metzen erfolgen, so würde B3 vom Tauschgeschäfte nicht ausgeschlossen sein und demnach den aus der Ausbeutung des vorliegenden Verhältnisses resultirenden Nutzen sich zuzueignen bemüht sein, was B1 und B2, die zu höheren Preisen immer noch einen beträchtlichen ökonomischen Nutzen sich zuzuwenden in der Lage sind, als wirthschaftende Subjecte nicht zulassen können; würde der Preis die Grenze von 70 Metzen Getreide erreichen, oder gar übersteigen, so würde B2 sich gar kein, B1 aber nur ein Pferd in ökonomischer Weise austauschen können und demnach nur eines der drei zur Veräusserung gebrachten Pferde thatsächlich zur Veräusserung gelangen können. Die Preisbildung ausserhalb der Grenzen von 60 und 70 Metzen Getreide ist demnach in unserem Falle ökonomisch ausgeschlossen.
Würde nun A anstatt 3 Pferden 6 Pferde zu Markte bringen, so könnten wir in ähnlicher Weise darthun, dass B1 3, B2 [190] 2 Pferde, B3 aber 1 Pferd erstehen, der Preis für ein solches aber zwischen 50 und 60 Metzen Getreide sich bilden müsste; würde aber A 10 Pferde zu Markte bringen, so würde B1 4 Pferde, B2 3 Pferde, B3 2 Pferde, B4 endlich 1 Pferd erstehen, der Preis sich aber zwischen 40 und 50 Metzen Getreide fixiren, und es ist kein Zweifel, dass, wofern der Monopolist A noch grössere Quantitäten des Monopolgutes zur Veräusserung brächte, einerseits eine immer geringere Anzahl der obigen Landwirthe von dem Eintausche von Quantitäten des Monopolgutes ökonomisch ausgeschlossen wäre, andererseits aber auch der Preis einer bestimmten Quantität dieses letzteren immer mehr und mehr herabgedrückt werden würde.
Denken wir uns unter B1 und B2 u. s. f. nicht einzelne Individuen, sondern Repräsentanten von Gruppen der Bevölkerung eines Landes, so zwar, dass wir unter B1 jene Gruppe von wirthschaftenden Individuen verstehen, welche rücksichtlich der beiden oben in Rede stehenden Güter (des Monopolgutes und des Getreides) die tauschkräftigsten und tauschlustigsten, B2 jene Gruppe von wirthschaftenden Individuen, welche in dieser Rücksicht den erstern folgen u. s. f., so steht vor uns das Bild des Monopolhandels, wie uns derselbe unter den gewöhnlichen Lebensverhältnissen thatsächlich vor die Augen tritt.
Wir sehen Bevölkerungsschichten von sehr verschiedener Tauschkraft um die zu Markte gelangenden Quantitäten der Monopolgüter concurriren, sehen dieselben sich, gleich wie diess oben an einzelnen Individuen gezeigt wurde, ökonomisch von dem Eintausche dieser Quantitäten ausschliessen, die Bevölkerungsschichten, welche den Genuss von Monopolgütern entbehren müssen, desto zahlreicher werden, je geringer die zu Markte gebrachte Quantität des Monopolgutes, und umgekehrt die Monopolgüter in um so minder tauschkräftige Bevölkerungsschichten eindringen, je grösser diese Quantität ist, und parallellaufend mit den obigen Erscheinungen die Preise der Monopolgüter steigen und fallen.
Fassen wir das Gesagte zusammen, so ergeben sich die nachfolgenden Grundsätze:
1. Die von einem Monopolisten zur Veräusserung gebrachte [191] Quantität des Monopolgutes gelangt in die Hände derjenigen Concurrenten um dasselbe, für welche die Masseinheiten des Monopolgutes Aequivalente der grössten Quantität des dagegen im Austausche zu bietenden Gutes sind, und vertheilt sich unter dieselben in der Weise, dass für jeden Erwerber von Theilquantitäten des Monopolgutes eine Masseinheit desselben das Aequivalent einer gleichen Quantität des Gegengutes wird (z. B. 1 Pferd gleich 50 Metzen Getreide)
2. Die Preisbildung erfolgt innerhalb der Grenzen, welche durch die Aequivalente einer Masseinheit des Monopolgutes für den am mindest tauschkräftigen und tauschlustigen Concurrenten, welcher noch zum Austausche gelangt, und für den tauschkräftigsten und tauschlustigsten unter jenen Concurrenten, welche vom Austausche ökonomisch ausgeschlossen sind, bezeichnet werden.
3. Je grösser die von dem Monopolisten zur Veräusserung gebrachte Quantität des Monopolgutes ist, um so weniger Concurrenten um das Monopolgut werden von der Erwerbung von Theilquantitäten desselben ökonomisch ausgeschlossen, um so vollständiger wird aber auch die Versorgung jener wirthschaftenden Subjecte, welche auch bei geringeren, zur Veräusserung gebrachten Quantitäten des Monopolgutes Theilquantitäten desselben auszutauschen in der Lage gewesen wären.
4. Je grösser die von dem Monopolisten zur Veräusserung gebrachte Quantität des Monopolgutes ist, in um so weniger tauschkräftige, beziehungsweise tauschlustige Schichten der Concurrenten um dieselbe muss er herabsteigen, um die ganze Quantität abzusetzen, um so niedriger stellen sich demnach auch die Preise der Masseinheiten des Monopolgutes.
c) Einfluss der von dem Monopolisten fixirten Preise auf die in den Verkehrtretenden Quantitäten des Monopolgutes und auf die Vertheilung derselben unter die Concurrenten.
Der Regel nach pflegt der Monopolist nicht bestimmte Quantitäten des Monopolgutes mit der Absicht zu Markte zu bringen, dieselben unter allen Umständen zu veräussern und, gleichwie bei einer Auction, den Erfolg der Mitbewerbung rücksichtlich der Preisbildung abzuwarten. Der gewöhnliche Weg ist [192] vielmehr der, dass er eine Quantität seines Monopolgutes zu Markte bringt, oder zur Veräusserung bereit hält, aber für die einzelnen Masseinheiten derselben selbst bestimmte Preisforderungen stellt. Der Grund hievon ist der Regel nach wohl in practischen Rücksichten zu suchen, zumal in dem Umstande, dass die oben dargestellte Methode der Veräusserung von Gütern, sollen anders die Preise unter Einflussnahme aller hier wirksamen ökonomischen Factoren erfolgen, den gleichzeitigen Zusammentritt einer möglichst grossen Anzahl von Concurrenten um das Monopolgut und zugleich die Beobachtung mannigfacher Förmlichkeiten erfordert, welche die Anwendung derselben nur in einzelnen, nicht allzu häufigen Fällen als zweckmässig erscheinen lässt.
Der Monopolist wird demnach in jenen Fällen, in welchen er auf einen Zusammentritt der sämmtlichen, oder doch einer ausreichenden Anzahl von Concurrenten rechnen kann und die berührten Förmlichkeiten ohne unverhältnissmässige ökonomische Opfer erfüllt werden können, wie dies z B. bei längere Zeit vorher angekündigten Auctionen in dem Hauptemporium eines Monopolartikels der Fall ist, allerdings den oben dargelegten Weg als den sichersten einschlagen, um die gesammte ihm verfügbare Menge des Monopolgutes in ökonomiscnester Weise an den Mann zu bringen, und auch sonst überall dort, wo es ihm um einen vollständigen Ausverkauf grösserer Quantitäten des Monopolgutes innerhalb einer bestimmten Zeitfrist zu thun ist, zur Auction schreiten. Der gewöhnliche Weg, auf welchem der Monopolist seine Waare in den Verkehr bringt, wird indess, wie gesagt, der sein, dass er die ihm verfügbaren Quantitäten des Monopolgutes zwar zur Veräusserung bereit halten, aber Theilquantitäten derselben gegen einen von ihm bestimmten Preis den Concurrenten um dieselben anbieten wird.
Unter solchen Umständen, das ist übeall dort, wo ein Monopolist den Preis 'der Masseinheit des Monopolgutes fixirt und den Concurrenten um dasselbe freistellt, ihren Bedarf an diesem Gute zu diesem Preise zu decken, also die Frage der Preisbildung der Hauptsache nach von vornherein gelöst ist, haben wir zu untersuchen:
Erstens, welche Concurrenten bei der jeweiligen Höhe [193] des Preises einer Masseinheit des Monopolgutes von der Erwerbung von Quantitäten desselben ökonomisch ausgeschlossen sind;
zweitens, welchen Einfluss der höhere, oder niedere, vom Monopolisten fixirte Preis auf die zur Veräusserung gelangenden Quantitäten des Monopolgutes hat, und
drittens, in welcher Weise die thatsächlich abgesetzte Quantität des Monopolgutes sich unter die einzelnen Concurrenten um dasselbe vertheilt?
Hier ist nun zunächst sicher, dass, wofern der Monopolist den Preis einer Masseinheit des Monopolgutes so hoch fixiren würde, dass eine solche selbst für den tauschkräftigsten und tauschlustigsten der vorhandenen Concurrenten um das Monopolgut nicht einen höhern Werth hätte, als der von dem Monopolisten beanspruchte Preis, sämmtliche Concurrenten um das Monopolgut von der Erwerbung irgend welcher Theilquantitäten desselben ausgeschlossen sein würden und ein Absatz des Monopolgutes demnach überhaupt nicht stattfinden könnte. Dies würde bei der durch das mehrerwähnte Schema (S 187) dargestellten Sachlage dann eintreten, wenn der Monopolist A den Preis eines Pferdes z. B. auf 100, oder selbst auch nur auf volle 80 Metzen Getreide fixiren würde, denn es ist klar, dass bei einem solchen Preise die Möglichkeit eines ökonomischen Tausches für keinen der in unserem Falle in Betracht kommenden acht Concurrenten um das Monopolgut vorhanden wäre.
Setzen wir nun aber den Fall, der obige Monopolist fixire den Preis eines Pferdes nicht so hoch, dass sämmtliche Concurrenten um das Monopolgut vom Austausche von Quantitäten desselben ökonomisch ausgeschlossen sein würden, so werden dieselben in ihrem Bestreben, ihre ökonomische Lage zu verbessern, die sich ihnen darbietende Gelegenheit ohne Zweifel ergreifen und innerhalb der im vorigen Capitel dargelegten Grenzen auch thatsächlich Tauschoperationen mit dem Monopolisten eingehen. Es ist aber klar, dass der Umfang derselben durch die Höhe der Preise wesentlich mitbestimmt werden wird. Setzen wir z. B. den Fall, dass A den Preis eines Pferdes auf 75 Metzen Getreide fixiren würde, so ist ersichtlich, dass B1 bereits in der Lage wäre, ein solches in ökonomischer Weise [194] einzutauschen, bei einem Preise von 62 Metzen Getreide B1 zwei Pferde, B2 aber ein Pferd; bei einem Preise von 54 Metzen Getreide: B1 drei, B2 zwei Pferde und B3 ein Pferd; bei einem Preise von 36 Metzen Getreide B1 fünf, B2 vier, B3 drei, B4 zwei Pferde, B5 ein Pferd erstehen wird u. s. f.
Die obige Darlegung, bei welcher wir uns unter B1, B2, B3 und so fort, eben so wohl auch Concurrentengruppen von verschiedener Tauschkraft und Tauschlust vorstellen können, versinnbildlicht uns den Einfluss, welchen die von einem Monopolisten fixirten Preise, je nach der Verschiedenheit ihrer Höhe, auf die Volkswirthschaft äussern, auf das deutlichste. Je höher diese Preise, um so zahlreicher die Individuen, beziehungsweise die Schichten der Bevölkerung, welche von dem Genusse des Monopolgutes vollständig ausgeschlossen sind, um so kärglicher die Versorgung der übrigen Schichten der Bevölkerung, um so geringer aber auch die Quantitäten des Monopolgutes, welche der Monopolist umsetzt, während bei Ermässigung der Preise immer weniger wirthschaftende Subjecte (beziehungsweise Bevölkerungsschichten) von dem Erwerbe von Quantitäten des Monopolgutes vollständig ausgeschlossen werden, die Versorgung der zum Eintausch gelangenden zugleich immer vollständiger wird und der Absatz des Monopolisten fortschreitend wächst. Die genauere Präcisirung findet das oben Gesagte in den nachfolgenden Grundsätzen.
1. Durch den vom Monopolisten fixirten Preis einer Masseinheit des Monopolgutes werden alle jene Concurrenten um das Monopolgut von der Erwerbung von Quantitäten dieses letzteren vollständig ausgeschlossen, für welche eine Masseinheit des Monopolgutes das Aequivalent einer gleichen, oder geringeren Quantität des im Austausche dagegen zu bietenden Gutes ist, als der Preis beträgt.
2. Die Concurrenten um Quantitäten des Monopolgutes, für welche eine Masseinheit desselben das Aequivalent einer grösseren Quantität des dagegen zu bietenden Gutes ist, als der vom Monopolisten fixirte Preis beträgt, versorgen sich bis zu jener Grenze mit Quantitäten des Monopolgutes, wo eine Masseinheit desselben für sie das Aequivalent der durch den Monopolpreis ausgedrückten Quantität des bezüglichen Gutes wird [195] und findet die in die Hände jedes einzelnen dieser Concurrenten übergehende Quantität des Monopolgutes ihr Mass in jener Quantität, rücksichtlich welcher für das betreffende Subject bei den vom Monopolisten fixirten Preisen die Grundlagen zu ökonomischen Tauschoperationen vorhanden sind.
3. Je höher der Preis einer Masseinheit des Monopolgutes vom Monopolisten fixirt wird, um so zahlreichere Schichten von Concurrenten um das Monopolgut werden von dem Erwerbe von Quantitäten desselben ausgeschlossen, um so unvollständiger ist die Versorgung der übrigen Schichten der Bevölkerung mit dem Monopolgute, um so geringer der Absatz des Monopolisten, während im umgekehrten Falle die entgegengesetzten Erscheinungen zu Tage treten.
d) Die Grundsätze des Monopolhandels, (Monopolisten-Politik.)
Wir haben in den beiden vorhergehenden Abschnitten dargelegt, welchen Einfluss die grössere, oder geringere zur Veräusserung gebrachte Quantität des Monopolgutes, beziehungsweise die von Seite des Monopolisten höher, oder niedriger gestellten Preise, in dem ersten Falle auf die Preisbildung, im letzteren auf die in den Verkehr tretenden Quantitäten, in beiden Fällen aber zugleich auch auf die Vertheilung der Monopolgüter unter die einzelnen Concurrenten um dieselben ausüben.
Hiebei haben wir gesehen, dass der Monopolist nicht rücksichtlich sämmtlicher hier zu Tage tretenden ökonomischen Erscheinungen die allein bestimmende und massgebende Persönlichkeit ist. Nicht nur, dass das allgemeine Gesetz alles ökonomischen Gütertausches, wornach bei jedem Tausche beiden Theilen ein wirthschaftlicher Vortheil erwachsen muss, auch beim Monopolhandel seine ungeschmälerte Geltung behält, ist der Monopolist auch innerhalb dieses so begrenzten Spielraumes seiner Beeinflussung der ökonomischen Erscheinungen durchaus nicht völlig unbeschränkt. Der Monopolist kann, wie wir sahen, wofern er bestimmte Quantitäten des Monopolgutes zur Veräusserung bringen will, nicht zugleich die Preise willkürlich fixiren; der Monopolist kann ferner, wofern er die Preise fixirt, nicht zugleich die Quantitäten bestimmen, welche bei diesen Preisen zur Veräusserung gelangen werden. Er kann demnach z. B. nicht grosse [196] Quantitäten des Monopolgutes absetzen und zugleich bewirken, dass sich die Preis so hoch bilden, als dies der Fall wäre, wenn er geringere Quantitäten zur Veräusserung gebracht hätte, und er kann nicht die Preise in bestimmter Höhe fixiren und zugleich den Erfolg herbeiführen, dass er einen so grossen Absatz erziele, als dies bei niedrigeren Preisen der Fall sein würde. Was ihm aber eine exceptionelle Stellung im wirthschaftlichen Leben gibt, das ist der Umstand, dass er in jedem gegebene Falle die Wahl hat, entweder die in den Verkehr gelangenden Quantitäten des Monopolgutes, oder aber die Preise dieses letzteren, allein und ohne Einflussnahme anderer wirthschaftenden Subjecte, je nach dem dies die Rücksichtsnahme auf seinen ökonomischen Vortheil erfordert, zu bestimmen, und es demnach in seiner Hand hat, entweder dadurch, dass er geringere, oder grössere Quantitäten des Monopolgutes in den Verkehr bringt, die Preise, oder dadurch, dass er die Preise höher, oder niedriger stellt, die in den Verkehr gelangenden Quantitäten des Monopolgutes, je nach seinem ökonomischen Interesse, zu regeln.
Die Preise des Monopolisten werden demnach innerhalb der durch den ökonomischen Charakter der Tauschoperationen gezogenen Grenzen emporschnellen, wenn er sich davon, dass er geringe Quantitäten des Monopolgutes bei hoben Preisen zur Veräugserung bringt, einen grösseren ökonomischen Nutzen verspricht, und er wird mit seinen Preisen herabgehen, falls es ihm vortheilhafter erscheint, grössere Quantitäten des Monopolgutes zu geringeren Preisen in den Verkehr zu bringen. Er wird im Anfange die Preise möglichst hoch stellen und solcherart nur geringe Quantitäten des Monopolgutes in den Verkehr bringen, und später die Preise nur allmählig bei wachsendem Absatze ermässigen, um solcherart alle Schichten der Gesellschaft nach und nach auszubeuten, falls er sich auf diese Weise den höchsten ökonomischen Nutzen zuwenden kann. Er wird umgekehrt sofort grosse Quantitäten des Monopolgutes bei niedrigen Preisen in den Verkehr bringen, wenn sein ökonomischer Vortheil ihm dies gebietet. Ja, er wird unter Umständen Veranlassung finden, einen Theil der ihm verfügbaren Quantität des Monopolgutes, anstatt denselben in den Verkehr zu bringen, der Vernichtung preiszugeben, oder, was mit Rücksicht auf [197] den Erfolg dasselbe ist, einen Theil der bezüglichen Productionsmittel, über welche er verfügen kann, statt sie zur Production des Monopolgutes zu verwenden, ruhen zu lassen, oder zu zerstören, falls er dadurch, dass er die ganze ihm unmittelbar, oder mittelbar verfügbare Quantität des Monopolgutes in den Verkehr brächte, zu Schichten der Bevölkerung hinabsteigen müsste, die so wenig tauschkräftig, oder tauschlustig sind, dass er bei den hiedurch bedingten niederen Preisen, trotz der in den Verkehr gebrachten grösseren Quantitäten des Monopolgutes, doch einen geringeren Erlös erzielen würde, als dadurch, dass er einen Theil der ihm verfügbaren Quantität des Monopolgutes vernichtet und nur den Rest zu höheren Preisen an die tauschkräftigeren Schichten der Bevölkerung veräussert [4].
[198]
Die Politik aller Monopolisten, wenn anders dieselben wirthschaftende Individuen sind, die ihren Vortheil wahrnehmen, geht naturgemäss weder dahin, möglichst niedrige Preise zu fixiren, noch auch möglichst grosse Quantitäten des Monopolgutes umzusetzen. Sie geht weder darauf hin, das Monopolgut möglichst vielen wirthschaftenden Individuen, beziehungsweise Grup pen von solchen zugänglich zu machen, noch auch die einzelnen Individuen möglichst vollständig mit dem Monopolgute zu versorgen. An all' dem hat der Monopolist kein wirthschaftliches Interesse. Seine Wirthschaftspolitik geht rücksichtlich der ihm verfügbaren Quantitäten des Monopolgutes auf den möglichst grossen Erlös. Er bringt demnach nicht die ganze ihm verfügbare Quantität des Monopolgutes, sondern nur eine solche zur Auction, von deren Veräusserung er sich, bei der zu erwartenden Preisbildung, den grössten Erlöss verspricht. Er fixirt die Preise nicht eben nur so hoch, um die ganze ihm verfügbare Quantität des Monopolgutes umzusetzen, sondern in einer solchen Weise, welche ihm den grössten Erlös verspricht, und seine Wirthschaftspolitik wird offenbar dann die richtigste sein, wenn er nur solche Quantitäten des Monopolgutes zur Veräusserung bringt, beziehungsweise die Höbe der Preise in solcher Weise fixirt, dass der obige Erfolg in dem einen, wie in dem anderen Falle eintritt.
Unrichtig wäre vom monopolitischen Standpunkte jedenfalls seine Politik, wenn, trotzdem er für geringere in den Verkehr gelangende Quantitäten des Monopolgutes einen höheren Erlös erzielen könnte, er doch eine grössere Quantität zur Veräusserung brächte, noch unökonomischer, falls er, anstatt sich in der Production des Monopolgutes auf jene Quantitäten zu beschränken, deren Veräusserung ihm den höchsten Gewinn verspricht, mit Aufwendung ökonomischer Güter, also mit seinerseits zu bringenden Opfern, diese Quantität vermehren und dadurch bewirken möchte, dass sein Erlös nichtsdestoweniger ein geringerer würde. Unrichtig wäre es, falls er die Preise so niedrig stellen würde, [199] dass er zwar grössere Quantitäten umsetzen, aber dafür einen geringeren Erlös erzielen würde, als wofern er höhere Preise fixirt hätte, unrichtig vor allem wäre es, wenn er die Preise des Monopolgutes so tief stellen würde, dass er nicht sämmtliche Concurrenten um das Monopolgut, für welche bei diesen Preisen die Grundlagen zu ökonomischen Täuschen vorliegen, mit der ihm verfügbaren Quantität des Monopolgutes versorgen könnte und einige derselben leer ausgehen würden, denn es wäre dies ein deutlicher Beweis dafür, dass er die Preise zu tief gestellt habe.
Bekräftigt wird das hier Gesagte durch Erfahrung und Geschichte. Die Politik aller Monopolisten hat sich innerhalb der obigen, ihrer ökonomischen Thätigkeit klar vorgezeichneten Grenzen bewegt. Wenn die holländisch-ostindische Compagnie im siebzehnten Jahrhundert einen Theil der Gewürzpflanzen auf den Molukken ausrotten liess, und auch sonst häufig grosse Mengen von Gewürzen in Ostindien und von Tabak in Nordamerika verbrannt wurden, wenn die Zünfte durch allerhand Mittel die Zahl der Gewerbtreibenden möglichst zu beschranken suchten (lange Lehrzeit, Verbot, mehr als eine bestimmte Anzahl von Lehrjungen zu halten etc.), so waren dies insgesammt, vom monopolistischen Standpunkte aus betrachtet, richtige Massregeln, um die in den Verkehr gelangenden Quantitäten der bezüglichen Monopol-Waaren in einer für die Interessen der Monopolisten, oder der Corporationen von solchen, günstigen Weise zu regeln. Als durch die freiere Gestaltung des Verkehrs, durch den Fabriksbetrieb und andere hier Einfluss nehmende Umstände, den Zünften die selbständige Regulirung der in den Verkehr gelangenden Güterquantitäten unmöglich gemacht worden war, wurde desshalb auch die ganze Zunftorganisation, soweit sie einen monopolistischen Charakter hatte, wirkungslos. Die monopolistischen Taxen u. dgl. die Preisbildung direct beeinflussenden Momente mussten der Gewalt der grösseren in den Verkehr tretenden Güterquantitäten sofort weichen. Ursprünglich zunächst darauf berechnet, einzelne das Interesse der ganzen Zunft, beziehungsweise das Interesse der Gesammtheit der Monopolisten verkennende Individuen, (Preisverderber!) in die der monopolistischen Gruppe nützlichen [200] Schranken zurückzuweisen, wurden dieselben, sobald die Regulirung der zu Markte gebrachten Quantitäten den Zünften aus der Hand genommen war, in sich unhaltbar. Die ihren Interessen entsprechende Regulirung der in den Verkehr gelangenden Quantitäten von Gewerbserzeugnissen war deshalb stets die eifrigste Sorge aller Zunftgenossen, diejenigen, welche sie in dieser Regulirung störten, galten ihnen stets als ihre gefährlichsten Gegner, gegen wolche sie unaufhörlich den Schutz der Regierungen anriefen, und der Durchbruch dieser ihrer regulirenden Thätigkeit durch die von der Grossindustrie in den Verkehr geworfenen Quantitäten von Gewerbserzeugnissen bedeutete den Untergang des Zunftwesens.
Fassen wir das in diesem Abschnitte Gesagte zusammen, so ergibt sich, dass bei jeder Seitens des Monopolisten zur Veräusserung gebrachten Quantität des Monopolgutes sich die Preisbildung, und bei jeder von dem Monopolisten fixirten Preishöhe der Masseinheit des Monopolgutes die in den Verkehr gelangende Quantität desselben, in beiden Fällen aber auch die Gütervertheilung nach bestimmten Gesetzen regelt und die hiebei zu Tage tretenden ökonomischen Erscheinungen demnach durchaus keinen zufälligen, sondern einen streng gesetzmässigen Charakter haben.
Aber auch der Umstand, dass der Monopolist es in seiner Hand hat, je nach seiner Wahl entweder die Preise, oder die zur Veräusserung gelangenden Quantitäten des Monopolgutes zu reguliren, schliesst, wie wir sahen, doch durchaus keine Unbestimmtheit bezüglich der hieraus resultirenden ökonomischen Erscheinungen in sich.
Der Monopolist hat es allerdings in seiner Hand, höhere, oder niedrigere Preise zu fixiren, grössere, oder geringere Quantitäten des Monopolgutes zur Veräusserung zu bringen, aber nur eine bestimmte Preisfixirung, nur eine bestimmte zu Markte gebrachte Quantität des Monopolgutes entspricht seinen ökonomischen Interessen am vollständigsten. Der Monopolist geht deshalb, wenn anders er ein wirthschaftendes Subject ist, auch in Bezug auf die Preisforderung, beziehungsweise rücksichtlich der zur Veräusserung gelangenden Quantitäten des Monopolgutes, durchaus nicht willkürlich, sondern nach bestimmten [201] Grundsätzen vor. Jede gegebene ökonomische Sachlage fördert eine innerhalb bestimmter Grenzen sich bewegende Preisbildung und Gütervertheilung zu Tage, jede andere Preisbildung und Gütervertheilung ist ökonomisch ausgeschlossen und es bieten uns somit die Erscheinungen des Monopolhandels in jeder Beziehung das Bild strenger Gesetzmässigkeit. Irrthum und mangelhafte Erkenntniss können wohl auch hier Abweichungen zu Tage fördern, es sind dies indess dann pathologische Erscheinungen der Volkswirthschaft, welche ebensowenig gegen die Gesetze der Volkswirthschaftslehre beweisen, als die Erscheinungen am kranken Körper gegen die Gesetze der Physiologie.
§. 3.
Preisbildung und Gütervertheilung bei beiderseitiger Concurrenz.
a) Die Entstehung der Concurrenz.
Man würde den Begriff des Monopolisten viel zu enge auffassen, wollte man denselben auf jene Personen beschränken, welche gegen die Concurrenz anderer wirthschaftender Subjecte durch die Staatsgewalt, oder sonst in gesellschaftlicher Weise geschützt sind. Es giebt Personen, welche durch ihren Besitz, oder in Folge eigenthümlicher Fähigkeiten und Verhältnisse Güter zu Markte bringen können, rücksichtlich welcher andere wirthschaftende Personen, durch die physische, oder ökonomische Unmöglichkeit, ein Gleiches zu thun, von der Concurrenz im Anbote an und für sich ausgeschlossen sind. Aber auch dort, wo solche eigenthümliche Verhältnisse nicht vorhanden sind, können ohne jede gesellschaftliche Beschränkung Monopolisten erstehen. Jeder Handwerksmann, der sich in einem Orte, wo Seinesgleichen noch nicht bestehen, etablirt, jeder Kaufmann, Arzt oder Rechtsanwalt, der sich in einem Orte niederlässt, wo bisher noch Niemand sein Gewerbe, oder seine Kunst ausübt, ist in einem gewissen Sinne Monopolist, denn die von ihm der Gesellschaft zum Austausch angebotenen Güter können, zum mindesten in zahlreichen Fällen, eben nur bei ihm erstanden werden. Die Chroniken mancher blühenden Städte wissen uns nicht selten von dem ersten Kunstweber zu erzählen, der sich, als die Ortschaft noch klein und schwach bevölkert war, daselbst angesied elt, [202] und noch jetzt kann der Reisende in Osteuropa und selbst bei uns in kleinern Ortschaften der in Rede stehenden eigenthümlichen Gattung von Monopolisten auf Schritt und Tritt begegnen. Das Monopol, als factischer Zustand und nicht als gesellschaftliche Beschränkung der freien Concurrenz aufgefasst, ist demnach der Regel nach das ältere, das ursprünglichere, die Concurrenz das der Zeitfolge nach spätere und der Darsteller der eigenthümlichen Erscheinungen des Tauschhandels unter dem Vorherrschen der Concurrenz wird demnach mit Vortheil an die Erscheinungen des Monopolhandels anknüpfen.
Die Art und Weise, in welcher sich die Concurrenz aus dem Monopol entwickelt, hängt innig mit dem Fortschritte der wirthschaftlichen Cultur zusammen. Das Anwachsen der Bevölkerung, die gesteigerten Bedürfnisse der einzelnen wirthschaftenden Individuen, ihr steigender Wohlstand, zwingen den Monopolisten in zahlreichen Fällen, selbst bei gesteigerter Production, immer mehr Schichten der Bevölkerung von dem Genusse des Monopolgutes auszuschliessen, gestatten ihm gleichzeitig, seine Preise immer mehr und mehr emporzuschrauben und die Gesellschaft wird solcherart zu einem immer günstigeren Objecte für seine monopolistische Ausbeutungspolitik Ein erster Handwerker irgend einer bestimmten Art, ein erster Arzt, ein erster Rechtsfreund ist in jedem Orte ein willkommener Mann. Wenn derselbe indess keiner Concurrenz begegnet während gleichzeitig der Ort aufblüht, wird er fast ohne Ausnahme nach einiger Zeit bei den minder wohlhabenden Schichten der Bevölkerung in den Ruf eines harten und selbstsüchtigen Mannes kommen und selbst bei den wohlhabenderen Bewohnern des Ortes für eigennützig gelten. Dem wachsenden Bedarf der Gesellschaft nach seinen Waaren, (beziehungsweise nach seinen Dienstleistungen,) kann der Monopolist nicht immer entsprechen und, wenn er es vermag, liegt eine entsprechende Vermehrung seines Absatzes, wie wir sahen, nicht immer in seinem ökonomischen Interesse. Er wird demnach in den meisten Fällen dazu geführt werden, eine Auswahl zwischen seinen Kunden zu treffen und ein Theil der Concurrenten um sein Monopolgut wird entweder ganz leer ausgehen, oder damit doch nur widerwillig und schlecht versorgt werden und selbst die wohlhabenderen Kunden werden [203] oft über Vernachlässigungen aller Art und über die Kostspieligkeit der Dienstleistungen zu klagen haben.
Die eben dargelegte wirthschaftliche Sachlage pflegt nun zugleich auch diejenige zu sein, welche, mit dem Bedürfnisse nach der Concurrenz, wo immer nicht gesellschaftliche, oder sonstige Hindernisse dem entgegenstehen, die Concurrenz selbst hervorruft und es wird unsere Aufgabe sein, die Wirkungen zu untersuchen, welche das Auftreten derselben auf die Gütervertheilung, den Umsatz und den Preis einer Waare, im Vergleiche zu den analogen, beim Monopolhandel beobachteten Erscheinungen, ausüben.
b) Wirkung der von den Concurrenten im Anbote zur Veräusserung gebrachten Quantitäten einer Waare auf die Preisbildung, und bestimmter von ihnen fixirten Preise auf den Absatz und in beiden Fällen auf die Vertheilung der Waare unter die Concurrenten um dieselbe [5].
Nehmen wir, um der leichtern Uebersichtlichkeit willen, den bei der Darlegung der Gesetze des Monopolhandels beispielsweise angeführten Fall auch hier zur Grundlage unserer Darstellung, so ergiebt sich das nachfolgende Schema:
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metzen Getreide. | ||||||||
| B1 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
| B2 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | |
| B3 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | ||
| B4 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | |||
| B5 | 40 | 30 | 20 | 10 | ||||
| B6 | 30 | 20 | 10 | |||||
| B7 | 20 | 10 | ||||||
| B8 | 10 | |||||||
in welchem B1, B2, B3 etc. einzelne Landleute, oder Gruppen von solchen darstellen, für welche ein jedes erste in ihre Verfügung tretende Pferd ein Aequivalent der daneben gestellten Quantität von Getreide, jedes weitere Pferd das Aequivalent einer um 10 Metzen Getreide geringern Quantität ist, und es fragt sich nunmehr, welchen Einfluss die grössern, oder geringern, [204] von mehreren Concurrenten im Anbote zur Veräusserung gebrachten Quantitäten einer Waare auf die Preisbildung, beziehungsweise auf die Vertheilung der bezüglichen Waare unt er die Concurrenten um dieselbe haben werden.
Nehmen wir nun zunächst an, es seien zwei Concurrenten im Anbote A1 und A2 vorhanden und dieselben brächten zusammen 3 Pferde zur Veräusserung, wovon A1 2 Pferde und A2 1 Pferd; so ist nach dem, was wir oben sagten, klar, dass in diesem Falle der Landwirth B1 2 Pferde, der Landwirth B2 aber 1 Pferd und zwar zu Preisen erstehen wird, welche zwischen 70 und 60 Metzen Getreide sich bilden werden, indem ein höherer Preis durch das ökonomische Interesse der beiden Landleute B1 und B2, ein niederer Preis durch die Concurrenz des B3 ausgeschlossen ist. Nehmen wir den Fall, dass A1 und A2 6 Pferde zur Veräusserung bringen, so ist nicht minder sicher, dass B1 hievon 3, B2 2 und B3 1 Stück erstehen, der Preis aber sich zwischen 60 und 50 Metzen Getreide stellen wird u. s. f. [6].
Vergleichen wir die hier mit Rücksicht auf bestimmte, von mehreren Concurrenten zur Veräusserung gebrachte Quantitäten einer Waare erfolgende Preisbildung und Gütervertheilung mit jener, welche wir beim Monopolhandel beobachtet haben, so begegnen wir einer vollständigen Analogie. Ob ein Monopolist, oder aber mehrere Concurrenten im Anbote eine bestimmte Quantität einer Waare zur Veräusserung bringen, und in welcher Weise diese Quantität auch immer unter die einzelnen Concurrenten im Anbote vertheilt ist, die Wirkung auf die Preisbildung. [205] beziehungsweise auf die Gütervertheilung unter die Concurrenten um die bezügliche Waare ist immer die gleiche.
Die grössere oder geringere zur Veräusserung gebrachte Quantität eines Gutes hat demnach allerdings einen sehr bestimmenden Einfluss auf die Preisbildung und auf die Gütervertheilung beim Monopolhandel sowohl, wie bei dem Tauschhandel unter dem Einflusse der Concurrenz, ob aber eine bestimmte Quantität einer Waare von einem Monopolisten allein, oder von mehreren Concurrenten im Anbote zusammengenommen zur Veräusserung gebracht wird, hat keinen Einfluss auf die eben erwähnten Erscheinungen des wirthschaftlichen Lebens.
Ein Gleiches können wir dort beobachten, wo Waaren zu bestimmten Preisen angeboten werden.
Die grössere, oder geringere Höhe der Preise hat, wie wir sahen, einen sehr wichtigen Einfluss auf den Gesammtabsatz der betreffenden Waare sowohl, als auch auf die Quantität, welche jeder einzelne Concurrent um dieselbe thatsächlich erwerben wird; ob aber die Waaren (bei den so fixirten Preisen) von einem einzelnen, oder von mehreren wirthschaftenden Subjecten zu Markte gebracht werden, hat weder auf den Absatz im Ganzen, noch auch auf die Quantitäten, welche in die Hände der einzelnen wirthschaftenden Individuen übergehen, einen unmittelbaren und nothwendigen Einfluss.
Die Grundsätze, welche wir bezüglich der Einwirkung bestimmter, zur Veräusserung gebrachter Quantitäten einer Monopolwaare auf die Preisbildung (S. 186) und jene, welche wir bezüglich bestimmter Preise auf den Absatz derselben (S. 191 ff.), in beiden Fällen aber auch auf ihre Vertheilung unter die einzelnen Concurrenten um dieselbe, entwickelt haben, sind demnach ihrem vollen Inhalte nach auch für alle jene Fälle anwendbar, wo eine Anzahl von wirthschaftenden Subjecten (Concurrenten in der Nachfrage) um die ihnen von mehreren anderen wirthschaftenden Subjecten (Concurrenten im Anbote) zum Austausch angebotenen Quantitäten einer Waare in Concurrenz treten.
[206]
c) Rückwirkung der Concurrenz im Anbote eines Gutes auf die zur Veräusserung gelangenden Quantitäten desselben, beziehungsweise auf die Anbotpreise (Concurrenz-Politik.)
Dass bei jeder bestimmten, zur Veräusserung gebrachten Quantität eines Gutes sich bestimmte Preise bilden, und bei jeder Preisfixirung ein bestimmter Absatz, in beiden Fällen aber auch eine bestimmte Gütervertheilung zur Erscheinung gelangt, und dass in dieser Rücksicht es gleichgiltig ist, ob die betreffenden Quantitäten des in Rede stehenden Gutes von einem Monopolisten, oder mehreren Concurrenten im Anbote zu Markte gebracht werden, haben wir soeben dargelegt.
Ob demnach z. B. 1000 Masseinheiten eines Gutes von einem Monopolisten, oder von mehreren Concurrenten im Anbote zur Veräusserung gebracht werden, die Preisbildung und Gütervertheilung werden in beiden Fällen, unter sonst gleichen Verhältnissen, gleich sein; ob eine Waare von einem Monopolisten, oder von mehreren Concurrenten zu einem bestimmten Preise, z. B. zum Preise von drei Masseinheiten des Gegengutes für eine Masseinheit der erstern, ausgeboten wird, der Absatz wird in beiden Fällen ein gleich grosser, die Vertheilung der abgesetzten Quantitäten unter die einzelnen Concurrenten um das in Rede stehende Gut die nämliche sein.
Wenn demnach die Concurrenz im Anbote überhaupt welche Wirkungen auf die Preisbildung, den Gesammtabsatz und die Vertheilung eines Gutes unter die Concurrenten um dasselbe äussern soll, so kann dies nur in der Weise erfolgen, dass unter der Herrschaft der Concurrenz im Anbote, entweder andere Quantitäten des betreffenden Gutes zur Veräusserung gelangen, oder aber die Concurrenten im Anbote der Gesellschaft andere Preise zu stellen sich genöthigt sehen, als dies beim Monopolhandel der Fall ist.
Der Einfluss der Concurrenz im Anbote einer Waare auf die zur Veräusserung gelangenden Quantitäten und die Vertheilung derselben, beziehungsweise auf die Ausbotpreise, ist nun der Gegenstand, der uns in dem Nachfolgenden besehäftigen wird.
Fassen wir zur vollständigen Klarstellung der hier hervortretenden [207] ökonomischen Erscheinungen den einfachen Fall in's Auge, dass die einem Monopolisten verfügbare Quantität des Monopolgutes plötzlich in die Hände zweier Concurrenten gelangen würde. Ein Monopolist ist gestorben und hat seine Monopolgüter und Productionsmittel zwei Erben zu gleichen Theilen hinterlassen—dies wäre ein solcher Fall, wie wir ihn eben hingestellt haben. Nun ist es nicht unmöglich, dass die beiden Erben des Monopolisten, anstatt gegenseitig zu concurriren, die oben dargelegte Monopolpolitik des Erblassers gemeinschaftlich fortsetzen, oder aber zur gemeinsamen Ausbeutung der Consumenten in ein gegenseitiges Einverständniss treten und dann gemeinsam die Quantitäten der zur Veräusserung gelangenden Güter, beziehungsweise die Preise derselben reguliren werden. Es ist auch nicht undenkbar, dass dieselben ohne ausdrückliche Uebereinkunft „in dem gegenseitigen wohlverstandenen Interesse“ die obige monopolistische Politik, soweit sie dieselbe in ihrem eigenen ökonomischen Interesse gelegen finden, gegen ihre Kunden beobachten werden. In diesen beiden Fällen, die wir in der wirthschaftlichen Entwickelung der Menschen aller Orten beobachten können [7], würden dann allerdings dieselben Erscheinungen zu Tage treten, welche wir oben beim Monopolhandel beobachten konnten; die bezüglichen wirthschaftenden Subjecte wären aber dann eben keine Concurrenten im Anbote, sondern Monopolisten, und von diesen ist hier nicht die Rede. Setzen wir aber den Fall, jeder der beiden Erben des Monopolisten sei entschlossen, in selbständiger Weise den Vertrieb des bisherigen Monopolgutes [208] fortzusetzen, so haben wir einen Fall der wirklichen Concurrenz vor uns und es fragt sich, welche Quantitäten des bisherigen Monopolgutes werden nunmehr im Gegensatze zu der frühern Sachlage zur Veräusserung gelangen, beziehungsweise welche Preise im Anbote von den beiden Concurrenten fixirt werden?
Wir haben im vorigen Abschnitte esehen, dass es nicht selten im ökonomischen Interesse des Monopolisten liegt, Theilquantitäten der ihm verfügbaren Menge des Monopolgutes nicht in den Verkehr zu bringen, das ist, dieselben zu zerstören, oder sonst dem Verderben preiszugeben, weil er für eine geringere Quantität desselben am Markte nicht selten einen grösseren Erlös erzielen kann, als wenn er die ganze ihm verfügbare Quantität bei niedrigeren Preisen zur Veräusserung bringen würde. Ein Monopolist verfügt über 1000 Pfund einer Monopolwaare. Derselbe kann nach der gegebenen ökonomischen Sachlage 800 Pfund zum Preise von je 9 Loth Silber absetzen, während er die ganze ihm verfügbare Quantität der Monopolwaare nur zu je 6 Loth Silber an den Mann bringen könnte. Es steht demnach in seiner Hand, 6000 Loth Silber für die ganze ihm verfügbare Quantität der Monopolwaare, oder 7200 Loth Silber für 800 Pfund derselben zu lösen. Die Wahl, die der Monopolist, falls er ein wirthschaftendes Subject ist, das seine Interessen wahrnimmt, hier treffen wird, ist nicht zweifelhaft. Er wird 200 Pfund seiner Monopolwaare vernichten, dem Verderben preisgeben, oder aber in sonstiger Weise dem Verkehre entziehen und nur die erübrigenden 800 Pfund zur Veräusserung bringen, oder, was dasselbe ist, solche Preise stellen, bei welchen der eben bezeichnete Erfolg eintritt.
Werden nun aber die in Rede stehenden 1000 Pfund der bisherigen Monopolwaare zwischen zwei Concurrenten getheilt, so wird die obige Politik für jeden einzelnen dieser letztern sofort ökonomisch unmöglich sein. Würde nämlich der eine von beiden einen Theil der ihm verfügbaren Quantität vernichten, oder sonst dem Verkehre entziehen, so würde er dadurch allerdings eine gewisse Preissteigerung einer Masseinheit seiner Waare hervorrufen, was er aber nicht, oder doch nur in sehr seltenen Fällen zu bewirken vermöchte, ist die Erzielung eines höheren Erlöses auf diesem Wege. Setzen wir den Fall, A1, der erste [209] der beiden Concurrenten, würde von den ihm verfügbaren 500 Pfund des Monopolgutes 200 Pfund vernichten, oder sonst dem Verkehre entziehen, so würde er hiedurch allerdings bewirken können, dass der Preis einer Masseinheit des in Rede stehenden Gutes z. B. von 6 auf 9 Loth Silber steigen, nicht aber, dass ihm ein grösserer Gesammterlös zufallen würde; der Erfolg seiner Massregel wäre nämlich, dass A2 für seine 500 Pfund, statt 3000 Loth Silber, 4500 Loth Silber, er selbst aber für die ihm erübrigenden 300 Masseinheiten (statt 3000) nur 2700 Loth Silber im Austausch erlangen, also der beabsichtigte Nutzen lediglich seinem Concurrenten zufallen, ihm selbst aber ein beträchtlicher Schaden erwachsen würde.
Die erste Folge des Auftretens einer jeden wahren Concurrenz im Anbote ist demnach, dass keiner der Concurrenten im Anbote einen ökonomischen Vortheil daraus ziehen kann, dass er etwa einen Theil der ihm verfügbaren Quantität einer Waare der Vernichtung preisgiebt, dem Verkehre entzieht, oder, was dasselbe ist, die ihm zur Erzeugung derselben verfügbaren Productionsmittel ungenützt lässt.
Auch eine zweite dem Monopol eigenthümliche Erscheinung des wirthschaftlichen Lebens wird durch die Concurrenz beseitigt, wir meinen die successive Ausbeutung der verschiedenen Gesellschaftsschichten, von der wir im vorigen Capitel gesprochen haben. Haben wir nämlich gesehen, dass es für den Monopolisten nicht selten vortheilhaft sein kann, im Anfange nur geringe Quantitäten des Monopolgutes bei hohen Preisen in den Verkehr zu bringen, und nur nach und nach minder tauschkräftige Schichten der Bevölkerung zum Tausche hinzuzulassen, um so aile Schichten der Bevölkerung allmälig auszubeuten, so ist ein solches Vorgehen durch die Concurrenz sofort unmöglich gemacht. Würde nämlich A1 trotz der Concurrenz des A2 eine solche stufenweise Ausbeutung der Gesellschaftsschichten versuchen und im Anfange nur geringe Quantitäten des bezüglichen Gutes in den Verkehr bringen, so würde er hiedurch nicht etwa bewirken, dass die Preise bis zu jener Grenze emporschnellen würden, wo ihm ein Nutzen erwächst, sondern nur den Erfolg herbeiführen, dass sein Concurrent die so geschaffenen Lücken [210] ausfüllen und den beabsichtigten ökonomischen Nutzen sich zueignen würde.
Was immer demnach die Wirkungen jeder wahren Concurrenz auf die Gütervertheilung und Preisbildung sind, so viel steht zunächst fest, dass durch dieselbe jene zwei für die Gesellschaft verderblichsten Auswüchse des Monopolhandels, von denen wir oben sprachen, jedenfalls beseitigt werden. Weder die Vernichtung eines Theiles der verfügbaren Quantität der Waare, rücksichtlich welcher Concurrenz im Anbote besteht, noch auch die Vernichtung eines Theiles der zu ihrer Hervorbringung dienlichen Mittel liegt im Interesse der einzelnen Concurrenten und die allmählige Ausbeutung der verschiedenen Gesellschaftsschichten wird unmöglich.
Aber noch eine andere viel wichtigere Folge für das wirthschaftliche Leben der Menschen hat das Auftreten der Concurrenz. Ich meine die Vermehrung der den wirthschaftenden Menschen verfügbaren Quantitäten der bis dahin monopolisirten Waare. Das Monopol hat zur Folge, dass der Regel nach nur ein Theil der dem Monopolisten verfügbaren Quantität der Monopolgüter zur Veräusserung gelangt, beziehungsweise nur ein Theil der ihm verfügbaren Productivmittel in Thätigkeit versetzt wird; diesen Uebelstand beseitigt sofort jede wahre Concurrenz. Aber sie hat den weiteren Erfolg, dass sie die verfügbare Quantität der bis dahin monopolisirten Waare überhaupt steigert. Es ist jedenfalls eine sehr seltene Erscheinung, dass die zwei, oder mehreren Concurrenten im Anbote zusammengenommen verfügbaren Productionsmittel so eng begrenzt sind, als diejenigen, über welche ein Monopolist verfügt und die Quantität einer Waare, über welche mehrere Concurrenten zusammengenommen verfügen können, ist demnach in der weitaus grössern Mehrzahl der Fälle bedeutend grösser, als diejenige, welche ein Monopolist zu Markte zu bringen vermag. Das Auftreten einer jeden wahren Concurrenz hat demnach zur Folge, dass nicht nur die gesammte verfügbare Quantität einer Waare thatsächlich zur Veräusserung gelangt, sondern auch den weitern viel wichtigeren Erfolg, dass sie diese letztere noch überdiess bedeutend steigert, solcherart, wenn anders nicht eine natürliche Beschränkung der Productionsmittel vorliegt, immer mehr [211] und mehr Gesellschaftskreise bei sinkenden Preisen zur Consumtion des Artikels gelangen und die Versorgung der Gesellschaft überhaupt eine immer vollständigere wird [8].
Auch in der Tendenz der ökonomischen Thätigkeit der bei der Erzeugung eines Gutes betheiligten wirthschaftenden Personen findet durch das Auftreten der Concurrenz ein mächtiger Umschwung statt. Dem Monopolisten ist naturgemäss das Bestreben eigen, seine Monopolgüter nur den höhern Gesellschaftsschichten zugänglich zu machen und alle minder tauschkräftigen Schichten der Gesellschaft vom Genusse derselben auszuschliessen, weil es für ihn der Regel nach viel vortheilhafter und immer bequemer ist, grosse Gewinne an geringern, als geringe Gewinne an grössern Quantitäten zu erzielen; die Concurrenz, welche selbst den geringsten ökonomischen Gewinn, wo immer er möglich ist, auszubeuten bemüht ist, hat dagegen die Tendenz, mit den Gütern in so tiefe Gesellschaftskreise herabzusteigen, als die jeweilige ökonomische Sachlage dies nur immer gestattet. Der Monopolist hat die Regelung der Preise, beziehungsweise [212] der in den Verkehr gelangenden Quantitäten des Monopolgutes innerhalb gewisser Grenzen in der Hand und verzichtet bereitwillig auf den kleinen Gewinn, der sich an Gütern machen lässt, die für den Consum der ärmern Volks, hichten berechnet sind, um die tauschkräftigern um so besser ausbeuten zu können. Bei der Concurrenz dagegen, wo kein einzelner Producent die Regelung der Preise, beziehungsweise der in den Verkehr gelangenden Quantitäten eines Gutes selbständig in seiner Hand hat, ist dem einzelnen Concurrenten selbst der geringste Gewinn erwünscht und die Ausbeutung der vorhandenen Möglichkeit, solche Gewinne zu machen, wird nicht ferner versäumt. Die Concurrenz führt denn auch zu der Production im Grossen mit ihrer auf viele kleine Gewinne gerichteten Tendenz und ihrem hohen Grade von Wirthschaftlichkeit, denn je geringer der Gewinn bei dem einzelnen Gute, um so gefährlicher wird jeder unökonomische Schlendrian, und je heftiger die Concurrenz, um so weniger möglich der gedankenlose Fortbetrieb der Geschäfte nach altgewohnten Methoden.
[213]
Sechstes Capitel.
Gebrauchswerth und Tauschwerth.↩
a) Ueber das Wesen des Gebrauchswerthes und des Tauschwerthes.
So lange die wirthschaftliche Entwickelung eines Volkes so tief steht, dass bei dem Mangel eines jeden nennenswerthen Verkehrs der Güterbedarf der einzelnen Familien direct durch ihre eigene Production gedeckt werden muss, haben die Güter für die wirthschaftenden Subjecte selbstverstandlich nur unter der Voraussetzung Werth, dass sie ihrer inneren Natur nach geeignet sind, Bedürfnisse der isolirt wirthschaftenden Individuen, oder solche ihrer Familien [1], in direoter Weise zu befriedigen. Wenn aber die wirthschaftenden Menschen in Folge der fortschreitenden Erkenntniss ihrer ökonomischen Interessen in Verkehr mit einauder treten, Güter gegen Güter zu tauschen beginnen und sich schliesslich ein Zustand ergibt, in welchem der Besitz von ökonomischen Gütern denjenigen, welche über dieselben verfügen, die Macht gibt, durch Zuhilfenahme von Tauschoperationen über Güter anderer Art zu verfügen, dann ist es zur Sicherstellung der Befriedigung bestimmter Bedürfnisse nicht mehr unbedingt erforderlich, dass die wirthschaftenden Individuen über die zur direoten Befriedigung dieser letztern erforderlichen Güter verfügen. Unter entwickelten Culturverhältnissen können die wirthschaftenden Subjecte sich die Befriedigung ihrer Bedürfnisse zwar vor wie nach dadurch sicher stellen, dass sie sich in den Besitz solcher Güter setzen, welche bei directer Verwendung jenen Erfolg herbeiführen, den wir die Befriedigung dieser Bedürfnisse nennen, sie können denselben Erfolg aber auch in indirecter Weise herbeiführen, indem sie Güter ihrer Verfügung unterwerfen, welche je [214] nach der ökonomischen Sachlage geeignet sind, gegen die obigen zur directen Befriedigung der in Rede stehenden Bedürfnisse erforderlichen Güter umgetauscht zu werden, und es entfällt somit die obige besondere Voraussetzung des Güterwerthes.
Nun ist der Werth, wie wir sahen, die Bedeutung, welche ein Gut für uns dadurch erlangt, dass wir uns in der Befriedigung eines unserer Bedürfnisse von der Verfügung über dasselbe abhängig zu sein bewusst sind, so zwar, dass diese Befriedigung nicht erfolgen würde, wofern wir über das in Rede stehende Gut nicht zu verfügen vermöchten. Ohne das Eintreffen dieser Vorbedingung ist die Erscheinung des Werthes undenkbar, aber sie ist nicht geknüpft an die Vorbedingung der directen, oder aber der indirecten Sicherstellung unseres Bedarfes. Damit ein Gut Werth erlange, muss es uns die Befriedigung von Bedürfnissen sichern, für welche nicht vorgesorgt wäre, wofern wir über jenes Gut nicht verfügen könnten; ob dies indess in directer oder indirecter Weise geschieht, ist überall dort, wo es sich um die allgemeine Erscheinung des Werthes handelt, ganz nebensächlich. Für einen isolirten Pelzjäger hat das Fell eines erlegten Bären nur insoferne Werth, als er die Befriedigung irgend eines Bedürfnisses entbehren müsste, wofern er darüber nicht verfügen würde; für denselben Jäger hat, nachdem er in den Tauschverkehr getreten, das gleiche Pelzwerk genau unter denselben Voraussetzungen Werth. Der Unterschied in den beiden Fällen, der indess das Wesen der Wertherscheinung im Allgemeinen durchaus nicht berührt, besteht nur darin, dass der Pelzjäger im ersten Falle den schädlichen Einflüssen der Witterung preisgegeben wäre, oder die Befriedigung irgend eines andern Bedürfnisses entbehren müsste, zu welcher das in Rede stehende Gut in directer Weise verwendet werden kann, im zweiten Falle aber auf Bedürfnissbefriedigungen verzichten müsste, welche er mittelst jener Güter herbeizuführen vermag, über die er durch den Besitz des Pelzwerkes indirect (auf dem Wege des Tausches) zu verfügen vermag.
Der Werth in dem ersten und der Werth in dem zweiten Falle sind demnach lediglich zwei verschiedene Formen derselben Erscheinung des wirthschaftlichen Lebens und bestehen beide in der Bedeutung, welche Güter für wirthschaftende Subjecte [215] dadurch erlangen, dass diese letztern in der Befriedigung ihrer Bedürfnisse von der Verfügung über dieselben abhängig zu sein sich bewusst sind. Was aber der Erscheinung des Werthes in jedem der beiden Fälle einen besonderen Charakter verleiht, das ist der Umstand, dass die Güter für die wirthschaftenden Subjecte, welche über dieselben verfügen, in dem ersten Falle mit Rücksicht auf ihre directe, im zweiten Falle mit Rücksicht auf ihre indirecte Verwendung jene Bedeutung erlangen, welche wir den Güterwerth nennen, ein Unterschied, der indess für das Leben und nicht minder für unsere Wissenschaft wichtig genug ist, um die Nothwendigkeit einer besonderen Bezeichnung dieser beiden Formen der Einen allgemeinen Wertherscheinung hervortreten zu lassen und so nennen wir denn den Werth in dem ersten Falle Gebrauchswerth, im letzteren aber Tauschwerth [2].
[216]
Der Gebrauchswerth ist demnach die Bedeutung, welche Güter dadurch für uns erlangen, dass sie uns in directer Weise die Befriedigung von Bedürfnissen unter Umständen sichern, unter welchen ohne unsere Verfügung über dieselben für diese Bedürfnissbefriedigungen nicht vorgesorgt wäre; der Tauschwerth aber ist die Bedeutung, welche Güter dadurch für uns erlangen, dass durch den Besitz derselben der gleiche Erfolg unter gleichen Verhältnissen in indirecter Weise gesichert wird.
b) Ueber das Verhältniss zwischen dem Gebrauchswerthe und Tauschwerthe der Güter.
In der isolirten Wirthschaft haben die den wirthschaftenden Individuen verfügbaren ökonomischen Güter für dieselben entweder [217] Gebrauchswerth, oder überhaupt keinen Werth. Aber auch unter entwickelten Culturverhältnissen und bei lebhaftem Verkehre können zahlreiche Fälle beobachtet werden, wo ökonomische Güter für die wirthschaftenden Subjecte, welche über dieselben verfügen, keinerlei Tauschwerth haben, obzwar ihr Gebrauchswerth für diese Personen ganz ausser allem Zweifel steht.
Die Krücke eines eigenthümlich verkrüppelten Menschen, Notizen, welche nur derjenige, welcher sie abgefasst hat, zu benützen vermag, Familiendocumente, alle diese und so zahlreiche andere Güter haben für bestimmte Individuen nicht selten einen sehr bedeutenden Gebrauchswerth, während dieselben Individuen in den meisten Fällen es doch vergeblich versuchen würden, irgend welche Bedürfnisse in indirecter, durch Tausch vermittelten Weise mit jenen Gütern zu befriedigen. Viel häufiger noch können wir bei fortgeschrittener Cultur jedoch das entgegensetzte Verhältniss beobachten. Die Brillen und optischen Instrumente, welche ein Optiker am Lager hält, haben für diesen letzteren, chirurgische Instrumente für diejenigen, welche sie verfertigen und damit Handel treiben, Werke in fremden, nur wenigen Gelehrten verständlichen Sprachen für die Buchhändler der Regel nach keinen Gebrauchswerth, während alle diese Güter mit Rücksicht auf die sich darbietenden Tauschgelegenheiten, für die obengenannten Personen doch zumeist einen unzweifelhaften Tauschwerth haben.
In diesen und so in allen andern Fällen, wo ökonomische Güter für diejenigen, welche darüber verfügen, entweder nur Gebrauchswerth, oder nur Tauschwerth haben, kann die Frage, welcher von beiden der die wirthschaftliche Thätigkeit der betreffenden Individuen bestimmende ist, gar nicht entstehen. Diese Fälle bilden indess doch nur Ausnahmen im wirthschaftlichen Leben der Menschen, denn der Regel nach haben die wirthschaftenden Individuen überall dort, wo sich bereits ein nennenswerther Tauschverkehr entwickelt hat, die Wahl, die in ihrer Verfügung befindlichen ökonomischen Güter, entweder in directer, oder aber in indirecter Weise, zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse heranzuziehen und die ökonomischen Güter haben somit für dieselben der Regel nach eben sowohl Gebrauchswerth, als auch Tauschwerth. Die Kleidungsstücke die Zimmereinrichtnugsstücke, [218] das Geschmeide, und so tausend andere Güter, welche sich in unserer Verfügung befinden, haben für uns der Regel nach einen ganz unzweifelhaften Gebrauchswerth; aber eben so sicher ist es, dass wir dieselben unter entwickelten Verkehrsverhältnissen auch in indirecter Weise zur Befriedigung von Bedürfnissen heranziehen können, und es haben diese Güter für uns demnach gleichzeitig auch Tauschwerth.
Die Bedeutung, welche diese Güter mit Rücksicht auf die directe, und jene, welche sie mit Rücksicht auf die indirecte Verwendung zur Befriedigung unserer Bedürfnisse für uns haben, sind nun zwar, wie wir sahen, lediglich verschiedene Formen der einen, allgemeinen Erscheinung des Werthes; ihrem Grade nach kann jedoch diese Bedeutung in den beiden Fällen sehr grosse Verschiedenheiten aufweisen. Der goldene Becher, welchen ein armer Mann in einer Lotterie gewinnt, wird für ihn unzweifelhaft einen hohen Tauschwerth haben, denn er wird in den Stand gesetzt sein, mittelst des in Rede stehenden Bechers viele Bedürfnisse, für welche sonst nicht vorgesorgt sein würde, in indirecter, das ist durch Tausch vermittelter Weise zu befriedigen. Der Gebrauchswerth dieses Bechers wird dagegen für dasselbe wirthschaftende Subject jedenfalls ein kaum nenneuswerther sein. Umgekehrt hat eine dem Auge ihres Besitzers genau entsprechende Brille für denselben der Regel nach einen nicht unbedeutenden Gebrauchswerth, während der Tauschwerth einer solchen in den meisten Fällen ein sehr geringer ist.
Ist es nun aber sicher, dass im wirthschaftlichen Leben der Menschen zahlreiche Fälle beobachtet werden können, in welchen ökonomische Güter für die wirthschaftenden Subjecte, in deren Verfügung sie sich befinden, gleichzeitig Gebrauchswerth und Tauschwerth haben, und ist es ferner sicher, dass diese letztern sich uns nicht selten als verschiedene Grössen darstellen, so fragt es sich nun, welche dieser beiden Grössen in jedem gegebenen Falle für das ökonomische Bewusstsein und das ökonomische Handeln der Menschen die massgebende, oder aber mit andern Worten, welcher dieser beiden Werthe in jedem einzelnen Falle der ökonomische ist.
Die Lösung dieser Frage ergiebt sich aus der Betrachtung des Wesens der menschlichen Wirthschaft und jenes des Werthes. [219] Der leitende Gedanke der gesammten wirthschaftlichen Thätigkeit der Menschen ist die möglichst vollständige Befriedigung ihrer Bedürfnisse. Sind nun mit Rücksicht auf die directe Verwendung eines Gutes wichtigere Bedürfnissbefriedigungen der wirthschaftenden Subjecte durch dasselbe sichergestellt, als bei indirecter Verwendung, ist es demnach sicher, dass, wofern das wirthschaftende Subject ein Gut in indirecter Weise zur Befriedigung seiner Bedürfnisse heranziehen würde, wichtigere Bedürfnisse desselben unbefriedigt bleiben müssten, als bei der directen Verwendung, so kann kein Zweifel darüber bestehen, dass der Gebrauchswerth desselben der für das wirthschaftliche Bewusstsein und für das ökonomische Handeln des betreffenden wirthschaftenden Subjectes Bestimmende sein wird, im umgekehrten Falle aber der Tauschwerth. Die im erstern Falle bei directer, im zweiten Falle aber bei indirecter Verwendung der Güter gesicherten Bedürfnissbefriedigungen sind nämlich diejenigen, die bei wirthschaftenden Individuen jedenfalls erfolgen würden und demnach von ihnen entbehrt werden müssten, wofern sie über die betreffenden Güter nicht verfügen würden. Es ist demnach in allen Fällen, wo ein Gut für dessen Besitzer sowohl Gebrauchswerth, als auch Tauschwerth hat, derjenige der ökonomische, welcher der grössere ist. Es ist aber nach dem, was wir im vierten Capitel sagten, klar, dass in allen Fällen, wo die Grundlagen eines ökonomischen Tausches vorhanden sind, der Tauschwerth, dort, wo dies nicht der Fall ist, der Gebrauchswerth der Güter der ökonomische ist.
c) Ueber den Wechsel im ökonomischen Schwerpunkte des Güterwerthes.
Den ökonomischen Werth der Güter zu erkennen, das ist, jeweilig darüber im Klaren zu sein, ob ihr Gebrauchswerth oder ihr Tauschwerth der ökonomische ist, gehört zu den wichtigsten Aufgaben der wirthschaftenden Menschen. Von dieser Erkenntniss hängt nämlich die Entscheidung der Frage ab, welche Güter, beziehungsweise welche Theilquantitäten derselben, in ihrem Besitze zu behalten, und welche zur Veräusserung zu bringen in ihrem ökonomischen Interesse liegt. Die richtige Beurtheilung [220] dieses Verhältnisses gehört aber zugleich auch zu den schwierigsten Aufgaben der practischen Wirthschaft, und zwar nicht nur deshalb, weil selbst bei verwickelteren Verkehrsverhältnissen hiezu ein Ueberblick über alle vorhandenen Gebrauchs- und Tauschgelegenheiten erforderlich ist, sondern vor Allem auch um dessentwillen, weil die Verhältnisse, welche die Grundlage für eine richtige Beurtheilung der obigen Frage bilden, vielfachem Wechsel unterworfen sind. Es ist nämlich klar, dass Alles, was den Gebrauchswerth eines Gutes für uns verringert, unter sonst gleichen Umständen zu bewirken vermag, dass der Tauschwerth dieser Güter zum ökonomischen wird, alles aber, was den Gebrauchswerth eines Gutes für uns erhöht, den Erfolg haben kann, dass für uns der Tauschwerth in den Hintergrund der Bedeutung tritt, die Erhöhung, oder Verringerung des Tauschwerthes eines Gutes unter sonst gleichen Verhältnissen aber die entgegengesetzte Wirkung auszuüben vermag.
Zu den hauptsächlichsten Ursachen dieses Wechsels gehören folgende:
Erstens: Der Wechsel in der Bedeutung jener Bedürfnissbefriedigungen, zu welchen ein Gut dem wirthschaftenden Subjecte, welches darüber verfügt, dient, insofern als hiedurch der Gebrauchswerth desselben für dessen Besitzer vermehrt, oder vermindert wird. So wird der Tabak- oder der Weinvorrath, welcher sich im Besitze einer Person befindet, für sie einen vorwiegenden Tauschwerth erhalten, falls dieselbe am Tabak- oder Weingenusse den Geschmack verliert. So veräussern Jagdliebhaber, oder Freunde des Sports, wenn ihre Liebhabereien für sie die frühere Bedeutung verlieren, lediglich aus diesem Grunde ihre Jagdgeräthe und Jagdthiere etc., da durch die Minderung des Gebrauchswerthes der obigen Güter der Tauschwerth derselben für sie in den Vordergrund der Bedeutung tritt.
Insbesondere pflegt der Uebergang aus einem Lebensalter in das andere solche Veränderungen im Gefolge zu haben. Die Befriedigung desselben Bedürfnisses hat für den Jüngling eine andere Bedeutung, als für den Mann, und für diesen letztern wiederum eine andere Bedeutung, als für den Greis. Die natürliche Entwicklung des Menschen hat demnach schon an und für [221] sich im Gefolge, dass der Gebrauchswerth der Güter einem nicht unbeträchtlichen Wechsel unterliegt, und so z B. die naiven Unterhaltungsmittel des Kindes für den Jüngling, die Bildungsmittel dieses letzteren für den Mann, die Erwerbsmittel des Mannes für den Greis an Gebrauchswerth einbüssen und einen vorwiegenden Tauschwerth erlangen. Es ist denn auch keine Erscheinung gewöhnlicher, als dass die Güter, welche für das kindliche Lebensalter einen überwiegenden Gebrauchswerth hatten, von dem Jünglinge veräussert werden. Wir sehen Personen, die in das Mannesalter treten, der Regel nach nicht nur viele dem Jünglingsalter eigenthümliche Genussmittel, sondern auch die Bildungsmittel ihrer Jugend veräussern, wie denn auch bei Greisen uns die Erscheinung so häufig entgegetritt, dass sie nicht nur die Genussmittel des Mannesalters, deren Benützung Lebenskraft und Muth erfordert, sondern auch die Erwerbsmittel (Fabriken, Gewerbsunternehmungen u. dgl. m.) in andere Hände gelangen lassen. Wenn die wirthschaftliche Bewegung, welche eine Folge dieses Umstandes ist, nicht so stark an die Oberfläche der Erscheinungen tritt, als dies dem natürlichen Verlaufe der Dinge nach der Fall sein müsste, so ist der Grund hievon in dem Familienleben der Menschen zu suchen und dem, nicht so sehr in Folge entgeltlicher Verträge, als vielmehr in Folge der Befriedigung von Gemüthsbedürfnissen vor sich gehenden Uebergange von Gütern aus dem Besitze der ältern Familienglieder in jenen der Jüngern. So ist denn die Familie mit der ihr eigenthümlichen Wirthschaft ein wesentliches Moment der Stabilität der wirthschaftlichen Verhältnisse der Menschen.
Die Erhöhung des Gebrauchswerthes eines Gutes für dessen Besitzer hat naturgemäss den entgegengesetzten Erfolg. Der Besitzer eines Forstes z. B., für welchen die jährlich geschlagene Holzquantität bisher nur Tauschwerth hatte, wird den Austausch seines Holzes gegen andere Güter der Regel nach sofort einstellen, wenn er einen Hochofen zur Eisenschmelzung angelegt hat und zum Betriebe desselben des vollen Erzeugnisses seiner Waldungen bedarf. Der Literat, welcher bisher seine Arbeiten an Verleger veräusserte, wird [222] dies ferner unterlassen, wenn er ein eigenes Journal begründet hat u. s. f.
Zweitens kann der blosse Wechsel in der Beschaffenheit eines Gutes den Schwerpunkt der ökonomischen Bedeutung desselben verrücken, insofern als dadurch der Gebrauchswerth desselben für den Besitzer verändert wird, der Tauschwerth aber entweder unverändent bleibt oder doch nicht in gleichem Verhältnisse wie der erstere steigt oder fällt.
So pflegen Kleider, Pferde, Hunde, Carossen und dergleichen Gegenstände, wenn sie in äusserlich leicht erkennbarer Weise Schaden nehmen, für reiche Leute ihren Gebrauchswerth fast gänzlich einzubüssen und ihr Tauschwerth, obzwar gleichfalls gemindert, tritt dann in den Vordergrund der Bedeutung. Sie pflegen an Gebrauchswerth für die obigen Personen noch mehr zu verlieren, als an Tauschwerth.
Umgekehrt verändern sich die Güter in vielen Fällen derart, dass der Tauschwerth derselben, welcher bisher der ökonomische war, für die wirthschaftenden Subjecte, welche darüber verfügen, gegen den Gebrauchswerth zurücktritt. So pfleger, Speisewirthe und Delikatessenhändler Gerichte, die äusserlich Schaden nehmen, für ihren eigenen Gebrauch zu verwenden, da diese Güter hiedurch ihren Tauschwerth fast gänzlich einbüssen, während der Gebrauchswerth derselben nicht selten derselbe bleibt, oder sich doch nicht in dem gleichen Masse wie der Tauschwerth mindert. Aehnliche Erscheinungen können wir auch bei den übrigen Gewerbsleuten beobachten, und so kommt es, dass Schuhmacher, zumal in kleinen Ortschaften, nicht selten misslungene Schuhe, Schneider verschnittene Kleider, und Hutmacher Hüte tragen, mit welchen ihnen ein kleiner Unfall zugestossen ist.
Wir gelangen nun zur dritten und wichtigsten Ursache des Wechsels im ökonomischen Schwerpunkt des Güterwerthes: Wir meinen die Vermehrung der Gütermenge, welche der Verfügung der wirthschaftenden Subjecte untersteht.
Durch die Vermehrung der Quantität irgend eines Gutes, welche der Verfügung einer Person untersteht, wird der Gebrauchswerth einer jeden Theilquantität hievon für ihren Besitzer unter sonst gleichen Verhältnissen fast immer vermindert, so [223] zwar, dass der Tauschwerth derselben dann für den Besitzer leicht eine überwiegende Bedeutung erhält. Nach der Ernte wird der Tauschwerth des Getreides für die Landwirthe fast ohne Ausnahme der ökonomische und bleibt dies so lange, bis durch fortgesetzte Veräusserung von Theilquantitäten der Gebrauchswerth desselben wieder der überwiegende wird. Das Getreide, welches die Landwirthe noch im Sommer besitzen, hat denn auch in der That der Regel nach für sie bereits einen vorwiegenden Gebrauchswerth. Wir haben aber an einer anderen Stelle dieses Werkes (Cap. IV, §. 2) gezeigt, wo die Grenze liegt, bei welcher der Tauschwerth der Güter gegen den Gebrauchswerth derselben in den Hintergrund der Bedeutung tritt. Für einen Erben, der bereits vor dem Anfalle der Erbschaft mit Möbeln in ausreichender Weise versehen war, und in dem Nachlasse des Erblassers noch ein anderes reiches Mobiliar findet, werden viele Möbelstücke einen sehr geringen, manche vielleicht gar keinen Gebrauchswerth haben und demnach einen vorwiegenden Tauschwerth erlangen. Der Erbe wird aber in der Veräusserung von Möbelstücken so lange fortfahren, bis der in seinem Besitze befindliche Rest für ihn wiederum einen überwiegenden Gebrauchswerth haben wird.
Umgekehrt hat die Verminderung der einem wirthschaftenden Subjecte verfügbaren Quantität eines Gutes zumeist zur Folge, dass der Gebrauchswerth desselben für den Besitzer steigt und dadurch Quantitäten dieses Gutes, welche sonst zum Austausche bestimmt gewesen wären, einen vorwiegenden Gebrauchswerth erhalten.
Von besonderer Wichtigkeit ist in dieser Beziehung die Wirkung der Veränderung im Vermögensbesitze überhaupt. Die Vermehrung oder Verminderung des Vermögens ist unter entwickelten Verkehrsverhältnissen für das wirthschaftende Subject, welches die Vermögensänderung erfährt, gleichbedeutend mit einer Vermehrung, beziehungsweise einer Verminderung fast jeder einzelnen Art von ökonomischen Gütern. Ein Mann, der verarmt, ist genöthigt, sich in der Befriedigung fast sämmtlicher Bedürfnisse einzuschränken. Er wird einzelne Bedürfnisse quantitativ und qualitativ minder vollständig, andere wohl auch gar nicht befriedigen. Finden sich nun nach seiner Verarmung in [224] seinem Besitze feinere Genussmittel, oder Luxusgegenstände, welche ehedem zur harmonischen Befriedigung seiner Bedürfnisse beitrugen; den geänderten Verhältnissen indess nicht mehr entsprechen, so wird er dieselben, wofern er ein wirthschaftendes Subject ist, veräussern, um mit ihrem Erlöse wichtigere Bedürfnisse seiner Person und seiner Familie zu befriedigen, die sonst unbefriedigt bleiben müssten. Personen, die ihr Vermögen durch unglückliche Speculationen, oder durch sonstige Unglücksfälle zum grossen Theil einbüssen, verkaufen denn auch in der That ihren Schmuck, die in ihrem Besitze befindlichen Kunstwerke und sonstige Luxusgegenstände, um sich mit den Nothwendigkeiten des Lebens zu versehen. Aber auch der steigende Reichthum hat, eine ähnliche, obwohl ihr r Tendenz nach entgegengesetzte Wirkung im Gefolge, indem hiedurch viele Güter, die bisher vorwiegenden Gebrauchswerth für den Besitzer hatten, diesen letztern einbüssen, und der Tauschwerth derselben in den Vordergrund der ökonomischen Bedeutung tritt. So pflegen plötzlich reich gewordene Leute ihr einfaches Mobiliar, ihren ärmlichen Schmuck, ihre unzureichenden Wohnhäuser und sonstige Güter, die bisher für sie einen überwiegenden Gebrauchswerth hatten, zu veräussern.
[225]
Siebentes Capitel.
Die Lehre von der Waare.↩
§. 1.
Ueber den Begriff der Waare im populären und wissenschaftlichen Sinne.
In der isolirten Wirthschaft ist die productive Thätigkeit jeder einzelnen wirthschaftenden Person lediglich auf die Herstellung der zum Eigenverbrauche nöthigen Güter gerichtet und somit die Production von Gütern zum Zwecke des Austausches derselben durch die eigenthümliche Natur dieser Wirthschaft von selbst ausgeschlossen. Dabei können die zur Deckung des Eigenbedarfes erforderlichen Arbeitsleistungen von dem Haupte der Familie immerhin den einzelnen Mitgliedern derselben und dem etwa vorhandenen Gesinde mit entsprechender Rücksichtnahme auf ihre besonderen Fähigkeiten und Fertigkeiten zugetheilt werden. Was die isolirte Wirthschaft charakterisirt, ist demnach nicht der Mangel an jeder Arbeitstheilung, sondern ihre Selbstgenügsamkeit die ausschliessliche Richtung der Production auf die Hervorbringung von Gütern für den Eigenbedarf und der vollständige Mangel an solchen Gütern, welche zum Austausche gegen andere bestimmt sind.
Dass die Arbeitstheilung im Bereiche der isolirten Wirthschaft eine sehr eng begrenzte bleibt, versteht sich dagegen von selbst. Der Bedarf einer Familie an einem einzelnen Gute ist zumeist viel zu gering, als dass ein sich ausschliesslich mit der Hervorbringung desselben, oder gar mit einer einzelnen Handtirung beschäftigendes Individuum im Bereiche derselben einen ausreichenden Wirkungskreis fände und die verfügbaren Mittel sind zur Ernährung zahlreicher Arbeiter meist viel zu klein Alle niederen Culturentwicklungen bieten uns das Bild complicirterer [226] Arbeitstheilung denn auch nur in den Wirthschaften einzelner Grossen dar, während die übrigen wirthschaftenden Subjecte bei geringer Arbeitstheilung und eng begränzten Bedürfnissen verharren.
Als erster Schritt in der wirthschaftlichen Culturentwickelung eines Volkes ist es zu betrachten, wenn Personen, welche sich gewisse Kunstfertigkeiten angeeignet haben, ihre Dienste der Gesellschaft anbieten und den ihnen dargereichten Rohstoff gegen eine Entschädigung verarbeiten. Die Thetes der Griechen scheinen in den ältern Zeiten Handwerker dieser Art gewesen zu sein. In vielen Gegenden Osteuropa's giebt es selbt heute noch keine andern Handwerker. Das im Hause des Consumenten selbst gesponnene Garn wird von dem Weber zu Stoffen, das selbst erzeugte Getreide vom Müller zu Mehl verarbeitet und selbst der Zimmermann und Schmied erhalten bei grössern Aufträgen den Rohstoff für das bestellte Product zugemessen.
Es ist als ein neuer Schritt auf dem Wege wirthschaftlicher Culturentwickelung, zumal als ein Zeichen wachsenden Wohlstandes zu betrachten, wenn die Handwerker das Rohmaterial für ihre Producte selbst beizustellen beginnen, wenngleich sie diese letzteren noch immer nur über Bestellung Seitens der Consumenten verfertigen. Es ist dies die Sachlage, wie wir sie mit geringen Ausnahmen in kleineren Städten und zum Theile auch noch in grösseren Ortschaften bei manchen Gewerben beobachten können. Der Gewerbsmann verfertigt allerdings noch kein Product auf ungewissen Verkauf, er ist indess bereits in der Lage, den Bedürfnissen seiner Kunden nach Massgabe seiner Arbeitskraft zu entsprechen, indem er sie zugleich der Mühe des ihrerseits meist in höchst unökonomischer Weise erfolgenden Einkaufes, beziehungsweise der Production des Rohmaterials enthebt [1].
Diese Methode der Versorgung der Gesellschaft mit Gütern bedeutet für die Consumenten sowohl, als auch für die Producenten bereits einen erheblichen Fortschritt in Bezug auf [227] Wirthschaftlichkeit und Bequemlichkeit, ist aber nichtsdestoweniger für beide noch mit manchen schwer wiegenden Nachtheilen verbunden. Der Consument muss noch immer einige Zeit auf das Product warten und ist der Beschaffenheit desselben von vornherein nie ganz sicher, der Producent ist bisweilen ganz unbeschäftigt, bisweilen wiederum mit Aufträgen überhäuft, so zwar, dass er bald feiern muss, bald dem auftretenden Bedarfe nicht voll entsprechen kann. Diese Uebelstände haben zur Production von Gütern auf ungewissen Verkauf geführt, also zur Erzeugung von Gütern, welche der Producent am Lager hält, um dem auftretenden Bedarfe sofort entsprechen zu können. Es ist dies jene Methode der Versorgung der Gesellschaft, welche bei fortschreitender Entwicklung der Volkswirthschaft einerseits zur Fabriksindustrie (zur Massenproduction) und andererseits zum Einkaufe von fertiger (Confections) Waare Seitens der Consumenten führt, also rücksichtlich der Producenten, wegen der Möglichkeit der vollständigen Ausbeutung der Arbeitstheilung und der Anwendung von Maschinen, die höchste Wirthschaftlichkeit, rücksichtlich der Consumenten die höchste Sicherheit (Augenschein vor dem Ankaufe) und Bequemlichkeit mit sich bringt.
Die von dem Producenten, oder dem Zwischenhändler für den Austausch bereit gehaltenen Producte nennt nun der gemeine Sprachgebrauch mit Beschränkung des Begriffes auf bewegliche Sachgüter, die nicht Geld sind, Waaren [2].
[228]
In der wissenschaftlichen Darstellung machte sich indess das Bedürfniss nach einer Bezeichnung aller für den Austausch bestimmten ökonomischen Güter, ohne Rücksicht auf ihre Körperlichkeit, Beweglichkeit, ihren Charakter als Arbeitsproducte, oder die Person, welche dieselben feilbietet, geltend, und so versteht denn eine grosse Anzahl zumal deutscher Nationalökonomen unter Waaren: zum Austausch bestimmte (ökonomische) Güter jeder Art.
Der Begriff der Waare im populären Sinne des Wortes ist aber nicht nur deshalb von Wichtigkeit, weil die Gesetzgebungen [3]und eine grosse Anzahl von National-Oekonomen [229] den Begriff der Waare in populärem Sinne gebrauchen, sondern auch um dessentwillen, weil ein Theil derjenigen, welche den Begriff der Waare in dem weitern wissenschaftlichen Sinne des Wortes auffassen, doch bald dies, bald jenes Element der engeren populären Begriffsbestimmung in seine Definitionen aufnimmt [4]
[230]
Aus dem eben dargelegten Begriff der Waare im wissenschaftlichen Sinne des Wortes ist zugleich ersichtlich, dass der [231] Waarencharakter nichts einem Gute Anhaftendes, keine Eigenschaft, sondern lediglich eine besondere Beziehung desselben zu derjenigen Person ist, welche darüber verfügt, eine Beziehung, mit deren Verschwinden auch der Waarencharakter der Güter selbst entfallen muss. Ein Gut hört demnach auf, Waare zu sein, sobald dasjenige wirthschaftende Subject, welches darüber verfügt, seine Absicht, dasselbe zu veräussern, aufgiebt, oder das betreffende Gut in die Hände derjenigen Person gelangt, welche dasselbe nicht weiter auszutauschen, sondern zu consumiren beabsichtigt. Der Hut, welchen ein Hutmacher, der Seidenstoff, welchen ein Seidenwaarenhändler in seinem Laden zum Zwecke der Veräusserung ausstellt, sind z. B. Waaren, sie hören aber sofort auf, Waaren zu sein, wenn der erstere den Hut zum eigenen Gebrauche, der letztere den Seidenstoff etwa zu einem Geschenke für seine Frau bestimmt, und Zuckerhüte, oder Orangen sind in den Handen des Krämers Waaren, büssen ihren Waarencharakter aber ein, sobald dieselben in die Hände der Consumenten übergegangen sind. Auch das gemünzte Metall hört sofort auf, „Waare“ zu sein, wenn dasselbe von seinem Besitzer nicht weiter [232] zum Austausche, sondern zu irgend einem Gebrauchszwecke bestimmt wird, z. B., wenn Thaler dem Silberarbeiter zu dem Zwecke übergeben werden, um daraus Silbergeschirre zu verfertigen.
Der Waarencharakter ist demnach nicht nur keine Eigenschaft der Güter, sondern der Regel nach nur eine vorübergehende Beziehung derselben zu den wirthschaftenden Subjecten. Gewisse Güter sind von ihren Besitzern für den Austausch gegen Güter anderer wirthschaftenden Subjecte bestimmt. In der Zwischenzeit des bisweilen durch mehrere Hände vermittelten Ueberganges aus dem Besitze der ersteren in den der letzteren nennen wir dieselben „Waaren,“ haben sie aber ihr ökonomisches Ziel erreicht, das ist, befinden sie sich in den Händen der Consumenten, so hören sie selbstverständlich auf, Waaren zu sein und werden „Gebrauchsgüter“ im engeren, dem der „Waare“ entgegengesetzten Sinne des Wortes. Wo dies indess nicht der Fall ist, wie z. B. sehr häufig bei Gold, Silber etc., zumal in gemünztem Zustande, bleiben sie naturgemäss insolange „Waaren,“ als sie sich eben in dem den Waarencharakter begründenden Verhältnisse befinden [5].
[233]
§. 2.
Ueber die Absatzfähigkeit der Waaren.
a) Ueber die Grenzen der Absatzfähigkeit der Waaren.
Das Problem, die Ursachen des verschiedenen und wech seln den Verhältnisses zwischen den im Austausch erscheinenden Güterquantitäten darzulegen, ist von den Forschern auf dem Gebiete der Volkswirthschaftslehre stets einer besonderen Aufmerksamkeit gewürdigt worden; der Versuche, dies Problem zu lösen, giebt es so viele, als selbstständige Bearbeitungen unserer Wissenschaft, ja, diese letztere ist bei manchen Bearbeitern in eine Theorie der Preise geradezu aufgegangen. Der Umstand dagegen, dass die verschiedenen Güter nicht mit gleicher Leichtigkeit gegen einander umgesetzt werden können, ist bisher nur wenig beachtet worden. Und doch ist die in die Augen fallende Verschiedenheit der Absatzfähigkeit der Waaren eine Erscheinung von so weit gehender practischer Bedeutung, von der richtigen Erkenntniss der hier wirkenden Einflüsse hängt in jedem einzelnen Falle so sehr der Erfolg der wirthschaftlichen Thätigkeit des Producenten sowohl, als des Handelsmannes ab, dass die Wissenschaft sich einer genauen Untersuchung der Natur und der Ursachen dieser Erscheinung für die Dauer nicht wohl entschlagen kann. Auch ist es ja klar, dass die bisher noch immer controverse Lehre über den Ursprung des Geldes, des absatzfähigsten aller Güter, in den hier einschlägigen Untersuchungen allein ihre volle und befriedigende Begründung finden kann.
So viel ich nun beobachten konnte, ist die Absatzfähigkeit der Waaren in vier Richtungen begrenzt:
Erstens in Rücksicht auf die Personen, an welche dieselben abgesetzt werden können.
Der Besitzer von Waaren hat es nicht in seiner Macht, dieselben an jede beliebige Person abzusetzen; es ist vielmehr stets nur ein bestimmter Kreis von wirthschaftenden Individuen vorhanden, an welche ein Absatz derselben stattfinden kann. Er hat keine Aussicht, seine Waaren abzusetzen an alle jene, welche:
[234]
a) keinen Bedarf an der Waare haben,
b) aus rechtlichen, oder physischen Gründen an dem Eintausche der Waare verhindert sind [6],
c) keine Kenntniss von der ihnen dargebotenen Tauschgelegenheit haben [7], und endlich an
d) alle jene, für welche Quantitäten der in Rede stehenden Waare nicht das Aequivalent einer grössern Quantität des im Austausche dagegen zu bietenden Gutes sind, als dies beim Besitzer der Waare der Fall ist [8].
Fassen wir nun die Kreise von Personen ins Auge, auf welche sich die Absatzfähigkeit der verschiedenen Waaren beschränkt, so bietet sich uns das Bild der grössten Verschiedenheit dar. Man vergleiche nur den Kreis von Personen, an welchen Brod und Fleisch, und jenen, an welchen astronomische Instrumente, den Kreis von Personen, an welchen Wein und Tabak, und jenen, an welchen Sanskritwerke Absatz finden können. Die gleiche Wahrnehmung kann in fast noch auffälligerer Weise bei den verschiedenen Species von Waaren derselben Gattung und Art gemacht werden. Unsere Optiker halten Brillen für alle Grade der Weitsichtigkeit und Kurzsichtigkeit zum Austausche [235] bereit und unsere Hut- und Handschuhhändler, unsere Schuhmacher und Kürschner: Hüte, Handschuhe, Schuhe und Kürschnerwaaren von verschiedener Grösse und Qualität. Wie gross ist aber die Verschiedenheit des Kreises von Personen, auf welche sich die Absatzfähigkeit von Brillen vom schärfsten vorhandenen Schliffe beschränkt, und jene von Brillen mittlerer Schärfe? Wie gross die Verschiedenheit des Kreises von Personen, auf welche sich die Absatzfähigkeit von Handschuhen und Hüten von mittlerer, und solcher von aussergewöhnlicher Grösse erstreckt?
Die Absatzfähigkeit der Waaren ist zweitens in Rücksicht auf das Gebiet begrenzt, innerhalb welches dieselbe Absatz finden kann.
Damit eine Waare nach irgend einem Orte Absatz finden könne, ist ausser dem obigen Erfordernisse, dass daselbst ein Kreis von Personen bestehe, an welchen dieselbe abgesetzt werden kann, nöthig:
a) dass kein physisches, oder rechtliches Hinderniss ihres Transportes nach jenem Orte und ihrer Feilbietung daselbst bestehe,
b) dass durch die mit dem Transporte verbundenen Kosten und Spesen nicht der aus den etwa vorhandenen Tauschgelegenheiten zu erzielende Nutzen erschöpft werde (S. 170 ff).
Was nun den Umfang dieser Grenzen betrifft, so ist die Verschiedenheit desselben bei den einzelnen Waaren keine geringere, als jene, welche wir rücksichtlich des Kreises von Personen beobachtet haben, an welche die Waaren Absatz finden können. Es giebt Waaren, welche schon wegen des auf gewisse räumliche Grenzen beschränkten Bedarfes nur in einer einzelnen Ortschaft, andere, die nur in einzelnen Bezirken, andere, die nur in einem gewissen Lande, noch andere, welche in allen Culturländern, und solche, die selbst darüber hinaus fast in allen bewohnten Theilen der Erde Absatz finden können. Die eigenthümlichen Hüte, wie sie in manchen Thälern Tirol's von der Landbevölkerung getragen werden, sind durchaus nur in einem bestimmten Thale, die Hüte der schwäbischen Bauern, oder der ungarischen Landleute nicht leicht wo anders, als in [236] französischen Mode die Märkte der ganzen civilisirten Welt offen stehen. Schwere Pelzwaaren sind aus demselben Grunde in ihrer Absatzfähigkeit lediglich auf nördliche Gegenden, schwere Wollwaaren auf die Landstriche der nördlichen und der gemässigten Zone beschränkt, während leichte Cottonwaaren fast auf der ganzen Erde Absatz finden können.
Einen nicht minder wichtigen Unterschied in dem Umfange der Absatzgebiete begründen die verschiedenen, mit dem Transporte der Waaren nach entfernten Märkten verbundenen ökonomischen Opfer. Das Absatzgebiet der aus einem Steinbruche, welcher nicht an einer Wasserstrasse liegt, gewonnenen gewöhnlichen Bausteine, das Absatzgebiet gewöhnlichen Sandes, Thones, oder Stalldüngers reicht dort, wo keine Eisenbahnen vorhanden sind, nicht leicht weiter als 2—3 Meilen im Umkreise, und selbst dort, wo Eisenbahnen bestehen, nur in den seltensten Fällen über 15—20 Meilen. Das Absatzgebiet von Steinkohlen, Torf und Brennholz ist unter gleichen Verhältnissen ein ausgedehnteres, aber immerhin doch enge begrenztes. Beträchtlich weiter ist das Absatzgebiet von Roheisen und Weizen, noch weiter das von Stahl und Weizenmehl, und das Absatzgebiet von edlen Metallen, Edelsteinen und Perlen umfasst so ziemlich alle Theile der Erde, wo Bedarf an diesen Gütern besteht und die Tauschmittel hiefür vorhanden sind.
Die ökonomischen Opfer, welche mit dem Transporte vorbunden sind, müssen durch die Differenz des Preises am Orte, wo sie sich befinden, und an ihrem Bestimmungsorte gedeckt werden. Bei Waaren von geringer Kostbarkeit kann diese Differenz an und für sich nie bedeutend sein. Das Brennholz in den Urwäldern Brasiliens und selbst in manchen Gegenden Ost-Europas ist um verschwindende Preise zu erstehen, in vielen Fällen in grossen Quantitäten geradezu kostenlos zu haben, der Preis eines Centners Brennholz ist aber nirgends ein so grosser, dass die Differenz zwischen demselben und dem Preise am Erzeugungsorte, und wäre dieser letztere gleich Null, die Kosten eines weiten Landtransportes decken könnte, während bei Waaren von grosser Kostbarkeit, z. B. bei Taschenuhren, die Differenz zwischen dem Preise eines Centners dieser Waare am Erzeugungsorte und auf den entferntesten Märkten z. B. in [237] Genf und in New-York, oder Rio-Janeiro, trotz des an und für sich beträchtlichen Preises derselben am ersteren Markte, leicht gross genug sein kann, um die Kosten und Spesen des Transportes der Waare nach jenem fernen Absatzgebiete zu ersetzen. Je kostbarer eine Waare, desto grösser ist demnach unter sonst gleichen Umständen ihr Absatzgebiet.
Drittens sind die Waaren in ihrer Absatzfähigkeit in quantitativer Weise begrenzt.
Die Absatzfähigkeit einer Waare ist in quantitativer Beziehung auf den noch ungedeckten Bedarf an derselben und weiter noch auf jene Quantitäten beschränkt, rücksichtlich welcher die Grundlagen zu ökonomischen Tauschoperationen vorhanden sind. Der Bedarf eines einzelnen Individuums an einer Waare mag noch so weite Grenzen haben, über diese Grenzen hinaus ist auf eine weitere Aufnahme von Quantitäten derselben innerhalb jedes gegebenen Zeitraumes nicht zu rechnen und selbst innerhalb dieser Grenzen wird dies Individuum nur solche Quantitäten der Waare einzutauschen bereit sein, rücksichtlich welcher die Grundlagen ökonomischer Tauschoperationen für dasselbe vorhanden sind. Aus der Nachfrage der einzelnen wirthschaftenden Individuuen nach einer Waare setzt sich die Nachfrage nach derselben überhaupt zusammen und die Quantität einer Waare, welche im Grossen und Ganzen an die Mitglieder einer Gesellschaft abgesetzt werden kann, ist demnach bei jeder gegebenen ökonomischen Sachlage eine streng begrenzte, ein Absatz über diese Grenze hinaus undenkbar.
Was nun den Umfang dieser Grenzen betrifft, so weist auch dieser in Rücksicht auf die einzelnen Güter eine sehr bemerkenswerthe Verschiedenheit auf. Es giebt solche Waaren, von welchen wegen des enge begrenzten Bedarfes unter allen Umständen nur eng begrenzte Quantitäten jeweilig Absatz finden können, andere bei welchen der Bedarf ein grösserer ist und in Folge dessen die quantitativen Grenzen der Absatzfähigkeit beträchtlich weiter sind, noch andere bei welchen nahezu jede practisch in Betracht kommende Quantität Absatz finden kann.
Der Verleger eines Werkes über die Sprache der Tupi-Indianer kann bei einem mässigen Preise des Werkes auf einen Absatz von etwa 300, aber selbst bei dem geringsten Preise [238] nicht auf einen höheren Absatz als von 000 Exemplaren rechnen. Ein Gelehrtenwerk, für welches sich nur ein enger Kreis von Fachgenossen interessirt, ist überdies der Regel nach noch für die Bedürfnisse mehrerer Gelehrtengenerationen berechnet—findet in vielen Fällen erst mit dem wachsenden Rufe seines Verfassers Absatz, und ist anders als allmälig durchaus nicht abzusetzen. Ein Werk, welches eine Wissenschaft behandelt, an welche sich ein allgemeines Interesse knüpft, mag dagegen, trotz seines gelehrten Charakters, doch immerhin einen Absatz von mehreren Tausend, populär wissenschaftliche Schriften einen solchen von 20—30.000 und mehr, bedeutende Dichterwerke unter günstigen Umständen einen Absatz von vielen hunderttausend Exemplaren finden. Man erwäge aber auch nur den Unterschied der quantitativen Grenzen der Absatzfähigkeit eines Werkes über peruanische Alterthümer und der Gedichte Friedrich Schillers, oder eines Sanskritwerkes und der Dramen Shakespeare's! Viel grösser erscheint noch die Verschiedenheit in den quantitativen Grenzen der Absatzfähigkeit der Waaren, wenn wir etwa einerseits Brod und Fleisch, und andererseits Chinarinde und Bibergeil, oder aber, einerseits Baumwollstoffe und Schafwollwaaren, und andererseits astronomische Instrumente und anatomische Präparate in Betracht ziehen. Man vergleiche endlich die quantitativen Grenzen der Absatzfähigkeit von Hüten und Handschuhen mittlerer und solcher von äusserster Grösse!
Endlich sind viertens die Waaren in ihrer Absatzfähigkeit auch rücksichtlich der Zeitgrenzen beschränkt, innerhalb welcher sie Absatz finden können.
Es giebt Güter, nach welchen nur im Winter, andere, nach welchen nur im Sommer ein Bedarf vorhanden ist, noch andere, für welche nur innerhalb eines kürzeren oder längeren, vorübergehenden Zeitraumes Nachfrage besteht. Programme für bevorstehende Festlichkeiten, oder Kunstvorstellungen und im gewissen Sinne selbst Journale und Modeartikel sind Güter dieser Art. Ja, alle Güter von kurzer Conservirungsfähigkeit sind schon ihrer inneren Natur nach rücksichtlich ihrer Absatzfähigkeit auf einen engen Zeitraum beschränkt.
Hiezu tritt nun noch der Umstand, dass das „am Lager [239] halten“ der Waaren für den Eigner der Regel nach mit nicht unbeträchtlichen ökonomischen Opfern verbunden ist. Was für die Absatzfähigkeit der Waaren in räumlicher Beziehung die Frachtkosten und Frachtspesen, das sind für die zeitlichen Grenzen der Absatzfähigkeit der Waaren die Kosten der Lagerung, der Conservirung und die Zinsverluste. Ein Viehhändler, welcher unter unsern Culturverhältnissen eine Heerde Schlachtthiere feil hält, wird wegen ihrer beschränkten Conservirungsfähigkeit, wegen der Zinsverluste, hauptsächlich aber um der sonstigen ökonomischen Opfer willen, welche mit dem Besitze dieser Thiere als „Waaren“ verbunden sind, für den Absatz derselben innerhalb gewisser zeitlicher Grenzen nothwendigerweise Sorge tragen müssen, und auch der Wollhändler, der Eisenhändler besitzen Waaren, deren Absatzfähigkeit zum Theile aus physischen, zum Theile aus ökonomischen Gründen (Lagerungskosten, Zinsverluste) auf gewisse Zeitgrenzen beschränkt ist.
Auch rücksichtlich dieser letztern können wir indess bei den verschiedenen Waaren eine stark in die Augen fallende Verschiedenheit beobachten. Die zeitlichen Grenzen, innerhalb welcher z. B. Austern, frisches Fleisch, manche zubereitete Speisen und Getränke, Blumensträusse, Programme für bevorstehende Festlichkeiten, politische Tagesblätter u. s. f. Absatz finden können, beschränken sich im Grossen und Ganzen auf wenige Tage nicht selten auf wenige Stunden, die der meisten frischen Baumfrüchte, vieler Modewaaren, von Wildpret, von Topfgewächsen u. dgl. m. auf wenige Wochen, die anderer ähnlicher Waaren auf wenige Monate, während dieselben bei noch anderen Waaren, zum mindesten soweit dieselben von ihrer Conservirungsdauer und dem andauernden Bedarfe an jenen Gütern abhängen, sich auf Jahre, Jahrzehnte und selbst auf Jahrhunderte erstrecken.
Hiezu tritt nun noch der Umstand, dass die mit der Conservirung und Lagerung der Waaren verbundenen ökonomischen Opfer ausserordentlich verschieden sind und dadurch ein weiteres sehr wichtiges Moment der Verschiedenheit der zeitlichen Grenzen der Absatzfähigkeit der Waaren entsteht. Wer Brennholz oder Bausteine feil hält, die er im Freien lagern kann, wird der Regel nach nicht so sehr zu einem raschen Absatz gedrängt sein, als ein Möbelhändler, und dieser wieder weniger [240] als ein Pferdehändler, und der Besitzer von Gold oder Silber, Edelsteinen und sonstigen (wenn man von dem Zinsverluste absieht) fast kostenlos zu lagernden Waaren, besitzt Güter, deren Absatzfähigkeit sich auf viel weitere zeitliche Grenzen erstreckt, als jene aller oben genannten.
b) Ueber den verschiedenen Grad der Absatzfähigkeit der Waaren.
Wir haben in dem bisherigen gesehen, dass die Absatzfähigkeit der Waaren bald auf einen engeren, bald auf einen weiteren Kreis von Personen, bald auf engere, bald auf weitere räumliche, zeitliche und quantitative Grenzen beschränkt ist. Mit all' dem haben wir indess nur die äusseren Grenzen gekennzeichnet, innerhalb welcher bei jeder gegebenen ökonomischen Sachlage der Absatz der Waaren stattfinden kann, und es erübrigt uns nunmehr zu untersuchen, von welchen Ursachen die grössere oder geringere Leichtigkeit, mit welcher Waaren innerhalb der obigen, ihrer Absatzfähigkeit gezogenen Grenzen umgesetzt werden können, abhängig ist.
Zu diesem Zwecke ist es nothwendig, dass wir einige Worte über die Natur und Bestimmung der Waare vorausschicken. Die Waare ist ein für den Austausch bestimmtes ökonomisches Gut; sie ist indess nicht schlechthin für den Austausch bestimmt. Der Eigner der Waare hat die Absicht, dieselbe auszutauschen, aber durchaus nicht für jeden Preis. Wer ein Lager von Taschenuhren besitzt, kann dasselbe fast unter allen denkbaren Umständen räumen, falls er die Taschenuhren um einen Thaler das Stück, und ein Lederhändler das seine, falls er das Leder zu ähnlichen Schleuderpreisen veräussern wollte. Nichts destoweniger werden sich die beiden obigen Handelsleute eventuell für berechtigt halten, über mangelnden Absatz zu klagen, denn ihre Waaren sind, wie gesagt, zwar zur Veräusserung bestimmt, aber nicht zu jedem, sondern zu dem der allgemeinen ökonomischen Sachlage entsprechenden Preise.
Die effectiven Preise sind nun aber das Product der jeweiligen Concurrenz-Verhältnisse (S. 203) und dieselben entsprechen um so mehr der allgemeinen wirthschaftlichen Sachlage, je vollständiger die Concurrenz auf beiden Seiten stattfindet. Wird durch irgend welche, Umstände ein Theil derjenigen, [241] welche Bedarf an einer Waare haben, von der Concurrenz zurückgehalten, so sinkt der Preis unter das der allgemeinen wirthschaftlichen Sachlage entsprechende Niveau, erfolgt dies bei der Concurrenz in dem Anbote, so steigt der Preis der Waare über dasselbe.
Ist nun die Concurrenz um eine Waare eine ungeregelte, so zwar, dass die Gefahr besteht, dass die Eigner dieselbe bei der Veräusserung zu den ökonomischen Preisen nicht werden absetzen können, während diese Gefahr für die Eigner anderer Waaren nicht, oder doch nicht in gleichem Masse besteht, so ist es klar, dass dieser Umstand einen sehr wichtigen Unterschied in der Absatzfähigkeit der in Rede stehenden Waaren begründet, denn die erstern Waaren können ihrer Bestimmung leicht und sicher, die andern oft nur mit ökonomischen Opfern, unter Umständen wohl auch gar nicht zugeführt werden.
Märkte, Messen, Börsen, periodisch wiederkehrende öffentliche Auctionen, wie sie z. B. in grossen Seestädten stattfinden, und dergleichen öffentliche Einrichtungen mehr, haben den Zweck, die sämmtlichen massgebenden Interessenten bei der Preisbildung einer Waare dauernd, oder doch periodisch an gewissen Punkten zu versammeln und dadurch die Preisbildung zu einer ökonomischen zu machen. Waaren, für welche ein geregelter Markt besteht, können desshalb von ihrem Besitzer leicht zu den der jeweiligen allgemeinen ökonomischen Sachlage entsprechenden Preisen abgesetzt werden, während andere, deren Umsatz ein ungeregelter ist, auch zu ungeregelten Preisen die Hände wechseln, bisweilen gar nicht an den Mann zu bringen sind. Die Errichtung eines Marktes für einen Artikel hat den Erfolg, den Producenten desselben, beziehungsweise denjenigen wirthschaftenden Subjecten, welche damit Handel treiben, die Aussicht zu eröffnen, ihre Waaren jeweilig zu ökonomischen Preisen absetzen zu können, und es ist klar, dass z. B. die Errichtung eines Woll- oder Getreidemarktes in einer Stadt die Absatzfähigkeit der Wolle, beziehungsweise des Getreides, in dem umliegenden Productionsgebiete dieses Artikels bedeutend vermehrt, wie denn z. B. auch die Zulassung eines Effectes zum Handel auf der Börse, die sogenannte Cotirung, zur ökonomischen Preisbildung beim Umsatze desselben, und wegen der Garantie, welche dieser [242] Umstand den Besitzern des bezüglichen Effectes für einen Absatz zu ökonomischen Preisen gewährt, auch zur Vermehrung der Absatzfähigkeit desselben in eminenter Weise beiträgt.
Schon der Umstand, dass jeder Consument die Besitzer einer Waare aufzufinden weiss,—was beim Grosshandel wohl am besten dadurch geschieht, dass die Eigner der Waare mit ihren Lagern möglichst nahe zusammenrücken, um durch ihre Concentrirung eine ähnliche Concentrirung der Consumenten hervor zurufen,—steigert im hohen Masse die Wahrscheinlichkeit, dass die betreffenden Waaren jeweilig zu ökonomischen Preisen zur Veräusserung gelangen werden und der Mangel einer solchen beim Grosshandel ganz allgemein zu beobachtenden Concentrirung im Detailhandel, so naturgemäss er sich auch aus der Rücksichtnahme auf die Bequemlichkeit und Zeitersparniss der Consumenten ergiebt, bildet doch den Hauptgrund der minder ökonomischen Preisbildung in diesem letztern Zweige des Verkehres.
Der Umstand, dass für eine Waare gewisse Concentrationspunkte des Verkehres und der ökonomischen Preisbildung bestehen, hat indess nicht nur den Erfolg, dass ihr Umsatz daselbst zu ökonomischen Preisen erfolgt. Die Preise, die sich in diesen Centren des Verkehres bilden, gelangen fortlaufend zur Kenntniss des Publicums und bieten die bezüglichen Veröffentlichungen auch den ausserhalb jener Verkehrscentren befindlichen Interessenten die Möglichkeit, Geschäfte zu den der jeweiligen ökonomischen Sachlage entsprechenden Preisen abzuschliessen. Allerdings wird dies nur sehr selten bei den grossen Käufern oder Verkäufern einer Waare der Fall sein, welche durch ihre Transactionen einen massgebenden Einfluss auf die Preisbildung selbst ausüben, aber die „kleinen Leute,“ deren Geschäfte zu unbedeutend sind, um nennenswerthe Preisschwankungen hervorzurufen, sind durch jene Veröffentlichungen in den Stand gesetzt, auch ausserhalb des Verkehrsmittelpunktes ihre Umsätze in ökonomischer Weise zu bewerkstelligen und participiren somit an den Vortheilen des Marktes, den sie nicht einmal besuchen. In der Nachbarschaft von London mag es vorkommen, dass ein Pächter nach der Notirung der „Times“ über das Getreidegeschäft in Marklane mit einem Müller abschliesst und in Wien [243] geschehen geringfügigere Spiritusverkäufe nicht selten nach der Notiz der „Neuen freien Presse,“ oder eines anderen bewährten Blattes und so haben Concentrationspunkte des Verkehres in einer Waare ganz allgemein den Erfolg, dass die Eigner von Waaren dieselben an jedes wirthschaftende Subject, das nach denselben Begehr hat, zu ökonomischen Preisen abzusetzen in der Lage sind.
Der Umstand nun, dass der Kreis von Personen, auf welche sich die Absatzfähigkeit der verschiedenen Waaren erstreckt, wie wir oben sahen, zum Theile enger, zum Theile weiter ist und die Concentrationspuncte der Interessenten bei der Preisbildung dieser Waaren bald besser bald schlechter organisirt sind, ist die erste Ursache der verschiedenen Absatzfähigkeit der Waaren.
Es giebt zweitens Waaren, welche innerhalb der ihrer Absatzfähigkeit gezogenen Grenzen fast überall Märkte finden. Nutzvieh, Getreide, Metalle und ähnliche Güter des allgemeinsten Gebrauches haben ihren Markt fast überall, wo überhaupt ein Verkehr besteht, und jedes Städtchen und selbst der kleinste Marktflecken wird in gewissen Zeiten zum Markte für diese Güter, während für andere Waaren (Rauhwaaren, Thee, Indigo) nur wenige durch weite Gebiete getrennte Märkte bestehen. Diese Märkte sind rücksichtlich der Preisbildung von einander nicht unabhängig. Die Berichte über die auf einem Markte vorfallenden Transactionen werden, wofern der Markt von massgebender Wichtigkeit ist, nach allen übrigen Hauptmärkten gemeldet und eine eigene Classe von wirthschaftenden Individuen, die der Arbitrageurs, sorgt dafür, dass die Preisdifferenzen zwischen den einzelnen Märkten nicht in nennenswerther Weise die Kosten und Spesen des Transportes übersteigen.
Der Umstand nun, dass die Absatzfähigkeit der Waaren zum Theile auf ein weiteres, zum Theile auf ein engeres räumliches Gebiet beschränkt ist, und dass die einen Waaren innerhalb dieses Gebietes an zahlreichen, die andern nur an wenigen Verkehrspunkten zu ökonomischen Preisen Absatz finden können, der Besitzer der ersteren Waaren, demnach dieselben, je nach seinem Belieben, an zahlreichen Punkten eines weitern, der andere nur an wenigen Punkten eines engeren Verkehrsgebietes [244] zu ökonomischen Preisen absetzen kann, ist die zweite Ursache der verschiedenen Absatzfähigkeit der Waaren.
Es giebt drittens Waaren, in welchen eine lebhafte und wohl geregelte Speculation besteht, welche jede jeweilig zu Markte gelangende Theilquantität der verfügbaren Menge derselben, wenngleich sie auch den laufenden Bedarf übersteigt, aufnimmt, während sich die Speculation an dem Verkehre in anderen Waaren nicht, oder doch nicht in gleichem Masse betheiligt und bei Ueberfüllung des Marktes die Preise entweder rapide sinken, oder aber die zugeführten Waaren unveräussert vom Markte zurückgeführt werden müssen. Güter der ersten Art können der Regel nach jeweilig in jeder thatsächlich vorhandenen Quantität mit geringer Preiseinbusse zur Veräusserung gebracht werden, während der Eigner einer Waare, in welcher keine Speculation besteht, dieselbe in einer den laufenden Bedarf übersteigenden Quantität entweder gar nicht, oder doch nur mit grossen Verlusten umsetzen kann.
Wir haben schon oben in gewissen für specifische Gelehrtenkreise berechneten Schriften ein Beispiel für die letztere Classe von Waaren gegeben. Wichtiger in dieser Hinsicht sind indess jene Waaren, welche für sich keine selbstständige Bedeutung haben und nur als Theil einer anderen begehrt werden. Was immer der Preis der Spiralfedern für Taschenuhren, oder der Druckmesser von Dampfmaschinen sein mag, der Bedarf an denselben wird sich ziemlich genau nach der Quantität der zu verfertigenden Uhren und Dampfmaschinen richten und eine beträchtlich grössere Quantität der obigen Waaren wäre zu keinem Preise anbringlich. Gold und Silber dagegen und so manche andere Güter, bei welchen einer eng begrenzten verfügbaren Quantität ein fast ungemessener Bedarf entgegensteht, sind in ihrer Absatzfähigkeit in quantitativer Beziehung nahezu unbegrenzt. Es ist kein Zweifel, dass auch die tausendfache Quantität des jetzt vorhandenen Goldes und die hundertfache des jetzt vorhandenen Silbers noch immer Käufer fänden, wenn sie zu Markte gebracht würden. Die eben genannten Metalle würden hiedurch tief im Preise sinken und dann ohne Zweifel auch von minder begüterten Personen zu Geräth und gewöhnlichem Geschirr, und selbst von den ärmeren Lenten zu [245] Schmuck verwendet werden, aber selbst bei der obigen enormen Vermehrung würden sie nicht vergeblich zu Markte gebracht werden und vor wie nach Absatz finden, während eine gleiche Vermehrung des besten Gelehrtenwerkes, der vorzüglichsten optischen Instrumente, ja selbst so wichtiger Waaren, wie Brod und Fleisch, dieselben geradezu unverkäuflich machen müsste. Aus dem Obigen folgt für den Besitzer von Gold und Silber die grosse Leichtigkeit, für jeden Theil der jeweilig vorhandenen Quantität dieser Güter, im schlimmsten Falle mit einem kleinen Preisverluste, Absatz zu finden, während bei den meisten anderen Gütern bei plötzlichen Waarenanhäufungen die Preisverluste leicht viel grösser sind, noch andere Güter unter solchen Umständen gar nicht veräussert werden können.
Der Umstand nun, dass die quantitativen Grenzen der Absatzfähigkeit einer Waare bald weiter, bald enger sind, und von der einen Waare innerhalb dieser Grenzen jede factisch zu Markte gelangende Quantität leicht zu ökonomischen Preisen Absatz findet, während das Gleiche bei anderen Waaren nicht, oder doch nicht in dem gleichen Masse stattfindet, ist die dritte Ursache der verschiedenen Absatzfähigkeit der Waaren.
Es giebt endlich viertens Waaren, für welche ein fast ununterbrochener Markt besteht Effecten und in Orten, wo Waarenbörsen bestehen, auch eine Anzahl von Rohproducten können täglich zur Veräusserung gebracht werden, andere Waaren werden an zwei oder drei Wochentagen gehandelt, für Getreide und sonstige Körnerfrüchte bestehen meist Wochenmärkte, für Manufacturwaaren Vierteljahrsmessen, für Pferde und sonstige Nutzthiere meist zwei oder mehr sogenannte Jahrmärkte etc.
Der Umstand nun, dass die zeitlichen Grenzen der Absatzfähigkeit der Waaren zum Theile weiter, zum Theile enger sind und innerhalb dieser Grenzen einige Waaren in jedem beliebigen Zeitpunkte, die anderen nur in mehr oder minder entfernten Zeitabschnitten zu ökonomischen Preisen zur Veräusserung gelangen können, ist die vierte Ursache der verschiedenen Absatzfähigkeit der Waaren.
Wenn wir einen Blick auf die Erscheinungen des wirthschiedenheit [246] der Absatzfähigkeit der einzelnen Waaren entgegentritt, so wird es uns nunmehr nicht schwer werden, dieselbe auf eine oder mehrere der oben dargelegten Ursach en zurückzuführen.
Wer eine Quantität Getreide besitzt, hat eine Waare in den Händen, deren er sich, dort wo Fruchtbörsen bestehen, so zu sagen jeden Augenblick, dort wo lediglich Wochenmärkte bestehen, doch jede Woche zu den der ökonomischen Sachlage entsprechenden Preisen entledigen kann, eine Waare, welche, um einen kaufmännischen und sehr bezeichnenden Ausdruck zu gebrauchen, gleichsam „baar Geld“ ist. Die Ursache hievon liegt in dem weiten Kreise von Personen, welche Bedarf an diesem Gute haben, in den weiten räumlichen, zeitlichen und quantitativen Grenzen der Absatzfähigkeit desselben, in der meist tüchtigen Organisation des Marktwesens und der lebhaften Speculation in dieser Waare.
Wer Rauhwaaren am Lager hat, wird in mehrfacher Beziehung etwas ungünstiger gestellt sein. Die quantitativen Grenzen der Absatzfähigkeit dieses Artikels sind viel enger, das Marktwesen ist weitaus nicht so wohl geregelt, als beim Getreide, die Märkte für diese Waare sind zeitlich und räumlich meist sehr entfernt von einander und die Speculation in diesem Artikel ist eine viel weniger lebhafte, als beim Getreide. Wer Weizen besitzt, wird sich fast unter allen Umständen seiner Waare entledigen können,falls er dieselbe um einige wenige Kreuzer unter der laufenden Notirung abgeben will, in Rauhwaaren wird dies nicht immer der Fall sein und es wird bei diesem Artikel leichter der Fall eintreten, dass der Eigner seine Waare nur mit verhältnissmässig grossen Verlusten, oder aber in einem gegebenen Momente wohl auch gar nicht umzusetzen in der Lage, und eine längere Zeit zuzuwarten gezwungen sein wird.
Und nun vergleiche man die Absatzfähigkeit des Getreides gar mit jener von solchen Artikeln, wie Fernröhre, Meerschaumwaaren, Topfgewächse im Allgemeinen, oder gar mit jener der minder gangbaren Sorten dieser Waaren!!
c) Ueber die Circulationsfähigkeit der Waaren.
Wir haben in dem Obigen die allgemeinen und besonderen Ursachen der verschiedenen Absatzfähigkeit der Waaren dargelegt, [247] oder, mit andern Worten, die Ursachen der grösseren, oder geringeren Leichtigkeit, mit welcher ein Eigner seine Waaren zu ökonomischen Preisen zu veräussern Aussicht hat. Damit wäre auch die Frage der grösseren, oder geringeren Leichtigkeit, mit welcher die verschiedenen Waaren durch mehrere Hände circuliren können, gelöst, indem jede Circulation einer Waare durch mehrere Hände sich doch lediglich aus den einzelnen Transactionen zusammensetzt, und eine Waare, die leicht aus der Hand ihres Eigners in die eines anderen wirthschaftenden Subjectes gebracht werden kann, auf den ersten Blick, eben so leicht ihren Weg aus der zweiten in die dritte Hand u. s. f. finden sollte. Diese Voraussetzung trifft jedoch erfahrungsgemäss nicht bei allen Waaren zu, und es wird in dem Nachfolgenden unsere Aufgabe sein, zu untersuchen, welche besonderen Gründe bewirken, dass ein Theil der Waaren leicht von Hand zu Hand circulirt, während das Gleiche bei den übrigen, und unter andern selbst bei Waaren von grosser Absatzfähigkeit nicht beobachtet werden kann.
Es giebt Waaren, welche in der Hand eines jeden wirthschaftenden Individuums nahezu die gleiche Absatzfähigkeit haben. Die Goldkörner, welcher ein schmutziger siebenbürger Zigeuner in dem Sande des Aranyos gewonnen hat, sind in seinen Händen eben so absatzfähig, als in jenen des Besitzers eines Goldbergwerkes, wofern er nur den richtigen Markt für seine Waaren aufzufinden weiss, und die Goldkörner können durch eine beliebige Anzahl von Händen gehen, ohne hiedurch an ihrer Absatzfähigkeit etwas einzubüssen. Kleidungsstücke, Bettstücke, zubereitete Speisen etc. wären dagegen in den Händen der obigen Person, falls sie dieselben auch nicht in Gebrauch gezogen, und selbst dann, wenn sie dieselben von vorn herein lediglich zum Zwecke der Weiterbegebung im Austausche übernommen hätte, verdächtig, fast unanbringlich und jedenfalls sehr entwerthet. Waaren dieser Art mögen in den Händen der betreffenden Producenten, oder gewisser Handelsleute noch so absatzfähig sein, sie büssen ihre Absatzfähigkeit ganz, oder doch zum Theile ein, wenn auch nur der Verdacht entsteht, dass 588.sie sich bereits im Gebrauche, oder auch nur in unsaubern Händen befunden haben, und sie sind deshalb nicht wohl geeignet, [248] im ökonomischen Austausche von Hand zu Hand zu circuliren.
Andere Waaren erfordern zu ihrem Vertriebe besondere Kenntnisse, Fertigkeiten, Verbindungen, oder behördliche Verwilligungen, Privilegien u. dgl. m. und sind in den Händen eines wirthschaftenden Subjectes, bei welchem diese Voraussetzungen nicht zutreffen, nicht, oder doch schwer veräusserlich und jedenfalls entwerthet. Waaren, die für den indischen oder südamerikanischen Verkehr bestimmt sind, Apothekerwaaren, Monopolartikel u. dgl. m. mögen in den Händen gewisser Personen sehr absatzfähig sein, in den Händen anderer Personen büssen sie dagegen einen grossen Theil ihrer Absatzfähigkeit ein und sind desshalb eben so wenig, wie die oben genannten Waaren, geeignet, von Hand zu Hand zu circuliren.
Selbst Güter, welche, um überhaupt verwendbar zu sein, dem Bedürfnisse des Consumenten erst noch besonders angepasst werden müssen, sind nicht in der Hand eines jeden Eigners in gleichem Masse absatzfähig. Schuhe, Hüte u. dgl. Artikel mehr, von welcher Grösse sie auch immer sein mögen, sind in den Händen eines Schuhwaarenhändlers, beziehungsweise eines Hutmachers, in dessen Werkstätte oder Kaufladen sich ein grosser Consumentenkreis versammelt, immer von einer gewissen Absatzfähigkeit, insbesondere da die obigen Geschäftsleute der Regel nach die Mittel in den Händen haben, um die Waare den speciellen Bedürfnissen ihrer Kunden anzupassen. In den Händen einer andern Person sind diese Waaren schwer und fast immer nur mit bedeutendem Verluste abzusetzen. Auch solche Waaren sind nicht dazu geeignet, von Hand zu Hand zu circuliren.
Auch Güter, deren Preis nicht wohl bekannt, oder bedeutenden Schwankungen ausgesetzt ist, sind nicht leicht von Hand zu Hand übertragbar. Dem Uebernehmer dieser Güter droht die Gefahr, dieselben zu „überzahlen,“ oder, bevor er sie weiter begeben hat, durch eine Minderung ihres Preises zu Schaden zu kommen. Eine „Partie Getreide“ pflegt auf Fruchtbörsen, und ein Posten gangbarer Effecten auf Geldbörsen leicht zehnmal während weniger Stunden die „Hände“ zu wechseln, während Landgüter oder gar Fabriken, deren Werth sich erst nach einer genauen Untersuchung aller Umstände feststellen lässt, zu einer [249] so raschen Circulation ganz und gar untauglich sind. Selbst Personen, welche ausserhalb der Börse stehen, nehmen leicht Effecten, deren Preis keinen beträchtlichen Schwankungen unterliegt, an Zahlungsstatt, während Waaren, die heftigen Preisschwankungen unterliegen, nicht leicht anders als „unter dem Preise“ circuliren können, da alle jene Personen, welche der Speculation ferne stehen, sich gegen Verluste sicher stellen wollen. Auch Waaren, deren Preis ein unbestimmter, beziehungsweise ein stark schwankender ist, sind demnach nicht wohl geeignet, von Hand zu Hand zu circuliren.
Klar ist endlich, dass die einzelnen, die Absatzfähigkeit der Waaren beschränkenden Momente überall dort, wo es sich um die Uebertragung derselben von Hand zu Hand, von Ort zu Ort und aus einem Zeitraume in den andern handelt, in potencirter Weise in's Gewicht fallen. Waaren, deren Absatzfähigkeit auf einen engen Kreis von Personen beschränkt, deren Absatzgebiet ein enges, deren Conservirungsdauer eine kurze, oder aber Waaren, deren Conservirung mit beträchtlichen ökonomischen Opfern verbunden ist, Waaren, welche jeweilig nur in eng begrenzten Quantitäten zu Markte gelangen können, deren Preise nicht wohl regulirt sind u. s. f., mögen in gewissen, wenn auch noch so engen Grenzen ein gewisses Mass der Absatzfähigkeit behaupten—circulationsfähig können sie aber nicht werden.
So stellt sich uns die Circulationsfähigkeit der Waaren als eine auf jedes wirthschaftende Subject, in dessen Händen sie sich befinden, erstreckende Absatzfähigkeit, im weitesten Sinne dieses Wortes, zugleich aber auch als eine solche dar, bei welcher nicht nur ein einzelnes Moment, sondern die sämmtlichen oben erwähnten vier Momente der höheren Absatzfähigkeit einer Waare zusammentreffen.
[250]
Achtes Capitel.
Die Lehre vom Gelde.↩
§. 1.
Ueber das Wesen und den Ursprung des Geldes [1].
In hen Anfängen des menschlichen Verkehrs, wo die Erkenntniss des ökonomischen Nutzens, welcher sich aus der Ausbeutung der vorhandenen Tauschgelegenheiten erzielen lässt, bei den wirthschaftenden Subjecten erst allmählig erwacht, ihre Zwecke, wie dies der Einfachheit aller Culturanfänge entspricht, vorerst nur auf das Nächstliegende gerichtet sind, und demgemäss Jedermann bei den Gütern, die er im Austausche erhalten soll, lediglich den Gebrauchswerth im Auge hat, werden die factisch zu Stande kommenden Tauschoperationen sich naturgemäss auf jene Fälle beschränken, wo Güter für die wirthschaftenden Subjecte, in deren Besitze sie sich befinden, einen geringeren Gebrauchswerth haben, als andere im Besitze anderer Subjecte befindliche Güter, während bei diesen letzteren Subjecten wiederum, rücksichtlich derselben Güter, das umgekehrte Verhältniss der Werthschätzung stattfindet. A besitzt ein Schwert, das für ihn einen geringeren Gebrauchswerth [251] hat, als der Pflug des B, während für B derselbe Pflug einen geringeren Gebrauchswerth hat, als das Schwert des A;—auf solche und ähnliche Fälle beschränken sich unter den obigen Verhältnissen nothwendigerweise die thatsächlich zur Ausführung gelangenden Tauschoperationen.
Nun ist es unschwer zu erkennen, dass unter solchen Verhältnissen die Zahl der thatsächlich zu Stande kommenden Tauschoperationen nur eine sehr eng begrenzte sein kann. Wie selten trifft sich nämlich der Fall, dass für eine Person ein in ihrem Besitze befindliches Gut einen geringeren Gebrauchswerth hat, als ein anderes im Besitze einer anderen Person befindliches, während zugleich für diese letztere gerade das umgekehrte Verhältniss stattfindet, um wie viel seltener noch der Fall, dass diese beiden Personen, selbst wenn das obige Verhältniss in einzelnen Fällen besteht, sich gegenseitig finden! A hat ein Fischnetz, das er gern gegen eine Quantität Hanf eintauschen möchte. Damit dieser Tausch wirklich zu Stande komme, ist nicht nur erforderlich, dass ein anderes wirthschaftendes Individuum B existire, das eine Quantität Hanf, wie sie den Wünschen des A entspricht, gegen das Fischnetz desselben hinzugeben bereit ist, sondern auch die weitere Voraussetzung, dass die beiden wirthschaftenden Individuen sich mit ihren Wünschen begegnen. Der Landwirth C besitzt ein Pferd, das er gern gegen eine Anzahl von Ackerbauwerkzeugen und Kleidungsstücken austauschen möchte. Wie unwahrscheinlich ist es nun gar, dass dieser letztere eine andere Person auffinden werde, welche seines Pferdes bedarf und zugleich in der Lage und Willens ist, ihm dafür die sämmtlichen von ihm begehrten Werkzeuge und Kleidungsstücke im Austausche hinzugeben?
Diese Schwierigkeit wäre eine geradezu unüberwindliche geworden, so zwar, dass den Fortschritten der Arbeitstheilung und zumal auch der Production von Gütern auf ungewissen Verkauf schwere Hemmnisse erwachsen sein würden, hätte nicht in der Natur der Dinge selbst ein Aushilfsmittel gelegen, welches, ohne dass eine besondere Uebereinkunft, oder gar ein staatlicher Zwang erforderlich gewesen wäre, die wirthschaftenden 597.Menschen aller Orten mit unabweislicher Gewalt zu [252] einem Zustande der Dinge führte, bei welchem die obige Schwierigkeit vollständig beseitigt erscheint.
Die directe Deckung des Bedarfes ist das Endziel aller wirthschaftlichen Bestrebungen der Menschen. Dieselben verfolgen bei ihren Tauschoperationen demnach ganz naturgemäss den Endzweck, sich für ihre Waaren solche Güter auszutauschen, welche für sie Gebrauchswerth haben, und ist dies Bestreben auf allen Culturstufen gleichmässig vorhanden und ökonomisch durchaus berechtigt. Die wirthschaftenden Individuen würden indess offenbar sehr unökonomisch handeln falls sie überall dort, wo dies Endziel nicht sofort und unmittelbar zu erreichen ist, es verschmähen würden, sich demselben überhaupt zu nähern.
Ein Waffenschmied des homerischen Zeitalters hat zwei kupferne Rüstungen verfertigt und gedenkt dieselben gegen Kupfer, Brennmaterialien und gegen Nahrungsmittel auszutauschen. Er begibt sich auf den Markt, bietet seine Waare gegen die obigen Güter aus und ist sicherlich sehr befriedigt, wenn er daselbst mit Personen zusammentrifft, die Rüstungen einzutauschen beabsichtigen und zugleich sämmtliche ihm nothwendige Rohmaterialien und Nahrungsmittel feilbieten. Es müsste indess offenbar als ein besonders glücklicher Zufall betrachtet werden, falls er unter der jeweilig geringen Zahl von Personen, welche ein so wenig absatzfähiges Gut, wie dies seine Rüstungen sind, einzutauschen beabsichtigen, gerade solche fände, welche jene Güter insgesammt ausbieten, deren er benöthigt. Er würde demnach auf den Austausch seiner Waaren verzichten, zum mindesten aber denselben nur mit bedeutendem Zeitverluste bewerkstelligen können, falls er so unökonomisch handeln würde, eben nur die ihm nöthigen Gebrauchsgüter im Austausche gegen seine Waaren annehmen zu wollen und nicht auch andere Güter, die zwar für ihn gleichfalls den Waarencharakter haben, aber von grösserer Absatzfähigkeit sind als die seinen, Waaren deren Besitz ihm demnach das Auffinden von Personen, welche eben jene Güter besitzen, deren er bedarf, bedeutend erleichtert. In den Zeiten, von welchen wir hier sprechen, ist das Vieh, wie wir weiter unten sehen werden, die absatzfähigste [253] unter der Voraussetzung, dass er bereits für seinen directen Bedarf genügend mit Vieh versorgt wäre, sehr unökonomisch handeln, falls er seine Rüstungen nicht auch gegen eine Anzahl von Häuptern Vieh hingeben würde. Er tauscht damit gegen seine Waare allerdings nicht Gebrauchsgüter (im engern, dem der „Waare“ entgegengesetzten Sinne dieses Wortes), sondern nur solche Güter ein, welche für ihn gleichfalls den Waarencharakter haben, wohl aber erhält er für seine minder absatzfähigen Waaren solche von grösserer Absatzfähigkeit und es ist klar, dass der Besitz dieser letzteren ihm die Wahrscheinlichkeit vervielfacht, am Markte Personen aufzufinden, welche die ihm selbst erforderlichen Gebrauchsgüter feil bieten. Unser Rüstungschmied wird demnach bei richtiger Erkenntniss seines individuellen Interesses naturgemäss, ohne Zwang, oder besondere Uebereinkunft dazu geführt werden, seine Rüstungen gegen eine entsprechende Anzahl Viehhäupter hinzugeben und mit den so gewonnenen absatzfähigeren Waaren sich zu jenen Marktbesuchern verfügen, welche Kupfer, Brennmaterialien und Nahrungsmittel feil bieten, um nunmehr mit vervielfachter Wahrscheinlichkeit und jedenfalls viel rascher und in ökonomischerer Weise seinen Endzweck, den Austausch der ihm nöthigen Gebrauchsgüter zu erreichen.
Das ökonomische Interesse der einzelnen wirthschaftenden Individuen führt sie demnach, bei gesteigerter Erkenntniss dieses ihres Interesses, ohne alle Uebereinkunft, ohne legislativen Zwang, ja ohne alle Rücksichtsnahme auf das öffentliche Interesse dazu, ihre Waaren gegen andere, absatzfähigere Waaren im Austausche hinzugeben, selbst wenn sie dieser letzteren für ihre unmittelbaren Gebrauchszwecke nicht bedürfen, und so tritt denn unter dem mächtigen Einflusse der Gewohnheit die allerorten mit der steigenden ökonomischen Cultur zu beobachtende Erscheinung zu Tage, dass eine gewisse Anzahl von Gütern, und zwar jene, welche mit Rücksicht auf Zeit und Ort die absatzfähigsten sind, von Jedermann im Austausche angenommen werden und desshalb auch gegen jede andere Waare umgesetzt werden können, Güter, welche unsere Vorfahren Geld nannten, von „gelten,“ das ist [254] „leisten, zahlen,“ wornach denn das Geld in unserer Sprache schlechthin das Zahlungsobject bedeutet [2].
Von welcher hohen Bedeutung gerade die Gewohnheit [3]für die Entstehung des Geldes ist, ergiebt sich unmittelbar aus der Betrachtung des eben dargelegten Processes, durch welchen [255] bestimmte Güter zum Gelde werden. Der Austausch von minder absatzfähigen Waaren gegen solche von höherer Absatzfähigkeit liegt im ökonomischen Interesse jedes einzelnen wirthschaftenden Individuums, aber der factische Abschluss solcher Tauschoperationen setzt die Erkenntniss dieses Interesses Seitens jener wirthschaftenden Subjecte voraus, welche ein ihnen an und für sich vielleicht gänzlich unnützes Gut um seiner höheren Absatzfähigkeit willen im Austausche gegen ihre Waaren annehmen sollen. Diese Erkenntniss wird niemals bei allen Gliedern eines Volkes zugleich entstehen. Vielmehr wird stets zunächst nur eine Anzahl von wirthschaftenden Subjecten den Vortheil erkennen, welcher ihnen dadurch erwächst, dass sie überall dort, wo ein unmittelbarer Austausch ihrer Waaren gegen Gebrauchsgüter nicht möglich, oder höchst ungewiss ist, gegen ihre Waaren andere, absatzfähigere Waaren im Austausche annehmen, ein Vortheil, der an und für sich unabhängig ist von der allgemeinen Anerkennung einer Waare als Geld, da immer und unter allen Umständen ein solcher Austausch das einzelne wirthschaftende Individuum seinem Endziele, der Erwerbung der ihm nöthigen Gebrauchsgüter um ein beträchtliches näher bringt. Da es nun aber kein besseres Mittel giebt, die Menschen über ihre ökonomischen Interessen aufzuklären, als die Betrachtung der ökonomischen Erfolge jener, welche die richtigen Mittel zur Erreichung derselben ins Werk setzen, so ist auch klar, dass nichts so sehr die Entstehung des Geldes begünstigte, als die Seitens der einsichtsvollsten und tüchtigsten wirthschaftenden Subjecte zum eigenen ökonomischen Nutzen durch längere Zeit geübte Annahme eminent absatzfähiger Waaren gegen alle andern. Solcherart haben Uebung und Gewohnheit sicherlich nicht wenig dazu beigetragen, die jeweilig absatzfähigsten Waaren zu solchen zu machen, welche nicht nur von vielen, sondern von allen wirthschaftenden Individuen im Austausche gegen ihre Waaren angenommen wurden [4].
[256]
Einen nicht zu leugnenden, wenn auch geringeren Einfluss auf den Geldcharakter einer Waare, pflegt innerhalb der staatlichen [257] Grenzen die Rechtsordnung zu haben. Der Ursprung des Geldes (zu unterscheiden von der Abart desselben der Münze) [258] ist wie wir sahen, ein durchaus naturgemässer, und er weist demnach auch nur in den seltensten Fällen auf legislative Einflüsse zurück. [259] Das Geldist keine staatliche Erfindung, nicht das Product eines legislativen Actes und die Sanction desselben Seitens der staatlichen [260] Autorität ist demnach dem Begriffe des Geldes überhaupt fremd. Auch die Existenz bestimmter Waaren als Geld hat sich naturgemäss aus den ökonomischen Verhältnissen herausgebildet, ohne dass die staatliche Einflussnahme hiebei erforderlich gewesen wäre.
Erhält nun aber in Uebereinstimmung mit den Bedürfnissen des Verkehres ein Gut die staatliche Sanction als Geld, so wird dadurch bewirkt, dass nicht nur jede Leistung an den Staat selbst, sondern auch alle übrigen Leistungen, deren Inhalt im concreten Fall nicht anderweitig normirt ist, namentlich also jede anstatt der ursprünglich festgestellten und aus irgend einem Grunde weggefallenen subsidiarisch eintretende Leistung nur in jenem Gute mit rechtlicher Wirkung gefordert und angeboten werden kann, dass also diesem Gute der Charakter der universellen Vertretungsfähigkeit von Staatswegen aufgedrückt wird, ein Umstand, der das betreffende Gut nicht erst zum Gelde macht, wohl aber seinen Geldcharakter bedeutend vervollkommnet [5].
§. 2.
Ueber das jedem Volke und jedem Zeitalter eigenthümliche Geld.
Das Geld ist kein Product des Uebereinkommens der wirthschaftenden Menschen, oder gar das Product legislativer Acte. Das Geld ist keine Erfindung der Völker. Die einzelnen wirthschaftenden Individuen im Volke gelangten allerorten mit der steigenden Einsicht in ihre ökonomischen Interessen zugleich auch zu der nahe liegenden Erkenntniss, dass durch die Hingabe minder absatzfähiger Waaren gegen solche von grösserer Absatzfähigkeit ihre speciellen ökonomischen Zwecke um einen bedeutenden Schritt gefördert werden und so entstand das Geld an zahlreichen von einander unabhängigen Culturcentren mit [261] der fortschreitenden Entwicklung der Volkswirthschaft. Aber eben desshalb, weil das Geld sich uns als ein naturgemässes Product der menschlichen Wirthschaft darstellt, war seine besondere Erscheinungsform auch allerorten und zu allen Zeiten das Ergebniss der besonderen und wechsolnden ökonomischen Sachlage und es haben bei denselben Völkern zu verschiedenen Zeiten, und bei verschiedenen Völkern zur selben Zeit verschiedene Güter jene eigenthümliche Stellung im Verkehre erlangt, auf welche wir oben hingewiesen haben.
In den frühesten Perioden wirthschaftlicher Entwicklung scheint bei den meisten Völkern der alten Welt das Vieh die absatzfähigste Waare geworden zu sein. Nutzthiere bilden bei Nomaden und allen aus dem Nomadenthume zur Bodenwirthschaft übergehenden Völkern den hauptsächlichsten Theil des Vermögensbesitzes jedes Einzelnen, und ihre Absatzfähigkeit erstreckt sich geradezu auf sämmtliche wirthschaftende Subjecte, bei dem Mangel an Kunststrassen und dem Umstande, dass das Vieh sich selbst transportirt (in den Culturanfägen nahezu kostenlos!) auf weitere räumliche Grenzen, als die der meisten andern Waaren. Vieh ist eine Waare von ausreichender Conservirungsfähigkeit, seine Erhaltungskosten sind dort, wo Weideland in Fülle vorhanden ist und die Thiere im Freien gehalten werden, verschwindend klein und dasselbe kann auf Culturstufen, wo Jedermann nach dem Besitze möglichst grosser Heerden strebt, auch nicht leicht in übergrosser Menge zu Markte gelangen, es ist deshalb auch in Rücksicht auf die zeitlichen und quantitativen Grenzen seiner Absatzfähigkeit begünstigt. Bei keiner andern Waare treffen in jener Epoche, von welcher wir hier sprechen, die Bedingungen einer auf weite Grenzen sich erstreckenden Absatzfähigkeit in gleicher Weise zusammen. Fügen wir nun noch hinzu, dass unter den obigen Verhältnissen der Verkehr mit Nutzthieren, wenn der irgend einer anderen Waare, sicherlich verhältnissmässig wohl entwickelt war, so stellt sich uns das Vieh als die absatzfähigste unter allen vorhandenen Waaren, als das natürliche Geld [6]der Völker der alten Welt dar.
[262]
Das gebildeteste Volk des Alterthumes, die Griechen, dessen Entwickelungsstufen uns die Geschichte in ziemlich deutlichen Umrissen erkennen lässt, zeigt uns denn auch selbst noch zu den Zeiten Homers in Handel und Wandel keine Spur unseres heutigen gemünzten Geldes. Jener war noch vorwiegend Tauschhandel, Heerden bilden den Reichthum der Menschen, in Vieh werden Zahlungen geleistet, die Preise der Waaren geschätzt und Strafbussen entrichtet. Noch Drakon legt Viehbussen auf, welche letztere erst Solon, offenbar nachdem sie sich bereits überlebt hatten, nach dem Massstabe von einer Drachme für das Schaf und von fünf Drachmen für das Rind in Metallgeld umschreibt. Viel deutlicher noch, als bei den Griechen lassen sich die Spuren des Viehgeldes bei den Viehzucht treibenden [263] Vorältern der Italiker erkennen. Bis in die spätere Zeit dient bei den Römern das Rind und daneben das Schaf als Tauschmittel. Die ältesten gesetzlichen Strafen sind Viehbussen (in Rindern und Schafen angesetzt), dieselben kommen noch in der lex Aternia Tarpeia v. J. 454 zum Vorscheine und werden erst 24 Jahre später in Beträge gemünzten Metalles umgesetzt [7]. Bei unseren Vorfahren, den alten Germanen, galt zu einer Zeit, wo sie, nach Tacitus, silbernes und thönernes Geschirr noch gleich hoch schätzten, ein grosser Viehstand und Reichthum für eins. Wie bei den Griechen des homerischen Zeitalters steht der Tauschhandel im Vordergrunde, doch dienen auch hier Viehstücke, zumal aber Pferde (daneben Waffen!) bereits als Tauschmittel. Vieh ist ihr liebster Besitz, den sie jedem andern vorziehen, in Vieh und Waffen, wie später in Metallgeld werden die gerichtlichen Bussen entrichtet [8]. Noch Otto der Grosse legt Viehbussen auf. Bei den Arabern hat die Viehwährung noch zu Mohamet's Zeiten bestanden [9]und bei den Völkern des östlichen Asiens, bei welchen die heiligen Schriften des Zoroaster, die Zendavesta Geltung hatten, haben andere Formen des Geldes die Viehwährung erst spät verdrängt, nachdem die Nachbarvölker schon längst zum Metallgelde übergegangen waren [10]. Dass das Vieh bei den Hebräern [11], den Kleinasiaten und den Bewohnern von Mesopotamien in vorhistorischer Zeit als Geld im Gebrauche war, mag vermuthet werden; Belege hiefür finden sich incht. Alle diese Völker treten auf einer Culturstufe in die Geschichte, wo sie die Viehwährung bereits hinter sich hatten, wofern man auf eine solche aus der Analogie der spätern Entwickelung und dem Umstande, dass es der Einfachheit der Culturanfänge entgegen zu sein scheint, [264] grosse Zahlungen in Metall, oder Metallgeräthen zu leisten, überhaupt schliessen darf [12].
Die fortschreitende Cultur, zumal die Trennung der Beschäftigungen und die natürliche Folge dieser Trennung, die allmälige Begründung von Städten mit vorwiegend Industrie treibender Bevölkerung, müssen indess allenthalbenzur Folge haben, dass die Absatzfähigkeit des Viehes in demselben Masse schwindet, in welchem sie bei andern Waaren, zumal bei den Nutzmetallen, zunimmt. Der Handwerker, der mit dem Ackerbauer einen Tausch eingeht, ist wohl nur ausnahmsweise in der Lage, Vieh als Geld anzunehmen, und unter allen Umständen ist für den Stadtbewohner der vorübergehende Besitz von Vieh nicht nur lästig, sondern zugleich mit beträchtlichen ökonomischen Opfern verbunden. Selbst für den Landwirth bedeutet die Verwahrung und Verpflegung des Viehes nur insolange kein nennenswerthes ökonomisches Opfer, als ihm Weideflächen in beliebiger Menge zur Verfügung stehen und man das Vieh im Freien zu halten gewöhnt ist. Das Vieh büsst demnach mit der fortschreitenden Culturentwicklung die weiten Grenzen seiner Absatzfähigkeit rücksichtlich des Kreises von Personen, an welche, und des Zeitraumes, innerhalb dessen es in ökonomischer Weise abgesetzt werden kann, grossentheils ein, während es in Rücksicht auf die räumlichen und quantitativen Grenzen seiner Absatzfähigkeit gegen andere Güter immer mehr in den Hintergrund tritt. Es hört auf, die absatzfähigste Waare, das ökonomische Geld und damit schliesslich und endlich überhaupt Geld zu sein.
Alle Culturvölker, bei welchen ehedem das Vieh den Charakter des Geldes hatte, haben denn auch mit dem Uebergange aus dem Nomadenthume und der reinen Bodenwirthschaft in die spätere, daneben Gewerbe treibende Epoche, das Viehgeld verlassen und zu den Nutzmetallen, und unter diesen hauptsächlich zu den um ihrer leichten Gewinnung und Geschmeidigkeit willen zuerst von den Menschen bearbeiteten: dem Kupfer, dem Silber, dem Golde, in einzelnen Fällen auch zum Eisen gegriffen, ein Uebergang, der, sobald er nothwendig geworden, um so leichter erfolgte, als überall neben der Viehwährung ohne [265] Zweifel schon früher bei kleinern Zahlungen Metallgeräth und das Rohmaterial selbst als Geld in Verwendung stand.
Kupfer war das älteste Metall, aus welchem der Ackerbauer seinen Pflug, der Krieger seine Waffen, der Handwerker seine Werkzeuge verfertigte, Kupfer, Gold und Silber das älteste Material für Geschirr und Schmuck aller Art. Auf jener Culturstufe, wo die Völker vom Vieh- zum blossen Metallgelde übergiengen, waren solcherart das Kupfer, und etwa noch einige Legirungen desselben, Güter des allgemeinsten Gebrauches, Gold und Silber, als die wichtigsten Mittel zur Befriedigung der allgemeinsten Leidenschaft niedrig cultivirter Menschen, der Sucht, vor den Stammesgenossen äusserlich hervorzuglänzen, Güter des allgemeinsten Wunsches. Fügen wir nun noch hinzu, dass diese Metalle, so lange es der Verwendungen wenige gab, in verarbeitetem Zustande, später, als Rohmaterialien von unbegrenzter Verwendbarkeit und Theilbarkeit, in ihrer Absatzfähigkeit weder auf einen engen Kreis von wirthschaftenden Personen, noch auch wegen ihres allen Völkern gemeinsamen Gebrauches und ihres leichten und mit relativ geringen ökonomischen Opfern verbundenen Transportes, auf enge räumliche Grenzen, wegen ihrer Dauerhaftigkeit in dieser Rücksicht ebensowenig auf enge zeitliche Grenzen beschränkt waren und bei der allgemeinen Concurrenz um dieselben auch in höherem Masse, als irgend eine andere Waare in jeder gegebenen Quantität zu ökonomischen Preisen verausgabt werden konnten (S. 214), so haben wir die wirthschaftliche Sachlage vor unseren Augen, bei deren Bestande die drei erwähnten Metalle, als die absatzfähigsten Güter, zum ausschliesslichen Tauschmittel der auf das Nomadenthum und die reine Bodenwirthschaft folgenden Epoche wurden.
Dieser Uebergang hat sich weder plötzlich, noch bei allen Völkern in gleicher Weise vollzogen. Die neuere Metall-Währung mag lange neben der ältern Viehwährung im Gebrauche gewesen sein, bevor sie dieselbe völlig verdrängte und die Bewerthung eines Viehstückes in dem zum Gelde gewordenen Metalle auch späterhin, als das letztere ausschliesslich den Verkehr durchdrang, sich als Masseinheit erhalten haben. Die Dekaboion, Tesseraboion, Hekatomboion der Griechen und das älteste Metall-Geld der Römer und Gallier mag solcher Art gewesen [266] sein und das auf den Metallstücken erscheinende Thier-Bild, das Symbol dieser Bewerthung [13].
Dass das Kupfer, beziehungsweise die Bronze, als das wichtigste Nutzmetall, das ältere Tauschmittel gewesen, und die edlen Metalle erst später als Geld in Function traten, ist zum mindesten ungewiss. Im Osten von Asien, in China, vielleicht auch in Indien ist die Kupferwährung allerdings zur vollständigsten Ausbildung gelangt und ebenso in Central-Italien das Kupfer zu einer eigenthümlichen Währung entwickelt worden. In den uralten Culturgebieten des Euphrat und Tigris finden sich dagegen nicht einmal Spuren des ehemaligen Bestandes einer selbstständigen Kupferwährung und in Vorderasien, Aegypten, in Griechenland, Sicilien und Unter - Italien ist die selbstständige Ausbildung derselben, wo sie überhaupt bestand, durch die grossartige Entwicklung des Waarenaustausches im Mittelmeere, welcher mit Kupfer füglich nicht betrieben werden konnte, aufgehalten worden. Fest steht dagegen, dass alle Völker, welche durch die äusseren Verhältnisse, unter welchen sich ihre wirthschaftliche Cultur entwickelte, zur Kupferwährung geführt wurden, mit den Fortschritten der Culturentwicklung, zumal aber mit der räumlichen Ausdehnung ihres Waarenverkehres von den minder kostbaren Metallen zu den kostbareren, vom Kupfer und Eisen zum Silber und Golde, und dort, wo die Silberwährung in Aufnahme kam, zur Goldwährung übergingen, oder bei ihnen doch die Tendenz hiezu besteht, wenngleich auch der Uebergang selbst nicht überall thatsächlich erfolgt ist. Im engen Verkehre einer alten sabinischen Stadt mit der umliegenden Landschaft und bei der Einfachheit sabinischer Sitte war, sobald die Viehwährung sich überlebt hatte, das den praktischen Zwecken der Landleute, wie der Stadtbewohner in gleicher Weise dienliche wichtigste Nutzmetall, das Kupfer, allerdings diejenige Waare, deren Absatzfähigkeit sich auf den weitesten Kreis von Personen erstreckte und in quantitativer Beziehung die weitesten Grenzen hatte—in den Anfängen der Cultur die wichtigsten Erfordernisse des Geldes—ein Gut überdiess, dessen leichte und kostenlose Conservirung [267] und Aufbewahrung in kleinern Beträgen und dessen relativ billiger Transport dasselbe innerhalb enger räumlicher Grenzen in ausreichender Weise zu Geldzwecken qualificirten. Sobald jedoch die Grenzen des Verkehrs sich erweitern und grosse Waarenumsätze stattfinden, verliert das Kupfer naturgemäss eben so sehr an Geldtüchtigkeit, als die edlen Metalle immer mehr und mehr zu den absatzfähigsten Waaren der fortgeschrittenen Culturepochen werden, mit ihrem die ganze Erde umspannenden Waarenverkehr, ihren grossen Waarenumsätzen und dem mit der steigenden Arbeitstheilung immer mehr hervortretenden Bedürfnisse jedes einzelnen wirthschaftenden Subjectes, Geld bei sich zu führen. Die edlen Metalle werden mit der fortschreitenden Cultur zu den absatzfähigsten Waaren und damit zum natürlichen Gelde wirthschaftlich fortgeschrittener Völker.
Die Geschichte anderer Völker bietet uns ein sehr verschiedenes Bild ihrer wirthschaftlichen Entwicklung und demgemäss auch ihres Geldwesens dar.
Als Mexiko das erstemal von Europäern betreten wurde, scheint dasselbe, nach den Berichten zu schliessen, welche Augenzeugen über den damaligen Zustand des Landes veröffentlicht haben, bereits einen nicht gewöhnlichen Grad wirthschaftlicher Cultur erreicht zu haben. Es ist aber das Verkehrswesen der alten Azteken für uns aus doppeltem Grunde von besonderem Interesse. Einerseits beweist es uns, dass der ökonomische Gedanke, welcher die Menschen bei ihrer auf die möglichst vollständige Befriedigung ihrer Bedürfnisse gerichteten Thätigkeit leitet, überall zu analogen ökonomischen Erscheinungen führt, andererseits bietet uns das alte Mexiko das Bild eines Landes dar, welches sich in dem Uebergangsstadium aus dem blossen Tauschhandel zur Geldwirthschaft befindet, das Bild von Zuständen demnach, an welchen wir den eigenthümlichen Process, durch welchen eine Anzahl von Gütern aus dem Kreise aller andern hervortreten und zum Gelde werden, unmittelbar beobachten können.
Die Berichte der Eroberer und zeitgenössischer Schriftsteller schildern uns Mexiko als ein Land mit zahlreichen Städten und einem wohlgeregelten grossartigen Güterverkehre. [268] In den Städten werden täglich Märkte gehalten, alle fünt Tage aber Hauptmärkte, welche in solcher Weise über das Reich vertheilt sind, dass der Hauptmarkt keiner Stadt durch die Concurrenz eines benachbarten beeinträchtigt wird. Für den Waarenverkehr bestehen in jeder Ortschaft eigene grosse Plätze, auf welchen wiederum für jede Waare ein bestimmter Ort angewiesen ist, ausserhalb welches sie nicht verkauft werden darf, und sind nur für die Nahrungsmittel und schwer transportable Gegenstände (Hölzer, Gerbstoffe, Steine etc.) Ausnahmen hievon gestattet. Die Zahl der Personen, welche sich auf dem Markte der Hauptstadt Mexiko versammeln, wird an gewöhnlichen Tagen auf 20–25,000, an Haupttagen auf 40–50,000 geschätzt und die Waaren, welche hier umgesetzt werden, sind von sehr grosser Mannigfaltigkeit [14].
Hier entsteht nun die interessante Frage, ob auf den Märkten des alten Mexiko, welche so viele Analogien mit denen der alten Welt aufweisen, nicht auch bereits unserem Gelde, dem Wesen und dem Ursprunge nach, analoge Erscheinungen zu Tage getreten sind.
Thatsächlich berichten die spanischen Eroberer, dass der Verkehr Mexiko's zur Zeit, als sie das Land zum erstenmale betraten, sich lange nicht mehr ausschliesslich in den Grenzen des reinen Tauschverkehrs bewegt habe, sondern bereits einige Waaren jene eigenthümliche Stellung im Güterverkehre erlangt hatten, welche wir oben eines weiteren dargelegt haben, das ist die Stellung des Geldes. Kakaobohnen in Säckchen zu 8–24,000 Stück, gewisse kleine Baumwolltücher, Goldstaub in Gänsekielen, die nach Verhältniss ihrer Grösse angenommen wurden (die Wage und Wägin strumente überhaupt waren den alten Mexikanern unbekannt), Kupferstücke und endlich dünne Stücke Zinn scheinen diejenigen Waaren gewesen zu sein, welche dort, wo ein unmittelbarer Austausch von Gebrauchsgütern nicht zu erzielen war, von Jedermann bereitwillig (als Geld) angenommen wurden, auch wenn die betreffende Person ihrer unmittelbar nicht bedurfte. Von Waaren, welche auf den mexikanischen Märkten umgesetzt wurden, werden von den [269] Augenzeugen die nachfolgenden erwähnt: Lebende und todte Thiere, Kakao, alle sonstigen Esswaaren, Edelsteine, Medicinalwaaren, Kräuter, Gummen, Harze, Erden, bereitete Heilmittel, aus den Fäden der Aloe, der Bergpalme und aus Thierhaaren bereitete Waaren, ferner Arbeiten aus Federn, Holz und Steinen, endlich Gold, Kupfer, Zinn, Holz, Steine, Gerbstoffe und Felle. Zieht man nun diese Waaren und den Umstand in Betracht, dass Mexiko zur Zeit, wo es von den Europäern entdeckt wurde, bereits ein fortgeschrittenes, industrietreibendes Land mit einer zahlreichen städtischen Bevölkerung war, aus diesem Grunde und weil es die meisten unserer Nutzthiere nicht kannte, eine Viehwährung ganz ausser Betracht kommt, und berücksichtigt man ferner, dass Kakao das tägliche Getränke, Baumwollstoffe das allgemeinste Bekleidungsmittel, Gold, Kupfer und Zinn die gebräuchlichsten Nutzmetalle des Aztekenvolkes waren, Güter also, welche ihrer innern Natur, wie ihrem allgemeinen Gebrauche nach eine über alle übrigen Waaren hervorragende Absatzfähigkeit besassen, so ist unschwer zu erkennen, warum eben diese Güter zum Gelde des Aztekenvolkes wurden. Sie waren das natürliche, wenn auch noch wenig entwickelte Geld des alten Mexiko.
Analoge Ursachen bewirken, dass unter Jägervölkern, insoferne dieselben auswärtigen Handel treiben, Thierfelle zum Gelde werden. Bei Jägervölkern wird naturgemäss ein Ueberfluss an Pelzwerk bestehen, da die Versorgung einer Familie mit Nahrungsmitteln auf dem Wege der Jagd die Anhäufung von so grossen Quantitäten von Thierfellen zur Folge hat, dass unter den einzelnen Mitgliedern des Jägerstammes höchstens eine Concurrenz um besonders schöne oder seltene Species von Thierfellen entstehen kann. Tritt ein Jägerstamm indess mit fremden Vökern in Tauschverkehr und entsteht ein Markt für Thierfelle, auf welchem hiefür zahlreiche Gebrauchsgüter, je nach der Wahl der Pelzjäger, eingetauscht werden können, so ist nichts natürlicher, als dass das Pelzwerk zum absatzfähigsten Gute und somit auch bei allfälligen Täuschen der Pelzjäger unter sich selbst mit Vorliebe im Tausche angenommen wird. Der Pelzjäger A benöthigt allerdings nicht die Thierfelle des Pelzjägers B, die er im Tausche annimmt, [270] ihm ist indess bewusst, dass er dieselben leicht gegen andere ihm nützliche Gebrauchsgüter am Markte auszutauschen in der Lage ist, und er zieht dieselben demnach, obgleich sie für ihn auch nur den Charakter von Waaren haben, doch andern allfällig in seinem Besitze befindlichen Waaren von geringerer Absatzfähigkeit vor. Wir können denn auch in der That beobachten, dass das eben dargelegte Verhältniss fast bei allen Jägerstämmen, welche mit dem Pelzwerke auswärtigen Handel treiben, vorhanden ist [15].
Der Umstand, dass Salztafeln und Sclaven im Innern von Africa, Wachskuchen am obern Amazonenstrome, Stockfische in Island und in Neufoundland, Tabak in Maryland und Virginien, Zucker im englischen Westindien, Elfenbein in der Nachbarschaft der portugiesischen Besitzungen zum Gelde wurden, erklärt sich aus dem Umstande, dass diese Güter daselbst die hauptsächlichen Handelsartikel bildeten, oder noch bilden, und demgemäss, gleichwie das Pelzwerk bei Jägervölkern, eine eminente Absatzfähigkeit erlangten, wie andererseits der örtliche Geldcharakter vieler anderen Güter auf ihren örtlich grossen und allgemeinen Gebrauchswerth und die hieraus resultirende grosse Absatzfähigkeit derselben zurückzuführen ist, so z. B. der Geldcharakter der Datteln auf der Oase von Siwah, der Theeziegeln in Hochasien und in Sibirien, der Glasperlen in Nubien und Senar, des Ghussub, einer Art Hirse, im Reiche Ahir (Africa), oder auf beide Momente, wie dies z. B. bei den Kauris der Fall ist, welche allgemein beliebter Schmuck und Handelswaare zugleich sind [16].
[271]
So stellt sich uns das Geld denn auch in seinen besonderen örtlich und zeitlich verschiedenen Erscheinungsformen nicht als das Ergebniss einer Uebereinkunft, oder eines legislativen Zwanges, eben so wenig aber auch als ein solches des blossen Zufalles dar, sondern als das naturgemässe Product der verschiedenen ökonomischen Sachlage verschiedener Völker in denselben, und derselben Völker in verschiedenen Zeitperioden.
§. 3.
Das Geld als „Massstab der Preise“ und als ökonomischeste Form der Tauschvorräthe.
Wenn in Folge der fortschreitenden Entwickelung des Verkehres und der Functionirung des Geldes sich ein wirthschaftlicher Zustand herausbildet, bei welchem Waaren aller Art gegen einander umgesetzt werden, und die Grenzen, innerhalb welcher die Preisbildung erfolgt, unter dem Einflusse einer lebhaften Concurrenz immer enger werden (S. 184 ff.), so liegt die Annahme nahe, dass alle Waaren, mit Rücksicht auf einen gegebenen Ort und Zeitpunkt, in einem gewissen Preisverhältnisse zu einander stehen, auf Grund welches sie gegen einander beliebig umgesetzt werden können.
Setzen wir den Fall, die Preisbildung der unten angeführten Waaren, (wobei bestimmte Qualitäten vorausgesetzt werden.) erfolge auf einem gegebenen Markte und in einem gegebenen Zeitpunkte in der nachstehenden Weise:
| Effective Preise: | Durchschnittspreise: | |
|---|---|---|
| per Centner. | ||
| Zucker: | 24 –26 Thlr. | 25 Thlr. |
| Baumwolle: | 29 –31 Thlr. | 30 Thlr. |
| Weizenmehl: | 5½– 6½ Thlr. | 6 Thlr. |
Nimmt man nun an, dass der Durchschnittspreis einer Waare derjenige ist, zu welchem sie ebensowohl gekauft als verkauft werden kann, so erscheinen uns in dem obigen Falle z. B. 4 Ctr. Zucker als das „Aequivalent“ von 3 1/3 Ctr. Baumwolle, diese letzteren als das „Aequivalent“ von 16 2/3 Ctr. Weizenmehl und von 100 Thlrn. und so umgekehrt, und wir brauchen dann nur das so verstandene Aequivalent einer Waare, oder eines von den vielen Aequivalenten derselben, ihren „Tauschwerth,“ [272] die Geldsumme aber, für welche sie ebensowohl erworben, als auch veräussert werden kann, ihren „Tauschwerth im vorzugsweisen Sinne“ zu nennen, um zu der in unserer Wissenschaft herrschenden Anschauung vom Tauschwerthe im Allgemeinen und von dem Gelde, als „Massstab des Tauschwerthes,“ insbesondere zu gelangen.
„In einem Lande, in welchem ein lebhafter Verkehr besteht,“ schreibt Turgot, „wird jede Güterart einen laufenden Preis im Verhältnisse zu jeder andern Güterart erlangen, so zwar, dass eine bestimmte Quantität der einen Art sich uns als das Aequivalent einer bestimmten Quantität jeder andern darstellen wird. Um nun den Tauschwerth eines Gutes insbesondere auszudrücken, genügt es offenbar, die Quantität einer andern bekannten Waare zu nennen, welche das Aequivalent jenes Gutes bildet. Es ist aber hieraus ersichtlich, dass alle Gütergattungen, welche Objecte des Verkehres sein können, sich, wenn man so sagen darf, gegenseitig messen, und dass jede einzelne als Massstab für alle andern dienen kann.“ In ähnlicher Weise sprechen sich fast alle übrigen Nationalökonomen aus und kommen, gleichwie Turgot, im Verlaufe seiner berühmten Abhandlung über die Entstehung und Vertheilung des Volksvermögens [17]zum Schlusse, dass das Geld unter allen möglichen „Massstäben des Tauschwerthes“ der zweckmässigste und deshalb auch der allgemeinste sei. Der einzige Fehler dieses Massstabes liege in dem Umstande, dass der Werth des Geldes selbst keine fixe, sondern eine wandelbare Grösse [18]sei und dasselbe somit wohl für jeden gegebenen Zeitpunkt, nicht aber für verschiedene Zeitpunkte einen sichern Massstab des „Tauschwerthes“ abgebe.
Nun haben wir in der Lehre vom Preise gezeigt, dass Güter-Aequivalente im objectiven Sinne des Wortes nirgends in der Wirthschaft der Menschen beobachtet werden können (S. 172 ff.) und die ganze obige Theorie, wornach das Geld als „Massstab des Tauschwerthes“ der Güter hingestellt wird, zerfällt demnach [273] in nichts, denn die Grundlage derselben ist eine Fiction, ein Irrthum.
Wenn auf einem Wollmarkte der Centner Wolle irgend einer bestimmten Qualität in dem einen Falle für 103 fl. verkauft wird, finden nicht selten am selben Markte gleichzeitig Transactionen zu höheren und zu niedrigeren Preisen, z. B. zu 104, 103½ und zu 102 und 102½ fl. statt, und während die am Markte noch vorhandenen Käufer sich bereit erklären, mit 101 fl. zu „nehmen,“ wollen die Verkäufer gleichzeitig nur mit 105 fl. „geben.“ Was ist in einem solchen Falle der „Tauschwerth“ eines Centners Wolle? Oder umgekehrt, welche Quantität von Wolle ist z. B. der „Tauschwerth“ von 100 fl.? Offenbar lässt sich nur sagen, dass ein Centner Wolle innerhalb der Grenzen von 101–105 fl. auf dem in Rede stehenden Markte und in dem gegebenen Zeitpunkte abgesetzt, beziehungsweise erstanden werden kann, aber eine bestimmte Quantität von Wolle und eine bestimmte Quantität von Geld, (oder sonst einer Waare,) welche wechselseitig umgetauscht werden könnten, also Aequivalente im objectiven Sinne des Wortes sind nirgends zu beobachten—nirgends vorhanden, und es kann demnach auch von einem Masse dieser Aequivalente (des „Tauschwerthes“) nicht die Rede sein.
Wohl hat das practische Leben mit Rücksicht auf manche wirthschaftliche Zwecke auch das Bedürfniss nach Schätzungen von ungefährer Genauigkeit, zumal nach solchen in Gelde, zu Tage gefördert, und werden in allen Fällen, wo es nur auf eine annäherungsweise Richtigkeit der Berechnungen ankommt, die Durchschnittspreise, als diejenigen, welche diesem Zwecke im allgemeinen am besten entsprechen, mit Recht den bezüglichen Schätzungen zu Grunde gelegt. Es ist aber klar, dass diese Methode der Schätzung von Gütern, wo immer es auf einen höheren Grad von Genauigkeit ankommt, sich selbst für das practische Leben als völlig unzureichend, ja geradezu als irreführend erweisen müsste. Ueberall dort, wo es sich um eine genaue Schätzung handelt, muss vielmehr, je nach der Absicht des Schätzenden, ein Dreifaches unterschieden werden. Die Absicht des Schätzenden kann darauf gerichtet sein:
1. den Preis zu berechnen, für welchen bestimmte Güter, [274] wenn sie zu Markte gebracht würden, veräussert werden könnten,
2. den Preis zu berechnen, für welchen Güter bestimmter Art und Beschaffenheit am Markte erstanden werden könnten, und
3. eine Waarenquantität, beziehungsweise eine Geldsumme zu berechnen, welche für ein bestimmtes Subject das Aequivalent eines Gutes, beziehungsweise einer Güterquantität ist.
Die Lösung der beiden ersten Aufgaben ergiebt sich bereits aus dem Gesagten. Die Preisbildung erfolgt, wie wir sahen, jeweilig zwischen zwei Extremen, von welchen man das niedere auch den Nachfragepreis (Preis, zu welchem die Waare am Markte gesucht wird), das höhere den Anbotpreis (Preis, zu welchem die Waare am Markte ausgeboten wird) nennen könnte. Der erstere wird der Regel nach die Grundlage der Berechnung ad 1), der letztere die Grundlage jener ad 2) bilden. Schwieriger ist die Beantwortung der dritten Frage, indem hiebei die besondere Stellung, welche das Gut, beziehungsweise die Güterquantität, deren Aequivalent (im subjectiven Sinne des Wortes) in Frage ist, in der Wirthschaft des betreffenden Subjectes einnimmt, zumal aber der Umstand in Betracht gezogen werden muss, ob das Gut überwiegenden Gebrauchswerth, oder überwiegenden Tauschwerth für dasselbe hat, bei Güterquantitäten aber auch noch die Theilquantität, rücksichtlich welcher das eine und das andere der Fall ist.
A besitzt die Güter a, b, c, welche für ihn überwiegenden Gebrauchswerth, und die Güter d, e, f, welche für ihn überwiegenden Tauschwerth haben. Die Geldsumme, welche er aus der Veräusserung der erstern voraussichtlich lösen könnte, wäre für ihn kein Aequivalent dieser Güter, weil der Gebrauchswerth derselben für ihn der höhere, der ökonomische ist. Vielmehr wird für ihn nur jener Betrag, für welchen gleiche Güter, oder aber doch solche, die für ihn einen gleichen Gebrauchswerth haben, erstanden werden könnten, ein Aequivalent derselben sein. Was dagegen die Güter d, e, f anbelangt, so sind sie Waaren, also ohnehin zum Austausche bestimmt, und zwar dem [275] und der voraussichtlich dafür zu erzielende Preis ist für das wirthschaftende Subject A allerdings der Regel nach das Aequivalent dieser Güter. Die richtige Bestimmung des Aequivalentes eines Gutes kann demnach nicht anders, als mit Rücksichtnahme auf den Besitzer und die wirthschaftliche Stellung des Gutes zu demselben vorgenommen werden, und die Bestimmung des Aequivalentes eines Gütercomplexes, beziehungsweise eines Vermögens, hat die gesonderte Berechnung des Aequivalentes der Gebrauchsgüter und jenes der Waaren zur nothwendigen Voraussetzung [19].
Muss nach dem Gesagten, gleichwie die Theorie des „Tauschwerthes“ überhaupt, so auch in nothwendiger Consequenz hievon die Theorie vom Gelde als „Massstab des Tauschwerthes“ insbesondere, als unhaltbar bezeichnet werden, so lehrt uns doch die Betrachtung der Natur und der Function des Geldes, dass die verschiedenen Schätzungen, von welchen wir soeben sprachen (zu unterscheiden von der Messung des „Tauschwerthes“ der Güter), der Regel nach doch am zweckmässigsten in Gelde erfolgen werden. Der Zweck der beiden erstern Schätzungen ist die Berechnung der Güterquantitäten, für welche eine Waare in einem gegebenen Zeitpunkte und auf einem gegebenen Markte veräussert, beziehungsweise erstanden werden könnte. Diese Güterquantitäten würden, falls die bezüglichen Transactionen thatsächlich zur Ausführung gelangten, der Regel nach doch nur in Gelde bestehen und die Kenntniss der Geldsummen, für welche eine Waare veräussert, beziehungsweise erstanden werden kann, ist somit naturgemäss der nächste, in der ökonomischen Aufgabe der Schätzung begründete Zweck derselben.
[276]
Es ist aber das Geld unter entwickelten Verkehrsverhältnissen zugleich diejenige Waare, in welcher allein die Schätzung aller andern ohne Umwege vorgenommen werden kann. Wo der Tauschhandel im engeren Sinne des Wortes verschwindet und im Grossen und Ganzen nur Geldsummen als Preise der verschiedenen Waaren thatsächlich zur Erscheinung gelangen, dort fehlt es nämlich an der sichern Grundlage für jede andere Schätzung. Eine Schätzung von Getreide, oder Wolle in Geld ist z. B. verhältnissmässig sehr einfach, eine Schätzung von Wolle in Getreide, oder umgekehrt von Getreide in Wolle, aber schon desshalb mit grössern Schwierigkeiten verbunden, weil ein unmittelbarer Austausch dieser beiden Güter nicht, oder doch nur in den seltensten Ausnahmsfällen vorkommt, und demnach die Grundlage der Schätzung, die bezüglichen effectiven Preise fehlen. Eine Schätzung dieser Art ist demnach zumeist nur auf Grundlage einer Berechnung möglich, welche die Schätzung der bezüglichen Güter in Gelde bereits zur Voraussetzung hat, während die Schätzung eines Gutes in Gelde unmittelbar auf Grundlage der vorhandenen Effectivpreise erfolgen kann.
Die Schätzung von Waaren in Gelde entspricht demnach, nicht nur, wie wir oben sahen, am besten den gewöhnlichen practischen Zwecken der Schätzung, sondern ist auch rücksichtlich der practischen Durchführung das nächstliegende, das einfachere, eine Schätzung in anderen Waaren, das complicirtere Vorgehen, welches die erstere Schätzung bereits zur Voraussetzung hat.
Ein gleiches gilt auch rücksichtlich der Berechnung der Güteräquivalente im subjectiven Sinne des Wortes, denn diese letztere hat, wie wir sahen, wiederum die beiden erstern Schätzungen zu ihrer Grundlage und Voraussetzung.
Es ist somit klar; warum eben das Geld diejenige Waare ist, in welcher Schätzungen der Regel nach vorgenommen werden und in diesem Sinne, (als Waare, in welcher unter entwickelten Verkehrsverhältnissen Schätzungen der Regel nach [20]am zweckmässigsten [277] vorgenommen werden,) mag man dasselbe immerhin einen Preismassstab nennen. [21]
Die gleiche Ursache bewirkt, dass das Geld auch das vorzüglichste Mittel zur Anlage aller jener Vermögensbestandtheile ist, mittelst welcher der Besitzer andere Güter (sei es nun Genuss- oder Productionsmittel) einzutauschen beabsichtiget. Diejenigen Vermögenstheile, welche ein wirthschaftendes Individuum dazu bestimmt, um sich mittelst derselben Genussmittel einzutauschen, [278] erlangen dadurch, dass sie zunächst gegen Geld umgesetzt werden, jene Form, in welcher der Besitzer seine Bedürfnisse jeweilig am raschesten und sichersten zu befriedigen vermag, und auch rücksichtlich desjenigen Theiles des Capitals eines wirthschaftenden Individuums, welcher nicht bereits aus Elementen der beabsichtigten Production besteht, ist aus dem gleichen Grunde die Geldform viel zweckmässiger, als jede andere, denn jede Waare anderer Art muss erst gegen Geld ausgetauscht werden, um weiter gegen die erforderlichen Productionsmittel umgesetzt werden zu können. In der That lehrt uns die tägliche Erfahrung, dass die wirthschaftenden Menschen denjenigen Theil ihres Consumtionsvorrathes, welcher nicht aus Gütern, die zur directen Befriedigung ihrer Bedürfnisse dienen, sondern aus Waaren besteht, gegen Geld umzusetzen bemüht sind und auch jenen Theil ihres Capitals, welcher nicht aus Elementen der beabsichtigten Production besteht, zunächst zu Gelde machen, um solcherart ihre wirthschaftlichen Zwecke um einen nicht unwesentlichen Schritt zu fördern.
Als irrthümlich muss dagegen jene Ansicht bezeichnet werden, welche dem Gelde als solchen zugleich die Function zuschreibt, „Werthe“ aus der Gegenwart in die Zukunft zu übertragen; denn, obzwar das Metallgeld wegen seiner Dauerhaftigkeit, der wenig kostspieligen Conservirung desselben etc., allerdings auch zu diesem Zwecke geeignet ist, so ist doch klar, dass andere Waaren hiezu eine noch höhere Eignung aufweisen, ja die Erfahrung lehrt, dass überall dort, wo nicht die edlen Metalle, sondern minder conservirungsfähige Güter den Geldcharakter erlangt haben, diese letztern wohl den Zwecken der Circulation, nicht aber jenen der Conservirung von „Werthen“ zu dienen pflegen. [22]
[279]
Fassen wir das Gesagte zusammen, so gelangen wir zu dem Schlusse, dass die zum Gelde gewordene Waare, wo immer in den Eigenthümlichkeiten derselben begründete Hindernisse dem nicht entgegenstehen, zwar zugleich diejenige ist, in welcher die den practischen Zwecken der wirthschaftenden Menschen entsprechenden Schätzungen, sowie die Anlage der Tauschvorräthe am zweckmässigten vorgenommen werden können, und das Metallgeld, (welches die Forscher auf dem Gebiete unserer Wissenschaft stets zunächst im Auge haben, wenn sie vom Gelde im Allgemeinen sprechen,) diesen Zwecken auch thatsächlich in hohem Grade entspricht. Eben so sicher scheint es uns aber auch, dass dem Gelde als solchen nicht die Function als „Werthmassstab“ und „Werthbewahrer“ zugeschrieben werden darf, denn dieselben sind lediglich accidentieller Natur und nicht bereits in dem Begriffe des Geldes enthalten.
§. 4.
Die Münze.
Aus der vorangehenden Darstellung des Wesens und des Ursprunges des Geldes ist ersichtlich, dass unter den gewöhnlichen Verkehrsverhältnissen civilisirter Völker die edlen Metalle naturgemäss zum ökonomischen Gelde wurden. Der Gebrauch [280] derselben zu Geldzwecken ist indess mit einigen Uebelständen verbunden, deren Beseitigung das Bestreben der wirthschaftenden Menschen sein musste. Die hauptsächlichen Uebelstände, die sich bei Verwendung der edlen Metalle zu Geldzwecken ergeben, liegen in der schwierigen Feststellung ihrer Echtheit, ihres Feinheitsgrades und in der Nothwendigkeit, die zähen Stoffe bei allen vorkommenden Transactionen in entsprechende Stücke zu zerlegen, Schwierigkeiten, die nicht leicht ohne Zeitverlust und ökonomische Opfer zu beheben sind.
Die Prüfung der Echtheit der edlen Metalle, beziehungsweise ihres Feinheitsgrades, erfordert die Anwendung von Chemicalien und specifische Arbeitsleistungen, indem dieselbe nur von Sachverständigen vorgenommen werden kann, und die Theilung der zähen Metalle in die jeweilig erforderlichen Stücke ist eine Operation, welche bei der Genauigkeit, mit welcher dieselbe vorgenommen werden muss, nicht nur Mühe, Zeitaufwand und genaue Instrumente erfordert, sondern auch mit einem nicht unerheblichen Verluste am edlen Metalle selbst verbunden ist, (durch Versplitterung und wiederholte Einschmelzung).
Eine sehr anschauliche Schilderung der Schwierigkeiten, welche sich aus der Verwendung der edlen Metalle zu Geldzwecken ergeben, bietet uns der bekannte Bereiser Hinterindiens Bastian in seinem Werke über Birma, ein Land, in welchem das Silber noch in ungemünztem Zustande circulirt.
„Wenn man in Birma auf den Markt geht,“ erzählt Bastian, „hat man sich mit einem Stück Silber, mit einem Hammer, einem Meissel, einer Waage und den entsprechenden Gewichten zu versehen.“ „Was kosten die Kochtöpfe?“ „Zeigen Sie mir Ihr Geld,“ entgegnet der Kaufmann und bestimmt nach dem Ansehen desselben den Preis zu dem, oder jenem Gewicht. Man lässt sich dann vom Kaufmann einen kleinen Amboss geben und hämmert an dem Stücke Silber herum, bis man glaubt, das richtige Gewicht gefunden zu haben. Das wiegt man mit der eigenen Waage, da denen der Kaufleute nicht zu trauen ist, und fügt zu, oder nimmt fort, bis das Gewicht richtig ist. Natürlich geht durch die abfallenden Splitter viel verloren und es ist immer vorzuziehen, nicht genau die gewünschte Quantität [281] das man gerade abgeschlagen hat. Bei grössern Einkäufen, die nur mit dem feinsten Silber gemacht werden, ist der Process noch umständlicher indem man erst einen Assayer rufen muss, um das Silber in der Feinheit genau zu bestimmen und dafür bezahlt zu werden.“
Die obige Schilderung bietet uns ein klares Bild der Schwierigkeiten, mit welchen der Verkehr aller Völker verbunden war, bevor sie Metalle münzen leruten und die Beseitigung dieser Schwierigkeiten musste um so wünschenswerther erscheinen, je mehr dieselben durch ihre häufige Wiederkehr jedem einzelnen wirthschaftenden Individuum empfindlich wurden.
Die erste der beiden Schwierigkeiten, die Feststellung der Feinhaltigkeit des Metalles, scheint diejenige gewesen zu sein, deren Beseitigung den wirthschaftenden Menschen zunächst von Wiehtigkeit erschien. Ein Stempel, von der öffentlichen Gewalt, oder von einer vertrauenswürdigen Person auf einen Metallbarren gedrückt, garantirte nicht dessen Gewicht, wohl aber dessen Feinheitsgrad und enthob den Besitzer bei Weiterbegebung des Metalles an Personen, welche die Verlässlichkeit des Stempels zu würdigen wussten, der lästigen und kostspieligen Probe. So geprägtes Metall musste zwar vor wie nach gewogen werden, dessen Feinheit erforderte indess keine weitere Untersuchung.
Gleichzeitig, in manchen Fällen vielleicht auch etwas später, scheinen die wirthschaftenden Menschen auf den Gedanken verfallen zu sein, auch das Gewicht der Metallstücke in ähnlicher Weise zu bezeichnen und die Metalle von vornherein in Stücke zu zerlegen, welche ihrem Feingehalte, aber zugleich auch ihrem Gewichte nach, in vertrauenswürdiger Weise bezeichnet waren. Dies geschah naturgemäss am besten dadurch, dass das edle Metall in kleine, dem Bedürfnisse des Verkehres entsprechende Stücke getheilt, die Bezeichnung des edlen Metalles aber in solcher Weise vorgenommen wurde, dass kein nennenswerther Theil der ihrem Gewichte und Feingehalte nach bestimmten Metallstücke defraudirt werden konnte, ohne dass dies sofort bemerkbar wurde. Diesen Zweck erreichte man durch Ausmünzung des Metalls und so erstanden unsere Münzen, welche demnach ihrem Wesen nach nichts anderes sind, als [282] Metallstücke, deren Feingehalt und Gewicht in vertrauenswürdiger Weise und mit einer für die practischen Zwecke des wirthschaftlichen Lebens ausreichenden Genauigkeit festgestellt und gegen Betrug in möglichst wirksamer Weise geschützt sind, ein Umstand, welcher uns bei allen Transactionen die erforderlichen Gewichtsmengen edlen Metalles, ohne lästige Probe, Theilung und Wägung desselben, durch blosses Zuzählen in verlässlicher Weise festzustellen, ermöglicht. Die volkswirthschaftliche Bedeutung der Münze liegt also darin, dass sie (abgesehen von der mechanischen Operation der Theilung des edlen Metalles in die erforderlichen Quantitäten) uns bei der Uebernahme derselben die Prüfung der Echtheit, Feinhaltigkeit und des Gewichtes des edlen Metalles, bei der Weiterbegebung aber den Beweis dieser Umstände erspart, uns solcherart vor vielen lästigen, zeitraubenden und mit ökonomischen Opfern verbundenen Vorkehrungen bewahrt und in Folge dieses Umstandes die von Natur aus grosse Absatzfähigkeit der edlen Metalle noch um ein namhaftes gesteigert wird. [23]
[283]
Dass die beste Gewährleistung für das Vollgewicht und die verbürgte Feinheit der Münzen durch die Staatsgewalt selbst geboten werden kann, weil dieselbe Jedermann bekannt und von Jedermann anerkannt ist und zugleich die Macht hat, Münzverbrechen hintanzuhalten und zu bestrafen, liegt in der Natur der Sache. Die Regierungen haben sich es denn auch zumeist zur Pflicht gemacht, die für den Verkehr nöthigen Münzen auszuprägen, dabei aber ihre Gewalt nicht selten so sehr missbraucht, dass bei den wirthschaftenden Subjecten schliesslich der Umstand fast in Vergessenheit gerieth, dass eine Münze nichts anderes sei, als ein seinem Feingehalte und Gewichte nach bestimmtes Stück edles Metall, für dessen Feinheit und Vollwichtigkeit die Würde und Rechtlichkeit des Ausprägers Gewähr leistet, und man sogar darüber in Zweifel gerieth, ob überhaupt das Geld eine Waare sei, ja dasselbe schliesslich für etwas rein Imaginäres und bloss auf menschlicher Convenienz Berubendes erklärte. Der Umstand, dass die Regierungen das Geld so behandelten, als wäre es thatsächlich lediglich ein Product der menschlichen Convenienz im Allgemeinen und ihrer legislativen Willkür insbesondere, hat solcherart nicht wenig dazu beigetragen, den Irrthümern über das Wesen des Geldes Vorschub zu leisten.
Die Unvollkommenheiten unserer Münzen bestehen hauptsächlich darin, dass sie ihrem Gewichte nach nicht vollkommen genau fabricirt werden können und selbst die erreichbare Genauigkeit aus practischen Gründen (wegen des Kostenpunctes) bei der in den Münzstätten üblichen Fabrication nicht angestrebt wird. Die Gebrechen, mit welchen behaftet die Münzen bereits die Münzstätte verlassen, vermehren sich noch während ihres Umlaufes durch Abnützung, so zwar, dass leicht eine empfindliche Ungleichheit im Gewichte der einzelnen Münzen von gleichem Course entsteht.
Selbstverständlich treten diese Uebelstände um so stärker hervor, je kleiner die Quantitäten sind, in welche das edle Metall getheilt wird. Die Ausmünzung desselben in so leichte Stücke, wie sie der Kleinverkehr erfordert, müsste sogar zu den [284] grössten technischen Schwierigkeiten führen, und, wofern dieselbe auch nur halbwegs sorgfältig vorgenommen werden sollte, ökonomische Opfer in Anspruch nehmen, welche in keinem Verhältnisse zum Course der Münzen stehen würden. Zu welchen Schwierigkeiten dagegen der Mangel an kleiner Münze führt, ist für jeden des Verkehres Kundigen leicht ersichtlich.
„Eine kleinere Münze als 2 Annas,“ erzählt Bastian, „giebt es in Siam nicht, und wer etwas unter diesem Preise zu kaufen wünschte, hatte zu warten, bis das Hinzutreten eines neuen Bedürfnisses die Ausgabe eines solchen rechtfertigte, oder musste sich mit andern Kauflustigen zusammenthun, und sich mit ihnen halbpart berechnen. Mitunter konnte man sich durch Tassen Reis helfen und in Socatra sollen kleine Stücke Ghi oder Butter zum auswechseln dienen.“ In Mexiko erhielt Bastian in den Städten Seifenstücke, auf dem Lande Eier als Scheidemünze. Auf dem Hochlande Perus pflegen die Eingebornen einen Korb parat zu halten, der, in Fächerchen getheilt, in dem einen Nähnadeln, in dem andern Zwirnknäuel, im andern Wachskerzen, oder sonstige Dinge des täglichen Verbrauches enthält und bieten hievon in Auswahl nach dem Betrage der rückständigen Scheidemünze. Im obern Birma gebraucht man für die kleinsten Einkäufe, wie Früchte, Cigarren etc., Bleiklumpen, von denen jeder Kaufmann einen grossen Kasten voll neben sich hat, und die auf einer massiveren Wage als das Silber gewogen werden. In Dörfern, wo keine Aussicht ist, Silber zu wechseln, muss für kleine Einkäufe der Diener mit einem schweren Sack Blei folgen.
In den meisten Culturstaaten weicht man den technischen und ökonomischen Schwierigkeiten, welche mit der Ausmünzung der edlen Metalle in allzuleichte Stücke verbunden sind, indess dadurch aus, dass man Münzen aus irgend einem gemeinen Metalle, zumeist aus Kupfer oder Bronce prägt.
Da schon aus Bequemlichkeitsrücksichten Niemand ohne Noth einen grössern Theil seines Tauschvorrathes in jenen Münzen anlegt, so haben sie lediglich eine secundäre Stellung im Verkehre und können zur grössern Bequemlichkeit der Tauschenden sogar ohne Schaden nur halbwichtig, oder noch darunter ausgeprägt werden, vorausgesetzt nur, dass sie jederzeit gegen Münze aus edlem Metalle beim Münzherrn eingewechselt werden können, oder doch nur in so geringer Menge [285] ausgegeben werden, dass der Verkehr sie festhält. Jedenfalls ist der erste Weg der correctere und zugleich eine sichere Schutzwehr gegen Missbräuche der Regierungen bei der ihnen vortheilhaften Emission dieser Münzen. Man nennt solche Geldstücke Scheidemünzen und ihr Werth liegt nur zum Theile in ihnen selbst, im übrigen aber darin, dass man für eine bestimmte Anzahl derselben eine grössere Münze beim Münzherrn austauschen, beziehungsweise mit diesen Münzen seinen Verpflichtungen gegen den Münzherrn überhaupt, gegen andere Personen aber bis zur Höhe des Betrages der kleinsten vollwichtigen Münze gerecht werden kann. Das Publicum duldet in diesem Falle, um der grössern Bequemlichkeit willen, die mit leichten Bronce- oder Kupfermünzen verbunden ist, gerne die kleine wirthschaftliche Anomalie, da der Nutzen der leichtern Transportabilität und Bequemlichkeit bei Münzen, die nie der Angelpunkt bedeutender ökonomischer Interessen sind, viel wichtiger ist, als die Vollwichtigkeit. In ähnlicher Weise werden in vielen Ländern selbst aus Silber leichtere Münzen ausgeprägt, und zwar ohne Nachtheil, so lange sie nur auf Beträge lauten, für die sich aus technischen oder ökonomischen Gründen keine dem Zwecke entsprechende vollwichtige Münze herstellen lässt.
[286]
Berichtigungen.
S. 6, Z. 6 v. o. sind die Worte: „(Sachgüter und Arbeitsleistungen)“ nach dem Worte: „solche“ (Z. 7) zu stellen.
S. 29, Z. 14 v. o. ist statt „dem“ „den“ zu lesen.
S. 54, Z. 3 v. o. ist nach „suoht“ der Satz: „gestützt auf A. Smith, W. of. N. B. II, Ch. III“ ausgefallen.
S. 81, Z. 14 v. u. ist: (vgl. O. Michaelis, „Das Capitel v. Werthe,“ Vierteljahrsschrift F. V. W. 1863, I, S. 16 ff.) einzuschalten.
S. 86, Z. 10 v. u. ist nur statt nu zu lesen.
S. 116, Z. 4 v. o. ist statt „er“ „der“ und statt „diez“ „die“ und Z. 7 statt Fichtenhlo—: Fichtenholz; Z. 9 v. u. statt „eleichen“: gleichen, Z. 6 v. u. statt „ginen“: „einen,“ statt „be“ „bei,“ Z. 5 v. u. am Ende statt „der—i“: „der“ zu bessern.
S. 128, Z. 19 v. u. ist statt „Intensität“: „Intensivität“, Z. 6 v. u. statt „liegenden“: „liegender“ zu lesen.
S. 130, Z. 9 ist statt „Herrmann“: „Hermann,“ ebenso S. 131, Z. 3 und 9 zu lesen.
Fußnoten↩
Vorrede.
[*] Novum Organ. II. 27.
Erstes Capitel. Die allgemeine Lehre vom Gute.↩
[1] Aristoteles nennt (Polit, I. 3) die Mittel zum Leben und Wohlergehen der Menschen: „Güter.“ Der vorwiegend ethische Standpunkt, von welchem das Alterthum die Lebensverhältnisse betrachtet, macht sich im Uebrigeu in den Anschauungen der meisten Alten über das Wesen der Nützlichkeit, bez der Güter geltend, gleichwie der religiöse Standpunkt in jenen der mittelalterlichen Schriftsteller. „Nihil utile, nisi quod ad vitae illius eternae prosit gratiam,“ sagt Ambrosins, und noch Thomassin, seinen wirthschaftlichen Anschauungen nach dem Mittelalter angehörig, schreibt in seinem: Traité de negoce 1697 (S.22). „L'utilité même se mesure par les considérations de la vie eternelle.“ Von den Neuern definirt Forbonnais die Güter (biens): „Les propriétés, qui ne rendent pas une production annuelle, telles que les meubles precieux, les fruits destinées à la consommation“ (Principes économiques, 1767, Chap. I., S. 174. ff., ed. Daire). indem er dieselben den „richesses“ (Gütern, welche einen Ertrag abwerfen) gegenüberstelit, wie dies in einem andern Sinne auch von Dupont (Physiokratie, p. CXVIII) geschieht. Der Gebrauch des Wortes „Gut“ in dem der heutigen Wissenschaft eigenthümlichen Sinne schon bei Le Trosne, (de l'intérêt social, 1777 Ch. I. §. 1,) welcher den Bedürfnissen die Mittel zur Befriedigung derselben gegenüberstellt, und diese letztern Güter (biens) nennt. Vgl. auch Necker: Legislation et commerce des grains, 1775, Part. I., Ch. 4. Say nennt (Cours d'écon. polit., 1828, I., S. 132) Güter (biens): „les moyens que nous avons de satisfaire nos besoins.“ Die Entwickelung, welche die Lehre vom Gute in Deutschland genommen, ist aus dem Nachfolgenden ersichtlich: Es definiren den Begriff des Gutes: Soden (Nationalökonomie, 1805, I., §. 43): = Genussmittel; H. L. v. Jacob (Grundsätze der Nationalök., 1806, §. 23): „Alles, was zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse dient;“ Hufeland: (Neue Grundlegung der Staatswiss., 1807, I., §. 1): „Jedes Mittel zu einem Zwecke eines Menschen;“ Storch: (Cours d'économ. polit., 1815, I., p. 56 ff.) sagt: „L'arrêt que notre jugement porte sur l'utilité des choses…en fait des biens.“ Auf seiner Grundlage definirt dann Fulda (Kammeralwissenschaften, 1816, S. 2, ed. 1820): „Gut“ = jede Sache, welche der Mensch zur Befriedigung seiner Bedürfnisse als Mittel anerkennt“ (vgl. aber auch schon Hufeland a. a. O., I., §. 5), Roscher (System I., §. 1): „Alles dasjenige, was zur Befriedigung eines wahren menschlichen Bedürfnisses anerkannt brauchbar ist.“
[2] Aus dem Obigen ist ersichtlich, dass die Güterqualität nichts den Gütern, Auhaftendes, das ist keine Eigenschaft derselben ist, sondern sich uns lediglich als eine Beziehung darstellt, in welcher sich gewisse Dinge zu den Menschen befinden, eine Beziehung, mit deren Verschwinden dieselben selbstverständlich auch aufhören. Güter zu sein.
[3] Schon Aristoteles (de anima, III. 10) unterscheidet wahre und eingebildete Güter, je nachdem das Bedürfniss von vernünftiger Ueberlegung geleitet, oder unvernünftig ist.
[4] Schäffle, Theorie der ausschliessenden Verhältnisse, 1867, S. 2—Vgl. Steuart: Principles of polit, economy. Basil 1796, II., S. 128 ff., wo die Güter bereits in Sachon, in persönliche Dienstleistungen und in Rechte getheilt und zu diesen letztern (ibid. S. 141) auch verkäufliche Privilegien gerechnet werden; Say zählt zu den Gütern (biens.): Advocatenstuben, Kundenkreise eines Kaufmannes, Zeitungsunternehmungen, aber auch den Ruf eines militärischen Führers etc. (Cours complet III. S. 219, 1828); Hermann (Staatswirthschaftliche Untersuchungen, 1832, S. 2, 3, 7, 289) fasst unter den Begriff der äusseren Güter eine grosse Anzahl von Lebensverhältnissen (Verhältnisse der Geselligkeit, der Liebe, der Familie, des Erwerbes etc.) zusammen und stellt dieselben den Sachgütern und persönlichen Dienstleistungen als eine besondere Kategorie von Gütern entgegen; Roscher System I., §. 3, rechnet auch den Staat zu den „Verhältnissen,“ während Schäffle den Begriff der Verhältnisse auf „übertragbare, durch private Beherrschung des Absatzes und Verdrängung der Concurrenz ausschliesslich gemachte Renten“ beschränkt (a. a. O. S. 12), wobei der Begriff der „Rente“ in dem diesem Schriftsteller eigenthümlichen Sinne (Das gesellschaftliche System der menschlichen Wirthschaft, 1867, S. 192 ff.) zu verstehen ist. Vgl. auch noch Soden (Nationalökonomie I., §. 26 ff.) und Hufeland (Neue Grundleg. I., S. 30. d. ed. 1815).
[5] Wealth. of. Nat. B. I. Ch. 1. Basil 1801, T. 1, S. 6.
[6] ibid. S. 11, ff.
[7] Vergl. Stein, Lehrbuch, S. 36, ff.
Zweites Capitel. Die Wirthschaft und die wirthschaftlichen Güter.↩
[1] Selbst manche Thiere legen Vorräthe an und sorgen so von vorn herein dafür, dass es ihnen im Winter nicht an Nahrung und einem warmen Lager gebreche.
[2] Das Wort „Bedarf“ hat in unserer Sprache eine doppelte Bedeutung. Einerseits bezeichnet man damit die zur vollständigen Befriedigung der Bedürfnisse einer Person erforderlichen, andererseits jene Güterquantitäten, welche eine Person voraussichtlich consumiren wird. In diesem letztern Sinne hat z. B. ein Mann, der 20.000 Thaler Renten hat und dieselben zu verbrauchen gewöhnt ist, einen sehr grossen, ein ländlicher Arbeiter, dessen Einkommen 100 Thaler beträgt, einen sehr geringen und ein dem Elende preisgegebener Bettler gar keinen Bedarf, während in ersterer Beziehung der Bedarf der Menschen, je nach ihrer Bildungsstufe und ihren Gewohnheiten, zwar gleichfalls eine sehr grosse Verschiedenheit aufweist, indess selbst eine Person, die von allen Mitteln entblösst ist, noch immer einen Bedarf hat, der in den zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse erforderlichen Güterquantitäten sein Mass findet, Kaufleute und Industrielle gebrauchen den Ausdruck „Bedarf“ der Regel nach in dem engeren Sinne des Wortes und verstehen darunter nicht selten die „voraussichtliche Nachfrage“ nach einem Gute. In diesen Sinne sagt man auch, dass „zu einem gewissen Preise“ Bedarf an einer Waare besteht, zu einem andern Preise jedoch nicht, u. dgl. m.
[3] Vgl. Condillac: Le commerce et le gouvernement. (I. Chap. 1. p. 248. ed. Daire.)
[4] Zu diesen Organen gehören zunächst die Correspondenten, welche von grossen Geschäftshäusern in allen Hauptplätzen jener Artikel, mit welchen sie sich befassen, unterhalten werden, und zu deren hauptsächlichen Pflichten es gehört, ihre Auftraggeber über den jeweiligen Stand der Stocks im Laufenden zu erhalten. Ausserdem besteht für jeden wichtigeren Artikel eine förmliche Literatur periodisch erscheinender kaufmännischer Berichte, welche dem gleichen Zwecke dienen. Wer die Berichte von Bell in London, von Meyer in Berlin über Getreide, von Licht in Magdeburg über Zucker, von Ellison und Haywood in Liverpool über Baumwolle u. dgl. m. aufmerksam verfolgt, wird in denselben nebeu manchen anderen für die Geschäftswelt wichtigen Daten, über welche wir uns später zu äussern Gelegenheit haben werden, auch sorgfältige, auf Erhebungen aller Art, und wo diese mangeln, auf scharfsinnige Berechnungen gestützte Angaben über den jeweiligen Stand der Stocks finden, Angaben, welche, wie wir sehen werden, einen sehr bestimmenden Einfluss auf die volkswirthschaftlichen Erscheinungen, zumal auf die Preisbildung ausüben. So enthalten z. B. die oben erwähnten Baumwoll-Circulare von Ellison und Haywood fortlaufende Berichte über den jeweiligen Baumwoll-Stock in Liverpool und in England überhaupt, mit Rücksicht auf die verschiedenen Gattungen der Baumwolle und ähnliche Ausweise für den Continent, ferner für Amerika, Indien, Egypten und die übrigen Productionsgebiete. Diese Circulare belehren uns über die jeweilig auf dem Meere befindlichen Quantitäten von Baumwolle (schwimmende Waare), über die Häfen, nach welchen dieselben dirigirt sind, und bezüglich der in England vorfindlichen Quantitäten, auch darüber, ob sich dieselben bereits in den Magazinen der Spinner und sonstiger Consumenten, oder aber noch in der ersten Hand befinden, über die Quantitäten, welche für den Export angemeldet wurden u. s. f.
[5] So finden sich z. B. in dem oben erwähnten Licht' schen Berichte nicht nur Mittheilungen über den jeweiligen Stand der Zuckerstocks in allen mit Deutschland in Verbindung stehenden Verkehrsgebieten, sondern auch alle auf die Rohstoffe und die Productionsrichtung Einfluss nehmenden Thatsachen auf das sorgfältigste gesammelt; so zumal Berichte über den jeweiligen Umfang der mit Zuckerrohr bepflanzten, beziehungsweise der Rübencultar gewidmeten Bodenflächen, den jeweiligen Stand der Zuckerpflanzungen und Rübenfelder, Berichte über den voraussichtlichen Einfluss der Witterung auf die Erntezeit, auf den quantitativen und qualitativen Ausfall der Ernte, Berichte über diese letztere selbst, über die Anzahl der in Betrieb stehenden und feiernden Zuckerfabriken und Raffinerien, über die Leistungsfähigkeit der ersteren. über die Quantitäten fremder und einheimischer Producte, welche voraussichtlich auf den deutschen Markt gelangen werden und über die Zeitpuncte. in welchen dies voraussichtlich erfolgen wird, über Fortschritte in der Technik der Zrckerfabrication, über Verkehrsstörungen etc. Aehnliche Mittheilungen finden sich rucksichtlich anderer Artikel auch in den übrigen kaufmannischen Circulären, deren wir oben erwähnten.
[6] Die Untersuchung über das Wesen der ökonomischen Güter be ginut mit den Versuchen, den Vermögensbegriff im Sinne der Individualwirthschaft festzustellen, A. Smith hat die Frage nur flüchtig berührt, doch sind die Anregungen, welche von ihm ausgegangen sind, von den weittragendsten Folgen auch für die obige Lehre geworden. „Wenn die Theilung der Arbeit einmal platzgegriffen hat,“ sagt er (W. o. N. Chap. V. Basil, 1801. S. 43 ff.), „so ist Jedermann reich oder arm, je nach der Quantität von Arbeit, über welche er verfügen, oder die er kaufen kann.“ Der Umstand, dass ein Gut uns die Verfügung über Arbeit verschafft oder, was im Geiste S's dasselbe ist dass es Tauschwerth hat, ist demnach in consequenter Ausbildung der S'schen Theorie das Kriterium seines Charakters als „Vermögensobject“ im obigen Sinne des Wortes. Dieser Anregung folgt denn auch Say. Er sondert (Traité d'économie politique, 1803 S. 2.) die Güter, welche Tauschwerth haben, von jenen, welche keinen solchen aufweisen, und achliesst die letztern aus dem Bereiche der Vermögensobjecte aus, („ce qui n'a point de valeur, ne saurait étre une richesse. Ces choses ne sont pas du domaine de l'économie politique.“) Auch Ricardo unterscheidet zwischen „Werthen“ und Gütern, die sich uns nicht als solche darstellen (Principles, XX. S. 165 der ed. 1846) und weicht nur in sofern von seinen Vorgängern ab, als er das Wort „riches“ in einem wesentlich andern Sinne gebraucht, als Say das Wort „richesse.“ Malthu's sucht das Kriterium des Vermögenscharakters der Güter Anfangs (Principles 1820. S. 28) ausschliesslich in der Körperlichkeit der Güter und beschränkt auch in seinen späteren Schriften den Begriff der Vermögensobjecte auf die materiellen Güter. Der letztern Ansicht sind in Deutschland: Storch, (Cours, I., S. 108, ff. 1815); Fulda, (Cameralwissensch. 1816, S. 2 der ed. 1820); Oberndorfer. (Nationalökonom. 1822, § 23); Rau, (Volkswirthschaftslehre, §. 1, 1826); Lotz, (Staatswirthschaftslehre, I., S. 19, der ed. 1837); Bernhardi, (Kritik der Gründe etc., 1849, S. 134 ff., insb. 143 ff.) Gegen die Ausscheidung der immateriellen Güter: Say, (Cours I., S. 161 1828); Mac Culloch, (Principles of P. E., ed 1864, S. 4); Hermann, (Staatswirthschaftliche Untersuchungen, S. 8., 1832); Roscher, (System I., §. 3). Dass durch die Beschränkung des Vermögensbegriffes auf die materiellen Güter der Begriff der Vermögensobjecte keineswegs richtig begränzt wird, hat übrigens schon Malthus erkaunt, (Principles, 2. Aufl. 1836, S. 34), von dessen wechselnden Versuchen, den obigen Begriff festzustellen, wir weiter unten sprechen. Von den neuesten Vertretern der Volkswirthschaftslehre in England wird der Begriff des Vermögensobjectes fast ausnahmslos wieder an den Tauschwerth geknüpft. So von: Mac Culloch, (Principles, S. 4 der ed. 1864); J. St. Mill, (Principles 6. Aufl. Prelim. Rem.); Senior, (Polit. Econom., S. 6, 1863.) Unter den neuern Franzosen folgen insbesondere A. Clement und A. Walras dieser Ansicht. Während solcherart die französischen und englischen Volkswirthe lediglich zwischen Gütern unterscheiden, welche Vermögensobjecte sind und jenen, die sich uns nicht als solche darstellen, geht Hermann (Staatswirthschaftliche Untersuch. S. 3, 1832) viel tiefer, indem er die wirthschaftlichen Güter (Objecte der Wirthschaft) den freien Gütern entgegenstellt, eine Unterscheidung, welche seither von der deutschen Wissenschaft mit wenigen Ausnahmen festgehalten wurde. Doch definirt Hermann selbst den Begriff der wirthschaftlichen Güter zu enge. „Wirthschaftliches Gut ist,“ sagt H., „was nur gegen bestimmte Aufopferung, durch Arbeit oder Vergeltung hergestellt werden kann“ (a a. O. S. 3) und macht dadurch den ökonomischen Charakter der Güter von der Arbeit, (ibid. S. 4 auch vom menschlichen Verkehre) abhängig. Aber sind die Baumfrüchte, welche ein isolirtes Subject mühelos erlangen kann, für dasselbe kein wirthschaftliches Gut, falls dieselben ihm in einer geringeren Quantität verfüg bar sind, als sein Bedarf beträgt, während doch das zwar eben so mühelos, aber ihm in einer den Bedarf übersteigenden Quantität verfügbare Quellwasser ein nicht ökonomisches Gut ist? Roscher, welcher in seinem Grundriss (1843, S. 3) die wirthschaftlichen Güter als solche definirt hatte, „die in den Verkehr kömmen“ und in den ältern Auflagen seines Systems als „Güter, welche des Verkehrs fähig sind, oder wenigstens denselben fördern können.“ (System I. 1857, S. 3) definirt in den neuern Auflagen seines Hauptwerkes die wirthschaftlichen Güter = „Zwecke und Mittel der Wirthschaft,“ eine Definition, welche, da sie lediglich eine Umschreibung des zu definirenden Begriffes ist, anzeigt, dass der ausgezeichnete Gelehrte die Frage nach dem Kriterium der ökonomischen und nicht ökonomischen Güter als eine offene behandelt Vgl. auch Schäffie: Tübing, Univ. Schrift. 1862, Abth. 5, S. 22, und: Das gesellschaftliche System der menschlichen Wirthschaft, 1867, S. 2.
[7] Der ökonomische Charakter der Güter ist in keinerlei Weise an die Vorbedingung der menschlichen Wirthschaft in ihrer socialen Erscheinung geknüpft. Ist der Bedarf eines isolirt wirthschaftenden Subjectes an einem Gute grösser, als die ihm verfügbare Quantität, so werden wir dasselbe jede Theilquantität dieses Gutes in seiner Verfügung erhalten, conserviren, auf das Zweckmässigste zur Befriedigung seiner Bedürfnisse verwenden und eine Wahl treffen sehen zwischen jenen Bedürfnissen, welche es mit der ihm verfügbaren Quantität befriedigen, und denjenigen, welche es unbefriedigt lassen wird, während dasselbe Subject bei allen jenen Gütern, welche ihm in einer seinen Bedarf übersteigenden Quantität verfügbar sind, keinen Anlass zu der eben gezeichneten Thätigkeit haben wird. Es werden demnach auch für das obige isolirte Subject ökonomische und nicht ökonomische Güter vorhanden sein. Weder der Umstand, dass ein Gut: „Verkehrsobject“ noch auch der, dass es „Eigenthumsobject“ ist, kann demnach die Ursache seines ökonomischen Charakters sein. Ebensowenig kann aber auch der Umstand, dass die Güter zum Theile Arbeitsproducte sind, zum andern Theile uns von der Natur ohne Arbeit dargeboten werden, als Kriterium des ökonomischen, beziehungsweise des nicht ökonomischen Charakters der Güter hingestellt werden, so grosser Scharfsinn auch darauf verwandt wurde, um die dem obigen Gesichtspuncte widersprechenden Lebenserscheinungen im Sinne desselben zu interpretiren. Die Erfahrung lehrt uns nämlich, dass zahlreiche Güter, auf welche keine Arbeit verwandt wurde (z. B. angeschwemmtes Land, Wasserkräfte etc.) den ökonomischen Charakter überall dort aufweisen, wo sie in einer unsern Bedarf nicht erreichenden Quantität uns verfügbar sind, wie denn andererseits der Umstand, dass ein Ding ein Arbeitsproduct ist, an und für sich nicht einmal die Güterqualität, geschweige denn den ökonomischen Charakter desselben zur nothwendigen Folge hat. Auch die auf ein Gut aufgewendate Arbeit kann demnach nicht das Kriterium des ökonomischen Charakters der Güter sein, es ist vielmehr klar, dass dasselbe ganz ausschliesslich in dem Verhältnisse zwischen Bedarf und verfügbarer Quantität derselben zu suchen ist.
[8] Man könnte nach einer in unserer Wissenschaft bereits gebräuchlichen analogen Ausdrucksweise die letztern, zum Unterschiede von den eigentlichen ökonomischen Gütern, die quasi ökonomischen, die erstern die quasi nicht ökonomischen Güter nennen.
[9] „Verfügbar,“ im wirthschaftlichen Sinne des Wortes, ist Jemanden ein Gut, wenn er dasselbe zur Befriedigung seiner Bedürfnisse heranzuziehen in der Lage ist. Dem können physische, oder rechtliche Hindernisse entgegenstehen. Das Vermögen eines Mündels z. B. ist dem Vormunde nicht verfügbar im obigen Sinne des Wortes.
[10] Hermann, Staatswirthschaftliche Untersuch, 1832, S. 6.—Welche Schwierigkeit für die nicht deutschen Nationalökonomen bei der Definirung des Begriffes „Vermögen“ daraus entsteht, dass sie den Begriff der „ökonomischen Güter“ nicht kennen, dafür sind die Schriften eines Malthus das deutlichste Zeugniss. In der ersten Auflage seiner „Principles of pol. econ.,“ welche 1820 erschien, definirt er (S. 28) wealth = „those material objects, which are necessary, useful or agreeable to mankind.“ Diese Definition umfasst unter dem Vermögensbegriff alle (materiellen) Güter, auch die nicht ökonomischen, und ist deshalb entschieden zu weit. In seinen „Definitions,“ welche er sieben Jahre später erscheinen liess, fügt er denn auch (Chap. II Art. „Wealth“, S. 7 der edit. 1853) der obigen, im Wesentlichen unveränderten Definition den Nachsatz hinzu: „which have required some portion of human industry to appropriate or produce.“ Als Grund dieses Beisatzes giebt er in der zweiten Ausgabe seiner Principles (1836, S. 34) an: „this latter part was added to exclude air, light, rain etc.“ Aber auch diese Definition erkennt er später als unhaltbar an, denn „there is some objection,“ sagt er a. a. O.: „to the introduction of the term industry or labour into the Definition (of wealth), because an object might be considered as wealth, which has had no labour employed upon it“ und gelangt schliesslich (Principles o. P. E. 1836, S. 33) zu folgender Definition des Begriffes „Vermögen“: I should define wealth to be the material objects, necessary, useful or agreeable to man. which are voluntary appropriated by individuals or nations,“ also zur Bestimmung der Vermögensobjecte als materielle Güter, die von den Menschen freiwillig in ihr Eigenthum genommen wurden,“ und verfällt demnach in einen neuen Irrthum, indem er den Umstand, dass ein Gut sich im Eigenthume wirthschaftender Menschen befindet, zum Principe der Vermögensqualität (des ökonomischen Charakters) desselben macht. Fast eben so wechselnde Versuche, den Begriff des Vermögensobjectes festzustellen, finden wir in den Schriften Say's. In seinem „Traité d'econ. pol.“ (1803) stellt er den Werth (Tauschwerth) als Princip der Vermögensqualität der Güter auf: „ce qui n'a point de valeur, ne saurait être une richesse (S. 2).“ Diese Ansicht wird von Torrens (On production of wealth S. 7, 1821) bekämpft und Say gelangt denn auch in seinem Cours d'E. P. (1828, I. S. 133 ff.) bezüglich jener Güter, welche Vermögensobjecte sind, zu der nachfolgenden Ansicht: „Nous sommes forcés d'acheter, pour ainsi dire, ces biens par des traveaux, des économies des privations; en un mot par de veritables sacrifices,“ also zu einer An schauung, welche jener, welcher Malthus in seinen „Definitions“ folgte, verwandt ist. Dagegen sagt Say (a. a. O. S. 133 weiter unten): On ne peut pas separer de ces biens l'idée de la proprieté. Ils n'existeraient pas, si la possession exclusive n'en était assuré à celui qui les a acquis….(S. 34) D'un autre côté la propriété suppose une société quelconque, des conventions, des lois. On peut en consequence nommer les richesses ainsi acquises „des richesses sociales.“
[11] Der bloss relative Massstab, welchen das Vermögen für die Benrtheilung des Grades der Vollständigkeit bietet, mit welcher ein Individuum seiuc Bedürfnisse befriedigen kann, hat dazu geführt, dass einige Schriftsteller das Vermögen im Sinne der Individualwirthschaft wohl als die Gesammtheit der ökonomischen, das Vermögen im Sinne der Volkswirthschaft dagegen als die Gesammtheit aller Güter definirten, und zwar zunächst deshalb, weil sie bei dem erstern die relative Wohlfahrt der einzelnen Individuen, bei dem letztern die absolute Wohlfahrt der Gesellschaft im Auge hatten. So zumal Landerdale, Inquiry into the nature etc. S. 39 ff. insb. S. 56 ff. 1804. Auch die von Roscher (System I, §. 8) neuerdings aufgeworfene Frage, ob nicht das Volksvermögen nach seinem Gebrauchswerthe, das Privatvermögen aber nach seinem Tauschwerthe zu schätzen sei, ist auf den obigen Gegensatz zurückzuführen.
[12] Vgl. schon Landerdale a. a. O. S. 43.
[13] Proudhon, Contradictions, Chap. II. §. 1.
[14] Vgl. Dietzel: Die Volkswirthschaft und ihr Verhältniss zu Gesellsellschaft und Staat, 1864, S. 106 ff.
Drittes Capitel. Die Lehre vom Werthe↩
[1] Das Bestreben, die allen Erscheinungsformen des Güterwerthes gemeinsamen Elemente festzustellen, d. i. den allgemeinen Begriff des „Werthes“ zu gewinnen, findet sich bei allen neuern Deutschen, welche die Lehre vom Werthe in selbstständiger Weise bearbeitet haben. Ebenso das Bestreben, den Gebrauchswerth der Güter von der blossen Nützlichkeit zu unterscheiden. Friedländer (Theorie d. Werthes, Dorpater Univ. Progr. 1852, S. 48) definirt den Werth als „das im menschlichen Urtheil erkannte Verhältniss, wornach ein Ding Mittel für die Erfüllung eines erstrebenswerthen Zweckes sein kann“ (vergl. auch Storch, Cours d'économ. polit. T. I., S. 36). Da nun das obige Verhältniss, (wofern der erstrebenzwerthe Zweck die Befriedigung eines menschlichen Bedürfnisses ist, oder doch mit einer solchen im Zusammenhang steht,) eben die Nützlichkeit eines Dinges begründet, so ist die obige Definition gleichbedentend mit jener, wornach der Güterwerth als die anerkannte Zweck-Tauglichkeit, beziehungsweise als die anerkannte Nützlichkeit eines Dinges aufgefasst wird. Es ist diese letztere aber eine allgemeine Voraussetzung der Güterqualität und demnach die Definition Friedländer's, abgesehen davon, dass sie das Wesen des Werthes nicht berührt, auch zu weit. In der That kommt derselbe (S. 50) zum Schlusse, dass die nicht ökonomischen Güter eben so wohl Objecte der Werthschätzung der Menschen sind, als die ökonomischen. Knies (Lehre vom Werth, Tübing, Zeitschr, 1855, S. 423) erkennt in dem Werthe, gleich wie viele seiner Vorgänger, den Grad der Brauchbarkeit eines Gutes für menschliche Zwecke, (vgl. noch die ältern Auflagen von Roscher's System I., §. 4,) eine Ansicht, welcher ich jedoch um dessentwillen nicht folgen kann, weil der Werth wohl eine Grösse ist, welche gemessen werden kann, das Mass desselben aber eben so wenig zu seinem Wesen gehört, als zu jenem des Raumes, oder der Zeit. In der That fühlt Knies auch die Schwierigkeiten, zu welchen diese Auffassung vom Werthe in ihren weitern Consequenzen führt, denn er erkennt auch die Begriffsbestimmung des Werthes als Branch-barkeit, Nützlichkeit, Güterqualität selbst an und bemerkt „die Werththeorie sei an einzelnen Stellen thatsächlich im Ganzen auf die Combination beider Bedeutungen des Wortes „Werth“ aufgebant,“ gelangt demnach zu keinem einheitlichen Principe.—Schäffie geht (Tübing, Universitätssehrft. 1862, Abth. 5, S. 10.) von der Ansicht aus, „eine potentielle oder actuelle vom Menschen mit bewusstem Wollen gestaltete Beziehung zwischen Person und unpersönlichen Aussendingen sei stets erforderlich, wenn von Wirthschaften und von wirthschaftlichen Gütern solle die Rede sein können. Diese Beziehung lasse sich nun sowohl von Seite des wirthschaftlichen Objectes, als von Seite des wirthschaftlichen Subjectes auffassen. Objective sei sie die Brauchbarkeit, subjectiv der Werth des Gutes, Brauchbarkeit (Nützlichkeit) sei die Tauglichkeit der Sache, einem menschlichen Zwecke zu dienen. Werth aber sei die Bedeutung, welche das Gut vermöge seiner Brauchbarkeit für das ökonomische Zweckbewusstsein der wirthschaftlichen Persönlichkeit habe.“ Auch diese Begriffsbestimmung des Werthes ist indess, wie Schäffie dadurch, dass er in seinen spätern Schriften, (Das gesellschaftliche System, 1867, S. 6,) den Werth als „die Bedeutung eines Gutes, um der dafür zu bringenden Opfer“ definirt, selbst andeutet, entschieden zu weit, denn auch die nicht ökonomischen Güter haben Brauchbarkeit und stehen in dem obigen Verhältnisse zum Zweckbewusstsein der Menschen, ohne doch Werth aufzuweisen. Durch Schäffie's ältere Begriffsbestimmung wird demnach der Werth nicht auf die ökonomischen Güter beschränkt, obzwar der schar fsinnige Forscher, (Tübinger Universitatsschr. 1862, a. a. O. S. 11,) sich sehr genan des Umstandes bewusst ist, dass bei den nicht ökonomischen Gütern die Wertherscheinung nicht zu Tage treten könne. Die neuere Definition Schäffie's ist dagegen entschieden zu enge, denn nichts ist sicherer, als dass es zahlreiche ökonomische Güter gibt, welche ohne die geringsten dafür zu bringenden Opfer in die Verfügung der Menschen gelangen (z. B. Angesch wemmtes Land etc.), andere, welche durch ökonomische Opfer nicht erlangt werden können (z. B. Naturanlagen). Ein wichtiges Moment der tiefern Einsicht in das Wesen des Werthes wird aber hier bereits in das vollste Licht gestellt: Nicht die objective Tauglichkeit an sich (Tübing, Universitätsschr. S. 11), auch nicht der Grad der Brauchbarkeit (ibid, S. 31), sondern die Bedeutung des Gutes für das wirthschaftende Subject macht nach Schäffie das Wesen des Güterwerthes aus.—Einen interessanten Beitrag zur richtigen Auffasung des Werthes fördert auch Rösler (Theorie des Werthes, Hildeb. Jahrbücher 1868, IX., S. 272 ff. 406 ff.) zu Tage. Derselbe kommt zum Schlusse, „dass die herkömmliche Unterscheidung zwischen Gebrauchswerth und Tauschwerth unrichtig sei, und mit dem Moment des nützlichen Gebrauches der Dinge der Begriff des Werthes absolut nicht verbunden werden könne; dass vielmehr der Begriff des Werthes nur ein einheitlicher sei, die Vermögensqualität der Dinge bezeichne und durch Realisirung der Vermögensrechtsordnung zur concreten Erscheinunggelange.“ Der eigenthümliche Standpunkt Rösler's ist aus dem Obigen ersichtlich und zugleich der Fortschritt, welcher in seiner Auffassung liegt, indem er den Kreis der Werthobjecte richtig begränzt und die Nützlickeit vom Werthe der Güter streng scheidet. Nicht einverstanden kann ich mich dagegen damit erklären, dass Rösler die Vermögensqualität eines Gutes, welche eben so wohl die Folge des oben dargelegten Quantitätenverhältnisses, als der Werth ist, zum Principe des letztern macht; auch scheint mir bedenklich, dass Rösler den Begriff der Vermögensqualität der Jurisprudenz entlehnt. (S.295, 302 ff. vgl. auch Ch. Schlözer Anfangsg. I. §. 15). Der Werth der Güter ist, gleichwie der ökonomische Charakter derselben, unabhängig von der menschlichen Wirthschaft in ihrer socialen Erscheinung, unabhängig auch von der Rechtsordnung, ja von dem Bestande der Gesellschaft. Er ist auch in der isolirten Wirthschaft zu beobachten und kann demnach nicht in der Rechtsordnung wurzeln. Von ältern Versuchen, den allgemeinen Begriff des Werthes festzustellen, seien hier jene Montanari's, † 1687, (della Moneta III, S. 43, p. a. der ed. Custodi), Turgot's (Valeurs et monnaies, S. 79 ff., ed. Daire), Condillac's (Le commerce et le gouvernement 1776, S. 151 ff., ed. Daire), Garnier's (S. 5 der Vorrede zu seiner Uebersetzung A. Smith's), Storch's (Cours d'économ: polit. 1815, I, S. 56 ff.) erwähnt. Zumal ist es Condillac, dessen Begriffsbestimmung des Werthes keine geringe Aehnlichkeit mit einzelnen neuern Entwickelungen dieser Lehre in Deutschland hat.
[2] Mit den Versuchen, den Unterschied zwischen den ökonomischen und den nicht ökonomischen Gütern darauf zurückzuführen, dass die erstern Arbeitsproducte seien, die letztern aber „freiwillige Gaben der Natur,“ die erstern sich uns als Objecte des Tauschverkehres darstellen, die letztern aber nicht, haben wir uns in dem vorigen Capitel eines weitern beschäftigt, und sind hiebei zum Resultate gelangt, dass der ökonomische Charakter der Güter von den beiden obigen Momenten unabhängig ist. Ein Gleiches gilt von dem Werthe. Derselbe ist, gleich wie der ökonomische Charakter der Güter, die Folge des mehrerwähnten Verhältnisses zwischen Bedarf und verfügbarer Quantität der Güter, und die gleichen Gründe, welche dagegen sprechen, dass die ökonomischen Güter als „Arbeitsproducte“, beziehungsweise als „Verkehrsgüter“ definirt werden, schliessen die diesbezüglichen Kriterien auch überall dort aus, wo es sich um die Unterscheidung der Güter handelt, welche für uns Werth haben, und jener, die keinen solchen aufweisen.
[3] Der Verwechslung von „Gebrauchswerth“ und „Nützlichkeit,“ beziehungsweise des erstern mit dem „Grade der Nützlichkeit“ oder mit der „erkannten Nützlichkeit,“ entspringt auch die Lehre vom abstracten Werthe der Güter (Siehe Rau, „Volkswirthschaftslehre,“ §. 58 ff., 1863). Eine Gattung kann nützliche Eigenschaften haben, welche die concreten Güter zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse tauglich machen. der Grad der Nützlichkeit kann bei den verschiedenen Gattungen mit Rücksicht auf bestimmte Gebranclszwecke ein ungleicher sein (Buchenholz und Weidenholz für Heizzwecke u. dgl. m.); weder die Nützlichkeit der Gattung, noch aber auch der verschiedene Grad derselben bei den verschiedenen Gattungen oder Species kann indess „Werth“ genannt werden. Nicht die Gattungen, sondern stets nur die concreten Güter sind den wirthschaftenden Individuen verfügbar, nur diese letztern demnach Güter und nur solche: Objecte unserer Wirthschaft und unserer Werthschätzung.
[4] Wie eine tiefer gehende Untersuchung der seelischen Vorgänge uns die Erkenntniss der Aussendinge lediglich als die zu unserem Bewusstsein gelangte Einwirkung der Dinge auf uns selbst, das ist in letzter Reihe als die Erkenntniss eines Zustandes unserer eigenen Person erscheinen lässt, so ist auch alle Bedeutung, welche wir den Dingen der Aussenwelt beimessen, in letzter Reihe nur ein Ausfluss jener Bedeutung, welche die Aufrechthaltung unserer Natur in ihrem Wesen und ihrer Entwickelung, das ist unser Leben und unsere Wohlfahrt für uns haben. Der Werth ist demnach nichts den Gütern Anhaftendes, keine Eigenschaft derselben, sondern vielmehr lediglich jene Bedeutung, welche wir zunächst der Befriedigung unserer Bedürfnisse, beziehungsweise unserem Leben und unserer Wohlfahrt beilegen und in weiterer Folge auf die ökonomischen Güter, als die ausschliessenden Ursachen derselben, übertragen.
[5] Proudhon (Système des contradictions économiques, Ch. II, §. 1) wird durch den obigen Irrthum verleitet, einen unlösbaren Widerspruch zwischen dem Gebrauchswerthe und dem Tauschwerthe zu constatiren.
[6] Ist ein Gut zur Befriedigung mehrerer, der Art nach verschiedenen Bedürfnisse tauglich, deren einzelne Acte wieder eine, je nach dem Grade der Vollständigkeit der bereits erfolgten Befriedigung der bezüglichen Bedürfnisse sich abschwächende Bedeutung haben, so verwenden die wirthschaftenden Menschen auch in diesem Falle die ihnen verfügbaren Quantitäten desselben zunächst zur Sicherstellung jener Acte der in Rede stehenden Bedürfnissbefriedigungen, welche für sie ohne Rücksicht auf die Art des Bedürfnisses die höchste Bedeutung haben, den Rest zur Sicherstellung, jener concreten Bedürfnissbefriedigungen, welche in Rücksicht auf ihre Bedeutung den erstern zunächst stehen und so fort zur Sicherstellung der minder wichtigen Bedürfnisse, ein Vorgehen, welches den Erfolg hat, dass die wichtigsten jener concreten Bedürfnisse, die nicht mehr zur Befriedigung gelangen, bei allen Arten der obigen Bedürfnisse jeweilig von gleicher Bedeutung sind, also alle Bedürfnisse bis zu einem gleichen Grade der Wichtigkeit der concreten Acte derselben zur Befriedigung gelangen.
[7] Setzen wir den Fall, ein wirthschaftendes Individuum bedürfte zur vollen Befriedigung seiner sämmtlichen, rücksichtlich ihrer Wichtigkeit sich von 10 bis zu 1 abstufenden Bedürfnisse nach einem Gute, 10 concrete Güter, oder Quantitäten von solchen (also 10 Q.), während ihm nur 7 solche Güter, oder Quantitäten (also 7 Q) verfügbar wären, so ist nach dem, was wir über das Wesen der menschlichen Wirthschaft gesagt haben, zunächst sicher, dass das obige Individuum mit der ihm verfügbaren Gesammtquantität (mit 7 Q.) nur jene Bedürfnisse befriedigen wird, deren Wichtigkeit sich von 10–4 abstuft, während die übrigen, rücksichtlich ihrer Wichtigkeit sich von 3–1 abstufenden Bedürfnisse unbefriedigt bleiben werden. Welchen Werth würde nun in diesem Falle ein concretes Gut, beziehungsweise eine der obigen 7 Quantitäten (also 1 Q.), für das in Rede stehende wirthschaftende Individuum haben? Diese Frage ist nach dem, was wir über das Wesen des Güterwerthes wissen, gleichbedentend mit der Frage nach der Bedeutung jener Bedürfnissbefriedigungen, welche nicht erfolgen würden, wofern das betreffende Individuum statt über 7 nur über 6 Güter oder Güterquantitäten (über 6 Q.) zu verfügen vermöchte? Nun ist es klar, dass die in Rede stehende Person, wenn ihr durch irgend ein Ereigniss eines der sieben ihr verfügbaren Güter, beziehungsweise Theilquantitäten entzogen würde, mit den übrigen sechs die Befriedigung der wichtigeren Bedürfnisse mit Hintansetzung der minder wichtigen vornehmen würde und demnach die Entziehung eines Gutes, oder einer der obigen Theilquantitäten, lediglich den Erfolg hätte, dass jene Bedürfnissbefriedigung entfallen möchte, deren Bedeutung unter den durch die verfügbare Gesammtquantität (also durch 7 Q.) noch gesicherten Bedürfnissbefriedungen die niedrigste ist, also diejenige, deren Bedeutung wir oben mit 4 bezeichnet haben, während die Bedürfnissbefriedigungen, beziehungsweise jene Acte derselben, deren Bedeutung von 10–5 herabreicht, vor wie nach erfolgen würden. Von der Verfügung über ein concretes Gut oder eine solche Theilquantität wäre demnach in dem obigen Falle nur eine Bedürfnissbefriedigung abhängig, deren Bedeutung wir mit 4 bezeichneten und diese Bedeutung wäre, insolange die hier in Rede stehende Person über 7 concrete Güter, beziehungsweise über die sieben oben erwähnten Theilquantitäten verfügte, der Werth jedes einzelnen Gutes, beziehungsweise jeder einzelnen Theilquantität. Nur eine Bedürfnissbefriedigung von diesem Masse der Bedeutung wäre nämlich in dem gegebenen Falle von jenem Gute, beziehungsweise von jener Theilquantität der verfügbaren Gütermenge abhängig. Befänden sich aber unter sonst gleichen Verhältnissen nur fünf Güter, beziehungsweise fünf der obigen Theilquantitäten, in der Verfügung des in Rede stehenden wirthschaftenden Subjectes, so ist ebenso klar, dass, insolange diese ökonomische Sachlage vorhanden wäre, jedes concrete Gut, beziehungsweise jede der obigen Theilquantitäten, eine Bedeutung für dasselbe hätte, die in der Zahl 6, bei 3 Gütern oder Theilquantitäten eine solche, die in der Zahl 8, bei einem einzigen Gute endlich eine solche, die in der Zahl 10 ihren ziffermässigen Ausdruck fände.
[8] Der Versuch, einen Massstab des Gebrauchswerthes der Güter aufzufinden und diesen letztern als Grundlage des Tauschwerthes derselben hinzustellen, wurde bereits von Aristoteles gemacht. „Es muss Etwas geben,“ sagt derselbe (Ethic. Nic. V. 8), „was das Mass von Allem sein kann…. Dieses Mass ist nun in Wahrheit nichts anderes, als das Bedürfniss, welches Alles zusammenhält: denn bedürfte man nichts, oder Alles auf die gleiche Weise, so würde es keinen Gütertausch geben.“ In demselben Sinne schreibt Galiani (Della moneta L. I, Cap. II, S. 27 der ed. 1780): „Essendo varie le dispositioni degli animi umani e varii i bisogni, vario è il valor delle cose.“ Turgot, der sich mit der obigen Frage in seiner uns als Fragment überkommenen Abhandlung „Valeurs et Monnaies“ in eingehender Weise beschäftigt, sagt (a. a. O. S. 81. Daire): Sobald die Cultur einen gewissen Grad erreicht hat, fängt der Mensch an, die Bedürfnisse mit einander zu vergleichen, um die Vorsorge für die Herbeischaffung der Güter dem Grade der Nothwendigkeit und Nützlichkeit der verschiedenen Güter (besoins, in diesem Sinne bei den Physiokraten sehr häufig) auzupassen. Bei der Bewerthung der Güter berücksichtige der Mensch indess auch die grössere oder geringere Schwierigkeit der Herbeischaffung derselben, und so kommt Turgot (ibid S. 83) zum Schlusse: „La valeur estimative d'un objet, pour l'homme isolé, est precisement la portion du total de ses facultés, qui répond au désir qu'il a de cet objet, ou celle qu'il veut employer à satisfaire ce desir.“Zu andern Resultaten gelangt Condillac. Er sagt (Le commerce et le gouvernement 1777, S. 250 ff., Daire.): On dit qu'une chose est utile, lorsqu'elle sert à quelquesuns de nos besoins. D'après cette utilité, nous l'estimons plus ou moins. Or, cette éstime est ce que nous appelons valeur.“ Während demnach bei Turgot die auf die Herbeischaffung eines Gutes gewendete Kraftaufopferung eines Menschen das Mass für den Gebrauchswerth eines Gutes ist, ist es nach Condillac der Grad seiner Nützlichkeit: zwei Grundanschauungen, welche seither vielfach in den Schriften englischer und französischer Nationalökonomen wiederkehren. eine tiefer gehende Behandlung hat die Frage nach dem Masse des Gebrauchswerthes indess erst bei den Deutschen gefunden. In einer vielfach angeführten Stelle, in welcher B. Hildebrand Proudhon's Widersprüche gegen die herrschende Werththeorie zurückweist (Nationalökonomie der Gegenwart und Zukunft, 1848, S. 318 ff) sagt derselbe: „Da der Nutzwerth immer eine Relation der Sache zum Menschen ist, so hat jede Gütergattung das Mass ihres Nutzwerthes an der Stimme und Rangordnung der menschlichen Bedürfnisse, welche sie befriedigt, und wo keine Menschen und keine Bedürfnisse existiren, dort giebt es auch keinen Nutzwerth. Die Summe des Nutzwerthes, welche jede Gütergattung besitzt, bleibt daher, sobald sich nicht die Bedürfnisse der menschlichen Gesellschaft ändern, unveränderlich, und vertheilt sich auf die einzelnen Stücke der Gattung, je nach der Quantität derselben. Je mehr sich die Summe der Stücke vergrössert, desto geringer wird der Antheil, welcher jedem Stücke vom Nutzwerthe der Gattung zufällt und umgekehrt.“ Die obige Darlegung, welche eine unvergleichliche Auregung zur Forschung bot, leidet nichtsdestoweniger an zwei Gebrechen, welche, wie wir sehen werden, spätere Bearbeiter der Lehre zum Theile auch empfunden haben und zu beseitigen bemüht waren. Unter dem Werthe einer „Gütergattung“ kann in dem obigen Zusammenhange füglich nichts Anderes verstanden werden, als der Werth, welchen die Gesammtheit der verfügbaren Güter einer Gattung für die menschliche Gesellschaft hat, Dieser Werth ist indess nicht realer Natur, das ist: nirgends in Wahrheit zu beobachten, indem der Werth stets nur im Individuum und zwar rücksichtlich concreter Güterquantitäten zur Erscheinung gelangt (v. oben S. 81). Würde man aber auch davon abschen und den obigen „Gattungswerth“ als die Gesammtheit des Werthes auffassen, welchen die concreten Güter einer Gattung für die einzelnen, Mitglieder der Gesellschaft, in deren Verfügung sie sich befinden, haben, so würde der obige Satz H's doch nicht bestehen können, denn es ist klar, dass schon eine verschiedene Vertheilung der in Rede stehenden Güter, geschweige denn die Veränderung der verfügbaren Quantität derselben den „Gattungswerth“ in diesem Sinne verändern, ja, unter Umständen gänzlich aufheben müsste. Ein „Gattungswerth“ im eigentlichen Sinne des Wortes ist demnach, wofern man die „Nützlichkeit,“ die „erkannte Nützlichkeit,“ beziehungsweise den „Grad der Nützlichkeit nicht mit dem „Werthe“ verwechselt, nicht realer Natur, nicht existent, der Gattungswerth im Sinne der Gesammtheit des Werthes der concreten Güter einer gewissen Gattung für die einzelnen Mit glieder der menschlichen Gesellschaft aber—auch wenn die Bedürfnisse dieser letzteren sich nicht ändern—keine unveränderliche Grösse und die Grundlage, auf welcher H. sein Calcul aufbaut, demnach anfechtbar. Dann tritt noch der Umstand, dass H. die verschiedene Bedeutung, welche die Befriedigung der einzelnen concretens Bedürfnisse für die Menschen hat, nicht in Berücksichtigung zieht, wenn er den „Werth der Gattung“ auf die einzelnen Stücke der Gattung je nach der Quantität vertheilt. (Vgl. schon Knie's Tüb. Ztsch. 1855, S. 463 ff.) Das wahre Element der obigen Lehre, H's, liegt in der sc' arfsinnigen und für alle Zeiten giltigen Beobachtung, dass der Gebrauchswerth der Güter sich mehrt, wenn die verfügbare Quantität derselben vermindert wird, und so umgekehrt, H. geht aber entschieden zu weit, indem er überall eine genaue Verhältnissmässigkeit annimmt.—Einen Versuch zur Lösung des obigen Problems in anderer Richtung macht Friedländer (Die Theorie des Werthes; Dorpater Univ. Schr. 1852, Seite 60 ff.). Derselbe kommt zu dem Resultate, dass „die durchschnittliche concrete Bedürfnisseinheit. (das Mittel der innerhalb der verschiedenen Classen der Gesellschaft gefundenen besonderen Bedürfnisseinheiten) der allgemeine Ausdruck für den objectiven volkswirthschaftlichen Gebrauchswerth sei und der Bruch, welcher die Quoten ausdrückt, welche die einzelnen Brauchlichkeiten zur Bedürfnisseinheit beitragen und das Werthverhältniss derselben zur mittleren concreten Bedürfnisseinheit anzeigt, das Mass für den objectiven Werth der einzelnen Brauchlichkeiten abgebe.“ Ich glaube, dass gegen die obige Lösung des Problems vor Allem einzuwenden ist, dass der subjective Charakter des Güterwerthes vollständig verkannt wird, wenn ein „mittlerer Mensch“ mit einem „Durchschnittsbedarf“ construirt wird, da ja der Gebrauchswerth, welchen ein und dasselbe Gut für zwei verschiedene Personen nach Massgabe ihres Bedarfes und der ihnen verfügbaren Quantität hat, ein höchst verschiedener zu sein pflegt. „Die Feststellung des Gebrauchswerthes in Bezug auf den mittleren Menschen“ löst demnach in Wahrheit nicht das obige Problem, da es sich bei demselben um das Mass des Gebrauchswerthes der Güter, wie derselbe von uns in den concreten Fällen beobachtet werden kann, also mit Rücksicht auf concrete Menschen handelt. Fr. gelangt denn auch lediglich zur Bestimmung des Masses für „den objectiven Werth“ der einzelnen Güter (S. 68), während ein solcher in Wahrheit doch gar nicht vorhanden ist. Einen tief gehenden Versuch. das obige Problem zu lösen, hat auch Knies in der bereits erwähnten Abhandlung (Die nat.-ökon. Lehre vom Werthe, Tübing. Ztsch. 1855) gemacht. „Die Bedingungen für die Abschätzung des Gebrauchswerthes der Güter,“ sagt K. (S. 429) ganz richtig, „können in nichts Anderem, als in den wesentlichen Elementen für den Begriff des Gebrauchswerthes gefunden werden.“ Der Umstand, dass K. diesen letztern, wie wir oben sahen, nicht eng genug begrenzt, verleitet ihn indess auch zu manchen anfechtbaren Schlüssen rücksichtlich der Bestimmung des Werthmasses. „Die Grösse des Gebrauchswerthes der Güter,“ fährt K. fort, „hängt ab: a) von der Intensivität des menschlichen Bedürfnisses, welches sie befriedigen, b) von der Intensivität, in welcher sie ein menschliches Bedürfniss befriedigen…Hiernach stellt sich eine Classification und Stufenleiter der menschlichen Bedürfnisse ein, mit welcher eine Classification und Stufenleiter der Gütergattungen correspondirt.“ Nun ist das Bedürfniss nach Wasser eines der intensivsten unter den menschlichen Bedürfnissen, denn von seiner Befriedigung hängt unser Leben ab, und Niemand vermag zu läugnen, dass frisches Quellwasser dies Bedürfniss in der intensivsten Weise befriedigt. Es müsste demnach dies Gut—wofern K's Princip des Werthmasses das richtige wäre—auf der Stufenleiter der Gütergattungen eine der höchsten Stufen einnehmen, Während doch concrete Quantitäten hievon der Regel nach keinen Werth haben, Gütergattungen aber, wie wir bereits oben zeigten, überhaupt keinen Werth haben können. Wenn K. im Verlaufe seiner Abhandlung nach einer ausführlichen Untersuchung über das Mass des „abstracten Güterwerthes“ auch den privatwirthschaftlich-concreten Gebrauchswerth (S. 461) zur Sprache bringt, so geschieht es doch nur, um mit Rau den häfigen Gegensatz zwischen dem „Gattungswerthe“ (in Wahrheit „Nützlichkeit“) und dem concreten Werthe der Güter, also den sehr richtigen Satz darzuthun, dass das Mass der Nützlichkeit der Dinge etwas von dem Masse ihres Werthes wesentlich verschiedenes ist. Zu einem Principe der Grössenbestimmung des Gebrauchswerthes in seiner concreten Form gelangt K. nicht, obzwar er demselben an einer Stelle seiner gedankeureichen Abhandlung (S. 441) sehr nahe kommt.—Von einem anderen Standpunkte aus ist Schäffle (Tübing. Univers. Schriften, 1862, 5. Abth., S. 12 ff.) an die Lösung der Frage gegangen. „Die Thätigkeit des Wirthschaftens,“ schreibt der scharfsinnige Forscher, „wird um so energischer in Anregung kommen, je dringender das persönliche Bedürfniss für ein Gut, und je schwieriger das diesem Bedürfniss entsprechende Gut zu beschaffen ist. Je mehr diese beiden Factoren: Intensivität des Begehrens und Intensivität der Schwierigkeit des Erlangens, auf einander wirken, desto stärker tritt die Bedeutung des Gutes in das die wirthschaftliche Thätigkeit leitende Bewusstsein. Auf dieses Grundverhältniss führen alle Sätze über Mass und Bewegung des Werthes zurüek.“ Ich stimme nun Sch. vollkommen bei, wenn er sagt, dass je dringender das persönliche Bedürfniss nach einem Gute ist, um so energischer auch unsere wirthschaftliche Thätigkeit in Bewegung gesetzt wird, überall dort, wo es sich darum handelt, uns das bezügliche Gut zu verschaffen; andererseits ist aber nicht minder sicher, dass nicht wenige Güter, nach welchen wir die dringendsten Bedürfnisse empfinden (z. B Wasser), der Regel nach gar keinen, andere, welche nur zur Befriedigung von Bedürfnissen von viel geringerer Bedeutung tauglich sind (Jagdschlösser künstliche Wildententeiche u. dgl. m.) einen nicht unbeträchtlichen Werth für die Menschen haben. Die Dringlichkeit der Bedürfnisse, zu deren Befriedigung ein Gut tauglich ist, kann demnach an und für sich nicht das massgebende Moment des Werthes eines Gutes sein, selbst wenn man von dem Umstande absehen will, dass die meisten Güter doch zur Befriedigung verschiedener Bedürfnisse, deren Intensivität gleichfalls eine verschiedene ist, dienlich sind, und somit bei dem obigen Principe die sichere Bestimmung der massgebenden Grösse, also dasjenige zweifelhaft bleibt, was eben in Frage ist. Eben so wenig ist aber auch die Intensivität der Schwierigkeit des Erlangens eines Gutes an und für sich das Mass seines Werthes. Güter von sehr geringem Werthe sind nicht selten nur mit den grössten Schwierigkeiten zu erlangen, und ist es nicht richtig, dass die wirthschaftliche Thätigkeit der Menschen um so energischer in Anregung kommt, je grösser die obigen Schwierigkeiten sind. Im Gegentheil richten die Menschen ihre wirthschaftliche Thätigkeit stets auf die Erlangung jener Güter, welche bei gleicher Dringlichkeit des Bedürfnisses mit den geringsten Schwierigkeiten erlangt werden können. Weder der eine noch der andere Theil des obigen Doppelprincips bietet demnach an und für sich ein massgebendes Princip für die Werthbestimmung. Allerdings sagt Sch.: „Je mehr diese beiden Factoren: Intensivität des Begehrens und Intensivität der Schwierigkeit des Erlangens, auf einander wirken, desto stärker tritt die Bedeutung des Gutes in das die wirthschaftliche Thätigkeit leitende Bewusstsein.“ Es ist aber klar, dass, wenn wir uns auch, wie Sch. dies (a. a. O. S. 7) ausdrücklich betont, die wirthschaftliche Thätigkeit „mit Bewusstsein auf die allseitige Erfüllung der sittlich vernünftigen Lebenszwecke gerichtet,“ oder mit andern Worten die Güter in den Händen vernünftig wirthschaftender Subjecte denken—ein Umstand, in dem, wie Sch. ganzrichtig erkannt hat, allerdings ein wesentliches Moment zur Lösung der obigen Widersprüche liegt—doch die Frage ungelöst bleibt, wie eigentlich „die beiden obigen Factoren auf einander wirken“ und wieso in Folge dieser gegenseitigen Einwirkung ein jedes Gut ein bestimmtes Mass der Bedeutung für die wirthschaftenden Menschen erlangt.—Unter den neuern Nationalökonomen, welche die Lehre vom Werthmasse als Theil eines Systems behandelt haben, ist insbesondere Stein wegen der originellen Auffassung dieser Lehre zu nennen. St., welcher den Werth (System der Staatswissenschaft I., S. 169 ff., 1852) als „das Verhältniss des Masses eines bestimmten Gutes zum Leben der Güter überhaupt“ definirt, gelangt (S. 171 ff.) zu der folgenden Formel für die Bestimmung des Werthmasses: „Das wirkliche Werthmass eines Gutes wird gefunden, indem die Masse der übrigen Güter mit der Masse des fraglichen Gutes dividirt wird. Um dies aber zu können, muss zuerst für die gesammte Gütermasse ein gleichnamiger Nenner gefunden werden. Dieser gleichartige Nenner, oder die Gleichartigkeit der Güter, ist für sie aber nur gegeben in ihrem gleichartigen Wesen; darin dass alles wirkliche Gut wieder aus den sechs Elementen des Stoffes, der Arbeit, des Erzeugnisses des Bedürfnisses, der Verwendung und der wirklichen Consumtion besteht, indem, wo eins dieser Elemente wegfällt, das Object ein Gut zu sein aufhört. Diese Elemente eines jeden wirklichen Gutes sind nun in diesem Gute wieder in bestimmtem Masse enthalten, und das Mass dieser Elemente bestimmt das Mass des einzelnen, wirklichen Gutes für sich. Daraus folgt, dass das Massverhältniss aller einzelnen Güter untereinander, oder ihr allgemeines Werthmass gegeben ist in dem Verhältniss der Guterelemente und ihrer Masse innerhalb des einen Gutes zu demjenigen innerhalb des audern. Und die Bestimmung und Berechnung dieses Verhältnisses ist mithin die Bestimmung des wirklichen Werthmasses.“ (Vergl. auch a. a. O S. 181 ff. die Formel der Werthgleichung.)
[9] Unser Bedarf an Gütern höherer Ordnung ist bedingt durch den voraussichtlichen ökonomischen Charakter (S. 67), beziehungsweise durch den voraussichtlichen Werth der Güter, zu deren Hervorbringung sie dienen. Wir können somit in der Sicherstellung unseres Bedarfes, beziehungsweise in der Befriedigung unserer Bedürfnisse auch nicht von der Verfügung über Güter abhängig sein, welche lediglich zur Hervorbringung solcher Güter niederer Ordung dienlich sind, die voraussichtlich keinen Werth haben werden (weil wir an ihnen eben keinen Bedarf haben), und es ergiebt sich somit der Grundsatz, dass der Werth der Güter höherer Ordnung durch den voraussichtlichen Werth der Güter niederer Ordnung bedingt ist, zu deren Hervorbringung sie dienen. Güter höherer Ordnung können demnach nur insoferne Werth erlangen, den erlangten aber auch nur insolange behaupten, als sie zur Hervorbringung von Gütern dienen, welche voraussichtlich Werth für uns haben werden.
[10] Zunächst und unmittelbar hat nur die Befriedigung unserer Bedürfnisse für uns eine Bedeutung, und findet diese letztere in jedem concreten Falle ihr Mass in der Wichtigkeit der bezüglichen Bedürfnissbefriedigung für unser Leben und unsere Wohlfahrt. Diese Bedeutung, und zwar in ihrer quantitativen Bestimmtheit, übertragen wir zunächst auf jene concreten Güter, von welchen wir, in der Befriedigung der betreffenden Bedürfnisse unmittelbar abhängig zu sein, uns bewusst sind, das ist auf die ökonomischen Güter erster Ordnung, nach den im vorigen Abschnitte dargelegten Grundsätzen. Wo immer aber unser Bedarf durch Güter erster Ordnung nicht, oder nicht vollständig gedeckt ist, das ist in allen Fällen, wo die Güter erster Ordnung eben Werth für uns erlangen, greifen wir in dem Bestreben unsere Bedürfnisse möglichst vollständig zu befriedigen nach den entsprechenden Gütern der nächst höheren Ordnung und übertragen den Werth der Güter erster Ordnung, fortschreitend auf die Güter zweiter, dritter und höherer Ordnung überall dort, wo auch diese letztern den ökonomischen Charakter aufweisen. Auch der Werth der Güter höherer Ordnung ist demnach in letzter Reihe nichts anderes, als eine besondere Erscheinungsform jener Bedeutung, welche wir unserem eigenen Leben und unserer Wohlfahrt beimessen, und das massgebende Moment desselben, gleichwie bei den Gütern erster Ordnung, in letzter Reihe lediglich die Bedeutung, welche jene Bedürfnisbefriedigungen für uns haben, rücksichtlich welcher wir von der Vorfügung über die Güter höherer Ordnung, deren Werth in Frage ist, abhängig zu sein uns bewusst sind. Der Causalnexus der Güter bewirkt indess, dass der Werth der Güter höherer Ordnung sein Mass nicht unmittelbar in der voraussichtlichen Bedeutung der endlichen Bedürfnissbefriedigung, sondern zunächst in dem voraussichtlichen Werthe der entsprechenden Güter niederer Ordnung findet.
[11] Der häufigste Fehler, welcher nicht nur bei der Eintheilung, sondern auch bei der Begriffsbestimmung des Capitals begangen wird, ist, dass der technische, statt des wirthschaftlichen Standpunktes betont wird. (Vid. dagegen schon Lotz: Staatswirthschaft I., 19, und Herrmann: Staatsw. Untersuchungen, 1832, S. 62.) Die Eintheilung der Güter in Productiv- und Genussmittel, (Güter höherer und erster Ordnung,) ist eine wissenschaftlich berechtigte, fällt aber mit der Eintheilung des Vermögens in Capital und Nichtcapital durchaus nicht zusammen. Ebenso unhaltbar scheint mir die Meinung derjenigen zu sein, welche jeden Vermögensbestandtheil, welcher deuernd Einkommen gewährt, „Capital“ nennen. Die consequente Ausbildung dieser Lehre führt (wofern der Begriff des Vermögens auch auf die Arbeitskraft und jener des Einkommens auch auf die Nutzungen von Gebrauchsgütern Seitens ihrer Besitzer ausgedehnt wird; vid. Herrmann: Staatsw. Unters, 1832, S. 300 ff., und Schmoller: Die Lehre vom Einkommen, Tübing, Zeitsch., 1863, S. 63 ff., S. 76 ff.) dazu, dass, sowohl die Arbeitskraft, (vid schon Canard, Principies d'econ. pol S. 9; Say, Cours, 1828, I. p. 285), als auch Grundstücke (vid. Ehrenberg: Staatsw. nach Naturgesetzen, 1819, S. 13; Oberndorfer: Nationalökonomie, 1822, S, 207; Edinb. Review. Vol. IV., p. 364 ff.; Herrmann: Staatsw. Unters, 1832, S. 48 ff., Hasner System I., 294) endlich auch alle Gebrauchsgüter von einiger Dauer (Hermann: Staatsw. Untersuch., 1832, S. 63) Capitalien genannt werden müssten. In Wahrheit versteht man unter Capitalien aber nur jene Quantitäten ökonomischer Güter, welche uns in der Gegenwart für kommende Zeiträume, also innerhalb gegebener Zeiträume verfügbar sind und uns jene Nutzung gestatten, deren Wesen und ökonomischen Charakter wir oben (S. 127 ff.) eines weitern dargelegt haben. Damit dieser Erfolg eintreten könne, ist indess das Zusammentreffen der folgenden Voraussetzungen nöthig. Es muss 1. der Zeitraum, innerhalb welches das wirthschaftende Subject über die bezüglichen Quantitäten ökonomischer Güter verfügt, ausreichend sein, um demselben eine Production (im wirthschaftlichen Sinne des Wortes, S. 133) zu ermöglichen. 2. Es müssen die Quantitäten dem Umfange und der Beschaffenheit nach der Art sein, dass das bezügliche wirthschaftende Subject durch dieselben entweder mittelbar oder unmittelbar über die zur Hervorbringung von Gütern niederer Ordnung erforderlichen complementären Quantitäten von Gütern höherer Ordnung verfügt. Quantitäten von ökonomischen Gütern, welche den wirthschaftenden Subjecten nur für so kurze Zeiträume, oder in Rücksicht auf Quantität, Beschaffenheit oder andere Thatumstände derart verfügbar sind, dass die Productivität derselben ausgeschlossen ist, sind demnach keine Capitalien. Der wichtigste Unterschied zwischen einzelnen Vermögensobjecten, welche Einkommen gewähren (Grundstücke, Gebäude etc.) und Capitalien besteht darin, dass die erstern concrete, dauerhafte Güter sind, deren Nutzungen selbst wieder Güterqualität und ökonomischen Charakter aufweisen, die letztern aber, sei es nun mittelbar oder unmittelbar, Gesammtheitens von ökonomischen Gütern höherer Ordnung (complementäre Quantitäten von solchen) darstellen, deren Nutzung zwar gleichfalls den ökonomischen Charakter hat und desshalb Einkommen gewährt, deren Productivität indess wesentlich anderer Natur ist, als jene der obigen Vermögensobjecte. Auf das sprachwidrige Zusammenfassen der beiden obigen Gruppen von Einkommensquellen unter dem Begriff des Capitals lassen sich fast sämmtliche Schwierigkeiten zurückführen, welche aus der Lehre vom Capital für die Theorie entstanden sind.—Der Umstand, dass unter entwickelten Verkehrsverhältnissen Capitalien sehr häufig in der bequemen Form von Geldsummen und auch sonst der Regel nach in Gelde geschätzt den Capitalbedürftigen zur Benützung dargeboten werden, hat zur Folge gehabt, dass im gemeinen Leben unter Capitalien der Regel nach Geldsummen verstanden werden. Dass der Begriff des Capitals hiebei viel zu eng aufgefasst und eine besondere Species des letztern zum Typus desselben überhaupt erhoben wird, ist einleuchtend. In den entgegengesetzten Fehler verfallen dagegen jene, welche die Geldcapitalien nicht als wahre Capitalien, sondern blos als Repräsentanten von solchen ansehen. Die Ansicht der erstern ist jener der Mercantilisten analog, welche nur im Gelde „Vermögen“ sahen, die letztere jener mancher zu weit gehenden Gegner des Mercantilismus, welche in Geldsummen überhaupt keine wahren Vermögensobjecte erkennen. (Siehe von Neuern namentlich: Chevalier, Cours d'econ. polit, III, p. 380, und Carey: Socialwissenschaft, XXXII., §. 3.). In Wahrheit ist das Geldcapital nur eine bequeme, dem Zwecke des Capitals unter entwickelten Verkehrsverhältnissen besonders entsprechende Form desselben (Vgl. H. Brocher in Hildebr. Jahrbüch, VII, S. 33 ff.). Sehr schön betont dies Knies (Die politische Oekonomie, 1853, S. 87) vom historischen Standpunkte aus: „Wir finden bei allen einzelnen Nationen insofern eine Analogie der Entwickelung, als überall das Capital seine wirthschaftliche Kraft erst nach der Einführung und der verbreiteteren Anwendung des Metallgeldes stärker entwickeln, seine ausgedehntere Macht erst auf den höheren Culturstufen entfalten konnte.“ Das Geld erleichtert demnach allerdings die Uebertragung von Capitalien aus einer Hand in die andere, insbesondere auch den Verkehr mit Capitalnutzungen und den Umsatz des Capitals in jede beliebige Form (die beliebige Benützung derselben), dem Begriffs des Capitals ist jedoch jener des Geldes vollständig fremd. (Vgl. Dühring: Zur Kritik des Capitalbegriffes „Hildebrand's Jahrbücher, V, S. 318 ff., und Kleinwächter: „Beitrag zur Lehre vom Capitale,“ ibid. IX., 369 ff.)
[12] Wenn von einigen Nationalökonomen die Zinszahlung als eine Entschädigung für die Enthaltsamkeit des Capitalbesitzers hingestellt wird, so ist dagegen zu bemerken, dass die Enthaltsamkeit einer Person an und für sich nicht die Güterqualität und demnach auch nicht Werth für uns erlangen kann. Auch entstcht das Capital durchaus nicht in allen Fällen durch Enthaltsamkeit, sondern in vielen Fällen (z. B. überall dort, wo bisher nicht-ökonomische Güter höherer Ordnung durch den wachsenden Bedarf der Gesellschaft den ökonomischen Charakter erlangen) durch blosse Occupation. Die Zinszahlung ist demnach nicht als Entschädigung des Capitalbesitzers für seine Enthaltsamkeit zu betrachten, sondern nichts anderes, als der Eintausch eines ökonomischen Gutes (der Capitalbenützung) gegen ein anderes, (z. B. gegen Geld). Allerdings verfällt Carey (Socialwissenschaft, XXXIX, §.6) in den entgegengesetzten Irrthum, wenn er der Sparsamkeit eine der Capitalerzeugung geradezu feindliche Tendenz zuschreibt.
[13] Als Güter höherer Ordnung sind nicht nur die technischen Productionsmittel zu betrachten, sondern überhaupt alle Güter, welche erst durch die Verbindung mit andern Gütern höherer Ordnung der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse zugeführt werden. Die Waaren, welche der Grosshändler nur mit Aufwendung von Capitalnutzungen, Frachten und verschiedenen specifischen Arbeitsleistungen in die Hände der Detailhändler gelangen lassen kann, sind als Güter höherer Ordnung zu betrachten, und eben so die Waaren, welche sich in den Händen des Krämers befinden. Selbst der Speculant fügt den Objecten seiner Speculation zum mindesten seine Unternehmerthätigkeit und Capitalnutzungen hinzu, nicht selten auch Conservirungsarbeiten, Magazinsbenutzungen u. dgl. m.
[14] Vgl. Hasner: System d. pol. Oekonomie. 1860, I., S. 29.
[15] Wer über die zur Hervorbringung von Gütern niederer Ordnung erforderlichen Güter höherer Ordnung verfügt, verfügt dadurch nicht sofort und unmittelbar über die erstern, sondern erst nach Ablauf eines durch die Natur des Productionsprocesses bedingten, bald längern, bald kürzern Zeitraumes. Will er nun für seine Güter höherer Ordnung sofort die entsprechenden Güter niederer Ordnung, oder was unter entwickelten Verkehrsverhältnissen dasselbe ist, die entsprechende Geldsumme, austauschen, so befindet er sich allerdings in einer ähnlichen Lage, wie derjenige, welcher über eine Summe in einem kommenden Zeitpunkte (z.B. nach 6 Monaten) verfügt und dieselbe sich sofort verfügbar machen will. Ist die Absicht des Besitzers von Gütern höherer Ordnung wohl darauf gerichtet, dieselben an eine dritte Person zu übertragen, begnügt er sich aber damit, dass ihm das Entgelt erst nach Beendigung des Productionsprocesses geleistet werde, so entfällt naturgemäss dies „Escomptiren“ und wir können denn auch in der That beobachten, dass der Preis von Gütern, welche auf Credit gegeben werden, (ganz abgesehen von der Gefahrprämie,) um so höher ist, je ferner der vereinbarte Zahlungstermin liegt. In dem Obigen liegt aber auch zugleich die Erklärung der grossen Förderung der productiven Thätigkeit eines Volkes durch den Credit. In der weitaus grössern Mehrzahl von Fällen bestehen Creditgeschäfte in der Hingabe von Gütern höherer Ordnung an diejenigen, welche dieselben zu den entsprechenden Gütern niederer Ordnung verarbeiten. Durch den Credit wird die Production, oder doch der umfangreichere Betrieb, sehr oft erst ermöglicht, und daher die verderbliche Stockung und Beschränkung der productiven Thätigkeit eines Volkes, wenn der Credit desselben plötzlich versiegt.
[16] Je länger der Zeitraum ist, welchen eine Production in Anspruch nimmt, um so höher ist allerdings unter sonst gleichen Umständen die Productivität derselben, um so grösser aber auch der Werth der Capitalbenützung, so zwar, dass sich der Werth von Gütern höherer Ordnung, welche für Productionen von sehr verschiedener Daner in Gebrauch gezogen werden können und uns je nach unserer Wahl Genussmittel von verschiedenem Werthe in verschiedenen Zeiträumen sichern, mit Rücksicht auf die Gegenwart ins Gleichgewicht stellt.
[17] Es ist bereits mehrfach die Frage aufgeworfen worden, welche Functionen zur Unternehmerthätigkeit gehören. Hier ist nun zunächst im Auge zu behalten, dass zu den Gütern höherer Ordnung, über welche ein Unternehmer zum Zwecke einer bestimmten Production verfügt, nicht selten auch seine eigenen technischen Arbeitsleistungen gehören, die er in einem solchen Falle denn auch gleich jenen anderer Personen ihrer Bestimmung zuführt. Der Journaleigenthümer ist demnach nicht selten zugleich Mitarbeiter seines Journales, der Gewerbeunternehmer zugleich Arbeiter. Unternehmer sind beide jedoch nicht durch ihre technische Mitwirkung beim Productionsprocesse, sondern dadurch, dass sie Güter höherer Ordnung durch ihr wirthschaftliches Calcül und schliesslich durch einen Willensact einem bestimmten Productionszwecke zuführen. Die Unternehmerthätigkeit umfasst a) die Information über die wirthschaftliche Sachlage, b) die sämmtlichen Berechnungen, welche ein Productionsprocess, soll er anders ein ökonomischer sein, zu seiner Voraussetzung hat, oder mit andern Worten das wirthschaftliche Calcül, c) den Willensact, durch welchen Güter höherer Ordnung (unter entwickelten Verkehrsverhältnissen, wo der Regel nach jedes ökonomische Gut gegen andere umgesetzt werden kann, Güter überhaupt) einer bestimmten Production gewidmet werden, und endlich d) die Ueberwachung der möglichst ökonomischen Durchführung des Productionsplanes. Die hier dargelegte Unternehmerthätigkeit pflegt bei geringfügigen Unternehmungen nur einen sehr unbeträchtlichen Theil der Zeit des Unternehmers in Anspruch zu nehmen, während bei grossen Unternehmungen nicht nur der Unternehmer selbst, sondern nicht selten auch noch einige Gehilfen von derselben vollauf in Anspruch genommen werden. Wie gross aber auch immer die Thätigkeit dieser letztern sein mag, immer lassen sich in jener des Unternehmers die vier obigen Elemente beobachten, selbst dann noch, wenn dieselbe sich schliesslich und endlich auf die Widmung von Vermögenstheilen zu gewissen, nur der Gattung nach bestimmten Productionszwecken, auf die Auswahl von Personen und die Controle beschränkt, (z. B. bei Actiengesellschaften.) Nicht einverstanden kann ich mich, nach dem Gesagten, mit Mangoldt erklären, welcher (Die Lehre vom Unternehmergewinn, 1855, S. 36 ff) „die Uebernahme der Gefahr“ bei einer Production als das wesentliche an der Unternehmung bezeichnet, während die „Gefahr“ doch nur etwas accidentielles ist und der Verlustdie Gewinn-Chance gegenübersteht.
[18] Der Umstand, dass der Preis der Bodennutzungen, der Capitalnutzungen und der Arbeitsleistungen, oder mit andern Worten: Bodenrente, Capitalzins und Arbeitslohn, wie wir in der Folge sehen werden, nicht ohne die grössten Gewaltsamkeiten auf Arbeitsquantitäten, beziehungsweise auf Productionskosten zurückgeführt werden können, hat die Vertreter der diesbezüglichen Theorien in die Nothwendigkeit versetzt, für die obigen drei Güterarten Principien der Preisbildung aufzustellen, welche von den für die übrigen Güter geltenden Grundsätzen vollständig abweichen. Nun haben wir in dem Vorangehenden dargethan, dass alle Wertherscheinungen, hinsichtlich welcher Güter sie auch immer zu Tage treten, derselben Natur sind, denselben Ursprung haben und der Werth auch rücksichtlich seines Masses in allen Fällen nach den gleichen Principion sich regelt. Da nun, wie wir in den beiden nächsten Capiteln sehen werden, der Preis der Güter eine Folge ihres Werthes für die wirthschaftenden Menschen ist und auch die Grösse des erstern unter allen Umständen in jener des letztern ihr massgebendes Princip findet, so ist zugleich klar, dass auch die Bodenrente, der Capitalzins und der Arbeitslohn sich nach den gleichen allgemeinen Grundsätzen regeln. In dem Obigen befassen wir uns indess lediglich mit dem Werthe der Bodennutzungen, der Capitalnutzungen und der Arbeitsleistungen, und werden erst dann auf Grundlage der hier gewonnenen Resultate die Grundsätze aufstellen, nach welchen sich der Preis der obigen Güter regelt, wenn wir die allgemeine Theorie des Preises überhaupt dargelegt haben werden.
Zu den seltsamsten wissenschaftlichen Streitfragen gehört jedenfalls auch die, ob die Bodenrente, beziehungsweise der Capitalzins, vom moralischen Standpunkte aus berechtigt, oder „unmoralisch“ seien. Ich glaube nämlich, dass unsere Wissenschaft unter Anderem wohl auch die Ursachen zu erforschen habe. warum, und unter welchen Voranssetzungen die Bodennutzungen, beziehungsweise die Capitalnutzungen. für uns Güter sind, den ökonomischen Charakter aufweisen, Werth erlangen und endlich im Güterverkehre erscheinen. also für dieselben Quantitäten anderer ökonomischer Güter (Preise) erlangt werden können—die Frage nach dem rechtlichen oder moralischen Charakter dieser Thatsachen aber ausserhalb der Sphäre unserer Wissenschaft liegt. Wo immer die Boden- und Capitalnutzungen Preise haben, überall dort ist dies die Folge ihres Werthes; dieser letztere ist aber nichts willkürliches (S. 85), sondern die nothwendige Consequenz ihres ökonomischen Charakters; die Preise der obigen Güter (die Bodenrente und der Capitalzins) sind demnach das nothwendige Product der ökonomischen Sachlage, unter welcher sie entstehen und werden dieselben um so sicherer entrichtet, je ausgebildeter der Rechtszustand eines Volkes und je geläuterter dessen öffentliche Moral ist. Wohl mag es für den Menschenfreund betrübend erscheinen, dass die Verfügung über ein Grundstück oder ein Capital innerhalb eines bestimmten Zeitraumes dem Besitzer nicht selten ein höheres Einkommen gewährt, als die angestrengteste Thätigkeit dem Arbeiter innerhalb desselben Zeitraumes. Der Grund hievon ist indess kein unmoralischer, sondern liegt darin, dass in den obigen Fällen eben von der Nutzung jenes Grundstückes, beziehungsweise jenes Capitals, die Befriedigung wichtigerer menschlicher Bedürfnisse abhängig sind, als von den in Rede stehenden Arbeitsleistungen. Die Agitation jener, welche einen grösseren Antheil der einer Gesellschaft verfügbaren Genussmittel den Arbeitern zugewendet sehen möchten, als dies gegenwärtig der Fall ist, verlangen demnach, so weit dies Begehren nicht Hand in Hand mit einer tüchtigeren Ausbildung des Arbeiterstandes geht, oder sich auf eine freiere Entfaltung der Concurrenzverhältnisse beschränkt, nichts anderes, als eine Entlohnung der Arbeit über ihren Werth, das ist Entlohnung der Arbeiter nicht so sehr nach dem, was ihre Leistungen der Gesellschaft werth sind, als vielmehr nach dem Massstabe einer würdigeren Existenz derselben, einer möglichst gleichen Vertheilung der Genussmittel und Mühseligkeiten des Lebens. Die Lösung der Frage auf dieser Grundlage hat nun aber allerdings eine völlige Umgestaltung unserer socialen Verhältnisse zur Voraussetzung. (Vgl. Schütz Tübing. Ztsch., 1855., S. 171 ff.)
[19] Canard: Principes d'econ. polit., 1801, S. 5 ff.; Carey: Principles of Soc. Sc. XLII §. 1; Bastiat: Harmonies écon., Chap. 9; Max Wirth: Grundzüge d. Nationalök., 1861. S. 347 ff.; Rösler: Grundsätze der Volkswirthschaftslehre, 1864, §. 100.
[20] Aus dem Obigen ergibt sich zugleich, dass wir überall dort, wo wir von Bodennutzungen sprechen, darunter die zeitlich gemessenen Nutzungen von Grundstücken verstehen, wie sie in der Wirthschaft der Menschen thatsächlich vorkommen und nicht die Benützung „ursprünglicher Kräfte,“ denn nur die erstern sind Gegenstände der menschlichen Wirthschaft, die letztern im concreten Falle lediglich Gegenstand einer zumeist noch sehr aussichtslosen historischen Untersuchung und für die wirthschaftenden Menschen irrelevant. Ob der Boden, den ein Landwirth für ein Jahr, oder für eine Reihe von Jahren pachtet, seine Fruchtbarkeit aus Capitalanfwendungen aller Art herleitet, oder von vornherein fruchtbar war, kümmert diesen wenig und hat keinen Einfluss auf den Preis, den er für die Bodenbenützung bezahlt und der Käufer eines Grundstückes bringt bei seinem Calcül wohl die „Zukunft,“ nicht aber die „Vergangnheit“ des Grundstückes in Rechnung.
[21] Ricardo: Principles of P. E., Chap. 2 und 33.
[22] Vgl. Rodhertus: Sociale Briefe au v. Kirchmann, 3. Br., 1851, S. 9 ff.
[23] Wenn Rodbertus (Sociale Briefe an v. Kirchmann, 3. Brief, S. 41 ff.) zum Schlusse gelangt, dass die Capitalbesitzer und Grundeigenthümer in Folge unserer socialen Einrichtungen in der Lage sind, den Arbeitern einen Theil des Arbeitsproductes zu entziehen und solcherart, ohne zu arbeiten, „mitleben“ können, so beruht dies auf der irrigen Voraussetzung, dass das ganze Ergebniss eines Productionsprocesses als Arbeitsproduct zu betrachten sei. Die Arbeitsleistungen sind lediglich ein Element des obigen Processes und auch nicht in höherem Masse ökonomische Güter, als die übrigen Elemente der Production und insbesondere die Boden- und Capitalnutzungen. Die Capital- und Grundbesitzer leben demnach auch nicht von dem, was sie den Arbeitern entziehen, sondern von ihren Capital- und Bodennutzungen, welche für Individuum und Gesellschaft ebenso wohl Werth haben, als die Arbeitsleistungen.
[24] Der Werth der Grundstücke richtet sich nach dem voraussichtlichen Werthe der Bodennutzungen, nicht umgekehrt dieser letztere nach dem erstern. Der Werth der Grundstücke ist nichts anderes, als der voraussichtliche Werth der Gesammtheit der Bodennntzungen zurückbezogen auf die Gegenwart. Je höher der voraussichtliche Werth der Bodennutzungen und je geringer der Werth der Capitalnutzungen, um so höher somit der Werth der Grundstücke. Wir werden in der Folge sehen, dass der Werth der Güter die Grundlage der Preise derselben ist. Wenn in Zeiten des wirthschaftlichen Aufschwunges eines Volkes regelmässig die Erscheinung zu Tage tritt, dass der Preis der Grundstücke in rascher Progression wächst, so hat dies seinen Grund einerseits in dem Steigen der Bodenrente und andererseits in dem Sinken des Zinsfusses.
[25] Eine besondere Eigenthümlichkeit der Arbeitsleistungen, welche auch auf die bezüglichen Wertherscheinungen einwirkt, besteht darin, dass ein Theil derselben für den Arbeiter mit unangenehmen Empfindungen verbunden ist und demnach nicht leicht anders als gegen ökonomische Vortheile, welche demselben aus seiner Thätigkeit entstehen, wirksam wird. Arbeiten dieser Art können desshalb- für die Gesellschaft nicht leicht den nicht ökonomischen Charakter erlangen. Indess wird der Werth, welchen die Unthätigkeit im Allgemeinen für den Arbeiter hat, der Regel nach denn doch stark überschätzt. Die Beschäftigungen der weitaus grössern Mehrzahl von Menschen gewähren ihnen Freude, sind für dieselben eine wahre Bedürfnissbefriedigung und würden, wenn auch in geringerem Masse, oder in modificirter Weise, auch dann ausgeübt werden, wenn die Menschen durch die Noth zur Entfaltung ihrer Kräfte nicht gezwungen würden. Die Bethätigung seiner Kraft ist für jeden wohlorganisirten Menschen Bedürfniss, und wenn nichtsdestoweniger nur wenige Personen ohne Aussicht auf wirthschaftliche Vortheile arbeiten, so liegt der Grund hievon nicht so sehr in der Unannehmlichkeit der Arbeit im Grossen und Ganzen, als vielmehr darin, dass Gelegenheit genug zur lohnenden Arbeit vorhanden ist.—Zu den Arbeitsleistungen ist entschieden auch die Unternehmerthätigkeit zu rechnen. Auch sie ist der Regel nach ein ökonomisches Gut und hat als solches Werth für die wirthschaftenden Menschen. Die Eigenthümlichkeiten dieser Kategorie von Arbeitsleistungen sind doppelter Art: a) Sind dieselben ihrer Natur nach keine Waaren (nicht zum Austausche bestimmt) und kommt demnach keine Preisbildung bei denselben zur Erscheinung. b) Haben dieselben die Verfügung über Capitalnutzungen zur nothwendigen Voraussetzung, indem dieselben sonst nicht wirksam werden können. Dieser letztere Umstand besehränkt die einem Volke verfügbare Unternehmerthätigkeit im Allgemeinen und insbesondere jene, welche nur unter der Voraussetzung wirksam werden kann, dass den bezüglichen wirthschaftenden Individuen Nutzungen grosser Capitalien verfügbar sind, auf verhältnissmässig sehr geringe Quantitäten.
[26] In Berlin kann keine Weissnähterin sich mit ihrer Hände Arbeit bei 15stündigem täglichem Nähen dasjenige verdienen, was sie zu ihrem Leben braucht; Nahrung, Wohnung und Holz vermag ihre Einnahme zu decken, aber die Kleidung kann sie sich auch bei dem angestrengtesten Fleisse nicht verdienen. (Vgl. Carnap in der deutschen Vierteljahrschrift 1868, II. Abth., S. 165.) Ein Aehnliches ist auch in den meisten der übrigen Grossstädte zu beobachten.
[27] Die Lebensweise der Arbeiter ist durch ihr Einkommen bedingt, nicht aber das Einkommen durch ihre Lebensweise, obzwar dies letztere in einer sonderbaren Verwschslung von Ursache und Wirkung allerdings oft behauptet wurde.
[28] Eine besondere Eigenthümlichkeit trifft bei der Preisbildung der Capitalnutzungen, wie wir in der Folge sehen werden, insofern zu Tage, als dieselben in den meisten Fällen nicht veräussert werden können, ohne dass die betreffenden Capitalien selbst in das Eigenthum der Ersteher der Capitalnutzungen übergeben werden, ein Umstand, welcher eine Gefahr fur den Capitalbesitzer in sich schliesst, für welche derselbe durch eine Prämie entschädigt werden muss.
Viertes Capitel. Die Lehre vom Tausche.↩
[1] Wealth o. N. B.I, Ch. 2, Basil 1801, S. 20.
[2] Nennen wir die beiden hier in Rede stehenden Personen A und B, die in der Verfügung des A befindliche Quantität des ersten Gutes 10 a, die in der Verfügung des B befindliche Quantität des zweiten Gutes 10 b. Nennen wir nun den Werth, den die Quantität 1 a für A hat = W, den Werth, den 1 b für ihn hätte, wofern er darüber verfügen könnte = W + x; den Werth, den 1 b für B hat = w und jenen, welchen 1 a für ihn hätte = w + y; so ist sicher, dass durch die Uebertragung von 1 a aus der Verfügung des A in jene des B, und umgekehrt von 1 b aus der Verfügung des B in jene des A, dieser letztere au Werth x, während B an Werth y gewinnt, oder mit anderen Worten, sich A nach dem Tausche in derselben Lage befindet, als ob ein Gut, dessen Werth für ihn gleich x ist, und B, als ob ein Gut, dessen Werth für ihn gleich y ist, neu zu seinem bisherigen Vermögen hinzugetreten wäre.
[3] Die obigen Ziffern haben, wie wir wohl nicht besonders hervorzuheben brauchen, nicht den Zweck die absolute, sondern lediglich den, die relative Grösse der Bedeutung der bezüglichen Bedürfnissbefriedigungen zum ziffermässigen Ausdruck zu bringen. Wenn wir demnach die Bedeutung zweier verschiedener Bedürfnissbefriedigungen z. B mit 40 und 20 bezeichnen, so drücken wir damit lediglich aus, dass die erstere für das betreffende wirthschaftende Subject die doppelte Bedeutung der letztern habe.
[4] Wenn von einigen Schriftstellern, (unter den neuern Deutschen noch von Lotz und Ran,) die Productivität des Handels geläuguet wird, so findet dies in dem Obigen seine vollständige Widerlegung Ein jeder ökonomische Gütertausch hat auf die wirthschaftliche Lage beider Tauschenden die nämliche Wirkung, als ob in den Besitz derselben ein neues Vermögensobject treten würde und ist demnach wirthschaftlich nicht minder productiv, als die industrielle, oder landwirthschaftliche Thätigkeit.
[5] Solche indifferente Tauschoperationen rechne ich entschieden zu den unökonomischen, denn es wird hier die vorsorgliche Thätigkeit der Menschen, abgesehen von allen ökonomischen Opfern, die ein solcher Tausch etwa erfordern Könnte, zwecklos in Bewegung gesetzt.
[6] Die Volkswirthschaft setzt sich aus den Wirthschaften der Individuen zusammen und das oben Gesagte gilt desshalb ebensowohl für den Verkehr ganzer Völker, als für jenen einzelner wirthschaftender Subjecte. Zwei Nationen, von welchen die eine hauptsächlich Ackerbau, die andere vorwiegend Industrie betreibt, werden ihre Bedürfnisse viel vollständiger zu befriedigen in der Lage sein, wenn dieselben einen Theil ihrer Producte, (die erstere einen Theil ihrer Bodenerzeugnisse, die letztere einen Theil ihrer Industrieproducte) austauschen. Sie werden indess den Tausch nicht in das Unbestimmte und Unbegränzte vornehmen, sondern mit Rücksicht auf jeden gegebenen Zeitpunkt zu einer Grenze gelangen, über welche hinaus jeder weitere Austausch von Bodenerzeugnissen gegen Industrieproducte für beide Völker unökonomisch sein würde.
[7] Wenn Carey (Principles of Social Science XXXVIII §. 4,) die Handelsleute desshalb, weil sie einen Theil des aus der Ausbeutung der vorhandenen Gelegenheiten zu ökonomischen Tauschoperationen sich ergebenden Nutzens für sich in Anspruch nehmen, als wirthschaftliche Parasiten darstellt, so beruht dies auf seinen irrigen Vorstellungen über die Productivitat des Tausches.
Fünftes Capitel. Die Lehre vom Preise.↩
[1] Schon Aristoteles (Eth. Nicom V. 7) verfällt in diesen Irrthum: „Wenn Jemand mehr erhält, als er ursprünglich hatte, so sagt man, er sei im Vortheil; wenn er weniger erhält, so ist er im Nachtheil; so beim Kaufen und Verkaufen. Wenn aber der ursprüngliche Besitz weder grösser, noch kleiner geworden, sondern im Verkehre gleichgeblieben, so heisst es, man habe das seinige, und sei weder im Vortheil noch im Nachtheil.“ Derselbe sagt (ibid. V. 8): „Wenn vorerst die verhältnissmässige Gleichheit bestimmt ist und demgemäss die Vergeltung oder Ausgleichung stattfindet, so ist dies das, was wir meinen…. Denn ein Austausch ist unmöglich ohne Gleichheit.“ Aehnlich Montonari. (Della moneta, ed. Custodi; p. a III., S. 119.) Quesnay (Dialogue sur les travaux etc S. 196, Daire) sagt: „Le commerce n'est qu'un échange de valeur pour valeur égale.“ Vgl. auch Turgot: Sur la formation et la distribut. des richesses, §. 35 ff.; Le Trosne: De l'interêt social, Chap. I, S. 903 (Daire); Smith: W. o. N I. Ch. V.; Ricardo: Principles, Chap. I. Sect. I.; J. B. Say: Cours d'econ. pol. II. Ch. 13., II. S. 204, 1828.—Gegen die obige Ansicht schon Condillac, (Le commerce et le gouvernement 1776 I. Chap. VI., S. 267, Daire.) obzwar mit einseitigen Gründen. Was Say a. a. O. gegen Condillac vorbringt, beruht auf einer Verwechslung des Gebrauchswerthes, den Condillac (vgl. a. a. O. S. 250 ff.) und des Tauschwerthes im Sinne eines Güteraequivalentes, welchen Say im Auge hat, eine Verwechslung, zu welcher allerdings der unsichere Gebrauch des Wortes „valeur“ Seitens Condillac's Veranlassung gegeben hat. Eine tiefgehende Kritik der englischen Preistheorien hat Bernhardi (Versuch einer Kritik der Gründe etc. 1849, S. 67–236) geboten. In jüngster Zeit haben Rösler („Theorie der Preise“ in Hildebrand's Jahrbüchern, B. 12, 1869. S. 81 ff.) und Komorzynski (Tübinger Zeitschrift, 1869, S. 189 ff.) die bisherigen Preistheorien einer eingehenden Kritik unterzogen. Vgl. auch Kuies: Tübinger-Ztschr 1855, S. 467.
[2] Wir sagen oben, dass B1 den B2 ökonomisch ausschliesst, um den Gegensatz zur Anwendung von physischer Gewalt, oder aber zur rechtlichen Ausschliessung des B2 vom Tauschgeschäfte zu bezeichnen. Dieser Unterschied ist aber insofern wichtig, als B2 sich leicht im Besitze einiger hundert Metzen Getreide befinden und ihm demnach physisch und rechtlich die Möglichkeit offen stehen kann, das Pferd des A einzutauschen, der einzige Grund aber warum er dies nicht thut, ökonomischer Natur ist, das ist darin liegt, dass er durch Hingabe einer grösseren Quantität Getreides, als 29 Metzen, für die Befriedigung seiner Bedürfnisse nicht besser versorgen würde, als dies ohne den Tausch der Fall wäre.
[3] Es könnte die Meinung entstehen, dass die Preisbildung in dem obigen Falle nicht so sehr zwischen 30 und 80, als vielmehr genau mit 30 Metzen erfolgen werde. Dies wäre nun auch vollkommen richtig, falls es sich um einen Gantverkauf ohne fixirten Minimalpreis handeln würde, oder der Ausrufspreis bei einem solchen unter 30 Metzen Getreide festgestellt wäre. In diesem Falle müsste sich nämlich A nach dem natürlichen Sinne des Gantgeschäftes allerdings mit dem Preise von 30 Metzen begnügen und sind in analogen Verhältnissen die Ursachen der eigenthümlichen Preisbildung bei Auctionen zu suchen. Wofern indess das wirthschaftende Subject A sich durch einen Gantvertrag nicht von vornherein bindet und seine Interessen völlig frei wahrnehmen kann, liegt kein Hinderniss vor, dass der Preis sich auch mit 79 fixire, wie andererseits allerdings auch die Eventualität ökonomisch nicht ausgeschlossen ist, dass zwischen A und B1 der Preis des Pferdes auf 30 Metzen fixirt werde.
[4] Es wäre sehr irrig, würde man annehmen, dass die Preise des Monopolgutes unter allen Umständen. oder selbst auch nur der Regel nach, genau in dem umgekehrten Verhältnisse zu den vom Monopolisten zur Veräusserung gebrachten Quantitäten des Monopolgutes steigen, oder fallen, oder aber dass zwischen den vom Monopolisten fixirten Preisen und den zur Veräusserung gelangenden Quantitäten des Monopolgutes eine solche Verhältnissmässigkeit besteht. Dadurch, dass vom Monopolisten z. B. statt 1000 Masseinheiten des Monopolgutes 2000 Masseinheiten desselben zur Veräusserung gebracht werden, wird der Preis einer Masseinheit des Monopolgutes nicht nothwendigerweise z. B. von 6 fl. auf 3 fl. sinken, sondern, je nach der ökonomischen Sachlage, in dem einen Falle beispielweise nur auf 5 fl., in dem andern aber sogar auf 2 fl. Der Gesammterlös, welchen der Monopolist aus einer grössern zur Veräusserung gebrachten Quantität des Monopolgutes erzielt, kann demnach unter Umständen genau derselbe sein, wie jener aus einer geringern Quantität, er kann aber je nach den vorliegenden Verhältnissen auch grösser, oder geringer sein. Könnte z. B. der Monopolist in dem obigen Falle für 1000 Masseinheiten des Monopolgutes, falls er sie zur Veräusserung bringen würde, 6000 fl erzielen, so wird er für 2000 Masseinheiten nicht nothwendigerweise gleichfalls 6000 fl. erhalten, sondern je nach Umständen auch 10.000 fl., oder nur 4000 fl. Die Ursache hievon liegt in letzter Reihe darin, dass die Aequivalentereihen für die einzelnen Individuen, rücksichtlich verschiedener Güter, eine sehr grosse Mannigfaltigkeit aufweisen. Für B kann z. B die erste Masseinheit eines in seinen Besitz tretenden Gutes das Aequivalent von 10, die zweite von 9, die dritte von 4 und die vierte nur noch von Einer Masseinheit des Gegengutes sein, während die obige Reihe mit Rücksicht auf ein anderes Gut sich z. B. in der nachfolgenden Weise darstellt: 8, 7, 6, 5…Denken wir uns unter dem erstern Gute Getreide, unter dem letztern irgend eine Luxuswaare, so wäre klar, dass die Vermehrung der zur Veränsserung gebrachten Quantitäten des erstern über einen gewissen Punct hinaus ein viel rapideres Sinken (die Verminderung der zur Veräusserung gebrachten Quantitäten aber auch ein viel rapideres Steigen) der Getreidepreise zur Folge haben würde, als jene der Luxuswaare.
[5] Vgl. J. Prince-Smith in der Vierteljahrschrift für Volksw., 1863. IV., S. 148 ff.
[6] Aus dem Obigen ist zugleich ersichtlich, von welch' hoher Wichtigkeit Märkte. Messen, Börsen und überhaupt alle Concentrationspuncte des Verkehres für die Wirthschaft des Menschen sind, indem bei complicirteren Verkehrsverhältnissen eine ökonomische Preisbildung ohne die obigen Einrichtungen geradezu unmöglich ist. Die Speculation, welche sich daselbst entwickelt, hat die Wirkung, die unökonomische Preisbildung—aus welchen Ursachen dieselbe auch immer erfolgen mag—zu verhindern, oder doch in ihrem schädlichen Einfluss auf die menschliche Wirthschaft abzuschwächen. (Vgl. J. Prince Smith in der Berliner „Vierteljahrschrift für Volksw,“ 1863, IV, S. 143 ff.; O. Michaelis, ibid. 1864. IV, S. 130 ff., 1865, V u. VI; K. Scholz, ibid. 1867, I. S. 25 ff., u. A. Emminghaus, ibid. S. 61 ff.)
[7] Keine Erscheinung ist gewöhnlicher, als dass ein Monopolist sich gegen das Auftreten eines Concurrenten in feindseligster Weise wehrt, keine aber auch häufiger, als dass er sich mit dem bereits etablirten Concurrenten verständigt. Sein Interesse geht dahin, den Concurrenten nicht aufkommen zu lassen. Hat sich dieser aber nichtsdestoweniger festgesetzt, so geht dann sein ökonomisches Interesse dahin, gemeinschaftlich mit ihm eine gemilderte Monopolpolitik weiter zu treiben, überall dort, wo ein Spielraum für Monopolistenpolitik auch nach dem Auftreten eines Concurrenten vorhanden ist. Die scharfe Concurrenz pflegt in solchen Fällen beiden wirthschaftenden Subjecten nachtheilig zu sein und daher die der Regel nach rasch erfolgende Verständigung der Anfangs so feindlich sich gegenüberstehenden Concurrenten.
[8] Wir haben in dem Vorangehenden auf die Ursachen hingewiesen, welche bewirken, dass der Monopolist der Regel nach nicht bestimmte Quantitäten seiner Waare schlechthin zur Veräusserung bringt, und die Preisbildung, gleich wie bei einer Auction, abwartet, sondern in den meisten Fällen von vornherein gewisse Preise für eine Waare fixirt und der Wirkung derselben auf den Absatz entgegensieht. Ein Aehnliches gilt nun auch dort, wo mehrere Concurrenten im Anbote einer Waare auftreten. Auch hier pflegt jeder derselben seine Waare zu einem bestimmten Preise auszubieten und denselben so zu calculiren, dass ihm voraussichtlich ein möglichst hoher Erlös zufalle. Was aber seine diesbezügliche Thätigkeit von jener des Monopolisten unterscheidet, ist, dass dieser Letztere, wie wir sahen, es oft in seinem Interesse gelegen finden kann, die Preise so hoch zu stellen, dass nur ein Theil der ihm verfügbaren Quantität in den Consum gelangt, während der Erstere durch die Concurrenz gezwungen ist, die Preise mit Rücksicht auf die gesammte in seinen und seiner Concurrenten Händen befindlichen Quantitäten festzustellen, und die Preise demnach—von Irrthum und Unkenntniss der wirthschaftenden Subjecte abgesehen.—sich unter der Einwirkung der gesammten, den Concurrenten im Anbote verfügbaren Quantitäten bilden. Dazu tritt nun noch der Umstand, dass die verfügbare Quantität der Waaren durch die Concurrenz, wie wir sahen, überhaupt beträchtlich gestergert wird, und es liegt hierin die Ursache der Ermässigung der Preise, welche die Concurrenz im Gefolge hat.
Sechstes Capitel. Gebrauchswerth und Tauschwerth.↩
[1] Vgl. Schmoller, Tübing. Ztsch. 1863. S 53.
[2] Bernhardi sagt (Versuch einer Kritik der Gründe etc., 1849, S 79): Es sei in nenerer Zeit mehrfach hervorgehoben worden, dass schon Aristoteles (Pol. I, 6) den Unterschied zwischen dem Gebrauchswerthe und dem Tauschwerthe gekaunt hätte; A. Smith habe dieselben indess unabhängig vom griechischen Weisen scharf gesondert. Dagegen ist nun zu bemerken, dass der grössere Theil der berühmt gewordenen Stelle A. Smith's (Wealth. of Nat. I, Ch. IV; Vol. I. p. 42, Basil, 1801) mit einer Stelle Law's (Considération sur le nummeraire, Chap I, p. 443 ff., ed. Daire) fast wörtlich übereinstimmt und Turgot (Valeurs et monnaies, S. 79 ff., Daire) den Gebrauchswerth und Tauschwerth (valeur estimative und valeur commercable) nicht nur scharf gesondert, sondern auch bereits eingehend behandelt hat. Von dogmengeschichtlichem Interesse ist auch eine Stelle ans den Werken des schottischen Moralphilosophen Hutcheson, des berühmten Lehrers A Smith's (System of moral philosophy 1755, II, p. 53 ff.), in welcher sich die Unterscheidung zwischen Gebrauchswerth und Tauschwerth, wenn auch noch nicht die von A. Smith gebrauchte Terminologie bereits vorfindet. (Vgl. auch Locke: Considérations of the lowering of interest ect. Works, II, p 20 ff. und Le Trosne: De l'interêt social (1777) Chap. I, §. 3.)—Von Neneren haben ausser den bereits oben (S. 78) Genanuten: Friedländer Knies, Schäffle, Rösler, welche die Theorie des Werthes gleichwie Michaelis (Vierteljahrschrift für Volksw., 1863, I, S. 1) und Lindwurm (Hildebrand's Jahrbücher, IV, 1865, S. 165 ff.) zum Gegenstande von Specialforschungen machten, den Unterschied zwischen Gebrauchswerth und Tauschwerth eingehend behandelt: Soden: Nationalökonomie, 1805, I, §. 42 ff. u. IV, §. 52 ff.; Hufeland: N. Grundlegung, 1807, I, §. 30 ff., Storch: Cours d'écon. pol. I, S. 37 ff.; Lotz: Handbuch, 1837, I, § 9: Rau: Volkswirthschaftsleure, I, §. 57 ff.; Bernhardi: Untersuchung d. Gründe etc., 1849, S. 69 ff.; Roscher: System, I, §. 4 ff.; Thomas: Theorie d. Verkehrs, I, S. 11; Stein: System, I, S. 168 ff.—Nichts zeigt übrigens das Streben nach philosophischer Vertiefung der Volkswirthschaftslehre bei den Deutschen und den auf das practische gerichteten Sinn der Engländer besser, als etwa eine Vergleichung der Bearbeitungen, welche die Lehre vom Werthe bei den Deutschen und den Engländern gefunden hat. Ricardo: Principles (1817), Chap. 28; Malthus: Principles, 1820, S 51 u. Definitions, 1827, Chap. II, S. 7 der edit. 1853; J St. Mill: Principles, B. III, Ch. I, §. 2, 6. ed. gebrauchen, gleichwie A. Smith „value in use“ gleichbedeutend mit „utility.“ Torrens: On the production of wealth, S. 8, und Mac Culloch halten sogar den Ausdruck „utility“ anstatt „value in use“ fest (Principles, 1864, S. 4) gleichwie unter den neuern Franzosen Bastiat (Harmonies écon. 1864, S. 256). Lauderdale (An Inquiry etc., 1804, S. 12) und Senior (Politic. Economy, 1863, S. 6 ff.) kennzeichnen die Nützlichkeit wohl als eine Bedingung des Tauschwerthes, aber nicht als Gebrauchswerth, welchen letztern Begriff sie überhaupt zurückweisen. Was man in England aber unter Tauschwerth versteht, geht wohl am besten aus der nachfolgenden Stelle J. St. Mill's (Book III, Chap. I, §. 2) hervor: „The words „Value“ and „Price“ were used as synonymous by the early political economists and are not always discriminated even by Ricardo. But the most accurate modern writers, to avoid the wasteful expenditure of two good scientific terms on a single idea, have employed Price to express the value of a thing in relation to money: the quantity of money for which it will exchange; by the Value,, or exchange value of a thing (we shall understand) its general power of purchasing; the command which its possession gives over purchaseable commodities in general.“
Siebentes Capitel. Die Lehre von der Waare.↩
[1] Roscher: Ansichten der Volksw. S. 117, 1861; B. Hildebrand in seinen Jahrbüchern II, 1864, S. 17; Scheel, ibid. VI, S. 15, 1866; Schmoller. Zur Gesch, des deutschen Kleingewerbes, 1870, S. 165, 180, 511 ff.
[2] Da der Umstand, dass ein Vermögensbestandtheil von dem Besitzer für den Austausch bereit gehalten wird, für dritte Personen nicht in allen Fällen erkennbar ist, so ist es begreiflich, dass der Begriff der Waare im gemeinen Leben noch weiter verengert wurde und im Volksmunde ganz allgemein nur jene Güter „Waaren“ genannt werden, bei welchen die Absicht des Besitzers, sie zu veräussern, auch für dritte Personen ersichtlich ist. Diese Absicht Kann auf sehr verschiedene Weise ausgedrückt werden. Am gewöhnlichsten erfolgt dies jedoch durch Ausstellung derselben an Orten, wo Käufer derselben sich zu versammeln pflagen, wie z. B. auf Märkten, Messen, Börsen, oder aber in eigenen Localen, welche durch die äussere Bezeichnung und andere in die Augen fallende Merkmale, den Zweck, zur Aufnahme von Waaren zu dienen, documentiren, oder doch bekanntermassen zur Aufnahme solcher Güter bestimmt sind, z. B. Verkaufsläden, Magazine, Lagerhäuser etc. Der Begriff der Waare verengert sich demnach in dem Volksmunde naturgemäss zu einer Bezeichnung jener ökonomischen Güter, welche sich unter solchen äusseren Verhältnissen befinden, dass ein Rückschluss auf die Absicht ihrer Besitzer, dieselben zu veräussern, dem Beurtheiler möglich ist.—Je weiter die Cultur eines Volkes fortschreitet, und je einseitiger die Production der einzelnen wirthschaftenden Individuen wird, um so umfangreicher werden die Grundlagen zu ökonomischen Täuschen, um so grösser die absolute und relative Menge derjenigen Güter, welche jeweilig den Waaren-charakter haben, und es ist der ökonomische Nutzen, welcher sich aus der Ausbeutung der obigen Verhältnisse ziehen lässt, schliesslich gross genug, um eine besondere Classe von wirthschaftenden Individuen hervorzurufen, welche den intellectuellen und mechanischen Theil der Tauschoperationen für die Gesellschaft besorgt, und sich dafür mit einem Theile des Tauschnutzens belohnen lässt. Die ökonomischen Güter nehmen dann ihren Weg zumeist nicht unmittelbar von den Producenten zu den Consumenten, sondern gehen einen oft sehr complicirten Weg durch die Hände von mehr, oder minder zahlreichen Mittelspersonen, die durch ihren Beruf schon bestimmte ökonomische Güter als Waaren zu behandeln gewöhnt sind, und eigene Localitäten zum Zwecke des Austausches dieser Güter für das Publicum offen halten. Auf die betreffenden, in den Händen dieser Personen und solcher Producenten befindlichen Güter, welche dieselben zum offenkundigen Zwecke der Veräusserung hervorbringen, hat nun der Volksmund insbesondere den Begriff der Waare beschränkt und zwar unzweifelhaft aus dem Grunde, weil die Absicht der Besitzer, jene Güter zu veräussern, in diesen Fällen für Jedermann insbesondere leicht ersichtlich ist, (Kaufmannsgüter, marchandises, merchandises, mercanzie etc.)
[3] Auch das deutsche Handelsgesetzbuch gebraucht das Wort „Waare“ im populären, und nicht im technischen Sinne. Anstatt des Ausdruckes „Waare“ findet sich bisweilen „Gut“ (Art. 365, 366, 367), „Gegenstand“ (Art. 349, 359) oder „bewegliche Sache“ (Art 272, 301, 342); Art. 271 heisst es: „Waaren, oder andere bewegliche Sachen, oder für den Handelsverkehr bestimmte Werthpapiere.“ Immobilien und Arbeitsleistungen werden im deutschen Handelsgesetzbuche niemals zu den Waaren gerechnet, desgleichen Firmen als solche, welche, nebenbei gesagt, abgesondert von dem Geschäft, für welches sie geführt werden, im rechtlichen Sinne gar nicht Waaren sein können (Art. 23), gleichwie alle übrigen „res extra commercium.“ Schiffe werden im deutschen Handelsrecht den Waaren entgegengestellt (Art. 67), doch gelten dieselben in manchen andern Codificationen für „bewegliche Sachen“ und können den Waarencharakter erlangen (s. Goldschmidt Handelsrecht, I, 2. Abth., §. 60, pag. 527, Anm. 7, 1868). Die juristische Literatur über den Begriff Waare: ibid. pag. 525; doch bestimmt Goldschmidt selbst (I, 1, Abth. 298) den Begriff „Waare“ auch vom juristischen Standpunkte aus zu eng, wenn er die vom Producenten für den Austausch bereit gehaltenen Güter nicht zu den Waaren rechnet. In den römischen Rechtsquellen werden „merx, res promercalis, mercatura“ etc. bald in dem engern Sinne des Handelsobjectes, bald in dem weiteren der feilgebotenen Sache gebraucht. (l. 73, §. 4, D. de legat. (32, 3); l. 32, §. 4, D. de aur. arg. 34, 2; I. 1, pr. §. 1, D. de cont. emt. (18, 1); l. 42, D. de fidejus. (46, 1). Das osterreichische bürgerliche Gesetzbuch stellt (§. 991) die Waaren den Schuldforderungen gegenüber.
[4] Die Lehre von der Waare hat bei den Engländern, Franzosen und Italienern mit einzelnen Ausnahmen überhaupt keine sclbständige Bearbeitung gefunden. Die Ausdrücke: goods, marchandises, merci etc. werden fast durchwegs in dem populären Sinne von „Handelsgütern.“ „Kaufobjecten,“ und auch da nicht in technischem Sinne, sondern in höchst schwankender Weise gebraucht. Häufig werden die Waaren den Arbeitsleistungen und dem Gelde (Necker: Legislation et commerce des grains, I, Chap. 12; Genovesi: Lezioni, II, 2, §. 4), regelmässig den unbeweglichen Gütern (Guillaumin et Cocquelin: Dictionnaire, II, 131. Art. „marchandise“ v. Hor, Say), bisweilen als Manufacturproducte den Rohstoffen (Quesnay: Maximes generales XVII.), oder den Unterhaltsmitteln: denrées (Dutot: Sur le commerce etc., Chap. I, 10) entgegengesetzt, während Montesquieu (Esprit des lois, XXII, 7) „marchandises“ eben im Sinne von: „denrées“ gebraucht. Roberts, ein Zeitgenosse Mun's, definirt (Merchant's map, 4th ed, S. 6 ff.): the things wherewith the merchants negotiate and traffick are termend „merchandises“ und theilt die letztern in „wares“ und „moneys.“ Der Dictionnaire de l'Academie française nennt Waaren: „ce qui se vend, se débite dans les boutiques, magasins, foires, marchés.“—Wo gelegentlich Waaren in dem weitern wissenschaftlichen Sinne bezeichnet werden sollen, geschieht dies durch Umschreibungen, z. B.: Quantité à vendre (Necker); superflu autant qu'il pent être échangé (Forbonnais); things who have not reached the hands of those, who are finally to use them (A. Smith); cio che sopprabonda in alcuni per sussistero essi stessi, e ch'essi passano ad altri (Ortes); doch nennt schon Condillac (Le commerce et le gouvernement, Part. I, 5) „marchandises“: „Ces choses, qu'on offre à échanger,“ und wird damit der Vorläufer des (französisch schreibenden) Storch, welcher (Cours I, S. 82, 1815): „Les choses destinées à l'échange se nomment marchandises“ definirt.—Unter den Deutschen gebrauchen Justi, Büsch, Sonnenfels, Jacob das Wort „Waare“ noch im populären Sinne. Soden nennt „allen Productstoff“: „Waare“ (Nationalökonomie, I, S. 285, 1815), wobei er unter „Productstoff“ alle Roh- und Industrieproducte versteht (ibid. S. 54), während Hufeland, (N. Grundleg., II, § 96) gleichfalls zu weit: „Waare ist Alles, was weggegeben, besonders für etwas Anderes weggegeben werden kann,“ definirt. Rau folgt (Volkswirthschaftslehre, I, §. 407) der Definition Storch's; auch ihm sind „alle Vorräthe von Gütern, welche zum Tausche bestimmt sind“: „Waaren“; auch Grundstücke können Waaren werden; das Geld ist seinem Stoffe nach, nicht aber als solches, Waare (ibid. I, §. 258); dass übrigens Rau nur Sachgüter als Waaren anerkennt, geht schon aus seiner allgemeinen Auffassung des Begriffes „Gut“ hervor. Fast parallel mit den Ansichten Rau's gehen jene Murhardt's (Theorie des Handels, I, S. 22, 1831.) Zachariae (40 Bücher v. St., V. Band, l. Abth., S. 2, 1832) dehnt den Begriff der Waare gleichfalls auf Grundstücke aus, wogegen Baumstark (Cameral-Enkyclopädie, S. 449, 1835) ihn wieder auf bewegliche Sachgüter beschränkt, und ausserdem eine gewisse Handelswürdigkeit der Güter, welche Waaren werden sollen, verlangt. Hiemit kommt er der populären Auffassung nahe, welche in den Schriften von Fulda, Lotz, Schön und Herrmann wieder die herrschende wird. Riedel, (Nationalökon. I, S. 336, 1838) und Roscher, (Syst. I, 95) stellen den wissenschaftlichen Begriff der Waare wieder her. Der Erstere nennt sie „die zum Tausch oder Verkauf bereit liegenden Güter,“ der Letztere: „Jedes zum Austausche bestimmte Gut,“ wobei ökonomische Güter gemeint werden (ibid. I, §. 3). Diesen folgen Mangoldt (Grundriss, S. 27); Knies (Tübinger Zeitschrift 1856, S. 266: „Für den Verkehr überschüssige Güter“); Rentsch (Handwörterbuch d. V. Art. „Waare“: „Tauschwerthe und zum Tausch bestimmte Güter,“ und der Hauptsache nach auch Hasner (System, I, S. 288 u. 302: abstracter Tauschwerth mit den beiden Hauptformen: Waarenvorrath und Baarfond). Die Eigenschaft des Productes halten von den Neuern beim Begriff der Waare fest: Glaser (Allgem. Wirthschaftsl., S. 115, 1858), welcher „jedes Product welches in den Handel kommt,“ Rösler (Volkswirthsch. S. 217, 1864), welcher „die für den Umlauf bestimmten, oder im Umlaufe befindlichen Producte,“ Scheel (Hildebrandt's Jahrbücher, VI, S. 15), welcher „die einzelnen zum Austausch bestimmten Producte“ Waaren nennt. Auch Stein bezeichnet (Lehrbuch d. Volksw., S. 152, 1858) die Waare als „einzelnes, selbständiges Product der Unternehmung“. In neuerer Zeit ist wieder eine Anzahl zum Theil sehr namhafter Gelehrten zum Gebrauche des Wortes „Waare“ im populären Sinne zurückgekehrt. So unter Andern B. Hildebrandt, welcher in seinen Jahrbüchern (II, S. 14), Schäffle, welcher in seinem „Gesellschaftlichen System d. m. W. S. 456 u. 465, die Waaren den Dienstleistungen gegenüberstellt. Der wissenschaftliche Begriff der Waare geht indess hiebei nicht verloren. Schäffle trennt im Gebrauche sogar sehr scharf die Waaren im populären und im wissenschaftlichen Sinne und nennt diese letztern „Tauschgüter“ (ibid., S. 50, 51 u. s. f.) Höchst eigenthümlich, wie in manchen andern Lehren, ist Schmalz, welcher (Staatsw. in Briefen, 1818, I, S. 63) in Folge einer irrigen Auffassung des Verhältnisses zwischen Geld und Waare den Begriff dieser letztern mit dem der Gebrauchsgüter in engerm Sinne des Wortes verwechselt, also gerade zu dem Gegentheil der obigen wissenschaftlichen Definition der Waare gelangt.
[5] Aus dem Obigen ist ein Doppeltes ersichtlich: einerseits, dass mit dem allgemeinen Hinweise darauf, dass das Geld eine „Waare“ sei, nichts für die Erklärung der eigenthümlichen Stellung des Geldes im Kreise der Waaren gewonnen ist; andererseits, dass die Ansicht derjenigen, welche den Waarencharakter des Geldes bestreiten, „weil dasselbe als solches, zumal als Münze keinem Gebrauchszwecke diene,“ (abgesehen von der Verkennung der wichtigen Function des Geldes, welche in dieser letztern Annahme liegt), schon um dessentwillen unhaltbar ist, weil der nämliche Einwurf auch gegen die Waarenqualität aller andern Güter erhoben werden kann. Keine „Waare“ als solche dient nämlich einem Gebrauchszwecke, am wenigsten in ihrer Verkehrsform (in Barren, Ballen, Gebinden, im verpackten Zustande etc.). Jedes Gut muss, um in Gebrauch gezogen zu werden, aufhören, „Waare“ zu sein, und seiner allfälligen Verkehrsform entledigt (eingeschmolzen, zerlegt, ausgepackt) werden. Die Münze und der Barren sind nun aber die gebräuchlichsten Verkehrsformen der edlen Metalle und der Umstand, dass dieselben bevor sie in Gebrauch gezogen werden, dieser ihrer Verkehrsform entledigt werden müssen, ist demnach nichts, was zu einem Zweifel an ihrem Waarencharakter berechtigt.
[6] Hier sind insbesondere die Beschränkungen zu erwähnen, welche durch Luxus- und Sicherheitspolizei-Gesetze für die Absatzfähigkeit der Waaren entstehen. Im Mittelalter war beispielsweise in vielen Ländern die Absatzfähigkeit von Sammet auf die dem Ritterstande und dem Clerus angehörigen Personen, und die Absatzfähigkeit von Waffen ist in manchen Ländern noch heutzutage auf solche Personen beschränkt, welche die behördliche Bewilligung zum Besitze derselben haben.
[7] Waaren, welche wenig gekannt sind („unbekannte Artikel“), haben schon aus diesem Grunde einen sehr engen Kreis von Abnehmern. Die Producenten pflegen daher ihre Waaren nicht selten mit grossen ökonomischen Opfern „bekannt“ zu machen, um den Kreis von Personen, auf welche sich die Absatzfähigkeit derselben erstreckt, zu erweitern. Hierin liegt auch die volkswirthschaftliche Bedeutung der öffentlichen Ankündigungen, Inserate, Reclamen etc.
[8] Durch die Entwickelung der Bedürfnisse und den steigenden Wohlstand eines Volkes wird die Absatzfähigkeit der Waaren im Allgemeinen bedeutend erhöht, rücksichtlich einiger Waaren allerdings auch vermindert. Manche Waare, welche in einem armen Lande leicht abgesetzt werden kann, ist in demselben, sobald es zur wirthschaftlichen Blüthe gelangt ist, geradezu unanbringlich (Vgl. S. 223 ff).
Achtes Capitel. Die Lehre vom Gelde.↩
[1] Mommsen: Geschichte des röm. Münzwesens, Einleitung und S. 169 ff.; v. Carnap: Zur Geschichte der Münzwissenschaft und der Werthzeichen, Tübing. Ztschrift. 1860. S. 348 ff.; Kenner: Die Anfänge des Geldwesens im Alterthum, Wiener Akad, Schriften, philos. hist. Section. 1863, S. 382 ff.; Roscher: System I, §. 16; B. Hildebrandt in seinen Jahrbüchern, II, S. 5, 1864; Scheel: Der Begriff des Geldes in seiner histor. Entwickelung, ibid. VI, S. 12 ff.; Bernardakis: De l'origine des monnaies et de leurs 77. noms. Journ. des Econom. 1870, XVIII, S. 209.
[2] Im Althochdeutschen vertritt der Regel nach das Wort „scaz“ die Stelle unseres „Geld,“ im Gothischen „skatts,“ doch übersetzt Ulfilas das Wort  (Marcus 14 11, wo es Geld im Allgemeinen bedeutet) mit „faihn“ (Vieh, Geld). Das althochdeutsche „gelt“ kommt für „Vergeltung, Abgabe, Lösung,“ in einem Bibelglossar des 10. Jahrhundertes = dem lat. aes vor. Im Altnordischen ist dagegen „giald“ bereits im Sinne unseres heutigen „Geld“ gebräuchlich. Im Mittelhochdeutschen heisst „gelt“ sehr gewöhnlich „Zahlung“ (Act und Object der Zahlung) „Vermögen,“ „Einkünfte,“ wird jedoch auch bereits vielfach in der heutigen Bedeutung von „Geld“ gebraucht. Z. D in Martina von Huge von Langenstein (Basl. Handschrift, 215) „zegelde keren“ (in Geld anschlagen), bei Peter Suchewirts, edit. Premisser, 31. 104 u. s. f. (vide Graff: Althochdeutscher Sprachschatz, IV, 191; Müller-Benecke: Mittelhochd. Wörterb, I, 522; Diefenbach: Vergleichendes Wörterbuch d. goth. Sprache, II. 403, 1851.) Nicht ohne Interesse ist die Art und Weise, wie andere Völker das Geld bezeichnen. Die Griechen, Hebräer und in einer Ausdrucksweise auch die Römer nannten das Geld: „Silber“ (
(Marcus 14 11, wo es Geld im Allgemeinen bedeutet) mit „faihn“ (Vieh, Geld). Das althochdeutsche „gelt“ kommt für „Vergeltung, Abgabe, Lösung,“ in einem Bibelglossar des 10. Jahrhundertes = dem lat. aes vor. Im Altnordischen ist dagegen „giald“ bereits im Sinne unseres heutigen „Geld“ gebräuchlich. Im Mittelhochdeutschen heisst „gelt“ sehr gewöhnlich „Zahlung“ (Act und Object der Zahlung) „Vermögen,“ „Einkünfte,“ wird jedoch auch bereits vielfach in der heutigen Bedeutung von „Geld“ gebraucht. Z. D in Martina von Huge von Langenstein (Basl. Handschrift, 215) „zegelde keren“ (in Geld anschlagen), bei Peter Suchewirts, edit. Premisser, 31. 104 u. s. f. (vide Graff: Althochdeutscher Sprachschatz, IV, 191; Müller-Benecke: Mittelhochd. Wörterb, I, 522; Diefenbach: Vergleichendes Wörterbuch d. goth. Sprache, II. 403, 1851.) Nicht ohne Interesse ist die Art und Weise, wie andere Völker das Geld bezeichnen. Die Griechen, Hebräer und in einer Ausdrucksweise auch die Römer nannten das Geld: „Silber“ ( , keseph, argentum), sowie heut noch die Franzosen (argent); die Engländer, Spanier, Portugiesen, sowie auch in einer andern Ausdrucksweise die Hebräer, Griechen und Franzosen: „Münze“ (money, monéda, moeda, maoth,
, keseph, argentum), sowie heut noch die Franzosen (argent); die Engländer, Spanier, Portugiesen, sowie auch in einer andern Ausdrucksweise die Hebräer, Griechen und Franzosen: „Münze“ (money, monéda, moeda, maoth,  monnaie). Die Italiener und Russen sprechen von Geldstücken (Denaren), wenn sie Geld im Allgemeinen bezeichnen wollen (danaro, dengi), dessgleichen in einer andern Ausdrucksweise die Spanier und Portugiesen. Die Polen, Böhmen und Slovenen nennen das Geld Pfennige (= Geldstücke): pienadze, penize, penize), desgleichen die Croaten, Dalmatiner und Bosnier. Auch die Dänen, Schweden und Magyaren sprechen von Geldstücken (Pfennigen) wenn sie „Geld“ bezeichnen wollen (penge, penningar, penz). Der Araber thut dasselbe, denn sein Ausdruck für Geld „fulus“ bedeutet „Münzen.“ In der Sprache der Bari, die am obern Nil wohnen, heisst naglia, die Glasperle, zugleich „Geld“ (Fr. Müller in den Wien. Acad. -Schriften, phil. hist. Sect. B. 45, S. 117) und die Nubier nennen das Metallgeld: schongir = „Muschel des Schriftzeichens“ (mit einem Schriftzeichen (Prägung!) versehenes Kauri).
monnaie). Die Italiener und Russen sprechen von Geldstücken (Denaren), wenn sie Geld im Allgemeinen bezeichnen wollen (danaro, dengi), dessgleichen in einer andern Ausdrucksweise die Spanier und Portugiesen. Die Polen, Böhmen und Slovenen nennen das Geld Pfennige (= Geldstücke): pienadze, penize, penize), desgleichen die Croaten, Dalmatiner und Bosnier. Auch die Dänen, Schweden und Magyaren sprechen von Geldstücken (Pfennigen) wenn sie „Geld“ bezeichnen wollen (penge, penningar, penz). Der Araber thut dasselbe, denn sein Ausdruck für Geld „fulus“ bedeutet „Münzen.“ In der Sprache der Bari, die am obern Nil wohnen, heisst naglia, die Glasperle, zugleich „Geld“ (Fr. Müller in den Wien. Acad. -Schriften, phil. hist. Sect. B. 45, S. 117) und die Nubier nennen das Metallgeld: schongir = „Muschel des Schriftzeichens“ (mit einem Schriftzeichen (Prägung!) versehenes Kauri).
[3] Die Gewohnheit als Moment der Entstehung des Geldes wird betont von Condillac (Le commerce et le gouvernement, 1776, Part. I, Ch. 14); Le Trosue (De l'intérêt social, 1777, Ch. III, 1).
[4] Die Erklärung des eigenthümlichen Vorganges, dass eine Auzahl von Gütern, bei fortgeschrittener Cultur: Gold und Silber in gemüuztem Zustande, von Jedermann im Austausche gegen alle andern Waaren bereitwillig angenommen werden, und zwar auch von solchen Personen, welche keinen unmittelbaren Bedarf an diesen Gütern, oder denselben doch bereits in ausreichender Weise gedeckt haben, hat bereits die grossen Denker des Alterthums und bis auf unsere Tage eine lange Reihe der ausgezeichnetsten Forscher beschäftigt, wie kein anderes Problem unserer Wissenschaft. Dass ein Gut von seinem. Besitzer gegen ein anderes ihm nützlicheres im Austausche hingegeben wird, ist eine Erscheinung, die auch dem gemeinsten Verstande einleuchtet; dass aber jedes wirthschaftende Subject eines Volkes begierig sein sollte, seine Waaren gegen kleine Metall-Platten einzutauschen, von welchen der Regel nach doch nur Wenige in directer Weise Gebrauch zu machen in der Lage sind, dies ist ein dem gewöhnlichen Laufe der Dinge so widersprechender Vorgang, dass es uns nicht Wunder nehmen darf, wern er selbst einem so ausgezeichneten Denker, wie Savigny (Obligat. II, 406), geradezu als „geheimnissvoll“ erscheint. Die Aufgabe, welche die Wissenschaft hier zu lösen hat, besteht in der Erklärung eines allgemeinen Handelns der Menschen, dessen Motive nicht klar zu Tage liegen, und der Gedanke, dasselbe auf eine Ueberinkunft der Menschen, beziehungsweise auf den Ausdruck ihres Gesammtwillens, das Gesetz, zurückzuführen, lag demnach, insbesondere mit Rücksicht auf die Münzform des Geldes, am nächsten. Platon und Aristoteles folgen dieser Meinung. Der Erstere nennt (de. rep. II, 12) das Geld „ein verabredetes Zeichen für den Tausch“ und Aristoteles sagt an einer vielfach angeführten Stelle (Eth. Nic. V, 8), das Geld sei durch Uebereinkunft entstanden; nicht durch die Natur, sondern durch das Gesetz. Deutlicher gibt er noch an einer andern Stelle (Pol. I, 6) dieser Meinung Ausdruck. „Die Menschen,“ sagt er, „sind übereingekommen, etwas als Aequivalent für jede Waare zu geben und zu nehmen,“ und daher die Erscheinung des Geldes.—Der römische Jurist Paulus, dessen Ansichten über den Ursprung des Geldes uns in Justinian's Gesetzsammlung (L. 1, D. de contr. emt. 18, 1) erhalten blieben, entledigt sich der Aufgabe in ähnlicher Weise, wie die griechischen Philosophen Er weist auf die Schwierigkeiten hin, welche dem blossen Tauschhandel entgegenstehen, und gibt seine Meinung dahin ab, dass dieselben durch eine öffentliche Einrichtung—das Geld—behoben worden seien. „Es wurde ein Stoff ausgewählt,“ schreibt Paulus, „dessen öffentliche, den Schwankungen der übrigen Waaren entrückte Bewerthung ihm einen stets gleichmässigen äussern (Nominal-) Werth gab; dieser Stoff sei Seitens der Gesellschaft mit einem Zeichen (seines äussern Werthes) versehen worden und gründe seinen Gebrauch und seine Tauschkraft nicht so sehr auf die Substanz, als vielmehr auf seinen Neunwerth.“ Auch Paulus führt demnach den Ursprung des Geldes auf die gesellschaftliche Autorität zurück.—Daneben macht sich allerdings auch schon im Alterthume das Bestreben geltend, die eigenthümliche Stellung, welche die edlen Metalle im Kreise der übrigen Waaren einnehmen, auf ihre besondern Eigenschaften zurückführen. Aristoteles weist (Polit. I, 6) auf ihre leichte Handhabung und Transportabilität, und au einer andern Stelle (Eth. Nic. V, 6) auf ihre relativ grosse Stabilität im Preise hin, und Xenophon (de vectigal. Athen. 4) beobachtet sogar schon die weiten quantitativen Grenzen ihrer Absatzfähigkeit, zumal jene des Silbers. Würden, so argumentirt er, die Producte der Kupferschmiede, Schmiede, ja selbst Wein und Getreide in aussergewöhnlich grossen Quantitäten zu Markte gelangen, so müssten sie stark im Preise sinken, während Silber und in beschränkterer Weise auch Gold stets lohnenden Absatz fänden. Die Danerhaftigkeit und Unzerstörbarkeit der edlen Metalle, zumal des Goldes, hat schon Plinius (hist. nat. 33, c. 19, 31) hervorgehoben.
Die ausserordentlich reiche Literatur, welche das Mittelalter und das sechzehnte Jahrhundert uber das Münz- und Masswesen zu Tage gefördert hat, findet man in der: „Bibliotheca nummaria“ des Philipp Labbe (ed. Reichenberg, 1692) sorgfältig gesammelt. Die „Collectio Budeliana“ (1591), Marquardus Freher: De re monetaria (1605) (hier die Tractate von Oresmius und Gabr. Byel) enthalten viele bemerkenswerthe Publicationen dieses Zeitraumes. Roscher hat in seinem System I, §. 116, 5 einige der wichtigsten mit grossem Forscherfleisse hervorgehoben. Dieselben beschäftigen sich zumeist mit practischen Fragen des Münzwesens, zumal mit der durch vielfache Missbräuche der Staatsverwaltungen wichtig gewordenen Frage nach dem Bestande und den Grenzen des Rechtes der Fürsten, Münzveränderungen vorzunehmen, und den vermögensrechtlichen Folgen dieser letzteren. Hiebei nehmen einige derselben Anlass, auch die Frage vom Ursprunge des Geldes zu behandeln und entledigen sich dieser Aufgabe auf Grundlage der Forschungen des Alterthums, mit stetem Hiuweise auf Aristoteles. So Nic. Oresmius († 1383): Tractat. de orig. et jure etc., ed. Freher, S. 2 append.; Gabr. Byel († 1495): Tract, de Monetis, ed. Freher, S. 33; Carol. Molinaeus: Tract, de mutatione monetarum (1555), edit. Budeliana, S. 485; Didacus Couarouvia: Veter. numm. collat. (um 1560) edit. Bud. S. 648; Malestroit: Paradoxa (1566), ibid. S. 747; J. Menochius: Consilia, ibid. S. 705; R. Budelius: De monetis et re nummaria (1591), S. 10. Der Gang der Untersuchung bei diesen Schriftstellern lässt sich fast durchwegs dahin zusammenfassen, dass sie zunächst die Schwierigkeiten darlegen, welche aus dem blossen Tauschhandel für den Verkehr entstehen, hierauf auf die Möglichkeit hinweisen, diese Schwierigkeiten durch Einführung des Geldes zu beheben, im weitern Verlaufe der Darstellung die besondere Eignung der edlen Metalle zu diesem Zwecke betonen, und endlich mit Berufung auf Aristoteles zum Schlusse gelangen, dieselben seien durch Menschensatzung thatsächlich zum Gelde geworden („pecunia instrumentum artificialiter adinventum,“ sagt Oresmius, S. 2. a. a. O.; „vel ex sui natura, vel ex hominum instituto etc.“ sagt G. Byel, S. 33, a. a. O.; „inventio et institutio monetae est de jure gentium: Molinaeus, S. 486, a. a. O.) So grosse Verdienste sich einzelne dieser Schriftsteller dadurch erworben haben, dass sie gegen die Seitens der Fürsten geübten Missbräuche in der Münzverwaltung auftraten—was die Frage des Ursprunges des Geldes betrifft, sind sie über die Einsichten der Alten nicht gekommen. Die ältern Italiener und Engländer machen hievon keine Ausnahmen. Davanzati: Lezioni sulle monete (1588) folgt noch strenge dem Urtheile des Aristoteles und Paulus, und führt den Ursprung des Geldes (S. 24, ed. Cust.) auf die staatliche Autorität zurück („per legge accordata“); ebenso Montanari, († 1687) (Della Moneta, Cap. I. S. 17, 32 und Cap. VII, S. 118 ed. Cust.). Auch Roberts, dessen weitverbreitete Handelseneyclopädie: „Merchants map of commerce, 1638“ besser als ein anderes Werk des siehzehnten Jahrhundertes die volkswirthschaftlichen Ansichten Englands in jenem Zeitalter wiederspiegelt, führt (S. 15 der edit 1700) den Ursprung des Geldes an die gleiche Quelle zurück.
Unter den Finanzschriftstellern der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhundertes ragt Law durch seine Forschungen über den Ursprung des Geldes hervor. Noch Boizard führt denselben auf die öffentliche Autorität zurück, und Vauban (Dîme royale, 1707, S. 51, ed. Daire), sowie Boisguillebert († 1714): (Dissertation sur la nature des richesses, Chap. II), beschränken sich darauf, die Nothwendigkeit des Geldes, als Mittel zur Erleichterung des Verkehres zu betonen. Law (Consideration sur le nummeraire, 1720, Chap. I, ursprünglich: Trade and money. 1705, und Memoire sur l'usage des monnaies, 1720, P. I), verwirft dagegen auf das Entschiedenste die Conventionstheorie, erkennt, wie Niemand vor ihm, die eigenthümliche Stellung der edlen Metalle im Kreise der übrigen Waaren, den Geldcharakter derselben aus den Eigenthümlichkeiten der edlen Metalle, genetisch zu entwickeln und wird solcherart der Begründer der richtigen Theorie vom Ursprunge des Geldes. Ihm folgen Genovesi (Lezioni, Part. II. C. 2, 4, 1769) und Turgot (Sur la formation et distribut. des richesses 1771, §§. 42–45) in der Bekämpfung der Theorie, welche den Ursprung des Geldes auf menschliche Convention zurückführt, während Beccaria (Economia publica, P. IV, C. II, §§. 7–8); Verri (Della economia politica, §. 2, und Riflessioni sulle leggi, P. I, S. 21, ed. Custodi); Turgot (a. a. O., und Lettre sur le papier-monnaie, S. 97, ed. Daire); A. Smith (Wealth of Nat. B. I, Chap. IV. 1776 und Büsch (Geldumlauf II, B. VI) den Versuch Law's, den Geldcharakter der edlen Metalle aus der eigenthümlichen Natur dieser Waaren genetisch zu erklären, von Neuem aufnehmen, und in zum Theile trefflicher Weise durchführen. An sie schliessen sich von neuern Schriftstellern: Malthus (Principl. of P. E., Chap. II, Sect. 1); Mac Culloch (Principl. of P. E., P. I, Ch. 24); J. St. Mill (Principl. of P. E., B. III, Chap. VII); Gioja (Nuovo prospette, 1815. I, S. 118 ff); Baudrillart (Manuel, Part III, Chap. III. 1, 1863); Garnier (Traité, Chap. XVII, 1868); und von deutschen Nationalökonomen: Ch. J. Kraus (Staatsw., B. I, S. 61 ff., ed. 1808); Lueder (National-Industrie, 1800, I, S. 48 ff.). Im Uebrigen zeigen die deutschen Nationalökonomen in den ersten Decennien dieses Jahrhunderts wenig Sinn für historische Forschung und das Interesse für unsere Frage geht in den Schriften eines Oberndorfer, Pölitz, Lotz, Zachariae, Herrmann, fast vollständig verloren, bis Rau. Eiselen Roscher, Hildebrandt, Knies, gleichwie schon früher Murchardt, mit dem Erwachen der historischen Forschung auf dem Gebiete unserer Wissenschaft die Frage nach dem Ursprunge des Geldes wieder aufnehmen.—Wenig gefördert wurde die Untersuchung durch die bisher erschienenen Monographien. Ad Müller (Theorie d. Geldes, 1816) constatirt das Verlangen der Menschen nach dem Staate und meint, die edlen Metalle vollzögen diese Vereinigung, (S. 156)—dies sei der Ursprung des Geldes, Hoffmann fuhrt (Lehre vom Gelde, 1838, S. 10) den Ursprung des Geldes wieder auf die Uebereinkunft der Menschen zurück, ebenso Mich. Chevalier (La monnaie, Cours III, S. 3, 1850) Von grösserem Interesse für unsere Frage ist Oppenheim's Monographie (Die Natur des Geldes, 1855), obzwar sie ihre Bedeutung nicht so sehr in einer eigenthümlichen Auffassung vom ersten Ursprunge des Geldes (S. 4 ff.), als in der Darlegung des Processes sucht, durch welchen die zum Tauschmittel gewordene Waare diesen ihren anfänglichen Charakter einbüsst, und schliesslich zu einem blossen Zeicheu des Werthes wird. Wenn wir nämlich auch der letztern Meinung entschieden widersprechen müssen, so liegt ihr doch ein aus der Darstellung Oppenheim's klar hervortretender Gedanke, oder vielmehr eine Beobachtung zu Grunde, welche allein erklärt, dass wir dem obigen Irrthume in den Schriften so vieler ausgezeichneten Nationalokonomen begegnen. Ich meine die Beobachtung, dass der Charakter des Geldes als Nutzmetall in Folge unseres bequemen Verkehrs-Mechanismus, dem Bewusstsein der wirthschaftenden Menschen nicht selten ganz entschwindet und in weiterer Consequenz dieses Umstandes lediglich sein Charakter als Tauschmittel beachtet wird. Die Macht der Gewohnheit ist es solcherart, welche dem Gelde, auch dort, wo dessen Charakter als Nutzmetall nicht unmittelbar beachtet wird, doch seine Tauschkraft sichert. Diese Beobachtung ist gauz richtig. Es ist aber klar, dass die Tauschkraft des Geldes sammt der ihr zu Grunde liegenden Gewohnheit sofort verschwinden würde, wenn der Charakter des Geldes als Nutzmetall dürch irgend ein Ereigniss beseitigt würde. Dass das Geld vielen wirthschaftenden Menschen bei hoch entwickeltem Verkehre lediglich als ein Zeichen erscheint, kann deshalb zugegeben werden. Es ist aber sicher, dass diese leicht erklärliche Täuschung sofort aufhören würde, wenn der Charakter der Geldstücke, als Quantitäten von Nutzmetall, verloren ginge.
[5] Vgl. Stein, Lehrbuch der Volksw. 1858, S. 55, insbes. Knies: Tübing, Ztschr, 1858. S. 266 und Mommsen: Geschichte des röm. Müuzwesens, 1860. Einleit. VII und VIII.
[6] Die Verbindung der Vorstellungen des Geldes und des Viehes, als des ältesten Tauschmittels, tritt aus den meistenSprachen hervor. Im altnordischen heisst „naut“ das Rind und das Geld, im altfriesischen „sket“ Vieh und Geld Das gothische „faihu“ das angelsächsische „féoh,“ das nordhumbrische „feh“ und die entsprechenden Ausdrücke in allen übrigen germanischen Mundarten werden in der wechselnden Bedeutung von Vieh, Vermögen, Geld u. s. f. gebraucht (Wackernagel in Haupt's Zeitschrift, IX, p. 549, Note 101; Diefenbach: Vergleichendes Wörterbuch der gothischen Sprache, I, 350 ff. 2, 757; siehe auch die interressante Note in Trench: A selset glossary of english words, p. 30). In der lex Fris. add. 11 heisst es: equam vel quamlibet pecuniam; im gl. Cassell. F. 12: pecunia fihu. Das altslavische: skotum = „Vieh“ bedentet in seiner litanischen Diminutivform: skatikas vel skatiks so viel, wie Groschen. (Nesselmann: Litanisches Wörterbuch). Auf die Herleitung des lateinischen pecunia, peculium etc. von pecus, das Vieh, ist bereits vielfach hingewiesen worder, desgleichen auf die von Pollux erwähnte Sage, wornach das älteste Geld der Athener  geheissen haben solle, eine Bezeichnung, die sich in dem Sprichworte
geheissen haben solle, eine Bezeichnung, die sich in dem Sprichworte  erhalten hätte. Bekannt sind auch die Ausdrücke: Dekaboion, Tesseraboion, Hekatomboion als Bezeichuungen von Geldbeträgen. Die Ansicht, dass diese Ausdrücke nicht auf ein ehemals beständenes Viehgeld, sondern auf das älteste mit Thierzeichen versehene Metallgeld zurückzuführen sei, findet sich schon bei Pollux und Plutarch, neuerdings bei Beulé und vielen Neuern. Richtiger scheint mir indess die Ansicht zu sein, dass bei dem allmäligen Uebergange von der gewohnten Viehwährung zur Metallwährung der Metallwerth eines Viehstückes ursprünglich das Nominale der neuen Währung bildete und daher Ausdrücke, welche Quantitäten von Viehhäuptern bezeichnen, auf Metallmünzen und Beträge von solchen übertragen wurden. Dass auch im Arabischen die Begriffe Vieh und Geld verwandt sind, dafür spricht das Wort „mâl,“ das in der Einzahl Besitzthum, Vieh, in der Mehrzahl (amwâl) Vermögen und Geld bedeutet (Freytag, Arab. Lexik. IV, 221, Maninski p. 4225.)
erhalten hätte. Bekannt sind auch die Ausdrücke: Dekaboion, Tesseraboion, Hekatomboion als Bezeichuungen von Geldbeträgen. Die Ansicht, dass diese Ausdrücke nicht auf ein ehemals beständenes Viehgeld, sondern auf das älteste mit Thierzeichen versehene Metallgeld zurückzuführen sei, findet sich schon bei Pollux und Plutarch, neuerdings bei Beulé und vielen Neuern. Richtiger scheint mir indess die Ansicht zu sein, dass bei dem allmäligen Uebergange von der gewohnten Viehwährung zur Metallwährung der Metallwerth eines Viehstückes ursprünglich das Nominale der neuen Währung bildete und daher Ausdrücke, welche Quantitäten von Viehhäuptern bezeichnen, auf Metallmünzen und Beträge von solchen übertragen wurden. Dass auch im Arabischen die Begriffe Vieh und Geld verwandt sind, dafür spricht das Wort „mâl,“ das in der Einzahl Besitzthum, Vieh, in der Mehrzahl (amwâl) Vermögen und Geld bedeutet (Freytag, Arab. Lexik. IV, 221, Maninski p. 4225.)
[7] Böckh: Metrologische Unters. 1838, S. 385 ff., 420 ff.; Mommsen: Geschichte des römischen Münzwesens, 1860, S. 169; F. Hultsch: Griechische und römische Metrologie, 1862, S. 124 ff., 188 ff.
[8] Wackernagel, Gewerbe, Handel und Schifffahrt der alten Germanen, in Haupt's Zeitschrift IX, 548 ff.; Grimm, deutsche Rechtsalterthümer, S. 586 ff.; Soetbeer, Beiträge zur Geschichte des Geld- und Munzwesens in den Forschungen zur dentschen Geschichte, I, 215.
[9] Sprenger, Leben Mohamed's, III, S. 139.
[10] Spiegel, Avesta (deutsche Bearbeitung), 1, S. 94 ff.
[11] Levy, Geschichte der jüdischen Münzen, S 7
[12] Vgl. Roscher, System, I, §. 118, Not. 5.
[13] Plut. Thes. 19; Plinius h. u. 18. 3; Schreiber in seinem Taschen-buche für Gesch. 2. 67 ff. 240 ffg. 3. 401 fgg.
[14] Clavigero: Geschichte von Mexiko, I. Band, VII. Buch, 35. Abth.
[15] Noch gegenwärtig bildet das Biberfell in mehreren Ländern der Hudsonsbay-Gesellschaft die Masseinheit des Verkchres. 3 Marder werden gleich 1 Biber geschätzt, 1 weisser Fuchs gleich 2 Bibern, 1 schwarzer Fuchs, oder Bär gleich 4 Bibern, 1 Flinte gleich 15 Bibern (Ausland, 1846, Nr. 21). Das esthuische Wort raha, Geld, hat in der verwandten Sprache der Lappen die Bedeutung von Pelzwerth (Ph. Krug, Zur Münzkunde Russlands, 1805). Vom Pelzgelde im russischen Mittelalter: Nestor, übersetzt von Schlöger, III, S. 90. Das alte Wort kung = Geld bedeutet eigentlich Marder. Noch 1610 wird eine russische Kriegscasse vom Feinde genommen, worin sich 5450 Rubel Silber und 7000 Rubel an Pelzwerk finden (Karamsin, XI, S. 183). Roscher, System, I, §. 118, 3, 1868; Siehe auch Storch, Uebersetz. v. Rau, III, S. 25.
[16] Roscher: System I. § 119, Note 12.
[17] Sur la form, et distrib. des richesses, S. 25 ed. Daire. Vgl. auch Roscher: System, I, §. 116, 1868; Knies: Tübing, Ztsch. 1858, S. 262.
[18] Siebe hierüber insbes Helferich: Von den periodischen Schwan-kungen im Werthe der edlen Metalle, 1843.
[19] Der obige Unterschied, welcher in unserer Wissenschaft bisher nicht genügend beachtet wurde, ist seit langem der Gegenstand sehr eingehender Untersuchungen Seitens der Juristen, indem für diese letztern, überall dort, wo Schadenansprüche vorliegen, und auch in manchen andern Fällen (bei allen subsidiären Leistungen), die obige Frage practisch wird. Man denke nur z. B. an den Fall, dass einem Gelehrten von irgend einer Person in unrechtmässiger Weise seine Bibliothek entzogen würde. Der „Verkaufspreis“ derselben würde ihm eine sehr ungenügende Entschädigung für seinen Verlust bieten. Dagegen würde derselbe das richtige Aequivalent der Bibliothek für einen Erben des Gelehrten sein, für welchen dieselbe überwiegenden Tauschwerth hätte.
[20] Wir haben in dem Obigen die Ursachen dargelegt, welche bewirken, dass die Schätzungen überall dort, wo eine Waare bereits den Charakter des Geldes erlangt hat, der Regel nach am zweckmässigsten in dieser letzteren vorgenommen werden können, und demnach,wo nicht dem zwecke der Schätzung hinderliche Eigenthümlichkeiten der zum Gelde gewordenen Waare dem entgegenstehen, auch thatsächlich vorgenommen werden. Dies letztere ist aber nicht eine nothwendige Folge des Geldcharakters einer Waare, und lassen sich sehr wohl Fälle denken, dass eine Waare, die den Geldcharakter nicht besitzt, zum „Preismesser“ würde, oder doch von mehreren Waaren, die den Geldcharakter erlangt haben, nur die eine, oder die andere. Die Function als Preismesser ist demnach nicht nothwendigerweise an diejenigen Waaren geknüpft, welche den Geldcharakter erlangt haben, nicht eine nothwendige Consequenz dieses letztern, am wenigsten aber Voraussetzung und Ursache desselben. Das Geld ist allerdings der Regel nach, und das Metallgeld wegen der hohen Fungibilität desselben und der relativ grossen Stabilität der seinen Werth bestimmenden Momente thatsächlich zugleich ein sehr zweckmässiger Preismesser. Andere Waaren, welche den Geldcharakter erlangten (Waffen, Metallgeräthe, Bronceringe u. dgl. m.) sind dagegen wohl nie als Preismesser verwendet worden. Diese letztere Function liegt demnach nicht in dem Begriffe des Geldes, und wenn bei einigen Nationalökonomen dieser letztere in dem des „Werthmassstabes“ geradezu aufgeht, so liegt hierin eine Verkennung der wahren Natur des Geldes.
[21] Das Geld, als Massstab im Güterverkehre der Menschen wird schon von Aristoteles (Ethic, Nicom, V, 8 und IX, 1,) beobachtet. Von den Schriftstellern, welche den Ursprung des Geldes ausschliesslich, oder doch vorwiegend auf das Bedürfniss der wirthschaftenden Menschen nach einem Massstabe des „Tauschwerthes,“ beziehungsweise der Preise, und den Geldcharakter der edlen Metalle auf ihre besondere Eignung zu diesem Zwecke zurückführen, seien hier erwähnt; Broggia (Delle monete, 1743, C. I, S. 304 ed. Cust.); Neri (Osservazioni, 1751, Cap. VI, Art. I, §. 14 ff.); Galiani (Della moneta, 1750, Lib. I, c. 1, S. 23 ff. und Lib. II. C. 1, S. 120 ff. der ed. 1831); Genovesi (Lezioni, Part. II, C. 2, 4, 1769); Hutcheson (A system of moral philosophy, 1755; Book II, Ch. XII, §. 2); Ricardo (Principles of P. E. Chap. III, S. 46, ed. 1846); Storch (Cours d'écon. politique, Petersb. 1815, I, Introd. gen., S. 8 ff.); Stein (System d. Staatswissenschaft, 1852; I, S. 217 ff.); Schäffle (Das gesellschaftliche System der menschlichen Wirthschaft, 1867, §. 60 ff.).
[22] Diese Theorie hat ihre hauptsächlichen Vertreter in den grossen englischen Philosophen des siebzehnten Jahrhundertes gefunden. Hobbes geht (Leviathan: de civitate, Pars II, C. 24, S. 123, oper. 1668) von dem Bedürfnisse der Menschen nach Conservirung vergänglicher, aber nicht zur sofortigen Consumtion bestimmter Vermögenswerthe aus, und zeigt, wie durch den Umsatz (die „concoctio“) derselben in Metallgeld dieser Zweck, sowie der Zweck der leichtern Transportabilität erreicht wird. Ebenso Locke (Of civil government,Book II, Ch. 5, §. 46 ff., 1691 und Farther Considerations concerning raising the value of money, I, §. 1, 1698).—Einen bereits in Aristoteles Anschanungen vom Gelde gelegenen Keim entwickelt Bandini (Discorso economico, 1737, bei Custodi, S. 142 ff.) Derselbe beginnt seine Darstellung mit dem Hinweise auf die Schwierigkeiten, zu welchen der blosse Tauschverkehr führt; derjenige, dessen Güter von Andern begehrt wurden, sei nicht immer in der Lage gewesen, die Güter dieser letzteren gebrauchen zu können, und deshalb sei ein Pfand (un mallevadore, sagt Bandini) nöthig geworden, dessen Uebergabe ihm die künftige Gegenleistung sichern sollte. Zu dieser Function seien die edlen Metalle gewählt worden. Diese Theorie bilden Ortes (Della economia nazionale LVI, c. 1 und Lettere: XVI, S. 258, edit. Custodi), Corniari (Riflessioni sulle monete III und: Lettera ad un legislatore, S. 153, bei Custodi) und Carli (Del origine del commercio e della moneta §§. 1 und 2) in Italien, Dutôt (Reflexions sur le commerce et finances, 1738, Chap. III, 1, S. 895, Daire) in Frankreich aus. Schmalz hat dieselbe (Staatsw. in Briefen, 1818, S. 48 ff.) in Deutschland, und Macleod (Elements of P. E., 1858, S. 24) neuerdings in England revidirt.
[23] Ursprünglich wurden die Münz-Metalle wohl durchaus in Stücke zerlegt, welche die auch sonst im Handel üblichen Gewichtsmengen ausdrückten. Das römische As war ursprünglich ein Pfund Kupfer, das englische Pfund Sterling enthielt zur Zeit Eduard's I nach Tower-Gewicht ein Pfund Silber von bestimmtem Feingehalte, ebenso der französische livre zur Zeit Karl des Grossen nach Troyes - Gewicht ein Pfund Silber. Der englische Shilling und Penny waren gleichfalls im Handel gebräuchliche Gewichtsmengen. - „Wenn der Weizen zwölf Shilling das Quarter kostet,“ sagt ein altes Statut Heinrich III., „so soll ein Weissbrod für einen Penny eilf Shilling und vier Pence wiegen.“ (Vgl. Ad. Smith, W. o. N. B. I, Ch. 4.) Dass auch unsere Mark, Schilling, Pfennig etc. ursprünglich Handelsgewichte gewesen, ist bekannt. Die Münzverschlechterungen, welche in der Folgezeit wiederholt von den Münzherren vorgenommen wurden, haben bewirkt, dass das gemeine Handelsgewicht und das Gewicht, nach welchem die edlen Metalle gehandelt (beziehungsweise als Münzen zugezählt) werden, in den meisten Ländern bald eine sehr grosse Verschiedenheit aufwiesen, ein Umstand, welcher seinerseits wiederum nicht wenig dazu beitrug, dass in dem Gelde ein eigenthümlicher „Massstab des Tauschwerthes“-erblickt wurde, während doch in jeder naturgemässen Volkswirthschaft der Münzfuss nichts anderes als die Gewichtsbestimmung ist, nach welcher die edlen Metalle gehandelt werden. In neuerer Zeit hat man vielfach versucht, das Handelsgewicht, so weit dies die Rücksichtsnahme auf die Bequemlichkeit des Verkehres gestattet, mit dem Münzgewichte wieder in Einklang zu bringen, so zumal auch in Deutschland und Oesterreich, wo das Zollpfund zur Grundlage des Münzsystems gewählt wurde.