WILHELM VON HUMBOLDT
Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen (1851)
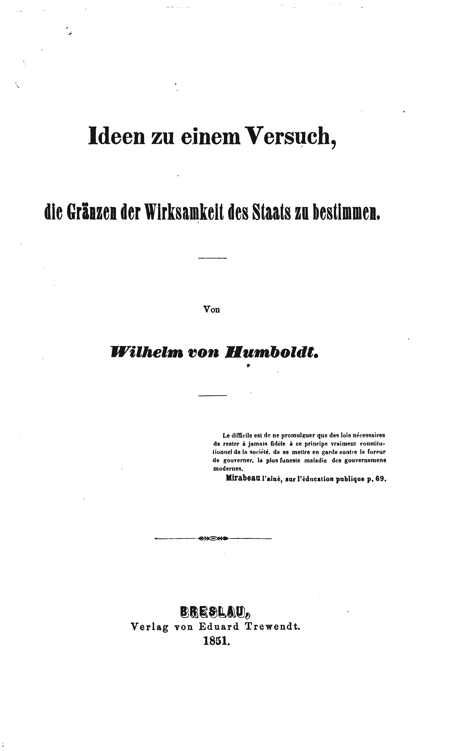 |
 |
This is an e-Book from |
Source
Wilhelm von Humboldt, Ideen zu einem Versuch, die Gränzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen (Breslau: Heinrich Richte, 1851).
Editor's Introduction
To make this edition useful to scholars and to make it more readable, I have done the following:
- inserted and highlighted the page numbers of the original edition
- not split a word if it has been hyphenated across a new line or page (this will assist in making word searches)
- added unique paragraph IDs (which are used in the "citation tool" which is part of the "enhanced HTML" version of this text)
- retained the spaces which separate sections of the text
- created a "blocktext" for large quotations
- moved the Table of Contents to the beginning of the text
- placed the footnotes at the end of the book
- formatted short margin notes to float right
- inserted Greek and Hebrew words as images
Table of Contents
- Title Page
- Einleitung (editor: Dr. Eduard Cauer) S. I
- Inhalts-Verzeichniss S. XXVIII
- I. Einleitung S. 1
- II. Betrachtung des einzelnen Menschen und der höchsten Endzwecke des Daseins desselben S. 9
- III. Uebergang zur eigentlichen Untersuchung. Eintheilung derselben. Sorgfalt des Staats für das positive, insbesondere physische Wohl der Bürger S. 16
- IV. Sorgfalt des Staats für das negative Wohl der Bürger, für ihre Sicherheit S. 44 S. 47
- V. Sorgfalt des Staats für die Sicherheit gegen auswärtige Feinde S. 47
- VI. Sorgfalt des Staats für die Sicherheit der Bürger unter einander. Mittel, diesen Endzweck zu erreichen. Veranstaltungen, welche auf die Umformung des Geistes und Charakters der Bürger gerichtet sind. Oeffentliche Erziehung S. 53
- VII. Religion S. 61
- VIII. Sittenverbesserung S. 84
- IX. Nähere, positive Bestimmung der Sorgfalt des Staats für die Sicherheit. Entwickelung des Begriffs der Sicherheit S. 100
- X. Sorgfalt des Staats für die Sicherheit durch Bestimmung solcher Handlungen der Bürger, welche sich unmittelbar und geradezu nur auf den Handlenden selbst beziehen. (Polizeigesetze.) S. 106
- XI. Sorgfalt des Staats für die Sicherheit durch Bestimmung solcher Handlungen der Bürger, welche sich unmittelbar und geradezu auf andre beziehen. (Civilgesetze.) S. 117
- XII. Sorgfalt des Staats für die Sicherheit durch rechtliche Entscheidung der Streitigkeiten der Bürger S. 133
- XIII. Sorgfalt des Staats für die Sicherheit durch Bestrafung der Uebertretungen der Gesetze des Staats. (Kriminalgesetze.) S. 138
- XIV. Sorgfalt des Staats für die Sicherheit durch Bestimmung des Verhältnisses derjenigen Personen, welche nicht im Besitz der natürlichen, oder gehörig gereiften menschlichen Kräfte sind. (Unmündige und des Verstandes Beraubte.) Allgemeine Anmerkung zu diesem und den vier vorhergehenden Abschnitten S. 162
- XV. Verhältniss der, zur Erhaltung des Staatsgebäudes überhaupt nothwendigen Mittel zur vorgetragenen Theorie. Schluss der theoretischen Entwicklung S. 171
- XVI. Anwendung der vorgetragenen Theorie auf die Wirklichkeit S. 177
- Fußnoten
Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen.↩
Le difficile est de ne promulguer que des lois nécessaires de rester à jamais fidèle à ce principe vraiment constitutionnel de la société, de se mettre en garde contre la fureur de gouverner, la plus funeste maladie des gouvernemens modernes.
Mirabeau l’aîné, sur l’éducation publique p. 69.
[I]
Einleitung.↩
Der geistige Besitz unsrer Nation hat in den letzten Decennien durch eine lange Reihe von Mittheilungen aus der Blüthenepoche unsrer literarischen Entwicklung die köstlichsten Bereicherungen erfahren, auf Grund deren das Verständniss der grossen Vergangenheit unsrer Literatur in einem früher schwerlich geahneten Grade an Ausdehnung, Lebendigkeit und Tiefe gewonnen hat. Die gegenwärtige Publication, die man einer glücklichen Fügung der Umstände und dem warmen zu jedem Opfer bereiten Eifer der ehrenwerthen Verlagshandlung zu verdanken hat, schliesst sich in der erfreulichsten Weise an die ihr vorausgegangenen an.
Eine bisher nur zum kleinsten Theile bekannte Schrift Wilhelm von Humboldts wird in Gegenwärtigem fast vollständig der Oeffentlichkeit übergeben, — eine Schrift, die ebenso sehr an sich durch die Bedeutung ihres Inhalts wie in Rücksicht auf ihren grossen Urheber das allgemeinste Interesse in Anspruch nehmen muss.
Dem Unterzeichneten, dem die Herausgabe dieser kostbaren Reliquie eines der ersten Geister unsrer Nation anvertraut worden ist und der eine Ehre darein gesetzt hat, sich diesem Geschäfte mit aller möglichen Sorgfalt zu unterziehen, liegt zunächst die Pflicht ob, zu berichten, was sich über die Entstehung und die bisherigen Schicksale der vorliegenden Schrift hat ermitteln lassen.[1]
[II]
Wilhelm von Humboldt hatte seine praktische Thätigkeit, die er gleich nach Vollendung seiner academischen Studien im Jahre 1790 beim Kammergericht in Berlin begonnen, sehr bald, schon im Sommer des folgenden Jahres wieder abgebrochen, und hatte, indem er sich verheirathete, die Zurückgezogenheit eines ihm durch seine Gattin zugebrachten Landgutes (Burgörner in der Grafschaft Mansfeld) aufgesucht. In dieser glücklichen Musse hatte er sich neben andren Beschäftigungen vorzugsweise dem Nachdenken über politische Fragen zugewandt. Schon von Göttingen aus hatten diese Fragen den Gegenstand seiner Correspondenz mit Forster gebildet, und die in voller Entwicklung begriffene französische Revolution hielt damals die Gedanken aller Männer von Kopf und Herzen in dieser Richtung fest. So kam es, dass von dem Abschlusse der ersten französischen Constitution Humboldt Gelegenheit nahm, im Allgemeinen seine Ideen über Staatsverfassungen und die Gesetze, nach denen sie sich entwickeln, in einem Briefe an einen Freund darzulegen. Dieser Brief fand den Weg in die Oeffentlichkeit durch die „Berlinische Monatsschrift“, welche in dem Januarheft des Jahres 1792 einen Abdruck desselben brachte.[2] Er gerieth auch in Dalbergs des Coadjutors Hände, der damals als Statthalter des Curfürsten von Mainz in Erfurt residirte und mit dem Humboldt schon bei einem früheren Aufenthalte in dieser Stadt in Berührung gekommen war.
Ein Bild der vielfachen Anregungen und Förderungen geistigen Lebens zu geben, die in jenen Jahren von Dalberg ausgingen und den umfassenden indirecten Antheil, der ihm an den [III] herrlichen literarischen Ergebnissen jener grossen Epoche gebührt, im Allgemeinen zu würdigen, liegt ausserhalb unsres Zweckes. Es genügt hier zu zeigen, wie er die Veranlassung zu der Entstehung der Schrift gab, die wir mit diesen Zeilen in die Oeffentlichkeit einführen. Als nämlich Humboldt einer Familienrücksicht wegen im Februar 1792 mit seiner Frau für einige Zeit nach Erfurt übersiedelte, forderte ihn Dalberg mit Bezug auf den in der Berlinischen Monatsschrift gedruckten Brief zu einer Fortsetzung seiner politischen Schriftstellerei auf. Humboldt spricht sich darüber selbst in einem Briefe an Forster, dem letzten, den wir haben, folgendermaassen aus: „Aus diesem Aufsatz hatte Dalberg gesehen, dass ich mich mit „Ideen dieser Art beschäftige, und wenig Tage nach meiner „Ankunft hier bat er mich, meine Ideen über die eigentlichen „Gränzen der Wirksamkeit des Staats aufzusetzen. Ich fühlte „wohl, dass der Gegenstand zu wichtig war, um so schnell be„arbeitet zu werden, als ein solcher Auftrag, wenn die Idee „nicht wieder alt werden sollte, forderte. Indess hatte ich „Einiges vorgearbeitet ,[3] noch mehr Materialien hatte ich im „Kopfe, und so fing ich an. Unter den Händen wuchs das „Werkchen, und es ist jetzt, da es seit mehreren Wochen fertig „ist, ein mässiges Bändchen geworden.“ Da Humboldt dies am 1. Juni schreibt, kann er zu der Ausarbeitung der vorliegenden Schrift (denn diese ist es, über die er an Forster berichtet,) kaum ein Vierteljahr gebraucht haben. Und er hat diese Zeit nicht einmal ausschliesslich darauf verwendet. Vielmehr war er gleichzeitig mit der Uebersetzung einer Pindarischen Ode, der 2ten olympischen,[4] beschäftigt, die er unterm 3ten Mai an Schiller schickt.
[IV]
Gleich nach ihrer Vollendung wurde die Schrift Dalberg vorgelegt, der sie erst für sich las und dann Abschnitt für Abschnitt mit Humboldt durchging. Dabei stellte sich eine sehr wesentliche Differenz der Ansichten heraus. [Humboldt äussert in dem Briefe an Forster vom 1. Juni, dass er in der Rücksicht auf den nächsten Zweck der vorstehenden Schrift einen besondern Grund gefunden habe, sich mit so grosser Schärfe gegen alle Uebergriffe der Staatsgewalt zu erklären. So ideal mithin auch die Anlage des Ganzen ist, so hat der Verfasser doch nebenher einen sehr bestimmten praktischen Gesichtspunkt verfolgt, nämlich den, Dalberg, den künftigen Regenten des Erzbisthums Mainz, davon zu überzeugen, wie verderblich die Sucht zu regieren sei. Dass ihm dies schlecht gelungen ist, davon giebt schon dieser Brief an Forster selbst Zeugniss, in dem gesagt wird, dass Dalberg die Richtigkeit der Humboldt’schen Ansichten nicht habe zugeben wollen, und für die Wirksamkeit des Staates einen weit grösseren Kreis in Anspruch nehme.
Wie weit aber Dalberg’s Standpunkt von dem unsrer Schrift entfernt blieb, das geht noch viel deutlicher aus einem kleinen Aufsatze hervor, der unter dem Titel:
„Von den wahren Grenzen der Wirksamkeit des Staats in Beziehung auf seine Mitglieder“ im Jahre 1793 zu Leipzig in der Sommer’schen Buchhandlung anonym erschienen ist, und der keinen Andren, als den Coadjutor selbst zum Verfasser hat.
Dieser Aufsatz schliesst sich durchweg auf das engste an den Gedankengang der Humboldt’schen Schrift an, und fast für jeden Passus in jenem lässt sich mit Leichtigkeit die Stelle in dieser bezeichnen, durch welche er hervorgerufen ist. Zwar ein ausgeführtes Gegenstück der vorstehenden Schrift ist er nicht. Auf 45 Seiten des kleinsten Octavformats und des splendidesten Drucks enthält er nichts weiter, als eine Anzahl abgerissener Bemerkungen, wie sie sich dem Verfasser bei der [V] Lectüre jener Schrift aufgedrängt haben. Auch ist Dalberg weit entfernt, dem mit so grosser Präcision hingestellten und mit so grosser Consequenz durchgeführten Grundprincipe Humboldt’s ein andres mit gleicher Schärfe entgegenzustellen. Gründe der Nützlichkeit und Nothwendigkeit erscheinen neben einander, Principien des Naturrechts neben einem ängstlichen Respect vor dem historisch Gegebenen, Bruchstücke Rousseau’scher Staatsweisheit neben den Maximen des aufgeklärten wohlwollenden Despotismus eines Joseph II. Dabei tritt oft eine erstaunliche Unbeholfenheit des Gedankens und des Ausdrucks zu Tage. Im Ganzen kann man sagen, dass in dieser Schrift das Raisonnement eines wohlmeinenden verständigen, leidlich aufgeklärten und toleranten den verschiedensten die Zeit bewegenden Richtungen zugänglichen Mannes dem selbständigen philosophisch geschulten Gedanken entgegentritt, und indem sie so gleichsam das Niveau der vulgären politischen Bildung jener Zeit bezeichnet, kann sie sehr passend dazu benutzt werden, von ihr aus die Höhe zu ermessen, zu der sich Humboldt erhoben hat.]
Trotz solcher Differenz war Humboldt zur Veröffentlichung seines Aufsatzes entschlossen und sandte zu diesem Zwecke eine Abschrift des Manuscripts nach Berlin. Allein der Gedanke, ihn dort gedruckt zu sehn, musste sehr bald aufgegeben werden. An einem Verleger zwar hätte es in Berlin nicht gefehlt. Aber schon am 12. Septbr. schreibt Humboldt Schiller’n von den Schwierigkeiten, die ihm die dortige Censur erregt habe.
„Der eine Censor verweigerte sein Imprimatur ganz, der „andere hat es zwar ertheilt, allein nicht ohne Besorgniss, dass „er deshalb noch künftig in Anspruch genommen werden könne. „Da ich nun alle Weitläufigkeiten dieser Art in den Tod hasse, „so bin ich entschlossen, die Schrift ausserhalb drucken zu „lassen.“ Also noch immer die feste Absicht der Veröffentlichung. Schillers Hülfe wurde nun dafür in Anspruch [VI] genommen. Das Originalmanuscript befand sich, wie aus diesem Briefe hervorgeht, bereits in seinen Händen und Humboldt bat ihn, bei Göschen in Leipzig anzufragen: „ob er den Verlag zur Ostermesse 1793 übernehmen wolle.“
Es ergiebt sich aber aus dem vorliegenden Briefe zugleich, dass Humboldt Schiller’n noch eine ganz andre Betheiligung als diese blos äusserliche an seinem literarischen Unternehmen zugedacht hatte. Es heisst in demselben: „Caroline[5] schreibt „uns noch, dass einige Ideen meiner Abhandlung Sie nicht ohne „Interesse gelassen haben, und dass Sie selbst sich jetzt mehr „mit diesen Gegenständen beschäftigen. Sie selbst versprachen „mir schon einmal halb und halb die Mittheilung einiger Ihrer „Ideen. Welch ein angenehmes Geschenk würden Sie mir da„mit machen! Wie wäre es aber, wenn Sie sie in Gestalt einer „Vorrede, oder eines Anhangs, oder wie Sie sonst wollten, mit „oder ohne Ihren Namen, meiner Abhandlung beifügten. Es „versteht sich, dass dies nur ein hingeworfner Einfall ist. Aber „es scheint mir zu interessant, wenn ein Mann von Ihrem Geiste, „ohne vorhergehendes eigentliches Studium dieser Materien, „und also von ganz anderen, neuen und originelleren Gesichts„punkten ausgehend, diesen Gegenstand behandelte; und der „Kreis Ihrer schriftstellerischen Arbeiten bietet Ihnen sonst „nicht leicht, wenn Sie nicht Lust hätten, Ihre Ideen zu einer „eignen Schrift auszuspinnen, eine bequemere Gelegenheit dar, „sie gelegentlich einzuweben.“
Wir erfahren nicht, welche Aufnahme dieser Vorschlag bei Schiller fand. Indessen darf angenommen werden, dass dieser schon desshalb nicht daran denken konnte, auf ihn einzugehn, weil die politischen Ideen, mit denen ihn Humboldt beschäftigt wusste, in ihm bereits den Plan zu einer eignen selbständigen [VII] Schrift gezeitigt hatten. Diese Schrift liegt uns vor in den Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen, die für Schiller, obwohl sie erst im Jahre 1794 zu Ende geführt wurden, schon im März 1792 den Gegenstand brieflicher Besprechung mit Körner bildeten, und die mit Humboldt’s „Ideen“ bei aller Verschiedenartigkeit der Ausführung doch in den Grundanschauungen und namentlich in der Weise, wie die Gebiete der Politik, der Moral und der Aesthetik zu einander in Beziehung gesetzt werden, eine unverkennbare Verwandtschaft zeigen.
Je weniger sich Schiller sonach veranlasst finden konnte, Humboldt’s zweitem Begehren zu willfahren, desto angelegentlicher nahm er sich des ersten, der äusseren Sorge für die Schrift des Freundes an. Göschen freilich wollte sich wider alles Erwarten wenigstens für jetzt auf nichts einlassen, — wie es scheint, weil er zu sehr mit Verlagsunternehmungen überhäuft war. — Aber nun bemühte sich Schiller nicht allein um einen andren Verleger, sondern er nahm auch ein Stück des Aufsatzes in seine Thalia auf, [6] und zwar mit der ausgesprochnen Absicht, die Mittheilungen aus demselben in dieser Zeitschrift weiter fortzusetzen. — Inzwischen waren auch in der Berlinischen Monatsschrift einige Bruchstücke publicirt worden. Biester, in dessen Händen sich die nach Berlin gesandte Abschrift befand, hatte für seine Zeitschrift den 5ten, 6ten und 8ten Abschnitt ausgewählt, und sie, wenigstens die beiden letzteren jedenfalls ohne Humboldt’s Wissen in den drei letzten Monatsheften des Jahres 1792 erscheinen lassen. [7] Auch diese Mittheilungen, wie die in der Thalia, waren nur vorläufige, die [VIII] keinesweges die Veröffentlichung des Ganzen ersetzen, vielmehr auf dieselbe vorbereiten sollten.[8]
Dass es zu dieser Veröffentlichung des Ganzen nicht mehr kam, dass es bei jenen vorläufigen Mittheilungen sein Bewenden behielt, davon trug die Schuld zuletzt Humboldt selbst. — Der Berliner Censur liess sich aus dem Wege gehn. Nun endlich hatte Schiller auch einen Verleger ausfindig gemacht; — zwischen dem 14ten und 18ten Januar erhielt Humboldt die Meldung davon nach Auleben, wohin er sich in der Mitte des verflossenen Sommers von Erfurt aus begeben hatte. — Ein objectives Hinderniss war nicht mehr vorhanden. Da ergaben sich neue und dieses Mal unüberwindliche Schwierigkeiten aus den Wandlungen und Stimmungen der Subjectivität des Verfassers. Es ist in der That merkwürdig zu sehen, wie sich stufenweise aber schnell genug das Verhältniss des Urhebers zu seinem Werke umwandelte. In dem Briefe an Forster vom 1. Juni spricht sich noch die vollste Zuversicht aus. Humboldt redet von den Ergebnissen seines Nachdenkens in dem Tone eines Mannes, der das Bewusstsein hat, mit sich fertig zu sein und was auch das Leben bringen möge, an dem System seiner Gedanken nun nichts mehr ändern zu müssen. „Sie stimmten sonst,“ schreibt er, „als wir noch von Göttingen aus über diese „Gegenstände correspondirten, mit meinen Ideen überein. Ich „habe seitdem, so viel ich auch nachzudenken und zu forschen „versucht habe, fast keine Veranlassung gefunden, sie eigent„lich abzuändern, aber ich darf behaupten, ihnen bei weitem „mehr Vollständigkeit, Ordnung und Präcision gegeben zu „haben.“ Dieselbe Sicherheit verbunden mit einer gewissen Ungeduld, die Schrift vor das Publikum gebracht zu sehen, verräth noch der Brief an Schiller vom 12. Septbr. Nun aber beginnt die Entfremdung. Am 7. Decbr. findet Humboldt noch, [IX] — wir werden richtiger sagen, schon Aenderungen nothwendig. Aber er denkt noch immer an nichts, als an schleunige Publication und will daher sich sogleich an die neue Durchsicht machen, „ob ich gleich,“ schreibt er, „noch selbst nicht „bestimmen kann, ob ich viel abändern werde.“ Am 14. Januar sind Humboldt’s Bedenken schon mächtig angewachsen. „Viel„leicht,“ schreibt er an Schiller, „nähme Göschen das Werkchen „in ein oder zwei Jahren, und mir wäre es lieb, wenn man so „lange damit wartete. Ich habe schlechterdings keine Eile da„mit, und gewönne vielmehr dadurch Zeit zu einer Umarbeitung „einzelner Abschnitte, die ich zum Theil für nothwendig halte, „an die ich aber jetzt, da ich mir einmal für die nächsten Mo„nateganz andere Beschäftigungen gewählt habe, nicht kommen „würde. Der Gegenstand selbst ist von allem Bezug auf „momentane Zeitumstände frei, und so, dächte ich, gewännen „sowohl die Leser, als die Ideen selbst, für die Sie sich zu „interessiren scheinen.“
Als unmittelbar nach Abgang dieses Briefes die Nachricht kam, dass ein Verleger gefunden sei und der Druck beginnen solle, als es also galt, einen entscheidenden Entschluss zu fassen, da scheint sich Humboldt selbst erst die tiefe Kluft zum Bewusstsein gebracht zu haben, die ihn bereits von den Tagen trennte, in denen er seine „Ideen“ niedergeschrieben hatte. Am 18. Januar spricht er sich gegen Schiller ausführlich über diese Angelegenheit aus: „als ich neulich die Abhandlung noch ein„mal durchging, fand ich in der That nicht blos viele Stellen, „die einer Aenderung, sondern auch einige, die einer gänzlichen „Umarbeitung bedürfen. Sie selbst, lieber Freund, waren „zuerst dieser Meinung und werden darum um so mehr mit mir „darüber übereinstimmen. Je mehr mich auch die vorgetragnen „Ideen interessiren, und je günstiger ich sogar von meiner Arbeit urtheile, um so weniger könnte ich mir die Nachlässigkeit verzeihen, ihr nicht diese letzte Sorgfalt gewidmet zu haben. [X] „Für jetzt aber und die nächsten Monate habe ich nicht allein „ganz heterogene Beschäftigungen, sondern es fehlt mir auch „theils an Stimmung, theils sogar an einigen Büchern, um an „diese Revision zu gehn. Ueber Einiges möchte ich sogar „durch Gespräch meine Ideen erst klarer machen können. „Alles dies hat mich nun zu dem festen Entschluss gebracht, „die Herausgabe, wenn es noch möglich ist, aufzuschieben, und „zwar auf unbestimmte Zeit, da, wie lang oder kurz eine be„stimmte sein möchte, alles Gebundensein in dergleichen Din„gen so unangenehm ist. — Ich kann aus der guten Caroline „Brief nicht sehen, in wiefern Sie, mein Theurer, schon sichere „Abrede getroffen haben. Haben Sie aber mit dem Buchhänd„ler noch nicht abgeschlossen, und können Sie noch zurück„gehen, so bitte ich Sie, ihm zu schreiben, dass der Entschluss „über die Zeit der Herausgabe der Schrift geändert sei, dass „also jetzt keine weitere sichere Abrede genommen werden „könne, dass ich aber, wenn ich mit den noch vorzunehmenden „Aenderungen[9] fertig wäre, mich an ihn abermals wenden, „und bei ihm anfragen würde. Wahrscheinlich würde er doch „bei einer zweiten Anfrage gleich geneigt sein, und wäre er es „nicht, so ist vielleicht dann Göschen frei, oder ich finde einen „Andern. — Haben Sie aber schon mit ihm abgeschlossen, und „wäre es nicht zu ändern, welches mir freilich sehr unlieb wäre, „so müsste ich Sie doch bitten, mit ihm die Abrede zu treffen, „dass das Buch erst Ostern 1794 oder frühestens Michaelis d. J. „erschiene. Dies wäre mein kürzester Termin, und er gewänne „ja auch durch die auf seinen Verlagsartikel gewandte Zeit. „Indess wäre mir das Erste bei Weitem immer das Liebste.“
Es war noch nicht ein Jahr vergangen, seit Humboldt von [XI] Dalberg die erste Anregung zu diesem Werke empfangen hatte. Nicht viel länger als acht Monate war es her, dass er die Feder, mit der er es niederschrieb, aus der Hand gelegt. Vor etwa vier Monaten noch hatte er sich mit der Ausführung seiner Ideen, die er darin gegeben, in voller Uebereinstimmung befunden, und jetzt war er schon auf den Punkt gekommen, wo er sich ebensowenig zu einer unveränderten Veröffentlichung, wie zu einer Vornahme der Veränderungen, die ihm nöthig schienen, entschliessen konnte. Wir werden es daher natürlich finden, dass ihm, nachdem er einmal ins Unbestimmte hinauszuschieben begonnen hatte, der eine Entschluss wie der andere mit jedem Tage mehr unmöglich werden musste. Nicht auf Monate, wie Humboldt damals glaubte, fesselten ihn heterogene Beschäftigungen; — und welcher Art diese waren, zeigt seine Correspondenz mit F. A. Wolf, die eben in den Tagen ihren Anfang nimmt, in welchen ihm seine politischen Ideen fremd zu werden begannen. Was ihm als eine flüchtige Excursion erschien, von der er sich bald in die Regionen politischer Speculation zurückfinden werde, wurde ihm zu dem Wege, auf dem er den besten Theil seiner Lebensaufgabe fand und löste. — Und als ihn endlich in einem ganz neuen Stadium seiner Entwicklung, nachdem er sich an der Hand F. A. Wolf’s in das Studium des Alterthums und der Sprachen versenkt, nachdem er mit Schiller im Bunde die Höhen der Kunstphilosophie erstiegen hatte, seine Lebensbahn zum Staate zurückführte, mussten da nicht dem Staatsmanne Humboldt die „Ideen“ des Jünglings wie eine andere Welt erscheinen? Schliesslich sei noch einer mit der Veränderung in Humboldt’s Gedankenrichtung zusammen treffenden sehr wesentlichen Umwandlung der äusseren Umstände gedacht. An demselben Tage, von dem der letzte diese Angelegenheit behandelnde Brief Humboldt’s datirt ist, am 18. Jan., wurde in Paris der Tod Ludwigs XVI. beschlossen. Drei Tage später fiel sein Haupt. Es ist bekannt, wie diese Katastrophe [XII] einen totalen Umschwung in der Stimmung des gebildeten deutschen Publicums gegenüber der Revolution und allen irgendwie mit ihr verwandten Ideen bewirkte. Die vorliegende Schrift, eine so grosse Selbständigkeit des Gedankens sie auch zeigt, wurzelt doch sehr bestimmt in dem Gefühle warmer Bewunderung für die in Frankreich zum Durchbruche gekommenen Ideen. Sie zeigt den Verfasser, wie Stolberg in jenen Jahren von ihm sagte, „getroffen von dem Gifthauche des Genius der Zeit.“ Es konnte daher die Veröffentlichung derselben schwerlich mehr angemessen erscheinen, nachdem die Gesinnung, auf der sie beruhte und die sie nothwendig auch bei den Lesern voraussetzte, fast überall in das Gegentheil umgeschlagen war. — So erklärt sich das Loos dieser Schrift, deren Verbreitung ihrem Verfasser anfangs so sehr am Herzen gelegen hatte und von der er noch, als er im Begriffe war, ihr für immer den Rücken zu wenden, so günstig urtheilte.
Von den Umständen, die sie jetzt, nachdem sie mehr als ein halbes Jahrhundert im Dunkel gelegen, an das Licht der Oeffentlichkeit fördern, ist nicht viel zu sagen. Es hat sich uns aus Humboldts Briefen ergeben, dass die Schrift in zwei Exemplaren vorhanden war, von denen sich während des Sommers 1792 das eine, das Original, in Schillers, das andre, eine Abschrift, in Biesters Händen befand. Ueber die Schicksale dieser Abschrift wissen wir nichts anzugeben, als dass sie an Humboldt zurückgekommen und dann abermals von ihm verliehen worden ist. [Vergl. die Briefe an Schiller vom 7. Decbr. 1792 und vom 18. Jan. 1793.] Das Original aber, um dessen Rücksendung Humboldt Schiller’n in dem Briefe vom 14. Jan. 1793 bittet, ist ebenfalls wieder in seine Hände gelangt, und es ist in seinem Besitze geblieben. In Ottmachau, jener schönen Besitzung in Schlesien, die Humboldt als Nationalbelohnung für die unsterblichen Verdienste erhielt, die er sich um die Wiederherstellung des Staates nach dem Falle von 1806 [XIII] erworben, auf der er in der letzten Epoche seines Lebens häufig verweilte, und die nach seinem Tode seinen Söhnen zufiel,[10] ist es kürzlich zum Vorschein gekommen. Es liegt der gegenwärtigen Veröffentlichung zu Grunde.
Dass wir wirklich das Original vor uns haben, darüber kann kein Zweifel sein. Erstlich zeigt die in gewissen Einzelheiten sehr charakteristische Handschrift die vollständigste Uebereinstimmung mit unzweifelhaft Humboldtschen Schriftzügen, namentlich mit denen des kürzlich vor den „Briefen an eine Freundin“ im Facsimile mitgetheilten Stammbuchsblattes vom Jahre 1788. Aber auch wenn man die unwahrscheinliche Annahme machen wollte, dass die Abschrift ebenfalls von Humboldt selbst hergerührt habe, würde man bei dem ersten Anblicke unsres Manuscripts namentlich durch die Natur der häufig in demselben vorkommenden Correkturen genöthigt sein anzuerkennen, dass die Worte desselben nicht nach einer vorliegenden Urschrift copirt, sondern nur unmittelbar aus dem Geiste in die Feder des Schreibenden geflossen sein können. Endlich liegt der schlagendste Beweis in einem übrigens sehr beklagenswerthen Umstande, nämlich in der Lücke, die sich in unsrem Manuscripte findet. — Sechs Bogen fehlen, — vom dritten bis zum achten, — dieselben, denen das in der Thalia gedruckte Stück des Aufsatzes entnommen ist. Es ist also klar, dass wir es mit demjenigen Manuscripte zu thun haben, welches sich in Schillers Händen befunden hat, und welches Humboldt sehr bestimmt als Urschrift von der Abschrift unterscheidet,— und dass die fehlenden Bogen von Schiller überhaupt nicht an Humboldt zurückgekommen sind.
Was nun die Lücke selbst betrifft, so ist sie trotz des Abdrucks in der Thalia in hohem Grade zu bedauern. Einmal ist der Abdruck kein durchaus getreuer gewesen. Vielmehr [XIV] hat Schiller mit dem Manuscripte einige Veränderungen vorgenommen, Aenderungen, die, wenn wir aus Humboldts Worten schliessen dürfen, welcher erklärt, dieselben mit innigem Vergnügen bemerkt zu haben und diesen Winken künftig folgen zu wollen [an Schiller. Auleben, 14. Januar 1793], nicht so ganz unerheblich waren. Es geht uns also die Möglichkeit verloren, zu ermitteln, wie viel von der Gestalt, die dieser Theil des Aufsatzes gegenwärtig hat, auf Schillers Rechnung zu setzen ist. — Allein noch ungleich schlimmer ist der Umstand, dass die Lücke durch den Abdruck in der Thalia zwar zum grössten Theile, aber doch nicht vollständig sich ausfüllen lässt. Das abgedruckte Stück fing weder genau mit dem Anfange des dritten Bogens an, noch hörte es genau mit dem Ende des achten auf. Es bleiben also auch jetzt noch zwei kleinere vor der Hand unausfüllbare Lücken übrig. Was ich über diese Lücken theils durch Feststellung des allgemeinen Raumverhältnisses von Druck und Manuscript zu einander, theils durch Vergleichung des der sorgfältig paginirten Handschrift von Humboldt selbst beigegebenen genauen Inhaltsverzeichnisses habe ermitteln können, ist Folgendes. Das in der Thalia gedruckte Stück kann kaum ganze 4 Bogen der Handschrift gefüllt haben. Zwei Bogen Manuscript und etwas darüber sind es also, die uns vollkommen fehlen. — Dies Fehlende (nach dem Maassstabe des gegenwärtigen Druckes 11—12 Seiten), vertheilt sich auf die beiden Lücken sehr ungleichmässig. Die erste ist von ausserordentlich geringer Ausdehnung und Erheblichkeit, indem das Manuscript bis pag. 14 reicht (das erste Blatt des ersten Bogens ist nämlich als Titelblatt nicht mitgezählt) und der Druck schon auf pag. 16 begonnen hat. Hier fehlen uns nur die wenigen Sätze, die dem ersten Abschnitte seinen formellen Abschluss geben, und dem Gedankengehalte nach haben wir an dieser Stelle kaum etwas zu entbehren. — Um so grösser ist dafür der Zwischenraum [XV] zwischen dem Ende des Druckes und dem Wiederbeginne des Manuscripts. Er beträgt nicht viel weniger als zwei Bogen des letzteren und führt eine sehr wesentliche und fühlbare Unterbrechung des Gedankenganges herbei. Wir müssen uns hier damit begnügen, aus dem Inhaltsverzeichnisse zu erkennen, welche Gedanken es seien, deren Ausführung wir zu entbehren haben.[11]
So schmerzlich nun auch namentlich diese letztere Lücke ist, so ist sie doch keinesweges der Art, dass sie von der Veröffentlichung des Gefundenen hätte können abstehen lassen. Vielmehr darf man sich vielleicht der Hoffnung hingeben, dass diese Veröffentlichung dahin führen wird, auch sie noch ausgefüllt zu sehn, sei es nun, dass der fehlende Theil unsres Manuscripts, sei es, dass die mehrerwähnte Abschrift durch Nachforschungen an den geeigneten Stellen zu Tage gefördert wird. Aber auch wenn diese Hoffnung getäuscht werden sollte, wird die gegenwärtige Veröffentlichung ein unschätzbarer Gewinn [XVI] für unsre Literatur bleiben. — Sie setzt die Nation in den beinahe vollständigen Besitz der ersten grösseren Schrift W. von Humboldts, einer Schrift, die ihrem Stoffe nach umfassender, in ihrem Inhalte von allgemeinerem Interesse, durch ihre Form zugänglicher ist, als alle seine späteren Hervorbringungen. Die bereits bekannten Abschnitte, bei deren Auswahl, wie sich aus den obigen Darlegungen ergeben haben wird, weder ein Urtheil über Werth und Unwerth der einzelnen Theile noch überhaupt irgend ein planmässiges Verfahren maassgebend gewesen ist, erhalten nun erst, da sie im Zusammenhange des Ganzen erscheinen, ihr rechtes Licht, und es treten andre verwandte Ausführungen neben sie, die, wie man hoffentlich finden wird, grossentheils in keinem Betracht hinter ihnen zurückzustehn verdienen.
Ich denke nicht, dass man diesen Erwägungen gegenüber die Rücksicht einer übel verstandenen Pietät gegen Humboldt wird geltend machen wollen, der ausgesprochner Maassen schon kurze Zeit nach Abfassung dieser Schrift ihre Veröffentlichung in der Gestalt, in welcher sie jetzt ans Licht tritt, unthunlich gefunden habe, und der ganz gewiss in der Zeit seiner vollen geistigen Reife eine solche noch viel weniger hätte gut heissen können. Humboldt hatte ganz recht, wenn er eine Schrift der Oeffentlichkeit vorenthielt, die er nicht mehr vertreten zu können meinte. Aber sollte die Nation weniger in ihrem Rechte sein, wenn sie sich begierig alle Hülfsmittel aneignet, die sich ihr zum Verständniss eines Mannes darbieten, der nun doch einmal mit Allem, was er geschaffen und gewirkt hat, längst ihr Eigenthum geworden ist? Und von diesem Rechte Gebrauch zu machen, konnte um so weniger einem Bedenken unterliegen, als, wie sich von selbst versteht, dieser Mann dabei wahrlich keinen Schaden leidet. Das ist ja eben das Grosse an Erscheinungen von Humboldts Art, dass unsre Bewunderung für sie wachsen muss mit jeder neuen Seite, von der sie sich uns [XVII] darstellen, mit jedem Schritte, den wir tiefer in das Verständniss ihres Wesens eindringen.
Es kann die Absicht nicht sein, an dieser Stelle in irgend erschöpfender Weise die Resultate zu ziehen, die sich aus dem Neuen der folgenden Blätter für die vollere Anschauung von Humboldts Individualität und Entwickelungsgang ergeben. Nur die Richtung, in der sie unsres Erachtens liegen werden, im Allgemeinen anzudeuten, sei uns erlaubt. Kleine Geister werden sich vielleicht darüber hermachen, emsig die einzelnen Widersprüche hervorzusuchen, in die Humboldts staatsmännische Wirksamkeit mit den Grundsätzen getreten ist, die in der vorliegenden Schrift über alle Theile des politischen Lebens ausgesprochen sind, um schliesslich mehr mit Behagen als mit Trauer das alte Lied anstimmen zu können, wie doch die Natur des Menschen so schwach, wie eitel und wandelbar seine Entschlüsse seien. Gönnen wir diese traurige Genugthuung denen, die das Grosse verkleinern müssen, um es nach ihrem Maasse messen zu können. Es verlohnt sich kaum der Mühe, einer so armseligen Auffassung gegenüber die innere Uebereinstimmung durzuthun, die sich durch Humboldts ganzes Leben hindurchzieht. Der Mann, der, als er in der Zeit der schwersten Drangsale die Sorge für das geistige Gedeihen des Volkes übernommen hatte, mit dem schönsten Erfolge für die Wiedererweckung des betäubten Nationalgeistes wirkte und der in einem Zustande, in welchem es kaum möglich schien, das Leben des Staates zu fristen, die Mittel zu dauernden Schöpfungen zu finden wusste; der dann in wechselnden Stellungen in Jahre langer unermüdeter Thätigkeit Alles daran setzte, der Nation die äusseren und inneren Bedingungen einer gesunden, freien, entwickelungsfähigen Existenz zu schaffen; — der Mann hatte wahrlich, da er nun in demselben Augenblicke, in dem in unsren vaterländischen Verhältnissen die entschiedene Wendung zum Schlimmeren eingetreten war, wieder sich selbst zu leben [XVIII] anfing, keine Ursache, die Erinnerung an die Ideale zu fliehen, denen er einst in der vorliegenden Schrift Ausdruck gegeben hatte.[12] — Mit denselben Worten fast, mit denen er am Schlusse derselben den Geist bezeichnet, aus dem heraus er sie geschrieben habe, könnte man treffend das Wesen seiner politischen Laufbahn charakterisiren. Wenn Humboldt gegen das Ende seines Lebens in einem seiner schönen Sonnette mit innerster Befriedigung von sich sagte, dass er seiner Jugend treu geblieben sei, dass er Einheit in des Geistes Streben bewahrt habe, so wird kein Einsichtiger ihm auf Grund der vorliegenden Schrift das Recht zu solchem Ausspruche streitig machen wollen. Er hat in Wahrheit „fromm und treu der Jugend Genius sein Herz führen lassen.“
Worein wir nun aber eigentlich den Hauptgewinn setzen, der sich aus der hier mitgetheilten Schrift für Humboldts Verständniss ergiebt, — das ist, dass eben der Genius seiner Jugend, der ihn durchs Leben geführt, in all seiner Frische und Ursprünglichkeit uns hier zum ersten Male näher tritt. [XIX] Humboldt selbst, indem er sich der Uebereinstimmung rühmt, in der er mit seiner Jugend geblieben sei, unterscheidet doch eben diese Jugend sehr nachdrücklich von allen anderen Lebensepochen: „Die Gefühle, die heiligten der Jugend Blüthenweihe. — — — Denn von den duft’gen Lebenskränzen allen Am duftigsten der Kranz der Jugend schwillet.“ Diese Weihezeit in Humboldts Leben, die er selbst im Alter in so schönen und rührenden Worten feierte, war uns bisher so gut wie verschlossen. Hier bietet sich uns nun eine duftige Blüthe aus dem Kranze seiner Jugend dar.
Varnhagen [13] hat an die Spitze der Charakteristik, die er uns von Humboldt giebt, ein Wort Rahels gestellt, Humboldt sei von keinem Alter gewesen und er hat seinerseits bestätigt, dass die verschiednen Lebensalter in ihm von geringer Kraft gewesen seien. Ich wage es ungern, dem Urtheil eines so bewährten Darstellers und eines Humboldt so nahe stehenden Mannes entgegenzutreten. Aber ich gestehe, dass, so wie uns jetzt Humboldts Geistesleben in einer langen Reihe von Documenten vorliegt, ich die Thatsachen doch damit einigermaassen im Widerspruche finde. Die Einheit in Humboldt’s Wesen wäre nicht so sehr zu bewundern, wenn sie nicht in einer so grossen Mannigfaltigkeit von Erscheinungsformen und Entwickelungsphasen zur Darstellung gekommen wäre. Der Kampf gegen die Hemmungen, die in der Enge, Unfreiheit und Einförmigkeit unsrer modernen Zustände für die energische und allseitige Entfaltung der Individualitäten liegen, ist das grosse Grundthema des vorliegenden Aufsatzes. Man darf sagen, dass kaum einer der Neueren diese Hemmungen an sich selbst weniger erfahren hat, als Humboldt, dass kaum in einem Zweiten eine gleich edle und tiefe Anlage gleich sehr und dauernd von allen Bedingungen des Gedeihens begünstigt war, dass [XX] kaum je gleich schöne Kräfte zu gleich schöner Wirksamkeit gekommen sind. Das ist es, was dem Drama seines Lebens jene wahrhaft idealische Vollendung gegeben hat, die wir sonst nur an den Gestalten des Alterthums zu finden gewohnt sind, ja was ihn diese selbst überragen lässt in dem, worin überhaupt die moderne Welt üher das Alterthum hinausgegangen ist, — in der Vertiefung des subjectiven Lebens. Unter den Momenten der Vollendung von Humboldts Wesen scheint mir nun eins der bedeutendsten das zu sein, dass es ihm, der sein Leben durch alle Altersstufen hindurchführte, vergönnt war, das Charakteristische einer jeden in einer recht eigentlich mustergültigen Weise auszuprägen. Woist der Mann, der bei einer solchen Rastlosigkeit im Denken, eine solche Entschlossenheit zur That, der zugleich so viel Energie im Handeln und so viel Virtuosität im Geniessen besessen hätte? wo der, dem zur Verwerthung aller dieser Fähigkeiten bessere Gelegenheiten entgegen gekommen wären, als ihm, der für die Tiefe und Schärfe seines Gedankens so grosse Objecte hatte in der Betheiligung an der gewaltigen geistigen Bewegung, die gegen Ende des vorigen Jahrhunderts unter unsrer Nation begonnen hatte; dem sich dann unter den glücklichsten Verhältnissen Italien darbot, das classische Land der Genüsse, der endlich für seine Thatkraft einen in Trümmer gefallenen Staat und in dem mächtig erwachenden Nationalgeiste den herrlichsten Stoff zum Neubau fand? Das waren Humboldts Mannesjahre. Vor noch nicht langer Zeit lagen diese allein in Wort und That offen vor uns. Seitdem seine „Sonnette,“ seine „Briefe an eine Freundin“ ans Licht getreten sind, sind wir auch mit seinem Greisenalter bekannt geworden. Man wird schwerlich irgendwo ein schöneres Bild dieser Lebensstufe aufweisen können, als es sich in jenen Briefen und Dichtungen darstellt, die den tiefsten Frieden athmen, über die eine sanfte Trauer ausgegossen ist, und die das Innere fast abgelöst von der Gegenwart und [XXI] getheilt zeigen zwischen der Erinnerung an die Vergangenheit und dem sehnsüchtigen Blicke in das Jenseits und doch wieder so, dass sich diese beiden Richtungen des Gedankens auf das rührendste in einander schlingen. Das Gegenstück zu diesem Bilde fehlte bis jetzt. Die vorliegende Schrift bietet es uns dar, indem sie eine umfassende Uebersicht der Gedanken und Strebungen giebt, welche Humboldts Jugend erfüllten. Es ist höchst anziehend, sie aus dem Gesichtspunkte dieses Contrastes zu betrachten als Ausgangspunkt seines inneren Lebens gegenüber dem Endpunkte desselben. So erst gewinnt man eine recht lebendige Anschauung der reichen und vollen Entwickelung, die zwischen dem einen und dem andren liegt. Welchen Wechsel der religiösen Stimmungen hat die Seele dieses Mannes durchlaufen müssen von dem prometheischen Selbstgefühle der Jugend bis zu der Hingebung und schmelzenden Weichheit des Alters .[14] Dort finden wir ihn mit der ganzen Energie des Gedankens gegen die Aussenwelt geworfen und in keckem Kampfe mit der Gesammtheit der bestehenden Zustände; — hier gegen Alles ausser ihm gleichgültig, ganz in sich gekehrt und versenkt; dort erfüllt von der Hoffnung durch äussere Veränderungen der Welt die Freiheit zu bringen; hier zufrieden mit der Gewissheit, in sich selber die Freiheit gefunden zu haben, die ihm noth thut. — Doch ich kann darauf [XXII] verzichten, die Reihe dieser Gegensätze, die sich Jedem von selbst darbieten, weiter fortzuführen. Nur eine Bemerkung will ich nicht unterdrücken, die sich mir aufdrängt, indem ich dies Jugendwerk Humboldts im Zusammenhange mit den Verhältnissen denke, unter denen es entstanden ist. Es war die erste bedeutendere Frucht der Musse, die er sich durch Aufgeben des Staatsdienstes geschaffen hatte. Wir begreifen nun, dass es einem Geiste, der sich mit solchen Entwürfen trug, in der Enge des Gerichtszimmers nicht hatte behagen können. Aber wir preisen auch den Mann glücklich, dem es vergönnt war, die Schranken zu vernichten, da sie kaum begonnen hatten, ihm fühlbar zu werden. Wie ist dagegen so manche edle Natur, die wohl nicht minder zukunftreiche Keime des Grossen und Schönen in sich getragen, — gezwungen, im Alter der Ideale in dem Joche des Alltagslebens zu ziehen, an demselben Conflicte zu Grunde gegangen, dem sich Humboldt mit leichter Mühe entziehen konnte. Den Kampf, den er als einen praktischen unter allgemeiner Missbilligung seiner Freunde durch einen so schnellen Rückzug abbrach, hat er dann in der vorliegenden Schrift als einen theoretischen wieder aufgenommen und mit Geist, Kühnheit und Feuer zu Ende geführt.
Eine wie grosse Bedeutung nun auch die Schrift nach dem Allen als ergänzendes Document für die Geschichte von Humboldts innerem Leben hat, so ist doch, wie sich von selbst versteht, das Interesse derselben damit keinesweges erschöpft. Ihr Werth liegt durchaus nicht ausschliesslich in dieser subjectiven Richtung. Von rein objectiven Gesichtspunkten aus betrachtet, stellt sie sich als eine nicht minder erhebliche Bereicherung unsrer Literatur dar. Nicht als ob der hier festgehaltene politische Standpunkt für unsre heutige Staatswissenschaft irgendwie maassgebend werden könnte. Diese Betrachtungsweise, welcher der Staat zuletzt doch nur wie ein nothwendiges Uebel erscheint, das man auf das möglichst [XXIII] geringe Maass zurückführen müsse, hat längst einer tieferen und wahreren Platz gemacht. — Wenn die wissenschaftliche Richtung, der Humboldt im Einklange mit seiner Zeit folgt, sich in dem Kampfe gegen den Staat als gegen eine fremde feindselige Gewalt erschöpft, — so hat dieser Kampf längst mit einem vollständigen theoretischen Siege geendigt, durch den aus der uns entgegenstehenden Macht unsere Macht geworden ist. Unser Ideal staatlicher Zustände liegt in einer ganz anderen Richtung, als das Humboldt’sche. — Nicht unseren Willen gegen die Gewalt des Staates sicher zu stellen, ist unser Ziel; das Ziel ist, ihn in die Staatsgewalt hineinzutragen. Nicht vom Staate, sondern im Staate wollen wir frei sein. Die politische Anschauungsweise der Gegenwart hat sich darin um ein gutes Theil der Denkart des Alterthums genähert, von der die moderne Staatstheorie wohl niemals weiter entfernt war, als grade in der Zeit, in welcher unsre Schrift entstanden ist, und gegen die das in derselben aufgestellte Ideal den directesten Gegensatz bildet. Humboldt selbst ist zu diesen tieferen Tendenzen fortgeschritten. Seine staatsmännische Thätigkeit legt davon Zeugniss ab, so weit sie darauf gerichtet war, Formen zu schaffen, durch die der Wille der Nation zur Geltung kommen sollte, — Formen, gegen die er auf seinem früheren politischen Standpunkte die vollkommenste Gleichgültigkeit an den Tag legt. Und wenn es gewiss ist, dass diese spätere politische Richtung Humboldts ungleich praktischer war, als seine früheren Ideen, — so muss man weiter sagen, dass sie es eben darum war, weil sie sich auf eine bessere Theorie gründete.
Wenn sonach der absolute Werth dieser „Ideen“ in Folge der mangelhaften Grundanschauung des Staats, auf der sie beruhen, nicht eben hoch anzuschlagen ist,[15] so ist, historisch [XXIV] betrachtet, die Stellung, die sie in dem geistigen Entwicklungsprocesse unsrer Nation einnehmen, eine um so merkwürdigere.
Diese „Ideen“ wurzeln ihrem speculativen Gehalte nach ganz und durchaus in der Kant’schen Philosophie. Nun bemerke man wohl, dass sie zu Papier gebracht worden sind kurz nachdem die Kritik der Urtheilskraft erschienen war (1790), die bekanntlich auch auf Schiller einen so mächtigen Einfluss übte. Mit diesem Werke hatte Kant sein System in sich abgeschlossen, und ging nun in seinen folgenden Schriften dazu [XXV] fort, dasselbe anzuwenden. Von allen diesen Schriften und Aufsätzen, durch die er seine Principien in die Gebiete des individuellen Lebens, der Rechts- und Staatsverhältnisse, der Religion hineintrug, war im Jahre 1792 noch nichts erschienen. Eben so wenig war damals schon irgend ein Anfang damit gemacht, die durch die strenge Zucht der Kant’schen Methode gestählte Denkkraft in freier und unabhängiger Weise zu handhaben. Schiller war noch mit keiner der philosophischen Arbeiten hervorgetreten, welche die Früchte seiner Vertiefung in das Studium Kants waren. Fichte’s Name wurde noch nicht genannt. Es waren die Jahre der unbedingten Herrschaft des Kant’schen Systems, der sich, wenn wir von F. H. Jacobi’s isolirter Erscheinung absehn, Alle willig fügten, die überhaupt von der geistigen Bewegung der Zeit ergriffen waren. Hält man sich diese Lage der Dinge gegenwärtig, so muss man in unserer Schrift die erste Bethätigung der wieder anhebenden Selbstständigkeit des Denkens erkennen. Und zwar macht sich diese Selbstständigkeit nach zwei Seiten hin geltend, einmal darin, dass Kants Grundsätze hier zuerst in Gebiete hineingetragen sind, die von dem Meister bis dahin noch nicht betreten waren; sodann darin, dass diese Grundsätze selbst hier zuerst sich zu vertiefen und zu verlebendigen beginnen. In ersterer Rücksicht ist es von ungemeinem Interesse, die Ansichten, die Kant in seinen späteren Schriften [16] über dieselben Materien entwickelt hat, zur Vergleichung heranzuziehen. Wie mir scheint, muss eine solche Vergleichung durchaus zu Humboldts Gunsten ausschlagen. — Er ist in der Anwendung von Kants Maximen auf das Recht und den Staat glücklicher gewesen, als der Urheber derselben; er hat ihn an [XXVI] Feinheit, Schärfe, Consequenz übertroffen. — Es würde uns zu weit führen, dieses Urtheil durch eine Zusammenstellung der beiderseitigen Raisonnements etwa über die Ehe, das Erbrecht, das Strafgesetz, über den Begriff der Staatsgewalt selber zu begründen.
Aber von noch ungleich grösserer Bedeutung ist die Humboldt’sche Schrift da, wo sie über Kant nicht in der Anwendung seiner Gedanken, sondern in ihrer Auffassung selbst hinausgeht. Zum Theil geschieht es in vollkommen bewusster Weise, und aus der Art, in der mehrmals auf Kant Bezug genommen wird, erkennt man durch die unbegränzte Bewunderung hindurch, die Humboldt ihm zollt, doch bereits deutlich ein durchaus freies und selbst kritisches Verhalten. Humboldt wahrt sich in den Fragen der Moral und Aesthetik sehr bestimmt die Selbstständigkeit seines Urtheils. Der Theorie, die Kant in der Kritik der Urtheilskraft von dem Wesen der schönen Künste und ihrer Rangordnung gegeben hat, stellt er seine eigne entgegen. Wer wollte leugnen, dass die letztere weit tiefer gegriffen und weit sinniger durchgeführt ist? Humboldt hat in den ästhetischen Andeutungen dieser Schrift bereits denselben Weg aus dem Kant’schen Systeme hinaus gefunden, den gleich nach ihm Schiller betrat, und auf dem sie dann Beide Hand in Hand zu so bedeutenden Resultaten gekommen sind. — Aber nicht minder, als in den ästhetischen Principien stellt diese Schrift in den moralischen einen bemerkenswerthen Fortschritt gegen Kant dar. Ja es ist in ihnen im Wesentlichen bereits Fichte’s Standpunkt erreicht. Indem Humboldt dazu kommt, die Energie die erste und einzige Tugend des Menschen zu nennen, womit zugleich die Trägheit als das eigentlich böse Princip in der menschlichen Natur bezeichnet ist, hat er in der That den Kernpunkt der Fichte’schen „Sittenlehre“ getroffen. Nur dass der Gedanke in unsrer Schrift sogleich eine Wendung auf das Politische bekommt.
Die öffentlichen Verhältnisse sollen so geordnet werden, [XXVII] dass sie die Energie der Individuen möglichst steigern, ihre Selbstthätigkeit auf recht vielfältige Weise herausfordern. In dieser Forderung liegt eigentlich die Summe des positiven Gehalts der ganzen Untersuchung, und von dieser Seite angesehn enthält sie eine grosse Lehre, die unter unsern heutigen Verhältnissen mehr an ihrem Platze ist, als sie es je früher gewesen wäre, und die von den segensreichsten Wirkungen sein könnte, wenn die Gegenwart in demselben Maasse für dieselbe empfänglich wäre, in dem sie ihrer bedürftig ist. Das Grundübel in den Wirren der letzten Jahre lag doch am Ende darin, dass die Bestrebungen, von denen die Massen in Bewegung gesetzt waren, das vollkommne Widerspiel des Humboldt’schen Freiheitsideales waren. Alles lief in ihnen auf Steigerung der Genüsse hinaus. Ein Jeder will es so bequem haben, wie möglich. Je weiter sich die Forderungen der politischen Schwärmer von heute und gestern von der Wirklichkeit entfernen, desto bestimmter tritt dies als ihr Grundzug hervor, und in letzter Instanz steigert sich diese Richtung zu dem Ideale eines gesellschaftlichen Zustandes, welcher der freien Bewegung der Individuen gar keinen Spielraum mehr lässt, in welchem Alles von dem Allgemeinen absorbirt, die Freiheit vollkommen der Wohlfahrt zum Opfer gebracht wird. Gegen den entnervenden Einfluss solcher Doctrinen, denen der Begriff der Individualität vollkommen verloren gegangen ist, möchten wir die gegenwärtige Schrift recht dringend als das heilsamste Gegengift empfehlen. Sie eignet sich für einen solchen Gebrauch eben darum so trefflich, weilihr Verfasser mit gleich radicaler Einseitigkeit in dem entgegengesetzten Extreme befangen ist. — Möchten von diesem edlen Geiste recht Viele lernen, die Freiheit nicht um der Genüsse willen zu lieben, die sie verspricht, sondern um der sittlichen Kraft willen, die sie zugleich fordert und schafft.
Breslau, 18. August 1850.
Dr. Eduard Cauer.
[1]
I.
Einleitung.↩
Bestimmung des Gegenstandes der Untersuchung. — Seltne Bearbeitung und Wichtigkeit desselben. — Historischer Blick auf die Gränzen, welche die Staaten ihrer Wirksamkeit wirklich gesetzt haben. — Unterschied der alten und neueren Staaten. — Zweck der Staatsverbindung überhaupt. — Streitfrage, ob derselbe allein in der Sorgfalt für die Sicherheit, oder für das Wohl der Nation überhaupt bestehen soll? — Gesetzgeber und Schriftsteller behaupten das Letztere. — Dennoch ist eine fernere Prüfung dieser Behauptung nothwendig. — Diese Prüfung muss von dem einzelnen Menschen und seinen höchsten Endzwecken ausgehen.
Wenn man die merkwürdigsten Staatsverfassungen mit einander, und mit ihnen die Meinungen der bewährtesten Philosophen und Politiker vergleicht; so wundert man sich vielleicht nicht mit Unrecht, eine Frage so wenig vollständig behandelt, und so wenig genau beantwortet zu finden, welche doch zuerst die Aufmerksamkeit an sich zu ziehen scheint, die Frage nämlich: zu welchem Zweck die ganze Staatseinrichtung hinarbeiten und welche Schranken sie ihrer Wirksamkeit setzen soll? Den verschiedenen Antheil, welcher der Nation, oder einzelnen ihrer Theile, an der Regierung gebührt, zu bestimmen, die mannigfaltigen Zweige der Staatsverwaltung gehörig zu vertheilen, und die nöthigen Vorkehrungen zu treffen, dass nicht ein Theil die Rechte des andern an sich reisse; damit allein haben sich fast alle beschäftigt, welche selbst Staaten umgeformt, oder Vorschläge zu politischen Reformationen gemacht haben. Dennoch müsste man, so dünkt mich, bei jeder neuen Staatseinrichtung zwei Gegenstände vor Augen haben, von welchen beiden keiner, ohne grossen Nachtheil übersehen werden dürfte: einmal die Bestimmung des herrschenden und dienenden Theils der Nation [2] und alles dessen, was zur wirklichen Einrichtung der Regierung gehört, dann die Bestimmung der Gegenstände, auf welche die einmal eingerichtete Regierung ihre Thätigkeit zugleich ausbreiten und einschränken muss. Dies Letztere, welches eigentlich in das Privatleben der Bürger eingreift und das Maass ihrer freien, ungehemmten Wirksamkeit bestimmt, ist in der That das wahre, letzte Ziel, das Erstere nur ein nothwendiges Mittel, dies zu erreichen. Wenn indess dennoch der Mensch dies Erstere mit mehr angestrengter Aufmerksamkeit verfolgt, so bewährt er dadurch den gewöhnlichen Gang seiner Thätigkeit. Nach Einem Ziele streben, und dies Ziel mit Aufwand physischer und moralischer Kraft erringen, darauf beruht das Glück des rüstigen, kraftvollen Menschen. Der Besitz, welcher die angestrengte Kraft der Ruhe übergiebt, reizt nur in der täuschenden Phantasie. Zwar existirt in der Lage des Menschen, wo die Kraft immer zur Thätigkeit gespannt ist, und die Natur um ihn her immer zur Thätigkeit reizt, Ruhe und Besitz in diesem Verstande nur in der Idee. Allein dem einseitigen Menschen ist Ruhe auch Aufhören Einer Aeusserung, und dem Ungebildeten giebt Ein Gegenstand nur zu wenigen Aeusserungen Stoff. Was man daher vom Ueberdruss am Besitze, besonders im Gebiete der feineren Empfindungen, sagt, gilt ganz und gar nicht von dem Ideale des Menschen, welches die Phantasie zu bilden vermag, im vollesten Sinne von dem ganz Ungebildeten, und in immer geringerem Grade, je näher immer höhere Bildung jenem Ideale führt. Wie folglich, nach dem Obigen, den Eroberer der Sieg höher freut, als das errungene Land, wie den Reformator die gefahrvolle Unruhe der Reformation höher, als der ruhige Genuss ihrer Früchte; so ist dem Menschen überhaupt Herrschaft reizender, als Freiheit, oder wenigstens Sorge für Erhaltung der Freiheit reizender, als Genuss derselben. Freiheit ist gleichsam nur die Möglichkeit einer unbestimmt mannigfaltigen Thätigkeit; Herrschaft, Regierung [3] überhaupt zwar eine einzelne, aber wirkliche Thätigkeit. Sehnsucht nach Freiheit entsteht daher nur zu oft erst aus dem Gefühle des Mangels derselben. Unläugbar bleibt es jedoch immer, dass die Untersuchung des Zwecks und der Schranken der Wirksamkeit des Staats eine grosse Wichtigkeit hat, und vielleicht eine grössere, als irgend eine andere politische. Dass sie allein gleichsam den letzten Zweck aller Politik betrifft, ist schon oben bemerkt worden. Allein sie erlaubt auch eine leichtere und mehr ausgebreitete Anwendung. Eigentliche Staatsrevolutionen, andere Einrichtungen der Regierung sind nie, ohne die Concurrenz vieler, oft sehr zufälliger Umstände möglich, und führen immer mannigfaltig nachtheilige Folgen mit sich. Hingegen die Gränzen der Wirksamkeit mehr ausdehnen oder einschränken kann jeder Regent — sei es in demokratischen, aristokratischen, oder monarchischen Staaten — still und unbemerkt, und er erreicht vielmehr seinen Endzweck nur um so sicherer, je mehr er auffallende Neuheit vermeidet. Die besten menschlichen Operationen sind diejenigen, welche die Operationen der Natur am getreuesten nachahmen. Nun aber bringt der Keim, welchen die Erde still und unbemerkt empfängt, einen reicheren und holderen Segen, als der gewiss nothwendige, aber immer auch mit Verderben begleitete Ausbruch tobender Vulkane. Auch ist keine andere Art der Reform unserm Zeitalter so angemessen, wenn sich dasselbe wirklich mit Recht eines Vorzugs an Kultur und Aufklärung rühmt. Denn die wichtige Untersuchung der Gränzen der Wirksamkeit des Staats muss — wie sich leicht voraussehen lässt — auf höhere Freiheit der Kräfte und grössere Mannigfaltigkeit der Situationen führen. Nun aber erfordert die Möglichkeit eines höheren Grades der Freiheit immer einen gleich hohen Grad der Bildung und das geringere Bedürfniss, gleichsam in einförmigen, verbundenen Massen zu handeln, eine grössere Stärke und einen mannigfaltigeren Reichthum [4] der handelnden Individuen. Besitzt daher das gegenwärtige Zeitalter einen Vorzug an dieser Bildung, dieser Stärke und diesem Reichthum, so muss man ihm auch die Freiheit gewähren, auf welche derselbe mit Recht Anspruch macht. Ebenso sind die Mittel, durch welche die Reform zu bewirken stände, einer fortschreitenden Bildung, wenn wir eine solche annehmen, bei weitem angemessener. Wenn sonst das gezückte Schwerdt der Nation die physische Macht des Beherrschers beschränkt, so besiegt hier Aufklärung und Kultur seine Ideen und seinen Willen; und die umgeformte Gestalt der Dinge scheint mehr sein Werk, als das Werk der Nation zu sein. Wenn es nun schon ein schöner, seelenerhebender Anblick ist, ein Volk zu sehen, das im vollen Gefühl seiner Menschen- und Bürgerrechte seine Fesseln zerbricht; so muss — weil, was Neigung oder Achtung für das Gesetz wirkt, schöner und erhebender ist, als was Noth und Bedürfniss erpresst — der Anblick eines Fürsten ungleich schöner und erhebender sein, welcher selbst die Fesseln löst und Freiheit gewährt, und dies Geschäft nicht als Frucht seiner wohlthätigen Güte, sondern als Erfüllung seiner ersten, unerlässlichen Pflicht betrachtet. Zumal da die Freiheit, nach welcher eine Nation durch Veränderung ihrer Verfassung strebt, sich zu der Freiheit, welche der einmal eingerichtete Staat geben kann, eben so verhält, als Hoffnung zum Genuss, Anlage zur Vollendung.
Wirft man einen Blick auf die Geschichte der Staatsverfassungen; so würde es sehr schwierig sein, in irgend einer genau den Umfang zu zeigen, auf welchen sich ihre Wirksamkeit beschränkt, da man wohl in keiner hierin einem überdachten, auf einfachen Grundsätzen beruhenden Plane gefolgt ist. Vorzüglich hat man immer die Freiheit der Bürger aus einem zwiefachen Gesichtspunkte eingeengt, einmal aus dem Gesichtspunkte der Nothwendigkeit, die Verfassung entweder einzurichten, oder zu sichern; dann aus dem Gesichtspunkte [5] der Nützlichkeit, für den physischen oder moralischen Zustand der Nation Sorge zu tragen. Je mehr oder weniger die Verfassung, an und für sich mit Macht versehen, andere Stützen braucht; oder je mehr oder weniger die Gesetzgeber weit ausblickten, ist man bald mehr bei dem einen, bald bei dem andern Gesichtspunkte stehen geblieben. Oft haben auch beide Rücksichten vereint gewirkt. In den älteren Staaten sind fast alle Einrichtungen, welche auf das Privatleben der Bürger Bezug haben, im eigentlichsten Verstande politisch. Denn da die Verfassung in ihnen wenig eigentliche Gewalt besass, so beruhte ihre Dauer vorzüglich auf dem Willen der Nation, und es musste auf mannigfaltige Mittel gedacht werden, ihren Charakter mit diesem Willen übereinstimmend zu machen. Eben dies ist noch jetzt in kleinen republikanischen Staaten der Fall, und es ist daher völlig richtig, dass — aus diesem Gesichtspunkt allein die Sache betrachtet — die Freiheit des Privatlebens immer in eben dem Grade steigt, in welchem die öffentliche sinkt, da hingegen die Sicherheit immer mit dieser gleichen Schritt hält. Oft aber sorgten auch die ältern Gesetzgeber, und immer die alten Philosophen im eigentlichsten Verstande für den Menschen, und da am Menschen der moralische Werth ihnen das Höchste schien, so ist z. B. Platos Republik, nach Rousseaus äusserst wahrer Bemerkung, mehr eine Erziehungsals eine Staatsschrift. Vergleicht man hiermit die neuesten Staaten, so ist die Absicht, für den Bürger selbst und sein Wohl zu arbeiten, bei so vielen Gesetzen und Einrichtungen, die dem Privatleben eine oft sehr bestimmte Form geben, unverkennbar. Die grössere innere Festigkeit unserer Verfassungen, ihre grössere Unabhängigkeit von einer gewissen Stimmung des Charakters der Nation, dann der stärkere Einfluss bloss denkender Köpfe — die, ihrer Natur nach, weitere und grössere Gesichtspunkte zu fassen im Stande sind — eine Menge von Erfindungen, welche die gewöhnlichen Gegenstände [6] der Thätigkeit der Nation besser bearbeiten oder benutzen lehren, endlich und vor Allem gewisse Religionsbegriffe, welche den Regenten auch für das moralische und künftige Wohl der Bürger gleichsam verantwortlich machen, haben vereint dazu beigetragen, diese Veränderung hervorzubringen. Geht man aber der Geschichte einzelner Polizei-Gesetze und Einrichtungen nach, so findet man oft ihren Ursprung in dem bald wirklichen, bald angeblichen Bedürfniss des Staats, Abgaben von den Unterthanen aufzubringen, und insofern kehrt die Aehnlichkeit mit den älteren Staaten zurück, indem insofern diese Einrichtungen gleichfalls auf die Erhaltung der Verfassung abzwecken. Was aber diejenigen Einschränkungen betrifft, welche nicht sowohl den Staat, als die Individuen, die ihn ausmachen, zur Absicht haben; so ist und bleibt ein mächtiger Unterschied zwischen den älteren und neueren Staaten. Die Alten sorgten für die Kraft und Bildung des Menschen, als Menschen; die Neueren für seinen Wohlstand, seine Habe und seine Erwerbfähigkeit. Die Alten suchten Tugend, die Neueren Glückseligkeit. Daher waren die Einschränkungen der Freiheit in den älteren Staaten auf der einen Seite drückender und gefährlicher. Denn sie griffen geradezu an, was des Menschen eigenthümliches Wesen ausmacht, sein inneres Dasein; und daher zeigen alle älteren Nationen eine Einseitigkeit, welche (den Mangel an feinerer Kultur, und an allgemeinerer Kommunikation noch abgerechnet) grossentheils durch die fast überall eingeführte gemeinschaftliche Erziehung, und das absichtlich eingerichtete gemeinschaftliche Leben der Bürger überhaupt hervorgebracht und genährt wurde. Auf der andern Seite erhielten und erhöheten aber auch alle diese Staatseinrichtungen bei den Alten die thätige Kraft des Menschen. Selbst der Gesichtspunkt, den man nie aus den Augen verlor, kraftvolle und genügsame Bürger zu bilden, gab dem Geiste und dem Charakter einen höheren Schwung. [7] Dagegen wird zwar bei uns der Mensch selbst unmittelbar weniger beschränkt, als vielmehr die Dinge um ihn her eine einengende Form erhalten, und es scheint daher möglich, den Kampf gegen diese äusseren Fesseln mit innerer Kraft zu beginnen. Allein schon die Natur der Freiheitsbeschränkungen unserer Staaten, dass ihre Absicht bei weitem mehr auf das geht, was der Mensch besitzt, als auf das, was er ist, und dass selbst in diesem Fall sie nicht — wie die Alten — die physische, intellektuelle und moralische Kraft nur, wenn gleich einseitig, üben, sondern vielmehr ihr bestimmende Ideen, als Gesetze, aufdringen, unterdrückt die Energie, welche gleichsam die Quelle jeder thätigen Tugend, und die nothwendige Bedingung zu einer höheren und vielseitigeren Ausbildung ist. Wenn also bei den älteren Nationen grössere Kraft für die Einseitigkeit schadlos hielt; so wird in den neueren der Nachtheil der geringeren Kraft noch durch Einseitigkeit erhöht. Ueberhaupt ist dieser Unterschied zwischen den Alten und Neueren überall unverkennbar. Wenn in den letzteren Jahrhunderten die Schnelligkeit der gemachten Fortschritte, die Menge und Ausbreitung künstlicher Erfindungen, die Grösse der gegründeten Werke am meisten unsere Aufmerksamkeit an sich zieht; so fesselt uns in dem Alterthum vor Allem die Grösse, welche immer mit dem Leben Eines Menschen dahin ist, die Blüthe der Phantasie, die Tiefe des Geistes, die Stärke des Willens, die Einheit des ganzen Wesens, welche allein dem Menschen wahren Werth giebt. Der Mensch und zwar seine Kraft und seine Bildung war es, welche jede Thätigkeit rege machte; bei uns ist es nur zu oft ein ideelles Ganze, bei dem man die Individuen beinah zu vergessen scheint, oder wenigstens nicht ihr inneres Wesen, sondern ihre Ruhe, ihr Wohlstand, ihre Glückseligkeit. Die Alten suchten ihre Glückseligkeit in der Tugend, die Neueren sind nur zu lange diese aus jener zu entwickeln bemüht [8] gewesen;[17] und der selbst,[18] welcher die Moralität in ihrer höchsten Reinheit sah und darstellte, glaubt, durch eine sehr künstliche Maschinerie seinem Ideal des Menschen die Glückseligkeit, wahrlich mehr, wie eine fremde Belohnung, als wie ein eigen errungenes Gut, zuführen zu müssen. Ich verliere kein Wort über diese Verschiedenheit. Ich schliesse nur mit einer Stelle aus Aristoteles Ethik: „Was einem Jeden, seiner „Natur nach, eigenthümlich ist, ist ihm das Beste und Süsseste. „Daher auch den Menschen das Leben nach der Vernunft, „wenn nämlich darin am meisten der Mensch besteht, am mei„sten beseligt.[19] “
Schon mehr als Einmal ist unter den Staatsrechtslehrern gestritten worden, ob der Staat allein Sicherheit, oder überhaupt das ganze physische und moralische Wohl der Nation beabsichten müsse? Sorgfalt für die Freiheit des Privatlebens hat vorzüglich auf die erstere Behauptung geführt; indess die natürliche Idee, dass der Staat mehr, als allein Sicherheit gewähren könne, und ein Missbrauch in der Beschränkung der Freiheit wohl möglich, aber nicht nothwendig sei, der letzteren das Wort redete. Auch ist diese [9] unläugbar sowohl in der Theorie, als in der Ausführung die herrschende. Dies zeigen die meisten Systeme des Staatsrechts, die neueren philosophischen Gesetzbücher, und die Geschichte der Verordnungen der meisten Staaten. Ackerbau, Handwerke, Industrie aller Art, Handel, Künste und Wissenschaften selbst, alles erhält Leben und Lenkung vom Staat. Nach diesen Grundsätzen hat das Studium der Staatswissenschaften eine veränderte Gestalt erhalten, wie Kameral- und Polizeiwissenschaft z. B. beweisen, nach diesen sind völlig neue Zweige der Staatsverwaltung entstanden, Kameral-, Manufaktur- und Finanz-Kollegia. So allgemein indess auch dieses Princip sein mag; so verdient es, dünkt mich, doch noch allerdings eine nähere Prüfung, und diese Prü[fung muss von dem einzelnen Menschen und seinen höchsten Endzwecken ausgehen.]
II.
Betrachtung des einzelnen Menschen, und der höchsten Endzwecke des Daseins desselben. ↩
Der höchste und letzte Zweck jedes Menschen ist die höchste und proportionirlichste Ausbildung seiner Kräfte in ihrer individuellen Eigenthümlichkeit. — Die nothwendigen Bedingungen der Erreichung desselben: Freiheit des Handelns, und Mannigfaltigkeit der Situationen. — Nähere Anwendung dieser Sätze auf das innere Leben des Menschen. — Bestätigung derselben aus der Geschichte. — Höchster Grundsatz für die ganze gegenwärtige Untersuchung, auf welchen diese Betrachtungen führen.
Der wahre Zweck des Menschen, nicht der, welchen die wechselnde Neigung, sondern welchen die ewig unveränderliche Vernunft ihm vorschreibt — ist die höchste und proportionirlichste Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen. Zu dieser Bildung ist Freiheit die erste und unerlässliche Bedingung. Allein ausser der Freiheit erfordert die Entwickelung der [10] menschlichen Kräfte noch etwas anderes, obgleich mit der Freiheit eng verbundenes, — Mannigfaltigkeit der Situationen. Auch der freieste und unabhängigste Mensch, in einförmige Lagen versetzt, bildet sich minder aus. Zwar ist nun einestheils diese Mannigfaltigkeit allemal Folge der Freiheit, und anderntheils giebt es auch eine Art der Unterdrückung, die, statt den Menschen einzuschränken, den Dingen um ihn her eine beliebige Gestalt giebt, so dass beide gewissermassen Eins und dasselbe sind. Indess ist es der Klarheit der Ideen dennoch angemessener, beide noch von einander zu trennen. Jeder Mensch vermag auf Einmal nur mit Einer Kraft zu wirken, oder vielmehr sein ganzes Wesen wird auf Einmal nur zu Einer Thätigkeit gestimmt. Daher scheint der Mensch zur Einseitigkeit bestimmt, indem er seine Energie schwächt, sobald er sich auf mehrere Gegenstände verbreitet. Allein dieser Einseitigkeit entgeht er, wenn er die einzelnen, oft einzeln geübten Kräfte zu vereinen, den beinah schon verloschnen wie den erst künftig hell aufflammenden Funken in jeder Periode seines Lebens zugleich mitwirken zu lassen, und statt der Gegenstände, auf die er wirkt, die Kräfte, womit er wirkt, durch Verbindung zu vervielfältigen strebt. Was hier gleichsam die Verknüpfung der Vergangenheit und der Zukunft mit der Gegenwart wirkt, das wirkt in der Gesellschaft die Verbindung mit andern. Denn auch durch alle Perioden des Lebens erreicht jeder Mensch dennoch nur Eine der Vollkommenheiten, welche gleichsam den Charakter des ganzen Menschengeschlechts bilden. Durch Verbindungen also, die aus dem Innern der Wesen entspringen, muss einer den Reichthum des andern sich eigen machen. Eine solche charakterbildende Verbindung ist, nach der Erfahrung aller auch sogar der rohesten Nationen, z. B. die Verbindung der beiden Geschlechter. Allein wenn hier der Ausdruck, sowohl der Verschiedenheit, als der Sehnsucht nach der Vereinigung gewissermassen stärker ist: so ist [11] beides darum nicht minder stark, nur schwerer bemerkbar, obgleich eben darum auch mächtiger wirkend, auch ohne alle Rücksicht auf jene Verschiedenheit, und unter Personen desselben Geschlechts. Diese Ideen weiter verfolgt und genauer entwickelt, dürften vielleicht auf eine richtigere Erklärung des Phänomens der Verbindungen führen, welche bei den Alten, vorzüglich den Griechen, selbst die Gesetzgeber benutzten, und die man oft zu unedel mit dem Namen der gewöhnlichen Liebe, und immer unrichtig mit dem Namen der blossen Freundschaft belegt hat. Der bildende Nutzen solcher Verbindungen beruht immer auf dem Grade, in welchem sich die Selbstständigkeit der Verbundenen zugleich mit der Innigkeit der Verbindung erhält. Denn wenn ohne diese Innigkeit der eine den andern nicht genug aufzufassen vermag, so ist die Selbstständigkeit nothwendig, um das Aufgefasste gleichsam in das eigne Wesen zu verwandeln. Beides aber erfordert Kraft der Individuen, und eine Verschiedenheit, die, nicht zu gross, damit einer den andern aufzufassen vermöge, auch nicht zu klein ist, um einige Bewundrung dessen, was der andre besitzt, und den Wunsch rege zu machen, es auch in sich überzutragen. Diese Kraft nun und diese mannigfaltige Verschiedenheit vereinen sich in der Originalität, und das also, worauf die ganze Grösse des Menschen zuletzt beruht, wonach der einzelne Mensch ewig ringen muss, und was der, welcher auf Menschen wirken will, nie aus den Augen verlieren darf, ist Eigenthümlichkeit der Kraft und der Bildung. Wie diese Eigenthümlichkeit durch Freiheit des Handelns und Mannigfaltigkeit des Handelnden gewirkt wird; so bringt sie beides wiederum hervor. Selbst die leblose Natur, welche nach ewig unveränderlichen Gesetzen einen immer gleichmässigen Schritt hält, erscheint dem eigengebildeten Menschen eigenthümlicher. Er trägt gleichsam sich selbst in sie hinüber, und so ist es im höchsten Verstande wahr, dass jeder immer in eben dem Grade [12] Fülle und Schönheit ausser sich wahrnimmt, in welchem er beide im eignen Busen bewahrt. Wieviel ähnlicher aber noch muss die Wirkung der Ursache da sein, wo der Mensch nicht bloss empfindet und äussere Eindrücke auffasst, sondern selbst thätig wird?
Versucht man es, diese Ideen durch nähere Anwendungen auf den einzelnen Menschen, noch genauer zu prüfen; so reducirt sich in diesem alles auf Form und Materie. Die reinste Form mit der leichtesten Hülle nennen wir Idee, die am wenigsten mit Gestalt begabte Materie, sinnliche Empfindung. Aus der Verbindung der Materie geht die Form hervor. Je grösser die Fülle und Mannigfaltigkeit der Materie, je erhabener die Form. Ein Götterkind ist nur die Frucht unsterblicher Eltern. Die Form wird wiederum gleichsam Materie einer noch schöneren Form. So wird die Blüthe zur Frucht, und aus dem Saamenkorn der Frucht entspringt der neue, von neuem blüthenreiche Stamm. Je mehr die Mannigfaltigkeit zugleich mit der Feinheit der Materie zunimmt, desto höher die Kraft. Denn desto inniger der Zusammenhang. Die Form scheint gleichsam in die Materie, in die Materie die Form verschmolzen; oder, um ohne Bild zu reden, je ideenreicher die Gefühle des Menschen, und je gefühlvoller seine Ideen, desto unerreichbarer seine Erhabenheit. Denn auf diesem ewigen Begatten der Form und der Materie, oder des Mannigfaltigen mit der Einheit beruht die Verschmelzung der beiden im Menschen vereinten Naturen, und auf dieser seine Grösse. Aber die Stärke der Begattung hängt von der Stärke der Begattenden ab. Der höchste Moment des Menschen ist dieser Moment der Blüthe.[20] Die minder reizende, einfache Gestalt der Frucht weist gleichsam selbst auf die Schönheit der Blüthe hin, die sich durch sie entfalten soll. Auch eilt nur alles der Blüthe zu. [13] Was zuerst dem Saamenkorn entspriesst, ist noch fern von ihrem Reiz. Der volle dicke Stengel, die breiten, aus einander fallenden Blätter bedürfen noch einer mehr vollendeten Bildung. Stufenweise steigt diese, wie sich das Auge am Stamme erhebt; zartere Blätter sehnen sich gleichsam, sich zu vereinigen, und schliessen sich enger und enger, bis der Kelch das Verlangen zu stillen scheint.[21] Indess ist das Geschlecht der Pflanzen nicht von dem Schicksal gesegnet. Die Blüthe fällt ab, und die Frucht bringt wieder den gleich rohen, und gleich sich verfeinernden Stamm hervor. Wenn im Menschen die Blüthe welkt; so macht sie nur jener schönern Platz, und den Zauber der schönsten birgt unserm Auge erst die ewig unerforschbare Unendlichkeit. Was nun der Mensch von aussen empfängt, ist nur Saamenkorn. Seine energische Thätigkeit muss es, sei’s auch das schönste, erst auch zum seegenvollsten für ihn machen. Aber wohlthätiger ist es ihm immer in dem Grade, in welchem es kraftvoll, und eigen in sich ist. Das höchste Ideal des Zusammenexistirens menschlicher Wesen wäre mir dasjenige, in dem jedes nur aus sich selbst, und um seiner selbst willen sich entwickelte. Physische und moralische Natur würden diese Menschen schon noch an einander führen, und wie die Kämpfe des Kriegs ehrenvoller sind, als die der Arena, wie die Kämpfe erbitterter Bürger höheren Ruhm gewähren, als die getriebener Miethsoldaten; so würde auch das Ringen der Kräfte dieser Menschen die höchste Energie zugleich beweisen und erzeugen.
Ist es nicht eben das, was uns an das Zeitalter Griechenlands und Roms, und jedes Zeitalter allgemein an ein entfernteres, hingeschwundenes so namenlos fesselt? Ist es nicht vorzüglich, dass diese Menschen härtere Kämpfe mit dem Schicksal, härtere mit Menschen zu bestehen hatten? Dass die [14] grössere ursprüngliche Kraft und Eigenthümlichkeit einander begegnete, und neue wunderbare Gestalten schuf. Jedes folgende Zeitalter — und in wieviel schnelleren Graden muss dieses Verhältniss von jetzt an steigen? — muss den vorigen an Mannigfaltigkeit nachstehen, an Mannigfaltigkeit der Natur — die ungeheuren Wälder sind ausgehauen, die Moräste getrocknet u. s. f. — an Mannigfaltigkeit der Menschen, durch die immer grössere Mittheilung und Vereinigung der menschlichen Werke, durch die beiden vorigen Gründe.[22] Dies ist eine der vorzüglichsten Ursachen, welche die Idee des Neuen, Ungewöhnlichen, Wunderbaren so viel seltner, das Staunen, Erschrecken beinahe zur Schande, und die Erfindung neuer, noch unbekannter Hülfsmittel, selbst nur plötzliche, unvorbereitete und dringende Entschlüsse bei weitem seltner nothwendig macht. Denn theils ist das Andringen der äusseren Umstände gegen den Menschen, welcher mit mehr Werkzeugen, ihnen zu begegnen, versehen ist, minder gross; theils ist es nicht mehr gleich möglich, ihnen allein durch diejenigen Kräfte Widerstand zu leisten, welche die Natur jedem giebt, und die er nur zu benutzen braucht; theils endlich macht das ausgearbeitetere Wissen das Erfinden weniger nothwendig, und das Lernen stumpft selbst die Kraft dazu ab. Dagegen ist es unläugbar, dass, wenn die physische Mannigfaltigkeit geringer wurde, eine bei weitem reichere und befriedigendere intellectuelle und moralische an ihre Stelle trat, und dass Gradationen und Verschiedenheiten von unserm mehr verfeinten Geiste wahrgenommen, und unserm, wenn gleich nicht eben so stark gebildeten, doch reizbaren kultivirten Charakter ins praktische Leben übergetragen werden, die auch vielleicht den Weisen des Alterthums, oder doch wenigstens nur ihnen nicht unbemerkt geblieben wären. Es ist im ganzen Menschengeschlecht, wie im einzelnen Menschen [15] gegangen. Das Gröbere ist abgefallen, das Feinere ist geblieben. Und so wäre es ohne allen Zweifel seegenvoll, wenn das Menschengeschlecht Ein Mensch wäre, oder die Kraft eines Zeitalters ebenso als seine Bücher, oder Erfindungen auf das folgende überginge. Allein dies ist bei weitem der Fall nicht. Freilich besitzt nun auch unsere Verfeinerung eine Kraft, und die vielleicht jene gerade um den Grad ihrer Feinheit an Stärke übertrifft; aber es fragt sich, ob nicht die frühere Bildung durch das Gröbere immer vorangehen muss? Ueberall ist doch die Sinnlichkeit der erste Keim, wie der lebendigste Ausdruck alles Geistigen. Und wenn es auch nicht hier der Ort ist, selbst nur den Versuch dieser Erörterung zu wagen; so folgt doch gewiss soviel aus dem Vorigen, dass man wenigstens diejenige Eigenthümlichkeit und Kraft, nebst allen Nahrungsmitteln derselben, welche wir noch besitzen, sorgfältigst bewachen müsse.
Bewiesen halte ich demnach durch das vorige, dass die wahre Vernunft dem Menschen keinen andern Zustand als einen solchen wünschen kann, in welchem nicht nur jeder Einzelne der ungebundensten Freiheit geniesst, sich aus sich selbst, in seiner Eigenthümlichkeit zu entwickeln, sondern in welchem auch die physische Natur keine andre Gestalt von Menschenhänden empfängt, als ihr jeder Einzelne, nach dem Maasse seines Bedürfnisses und seiner Neigung, nur beschränkt durch die Gränzen seiner Kraft und seines Rechts, selbst und willkührlich giebt. Von diesem Grundsatz darf, meines Erachtens, die Vernunft nie mehr nachgeben, als zu seiner eignen Erhaltung selbst nothwendig ist. Er musste daher auch jeder Politik, und besonders der Beantwortung der Frage, von der hier die Rede ist, immer zum Grunde liegen.
[16]
III.
Uebergang zur eigentlichen Untersuchung. Eintheilung derselben. Sorgfalt des Staats für das positive, insbesondere physische, Wohl der Bürger. ↩
Umfang dieses Abschnitts. — Die Sorgfalt des Staats für das positive Wohl der Bürger ist schädlich. Denn sie — bringt Einförmigkeit hervor; — schwächt die Kraft; — stört und verhindert die Rückwirkung der äusseren, auch bloss körperlichen Beschäftigungen, und der äusseren Verhältnisse überhaupt auf den Geist und den Charakter der Menschen; — muss auf eine gemischte Menge gerichtet werden, und schadet daher den Einzelnen durch Maassregeln, welche auf einen jeden von ihnen, nur mit beträchtlichen Fehlern passen; — hindert die Entwickelung der Individualität und Eigenthümlichkeit des Menschen; — erschwert die Staatsverwaltung selbst, vervielfältigt die dazu erforderlichen Mittel, und wird dadurch eine Quelle mannigfaltiger Nachtheile; — verrückt endlich die richtigen und natürlichen Gesichtspunkte der Menschen, bei den wichtigsten Gegenständen. — Rechtfertigung gegen den Einwurf der Uebertreibung der geschilderten Nachtheile. — Vortheile des, dem eben bestrittenen entgegengesetzten Systems. — Höchster, aus diesem Abschnitt gezogener Grundsatz. — Mittel einer auf das positive Wohl der Bürger gerichteten Sorgfalt des Staats. — Schädlichkeit derselben. — Unterschied der Fälle, wenn etwas vom Staat, als Staat, und wenn dasselbe von einzelnen Bürgern gethan wird. — Prüfung des Einwurfs: ob eine Sorgfalt des Staats für das positive Wohl nicht nothwendig ist, weil es vielleicht nicht möglich ist, ohne sie, dieselben äussern Zwecke zu erreichen, dieselben nothwendigen Resultate zu erhalten? — Beweis dieser Möglichkeit, — vorzüglich durch freiwillige gemeinschaftliche Veranstaltungen der Bürger. — Vorzug dieser Veranstaltungen vor den Veranstaltungen des Staats.
In einer völlig allgemeinen Formel ausgedrückt, könnte man den wahren Umfang der Wirksamkeit des Staats alles dasjenige nennen, was er zum Wohl der Gesellschaft zu thun vermöchte, ohne jenen oben ausgeführten Grundsatz zu verletzen; und es würde sich unmittelbar hieraus auch die nähere Bestimmung ergeben, dass jedes Bemühen des Staats verwerflich sei, sich in die Privatangelegenheiten der Bürger überall da einzumischen, wo dieselben nicht unmittelbaren Bezug auf die Kränkung der Rechte des einen durch den andern haben. Indess ist es doch, um die vorgelegte Frage ganz zu [17] erschöpfen, nothwendig, die einzelnen Theile der gewöhnlichen oder möglichen Wirksamkeit der Staaten genau durchzugehen.
Der Zweck des Staats kann nämlich ein doppelter sein; er kann Glück befördern, oder nur Uebel verhindern wollen, und im letzteren Fall Uebel der Natur oder Uebel der Menschen. Schränkt er sich auf das letztere ein, so sucht er nur Sicherheit, und diese Sicherheit sei es mir erlaubt, einmal allen übrigen möglichen Zwecken, unter dem Namen des positiven Wohlstandes vereint entgegen zu setzen. Auch die Verschiedenheit der vom Staat angewendeten Mittel giebt seiner Wirksamkeit eine verschiedene Ausdehnung. Er sucht nämlich seinen Zweck entweder unmittelbar zu erreichen, sei’s durch Zwang — befehlende und verbietende Gesetze, Strafen — oder durch Ermunterung und Beispiel; oder mit allen, indem er entweder der Lage der Bürger eine demselben günstige Gestalt giebt, und sie gleichsam anders zu handeln hindert, oder endlich, indem er sogar ihre Neigung mit demselben übereinstimmend zu machen, auf ihren Kopf oder ihr Herz zu wirken strebt. Im ersten Falle bestimmt er zunächst nur einzelne Handlungen; im zweiten schon mehr die ganze Handlungsweise; und im dritten endlich, Charakter und Denkungsart. Auch ist die Wirkung der Einschränkung im ersten Falle am kleinsten, im zweiten grösser, im dritten am grössesten, theils weil auf Quellen gewirkt wird, aus welchen mehrere Handlungen entspringen, theils weil die Möglichkeit der Wirkung selbst mehrere Veranstaltungen erfordert. So verschieden indess hier gleichsam die Zweige der Wirksamkeit des Staats scheinen, so giebt es schwerlich eine Staatseinrichtung, welche nicht zu mehreren zugleich gehörte, da z. B. Sicherheit und Wohlstand so sehr von einander abhängen, und was auch nur einzelne Handlungen bestimmt, wenn es durch öftere Wiederkehr Gewohnheit hervorbringt, auf den Charakter wirkt. Es ist [18] daher sehr schwierig, hier eine, dem Gange der Untersuchung angemessene Eintheilung des Ganzen zu finden. Am besten wird es indess sein, zuvörderst zu prüfen, ob der Staat auch den positiven Wohlstand der Nation oder bloss ihre Sicherheit abzwecken soll, bei allen Einrichtungen nur auf das zu sehen, was sie hauptsächlich zum Gegenstande, oder zur Folge haben, und bei jedem beider Zwecke zugleich die Mittel zu prüfen, deren der Staat sich bedienen darf.
Ich rede daher hier von dem ganzen Bemühen des Staats, den positiven Wohlstand der Nation zu erhöhen, von aller Sorgfalt für die Bevölkerung des Landes, den Unterhalt der Einwohner, theils geradezu durch Armenanstalten, theils mittelbar durch Beförderung des Ackerbaues, der Industrie und des Handels, von allen Finanz- und Münzoperationen, Ein- und Ausfuhr-Verboten u. s. f. (in so fern sie diesen Zweck haben) endlich allen Veranstaltungen zur Verhütung oder Herstellung von Beschädigungen durch die Natur, kurz von jeder Einrichtung des Staats, welche das physische Wohl der Nation zu erhalten, oder zu befördern die Absicht hat. Denn da das Moralische nicht leicht um seiner selbst willen, sondern mehr zum Behuf der Sicherheit befördert wird, so komme ich zu diesem erst in der Folge.
Alle diese Einrichtungen nun, behaupte ich, haben nachtheilige Folgen, und sind einer wahren, von den höchsten, aber immer menschlichen Gesichtspunkten ausgehenden Politik unangemessen.
1. Der Geist der Regierung herrscht in einer jeden solchen Einrichtung, und wie weise und heilsam auch dieser Geist sei, so bringt er Einförmigkeit und eine fremde Handlungsweise in der Nation hervor. Statt dass die Menschen in Gesellschaft traten, um ihre Kräfte zu schärfen, sollten sie auch dadurch an ausschliessendem Besitz und Genuss verlieren; so erlangen sie Güter auf Kosten ihrer Kräfte. Gerade die [19] aus der Vereinigung Mehrerer entstehende Mannigfaltigkeit ist das höchste Gut, welches die Gesellschaft giebt, und diese Mannigfaltigkeit geht gewiss immer in dem Grade der Einmischung des Staats verloren. Es sind nicht mehr eigentlich die Mitglieder einer Nation, die mit sich in Gemeinschaft leben, sondern einzelne Unterthanen, welche mit dem Staat, d. h. dem Geiste, welcher in seiner Regierung herrscht, in Verhältniss kommen, und zwar in ein Verhältniss, in welchem schon die überlegene Macht des Staats das freie Spiel der Kräfte hemmt. Gleichförmige Ursachen haben gleichförmige Wirkungen. Je mehr also der Staat mitwirkt, desto ähnlicher ist nicht bloss alles Wirkende, sondern auch alles Gewirkte. Auch ist dies gerade die Absicht der Staaten. Sie wollen Wohlstand und Ruhe. Beide aber erhält man immer in eben dem Grade leicht, in welchem das Einzelne weniger mit einander streitet. Allein was der Mensch beabsichtet und beabsichten muss, ist ganz etwas anders, es ist Mannigfaltigkeit und Thätigkeit. Nur dies giebt vielseitige und kraftvolle Charaktere, und gewiss ist noch kein Mensch tief genug gesunken, um für sich selbst Wohlstand und Glück der Grösse vorzuziehen. Wer aber für andre so raisonniret, den hat man, und nicht mit Unrecht, in Verdacht, dass er die Menschheit miskennt, und aus Menschen Maschinen machen will.
2. Das wäre also die zweite schädliche Folge, dass diese Einrichtungen des Staats die Kraft der Nation schwächen. So wie durch die Form, welche aus der selbstthätigen Materie hervorgeht, die Materie selbst mehr Fülle und Schönheit erhält — denn was ist sie anders, als die Verbindung dessen, was erst stritt? eine Verbindung, zu welcher allemal die Auffindung neuer Vereinigungspunkte, folglich gleichsam eine Menge neuer Entdeckungen nothwendig ist, die immer in Verhältniss mit der grösseren, vorherigen Verschiedenheit steigt — eben so wird die Materie vernichtet durch diejenige, die man [20] ihr von aussen giebt. Denn das Nichts unterdrückt da das Etwas. Alles im Menschen ist Organisation. Was in ihm gedeihen soll, muss in ihm gesäet werden. Alle Kraft setzt Enthusiasmus voraus, und nur wenige Dinge nähren diesen so sehr, als den Gegenstand desselben als ein gegenwärtiges, oder künftiges Eigenthum anzusehen. Nun aber hält der Mensch das nie so sehr für sein, was er besitzt, als was er thut, und der Arbeiter, welcher einen Garten bestellt, ist vielleicht in einem wahreren Sinne Eigenthümer, als der müssige Schwelger, der ihn geniesst. Vielleicht scheint dies zu allgemeine Raisonnement keine Anwendung auf die Wirklichkeit zu verstatten. Vielleicht scheint es sogar, als diente vielmehr die Erweiterung vieler Wissenschaften, welche wir diesen und ähnlichen Einrichtungen des Staats, welcher allein Versuche im Grossen anzustellen vermag, vorzüglich danken, zur Erhöhung der intellectuellen Kräfte und dadurch der Kultur und des Charakters überhaupt. Allein nicht jede Bereicherung durch Kenntnisse ist unmittelbar auch eine Veredlung, selbst nur der intellectuellen Kraft, und wenn eine solche wirklich dadurch veranlasst wird, so ist dies nicht sowohl bei der ganzen Nation, als nur vorzüglich bei dem Theile, welcher mit zur Regierung gehört. Ueberhaupt wird der Verstand des Menschen doch, wie jede andere seiner Kräfte, nur durch eigne Thätigkeit, eigne Erfindsamkeit, oder eigne Benutzung fremder Erfindungen gebildet. Anordnungen des Staats aber führen immer, mehr oder minder, Zwang mit sich, und selbst, wenn dies der Fall nicht ist, so gewöhnen sie den Menschen zu sehr, mehr fremde Belehrung, fremde Leitung, fremde Hülfe zu erwarten, als selbst auf Auswege zu denken. Die einzige Art beinah, auf welche der Staat die Bürger belehren kann, besteht darin, dass er das, was er für das Beste erklärt, gleichsam das Resultat seiner Untersuchungen, aufstellt, und entweder direkt durch ein Gesetz, oder indirekt durch irgend eine, die Bürger [21] bindende Einrichtung anbefiehlt, oder durch sein Ansehn und ausgesetzte Belohnungen, oder andre Ermunterungsmittel dazu anreizt, oder endlich es bloss durch Gründe empfiehlt; aber welche Methode er von allen diesen befolgen mag, so entfernt er sich immer sehr weit von dem besten Wege des Lehrens. Denn dieser besteht unstreitig darin, gleichsam alle mögliche Auflösungen des Problems vorzulegen, um den Menschen nur vorzubereiten, die schicklichste selbst zu wählen, oder noch besser, diese Auflösung selbst nur aus der gehörigen Darstellung aller Hindernisse zu erfinden. Diese Lehrmethode kann der Staat bei erwachsenen Bürgern nur auf eine negative Weise, durch Freiheit, die zugleich Hindernisse entstehen lässt, und zu ihrer Hinwegräumung Stärke und Geschicklichkeit giebt; auf eine positive Weise aber nur bei den erst sich bildenden durch eine wirkliche Nationalerziehung befolgen. Eben so wird in der Folge der Einwurf weitläuftiger geprüft werden, der hier leicht entstehen kann, dass es nämlich bei Besorgung der Geschäfte, von welchen hier die Rede ist, mehr darauf ankomme, dass die Sache geschehe, als wie der, welcher sie verrichtet, darüber unterrichtet sei, mehr, dass der Acker wohl gebaut werde, als dass der Ackerbauer gerade der geschickteste Landwirth sei.
Noch mehr aber leidet durch eine zu ausgedehnte Sorgfalt des Staats die Energie des Handlens überhaupt, und der moralische Charakter. Dies bedarf kaum einer weiteren Ausführung. Wer oft und viel geleitet wird, kommt leicht dahin, den Ueberrest seiner Selbstthätigkeit gleichsam freiwillig zu opfern. Er glaubt sich der Sorge überhoben, die er in fremden Händen sieht, und genug zu thun, wenn er ihre Leitung erwartet und ihr folgt. Damit verrücken sich seine Vorstellungen von Verdienst und Schuld. Die Idee des ersteren feuert ihn nicht an, das quälende Gefühl der letzteren ergreift ihn seltener und minder wirksam, da er dieselbe bei weitem leichter auf seine [22] Lage, und auf den schiebt, der dieser die Form gab. Kommt nun noch dazu, dass er die Absichten des Staats nicht für völlig rein hält, dass er nicht seinen Vortheil allein, sondern wenigstens zugleich einen fremdartigen Nebenzweck beabsichtet glaubt, so leidet nicht allein die Kraft, sondern auch die Güte des moralischen Willens. Er glaubt sich nun nicht bloss von jeder Pflicht frei, welche der Staat nicht ausdrücklich auflegt, sondern sogar jeder Verbesserung seines eignen Zustandes überhoben, die er manchmal sogar, als eine neue Gelegenheit, welche der Staat benutzen möchte, fürchten kann. Und den Gesetzen des Staats selbst sucht er, soviel er vermag, zu entgehen, und hält jedes Entwischen für Gewinn. Wenn man bedenkt, dass bei einem nicht kleinen Theil der Nation die Gesetze und Einrichtungen des Staats gleichsam den Umfang der Moralität abzeichnen; so ist es ein niederschlagender Anblick, oft die heiligsten Pflichten und die willkührlichsten Anordnungen von demselben Munde ausgesprochen, ihre Verletzung nicht selten mit gleicher Strafe belegt zu sehen. Nicht minder sichtbar ist jener nachtheilige Einfluss in dem Betragen der Bürger gegen einander. Wie jeder sich selbst auf die sorgende Hülfe des Staats verlässt, so und noch weit mehr übergiebt er ihr das Schicksal seines Mitbürgers. Dies aber schwächt die Theilnahme, und macht zu gegenseitiger Hülfsleistung träger. Wenigstens muss die gemeinschaftliche Hülfe da am thätigsten sein, wo das Gefühl am lebendigsten ist, dass auf ihm allein alles beruhe, und die Erfahrung zeigt auch, dass gedrückte, gleichsam von der Regierung verlassene Theile eines Volks immer doppelt fest unter einander verbunden sind. Wo aber der Bürger kälter ist gegen den Bürger, da ist es auch der Gatte gegen den Gatten, der Hausvater gegen die Familie.
Sich selbst in allem Thun und Treiben überlassen, von jeder fremden Hülfe entblösst, die sie nicht selbst sich [23] verschafften, würden die Menschen auch oft, mit und ohne ihre Schuld, in Verlegenheit und Unglück gerathen. Aber das Glück, zu welchem der Mensch bestimmt ist, ist auch kein andres, als welches seine Kraft ihm verschafft; und diese Lagen gerade sind es, welche den Verstand schärfen, und den Charakter bilden. Wo der Staat die Selbstthätigkeit durch zu specielles Einwirken verhindert, da — entstehen etwa solche Uebel nicht? Sie entstehen auch da, und überlassen den einmal auf fremde Kraft sich zu lehnen gewohnten Menschen nun einem weit trostloseren Schicksal. Denn so wie Ringen und thätige Arbeit das Unglück erleichtern, so und in zehnfach höherem Grade erschwert es hoffnungslose, vielleicht getäuschte Erwartung. Selbst den besten Fall angenommen, gleichen die Staaten, von denen ich hier rede, nur zu oft den Aerzten, welche die Krankheit nähren und den Tod entfernen. Ehe es Aerzte gab, kannte man nur Gesundheit oder Tod.
3. Alles, womit sich der Mensch beschäftigt, wenn es gleich nur bestimmt ist, physische Bedürfnisse mittelbar oder unmittelbar zu befriedigen, oder überhaupt äussere Zwecke zu erreichen, ist auf das genaueste mit innern Empfindungen verknüpft. Manchmal ist auch, neben dem äusseren Endzweck, noch ein innerer, und manchmal ist sogar dieser der eigentlich beabsichtete, jener nur, nothwendig oder zufällig, damit verbunden. Je mehr Einheit der Mensch besitzt, desto freier entspringt das äussere Geschäft, das er wählt, aus seinem innern Sein; und desto häufiger und fester knüpft sich dieses an jenes da an, wo dasselbe nicht frei gewählt wurde. Daher ist der interessante Mensch in allen Lagen und allen Geschäften interessant; daher blüht er zu einer entzückenden Schönheit auf in einer Lebensweise, die mit seinem Charakter übereinstimmt.
So liessen sich vielleicht aus allen Bauern und Handwerkern Künstler bilden, d. h. Menschen, die ihr Gewerbe um [24] ihres Gewerbes willen liebten, durch eigen gelenkte Kraft und eigne Erfindsamkeit verbesserten, und dadurch ihre intellectuellen Kräfte kultivirten, ihren Charakter veredelten, ihre Genüsse erhöhten. So würde die Menschheit durch eben die Dinge geadelt, die jetzt, wie schön sie auch an sich sind, so oft dazu dienen, sie zu entehren. Je mehr der Mensch in Ideen und Empfindungen zu leben gewohnt ist, je stärker und feiner seine intellectuelle und moralische Kraft ist; desto mehr sucht er allein solche äussere Lagen zu wählen, welche zugleich dem innern Menschen mehr Stoff geben, oder denjenigen, in welche ihn das Schicksal wirft, wenigstens solche Seiten abzugewinnen. Der Gewinn, welchen der Mensch an Grösse und Schönheit einerntet, wenn er unaufhörlich dahin strebt, dass sein inneres Dasein immer den ersten Platz behaupte, dass es immer der erste Quell, und das letzte Ziel alles Wirkens, und alles Körperliche und Aeussere nur Hülle und Werkzeug desselben sei, ist unabsehlich.
Wie sehr zeichnet sich nicht, um ein Beispiel zu wählen, in der Geschichte der Charakter aus, welchen der ungestörte Landbau in einem Volke bildet. Die Arbeit, welche es dem Boden widmet, und die Ernte, womit derselbe es wieder belohnt, fesseln es süss an seinen Acker und seinen Heerd; Theilnahme der segenvollen Mühe und gemeinschaftlicher Genuss des Gewonnenen schlingen ein liebevolles Band um jede Familie, von dem selbst der mitarbeitende Stier nicht ganz ausgeschlossen wird. Die Frucht, die gesäet und geerntet werden muss, aber alljährlich wiederkehrt, und nur selten die Hoffnung täuscht, macht geduldig, vertrauend und sparsam; das unmittelbare Empfangen aus der Hand der Natur, das immer sich aufdringende Gefühl: dass, wenn gleich die Hand des Menschen den Saamen ausstreuen muss, doch nicht sie es ist, von welcher Wachsthum und Gedeihen kommt; die ewige Abhängigkeit von günstiger und ungünstiger Witterung, [25] flösst den Gemüthern bald schauderhafte, bald frohe Ahndungen höherer Wesen, wechselweis Furcht und Hoffnung ein, und führt zu Gebet und Dank; das lebendige Bild der einfachsten Erhabenheit, der ungestörtesten Ordnung, und der mildesten Güte bildet die Seelen einfach gross, sanft, und der Sitte und dem Gesetz froh unterworfen. Immer gewohnt hervorzubringen, nie zu zerstören, ist der Ackerbau friedlich, und von Beleidigung und Rache fern, aber erfüllt von dem Gefühl der Ungerechtigkeit eines ungereizten Angriffs und gegen jeden Störer seines Friedens mit unerschrockenem Muth beseelt.
Allein freilich ist Freiheit die nothwendige Bedingung, ohne welche selbst das seelenvollste Geschäft keine heilsamen Wirkungen dieser Art hervor zu bringen vermag. Was nicht von dem Menschen selbst gewählt, worin er auch nur eingeschränkt und geleitet wird, das geht nicht in sein Wesen über, das bleibt ihm ewig fremd, das verrichtet er nicht eigentlich mit menschlicher Kraft, sondern mit mechanischer Fertigkeit. Die Alten, vorzüglich die Griechen, hielten jede Beschäftigung, welche zunächst die körperliche Kraft angeht, oder Erwerbung äusserer Güter, nicht innere Bildung, zur Absicht hat, für schädlich und entehrend. Ihre menschenfreundlichsten Philosophen billigten daher die Sklaverei, gleichsam um durch ein ungerechtes und barbarisches Mittel einem Theile der Menschheit durch Aufopferung eines andern die höchste Kraft und Schönheit zu sichern. Allein den Irrthum, welcher diesem ganzen Raisonnement zum Grunde liegt, zeigen Vernunft und Erfahrung leicht. Jede Beschäftigung vermag den Menschen zu adeln, ihm eine bestimmte, seiner würdige Gestalt zu geben. Nur auf die Art, wie sie betrieben wird, kommt es an; und hier lässt sich wohl als allgemeine Regel annehmen, dass sie heilsame Wirkungen äussert, so lange sie selbst, und die darauf verwandte Energie vorzüglich die Seele füllt, minder wohlthätige, oft nachtheilige hingegen, wenn man mehr auf das [26] Resultat sieht, zu dem sie führt, und sie selbst nur als Mittel betrachtet. Denn alles, was in sich selbst reizend ist, erweckt Achtung und Liebe, was nur als Mittel Nutzen verspricht, bloss Interesse; und nun wird der Mensch durch Achtung und Liebe eben so sehr geadelt, als er durch Interesse in Gefahr ist, entehrt zu werden. Wenn nun der Staat eine solche positive Sorgfalt übt, als die, von der ich hier rede, so kann er seinen Gesichtspunkt nur auf die Resultate richten, und nun die Regeln feststellen, deren Befolgung der Vervollkommnung dieser am zuträglichsten ist.
Dieser beschränkte Gesichtspunkt richtet nirgends grösseren Schaden an, als wo der wahre Zweck des Menschen völlig moralisch, oder intellectuell ist, oder doch die Sache selbst, nicht ihre Folgen beabsichtet, und diese Folgen nur nothwendig oder zufällig damit zusammenhängen. So ist es bei wissenschaftlichen Untersuchungen, und religiösen Meinungen, so mit allen Verbindungen der Menschen unter einander, und mit der natürlichsten, die für den einzelnen Menschen, wie für den Staat, die wichtigste ist, mit der Ehe.
Eine Verbindung von Personen beiderlei Geschlechts, welche sich gerade auf die Geschlechtsverschiedenheit gründet, wie vielleicht die Ehe am richtigsten definirt werden könnte, lässt sich auf eben so mannigfaltige Weise denken, als mannigfaltige Gestalten die Ansicht jener Verschiedenheit, und die, aus derselben entspringenden Neigungen des Herzens und Zwecke der Vernunft anzunehmen vermögen; und bei jedem Menschen wird sein ganzer moralischer Charakter, vorzüglich die Stärke, und die Art seiner Empfindungskraft darin sichtbar sein. Ob der Mensch mehr äussere Zwecke verfolgt, oder lieber sein innres Wesen beschäftigt? ob sein Verstand thätiger ist oder sein Gefühl? ob er lebhaft umfasst und schnell verlässt; oder langsam eindringt und treu bewahrt? ob er losere Bande knüpft, oder sich enger anschliesst? ob er bei der innigsten [27] Verbindung mehr oder minder Selbstständigkeit behält? und eine unendliche Menge andrer Bestimmungen modifiziren anders und anders sein Verhältniss im ehelichen Leben. Wie dasselbe aber auch immer bestimmt sein mag; so ist die Wirkung davon auf sein Wesen und seine Glückseligkeit unverkennbar, und ob der Versuch die Wirklichkeit nach seiner innern Stimmung zu finden oder zu bilden, glücke oder misslinge? davon hängt grösstentheils die höhere Vervollkommnung, oder die Erschlaffung seines Wesens ab. Vorzüglich stark ist dieser Einfluss bei den interessantesten Menschen, welche am zartesten und leichtesten auffassen, und am tiefsten bewahren. Zu diesen kann man mit Recht im Ganzen mehr das weibliche, als das männliche Geschlecht rechnen, und daher hängt der Charakter des ersteren am meisten von der Art der Familienverhältnisse in einer Nation ab. Von sehr vielen äusseren Beschäftigungen gänzlich frei; fast nur mit solchen umgeben, welche das innere Wesen beinah ungestört sich selbst überlassen; stärker durch das, was sie zu sein, als was sie zu thun vermögen; ausdrucksvoller durch die stille, als die geäusserte Empfindung; mit aller Fähigkeit des unmittelbarsten, zeichenlosesten Ausdrucks, bei dem zarteren Körperbau, dem beweglicheren Auge, der mehr ergreifenden Stimme, reicher versehen; im Verhältniss gegen andre mehr bestimmt, zu erwarten und aufzunehmen, als entgegen zu kommen; schwächer für sich, und doch nicht darum, sondern aus Bewunderung der fremden Grösse und Stärke inniger anschliessend; in der Verbindung unaufhörlich strebend, mit dem vereinten Wesen zu empfangen, das Empfangene in sich zu bilden, und gebildet zurück zu geben; zugleich höher von dem Muthe beseelt, welchen Sorgfalt der Liebe, und Gefühl der Stärke einflösst, die nicht dem Widerstande aber dem Erliegen im Dulden trotzt — sind die Weiber eigentlich dem Ideale der Menschheit näher, als der Mann; und wenn es nicht unwahr ist, [28] dass sie es seltner erreichen, als er, so ist es vielleicht nur, weil es überall schwerer ist, den unmittelbaren steilen Pfad, als den Umweg zu gehen. Wie sehr aber nun ein Wesen, das so reizbar, so in sich Eins ist, bei dem folglich nichts ohne Wirkung bleibt, und jede Wirkung nicht einen Theil sondern das Ganze ergreift, durch äussre Missverhältnisse gestört wird, bedarf nicht ferner erinnert zu werden. Dennoch hängt von der Ausbildung des weiblichen Charakters in der Gesellschaft so unendlich viel ab. Wenn es keine unrichtige Vorstellung ist, dass jede Gattung der Trefflichkeit sich — wenn ich so sagen darf — in einer Art der Wesen darstellt; so bewahrt der weibliche Charakter den ganzen Schatz der Sittlichkeit.
Nach Freiheit strebt der Mann, das Weib nach Sitte (†),[23]
und wenn, nach diesem tief und wahr empfundenen Ausspruch des Dichters, der Mann sich bemüht, die äusseren Schranken zu entfernen, welche dem Wachsthum hinderlich sind, so zieht die sorgsame Hand der Frauen die wohlthätige innere, in welcher allein die Fülle der Kraft sich zur Blüthe zu läutern vermag, und zieht sie um so feiner, als die Frauen das innre Dasein des Menschen tiefer empfinden, seine mannigfaltigen Verhältnisse feiner durchschauen, als ihnen jeder Sinn am willigsten zu Gebote steht, und sie des Vernünftelns überhebt, das so oft die Wahrheit verdunkelt.
Sollte es noch nothwendig scheinen, so würde auch die Geschichte diesem Raisonnement Bestätigung leihen, und die Sittlichkeit der Nationen mit der Achtung des weiblichen Geschlechts überall in enger Verbindung zeigen. Es erhellt demnach aus dem Vorigen, dass die Wirkungen der Ehe eben so mannigfaltig sind, als der Charakter der Individuen; und dass es also die nachtheiligsten Folgen haben muss, wenn der [29] Staat eine, mit der jedesmaligen Beschaffenheit der Individuen so eng verschwisterte Verbindung, durch Gesetze zu bestimmen, oder durch seine Einrichtungen, von andern Dingen, als von der blossen Neigung, abhängig zu machen versucht. Dies muss um so mehr der Fall sein, als er bei diesen Bestimmungen beinah nur auf die Folgen, auf Bevölkerung, Erziehung der Kinder u. s. f. sehen kann. Zwar lässt sich gewiss darthun, dass […]eben diese Dinge auf dieselben Resultate mit der höchsten Sorgfalt für das schönste innere Dasein führen. Denn bei sorgfältig angestellten Versuchen, hat man die ungetrennte, dauernde Verbindung Eines Mannes mit Einer Frau der Bevölkerung am zuträglichsten gefunden, und unläugbar entspringt gleichfalls keine andre aus der wahren, natürlichen, unverstimmten Liebe. Eben so wenig führt diese ferner auf andre, als eben die Verhältnisse, welche die Sitte und das Gesetz bei uns mit sich bringen; Kindererzeugung, eigne Erziehung, Gemeinschaft des Lebens, zum Theil der Güter, Anordnung der äussern Geschäfte durch den Mann, Verwaltung des Hauswesens durch die Frau. Allein, der Fehler scheint mir darin zu liegen, dass das Gesetz befiehlt, da doch ein solches Verhältniss nur aus Neigung, nicht aus äussern Anordnungen entstehn kann, und wo Zwang oder Leitung der Neigung widersprechen, diese noch weniger zum rechten Wege zurückkehrt. Daher, dünkt mich, sollte der Staat nicht nur die Bande freier und weiter machen, sondern — wenn es mir erlaubt ist, hier, wo ich nicht von der Ehe überhaupt, sondern einem einzelnen, bei ihr sehr in die Augen fallenden Nachtheil einschränkender Staatseinrichtungen rede, allein nach den im Vorigen gewagten Behauptungen zu entscheiden — überhaupt von der Ehe seine ganze Wirksamkeit entfernen, und dieselbe vielmehr der freien Willkühr der Individuen, und der von ihnen errichteten mannigfaltigen Verträge, sowohl überhaupt, als in ihren Modifikationen, gänzlich [30] überlassen. Die Besorgniss, dadurch alle Familienverhältnisse zu stören, oder vielleicht gar ihre Entstehung überhaupt zu verhindern — so gegründet dieselbe auch, bei diesen oder jenen Lokalumständen, sein möchte — würde mich, in so fern ich allein auf die Natur der Menschen und Staaten im Allgemeinen achte, nicht abschrecken. Denn nicht selten zeigt die Erfahrung, dass gerade, was das Gesetz löst, die Sitte bindet; die Idee des äussern Zwangs ist einem, allein auf Neigung und innrer Pflicht beruhenden Verhältniss, wie die Ehe, völlig fremdartig; und die Folgen zwingender Einrichtungen entsprechen der Absicht schlechterdings nicht.
[4. Die Sorgfalt des Staats für das positive Wohl der Bürger ist ferner darum schädlich, weil sie auf eine gemischte Menge gerichtet werden muss, und daher den Einzelnen durch Maassregeln schadet, welche auf einen Jeden von ihnen nur mit beträchtlichen Fehlern passen.
5. Sie hindert die Entwicklung der Individualität und Eigenthümlichkeit des Menschen] . . . . . . . . . . . . . . . in dem moralischen und überhaupt praktischen Leben des Menschen, sofern er nur auch hier gleichsam die Regeln beobachtet — die sich aber vielleicht allein auf die Grundsätze des Rechts beschränken — überall den höchsten Gesichtspunkt der eigenthümlichsten Ausbildung seiner selbst und anderer vor Augen hat, überall von dieser reinen Absicht geleitet wird, und vorzüglich jedes andere Interesse diesem ohne alle Beimischung sinnlicher Beweggründe erkannten Gesetze unterwirft. Allein alle Seiten, welche der Mensch zu kultiviren vermag, stehen in einer wunderbar engen Verknüpfung, und wenn schon in der intellektuellen Welt der Zusammenhang wenn nicht inniger, doch wenigstens deutlicher und bemerkbarer ist, als in der physischen; so ist er es noch bei weitem mehr in der moralischen. Daher müssen sich die Menschen unter einander verbinden, nicht um an Eigenthümlichkeit, aber an ausschliessendem Isolirtsein [31] zu verlieren; die Verbindung muss nicht ein Wesen in das andre verwandeln, aber gleichsam Zugänge von einem zum andern eröffnen; was jeder für sich besitzt, muss er mit dem, von andern Empfangenen vergleichen, und danach modificiren, nicht aber dadurch unterdrücken lassen. Denn wie in dem Reiche des Intellektuellen nie das Wahre, so streitet in dem Gebiete der Moralität nie das des Menschen wahrhaft Würdige mit einander; und enge und mannigfaltige Verbindungen eigenthümlicher Charaktere mit einander sind daher eben so nothwendig, um zu vernichten, was nicht neben einander bestehen kann, und daher auch für sich nicht zu Grösse und Schönheit führt, als das, dessen Dasein gegenseitig ungestört bleibt, zu erhalten, zu nähren, und zu neuen, noch schöneren Geburten zu befruchten. Daher scheint ununterbrochenes Streben, die innerste Eigenthümlichkeit des andern zu fassen, sie zu benutzen, und, von der innigsten Achtung für sie, als die Eigenthümlichkeit eines freien Wesens, durchdrungen, auf sie zu wirken — ein Wirken, bei welchem jene Achtung nicht leicht ein andres Mittel erlauben wird, als sich selbst zu zeigen und gleichsam vor den Augen des andern mit ihm zu vergleichen — der höchste Grundsatz der Kunst des Umganges, welche vielleicht unter allen am meisten bisher noch vernachlässigt worden ist. Wenn aber auch diese Vernachlässigung leicht eine Art der Entschuldigung davon borgen kann, dass der Umgang eine Erholung nicht eine mühevolle Arbeit sein soll, und dass leider sehr vielen Menschen kaum irgend eine interessante eigenthümliche Seite abzugewinnen ist; so sollte doch jeder zu viel Achtung für sein eignes Selbst besitzen, um eine andre Erholung, als den Wechsel interessanter Beschäftigung, und noch dazu eine solche zu suchen, welche gerade seine edelsten Kräfte unthätig lässt, und zu viel Ehrfurcht für die Menschheit, um auch nur Eins ihrer Mitglieder für völlig unfähig zu erklären, benutzt, oder durch Einwirkung anders modificirt zu [32] werden. Wenigstens aber darf derjenige diesen Gesichtspunkt nicht übersehen, welcher sich Behandlung der Menschen und Wirken auf sie zu einem eigentlichen Geschäft macht, und insofern folglich der Staat, bei positiver Sorgfalt auch nur für das, mit dem innern Dasein immer eng verknüpfte äussere und physische Wohl, nicht umhin kann, der Entwickelung der Individualität hinderlich zu werden, so ist dies ein neuer Grund eine solche Sorgfalt nie, ausser dem Fall einer absoluten Nothwendigkeit, zu verstatten.
Dies möchten etwa die vorzüglichsten nachtheiligen Folgen sein, welche aus einer positiven Sorgfalt des Staats für den Wohlstand der Bürger entspringen, und die zwar mit gewissen Arten der Ausübung derselben vorzüglich verbunden, aber überhaupt doch von ihr meines Erachtens nicht zu trennen sind. Ich wollte jetzt nur von der Sorgfalt für das physische Wohl reden, und gewiss bin ich auch überall von diesem Gesichtspunkte ausgegangen, und habe alles genau abgesondert, was sich nur auf das moralische allein bezieht. Allein ich erinnerte gleich anfangs, dass der Gegenstand selbst keine genaue Trennung erlaubt, und dies möge also zur Entschuldigung dienen, wenn sehr Vieles des im Vorigen entwickelten Raisonnements von der ganzen positiven Sorgfalt überbaupt gilt. Ich habe indess bis jetzt angenommen, dass die Einrichtungen des Staats, von welchen ich hier rede, schon wirklich getroffen wären, und ich muss daher noch von einigen Hindernissen reden, welche sich eigentlich bei der Anordnung selbst zeigen.
6. Nichts wäre gewiss bei dieser so nothwendig, als die Vortheile, die man beabsichtet, gegen die Nachtheile, und vorzüglich gegen die Einschränkungen der Freiheit, welche immer damit verbunden sind, abzuwägen. Allein eine solche Abwägung lässt sich nur sehr schwer, und genau und vollständig vielleicht schlechterdings nicht zu Stande bringen. Denn jede einschränkende Einrichtung kollidirt mit [33] der freien und natürlichen Aeusserung der Kräfte, bringt bis ins Unendliche gehend neue Verhältnisse hervor, und so lässt sich die Menge der folgenden, welche sie nach sich zieht, (selbst den gleichmässigsten Gang der Begebenheiten angenommen, und alle irgend wichtige unvermuthete Zufälle, die doch nie fehlen, abgerechnet) nicht voraussehen. Jeder, der sich mit der höheren Staatsverwaltung zu beschäftigen Gelegenheit hat, fühlt gewiss aus Erfahrung, wie wenig Maassregeln eigentlich eine unmittelbare, absolute, wie viele hingegen eine bloss relative, mittelbare, von andern vorhergegangenen abhängende Nothwendigkeit haben. Dadurch wird daher eine bei weitem grössere Menge von Mitteln nothwendig, und eben diese Mittel werden der Erreichung des eigentlichen Zweckes entzogen. Nicht allein dass ein solcher Staat grösserer Einkünfte bedarf, sondern er erfordert auch künstlichere Anstalten zur Erhaltung der eigentlichen politischen Sicherheit, die Theile hängen weniger von selbst fest zusammen, die Sorgfalt des Staats muss bei weitem thätiger sein. Daraus entspringt nun eine gleich schwierige, und leider nur zu oft vernachlässigte Berechnung, ob die natürlichen Kräfte des Staats zu Herbeischaffung aller nothwendig erforderlichen Mittel hinreichend sind? und fällt diese Berechnung unrichtig aus, ist ein wahres Missverhältniss vorhanden, so müssen neue künstliche Veranstaltungen die Kräfte überspannen, ein Uebel, an welchem nur zu viele neuere Staaten, wenn gleich nicht allein aus dieser Ursache, kranken.
Vorzüglich ist hiebei ein Schade nicht zu übersehen, weil er den Menschen und seine Bildung so nahe betrifft, nämlich dass die eigentliche Verwaltung der Staatsgeschäfte dadurch eine Verflechtung erhält, welche, um nicht Verwirrung zu werden, eine unglaubliche Menge detaillirter Einrichtungen bedarf und eben so viele Personen beschäftigt. Von diesen haben indess doch die meisten nur mit Zeichen und Formeln [34] der Dinge zu thun. Dadurch werden nun nicht bloss viele, vielleicht treffliche Köpfe dem Denken, viele, sonst nützlicher beschäftigte Hände der reellen Arbeit entzogen; sondern ihre Geisteskräfte selbst leiden durch diese zum Theil leere, zum Theil zu einseitige Beschäftigung. Es entsteht nun ein neuer und gewöhnlicher Erwerb, Besorgung von Staatsgeschäften, und dieser macht die Diener des Staats so viel mehr von dem regierenden Theile des Staats, der sie besoldet, als eigentlich von der Nation abhängig. Welche ferneren Nachtheile aber noch hieraus erwachsen, welches Warten auf die Hülfe des Staats, welcher Mangel der Selbstständigkeit, welche falsche Eitelkeit, welche Unthätigkeit sogar und Dürftigkeit, beweist die Erfahrung am unwidersprechlichsten. Dasselbe Uebel, aus welchem dieser Nachtheil entspringt, wird wieder von demselben wechselsweis hervorgebracht. Die, welche einmal die Staatsgeschäfte auf diese Weise verwalten, sehen immer mehr und mehr von der Sache hinweg und nur auf die Form hin, bringen immerfort bei dieser, vielleicht wahre, aber nur, mit nicht hinreichender Hinsicht auf die Sache selbst, und daher oft zum Nachtheil dieser ausschlagende Verbesserungen an, und so entstehen neue Formen, neue Weitläuftigkeiten, oft neue einschränkende Anordnungen, aus welchen wiederum sehr natürlich eine neue Vermehrung der Geschäftsmänner erwächst. Daher nimmt in den meisten Staaten von Jahrzehend zu Jahrzehend das Personale der Staatsdiener, und der Umfang der Registraturen zu, und die Freiheit der Unterthanen ab. Bei einer solchen Verwaltung kommt freilich alles auf die genaueste Aufsicht, auf die pünktlichste und ehrlichste Besorgung an, da die Gelegenheiten, in beiden zu fehlen, so viel mehr sind. Daher sucht man insofern nicht mit Unrecht, alles durch so viel Hände, als möglich gehen zu lassen, und selbst die Möglichkeit von Irrthümern oder Unterschleifen zu entfernen. Dadurch aber werden die Geschäfte beinah völlig [35] mechanisch, und die Menschen Maschinen; und die wahre Geschicklichkeit und Redlichkeit nehmen immer mit dem Zutrauen zugleich ab. Endlich werden, da die Beschäftigungen, von denen ich hier rede, eine grosse Wichtigkeit erhalten, und um konsequent zu sein, allerdings erhalten müssen, dadurch überhaupt dem Gesichtspunkte des Wichtigen und Unwichtigen, Ehrenvollen und Verächtlichen, des letzteren und der untergeordneten Endzwecke verrückt. Und da die Nothwendigkeit von Beschäftigungen dieser Art auch wiederum durch manche leicht in die Augen fallende heilsame Folgen für ihre Nachtheile entschädigt; so halte ich mich hiebei nicht länger auf, und gehe nunmehr zu der letzten Betrachtung, zu welcher alles bisher Entwickelte, gleichsam als eine Vorbereitung, nothwendig war, zu der Verrückung der Gesichtspunkte überhaupt über, welche eine positive Sorgfalt des Staats veranlasst.
7. Die Menschen — um diesen Theil der Untersuchung mit einer allgemeinen, aus den höchsten Rücksichten geschöpften Betrachtung zu schliessen — werden um der Sachen, die Kräfte um der Resultate willen vernachlässigt. Ein Staat gleicht nach diesem System mehr einer aufgehäuften Menge von leblosen und lebendigen Werkzeugen der Wirksamkeit und des Genusses, als einer Menge thätiger und geniessender Kräfte. Bei der Vernachlässigung der Selbstthätigkeit der handelnden Wesen scheint nur auf Glückseligkeit und Genuss gearbeitet zu sein. Allein wenn, da über Glückseligkeit und Genuss nur die Empfindung des Geniessenden richtig urtheilt, die Berechnung auch richtig wäre; so wäre sie dennoch immer weit von der Würde der Menschheit entfernt. Denn woher käme es sonst, dass eben dies nur Ruhe abzweckende System auf den menschlich höchsten Genuss, gleichsam aus Besorgniss vor seinem Gegentheil, willig Verzicht thut? Der Mensch geniesst am meisten in den Momenten, in welchen er sich in dem höchsten Grade seiner Kraft und seiner Einheit fühlt. [36] Freilich ist er auch dann dem höchsten Elend am nächsten. Denn auf den Moment der Spannung vermag nur eine gleiche Spannung zu folgen, und die Richtung zum Genuss oder zum Entbehren liegt in der Hand des unbesiegten Schicksals. Allein wenn das Gefühl des Höchsten im Menschen nur Glück zu heissen verdient, so gewinnt auch Schmerz und Leiden eine veränderte Gestalt. Der Mensch in seinem Innern wird der Sitz des Glücks und des Unglücks, und er wechselt ja nicht mit der wallenden Fluth, die ihn trägt. Jenes System führt, meiner Empfindung nach, auf ein fruchtloses Streben, dem Schmerz zu entrinnen. Wer sich wahrhaft auf Genuss versteht, erduldet den Schmerz, der doch den Flüchtigen ereilt, und freuet sich unaufhörlich am ruhigen Gange des Schicksals; und der Anblick der Grösse fesselt ihn süss, es mag entstehen oder vernichtet werden. So kommt er — doch freilich nur der Schwärmer in andern, als seltnen Momenten — selbst zu der Empfindung, dass sogar der Moment des Gefühls der eignen Zerstörung ein Moment des Entzückens ist.
Vielleicht werde ich beschuldigt, die hier aufgezählten Nachtheile übertrieben zu haben; allein ich musste die volle Wirkung des Einmischens des Staats — von dem hier die Rede ist — schildern, und es versteht sich von selbst, dass jene Nachtheile, nach dem Grade und nach der Art dieses Einmischens selbst, sehr verschieden sind. Ueberhaupt sei mir die Bitte erlaubt, bei allem, was diese Blätter Allgemeines enthalten, von Vergleichungen mit der Wirklichkeit gänzlich zu abstrahiren. In dieser findet man selten einen Fall voll und rein, und selbst dann sieht man nicht abgeschnitten und für sich die einzelnen Wirkungen einzelner Dinge. Dann darf man auch nicht vergessen, dass, wenn einmal schädliche Einflüsse vorhanden sind, das Verderben mit sehr beschleunigten Schritten weiter eilt. Wie grössere Kraft, mit grösserer vereint, doppelt grössere hervorbringt, so artet auch geringere mit geringerer in doppelt [37] geringere aus. Welcher Gedanke selbst wagt es nun, die Schnelligkeit dieser Fortschritte zu begleiten? Indess auch sogar zugegeben, die Nachtheile wären minder gross; so, glaube ich, bestätigt sich die vorgetragene Theorie doch noch bei weitem mehr durch den wahrlich namenlosen Seegen, der aus ihrer Befolgung — wenn diese, wie freilich manches zweifeln lässt, je ganz möglich wäre — entstehen müsste. Denn die immer thätige, nie ruhende, den Dingen innewohnende Kraft kämpft gegen jede, ihr schädliche Einrichtung, und befördert jede, ihr heilsame; so dass es im höchsten Verstande wahr ist, dass auch der angestrengteste Eifer nie so viel Böses zu wirken vermag, als immer und überall von selbst Gutes hervorgeht.
Ich könnte hier ein erfreuliches Gegenbild eines Volkes aufstellen, das in der höchsten und ungebundensten Freiheit, und in der grössesten Mannigfaltigkeit seiner eignen und der übrigen Verhältnisse um sich her existirte; ich könnte zeigen, wie hier, noch in eben dem Grade schönere, höhere und wunderbarere Gestalten der Mannigfaltigkeit und der Originalität erscheinen müssten, als in dem, schon so unnennbar reizenden Alterthum, in welchem die Eigenthümlichkeit eines minder kultivirten Volks allemal roher und gröber ist, in welchem mit der Feinheit auch allemal die Stärke, und selbst der Reichthum des Charakters wächst, und in welchem, bei der fast gränzenlosen Verbindung aller Nationen und Welttheile mit einander, schon die Elemente gleichsam zahlreicher sind; zeigen welche Stärke hervorblühen müsste, wenn jedes Wesen sich aus sich selbst organisirte, wenn es, ewig von den schönsten Gestalten umgeben, mit uneingeschränkter und ewig durch die Freiheit ermunterter Selbstthätigkeit diese Gestalten in sich verwandelte; wie zart und fein das innere Dasein des Menschen sich ausbilden, wie es die angelegentlichere Beschäftigung desselben werden, wie alles Physische und Aeussere in das Innere moralische und intellektuelle übergehen, und das [38] Band, welches beide Naturen im Menschen verknüpft, an Dauer gewinnen würde, wenn nichts mehr die freie Rückwirkung aller menschlichen Beschäftigungen auf den Geist und den Charakter störte; wie keiner dem andern gleichsam aufgeopfert würde, wie jeder seine ganze, ihm zugemessene Kraft für sich behielte, und ihn eben darum eine noch schönere Bereitwilligkeit begeisterte, ihr eine, für andre wohlthätige Richtung zu geben; wie, wenn jeder in seiner Eigenthümlichkeit fortschritte, mannigfaltigere und feinere Nüancen des schönen menschlichen Charakters entstehen, und Einseitigkeit um so seltener sein würde, als sie überhaupt immer nur eine Folge der Schwäche und Dürftigkeit ist, und als jeder, wenn nichts mehr den andern zwänge, sich ihm gleich zu machen, durch die immer fortdauernde Nothwendigkeit der Verbindung mit andern, dringender veranlasst werden würde, sich nach ihnen anders und anders selbst zu modificiren; wie in diesem Volke keine Kraft und keine Hand für die Erhöhung und den Genuss des Menschendaseins verloren ginge; endlich zeigen, wie schon dadurch eben so auch die Gesichtspunkte aller nun dahin gerichtet, und von jedem andern falschen, oder doch minder der Menschheit würdigen Endzweck abgewandt werden würden. Ich könnte dann damit schliessen, aufmerksam darauf zu machen, wie diese wohlthätigen Folgen einer solchen Konstitution, unter einem Volke, welches es sei, ausgestreut, selbst dem freilich nie ganz tilgbaren Elende der Menschen, den Verheerungen der Natur, dem Verderben der feindseligen Neigungen, und den Ausschweifungen einer zu üppigen Genussesfülle, einen unendlich grossen Theil seiner Schrecklichkeit nehmen würden. Allein ich begnüge mich, das Gegenbild geschildert zu haben; es ist mir genug, Ideen hinzuwerfen, damit ein reiferes Urtheil sie prüfe.
Wenn ich aus dem ganzen bisherigen Raisonnement das letzte Resultat zu ziehen versuche; so muss der erste [39] Grundsatz dieses Theils der gegenwärtigen Untersuchung der sein:
der Staat enthalte sich aller Sorgfalt für den positiven Wohlstand der Bürger, und gehe keinen Schritt weiter, als zu ihrer Sicherstellung gegen sich selbst und gegen auswärtige Feinde nothwendig ist; zu keinem andern Endzwecke beschränke er ihre Freiheit.
Ich müsste mich jetzt zu den Mitteln wenden, durch welche eine solche Sorgfalt thätig geübt wird; allein, da ich sie selbst, meinen Grundsätzen gemäss, gänzlich missbillige, so kann ich hier von diesen Mitteln schweigen, und mich begnügen nur allgemein zu bemerken, dass die Mittel, wodurch die Freiheit zum Behuf des Wohlstandes beschränkt wird, von sehr mannigfaltiger Natur sein können, direkte: Gesetze, Ermunterungen, Preise; indirekte: wie dass der Landesherr selbst der beträchtlichste Eigenthümer ist, und dass er einzelnen Bürgern überwiegende Rechte, Monopolien u. s. f. einräumt, und dass alle, einen, obgleich dem Grade und der Art nach, sehr verschiedenen Nachtheil mit sich führen. Wenn man hier auch gegen das Erstere und Letztere keinen Einwurf erregte; so scheint es dennoch sonderbar, dem Staate wehren zu wollen, was jeder Einzelne darf, Belohnungen aussetzen, unterstützen, Eigenthümer sein. Wäre es in der Ausübung möglich, dass der Staat eben so eine zwiefache Person ausmachte, als er es in der Abstraktion thut; so wäre hiergegen nichts zu erinnern. Es wäre dann gerade nicht anders, als wenn eine Privatperson einen mächtigen Einfluss erhielte. Allein da, jenen Unterschied zwischen Theorie und Praxis noch abgerechnet, der Einfluss einer Privatperson durch Konkurrenz andrer, Versplitterung ihres Vermögens, selbst durch ihren Tod aufhören kann, lauter Dinge, die beim Staate nicht zutreffen; so steht noch immer der Grundsatz, dass der Staat sich in nichts mischen darf, was nicht allein die Sicherheit angeht, um so mehr entgegen, als [40] derselbe schlechterdings nicht durch Beweise unterstützt worden ist, welche gerade aus der Natur des Zwanges allein hergenommen gewesen wären. Auch handelt eine Privatperson aus andern Gründen, als der Staat. Wenn z. B. ein einzelner Bürger Prämien aussetzt, die ich auch — wie es doch wohl nie ist — an sich gleich wirksam mit denen des Staats annehmen will; so thut er dies seines Vortheils halber. Sein Vortheil aber steht, wegen des ewigen Verkehrs mit allen übrigen Bürgern, und wegen der Gleichheit seiner Lage mit der ihrigen, mit dem Vortheile oder Nachtheile anderer, folglich mit ihrem Zustande in genauem Verhältniss. Der Zweck, den er erreichen will, ist also schon gewissermaassen in der Gegenwart vorbereitet, und wirkt folglich darum heilsam. Die Gründe des Staats hingegen sind Ideen und Grundsätze, bei welchen auch die genaueste Berechnung oft täuscht; und sind es aus der Privatlage des Staats geschöpfte Gründe, so ist diese schon an sich nur zu oft für den Wohlstand und die Sicherheit der Bürger bedenklich, und auch die Lage der Bürger nie in eben dem Grade gleich. Wäre sie dies, nun so ist’s auch in der Wirklichkeit nicht der Staat mehr, der handelt, und die Natur dieses Raisonnements selbst verbietet dann seine Anwendung.
Eben dies, und das ganze vorige Raisonnement aber ging allein aus Gesichtspunkten aus, welche blos die Kraft des Menschen, als solchen, und seine innere Bildung zum Gegenstand hatten. Mit Recht würde man dasselbe der Einseitigkeit beschuldigen, wenn es die Resultate, deren Dasein so nothwendig ist, damit jene Kraft nur überhaupt wirken kann, ganz vernachlässigte. Es entsteht also hier noch die Frage: ob eben diese Dinge, von welchen hier die Sorgfalt des Staats entfernt wird, ohne ihn und für sich gedeihen können? Hier wäre es nun der Ort, die einzelnen Arten der Gewerbe, Ackerbau, Industrie, Handel und alles Uebrige, wovon ich hier zusammengenommen rede, einzeln durchzugehen, und mit Sachkenntniss [41] aus einander zu setzen, welche Nachtheile und Vortheile Freiheit und Selbstüberlassung ihnen gewährt. Mangel eben dieser Sachkenntniss hindert mich, eine solche Erörterung einzugehen. Auch halte ich dieselbe für die Sache selbst nicht mehr nothwendig. Indess, gut und vorzüglich historisch ausgeführt, würde sie den sehr grossen Nutzen gewähren, diese Ideen mehr zu empfehlen, und zugleich die Möglichkeit einer sehr modificirten Ausführung — da die einmal bestehende wirkliche Lage der Dinge schwerlich in irgend einem Staat eine uneingeschränkte erlauben dürfte — zu beurtheilen. Ich begnüge mich an einigen wenigen allgemeinen Bemerkungen. Jedes Geschäft — welcher Art es auch sei — wird besser betrieben, wenn man es um seiner selbst willen, als den Folgen zu Liebe treibt. Dies liegt so sehr in der Natur des Menschen, dass gewöhnlich, was man anfangs nur des Nutzens wegen wählt, zuletzt für sich Reiz gewinnt. Nun aber rührt dies blos daher, weil dem Menschen Thätigkeit lieber ist, als Besitz, allein Thätigkeit nur, insofern sie Selbstthätigkeit ist. Gerade der rüstigste und thätigste Mensch würde am meisten einer erzwungenen Arbeit Müssiggang vorziehn. Auch wächst die Idee des Eigenthums nur mit der Idee der Freiheit, und gerade die am meisten energische Thätigkeit danken wir dem Gefühle des Eigenthums. Jede Erreichung eines grossen Endzwecks erfordert Einheit der Anordnung. Das ist gewiss. Eben so auch jede Verhütung oder Abwehrung grosser Unglücksfälle, Hungersnoth, Ueberschwemmungen u. s. f. Allein diese Einheit lässt sich auch durch Nationalanstalten, nicht blos durch Staatsanstalten hervorbringen. Einzelnen Theilen der Nation, und ihr selbst im Ganzen muss nur Freiheit gegeben werden, sich durch Verträge zu verbinden. Es bleibt immer ein unläugbar wichtiger Unterschied zwischen einer Nationalanstalt und einer Staatseinrichtung. Jene hat nur eine mittelbare, diese eine unmittelbare Gewalt. Bei jener ist daher mehr [42] Freiheit im Eingehen, Trennen und Modificiren der Verbindung. Anfangs sind höchst wahrscheinlich alle Staatsverbindungen nichts, als dergleichen Nationenvereine gewesen. Allein hier zeigt eben die Erfahrung die verderblichen Folgen, wenn die Absicht Sicherheit zu erhalten, und andre Endzwecke zu erreichen mit einander verbunden wird. Wer dieses Geschäft besorgen soll, muss, um der Sicherheit willen, absolute Gewalt besitzen. Diese aber dehnt er nun auch auf das Uebrige aus, und jemehr sich die Einrichtung von ihrer Entstehung entfernt, desto mehr wächst die Macht, und desto mehr verschwindet die Erinnerung des Grundvertrags. Eine Anstalt im Staat hingegen hat nur Gewalt, insofern sie diesen Vertrag und sein Ansehn erhält. Schon dieser Grund allein könnte hinreichend scheinen. Allein dann, wenn auch der Grundvertrag genau beachtet würde, und die Staatsverbindung im engsten Verstande eine Nationalverbindung wäre; so könnte dennoch der Wille der einzelnen Individuen sich nur durch Repräsentation erklären; und ein Repräsentant Mehrerer kann unmöglich ein so treues Organ der Meinung der einzelnen Repräsentirten sein. Nun aber führen alle im Vorigen entwickelten Gründe auf die Nothwendigkeit der Einwilligung jedes Einzelnen. Eben diese schliesst auch die Entscheidung nach der Stimmenmehrheit aus, und doch liesse sich keine andere in einer solchen Staatsverbindung, welche sich auf diese, das positive Wohl der Bürger betreffende Gegenstände verbreitete, denken. Den nicht Einwilligenden bliebe also nichts übrig, als aus der Gesellschaft zu treten, dadurch ihrer Gerichtsbarkeit zu entgehen, und die Stimmenmehrheit nicht mehr für sich geltend zu machen. Allein dies ist beinah bis zur Unmöglichkeit erschwert, wenn aus dieser Gesellschaft gehen, zugleich aus dem Staate gehen heisst. Ferner ist es besser, wenn bei einzelnen Veranlassungen einzelne Verbindungen eingegangen, als allgemeinere für unbestimmte künftige Fälle geschlossen [43] werden. Endlich entstehen auch Vereinigungen freier Menschen in einer Nation mit grösserer Schwierigkeit. Wenn nun dies auf der einen Seite auch der Erreichung der Endzwecke schadet — wogegen doch immer zu bedenken bleibt, dass allgemein, was schwerer entsteht, weil gleichsam die langgeprüfte Kraft sich in einander fügt, auch eine festere Dauer gewinnt — so ist doch gewiss überhaupt jede grössere Vereinigung minder heilsam. Je mehr der Mensch für sich wirkt, desto mehr bildet er sich. In einer grossen Vereinigung wird er zu leicht Werkzeug. Auch sind diese Vereinigungen Schuld, dass oft das Zeichen an die Stelle der Sache tritt, welches der Bildung allemal hinderlich ist. Die todte Hieroglyphe begeistert nicht, wie die lebendige Natur. Ich erinnere hier nur statt alles Beispiels an Armenanstalten. Tödtet etwas Andres so sehr alles wahre Mitleid, alle hoffende aber anspruchlose Bitte, alles Vertrauen des Menschen auf Menschen? Verachtet nicht jeder den Bettler, dem es lieber wäre, ein Jahr im Hospital bequem ernährt zu werden, als, nach mancher erduldeten Noth, nicht auf eine hinwerfende Hand, aber auf ein theilnehmendes Herz zu stossen? Ich gebe es also zu, wir hätten diese schnellen Fortschritte ohne die grossen Massen nicht gemacht, in welchen das Menschengeschlecht, wenn ich so sagen darf, in den letzten Jahrhunderten gewirkt hat; allein nur die schnellen nicht. Die Frucht wäre langsamer, aber dennoch gereift. Und sollte sie nicht seegenvoller gewesen sein? Ich glaube daher von diesem Einwurf zurückkehren zu dürfen. Zwei andre bleiben der Folge zur Prüfung aufbewahrt, nämlich, ob auch, bei der Sorglosigkeit, die dem Staate hier vorgeschrieben wird, die Erhaltung der Sicherheit möglich ist? und ob nicht wenigstens die Verschaffung der Mittel, welche dem Staate nothwendig zu seiner Wirksamkeit eingeräumt werden müssen, ein vielfacheres Eingreifen der Räder der Staatsmaschine in die Verhältnisse der Bürger nothwendig macht?
[44]
IV.
Sorgfalt des Staats für das negative Wohl der Bürger, für ihre Sicherheit.↩
Diese Sorgfalt ist nothwendig, — macht den eigentlichen Endzweck des Staats aus. — Höchster, aus diesem Abschnitt gezogener Grundsatz. — Bestätigung desselben durch die Geschichte.
Wäre es mit dem Uebel, welches die Begierde der Menschen, immer über die, ihnen rechtmässig gezogenen Schranken in das Gebiet andrer einzugreifen,[24] und die daraus entspringende Zwietracht stiftet, wie mit den physischen Uebeln der Natur, und denjenigen, diesen hierin wenigstens gleichkommenden moralischen, welche durch Uebermaass des Geniessens oder Entbehrens, oder durch andere, mit den nothwendigen Bedingungen der Erhaltung nicht übereinstimmende Handlungen auf eigne Zerstörung hinauslaufen; so wäre schlechterdings keine Staatsvereinigung nothwendig. Jenen würde der Muth, die Klugheit und Vorsicht der Menschen, diesen die, durch Erfahrung belehrte Weisheit von selbst steuern, und wenigstens ist in beiden mit dem gehobenen Uebel immer Ein Kampf beendigt. Es ist daher keine letzte, widerspruchlose Macht nothwendig, welche doch im eigentlichsten Verstande den Begriff des Staats ausmacht. Ganz anders aber verhält es sich mit den Uneinigkeiten der Menschen, und sie erfordern allemal schlechterdings eine solche eben beschriebene Gewalt. Denn bei der Zwietracht entstehen Kämpfe aus Kämpfen. Die [45] Beleidigung fordert Rache, und die Rache ist eine neue Beleidigung. Hier muss man also auf eine Rache zurückkommen, welche keine neue Rache erlaubt — und diese ist die Strafe des Staats — oder auf eine Entscheidung, welche die Partheien sich zu beruhigen nöthigt, die Entscheidung des Richters. Auch bedarf nichts so eines zwingenden Befehls und eines unbedingten Gehorsams, als die Unternehmungen der Menschen gegen den Menschen, man mag an die Abtreibung eines auswärtigen Feindes, oder an Erhaltung der Sicherheit im Staate selbst denken. Ohne Sicherheit vermag der Mensch weder seine Kräfte auszubilden, noch die Frucht derselben zu geniessen; denn ohne Sicherheit ist keine Freiheit. Es ist aber zugleich etwas, das der Mensch sich selbst allein nicht verschaffen kann; dies zeigen die eben mehr berührten als ausgeführten Gründe, und die Erfahrung, dass unsre Staaten, die sich doch, da so viele Verträge und Bündnisse sie mit einander verknüpfen, und Furcht so oft den Ausbruch von Thätlichkeiten hindert, gewiss in einer bei weitem günstigeren Lage befinden, als es erlaubt ist, sich den Menschen im Naturstande zu denken, dennoch die Sicherheit nicht geniessen, welcher sich auch in der mittelmässigsten Verfassung der gemeinste Unterthan zu erfreuen hat. Wenn ich daher in dem Vorigen die Sorgfalt des Staats darum von vielen Dingen entfernt habe, weil die Nation sich selbst diese Dinge gleich gut, und ohne die bei der Besorgung des Staats mit einfliessenden Nachtheile verschaffen kann; so muss ich dieselbe aus gleichem Grunde jetzt auf die Sicherheit richten, als das Einzige,[25] welches der einzelne Mensch mit seinen Kräften allein nicht zu erlangen vermag. Ich glaube daher hier als den ersten positiven — aber in der Folge noch genauer zu bestimmenden und einzuschränkenden — Grundsatz aufstellen zu können:
[46]
dass die Erhaltung der Sicherheit sowohl gegen auswärtige Feinde, als innerliche Zwistigkeiten den Zweck des Staats ausmachen, und seine Wirksamkeit beschäftigen muss;
da ich bisher nur negativ zu bestimmen versuchte, dass er die Gränzen seiner Sorgfalt wenigstens nicht weiter ausdehnen dürfe.
Diese Behauptung wird auch durch die Geschichte so sehr bestätigt, dass in allen früheren Nationen die Könige nichts andres waren, als Anführer im Kriege, oder Richter im Frieden. Ich sage die Könige. Denn — wenn mir diese Abschweifung erlaubt ist — die Geschichte zeigt uns, wie sonderbar es auch scheint, gerade in der Epoche, wo dem Menschen, welcher, mit noch sehr wenigem Eigenthum versehen, nur persönliche Kraft kennt und schätzt, und in die ungestörteste Ausübung derselben den höchsten Genuss setzt, das Gefühl seiner Freiheit das theuerste ist, nichts als Könige und Monarchien. So alle Staatsverfassungen Asiens, so die ältesten Griechenlands, Italiens, und der freiheitliebendsten Stämme, der germanischen.[26] Denkt man über die Gründe hiervon nach, so wird man gleichsam von der Wahrheit überrascht, dass gerade die Wahl einer Monarchie ein Beweis der höchsten Freiheit der Wählenden ist. Der Gedanke eines Befehlshabers entsteht, wie oben gesagt, nur durch das Gefühl der Nothwendigkeit eines Anführers, oder eines Schiedsrichters. Nun ist Ein Führer oder Entscheider unstreitig das Zweckmässigste. Die Besorgniss, dass der Eine aus einem Führer und Schiedsrichter ein Herrscher werden möchte, kennt der wahrhaft freie Mann, die Möglichkeit selbst ahnet er nicht; er traut keinem Menschen die [47] Macht, seine Freiheit unterjochen zu können, und keinem Freien den Willen zu, Herrscher zu sein — wie denn auch in der That der Herrschsüchtige, nicht empfänglich für die hohe Schönheit der Freiheit, die Sklaverei liebt, nur dass er nicht der Sklave sein will — und so ist, wie die Moral mit dem Laster, die Theologie mit der Ketzerei, die Politik mit der Knechtschaft entstanden. Nur führen freilich unsere Monarchen nicht eine so honigsüsse Sprache, als die Könige bei Homer und Hesiodus.[27]
V.
Sorgfalt des Staats für die Sicherheit gegen auswärtige Feinde.↩
Bei dieser Betrachtung gewählter Gesichtspunkt. — Einfluss des Kriegs überhaupt auf den Geist und den Charakter der Nation. — Damit angestellte Vergleichung des Zustandes desselben, und aller sich auf ihn beziehenden Einrichtungen bei uns. — Mannigfaltige Nachtheile dieses Zustandes für die innere Bildung des Menschen. — Höchster, aus dieser Vergleichung geschöpfter Grundsatz.
Von der Sicherheit gegen auswärtige Feinde brauchte ich — um zu meinem Vorhaben zurückzukehren — kaum ein Wort [48] zu sagen, wenn es nicht die Klarheit der Hauptidee vermehrte, sie auf alle einzelne Gegenstände nach und nach anzuwenden. Allein diese Anwendung wird hier um so weniger unnütz sein, als ich mich allein auf die Wirkung des Krieges auf den Charakter der Nation, und folglich auf den Gesichtspunkt beschränken werde, den ich in der ganzen Untersuchung, als den herrschenden, gewählt habe. Aus diesem nun die Sache betrachtet, ist mir der Krieg eine der heilsamsten Erscheinungen zur Bildung des Menschengeschlechts, und ungern seh’ ich ihn nach und nach immer mehr vom Schauplatz zurücktreten. Es ist das freilich furchtbare Extrem, wodurch jeder thätige Muth gegen Gefahr, Arbeit und Mühseligkeit geprüft und gestählt wird, der sich nachher in so verschiedene Nüancen im Menschenleben modificirt, und welcher allein der ganzen Gestalt die Stärke und Mannigfaltigkeit giebt, ohne welche Leichtigkeit Schwäche, und Einheit Leere ist.
Man wird mir antworten, dass es, neben dem Kriege, noch andere Mittel dieser Art giebt, physische Gefahren bei mancherlei Beschäftigungen, und — wenn ich mich des Ausdrucks bedienen darf — moralische von verschiedener Gattung, welche den festen, unerschütterten Staatsmann im Kabinet, wie den freimüthigen Denker in seiner einsamen Zelle treffen können. Allein es ist mir unmöglich, mich von der Vorstellung loszureissen, dass, wie alles Geistige nur eine feinere Blüthe des Körperlichen, so auch dieses es ist. Nun lebt zwar der Stamm, auf dem sie hervorspriessen kann, in der Vergangenheit. Allein das Andenken der Vergangenheit tritt immer weiter zurück, die Zahl derer, auf welche es wirkt, vermindert sich immer in der Nation, und selbst auf diese wird die Wirkung schwächer. Andern, obschon gleich gefahrvollen Beschäftigungen, Seefahrten, dem Bergbau u. s. f. fehlt, wenn gleich mehr und minder, die Idee der Grösse und des Ruhms, die mit dem Kriege so eng verbunden ist. Und diese Idee ist in der That nicht chimärisch. [49] Sie beruht auf einer Vorstellung von überwiegender Macht. Den Elementen sucht man mehr zu entrinnen, ihre Gewalt mehr auszudauern, als sie zu besiegen:
— mit Göttern
soll sich nicht messen
irgend ein Mensch (†);[28]
Rettung ist nicht Sieg; was das Schicksal wohlthätig schenkt, und menschlicher Muth, oder menschliche Empfindsamkeit nur benutzt, ist nicht Frucht, oder Beweis der Obergewalt. Auch denkt jeder im Kriege, das Recht auf seiner Seite zu haben, jeder eine Beleidigung zu rächen. Nun aber achtet der natürliche Mensch, und mit einem Gefühl, das auch der kultivirteste nicht abläugnen kann, es höher, seine Ehre zu reinigen, als Bedarf fürs Leben zu sammeln.
Niemand wird es mir zutrauen, den Tod eines gefallenen Kriegers schöner zu nennen, als den Tod eines kühnen Plinius, oder, um vielleicht nicht genug geehrte Männer zu nennen, den Tod von Robert und Pilatre du Rozier. Allein diese Beispiele sind selten, und wer weiss, ob ohne jene sie überhaupt nur wären? Auch habe ich für den Krieg gerade keine günstige Lage gewählt. Man nehme die Spartaner bei Thermopylä. Ich frage einen jeden, was solch ein Beispiel auf eine Nation wirkt? Wohl weiss ichs, eben dieser Muth, eben diese Selbstverläugnung kann sich in jeder Situation des Lebens zeigen, und zeigt sich wirklich in jeder. Aber will man es dem sinnlichen Menschen verargen, wenn der lebendigste Ausdruck ihn auch am meisten hinreisst, und kann man es läugnen, dass ein Ausdruck dieser Art wenigstens in der grössesten Allgemeinheit wirkt? Und bei alle dem, was ich auch je von Uebeln hörte, welche schrecklicher wären, als der Tod; ich sah noch keinen Menschen, der das Leben in üppiger Fülle genoss, und der — ohne [50] Schwärmer zu sein — den Tod verachtete. Am wenigsten aber existirten diese Menschen im Alterthum, wo man noch die Sache höher, als den Namen, die Gegenwart höher, als die Zukunft schätzte. Was ich daher hier von Kriegern sage, gilt nur von solchen, die, nicht gebildet, wie jene in Platos Republik (†),[29] die Dinge, Leben und Tod, nehmen für das, was sie sind; von Kriegern, welche, das Höchste im Auge, das Höchste aufs Spiel setzen. Alle Situationen, in welchen sich die Extreme gleichsam an einander knüpfen, sind die interessantesten und bildendsten. Wo ist dies aber mehr der Fall, als im Kriege, wo Neigung und Pflicht, und Pflicht des Menschen und des Bürgers in unaufhörlichem Streite zu sein scheinen, und wo dennoch — sobald nur gerechte Vertheidigung die Waffen in die Hand gab — alle diese Kollisionen die vollste Auflösung finden?
Schon der Gesichtspunkt, aus welchem allein ich den Krieg für heilsam und nothwendig halte, zeigt hinlänglich, wie, meiner Meinung nach, im Staate davon Gebrauch gemacht werden müsste. Dem Geist, den er wirkt, muss Freiheit gewährt werden, sich durch alle Mitglieder der Nation zu ergiessen. Schon dies spricht gegen die stehenden Armeen. Ueberdies sind sie und die neuere Art des Krieges überhaupt, freilich weit von dem Ideal entfernt, das für die Bildung des Menschen das nützlichste wäre. Wenn schon überhaupt der Krieger, mit Aufopferung seiner Freiheit, gleichsam Maschine werden muss; so muss er es noch in weit höherem Grade bei unserer Art der Kriegführung, bei welcher es soviel weniger auf die Stärke, Tapferkeit und Geschicklichkeit des Einzelnen ankommt. Wie verderblich muss es nun sein, wenn beträchtliche Theile der Nationen, nicht bloss einzelne Jahre, sondern oft ihr Leben hindurch im Frieden, nur zum Behuf des möglichen Krieges, in diesem maschinenmässigen Leben erhalten werden?
[51]
Vielleicht ist es nirgends so sehr, als hier, der Fall, dass mit der Ausbildung der Theorie der menschlichen Unternehmungen, der Nutzen derselben für diejenigen sinkt, welche sich mit ihnen beschäftigen. Unläugbar hat die Kriegskunst unter den Neueren unglaubliche Fortschritte gemacht, aber ebenso unläugbar ist der edle Charakter der Krieger seltner geworden, seine höchste Schönheit existirt nur noch in der Geschichte des Alterthums, wenigstens — wenn man dies für übertrieben halten sollte — hat der kriegerische Geist bei uns sehr oft blos schädliche Folgen für die Nationen, da wir ihn im Alterthum so oft von so heilsamen begleitet sehen. Allein unsere stehende Armeen bringen, wenn ich so sagen darf, den Krieg mitten in den Schooss des Friedens. Kriegsmuth ist nur in Verbindung mit den schönsten friedlichen Tugenden, Kriegszucht nur in Verbindung mit dem höchsten Freiheitsgefühle ehrwürdig. Beides getrennt — und wie sehr wird eine solche Trennung durch den im Frieden bewaffneten Krieger begünstigt? — artet diese sehr leicht in Sklaverei, jener in Wildheit und Zügellosigkeit aus.
Bei diesem Tadel der stehenden Armeen sei mir die Erinnerung erlaubt, dass ich hier nicht weiter von ihnen rede, als mein gegenwärtiger Gesichtspunkt erfordert. Ihren grossen, unbestrittenen Nutzen — wodurch sie dem Zuge das Gleichgewicht halten, mit dem sonst ihre Fehler sie, wie jedes irdische Wesen, unaufhaltbar zum Untergange dahinreissen würden — zu verkennen, sei fern von mir. Sie sind ein Theil des Ganzen, welches nicht Plane eitler menschlicher Vernunft, sondern die sichere Hand des Schicksals gebildet hat. Wie sie in alles Andere, unserem Zeitalter Eigenthümliche, eingreifen, wie sie mit diesem die Schuld und das Verdienst des Guten und Bösen theilen, das uns auszeichnen mag, müsste das Gemälde schildern, welches uns, treffend und vollständig gezeichnet, der Vorwelt an die Seite zu stellen wagte.
[52]
Auch müsste ich sehr unglücklich in Auseinandersetzung meiner Ideen gewesen sein, wenn man glauben könnte, der Staat sollte, meiner Meinung nach, von Zeit zu Zeit Krieg erregen. Er gebe Freiheit und dieselbe Freiheit geniesse ein benachbarter Staat. Die Menschen sind in jedem Zeitalter Menschen, und verlieren nie ihre ursprünglichen Leidenschaften. Es wird Krieg von selbst entstehen; und entsteht er nicht, nun so ist man wenigstens gewiss, dass der Friede weder durch Gewalt erzwungen, noch durch künstliche Lähmung hervorgebracht ist; und dann wird der Friede den Nationen freilich ein eben so wohlthätigeres Geschenk sein, wie der friedliche Pflüger ein holderes Bild ist, als der blutige Krieger. Und gewiss ist es, denkt man sich ein Fortschreiten der ganzen Menschheit von Generation zu Generation; so müssten die folgenden Zeitalter immer die friedlicheren sein. Aber dann ist der Friede aus den inneren Kräften der Wesen hervorgegangen, dann sind die Menschen, und zwar die freien Menschen friedlich geworden. Jetzt — das beweist Ein Jahr Europäischer Geschichte — geniessen wir die Früchte des Friedens, aber nicht die der Friedlichkeit. Die menschlichen Kräfte, unaufhörlich nach einer gleichsam unendlichen Wirksamkeit strebend, wenn sie einander begegnen, vereinen oder bekämpfen sich. Welche Gestalt der Kampf annehme, ob die des Krieges, oder des Wetteifers, oder welche sonst man nüanciren möge? hängt vorzüglich von ihrer Verfeinerung ab.
Soll ich jetzt auch aus diesem Raisonnement einen zu meinem Endziel dienenden Grundsatz ziehen;
so muss der Staat den Krieg auf keinerlei Weise befördern, allein auch ebensowenig, wenn die Notwendigkeit ihn fordert, gewaltsam verhindern; dem Einflusse desselben auf Geist und Charakter sich durch die ganze Nation zu ergiessen völlige Freiheit verstatten; und vorzüglich sich aller positiven Einrichtungen enthalten, die Nation zum [53] Kriege zu bilden, oder ihnen, wenn sie denn, wie z. B. Waffenübungen der Bürger, schlechterdings nothwendig sind, eine solche Richtung geben, dass sie derselben nicht blos die Tapferkeit, Fertigkeit und Subordination eines Soldaten beibringen, sondern den Geist wahrer Krieger, oder vielmehr edler Bürger einhauchen, welche für ihr Vaterland zu fechten immer bereit sind.
VI.
Sorgfalt des Staats für die Sicherheit der Bürger unter einander. Mittel, diesen Endzweck zu erreichen. Veranstaltungen, welche auf die Umformung des Geistes und Charakters der Bürger gerichtet sind. Oeffentliche Erziehung.↩
Möglicher Umfang der Mittel, diese Sicherheit zu befördern. — Moralische Mittel. — Oeffentliche Erziehung. — Ist nachtheilig, vorzüglich weil sie die Mannigfaltigkeit der Ausbildung hindert; — unnütz, weil es in einer Nation, die einer gehörigen Freiheit geniesst, an guter Privaterziehung nicht fehlen wird; — wirkt zu viel, weil die Sorgfalt für die Sicherheit nicht gänzliche Umformung der Sitten nothwendig macht; — liegt daher ausser den Gränzen der Wirksamkeit des Staats.
Eine tiefere und ausführlichere Prüfung erfordert die Sorgfalt des Staats für die innere Sicherheit der Bürger unter einander, zu der ich mich jetzt wende. Denn es scheint mir nicht hinlänglich, demselben blos allgemein die Erhaltung derselben zur Pflicht zu machen, sondern ich halte es vielmehr für nothwendig, die besondern Gränzen dabei zu bestimmen, oder wenn dies allgemein nicht möglich sein sollte, wenigstens die Gründe dieser Unmöglichkeit auseinanderzusetzen, und die Merkmale anzugeben, an welchen sie in gegebenen Fällen zu erkennen sein möchten. Schon eine sehr mangelhafte Erfahrung lehrt, dass diese Sorgfalt mehr oder minder weit ausgreifen kann, ihren Endzweck zu erreichen. Sie kann sich begnügen, begangene Unordnungen wieder herzustellen, und zu bestrafen. Sie kann schon ihre Begehung überhaupt zu verhüten suchen, und [54] sie kann endlich zu diesem Endzweck den Bürgern, ihrem Charakter und ihrem Geist, eine Wendung zu ertheilen bemüht sein, die hierauf abzweckt. Auch gleichsam die Extension ist verschiedener Grade fähig. Es können blos Beleidigungen der Rechte der Bürger, und unmittelbaren Rechte des Staats untersucht und gerügt werden; oder man kann, indem man den Bürger als ein Wesen ansieht, das dem Staate die Anwendung seiner Kräfte schuldig ist, und also durch Zerstörung oder Schwächung dieser Kräfte ihn gleichsam seines Eigenthums beraubt, auch auf Handlungen ein wachsames Auge haben, deren Folgen sich nur auf den Handelnden selbst erstrecken. Alles dies fasse ich hier auf einmal zusammen, und rede daher allgemein von allen Einrichtungen des Staats, welche in der Absicht der Beförderung der öffentlichen Sicherheit geschehen. Zugleich werden sich hier von selbst alle diejenigen darstellen, die, sollten sie auch nicht überall, oder nicht blos auf Sicherheit abzwecken, das moralische Wohl der Bürger angehen, da, wie ich schon oben bemerkt, die Natur der Sache selbst keine genaue Trennung erlaubt, und diese Einrichtungen doch gewöhnlich die Sicherheit und Ruhe des Staats vorzüglich beabsichten. Ich werde dabei demjenigen Gange getreu bleiben, den ich bisher gewählt habe. Ich habe nämlich zuerst die grösseste mögliche Wirksamkeit des Staats angenommen, und nun nach und nach zu prüfen versucht, was davon abgeschnitten werden müsse. Jetzt ist mir nur die Sorge für die Sicherheit übrig geblieben. Bei dieser muss nun aber wiederum auf gleiche Weise verfahren werden, und ich werde daher dieselbe zuerst in ihrer grössesten Ausdehnung betrachten, um durch allmähliche Einschränkungen auf diejenigen Grundsätze zu kommen, welche mir die richtigen scheinen. Sollte dieser Gang vielleicht für zu langsam und weitläuftig gehalten werden; so gebe ich gern zu, dass ein dogmatischer Vortrag gerade die entgegengesetzte Methode erfordern würde. Allein bei einem blos [55] untersuchenden, wie der gegenwärtige, ist man wenigstens gewiss, den ganzen Umfang des Gegenstandes umspannt, nichts übersehen, und die Grundsätze gerade in der Folge entwickelt zu haben, in welcher sie wirklich aus einander herfliessen.
Man hat, vorzüglich seit einiger Zeit, so sehr auf die Verhütung gesetzwidriger Handlungen und auf Anwendung moralischer Mittel im Staate gedrungen. Ich, so oft ich dergleichen oder ähnliche Aufforderungen höre, freue mich, gesteh’ ich, dass eine solche freiheitbeschränkende Anwendung bei uns immer weniger gemacht, und, bei der Lage fast aller Staaten, immer weniger möglich wird.
Man beruft sich auf Griechenland und Rom, aber eine genauere Kenntniss ihrer Verfassungen würde bald zeigen, wie unpassend diese Vergleichungen sind. Jene Staaten waren Republiken, ihre Anstalten dieser Art waren Stützen der freien Verfassung, welche die Bürger mit einem Enthusiasmus erfüllte, welcher den nachtheiligen Einfluss der Einschränkung der Privatfreiheit minder fühlen, und die Energie des Charakters minder schädlich werden liess. Dann genossen sie auch übrigens einer grösseren Freiheit, als wir, und was sie aufopferten, opferten sie einer andern Thätigkeit, dem Antheil an der Regierung, auf. In unsern, meistentheils monarchischen Staaten ist das alles ganz anders. Was die Alten von moralischen Mitteln anwenden mochten, Nationalerziehung, Religion, Sittengesetze, alles würde bei uns minder fruchten, und einen grösseren Schaden bringen. Dann war auch das Meiste, was man jetzt so oft für Wirkung der Klugheit des Gesetzgebers hält, blos schon wirkliche, nur vielleicht wankende, und daher der Sanktion des Gesetzes bedürfende Volkssitte. Die Uebereinstimmung der Einrichtungen des Lykurgus mit der Lebensart der meisten unkultivirten Nationen hat schon Freguson(†)[30] meisterhaft gezeigt, [56] und da höhere Kultur die Nation verfeinerte, erhielt sich auch in der That nicht mehr, als der Schatten jener Einrichtungen. Endlich steht, dünkt mich, das Menschengeschlecht jetzt auf einer Stufe der Kultur, von welcher es sich nur durch Ausbildung der Individuen höher emporschwingen kann; und daher sind alle Einrichtungen, welche diese Ausbildung hindern, und die Menschen mehr in Massen zusammendrängen, jetzt schädlicher als ehmals.
Schon diesen wenigen Bemerkungen zufolge erscheint, um zuerst von demjenigen moralischen Mittel zu reden, was am weitesten gleichsam ausgreift, öffentliche, d. i. vom Staat angeordnete oder geleitete Erziehung wenigstens von vielen Seiten bedenklich. Nach dem ganzen vorigen Raisonnement kommt schlechterdings Alles auf die Ausbildung des Menschen in der höchsten Mannigfaltigkeit an; öffentliche Erziehung aber muss, selbst wenn sie diesen Fehler vermeiden, wenn sie sich blos darauf einschränken wollte, Erzieher anzustellen und zu unterhalten, immer eine bestimmte Form begünstigen. Es treten daher alle die Nachtheile bei derselben ein, welche der erste Theil dieser Untersuchung hinlänglich dargestellt hat, und ich brauche nur noch hinzuzufügen, dass jede Einschränkung verderblicher wird, wenn sie sich auf den moralischen Menschen bezieht, und dass, wenn irgend etwas Wirksamkeit auf das einzelne Individuum fordert, dies gerade die Erziehung ist, welche das einzelne Individuum bilden soll. Es ist unläugbar, dass gerade daraus sehr heilsame Folgen entspringen, dass der Mensch in der Gestalt, welche ihm seine Lage und die Umstände gegeben haben, im Staate selbst thätig wird, und nun durch den Streit — wenn ich so sagen darf — der ihm vom Staat angewiesenen Lage, und der von ihm selbst gewählten, zum Theil er anders geformt wird, zum Theil die Verfassung des Staats selbst Aenderungen erleidet, in denen dergleichen, obgleich freilich auf einmal fast unbemerkbare Aenderungen, nach [57] den Modifikationen des Nationalcharakters, bei allen Staaten unverkennbar sind. Dies aber hört wenigstens immer in dem Grade auf, in welchem der Bürger von seiner Kindheit an schon zum Bürger gebildet wird. Gewiss ist es wohlthätig, wenn die Verhältnisse des Menschen und des Bürgers soviel als möglich zusammenfallen; aber es bleibt dies doch nur alsdann, wenn das des Bürgers so wenig eigenthümliche Eigenschaften fordert, dass sich die natürliche Gestalt des Menschen, ohne etwas aufzuopfern, erhalten kann — gleichsam das Ziel, wohin alle Ideen, die ich in dieser Untersuchung zu entwickeln wage, allein hinstreben. Ganz und gar aber hört es auf, heilsam zu sein, wenn der Mensch dem Bürger geopfert wird. Denn wenn gleich alsdann die nachtheiligen Folgen des Missverhältnisses hinwegfallen; so verliert auch der Mensch dasjenige, welches er gerade durch die Vereinigung in einen Staat zu sichern bemüht war. Daher müsste, meiner Meinung zufolge, die freieste, so wenig als möglich schon auf die bürgerlichen Verhältnisse gerichtete Bildung des Menschen überall vorangehen. Der so gebildete Mensch müsste dann in den Staat treten, und die Verfassung des Staats sich gleichsam an ihm prüfen. Nur bei einem solchen Kampfe würde ich wahre Verbesserung der Verfassung durch die Nation mit Gewissheit hoffen, und nur bei einem solchen schädlichen Einfluss der bürgerlichen Einrichtung auf den Menschen nicht besorgen. Denn selbst wenn die letztere sehr fehlerhaft wäre, liesse sich denken, wie gerade durch ihre einengenden Fesseln die widerstrebende, oder, trotz derselben, sich in ihrer Grösse erhaltende Energie des Menschen gewänne. Aber dies könnte nur sein, wenn dieselbe vorher sich in ihrer Freiheit entwickelt hätte. Denn welch ein ungewöhnlicher Grad gehörte dazu, sich auch da, wo jene Fesseln von der ersten Jugend an drückten, noch zu erheben und zu erhalten? Jede öffentliche Erziehung aber, da immer der Geist der Regierung in ihr herrscht, giebt dem Menschen eine gewisse bürgerliche Form.
[58]
Wo nun eine solche Form an sich bestimmt und in sich, wenn gleich einseitig, doch schön ist, wie wir es in den alten Staaten, und vielleicht noch jetzt in mancher Republik finden, da ist nicht allein die Ausführung leichter, sondern auch die Sache selbst minder schädlich. Allein in unsern monarchischen Verfassungen existirt — und gewiss zum nicht geringen Glück für die Bildung des Menschen — eine solche bestimmte Form ganz und gar nicht. Es gehört offenbar zu ihren, obgleich auch von manchen Nachtheilen begleiteten Vorzügen, dass, da doch die Staatsverbindung immer nur als ein Mittel anzusehen ist, nicht soviel Kräfte der Individuen auf dies Mittel verwandt zu werden brauchen, als in Republiken. Sobald der Unterthan den Gesetzen gehorcht, und sich und die seinigen im Wohlstande und einer nicht schädlichen Thätigkeit erhält, kümmert den Staat die genauere Art seiner Existenz nicht. Hier hätte daher die öffentliche Erziehung, die, schon als solche, sei es auch unvermerkt, den Bürger oder Unterthan, nicht den Menschen, wie die Privaterziehung, vor Augen hat, nicht Eine bestimmte Tugend oder Art zu sein zum Zweck; sie suchte vielmehr gleichsam ein Gleichgewicht aller, da nichts so sehr, als gerade dies, die Ruhe hervorbringt und erhält, welche eben diese Staaten am eifrigsten beabsichten. Ein solches Streben aber gewinnt, wie ich schon bei einer andern Gelegenheit zu zeigen versucht habe, entweder keinen Fortgang, oder führt auf Mangel an Energie; da hingegen die Verfolgung einzelner Seiten, welche der Privaterziehung eigen ist, durch das Leben in verschiedenen Verhältnissen und Verbindungen jenes Gleichgewicht sichrer und ohne Aufopferung der Energie hervorbringt.
Will man aber der öffentlichen Erziehung alle positive Beförderung dieser oder jener Art der Ausbildung untersagen, will man es ihr zur Pflicht machen, blos die eigene Entwickelung der Kräfte zu begünstigen; so ist dies einmal an sich nicht ausführbar, da was Einheit der Anordnung hat, auch allemal [59] eine gewisse Einförmigkeit der Wirkung hervorbringt, und dann ist auch unter dieser Voraussetzung der Nutzen einer öffentlichen Erziehung nicht abzusehen. Denn ist es blos die Absicht zu verhindern, dass Kinder nicht ganz unerzogen bleiben; so ist es ja leichter und minder schädlich, nachlässigen Eltern Vormünder zu setzen, oder dürftige zu unterstützen. Ferner erreicht auch die öffentliche Erziehung nicht einmal die Absicht, welche sie sich vorsetzt, nämlich die Umformung der Sitten nach dem Muster, welches der Staat für das ihm angemessenste hält. So wichtig und auf das ganze Leben einwirkend auch der Einfluss der Erziehung sein mag; so sind doch noch immer wichtiger die Umstände, welche den Menschen durch das ganze Leben begleiten. Wo also nicht alles zusammenstimmt, da vermag diese Erziehung allein nicht durchzudringen. Ueberhaupt soll die Erziehung nur, ohne Rücksicht auf bestimmte, den Menschen zu ertheilende bürgerliche Formen, Menschen bilden; so bedarf es des Staats nicht. Unter freien Menschen gewinnen alle Gewerbe bessern Fortgang; blühen alle Künste schöner auf; erweitern sich alle Wissenschaften. Unter ihnen sind auch alle Familienbande enger, die Eltern eifriger bestrebt für ihre Kinder zu sorgen, und, bei höherem Wohlstande, auch vermögender, ihrem Wunsche hierin zu folgen. Bei freien Menschen entsteht Nacheiferung, und es bilden sich bessere Erzieher, wo ihr Schicksal von dem Erfolg ihrer Arbeiten, als wo es von der Beförderung abhängt, die sie vom Staate zu erwarten haben. Es wird daher weder an sorgfältiger Familienerziehung, noch an Anstalten so nützlicher und nothwendiger gemeinschaftlicher Erziehung fehlen.[31] Soll aber öffentliche Erziehung dem Menschen eine bestimmte Form ertheilen, so ist, was man auch [60] sagen möge, zur Verhütung der Uebertretung der Gesetze, zur Befestigung der Sicherheit so gut als nichts gethan. Denn Tugend und Laster hängen nicht an dieser oder jener Art des Menschen zu sein, sind nicht mit dieser oder jener Charakterseite nothwendig verbunden; sondern es kommt in Rücksicht auf sie weit mehr auf die Harmonie oder Disharmonie der verschiedenen Charakterzüge, auf das Verhältniss der Kraft zu der Summe der Neigungen u. s. f. an. Jede bestimmte Charakterbildung ist daher eigener Ausschweifungen fähig, und artet in dieselben aus. Hat daher eine ganze Nation ausschliesslich vorzüglich eine gewisse erhalten, so fehlt es an aller entgegenstrebenden Kraft, und mithin an allem Gleichgewicht. Vielleicht liegt sogar hierin auch ein Grund der häufigen Veränderungen der Verfassung der alten Staaten. Jede Verfassung wirkte so sehr auf den Nationalcharakter, dieser, bestimmt gebildet, artete aus, und brachte eine neue hervor. Endlich wirkt öffentliche Erziehung, wenn man ihr völlige Erreichung ihrer Absicht zugestehn will, zu viel. Um die in einem Staat nothwendige Sicherheit zu erhalten, ist Umformung der Sitten selbst nicht nothwendig. Allein die Gründe, womit ich diese Behauptung zu unterstützen gedenke, bewahre ich der Folge auf, da sie auf das ganze Bestreben des Staats, auf die Sitten zu wirken, Bezug haben, und mir noch vorher von einem Paar einzelner, zu demselben gehöriger Mittel zu reden übrig bleibt. Oeffentliche Erziehung scheint mir daher ganz ausserhalb der Schranken zu liegen, in welchen der Staat seine Wirksamkeit halten muss.[32]
VII.
Religion.↩
Historischer Blick auf die Art, wie die Staaten sich der Religion bedient haben. — Jedes Einmischen des Staats in die Religion führt Begünstigung gewisser Meinungen, mit Ausschliessung andrer, und einen Grad der Leitung der Bürger mit sich. — Allgemeine Betrachtungen über den Einfluss der Religion auf den Geist und den Charakter des Menschen. — Religion und Moralität sind nicht unzertrennlich mit einander verbunden. Denn — der Ursprung aller Religionen ist gänzlich subjektiv; — Religiosität und der gänzliche Mangel derselben können gleich wohlthätige Folgen für die Moralität hervorbringen; — die Grundsätze der Moral sind von der Religion völlig unabhängig; — und die Wirksamkeit aller Religion beruht allein auf der individuellen Beschaffenheit des Menschen; — so dass dasjenige, was allein auf die Moralität wirkt, nicht der Inhalt gleichsam der Religionssysteme ist, sondern die Form des innern Annehmens derselben. — Anwendung dieser Betrachtungen auf die gegenwärtige Untersuchung, und Prüfung der Frage: ob der Staat sich der Religion, als eines Wirkungsmittels bedienen müsse? — Alle Beförderung der Religion durch den Staat bringt aufs Höchste gesetzmässige Handlungen hervor. — Dieser Erfolg aber darf dem Staate nicht genügen, welcher die Bürger dem Gesetze folgsam, nicht blos ihre Handlungen mit demselben übereinstimmend machen soll. — Derselbe ist auch an sich ungewiss, sogar unwahrscheinlich, und wenigstens durch andere Mittel besser erreichbar, als durch jenes. — Jenes Mittel führt überdies so überwiegende Nachtheile mit sich, dass schon diese den Gebrauch desselben gänzlich verbieten. — Gelegentliche Beantwortung eines hiebei möglichen, von dem Mangel an Kultur mehrerer Volksklassen hergenommenen Einwurfs. — Endlich, was die Sache aus den höchsten und allgemeinsten Gesichtspunkten entscheidet, ist dem Staat gerade zu dem Einzigen, was wahrhaft auf die Moralität wirkt, zu der Form des innern Annehmens von Religionsbegriffen, der Zugang gänzlich verschlossen. — Daher liegt alles, was die Religion betrifft, ausserhalb der Gränzen der Wirksamkeit des Staats.
Ausser der eigentlichen Erziehung der Jugend gibt es noch ein anderes Mittel auf den Charakter und die Sitten der Nation zu wirken, durch welches der Staat gleichsam den erwachsenen, reif gewordenen Menschen erzieht, sein ganzes Leben hindurch seine Handlungsweise und Denkungsart begleitet, und derselben diese oder jene Richtung zu ertheilen, oder sie wenigstens vor diesem oder jenem Abwege zu bewahren versucht — die Religion. Alle Staaten, soviel uns die Geschichte aufzeigt, haben sich dieses Mittels, obgleich in sehr verschiedener [62] Absicht, und in verschiedenem Maasse bedient. Bei den Alten war die Religion mit der Staatsverfassung innigst verbunden, eigentlich politische Stütze oder Triebfeder derselben, und es gilt daher davon alles das, was ich im Vorigen über ähnliche Einrichtungen der Alten bemerkt habe. Als die christliche Religion, statt der ehemaligen Partikulargottheiten der Nationen, eine allgemeine Gottheit aller Menschen lehrte, dadurch eine der gefährlichsten Mauern umstürzte, welche die verschiedenen Stämme des Menschengeschlechts von einander absonderten, und damit den wahren Grund aller wahren Menschentugend, Menschenentwickelung und Menschenvereinigung legte, ohne welche Aufklärung, und Kenntnisse und Wissenschaften selbst noch sehr viel länger, wenn nicht immer, ein seltenes Eigenthum einiger Wenigen geblieben wären; wurde das Band zwischen der Verfassung des Staats und der Religion lockerer. Als aber nachher der Einbruch barbarischer Völker die Aufklärung verscheuchte, Missverstand eben jener Religion einen blinden und intoleranten Eifer Proselyten zu machen eingab, und die politische Gestalt der Staaten zugleich so verändert war, dass man, statt der Bürger, nur Unterthanen, und nicht sowohl des Staats, als des Regenten fand, wurde Sorgfalt für die Erhaltung und Ausbreitung der Religion aus eigener Gewissenhaftigkeit der Fürsten geübt, welche dieselbe ihnen von der Gottheit selbst anvertraut glaubten. In neueren Zeiten ist zwar dies Vorurtheil seltener geworden, allein der Gesichtspunkt der innerlichen Sicherheit und der Sittlichkeit — als ihrer festesten Schutzwehr — hat die Beförderung der Religion durch Gesetze und Staatseinrichtungen nicht minder dringend empfohlen. Dies, glaube ich, wären etwa die Hauptepochen in der Religionsgeschichte der Staaten, ob ich gleich nicht läugnen will, dass jede der angeführten Rücksichten, und vorzüglich die letzte überall mitwirken mochte, indess freilich Eine die vorzüglichste war. Bei dem Bemühen, durch Religionsideen auf [63] die Sitten zu wirken, muss man die Beförderung einer bestimmten Religion von der Beförderung der Religiösität überhaupt unterscheiden. Jene ist unstreitig drückender und verderblicher, als diese. Allein überhaupt ist nur diese nicht leicht, ohne jene, möglich. Denn wenn der Staat einmal Moralität und Religiösität unzertrennbar vereint glaubt, und es für möglich und erlaubt hält, durch dies Mittel zu wirken; so ist es kaum möglich, dass er nicht, bei der verschiedenen Angemessenheit verschiedener Religionsmeinungen zu der wahren oder angenommenen Ideen nach geformten Moralität eine vorzugsweise vor der andern in Schutz nehme. Selbst wenn er dies gänzlich vermeidet, und gleichsam als Beschützer und Vertheidiger aller Religionspartheien auftritt; so muss er doch, da er nur nach den äusseren Handlungen zu urtheilen vermag, die Meinungen dieser Partheien mit Unterdrückung der möglichen abweichenden Meinungen Einzelner begünstigen; und wenigstens interessirt er sich auf alle Fälle insofern für Eine Meinung, als er den auf’s Leben einwirkenden Glauben an eine Gottheit allgemein zum herrschenden zu machen sucht. Hierzu kommt nun noch über dies alles, dass, bei der Zweideutigkeit aller Ausdrücke, bei der Menge der Ideen, welche sich Einem Wort nur zu oft unterschieben lassen, der Staat selbst dem Ausdruck Religiösität eine bestimmte Bedeutung unterlegen müsste, wenn er sich desselben irgend, als einer Richtschnur bedienen wollte. So ist daher, meines Erachtens, schlechterdings keine Einmischung des Staats in Religionssachen möglich, welche sich nicht, nur mehr oder minder, die Begünstigung gewisser bestimmter Meinungen zu Schulden kommen liesse, und folglich nicht die Gründe gegen sich gelten lassen müsste, welche von einer solchen Begünstigung hergenommen sind. Eben so wenig halte ich eine Art dieses Einmischens möglich, welche nicht wenigstens gewissermaassen eine Leitung, eine Hemmung der Freiheit der Individuen mit [64] sich führte. Denn wie verschieden auch sehr natürlich der Einfluss von eigentlichem Zwange, blosser Aufforderung, und endlich blosser Verschaffung leichterer Gelegenheit zu Beschäftigung mit Religionsideen ist; so ist doch selbst in dieser letzteren, wie im Vorigen bei mehreren ähnlichen Einrichtungen ausführlicher zu zeigen versucht worden ist, immer ein gewisses, die Freiheit einengendes Uebergewicht der Vorstellungsart des Staats. Diese Bemerkungen habe ich vorausschicken zu müssen geglaubt, um bei der folgenden Untersuchung dem Einwurfe zu begegnen, dass dieselbe nicht von der Sorgfalt für die Beförderung der Religion überhaupt, sondern nur von einzelnen Gattungen derselben rede, und um dieselbe nicht durch eine ängstliche Durchgehung der einzelnen möglichen Fälle zu sehr zerstückeln zu dürfen.
Alle Religion — und zwar rede ich hier von Religion, insofern sie sich auf Sittlichkeit und Glückseligkeit bezieht, und folglich in Gefühl übergegangen ist, nicht insofern die Vernunft irgend eine Religionswahrheit wirklich erkennt, oder zu erkennen meint, da Einsicht der Wahrheit unabhängig ist von allen Einflüssen des Wollens oder Begehrens, oder insofern Offenbarung irgend eine bekräftigt, da auch der historische Glaube dergleichen Einflüssen nicht unterworfen sein darf — alle Religion, sage ich, beruht auf einem Bedürfniss der Seele. Wir hoffen, wir ahnden, weil wir wünschen. Da, wo noch alle Spur geistiger Kultur fehlt, ist auch das Bedürfniss bloss sinnlich. Furcht und Hoffnung bei Naturbegebenheiten, welche die Einbildungskraft in selbstthätige Wesen verwandelt, machen den Inbegriff der ganzen Religion aus. Wo geistige Kultur anfängt, genügt dies nicht mehr. Die Seele sehnt sich dann nach dem Anschauen einer Vollkommenheit, von der ein Funke in ihr glimmt, von der sie aber ein weit höheres Maass ausser sich ahndet. Dies Anschauen geht in Bewunderung, und wenn der Mensch sich ein Verhältniss zu jenem Wesen hinzudenkt, [65] in Liebe über, aus welcher Begierde des Aehnlichwerdens, der Vereinigung entspringt. Dies findet sich auch bei denjenigen Völkern, welche noch auf den niedrigsten Stufen der Bildung stehen. Denn daraus entspringt es, wenn selbst bei den rohesten Völkern die Ersten der Nation sich von den Göttern abzustammen, zu ihnen zurückzukehren wähnen. Nur verschieden ist die Vorstellung der Gottheit nach der Verschiedenheit der Vorstellung von Vollkommenheit, die in jedem Zeitalter und unter jeder Nation herrscht. Die Götter der ältesten Griechen und Römer, und die Götter unserer entferntesten Vorfahren waren Ideale körperlicher Macht und Stärke. Als die Idee des sinnlich Schönen entstand und verfeinert ward, erhob man die personificirte sinnliche Schönheit auf den Thron der Gottheit, und so entstand die Religion, welche man Religion der Kunst nennen könnte. Als man sich von dem Sinnlichen zum rein Geistigen, von dem Schönen zum Guten und Wahren erhob, wurde der Inbegriff aller intellektuellen und moralischen Vollkommenheit Gegenstand der Anbetung, und die Religion ein Eigenthum der Philosophie. Vielleicht könnte nach diesem Maassstabe der Werth der verschiedenen Religionen gegen einander abgewogen werden, wenn Religionen nach Nationen oder Partheien, nicht nach einzelnen Individuen verschieden wären. Allein so ist Religion ganz subjektiv, beruht allein auf der Eigenthümlichkeit der Vorstellungsart jedes Menschen.
Wenn die Idee einer Gottheit die Frucht wahrer geistiger Bildung ist; so wirkt sie schön und wohlthätig auf die innere Vollkommenheit zurück. Alle Dinge erscheinen uns in veränderter Gestalt, wenn sie Geschöpfe planvoller Absicht, als wenn sie ein Werk eines vernunftlosen Zufalls sind. Die Ideen von Weisheit, Ordnung, Absicht, die uns zu unserm Handeln, und selbst zur Erhöhung unsrer intellektuellen Kräfte so nothwendig sind, fassen festere Wurzel in unserer Seele, wenn wir [66] sie überall entdecken. Das Endliche wird gleichsam unendlich, das Hinfällige bleibend, das Wandelbare stät, das Verschlungene einfach, wenn wir uns Eine ordnende Ursach an der Spitze der Dinge, und eine endlose Dauer der geistigen Substanzen denken. Unser Forschen nach Wahrheit, unser Streben nach Vollkommenheit gewinnt mehr Festigkeit und Sicherheit, wenn es ein Wesen für uns giebt, das der Quell aller Wahrheit, der Inbegriff aller Vollkommenheit ist. Widrige Schicksale werden der Seele weniger fühlbar, da Zuversicht und Hoffnung sich an sie knüpft. Das Gefühl, alles, was man besitzt, aus der Hand der Liebe zu empfangen, erhöht zugleich die Glückseligkeit und die moralische Güte. Durch Dankbarkeit bei der genossenen, durch hinlehnendes Vertrauen bei der ersehnten Freude geht die Seele aus sich heraus, brütet nicht immer, in sich verschlossen, über den eignen Empfindungen, Planen, Besorgnissen, Hoffnungen. Wenn sie das erhebende Gefühl entbehrt, sich allein alles zu danken; so geniesst sie das entzückende, in der Liebe eines andern Wesens zu leben, ein Gefühl, worin die eigne Vollkommenheit sich mit der Vollkommenheit jenes Wesens gattet. Sie wird gestimmt, andren zu sein, was andre ihr sind; will nicht, dass andre ebenso alles aus sich selbst nehmen sollen, als sie nichts von andern empfängt. Ich habe hier nur die Hauptmomente dieser Untersuchung berührt. Tiefer in den Gegenstand einzugehen, würde, nach Garves meisterhafter Ausführung, unnütz und vermessen sein.
So mitwirkend aber auf der einen Seite religiöse Ideen bei der moralischen Vervollkommnung sind; so wenig sind sie doch auf der andern Seite unzertrennlich damit verbunden. Die blosse Idee geistiger Vollkommenheit ist gross und füllend und erhebend genug, um nicht mehr einer andern Hülle oder Gestalt zu bedürfen. Und doch liegt jeder Religion eine Personificirung, eine Art der Versinnlichung zum Grunde, ein Anthropomorphismus in höherem oder geringerem Grade. [67] Jene Idee der Vollkommenheit wird auch demjenigen unaufhörlich vorschweben, der nicht gewohnt ist, die Summe alles moralisch Guten in Ein Ideal zusammenzufassen, und sich in Verhältniss zu diesem Wesen zu denken; sie wird ihm Antrieb zur Thätigkeit, Stoff aller Glückseligkeit sein. Fest durch die Erfahrung überzeugt, dass seinem Geiste Fortschreiten in höherer moralischer Stärke möglich ist, wird er mit muthigem Eifer nach dem Ziele streben, das er sich steckt. Der Gedanke der Möglichkeit der Vernichtung seines Daseins wird ihn nicht schrecken, sobald seine täuschende Einbildungskraft nicht mehr im Nichtsein das Nichtsein noch fühlt. Seine unabänderliche Abhängigkeit von äusseren Schicksalen drückt ihn nicht; gleichgültiger gegen äusseres Geniessen und Entbehren, blickt er nur auf das rein Intellektuelle und Moralische hin, und kein Schicksal vermag etwas über das Innere seiner Seele. Sein Geist fühlt sich durch Selbstgenügsamkeit unabhängig, durch die Fülle seiner Ideen, und das Bewusstsein seiner innern Stärke über den Wandel der Dinge gehoben. Wenn er nun in seine Vergangenheit zurückgeht, Schritt vor Schritt aufsucht, wie er jedes Ereigniss bald auf diese, bald auf jene Weise benutzte, wie er nach und nach zu dem ward, was er jetzt ist, wenn er so Ursach und Wirkung, Zweck und Mittel, alles in sich vereint sieht, und dann, voll des edelsten Stolzes, dessen endliche Wesen fähig sind, ausruft:
Hast du nicht alles selbst vollendet,
Heilig glühend Herz (†)?[33]
wie müssen da in ihm alle die Ideen von Alleinsein, von Hülflosigkeit, von Mangel an Schutz und Trost und Beistand verschwinden, die man gewöhnlich da glaubt, wo eine persönliche, ordnende, vernünftige Ursach der Kette des Endlichen fehlt? Dieses Selbstgefühl, dieses in und durch sich Sein wird ihn [68] auch nicht hart und unempfindlich gegen andre Wesen machen, sein Herz nicht der theilnehmenden Liebe und jeder wohlwollenden Neigung verschliessen. Eben diese Idee der Vollkommenheit, die warlich nicht blos kalte Idee des Verstandes ist, sondern warmes Gefühl des Herzens sein kann, auf die sich seine ganze Wirksamkeit bezieht, trägt sein Dasein in das Dasein andrer über. Es liegt ja in ihnen gleiche Fähigkeit zu grösserer Vollkommenheit, diese Vollkommenheit kann er hervorbringen oder erhöhen. Er ist noch nicht ganz von dem höchsten Ideale aller Moralität durchdrungen, so lange er noch sich oder andre einzeln zu betrachten vermag, so lange nicht alle geistige Wesen in der Summe der in ihnen einzeln zerstreut liegenden Vollkommenheit in seiner Vorstellung zusammenfliessen. Vielleicht ist seine Vereinigung mit den übrigen, ihm gleichartigen Wesen noch inniger, seine Theilnahme an ihrem Schicksale noch wärmer, je mehr sein und ihr Schicksal, seiner Vorstellung nach, allein von ihm und von ihnen abhängt.
Setzt man vielleicht, und nicht mit Unrecht dieser Schilderung den Einwurf entgegen, dass sie, um Realität zu erhalten, eine ausserordentliche, nicht blos gewöhnliche Stärke des Geistes und des Charakters erfordert; so darf man wiederum nicht vergessen, dass dies in gleichem Grade da der Fall ist, wo religiöse Gefühle ein wahrhaft schönes, von Kälte und Schwärmerei gleich fernes Dasein hervorbringen sollen. Auch würde dieser Einwurf überhaupt nur passend sein, wenn ich die Beförderung der zuletzt geschilderten Stimmung vorzugsweise empfohlen hätte. Allein so geht meine Absicht schlechterdings allein dahin, zu zeigen, dass die Moralität, auch bei der höchsten Konsequenz des Menschen, schlechterdings nicht von der Religion abhängig, oder überhaupt nothwendig mit ihr verbunden ist, und dadurch auch an meinem Theile zu der Entfernung auch des mindesten Schattens von Intoleranz, und der Beförderung derjenigen Achtung beizutragen, welche den [69] Menschen immer für die Denkungs- und Empfindungsweise des Menschen erfüllen sollte. Um diese Vorstellungsart noch mehr zu rechtfertigen, könnte ich jetzt auf der andern Seite auch den nachtheiligen Einfluss schildern, welches die religiöseste Stimmung, wie die am meisten entgegengesetzte, fähig ist. Allein es ist gehässig, bei so wenig angenehmen Gemälden zu verweilen, und die Geschichte schon stellt ihrer zur Genüge auf. Vielleicht führt es auch sogar eine grössere Evidenz mit sich, auf die Natur der Moralität selbst, und auf die genaue Verbindung, nicht blos der Religiösität, sondern auch der Religionssysteme der Menschen mit ihren Empfindungssystemen einen flüchtigen Blick zu werfen.
Nun ist weder dasjenige, was die Moral, als Pflicht vorschreibt, noch dasjenige, was ihren Gesetzen gleichsam die Sanktion giebt, was ihnen Interesse für den Willen leiht, von Religionsideen abhängig. Ich führe hier nicht an, dass eine solche Abhängigkeit sogar der Reinheit des moralischen Willens Abbruch thun würde. Man könnte vielleicht diesem Grundsatz in einem, aus der Erfahrung geschöpften, und auf die Erfahrung anzuwendenden Raisonnement, wie das gegenwärtige, die hinlängliche Gültigkeit absprechen. Allein die Beschaffenheiten einer Handlung, welche dieselbe zur Pflicht machen, entspringen theils aus der Natur der menschlichen Seele, theils aus der näheren Anwendung auf die Verhältnisse der Menschen gegen einander; und wenn dieselben auch unläugbar in einem ganz vorzüglichen Grade durch religiöse Gefühle empfohlen werden, so ist dies weder das einzige, noch auch bei weitem ein auf alle Charaktere anwendbares Mittel. Vielmehr beruht die Wirksamkeit der Religion schlechterdings auf der individuellen Beschaffenheit der Menschen, und ist im strengsten Verstande subjektiv. Der kalte, bloss nachdenkende Mensch, in dem die Erkenntniss nie in Empfindung übergeht, dem es genug ist, das Verhältniss der Dinge und Handlungen [70] einzusehen, um seinen Willen darnach zu bestimmen, bedarf keines Religionsgrundes, um tugendhaft zu handeln, und, soviel es seinem Charakter nach möglich ist, tugendhaft zu sein. Ganz anders ist es hingegen, wo die Fähigkeit zu empfinden sehr stark ist, wo jeder Gedanke leicht Gefühl wird. Allein auch hier sind die Nuancen unendlich verschieden. Wo die Seele einen starken Hang fühlt, aus sich hinaus in andre überzugehen, an andre sich anzuschliessen, da werden Religionsideen wirksame Triebfedern sein. Dagegen giebt es Charaktere, in welchen eine so innige Konsequenz aller Ideen und Empfindungen herrscht, die eine so grosse Tiefe der Erkenntniss und des Gefühls besitzen, dass daraus eine Stärke und Selbstständigkeit hervorgeht, welche das Hingeben des ganzen Seins an ein fremdes Wesen, das Vertrauen auf fremde Kraft, wodurch sich der Einfluss der Religion so vorzüglich äussert, weder fordert noch erlaubt. Selbst die Lagen, welche erfordert werden, um auf Religionsideen zurückzukommen, sind nach Verschiedenheit der Charaktere verschieden. Bei dem einen ist jede starke Rührung — Freude oder Kummer — bei dem andern nur das frohe Gefühl aus dem Genuss entspringender Dankbarkeit dazu hinreichend. Die letzteren Charaktere verdienen vielleicht nicht die wenigste Schätzung. Sie sind auf der einen Seite stark genug, um im Unglück nicht fremde Hülfe zu suchen, und haben auf der andern zu viel Sinn für das Gefühl geliebt zu werden, um nicht an die Idee des Genusses gern die Idee eines liebevollen Gebers zu knüpfen. Oft hat auch die Sehnsucht nach religiösen Ideen noch einen edleren, reineren, wenn ich so sagen darf, mehr intellektuellen Quell. Was der Mensch irgend um sich her erblickt, vermag er allein durch die Vermittlung seiner Organe aufzufassen; nirgends offenbart sich ihm unmittelbar das reine Wesen der Dinge; gerade das, was am heftigsten seine Liebe erregt, am unwiderstehlichsten sein ganzes Inneres ergreift, ist mit dem dichtesten Schleier umhüllt; sein [71] ganzes Leben hindurch ist seine Thätigkeit Bestreben, den Schleier zu durchdringen, seine Wollust Ahnden der Wahrheit in dem Räthsel des Zeichens, Hoffen der unvermittelten Anschauung in anderen Perioden seines Daseins. Wo nun, in wundervoller und schöner Harmonie, nach der unvermittelten Anschauung des wirklichen Daseins der Geist rastlos forscht, und das Herz sehnsuchtsvoll verlangt, wo der Tiefe der Denkkraft nicht die Dürftigkeit des Begriffs, und der Wärme des Gefühls nicht das Schattenbild der Sinne und der Phantasie genügt; da folgt der Glaube unaufhaltbar dem eigenthümlichen Triebe der Vernunft, jeden Begriff, bis zur Hinwegräumung aller Schranken, bis zum Ideal zu erweitern, und heftet sich fest an ein Wesen, das alle andre Wesen umschliesst, und rein und ohne Vermittlung existirt, anschaut und schafft. Allein oft beschränkt auch eine genügsame Bescheidenheit den Glauben innerhalb des Gebiets der Erfahrung; oft vergnügt sich zwar das Gefühl gern an dem der Vernunft so eignen Ideal, findet aber einen wollustvolleren Reiz in dem Bestreben, eingeschränkt auf die Welt, für die ihm Empfänglichkeit gewährt ist, die sinnliche und unsinnliche Natur enger zu verweben, dem Zeichen einen reicheren Sinn, und der Wahrheit ein verständlicheres, ideenfruchtbareres Zeichen zu leihen; und oft wird so der Mensch für das Entbehren jener trunkenen Begeisterung hoffender Erwartung, indem er seinem Blicke in unendliche Fernen zu schweifen verbietet, durch das ihn immer begleitende Bewusstsein des Gelingens seines Bestrebens entschädigt. Sein minder kühner Gang ist doch sichrer; der Begriff des Verstandes, an den er sich festhält, bei minderem Reichthum, doch klarer; die sinnliche Anschauung, wenn gleich weniger der Wahrheit treu, doch für ihn tauglicher, zur Erfahrung verbunden zu werden. Nichts bewundert der Geist des Menschen überhaupt so willig und mit so voller Einstimmung seines Gefühls, als weisheitsvolle Ordnung in einer zahllosen [72] Menge mannigfaltiger, vielleicht sogar mit einander streitender Individuen. Indess ist diese Bewunderung einigen noch in einem bei weitem vorzüglicheren Grade eigen, und diese verfolgen daher vor allem gern die Vorstellungsart, nach welcher Ein Wesen die Welt schuf und ordnete, und mit sorgender Weisheit erhält. Allein andern ist gleichsam die Kraft des Individuums heiliger, andre fesselt diese mehr, als die Allgemeinheit der Anordnung, und es stellt sich ihnen daher öfter und natürlicher der, wenn ich so sagen darf, entgegengesetzte Weg dar, der nämlich, auf welchen das Wesen der Individuen selbst, indem es sich in sich entwickelt, und durch Einwirkung gegenseitig modificirt, sich selbst zu der Harmonie stimmt, in welcher allein der Geist, wie das Herz des Menschen, zu ruhen vermag. Ich bin weit entfernt zu wähnen, mit diesen wenigen Schilderungen die Mannigfaltigkeit des Stoffs, dessen Reichthum jeder Klassifikation widerstrebt, erschöpft zu haben. Ich habe nur an ihnen, wie an Beispielen zeigen wollen, dass die wahre Religiösität, so wie auch jedes wahre Religionssystem, im höchsten Verstande aus dem innersten Zusammenhange der Empfindungsweise des Menschen entspringt. Unabhängig von der Empfindung und der Verschiedenheit des Charakters ist nun zwar das, was in den Religionsideen rein Intellektuelles liegt, die Begriffe von Absicht, Ordnung, Zweckmässigkeit, Vollkommenheit. Allein einmal ist hier nicht sowohl von diesen Begriffen an sich, als von ihrem Einfluss auf die Menschen die Rede, welcher letztere unstreitig keinesweges eine gleiche Unabhängigkeit behauptet; und dann sind auch diese der Religion nicht ausschliessend eigen. Die Idee von Vollkommenheit wird zuerst aus der lebendigen Natur geschöpft, dann auf die leblose übergetragen, endlich nach und nach, bis zu dem Allvollkommenen hinauf von allen Schranken entblösst. Nun aber bleiben lebendige und leblose Natur dieselben, und ist es nicht möglich, die ersten Schritte zu thun, und doch vor dem letzten [73] stehen zu bleiben? Wenn nun alle Religiösität so gänzlich auf den mannigfaltigen Modifikationen des Charakters und vorzüglich des Gefühls beruht; so muss auch ihr Einfluss auf die Sittlichkeit ganz und gar nicht von der Materie gleichsam des Inhalts der angenommenen Sätze, sondern von der Form des Annehmens, der Ueberzeugung, des Glaubens abhängig sein. Diese Bemerkung, die mir gleich in der Folge von grossem Nutzen sein wird, hoffe ich durch das Bisherige hinlänglich gerechtfertigt zu haben. Was ich vielleicht allein hier noch fürchten darf, ist der Vorwurf, in allem, was ich sagte, nur den sehr von der Natur und den Umständen begünstigten, interessanten, und eben darum seltenen Menschen vor Augen gehabt zu haben. Allein die Folge wird, hoffe ich, zeigen, dass ich den freilich grösseren Haufen keineswegs übersehe, und es scheint mir unedel, überall da, wo es der Mensch ist, welcher die Untersuchung beschäftigt, nicht aus den höchsten Gesichtspunkten auszugehen.
Kehre ich jetzt — nach diesem allgemeinen, auf die Religion und ihren Einfluss im Leben geworfenen Blick — auf die Frage zurück, ob der Staat durch die Religion auf die Sitten der Bürger wirken darf oder nicht? so ist es gewiss, dass die Mittel, welche der Gesetzgeber zum Behuf der moralischen Bildung anwendet, immer in dem Grade nützlich und zweckmässig sind, in welchem sie die innere Entwickelung der Fähigkeiten und Neigungen begünstigen. Denn alle Bildung hat ihren Ursprung allein in dem Innern der Seele, und kann durch äussere Veranstaltungen nur veranlasst, nie hervorgebracht werden. Dass nun die Religion, welche ganz auf Ideen, Empfindungen und innerer Ueberzeugung beruht, ein solches Mittel sei, ist unläugbar. Wir bilden den Künstler, indem wir sein Auge an den Meisterwerken der Kunst üben, seine Einbildungskraft mit den schönen Gestalten der Produkte des Alterthums nähren. Ebenso muss der sittliche Mensch gebildet werden durch das Anschauen [74] hoher moralischer Vollkommenheit, im Leben durch Umgang, und durch zweckmässiges Studium der Geschichte, endlich durch das Anschauen der höchsten, idealischen Vollkommenheit im Bilde der Gottheit. Aber diese letztere Ansicht ist, wie ich im Vorigen gezeigt zu haben glaube, nicht für jedes Auge gemacht, oder um ohne Bild zu reden, diese Vorstellungsart ist nicht jedem Charakter angemessen. Wäre sie es aber auch; so ist sie doch nur da wirksam, wo sie aus dem Zusammenhange aller Ideen und Empfindungen entspringt, wo sie mehr von selbst aus dem Innern der Seele hervorgeht, als von aussen in dieselbe gelegt wird. Wegräumung der Hindernisse, mit Religionsideen vertraut zu werden, und Begünstigung des freien Untersuchungsgeistes sind folglich die einzigen Mittel, deren der Gesetzgeber sich bedienen darf; geht er weiter, sucht er die Religiosität direkt zu befördern, oder zu leiten, oder nimmt er gar gewisse bestimmte Ideen in Schutz, fordert er, statt wahrer Ueberzeugung, Glauben auf Autorität; so hindert er das Aufstreben des Geistes, die Entwicklung der Seelenkräfte; so bringt er vielleicht durch Gewinnung der Einbildungskraft, durch augenblickliche Rührungen Gesetzmässigkeit der Handlungen seiner Bürger, aber nie wahre Tugend hervor. Denn wahre Tugend ist unabhängig von aller, und unverträglich mit befohlner, und auf Autorität geglaubter Religion.
Wenn jedoch gewisse Religionsgrundsätze auch nur gesetzmässige Handlungen hervorbringen, ist dies nicht genug, um den Staat zu berechtigen, sie, auch auf Kosten der allgemeinen Denkfreiheit, zu verbreiten? Die Absicht des Staats wird erreicht, wenn seine Gesetze streng befolgt werden; und der Gesetzgeber hat seiner Pflicht ein Genüge gethan, wenn er weise Gesetze giebt, und ihre Beobachtung von seinen Bürgern zu erhalten weiss. Ueberdies passt jener aufgestellte Begriff von Tugend nur auf einige wenige Klassen der Mitglieder eines Staats, nur auf die, welche ihre äussere Lage in den Stand [75] setzt, einen grossen Theil ihrer Zeit und ihrer Kräfte dem Geschäfte ihrer inneren Bildung zu weihen. Die Sorgfalt des Staats muss sich auf die grössere Anzahl erstrecken, und diese ist jenes höheren Grades der Moralität unfähig.
Ich erwähne hier nicht mehr die Sätze, welche ich in dem Anfange dieses Aufsatzes zu entwickeln versucht habe, und die in der That den Grund dieser Einwürfe umstossen, die Sätze nämlich, dass die Staatseinrichtung an sich nicht Zweck, sondern nur Mittel zur Bildung des Menschen ist, und dass es daher dem Gesetzgeber nicht genügen kann, seinen Aussprüchen Autorität zu verschaffen, wenn nicht zugleich die Mittel, wodurch diese Autorität bewirkt wird, gut, oder doch unschädlich sind. Es ist aber auch unrichtig, dass dem Staate allein die Handlungen seiner Bürger und ihre Gesetzmässigkeit wichtig sei. Ein Staat ist eine so zusammengesetzte und verwickelte Maschine, dass Gesetze, die immer nur einfach, allgemein, und von geringer Anzahl sein müssen, unmöglich allein darin hinreichen können. Das Meiste bleibt immer den freiwilligen einstimmigen Bemühungen der Bürger zu thun übrig. Man braucht nur den Wohlstand kultivirter und aufgeklärter Nationen mit der Dürftigkeit roher und ungebildeter Völker zu vergleichen, um von diesem Satze überzeugt zu werden. Daher sind auch die Bemühungen aller, die sich je mit Staatseinrichtungen beschäftigt haben, immer dahin gegangen, das Wohl des Staats zum eignen Interesse des Bürgers zu machen, und den Staat in eine Maschine zu verwandeln, die durch die innere Kraft ihrer Triebfedern in Gang erhalten würde, und nicht unaufhörlich neuer äusserer Einwirkungen bedürfte. Wenn die neueren Staaten sich eines Vorzugs vor den alten rühmen dürfen; so ist es vorzüglich weil sie diesen Grundsatz mehr realisirten. Selbst dass sie sich der Religion, als eines Bildungsmittels bedienen, ist ein Beweis davon. Doch auch die Religion, insofern nämlich durch gewisse bestimmte Sätze nur gute Handlungen hervorgebracht, [76] oder durch positive Leitung überhaupt auf die Sitten gewirkt werden soll, wie es hier der Fall ist, ist ein fremdes, von aussen einwirkendes Mittel. Daher muss es immer des Gesetzgebers letztes, aber — wie ihn wahre Kenntniss des Menschen bald lehren wird — nur durch Gewährung der höchsten Freiheit erreichbares Ziel bleiben, die Bildung der Bürger bis dahin zu erhöhen, dass sie alle Triebfedern zur Beförderung des Zwecks des Staats allein in der Idee des Nutzens finden, welchen ihnen die Staatseinrichtung zu Erreichung ihrer individuellen Absichten gewährt. Zu dieser Einsicht aber ist Aufklärung und hohe Geistesbildung nothwendig, welche da nicht emporkommen können, wo der freie Untersuchungsgeist durch Gesetze beschränkt wird.
Nur dass man sich überzeugt hält, ohne bestimmte, geglaubte Religionssätze oder wenigstens ohne Aufsicht des Staats auf die Religion der Bürger, können auch äussere Ruhe und Sittlichkeit nicht bestehen, ohne sie sei es der bürgerlichen Gewalt unmöglich, das Ansehen der Gesetze zu erhalten, macht, dass man jenen Betrachtungen kein Gehör giebt. Und doch bedurfte der Einfluss, den Religionssätze, die auf diese Weise angenommen werden und überhaupt jede, durch Veranstaltungen des Staats beförderte Religiosität haben soll, wohl erst einer strengeren und genaueren Prüfung. Bei dem rohen Theile des Volks rechnet man von allen Religionswahrheiten am meisten auf die Ideen künftiger Belohnungen und Bestrafungen. Diese mindern den Hang zu unsittlichen Handlungen nicht, befördern nicht die Neigung zum Guten, verbessern also den Charakter nicht, sie wirken blos auf die Einbildungskraft, haben folglich, wie Bilder der Phantasie überhaupt, Einfluss auf die Art zu handeln, ihr Einfluss wird aber auch durch alles das vermindert, und aufgehoben, was die Lebhaftigkeit der Einbildungskraft schwächt. Nimmt man nun hinzu, dass diese Erwartungen so entfernt, und darum, selbst [77] nach den Vorstellungen der Gläubigsten, so ungewiss sind, dass die Ideen von nachheriger Reue, künftiger Besserung, gehoffter Verzeihung, welche durch gewisse Religionsbegriffe so sehr begünstigt werden — ihnen einen grossen Theil ihrer Wirksamkeit wiederum nehmen; so ist es unbegreiflich, wie diese Ideen mehr wirken sollten, als die Vorstellung bürgerlicher Strafen, die nah, bei guten Polizeianstalten gewiss, und weder durch Reue, noch nachfolgende Besserung abwendbar sind, wenn man nur von Kindheit an die Bürger ebenso mit diesen, als mit jenen Folgen sittlicher und unsittlicher Handlungen bekannt machte. Unläugbar wirken freilich auch weniger aufgeklärte Religionsbegriffe bei einem grossen Theile des Volks auf eine edlere Art. Der Gedanke, Gegenstand der Fürsorge eines allweisen und vollkommenen Wesens zu sein, giebt ihnen mehr Würde, die Zuversicht einer endlosen Dauer führt sie auf höhere Gesichtspunkte, bringt mehr Absicht und Plan in ihre Handlungen, das Gefühl der liebevollen Güte der Gottheit giebt ihrer Seele eine ähnliche Stimmung, kurz die Religion flösst ihnen Sinn für die Schönheit der Tugend ein. Allein wo die Religion diese Wirkungen haben soll, da muss sie schon in den Zusammenhang der Ideen und Empfindungen ganz übergegangen sein, welches nicht leicht möglich ist, wenn der freie Untersuchungsgeist gehemmt, und alles auf den Glauben zurückgeführt wird; da muss auch schon Sinn für bessere Gefühle vorhanden sein; da entspringt sie mehr aus einem, nur noch unentwickelten Hange zur Sittlichkeit, auf den sie hernach nur wieder zurückwirkt. Und überhaupt wird ja niemand den Einfluss der Religion auf die Sittlichkeit ganz abläugnen wollen; es fragt sich nur immer, ob er von einigen bestimmten Religionssätzen abhängt? und dann ob er so entschieden ist, dass Moralität und Religion darum in unzertrennlicher Verbindung mit einander stehen? Beide Fragen müssen, glaube ich, verneint werden. Die Tugend stimmt so sehr mit [78] den ursprünglichen Neigungen des Menschen überein, die Gefühle der Liebe, der Verträglichkeit, der Gerechtigkeit haben so etwas Süsses, die der uneigennützigen Thätigkeit, der Aufopferung für andre so etwas Erhebendes, die Verhältnisse, welche daraus im häuslichen und gesellschaftlichen Leben überhaupt entspringen, sind so beglückend, dass es weit weniger nothwendig ist, neue Triebfedern zu tugendhaften Handlungen hervorzusuchen, als nur denen, welche schon von selbst in der Seele liegen, freiere und ungehindertere Wirksamkeit zu verschaffen.
Wollte man aber auch weiter gehen, wollte man neue Beförderungsmittel hinzufügen; so dürfte man doch nie einseitig vergessen, ihren Nutzen gegen ihren Schaden abzuwägen. Wie vielfach aber der Schade eingeschränkter Denkfreiheit ist, bedarf wohl, nachdem es so oft gesagt, und wieder gesagt ist, keiner weitläufigen Auseinandersetzung mehr; und ebenso enthält der Anfang dieses Aufsatzes schon alles, was ich über den Nachtheil jeder positiven Beförderung der Religiosität durch den Staat zu sagen für nothwendig halte. Erstreckte sich dieser Schade blos auf die Resultate der Untersuchungen, brächte er blos Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit in unsrer wissenschaftlichen Erkenntniss hervor; so möchte es vielleicht einigen Schein haben, wenn man den Nutzen, den man von dem Charakter davon erwartet — auch erwarten darf? — dagegen abwägen wollte. Allein so ist der Nachtheil bei weitem beträchtlicher. Der Nutzen freier Untersuchung dehnt sich auf unsre ganze Art, nicht blos zu denken, sondern zu handeln aus. In einem Manne, der gewohnt ist, Wahrheit und Irrthum, ohne Rücksicht auf äussere Verhältnisse für sich und gegen andre zu beurtheilen, und von andren beurtheilt zu hören, sind alle Principien des Handelns durchdachter, konsequenter, aus höheren Gesichtspunkten hergenommen, als in dem, dessen Untersuchungen unaufhörlich von Umständen geleitet werden, die [79] nicht in der Untersuchung selbst liegen. Untersuchung und Ueberzeugung, die aus der Untersuchung entspringt, ist Selbstthätigkeit; Glaube Vertrauen auf fremde Kraft, fremde intellektuelle oder moralische Vollkommenheit. Daher entsteht in dem untersuchenden Denker mehr Selbstständigkeit, mehr Festigkeit; in dem vertrauenden Gläubigen mehr Schwäche, mehr Unthätigkeit. Es ist wahr, dass der Glaube, wo er ganz herrscht, und jeden Zweifel erstickt, sogar einen noch unüberwindlicheren Muth, eine noch ausdauerndere Stärke hervorbringt, die Geschichte aller Schwärmer lehrt es. Allein diese Stärke ist nur da wünschenswerth, wo es auf einen äussern bestimmten Erfolg ankommt, zu welchem blos maschinenmässiges Wirken erfordert wird; nicht da, wo man eignes Beschliessen, durchdachte, auf Gründen der Vernunft beruhende Handlungen, oder gar innere Vollkommenheit erwartet. Denn diese Stärke selbst beruht nur auf der Unterdrückung aller eignen Thätigkeit der Vernunft. Zweifel sind nur dem quälend, welcher glaubt, nie dem, welcher blos der eignen Untersuchung folgt. Denn überhaupt sind diesem die Resultate weit weniger wichtig, als jenem. Er ist sich, während der Untersuchung, der Thätigkeit, der Stärke seiner Seele bewusst, er fühlt, dass seine wahre Vollkommenheit, seine Glückseligkeit eigentlich auf dieser Stärke beruht; statt dass Zweifel an den Sätzen, die er bisher für wahr hielt, ihn drücken sollten, freut es ihn, dass seine Denkkraft so viel gewonnen hat, Irrthümer einzusehen, die ihm vorher verborgen blieben. Der Glaube hingegen kann nur Interesse an dem Resultat selbst finden, denn für ihn liegt in der erkannten Wahrheit nichts mehr. Zweifel, die seine Vernunft erregt, peinigen ihn. Denn sie sind nicht, wie in dem selbstdenkenden Kopfe, neue Mittel zur Wahrheit zu gelangen; sie nehmen ihm blos die Gewissheit, ohne ihm ein Mittel anzuzeigen, dieselbe auf eine andre Weise wieder zu erhalten. Diese Betrachtung, weiter verfolgt, führt auf die Bemerkung, dass es [80] überhaupt nicht gut ist, einzelnen Resultaten eine so grosse Wichtigkeit beizumessen, zu glauben, dass entweder so viele andere Wahrheiten, oder so viele äussere oder innere nützliche Folgen von ihnen abhängen. Es wird dadurch zu leicht ein Stillstand in der Untersuchung hervorgebracht, und so arbeiten manchmal die freiesten und aufgeklärtesten Behauptungen gerade gegen den Grund, ohne den sie selbst nie hätten emporkommen können. So wichtig ist Geistesfreiheit, so schädlich jede Einschränkung derselben. Auf der andren Seite hingegen fehlt es dem Staate nicht an Mitteln, die Gesetze aufrecht zu erhalten, und Verbrechen zu verhüten. Man verstopfe, so viel es möglich ist, diejenigen Quellen unsittlicher Handlungen, welche sich in der Staatseinrichtung selbst finden, man schärfe die Aufsicht der Polizei auf begangene Verbrechen, man strafe auf eine zweckmässige Weise, und man wird seines Zwecks nicht verfehlen. Und vergisst man denn, dass die Geistesfreiheit selbst, und die Aufklärung, die nur unter ihrem Schutze gedeiht, das wirksamste aller Beförderungsmittel der Sicherheit ist? Wenn alle übrige nur den Ausbrüchen wehren, so wirkt sie auf Neigungen und Gesinnungen; wenn alle übrige nur eine Uebereinstimmung äussrer Handlungen hervorbringen, so schafft sie eine innere Harmonie des Willens und des Bestrebens. Wann wird man aber auch endlich aufhören, die äusseren Folgen der Handlungen höher zu achten, als die innere geistige Stimmung, aus welcher sie fliessen? wann wird der Mann aufstehen, der für die Gesetzgebung ist, was Rousseau der Erziehung war, der den Gesichtspunkt von den äussren physischen Erfolgen hinweg auf die innere Bildung des Menschen zurückzieht?
Man glaube auch nicht, dass jene Geistesfreiheit und Aufklärung nur für einige Wenige des Volks sei, dass für den grösseren Theil desselben, dessen Geschäftigkeit freilich durch die Sorge für die physischen Bedürfnisse des Lebens erschöpft wird, sie unnütz bleibe, oder gar nachtheilig werde, dass man auf ihn [81] nur durch Verbreitung bestimmter Sätze, durch Einschränkung der Denkfreiheit wirken könne. Es liegt schon an sich etwas die Menschheit Herabwürdigendes in dem Gedanken, irgend einem Menschen das Recht abzusprechen, ein Mensch zu sein. Keiner steht auf einer so niedrigen Stufe der Kultur, dass er zu Erreichung einer höheren unfähig wäre; und sollten auch die aufgeklärteren religiösen und philosophischen Ideen auf einen grossen Theil der Bürger nicht unmittelbar übergehen können, sollte man dieser Klasse von Menschen, um sich an ihre Ideen anzuschmiegen, die Wahrheit in einem andern Kleide vortragen müssen, als man sonst wählen würde, sollte man genöthigt sein, mehr zu ihrer Einbildungskraft und zu ihrem Herzen, als zu ihrer kalten Vernunft zu reden; so verbreitet sich doch die Erweiterung, welche alle wissenschaftliche Erkenntniss durch Freiheit und Aufklärung erhält, auch bis auf sie herunter, so dehnen sich doch die wohlthätigen Folgen der freien, uneingeschränkten Untersuchung auf den Geist und den Charakter der ganzen Nation bis in ihre geringsten Individua hin aus.
Um diesem Raisonnement, weil es sich grossentheils nur auf den Fall bezieht, wenn der Staat gewisse Religionssätze zu verbreiten bemüht ist, eine grössere Allgemeinheit zu geben, muss ich noch an den, im Vorigen entwickelten Satz erinnern, dass aller Einfluss der Religion auf die Sittlichkeit weit mehr — wenn nicht allein — von der Form abhängt, in welcher gleichsam die Religion im Menschen existirt, als von dem Inhalte der Sätze, welche sie ihm heilig macht. Nun aber wirkt jede Veranstaltung des Staats, wie ich gleichfalls im Vorigen zu zeigen versucht habe, nur mehr oder minder, auf diesen Inhalt, indess der Zugang zu jener Form — wenn ich mich dieses Ausdrucks ferner bedienen darf — ihm so gut als gänzlich verschlossen ist. Wie Religion in einem Menschen von selbst entstehe? wie er sie aufnehme? dies hängt gänzlich von seiner ganzen Art zu sein, zu denken und zu empfinden ab. Auch nun [82] angenommen, der Staat wäre im Stande, diese auf eine, seinen Absichten bequeme Weise umzuformen — wovon doch die Unmöglichkeit wohl unläugbar ist so wäre ich in der Rechtfertigung der, in dem ganzen bisherigen Vortrage aufgestellten Behauptungen sehr unglücklich gewesen, wenn ich hier noch alle die Gründe wiederholen müsste, welche es dem Staate überall verbieten, sich des Menschen, mit Uebersehung der individuellen Zwecke desselben, eigenmächtig zu seinen Absichten zu bedienen. Dass auch hier nicht absolute Nothwendigkeit eintritt, welche allein vielleicht eine Ausnahme zu rechtfertigen vermöchte, zeigt die Unabhängigkeit der Moralität von der Religion, die ich darzuthun versucht habe, und werden diejenigen Gründe noch in ein helleres Licht stellen, durch die ich bald zu zeigen gedenke, dass die Erhaltung der innerlichen Sicherheit in einem Staate keineswegs es erfordert, den Sitten überhaupt eine eigene bestimmte Richtung zu geben. Wenn aber irgend etwas in den Seelen der Bürger einen fruchtbaren Boden für die Religion zu bereiten vermag, wenn irgend etwas die fest aufgenommene und in das Gedanken- wie in das Empfindungssystem übergegangene Religion wohlthätig auf die Sittlichkeit zurückwirken lässt; so ist es die Freiheit, welche doch immer, wie wenig es auch sei, durch eine positive Sorgfalt des Staats leidet. Denn je mannigfaltiger und eigenthümlicher der Mensch sich ausbildet, je höher sein Gefühl sich emporschwingt; desto leichter richtet sich auch sein Blick von dem engen, wechselnden Kreise, der ihn umgiebt, auf das hin, dessen Unendlichkeit und Einheit den Grund jener Schranken und jenes Wechsels enthält, er mag nun ein solches Wesen zu finden, oder nicht zu finden vermeinen. Je freier ferner der Mensch ist, desto selbstständiger wird er in sich, und desto wohlwollender gegen andere. Nun aber führt nichts so der Gottheit zu, als wohlwollende Liebe; und macht nichts so das Entbehren der Gottheit der Sittlichkeit unschädlich, als Selbstständigkeit, die Kraft, die [83] sich in sich genügt, und sich auf sich beschränkt. Je höher endlich das Gefühl der Kraft in dem Menschen, je ungehemmter jede Aeusserung derselben; desto williger sucht er ein inneres Band, das ihn leite und führe, und so bleibt er der Sittlichkeit hold, es mag nun dies Band ihm Ehrfurcht und Liebe der Gottheit, oder Belohnung des eignen Selbstgefühls sein. Der Unterschied scheint mir demnach der: der in Religionssachen völlig sich selbst gelassene Bürger wird, nach seinem individuellen Charakter religiöse Gefühle in sein Inneres verweben, oder nicht; aber in jedem Fall wird sein Ideensystem konsequenter, seine Empfindung tiefer, in seinem Wesen mehr Einheit sein, und so wird ihn Sittlichkeit und Gehorsam gegen die Gesetze mehr auszeichnen. Der durch mancherlei Anordnungen beschränkte hingegen wird — trotz derselben — eben so verschieden Religionsideen aufnehmen, oder nicht; allein in jedem Fall wird er weniger Konsequenz der Ideen, weniger Innigkeit des Gefühls, weniger Einheit des Wesens besitzen, und so wird er die Sittlichkeit minder ehren, und dem Gesetz öfter ausweichen wollen.
Ohne also weitere Gründe hinzuzufügen, glaube ich demnach den auch an sich nicht neuen Satz aufstellen zu dürfen,
dass alles, was die Religion betrifft, ausserhalb der Gränzen der Wirksamkeit des Staats liegt, und dass die Prediger, wie der ganze Gottesdienst überhaupt, eine, ohne alle besondere Aufsicht des Staats zu lassende Einrichtung der Gemeinen sein müssten.
[84]
VIII.
Sittenverbesserung. ↩
Mögliche Mittel zu derselben. — Sie reducirt sich vorzüglich auf Beschränkung der Sinnlichkeit. — Allgemeine Betrachtungen über den Einfluss der Sinnlichkeit auf den Menschen, — Einfluss der sinnlichen Empfindungen, dieselben an sich und allein, als solche, betrachtet, — Verschiedenheit dieses Einflusses, nach ihrer eignen verschiednen Natur, vorzüglich Verschiedenheit des Einflusses der energisch wirkenden, und der übrigen sinnlichen Empfindungen. — Verbindung des Sinnlichen mit dem Unsinnlichen durch das Schöne und Erhabene. — Einfluss der Sinnlichkeit auf die forschenden, intellektuellen, — auf die schaffenden, moralischen Kräfte des Menschen, — Nachtheile und Gefahren der Sinnlichkeit, — Anwendung dieser Betrachtungen auf die gegenwärtige Untersuchung, und Prüfung der Frage: ob der Staat positiv auf die Sitten zu wirken versuchen dürfe? — Jeder solcher Versuch wirkt nur auf die äussern Handlungen — und bringt mannigfaltige und wichtige Nachtheile hervor, — Sogar das Sittenverderbniss selbst, dem er entgegen steuert, ermangelt nicht aller heilsamen Folgen — und macht wenigstens die Anwendung eines, die Sitten überhaupt umformenden Mittels nicht nothwendig. — Ein solches Mittel liegt daher ausserhalb der Gränzen der Wirksamkeit des Staats, — Höchster aus diesem, und den beiden vorhergehenden Abschnitten gezogener Grundsatz.
Das letzte Mittel, dessen sich die Staaten zu bedienen pflegen, um eine, ihrem Endzweck der Beförderung der Sicherheit angemessene Umformung der Sitten zu bewirken, sind einzelne Gesetze und Verordnungen. Da aber dies ein Weg ist, auf welchem Sittlichkeit und Tugend nicht unmittelbar befördert werden kann; so müssen sich einzelne Einrichtungen dieser Art natürlich darauf beschränken, einzelne Handlungen der Bürger zu verbieten, oder zu bestimmen, die theils an sich, jedoch ohne fremde Rechte zu kränken, unsittlich sind, theils leicht zur Unsittlichkeit führen.
Dahin gehören vorzüglich alle Luxus einschränkende Gesetze. Denn nichts ist unstreitig eine so reiche und gewöhnliche Quelle unsittlicher, selbst gesetzwidriger Handlungen, als das zu grosse Uebergewicht der Sinnlichkeit in der Seele, oder das Missverhältniss der Neigungen und Begierden überhaupt gegen die Kräfte der Befriedigung, welche die äussere Lage [85] darbietet. Wenn Enthaltsamkeit und Mässigkeit die Menschen mit den ihnen angewiesenen Kreisen zufrieden macht; so suchen sie minder, dieselben auf eine, die Rechte andrer beleidigende, oder wenigstens ihre eigne Zufriedenheit und Glückseligkeit störende Weise zu verlassen. Es scheint daher dem wahren Endzweck des Staats angemessen, die Sinnlichkeit — aus welcher eigentlich alle Kollisionen unter den Menschen entspringen, da das, worin geistige Gefühle überwiegend sind, immer und überall harmonisch mit einander bestehen kann — in den gehörigen Schranken zu halten; und, weil dies freilich das leichteste Mittel hierzu scheint, so viel als möglich zu unterdrücken.
Bleibe ich indess den bisher behaupteten Grundsätzen getreu, immer erst an dem wahren Interesse des Menschen die Mittel zu prüfen, deren der Staat sich bedienen darf; so wird es nothwendig sein, mehr den Einfluss der Sinnlichkeit auf das Leben, die Bildung, die Thätigkeit und die Glückseligkeit des Menschen, soviel es zu dem gegenwärtigen Endzwecke dient, zu untersuchen — eine Untersuchung, welche, indem sie den thätigen und geniessenden Menschen überhaupt in seinem Innern zu schildern versucht, zugleich anschaulicher darstellen wird, wie schädlich oder wohlthätig demselben überhaupt Einschränkung und Freiheit ist. Erst wenn dies geschehen ist, dürfte sich die Befugniss des Staats, auf die Sitten der Bürger positiv zu wirken, in der höchsten Allgemeinheit beurtheilen, und damit dieser Theil der Auflösung der vorgelegten Frage beschliessen lassen.
Die sinnlichen Empfindungen, Neigungen und Leidenschaften sind es, welche sich zuerst und in den heftigsten Aeusserungen im Menschen zeigen. Wo sie, ehe noch Kultur sie verfeinert, oder der Energie der Seele eine andre Richtung gegeben hat, schweigen; da ist auch alle Kraft erstorben, und es kann nie etwas Gutes und Grosses gedeihen. Sie sind es gleichsam, welche wenigstens zuerst der Seele eine belebende Wärme [86] einhauchen, zuerst zu einer eigenen Thätigkeit anspornen. Sie bringen Leben und Strebekraft in dieselbe; unbefriedigt machen sie thätig, zur Anlegung von Planen erfindsam, muthig zur Ausübung; befriedigt befördern sie ein leichtes, ungehindertes Ideenspiel. Ueberhaupt bringen sie alle Vorstellungen in grössere und mannigfaltigere Bewegung, zeigen neue Ansichten, führen auf neue, vorher unbemerkt gebliebene Seiten; ungerechnet, wie die verschiedne Art ihrer Befriedigung auf den Körper und die Organisation, und diese wieder auf eine Weise, die uns freilich nur in den Resultaten sichtbar wird, auf die Seele zurückwirkt.
Indess ist ihr Einfluss in der Intension, wie in der Art des Wirkens verschieden. Dies beruht theils auf ihrer Stärke oder Schwäche, theils aber auch — wenn ich mich so ausdrücken darf — auf ihrer Verwandtschaft mit dem Unsinnlichen, auf der grösseren oder minderen Leichtigkeit, sie von thierischen Genüssen zu menschlichen Freuden zu erheben. So leiht das Auge der Materie seiner Empfindung die für uns so genussreiche und ideenfruchtbare Form der Gestalt, so das Ohr die der verhältnissmässigen Zeitfolge der Töne. Ueber die verschiedene Natur dieser Empfindungen, und die Art ihrer Wirkung liesse sich vielleicht viel Schönes und manches Neue sagen, wozu aber schon hier nicht einmal der Ort ist. Nur Eine Bemerkung über ihren verschiedenen Nutzen zur Bildung der Seele.
Das Auge, wenn ich so sagen darf, liefert dem Verstande einen mehr vorbereiteten Stoff. Das Innere des Menschen wird uns gleichsam mit seiner, und der übrigen, immer in unserer Phantasie auf ihn bezogenen Dinge Gestalt, bestimmt, und in einem einzelnen Zustande, gegeben. Das Ohr, blos als Sinn betrachtet, und insofern es nicht Worte aufnimmt, gewährt eine bei weitem geringere Bestimmtheit. Darum räumt auch Kant den bildenden Künsten den Vorzug vor der Musik ein (†).[34] Allein [87] er bemerkt sehr richtig, dass dies auch zum Maassstabe die Kultur voraussetzt, welche die Künste dem Gemüth verschaffen, und ich möchte hinzusetzen, welche sie ihm unmittelbar verschaffen.
Es fragt sich indess, ob dies der richtige Maassstab sei? Meiner Idee nach, ist Energie die erste und einzige Tugend des Menschen. Was seine Energie erhöht, ist mehr werth, als was ihm nur Stoff zur Energie an die Hand giebt. Wie nun aber der Mensch auf Einmal nur Eine Sache empfindet, so wirkt auch das am meisten, was nur Eine Sache zugleich ihm darstellt; und wie in einer Reihe auf einander folgender Empfindungen jede einen, durch alle vorige gewirkten, und auf alle folgende wirkenden Grad hat, das, in welchem die einzelnen Bestandtheile in einem ähnlichen Verhältnisse stehen. Dies alles aber ist der Fall der Musik. Ferner ist der Musik blos diese Zeitfolge eigen; nur diese ist in ihr bestimmt. Die Reihe, welche sie darstellt, nöthigt sehr wenig zu einer bestimmten Empfindung. Es ist gleichsam ein Thema, dem man unendlich viele Texte unterlegen kann. Was ihr also die Seele des Hörenden — insofern derselbe nur überhaupt und gleichsam der Gattung nach, in einer verwandten Stimmung ist — wirklich unterlegt, entspringt völlig frei und ungebunden aus ihrer eignen Fülle, und so umfasst sie es unstreitig wärmer, als was ihr gegeben wird, und was oft mehr beschäftigt, wahrgenommen, als empfunden zu werden. Andre Eigenthümlichkeiten und Vorzüge der Musik, z. B. dass sie, da sie aus natürlichen Gegenständen Töne hervorlockt, der Natur weit näher bleibt, als Malerei, Plastik und Dichtkunst, übergehe ich hier, da es mir nicht darauf ankommt, eigentlich sie und ihre Natur zu prüfen, sondern ich sie nur als ein Beispiel brauche, um an ihr die verschiedene Natur der sinnlichen Empfindungen deutlicher darzustellen.
Die eben geschilderte Art zu wirken, ist nun nicht der [88] Musik allein eigen. Kant (†)[35] bemerkt eben sie als möglich bei einer wechselnden Farbenmischung, und in noch höherem Grade ist sie es bei dem, was wir durch das Gefühl empfinden. Selbst bei dem Geschmack ist sie unverkennbar. Auch im Geschmack ist ein Steigen des Wohlgefallens, das sich gleichsam nach einer Auflösung sehnt, und nach der gefundnen Auflösung in schwächeren Vibrationen nach und nach verschwindet. Am dunkelsten dürfte dies bei dem Geruch sein. Wie nun im empfindenden Menschen der Gang der Empfindung, ihr Grad, ihr wechselndes Steigen und Fallen, ihre — wenn ich mich so ausdrücken darf — reine und volle Harmonie eigentlich das anziehendste, und anziehender ist, als der Stoff selbst, insofern man nämlich vergisst, dass die Natur des Stoffes vorzüglich den Grad, und noch mehr die Harmonie jenes Ganges bestimmt; und wie der empfindende Mensch — gleichsam das Bild des blüthetreibenden Frühlings—gerade das interessanteste Schauspiel ist, so sucht auch der Mensch gleichsam dies Bild seiner Empfindung, mehr als irgend etwas andres, in allen schönen Künsten. So macht die Malerei, selbst die Plastik es sich eigen. Das Auge der Guido Reni’schen Madonna hält sich gleichsam nicht in den Schranken eines flüchtigen Augenblicks. Die angespannte Muskel des Borghesischen Fechters verkündet den Stoss, den er zu vollführen bereit ist. Und in noch höherem Grade benutzt dies die Dichtkunst. Ohne hier eigentlich von dem Range der schönen Künste reden zu wollen, sei es mir erlaubt, nur noch Folgendes hinzuzusetzen, um meine Idee deutlich zu machen. Die schönen Künste bringen eine doppelte Wirkung hervor, welche man immer bei jeder vereint, aber auch bei jeder in sehr verschiedener Mischung antrifft; sie geben unmittelbar Ideen, oder regen die Empfindung auf, stimmen den Ton der Seele, oder, wenn der Ausdruck nicht zu gekün [89] stelt scheint, bereichern oder erhöhen mehr ihre Kraft. Je mehr nun die eine Wirkung die andre zu Hülfe nimmt, desto mehr schwächt sie ihren eignen Eindruck. Die Dichtkunst vereinigt am meisten und vollständigsten beide, und darum ist dieselbe auf der einen Seite die vollkommenste aller schönen Künste, aber auf der andern Seite auch die schwächste. Indem sie den Gegenstand weniger lebhaft darstellt, als die Malerei und die Plastik, spricht sie die Empfindung weniger eindringend an, als der Gesang und die Musik. Allein freilich vergisst man diesen Mangel leicht, da sie — jene vorhin bemerkte Vielseitigkeit noch abgerechnet — dem innern, wahren Menschen gleichsam am nächsten tritt, den Gedanken, wie die Empfindung, mit der leichtesten Hülle bekleidet.
Die energisch wirkenden sinnlichen Empfindungen — denn nur um diese zu erläutern, rede ich hier von Künsten — wirken wiederum verschieden, theils je nachdem ihr Gang wirklich das abgemessenste Verhältniss hat, theils je nachdem die Bestandtheile selbst, gleichsam die Materie, die Seele stärker ergreifen. So wirkt die gleich richtige und schöne Menschenstimme mehr als ein todtes Instrument. Nun aber ist uns nie etwas näher, als das eigne körperliche Gefühl. Wo also dieses selbst mit im Spiele ist, da ist die Wirkung am höchsten. Aber wie immer die unverhältnissmässige Stärke der Materie gleichsam die zarte Form unterdrückt; so geschieht es auch hier oft, und es muss also zwischen beiden ein richtiges Verhältniss sein. Das Gleichgewicht bei einem unrichtigen Verhältniss kann hergestellt werden durch Erhöhung der Kraft des einen, oder Schwächung der Stärke des andern. Allein es ist immer falsch, durch Schwächung zu bilden, oder die Stärke müsste denn nicht natürlich, sondern erkünstelt sein. Wo sie aber das nicht ist, da schränke man sie nie ein. Es ist besser, dass sie sich zerstöre, als dass sie langsam hinsterbe. Doch genug hievon. Ich hoffe meine Idee hinlänglich erläutert zu haben, obgleich ich gern die [90] Verlegenheit gestehe, in der ich mich bei dieser Untersuchung befinde, da auf der einen Seite das Interesse des Gegenstandes, und die Unmöglichkeit, nur die nöthigen Resultate aus andern Schriften — da ich keine kenne, welche gerade aus meinem gegenwärtigen Gesichtspunkt ausginge — zu entlehnen, mich einlud, mich weiter auszudehnen; und auf der andern Seite die Betrachtung, dass diese Ideen nicht eigentlich für sich, sondern nur als Lehnsätze, hierhergehören, mich immer in die gehörigen Schranken zurückwies. Die gleiche Entschuldigung muss ich, auch bei dem nun Folgenden, nicht zu vergessen bitten.
Ich habe bis jetzt — obgleich eine völlige Trennung nie möglich ist — von der sinnlichen Empfindung nur als sinnlicher Empfindung zu reden versucht. Aber Sinnlichkeit und Unsinnlichkeit verknüpft ein geheimnissvolles Band, und wenn es unserm Auge versagt ist, dieses Band zu sehen, so ahnet es unser Gefühl. Dieser zwiefachen Natur der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dem angebornen Sehnen nach dieser, und dem Gefühl der gleichsam süssen Unentbehrlichkeit jener, danken wir alle, wahrhaft aus dem Wesen des Menschen entsprungene, konsequente philosophische Systeme, so wie eben daraus auch die sinnlosesten Schwärmereien entstehen. Ewiges Streben, beide dergestalt zu vereinen, dass jede so wenig als möglich der andren raube, schien mir immer das wahre Ziel des menschlichen Weisen. Unverkennbar ist überall dies ästhetische Gefühl, mit dem uns die Sinnlichkeit Hülle des Geistigen, und das Geistige belebendes Princip der Sinnenwelt ist. Das ewige Studium dieser Physiognomik der Natur bildet den eigentlichen Menschen. Denn nichts ist von so ausgebreiteter Wirkung auf den ganzen Charakter, als der Ausdruck des Unsinnlichen im Sinnlichen, des Erhabenen, des Einfachen, des Schönen in allen Werken der Natur und Produkten der Kunst, die uns umgeben. Und hier zeigt sich zugleich wieder der Unterschied der energisch wirkenden, und der übrigen sinnlichen [91] Empfindungen. Wenn das letzte Streben alles unsres menschlichsten Bemühens nur auf das Entdecken, Nähren und Erschaffen des einzig wahrhaft Existirenden, obgleich in seiner Urgestalt ewig Unsichtbaren, in uns und andren gerichtet ist, wenn es allein das ist, dessen Ahnung uns jedes seiner Symbole so theuer und heilig macht; so treten wir ihm einen Schritt näher, wenn wir das Bild seiner ewig regen Energie anschauen. Wir reden gleichsam mit ihm in schwerer und oft unverstandner, aber auch oft mit der gewissesten Wahrheitsahnung überraschender Sprache, indess die Gestalt — wieder, wenn ich so sagen darf, das Bild jener Energie — weiter von der Wahrheit entfernt ist.
Auf diesem Boden, wenn nicht allein, doch vorzüglich, blüht auch das Schöne, und noch weit mehr das Erhabene auf, das die Menschen der Gottheit gleichsam noch näher bringt. Die Nothwendigkeit eines reinen, von allen Zwecken entfernten Wohlgefallens an einem Gegenstande, ohne Begriff, bewährt ihm gleichsam seine Abstammung von dem Unsichtbaren, und seine Verwandtschaft damit; und das Gefühl seiner Unangemessenheit zu dem überschwenglichen Gegenstande verbindet, auf die menschlich göttlichste Weise, unendliche Grösse mit hingebender Demuth. Ohne das Schöne, fehlte dem Menschen die Liebe der Dinge um ihrer selbst willen; ohne das Erhabene, der Gehorsam, welcher jede Belohnung verschmäht, und niedrige Furcht nicht kennt. Das Studium des Schönen gewährt Geschmack, des Erhabnen — wenn es auch hiefür ein Studium giebt, und nicht Gefühl und Darstellung des Erhabenen allein Frucht des Genies ist — richtig abgewägte Grösse. Der Geschmack allein aber, dem allemal Grösse zum Grunde liegen muss, weil nur das Grosse des Maasses, und nur das Gewaltige der Haltung bedarf, vereint alle Töne des vollgestimmten Wesens in eine reizende Harmonie. Er bringt in alle unsre, auch blos geistigen Empfindungen und Neigungen, so etwas [92] Gemässigtes, Gehaltnes, auf Einen Punkt hin Gerichtetes. Wo er fehlt, da ist die sinnliche Begierde roh und ungebändigt, da haben selbst wissenschaftliche Untersuchungen vielleicht Scharfsinn und Tiefsinn, aber nicht Feinheit, nicht Politur, nicht Fruchtbarkeit in der Anwendung. Ueberhaupt sind ohne ihn die Tiefen des Geistes, wie die Schätze des Wissens todt und unfruchtbar, ohne ihn der Adel und die Stärke des moralischen Willens selbst rauh und ohne erwärmende Segenskraft.
Forschen und Schaffen — darum drehen und darauf beziehen sich wenigstens, wenn gleich mittelbarer oder unmittelbarer, alle Beschäftigungen des Menschen. Das Forschen, wenn es die Gründe der Dinge, oder die Schranken der Vernunft erreichen soll, setzt, ausser der Tiefe, einen mannigfaltigen Reichthum und eine innige Erwärmung des Geistes, eine Anstrengung der vereinten menschlichen Kräfte voraus. Nur der blos analytische Philosoph kann vielleicht durch die einfachen Operationen der, nicht blos ruhigen, sondern auch kalten Vernunft seinen Endzweck erreichen. Allein um das Band zu entdecken, welches synthetische Sätze verknüpft, ist eigentliche Tiefe und ein Geist erforderlich, welcher allen seinen Kräften gleiche Stärke zu verschaffen gewusst hat. So wird Kants — man kann wohl mit Wahrheit sagen — nie übertroffener Tiefsinn noch oft in der Moral und Aesthetik der Schwärmerei beschuldigt werden, wie er es schon wurde, und — wenn mir das Geständniss erlaubt ist — wenn mir selbst einige, obgleich seltne Stellen (ich führe hier, als ein Beispiel, die Deutung der Regenbogenfarben in der Kritik der Urtheilskraft an (†) [36] darauf [93] hinzuführen scheinen; so klage ich allein den Mangel der Tiefe meiner intellektuellen Kräfte an. Könnte ich diese Ideen hier weiter verfolgen, so würde ich auf die gewiss äusserst schwierige, aber auch ebenso interessante Untersuchung stossen: welcher Unterschied eigentlich zwischen der Geistesbildung des Metapkysikers und des Dichters ist? und wenn nicht vielleicht eine vollständige, wiederholte Prüfung die Resultate meines bisherigen Nachdenkens hierüber wiederum umstiesse, so würde ich diesen Unterschied blos darauf einschränken, dass der Philosoph sich allein mit Perceptionen, der Dichter hingegen mit Sensationen beschäftigt, beide aber übrigens desselben Maasses und derselben Bildung der Geisteskräfte bedürfen. Allein dies würde mich zu weit von meinem gegenwärtigen Endzwecke entfernen, und ich hoffe selbst durch die wenigen, im Vorigen angeführten Gründe, hinlänglich bescheinigt zu haben, dass, auch um den ruhigsten Denker zu bilden, Genuss der Sinne und der Phantasie oft um die Seele gespielt haben muss. Gehen wir aber gar von transcendentalen Untersuchungen zu psychologischen über, wird der Mensch, wie er erscheint, unser Studium, wie wird da nicht der das gestaltenreiche Geschlecht am tiefsten erforschen, und am wahrsten und lebendigsten darstellen, dessen eigner Empfindung selbst die wenigsten dieser Gestalten fremd sind?
Daher erscheint der also gebildete Mensch in seiner höchsten Schönheit, wenn er ins praktische Leben tritt, wenn er, was er in sich aufgenommen hat, zu neuen Schöpfungen in und ausser sich fruchtbar macht. Die Analogie zwischen den Gesetzen der plastischen Natur, und denen des geistigen Schaffens ist schon mit einem wahrlich unendlich genievollen Blicke beobachtet, und mit treffenden Bemerkungen bewährt worden.[37] Doch vielleicht wäre eine noch anziehendere [94] Ausführung möglich gewesen; statt der Untersuchung unerforschbarer Gesetze der Bildung des Keims, hätte die Psychologie vielleicht eine reichere Belehrung erhalten, wenn das geistige Schaffen gleichsam als eine feinere Blüthe des körperlichen Erzeugens näher gezeigt worden wäre.
Um auch in dem moralischen Leben von demjenigen zuerst zu reden, was am meisten blosses Werk der kalten Vernunft scheint; so macht es die Idee des Erhabenen allein möglich, dem unbedingt gebietenden Gesetze zwar allerdings, durch das Medium des Gefühls, auf eine menschliche, und doch, durch den völligen Mangel der Rücksicht auf Glückseligkeit oder Unglück, auf eine göttlich uneigennützige Weise zu gehorchen. Das Gefühl der Unangemessenheit der menschlichen Kräfte zum moralischen Gesetz, das tiefe Bewusstsein, dass der Tugendhafteste nur der ist, welcher am innigsten empfindet, wie unerreichbar hoch das Gesetz über ihn erhaben ist, erzeugt die Achtung — eine Empfindung, welche nicht mehr körperliche Hülle zu umgeben scheint, als nöthig ist, sterbliche Augen nicht durch den reinen Glanz zu verblenden. Wenn nun das moralische Gesetz jeden Menschen, als einen Zweck in sich zu betrachten nöthigt, so vereint sich mit ihm das Schönheitsgefühl, das gern jedem Staube Leben einhaucht, um, auch in ihm, an einer eignen Existenz sich zu freuen, und das um so viel voller und schöner den Menschen aufnimmt und umfasst, als es, unabhängig vom Begriff, nicht auf die kleine Anzahl der Merkmale beschränkt ist, welche der Begriff, und noch dazu nur abgeschnitten und einzeln, allein zu umfassen vermag.
Die Beimischung des Schönheitsgefühls scheint der Reinheit des moralischen Willens Abbruch zu thun, und sie könnte es allerdings, und würde es auch in der That, wenn dies Gefühl eigentlich dem Menschen Antrieb zur Moralität sein sollte. Allein es soll blos die Pflicht auf sich haben, gleichsam mannigfaltigere Anwendungen für das moralische Gesetz aufzufinden, [95] welche dem kalten und darum hier allemal unfeinen Verstande entgehen würden, und soll das Recht geniessen, dem Menschen — dem es nicht verwehrt ist, die mit der Tugend so eng verschwisterte Glückseligkeit zu empfangen, sondern nur mit der Tugend gleichsam um diese Glückseligkeit zu handlen — die süssesten Gefühle zu gewähren. Je mehr ich überhaupt über diesen Gegenstand nachdenken mag, desto weniger scheint mir der Unterschied, den ich eben bemerkte, blos subtil, und vielleicht schwärmerisch zu sein. Wie strebend der Mensch nach Genuss ist, wie sehr er sich Tugend und Glückseligkeit ewig, auch unter den ungünstigsten Umständen, vereint denken möchte; so ist doch auch seine Seele für die Grösse des moralischen Gesetzes empfänglich. Sie kann sich der Gewalt nicht erwehren, mit welcher diese Grösse sie zu handeln nöthigt, und, nur von diesem Gefühle durchdrungen, handelt sie schon darum ohne Rücksicht auf Genuss, weil sie nie das volle Bewusstsein verliert, dass die Vorstellung jedes Unglücks ihr kein andres Betragen abnöthigen würde.
Allein diese Stärke gewinnt die Seele freilich nur auf einem, dem ähnlichen Wege, von welchem ich im Vorigen rede; nur durch mächtigen inneren Drang und mannigfaltigen äussern Streit. Alle Stärke — gleichsam die Materie — stammt aus der Sinnlichkeit, und, wie weit entfernt von dem Stamme, ist sie doch noch immer, wenn ich so sagen darf, auf ihm ruhend. Wer nun seine Kräfte unaufhörlich zu erhöhen, und durch häufigen Genuss zu verjüngen sucht, wer die Stärke seines Charakters oft braucht, seine Unabhängigkeit vor der Sinnlichkeit zu behaupten, wer so diese Unabhängigkeit mit der höchsten Reizbarkeit zu vereinen bemüht ist, wessen gerader und tiefer Sinn der Wahrheit unermüdet nachforscht, wessen richtiges und feines Schönheitsgefühl keine reizende Gestalt unbemerkt lässt, wessen Drang, das ausser sich Empfundene in sich aufzunehmen und das in sich Aufgenommene zu neuen [96] Geburten zu befruchten, jede Schönheit in seine Individualität zu verwandeln, und, mit jeder sein ganzes Wesen gattend, neue Schönheit zu erzeugen strebt; der kann das befriedigende Bewusstsein nähren, auf dem richtigen Wege zu sein, dem Ideale sich zu nahen, das selbst die kühnste Phantasie der Menschheit vorzuzeichnen wagt.
Ich habe durch dies, an und für sich politischen Untersuchungen ziemlich fremdartige, allein in der von mir gewählten Folge der Ideen nothwendige Gemälde zu zeigen versucht, wie die Sinnlichkeit, mit ihren heilsamen Folgen, durch das ganze Leben, und alle Beschäftigungen des Menschen verflochten ist. Ihr dadurch Freiheit und Achtung zu erwerben, war meine Absicht. Vergessen darf ich indess nicht, dass gerade die Sinnlichkeit auch die Quelle einer grossen Menge physischer und moralischer Uebel ist. Selbst moralisch nur dann heilsam, wenn sie in richtigem Verhältniss mit der Uebung der geistigen Kräfte steht, erhält sie so leicht ein schädliches Uebergewicht. Dann wird menschliche Freude thierischer Genuss, der Geschmack verschwindet, oder erhält unnatürliche Richtungen. Bei diesem letzteren Ausdruck kann ich mich jedoch nicht enthalten, vorzüglich in Hinsicht auf gewisse einseitige Beurtheilungen, noch zu bemerken, dass nicht unnatürlich heissen muss, was nicht gerade diesen oder jenen Zweck der Natur erfüllt, sondern was den allgemeinen Endzweck derselben mit dem Menschen vereitelt. Dieser aber ist, dass sein Wesen sich zu immer höherer Vollkommenheit bilde, und daher vorzüglich, dass seine denkende und empfindende Kraft, beide in verhältnissmässigen Graden der Stärke, sich unzertrennlich vereinen. Es kann aber ferner ein Missverhältniss entstehen, zwischen der Art, wie der Mensch seine Kräfte ausbildet, und überhaupt in Thätigkeit setzt, und zwischen den Mitteln des Wirkens und Geniessens, die seine Lage ihm darbietet, und dies Missverhältniss ist eine neue Quelle von [97] Uebeln. Nach den im Vorigen ausgeführten Grundsätzen aber ist es dem Staat nicht erlaubt, mit positiven Endzwecken auf die Lage der Bürger zu wirken. Diese Lage erhält daher nicht eine so bestimmte und erzwungene Form, und ihre grössere Freiheit, wie dass sie in eben dieser Freiheit selbst grösstentheils von der Denkungs- und Handlungsart der Bürger ihre Richtung erhält, vermindert schon jenes Missverhältniss. Dennoch könnte indess die, immer übrig bleibende, wahrlich nicht unbedeutende Gefahr die Vorstellung der Nothwendigkeit erregen, der Sittenverderbniss durch Gesetze und Staatseinrichtungen entgegenzukommen.
Allein, wären dergleichen Gesetze und Einrichtungen auch wirksam, so würde nur mit dem Grade ihrer Wirksamkeit auch ihre Schädlichkeit steigen. Ein Staat, in welchem die Bürger durch solche Mittel genöthigt oder bewogen würden, auch den besten Gesetzen zu folgen, könnte ein ruhiger, friedliebender, wohlhabender Staat sein; allein er würde mir immer ein Haufe ernährter Sklaven, nicht eine Vereinigung freier, nur, wo sie die Gränze des Rechts übertreten, gebundener Menschen scheinen. Blos gewisse Handlungen, Gesinnungen hervorzubringen, giebt es freilich sehr viele Wege. Keiner von allen aber führt zur wahren, moralischen Vollkommenheit. Sinnliche Antriebe zur Begehung gewisser Handlungen, oder Nothwendigkeit sie zu unterlassen, bringen Gewohnheit hervor; durch die Gewohnheit wird das Vergnügen, das anfangs nur mit jenen Antrieben verbunden war, auf die Handlung selbst übergetragen, oder die Neigung, welche anfangs nur vor der Nothwendigkeit schwieg, gänzlich erstickt; so wird der Mensch zu tugendhaften Handlungen, gewissermassen auch zu tugendhaften Gesinnungen geleitet. Allein die Kraft seiner Seele wird dadurch nicht erhöht; weder seine Ideen über seine Bestimmung und seinen Werth erhalten dadurch mehr Aufklärung, noch sein Wille mehr Kraft, die herrschende Neigung zu besiegen; an wahrer, [98] eigentlicher Vollkommenheit gewinnt er folglich nichts. Wer also Menschen bilden, nicht zu äussern Zwecken ziehen will, wird sich dieser Mittel nie bedienen. Denn abgerechnet, dass Zwang und Leitung nie Tugend hervorbringen; so schwächen sie auch noch immer die Kraft. Was sind aber Sitten, ohne moralische Stärke und Tugend? Und wie gross auch das Uebel des Sittenverderbnisses sein mag, es ermangelt selbst der heilsamen Folgen nicht. Durch die Extreme müssen die Menschen zu der Weisheit und Tugend mittlerem Pfad gelangen. Extreme müssen, gleich grossen, in die Ferne leuchtenden Massen, weit wirken. Um den feinsten Adern des Körpers Blut zu verschaffen, muss eine beträchtliche Menge in den grossen vorhanden sein. Hier die Ordnung der Natur stören wollen, heisst moralisches Uebel anrichten, um physisches zu verhüten.
Es ist aber auch, meines Erachtens, unrichtig, dass die Gefahr des Sittenverderbnisses so gross und dringend sei; und so manches auch schon zu Bestätigung dieser Behauptung im Vorigen gesagt worden ist, so mögen doch noch folgende Bemerkungen dazu dienen, sie ausführlicher zu beweisen:
1. Der Mensch ist an sich mehr zu wohlthätigen, als eigennützigen Handlungen geneigt. Dies zeigt sogar die Geschichte der Wilden. Die häuslichen Tugenden haben so etwas Freundliches, die öffentlichen des Bürgers so etwas Grosses und Hinreissendes, dass auch der blos unverdorbene Mensch ihrem Reiz selten widersteht.
2. Die Freiheit erhöht die Kraft, und führt, wie immer die grössere Stärke, allemal eine Art der Liberalität mit sich. Zwang erstickt die Kraft, und führt zu allen eigennützigen Wünschen, und allen niedrigen Kunstgriffen der Schwäche. Zwang hindert vielleicht manche Vergehung, raubt aber selbst den gesetzmässigen Handlungen von ihrer Schönheit. Freiheit veranlasst vielleicht manche Vergehung, giebt aber selbst dem Laster eine minder unedle Gestalt.
[99]
3. Der sich selbst überlassene Mensch kommt schwerer auf richtige Grundsätze, allein sie zeigen sich unaustilgbar in seiner Handlungsweise. Der absichtlich geleitete empfängt sie leichter, aber sie weichen auch sogar seiner doch geschwächten Energie.
4. Alle Staatseinrichtungen, indem sie ein mannigfaltiges und sehr verschiedenes Interesse in eine Einheit bringen sollen, verursachen vielerlei Kollisionen. Aus den Kollisionen entstehen Missverhältnisse zwischen dem Verlangen und dem Vermögen der Menschen; und aus diesen Vergehungen. Je müssiger also — wenn ich so sagen darf — der Staat, desto geringer die Anzahl dieser. Wäre es, vorzüglich in gegebenen Fällen möglich, genau die Uebel aufzuzählen, welche Polizeieinrichtungen veranlassen, und welche sie verhüten, die Zahl der ersteren würde allemal grösser sein.
5. Wieviel strenge Aufsuchung der wirklich begangenen Verbrechen, gerechte und wohl abgemessene, aber unerlässliche Strafe, folglich seltne Straflosigkeit vermag, ist praktisch noch nie hinreichend versucht worden.
Ich glaube nunmehr für meine Absicht hinlänglich gezeigt zu haben, wie bedenklich jedes Bemühen des Staats ist, irgend einer — nur nicht unmittelbar fremdes Recht kränkenden Ausschweifung der Sitten entgegen, oder gar zuvorzukommen, wie wenig dann insbesondere heilsame Folgen auf die Sittlichkeit selbst zu erwarten sind, und wie ein solches Wirken auf den Charakter der Nation, selbst zur Erhaltung der Sicherheit, nicht nothwendig ist. Nimmt man nun noch hinzu die im Anfange dieses Aufsatzes entwickelten Gründe, welche jede auf positive Zwecke gerichtete Wirksamkeit des Staats missbilligen, und die hier um so mehr gelten, als gerade der moralische Mensch jede Einschränkung am tiefsten fühlt; und vergisst man nicht, dass, wenn irgend eine Art der Bildung der Freiheit ihre höchste Schönheit dankt, dies gerade die Bildung [100] der Sitten und des Charakters ist; so dürfte die Richtigkeit des folgenden Grundsatzes keinem weiteren Zweifel unterworfen sein, des Grundsatzes nämlich:
dass der Staat sich schlechterdings alles Bestrebens, direkt oder indirekt auf die Sitten und den Charakter der Nation anders zu wirken, als insofern dies als eine natürliche, von selbst entstehende Folge seiner übrigen schlechterdings nothwendigen Maassregeln unvermeidlich ist, gänzlich enthalten müsse, und dass alles, was diese Absicht befördern kann, vorzüglich alle besondere Aufsicht auf Erziehung, Religionsanstalten, Luxusgesetze u. s. f. schlechterdings ausserhalb der Schranken seiner Wirksamkeit liege.
IX.
Nähere, positive Bestimmung der Sorgfalt des Staats für die Sicherheit. Entwickelung des Begriffs der Sicherheit.↩
Rückblick auf den Gang der ganzen Untersuchung. — Aufzählung des noch Mangelnden. — Bestimmung des Begriffs der Sicherheit. — Definition. — Rechte, für deren Sicherheit gesorgt werden muss. — Rechte der einzelnen Bürger. — Rechte des Staats. — Handlungen, welche die Sicherheit stören. — Eintheilung des noch übrigen Theils der Untersuchung.
Nachdem ich jetzt die wichtigsten und schwierigsten Theile der gegenwärtigen Untersuchung geendigt habe, und ich mich nun der völligen Auflösung der vorgelegten Frage nähere, ist es nothwendig, wiederum einmal einen Blick zurück auf das bis hieher entwickelte Ganze zu werfen. Zuerst ist die Sorgfalt des Staats von allen denjenigen Gegenständen entfernt worden, welche nicht zur Sicherheit der Bürger, der auswärtigen sowohl als der innerlichen, gehören. Dann ist aber diese Sicherheit als der eigentliche Gegenstand der Wirksamkeit des Staats dargestellt, und endlich das Princip festgesetzt worden, dass, um dieselbe zu befördern und zu erhalten, nicht [101] auf die Sitten und den Charakter der Nation selbst zu wirken, diesem eine bestimmte Richtung zu geben, oder zu nehmen, versucht werden dürfe. Gewissermassen könnte daher die Frage: in welchen Schranken der Staat seine Wirksamkeit halten müsse? schon vollständig beantwortet scheinen, indem diese Wirksamkeit auf die Erhaltung der Sicherheit, und in Absicht der Mittel hiezu noch genauer auf diejenigen eingeschränkt ist, welche sich nicht damit befassen, die Nation zu den Endzwecken des Staats gleichsam bilden, oder vielmehr ziehen zu wollen. Denn wenn diese Bestimmung gleich nur negativ ist, so zeigt sich doch das, was, nach geschehener Absonderung, übrig bleibt, von selbst deutlich genug. Der Staat wird nämlich allein sich auf Handlungen, welche unmittelbar und geradezu in fremdes Recht eingreifen, ausbreiten, nur das streitige Recht entscheiden, das verletzte wieder herstellen und die Verletzer bestrafen dürfen. Allein der Begriff der Sicherheit, zu dessen näherer Bestimmung bis jetzt nichts andres gesagt ist, als dass von der Sicherheit vor auswärtigen Feinden, und vor Beeinträchtigungen der Mitbürger selbst die Rede sei, ist zu weit und vielumfassend, um nicht einer genaueren Auseinandersetzung zu bedürfen. Denn so verschieden auf der einen Seite die Nüancen von dem blos Ueberzeugung beabsichtenden Rath zur zudringlichen Empfehlung, und von da z um nöthigenden Zwange, und eben so verschieden und vielfach die Grade der Unbilligkeit oder Ungerechtigkeit von der, innerhalb der Schranken des eignen Rechts ausgeübten, aber dem andern möglicherweise schädlichen Handlung, bis zu der, gleichfalls sich nicht aus jenen Schranken entfernenden, aber den andern im Genuss seines Eigenthums sehr leicht, oder immer störenden, und von da bis zu einem wirklichen Eingriff in fremdes Eigenthum sind; ebenso verschieden ist auch der Umfang des Begriffs der Sicherheit, indem man darunter Sicherheit von einem solchen oder solchen Grade des Zwanges, [102] oder einer so nah oder so fern das Recht kränkenden Handlung verstehen kann. Gerade aber dieser Umfang ist von überaus grosser Wichtigkeit, und wird er zu weit ausgedehnt, oder zu eng eingeschränkt; so sind wiederum, wenn gleich unter andern Namen, alle Gränzen vermischt. Ohne eine genaue Bestimmung jenes Umfangs also ist an eine Berichtigung dieser Gränzen nicht zu denken. Dann müssen auch die Mittel, deren sich der Staat bedienen darf, oder nicht, noch bei weitem genauer auseinandergesetzt und geprüft werden. Denn wenn gleich ein auf die wirkliche Umformung der Sitten gerichtetes Bemühen des Staats, nach dem Vorigen, nicht rathsam scheint, so ist hier doch noch für die Wirksamkeit des Staats ein viel zu unbestimmter Spielraum gelassen, und z. B. die Frage noch sehr wenig erörtert, wie weit die einschränkenden Gesetze des Staats sich von der, unmittelbar das Recht andrer beleidigenden Handlung entfernen? inwiefern derselbe wirkliche Verbrechen durch Verstopfung ihrer Quellen, nicht in dem Charakter der Bürger, aber in den Gelegenheiten der Ausübung verhüten darf? Wie sehr aber, und mit wie grossem Nachtheile hierin zu weit gegangen werden kann, ist schon daraus klar, dass gerade Sorgfalt für die Freiheit mehrere gute Köpfe vermocht hat, den Staat für das Wohl der Bürger überhaupt verantwortlich zu machen, indem sie glaubten, dass dieser allgemeinere Gesichtspunkt die ungehemmte Thätigkeit der Kräfte befördern würde. Diese Betrachtungen nöthigen mich daher zu dem Geständniss, bis hieher mehr grosse, und in der That ziemlich sichtbar ausserhalb der Schranken der Wirksamkeit des Staats liegende Stücke abgesondert, als die genaueren Gränzen, und gerade da, wo sie zweifelhaft und streitig scheinen konnten, bestimmt zu haben. Dies bleibt mir jetzt zu thun übrig, und sollte es mir auch selbst nicht völlig gelingen, so glaube ich doch wenigstens dahin streben zu müssen, die Gründe dieses Misslingens so deutlich und vollständig als [103] möglich darzustellen. Auf jeden Fall aber hoffe ich, mich nur sehr kurz fassen zu können, da alle Grundsätze, deren ich zu dieser Arbeit bedarf, schon im Vorigen — wenigstens so viel es meine Kräfte erlaubten — erörtert und bewiesen worden sind.
Sicher nenne ich die Bürger in einem Staat, wenn sie in der Ausübung der ihnen zustehenden Rechte, dieselben mögen nun ihre Person, oder ihr Eigenthum betreffen, nicht durch fremde Eingriffe gestört werden; Sicherheit folglich — wenn der Ausdruck nicht zu kurz, und vielleicht dadurch undeutlich scheint, Gewissheit der gesetzmässigen Freiheit. Diese Sicherheit wird nun nicht durch alle diejenigen Handlungen gestört, welche den Menschen an irgend einer Thätigkeit seiner Kräfte, oder irgend einem Genuss seines Vermögens hindern, sondern nur durch solche, welche dies widerrechtlich thun. Diese Bestimmung, so wie die obige Definition, ist nicht willkürlich von mir hinzugefügt, oder gewählt worden. Beide fliessen unmittelbar aus dem oben entwickelten Raisonnement. Nur wenn man dem Ausdrucke der Sicherheit diese Bedeutung unterlegt, kann jenes Anwendung finden. Denn nur wirkliche Verletzungen des Rechts bedürfen einer andern Macht, als die ist, welche jedes Individuum besitzt; nur was diese Verletzungen verhindert, bringt der wahren Menschenbildung reinen Gewinn, indess jedes andre Bemühen des Staats ihr gleichsam Hindernisse in den Weg legt; nur das endlich fliesst aus dem untrüglichen Princip der Nothwendigkeit, da alles andre blos auf den unsichern Grund einer, nach täuschenden Wahrscheinlichkeiten berechneten Nützlichkeit gebaut ist.
Diejenigen, deren Sicherheit erhalten werden muss, sind auf der einen Seite alle Bürger, in völliger Gleichheit, auf der andern der Staat selbst. Die Sicherheit des Staats selbst hat ein Objekt von grösserem oder geringerem Umfange, je weiter [104] man seine Rechte ausdehnt, oder je enger man sie beschränkt, und daher hängt hier die Bestimmung von der Bestimmung des Zwecks derselben ab. Wie ich nun diese hier bis jetzt versucht habe, dürfte er für nichts andres Sicherheit fordern können, als für die Gewalt, welche ihm eingeräumt, und das Vermögen, welches ihm zugestanden worden. Hingegen Handlungen in Hinsicht auf diese Sicherheit einschränken, wodurch ein Bürger, ohne eigentliches Recht zu kränken — und folglich vorausgesetzt, dass er nicht in einem besondern persönlichen, oder temporellen Verhältnisse mit dem Staat stehe, wie z. B. zur Zeit eines Krieges — sich oder sein Eigenthum ihm entzieht, könnte er nicht. Denn die Staatsvereinigung ist blos ein untergeordnetes Mittel, welchem der wahre Zweck, der Mensch, nicht aufgeopfert werden darf, es müsste denn der Fall einer solchen Kollision eintreten, dass, wenn auch der Einzelne nicht verbunden wäre, sich zum Opfer zu geben, doch die Menge das Recht hätte, ihn als Opfer zu nehmen. Ueberdies aber darf, den entwickelten Grundsätzen nach, der Staat nicht für das Wohl der Bürger sorgen, und um ihre Sicherheit zu erhalten, kann das nicht nothwendig sein, was gerade die Freiheit und mithin auch die Sicherheit aufhebt.
Gestört wird die Sicherheit entweder durch Handlungen, welche an und für sich in fremdes Recht eingreifen, oder durch solche, von deren Folgen nur dies zu besorgen ist. Beide Gattungen der Handlungen muss der Staat jedoch mit Modificationen, welche gleich der Gegenstand der Untersuchung sein werden, verbieten, zu verhindern suchen; wenn sie geschehen sind, durch rechtlich bewirkten Ersatz des angerichteten Schadens, soviel es möglich ist, unschädlich, und, durch Bestrafung, für die Zukunft seltner zu machen bemüht sein. Hieraus entspringen Polizei- Civil- und Kriminalgesetze, um den gewöhnlichen Ausdrücken treu zu bleiben. Hiezu kommt aber noch ein anderer Gegenstand, welcher, seiner eigenthümlichen Natur [105] nach, eine völlig eigne Behandlung verdient. Es giebt nämlich eine Klasse der Bürger, auf welche die im Vorigen entwickelten Grundsätze, da sie doch immer den Menschen in seinen gewöhnlichen Kräften voraussetzen, nur mit manchen Verschiedenheiten passen, ich meine diejenigen, welche noch nicht das Alter der Reife erlangt haben, oder welche Verrücktheit oder Blödsinn des Gebrauchs ihrer menschlichen Kräfte beraubt. Für die Sicherheit dieser muss der Staat gleichfalls Sorge tragen, und ihre Lage kann, wie sich schon voraussehen lässt, leicht eine eigne Behandlung erfordern. Es muss also noch zuletzt das Verhältniss betrachtet werden, in welchem der Staat — wie man sich auszudrücken pflegt — als Ober-Vormund, zu allen Unmündigen unter den Bürgern steht. So glaube ich — da ich von der Sicherheit gegen auswärtige Feinde wohl, nach dem im Vorigen Gesagten, nichts mehr hinzuzusetzen brauche — die Aussenlinien aller Gegenstände gezeichnet zu haben, auf welche der Staat seine Aufmerksamkeit richten muss. Weit entfernt nun in alle, hier genannte, so weitläuftige und schwierige Materien irgend tief eindringen zu wollen, werde ich mich begnügen, bei einer jeden, so kurz als möglich, die höchsten Grundsätze, insofern sie die gegenwärtige Untersuchung angehen, zu entwickeln. Erst wenn dies geschehen ist, wird auch nur der Versuch vollendet heissen können, die vorgelegte Frage gänzlich zu erschöpfen, und die Wirksamkeit des Staats von allen Seiten her mit den gehörigen Gränzen zu umschliessen.
[106]
X.
Sorgfalt des Staats für die Sicherheit durch Bestimmung solcher Handlungen der Bürger, welche sich unmittelbar und geradezu nur auf den Handlenden selbst beziehen. (Polizeigesetze.) ↩
Ueber den Ausdruck Polizeigesetze. — Der einzige Grund, welcher den Staat hier zu Beschränkungen berechtigt, ist, wenn die Folgen solcher Handlungen die Rechte andrer schmälern. — Beschaffenheit der Folgen, welche eine solche Schmälerung enthalten. — Erläuterung durch das Beispiel Aergerniss erregender Handlungen. — Vorsichtsregeln für den Staat für den Fall solcher Handlungen, deren Folgen dadurch den Rechten andrer gefährlich werden können, weil ein seltner Grad der Beurtheilungskraft und der Kenntnisse erfordert wird, um der Gefahr zu entgehen, — Welche Nähe der Verbindung jener Folgen mit der Handlung selbst nothwendig ist, um Beschränkungen zu begründen? — Höchster aus dem Vorigen gezogener Grundsatz. — Ausnahmen desselben. — Vortheile, wenn die Bürger freiwillig durch Verträge bewirken, was der Staat sonst durch Gesetze bewirken muss. — Prüfung der Frage: ob der Staat zu positiven Handlungen zwingen kann. — Verneinung, weil — ein solcher Zwang schädlich, — zur Erhaltung der Sicherheit nicht nothwendig ist. — Ausnahmen des Nothrechts. — Handlungen, welche auf gemeinschaftlichem Eigenthum geschehen, oder dasselbe betreffen.
Um — wie es jetzt geschehen muss — dem Menschen durch alle die mannigfaltigen Verhältnisse des Lebens zu folgen, wird es gut sein, bei demjenigen zuerst anzufangen, welches unter allen das einfachste ist, bei dem Falle nämlich, wo der Mensch, wenn gleich in Verbindung mit andern lebend, doch völlig innerhalb der Schranken seines Eigenthums bleibt, und nichts vornimmt, was sich unmittelbar und geradezu auf andre bezieht. Von diesem Fall handeln die meisten der sogenannten Polizeigesetze. Denn so schwankend auch dieser Ausdruck ist; so ist dennoch wohl die wichtigste und allgemeinste Bedeutung die, dass diese Gesetze, ohne selbst Handlungen zu betreffen, wodurch fremdes Recht unmittelbar gekränkt wird, nur von Mitteln reden, dergleichen Kränkungen vorzubeugen; sie mögen nun entweder solche Handlungen beschränken, deren Folgen selbst dem fremden Rechte leicht gefährlich werden können, oder solche, welche gewöhnlich zu Uebertretungen der [107] Gesetze führen, oder endlich dasjenige bestimmen, was zur Erhaltung oder Ausübung der Gewalt des Staats selbst nothwendig ist. Dass auch diejenigen Verordnungen, welche nicht die Sicherheit, sondern das Wohl der Bürger zum Zweck haben, ganz vorzüglich diesen Namen erhalten, übergehe ich hier, weil es nicht zu meiner Absicht dient. Den im Vorigen festgesetzten Principien zufolge, darf nun der Staat hier, in diesem einfachen Verhältnisse des Menschen, nichts weiter verbieten, als was mit Grund Beeinträchtigung seiner eignen Rechte, oder der Rechte der Bürger besorgen lässt. Und zwar muss in Absicht der Rechte des Staats hier dasjenige angewandt werden, was von dem Sinne dieses Ausdrucks so eben allgemein erinnert worden ist. Nirgends also, wo der Vortheil oder der Schade nur den Eigenthümer allein trifft, darf der Staat sich Einschränkungen durch Prohibitiv-Gesetze erlauben. Allein es ist auch, zur Rechtfertigung solcher Einschränkungen nicht genug, dass irgend eine Handlung einem andren blos Abbruch thue; sie muss auch sein Recht schmälern. Diese zweite Bestimmung erfordert also eine weitere Erklärung. Schmälerung des Rechts nämlich ist nur überall da, wo jemandem, ohne seine Einwilligung, oder gegen dieselbe, ein Theil seines Eigenthums, oder seiner persönlichen Freiheit entzogen wird. Wo hingegen keine solche Entziehung geschieht, wo nicht der eine gleichsam in den Kreis des Rechts des andern eingreift, da ist, welcher Nachtheil auch für ihn entstehen möchte, keine Schmälerung der Befugnisse. Ebensowenig ist diese da, wo selbst der Nachtheil nicht eher entsteht, als bis der, welcher ihn leidet, auch seinerseits thätig wird, die Handlung — um mich so auszudrücken — auffasst, oder wenigstens der Wirkung derselben nicht wie er könnte entgegenarbeitet.
Die Anwendung dieser Bestimmungen ist von selbst klar; ich erinnere nur hier an ein Paar merkwürdige Beispiele. Es fällt nämlich, diesen Grundsätzen nach, schlechterdings alles [108] weg, was man von Aergerniss erregenden Handlungen in Absicht auf Religion und Sitten besonders sagt. Wer Dinge äussert, oder Handlungen vornimmt, welche das Gewissen und die Sittlichkeit des andern beleidigen, mag allerdings unmoralisch handeln, allein, so fern er sich keine Zudringlichkeit zu Schulden kommen lässt, kränkt er kein Recht. Es bleibt dem andern unbenommen, sich von ihm zu entfernen, oder macht die Lage dies unmöglich, so trägt er die unvermeidliche Unbequemlichkeit der Verbindung mit ungleichen Charakteren, und darf nicht vergessen, dass vielleicht auch jener durch den Anblick von Seiten gestört wird, die ihm eigenthümlich sind, da, auf wessen Seite sich das Recht befinde? immer nur da wichtig ist, wo es nicht an einem Rechte zu entscheiden fehlt. Selbst der doch gewiss weit schlimmere Fall, wenn der Anblick dieser oder jener Handlung, das Anhören dieses oder jenen Raisonnements die Tugend oder die Vernunft und den gesunden Verstand andrer verführte, würde keine Einschränkung der Freiheit erlauben. Wer so handelte, oder sprach, beleidigte dadurch an sich Niemandes Recht, und es stand dem andren frei, dem üblen Eindruck bei sich selbst Stärke des Willens, oder Gründe der Vernunft entgegenzusetzen. Daher denn auch, wie gross sehr oft das hieraus entspringende Uebel sein mag, wiederum auf der andren Seite nie der gute Erfolg ausbleibt, dass in diesem Fall die Stärke des Charakters, in dem vorigen die Toleranz und die Vielseitigkeit der Ansicht geprüft wird und gewinnt. Ich brauche hier wohl nicht zu erinnern, dass ich an diesen Fällen hier nichts weiter betrachte, als ob sie die Sicherheit der Bürger stören? Denn ihr Verhältniss zur Sittlichkeit der Nation, und was dem Staat in dieser Hinsicht erlaubt sein kann, oder nicht? habe ich schon im Vorigen auseinanderzusetzen versucht.
Da es indess mehrere Dinge giebt, deren Beurtheilung positive, nicht jedem eigne Kenntnisse erfordert, und wo daher die [109] Sicherheit gestört werden kann, wenn jemand vorsätzlicher oder unbesonnener Weise die Unwissenheit andrer zu seinem Vortheile benutzt; so muss es den Bürgern frei stehen, in diesen Fällen den Staat gleichsam um Rath zu fragen. Vorzüglich auffallende Beispiele hievon geben theils wegen der Häufigkeit des Bedürfnisses, theils wegen der Schwierigkeit der Beurtheilung und endlich wegen der Grösse des zu besorgenden Nachtheils, Aerzte, und zum Dienst der Partheien bestimmte Rechtsgelehrte ab. Um nun in diesen Fällen dem Wunsche der Nation zuvorzukommen, ist es nicht blos rathsam, sondern sogar nothwendig, dass der Staat diejenigen, welche sich zu solchen Geschäften bestimmen — insofern sie sich einer Prüfung unterwerfen wollen — prüfe, und wenn die Prüfung gut ausfällt, mit einem Zeichen der Geschicklichkeit versehe, und nun den Bürgern bekannt mache, dass sie ihr Vertrauen nur denjenigen gewiss schenken können, welche auf diese Weise bewährt gefunden worden sind. Weiter aber dürfte er auch nie gehen, nie weder denen, welche entweder die Prüfung ausgeschlagen, oder in derselben unterlegen, die Uebung ihres Geschäfts, noch der Nation den Gebrauch derselben untersagen. Dann dürfte er dergleichen Veranstaltungen auch auf keine andre Geschäfte ausdehnen, als auf solche, wo einmal nicht auf das Innere, sondern nur auf das Aeussere des Menschen gewirkt werden soll, wo dieser folglich nicht selbst mitwirkend, sondern nur folgsam und leidend zu sein braucht, und wo es demnach nur auf die Wahrheit oder Falschheit der Resultate ankommt; und wo zweitens die Beurtheilung Kenntnisse voraussetzt, die ein ganz abgesondertes Gebiet für sich ausmachen, nicht durch Uebung des Verstandes, und der praktischen Urtheilskraft erworben werden, und deren Seltenheit selbst das Rathfragen erschwert. Handelt der Staat gegen die letztere Bestimmung, so geräth er in Gefahr, die Nation träge, unthätig, immer vertrauend auf fremde Kenntniss und fremden Willen zu machen, da gerade [110] der Mangel sicherer, bestimmter Hülfe sowohl zu Bereicherung der eigenen Erfahrung und Kenntniss mehr anspornt, als auch die Bürger unter einander enger und mannigfaltiger verbindet, indem sie mehr einer von dem Rathe des andern abhängig sind. Bleibt er der ersteren Bestimmung nicht getreu; so entspringen, neben dem eben erwähnten, noch alle, im Anfange dieses Aufsatzes weiter ausgeführte Nachtheile. Schlechterdings müsste daher eine solche Veranstaltung wegfallen, um auch hier wiederum ein merkwürdiges Beispiel zu wählen, bei Religionslehrern. Denn was sollte der Staat bei ihnen prüfen? Bestimmte Sätze — davon hängt, wie oben genauer gezeigt ist, die Religion nicht ab; das Maass der intellectuellen Kräfte überhaupt — allein bei dem Religionslehrer, welcher bestimmt ist, Dinge vorzutragen, die in so genauem Zusammenhange mit der Individualität seiner Zuhörer stehen, kommt es beinah einzig auf das Verhältniss seines Verstandes, zu dem Verstande dieser an, und so wird schon dadurch die Beurtheilung unmöglich; die Rechtschaffenheit und den Charakter — allein dafür giebt es keine andere Prüfung, als gerade eine solche, zu welcher die Lage des Staats sehr unbequem ist, Erkundigung nach den Umständen, dem bisherigen Betragen des Menschen u. s. f. Endlich müsste überhaupt, auch in den oben von mir selbst gebilligten Fällen, eine Veranstaltung dieser Art doch nur immer da gemacht werden, wo der nicht zweifelhafte Wille der Nation sie forderte. Denn an sich ist sie unter freien, durch Freiheit selbst kultivirten Menschen, nicht einmal nothwendig, und immer könnte sie doch manchem Missbrauch unterworfen sein. Da es mir überhaupt hier nicht um Ausführung einzelner Gegenstände, sondern nur um Bestimmung der Grundsätze zu thun ist, so will ich noch einmal kurz den Gesichtspunkt angeben, aus welchem allein ich einer solchen Einrichtung erwähnte. Der Staat soll nämlich auf keine Weise für das positive Wohl der Bürger sorgen, daher auch nicht für ihr Leben und ihre [111] Gesundheit — es müssten denn Handlungen andrer ihnen Gefahr drohen — aber wohl für ihre Sicherheit. Und nur, insofern die Sicherheit selbst leiden kann, indem Betrügerei die Unwissenheit benutzt, könnte eine solche Aufsicht innerhalb der Gränzen der Wirksamkeit des Staats liegen. Indess muss doch bei einem Betruge dieser Art der Betrogene immer zur Ueberzeugung überredet werden, und da das Ineinanderfliessen der verschiedenen Nüancen hiebei schon eine allgemeine Regel beinah unmöglich macht, auch gerade die, durch die Freiheit übriggelassne Möglichkeit des Betrugs die Menschen zu grösserer Vorsicht und Klugheit schärft; so halte ich es für besser und den Principien gemässer, in der, von bestimmten Anwendungen fernen Theorie, Prohibitivgesetze nur auf diejenigen Fälle auszudehnen, wo ohne, oder gar gegen den Willen des andern gehandelt wird. Das vorige Raisonnement wird jedoch immer dazu dienen, zu zeigen, wie auch andre Fälle — wenn die Nothwendigkeit es erforderte — in Gemässheit der aufgestellten Grundsätze behandelt werden müssten.[38]
Wenn bis jetzt die Beschaffenheit der Folgen einer Handlung auseinandergesetzt ist, welche dieselbe der Aufsicht des Staats unterwirft; so fragt sich noch, ob jede Handlung eingeschränkt werden darf, bei welcher nur die Möglichkeit einer solchen Folge vorauszusehen ist, oder nur solche, mit welcher dieselbe nothwendig verbunden ist? In dem ersteren Fall geriethe die Freiheit, in dem letzteren die Sicherheit in Gefahr zu leiden. Es ist daher freilich soviel ersichtlich, dass ein [112] Mittelweg getroffen werden muss. Diesen indess allgemein zu zeichnen halte ich für unmöglich. Freilich müsste die Berathschlagung über einen Fall dieser Art, durch die Betrachtung des Schadens, der Wahrscheinlichkeit des Erfolgs, und der Einschränkung der Freiheit im Fall eines gegebenen Gesetzes zugleich geleitet werden. Allein keins dieser Stücke erlaubt eigentlich ein allgemeines Maass; vorzüglich täuschen immer Wahrscheinlichkeitsberechnungen. Die Theorie kann daher nicht mehr, als jene Momente der Ueberlegung, angeben. In der Anwendung müsste man, glaube ich, allein auf die specielle Lage sehen, nicht aber sowohl auf die allgemeine Natur der Fälle, und nur, wenn Erfahrung der Vergangenheit und Betrachtung der Gegenwart eine Einschränkung nothwendig machte, dieselbe verfügen. Das Naturrecht, wenn man es auf das Zusammenleben mehrerer Menschen anwendet, scheidet die Gränzlinie scharf ab. Es missbilligt alle Handlungen, bei welchen der eine mit seiner Schuld in den Kreis des andern eingreift, alle folglich, wo der Schade entweder aus einem eigentlichen Versehen entsteht, oder, wo derselbe immer, oder doch in einem solchen Grade der Wahrscheinlichkeit mit der Handlung verbunden ist, dass der Handlende ihn entweder einsieht, oder wenigstens nicht, ohne dass es ihm zugerechnet werden müsste, übersehn kann. Ueberall, wo sonst Schaden entsteht, ist es Zufall, den der Handelnde zu ersetzen nicht verbunden ist. Eine weitere Ausdehnung liesse sich nur aus einem stillschweigenden Vertrage der Zusammenlebenden, und also schon wiederum aus etwas Positivem herleiten. Allein hiebei auch im Staate stehen zu bleiben, könnte mit Recht bedenklich scheinen, vorzüglich wenn man die Wichtigkeit des zu besorgenden Schadens, und die Möglichkeit bedenkt, die Einschränkung der Freiheit der Bürger nur wenig nachtheilig zu machen. Auch lässt sich das Recht des Staats hiezu nicht bestreiten, da er nicht blos insofern für die Sicherheit sorgen [113] soll, dass er, bei geschehenen Kränkungen des Rechts zur Entschädigung zwinge, sondern auch so, dass er Beeinträchtigungen verhindre. Auch kann ein Dritter, der einen Ausspruch thun soll, nur nach äussren Kennzeichen entscheiden. Unmöglich darf daher der Staat dabei stehen bleiben, abzuwarten, ob die Bürger es nicht werden an der gehörigen Vorsicht bei gefährlichen Handlungen mangeln lassen, noch kann er sich allein darauf verlassen, ob sie die Wahrscheinlichkeit des Schadens voraussehen; er muss vielmehr — wo wirklich die Lage die Besorgniss dringend macht — die an sich unschädliche Handlung selbst einschränken.
Vielleicht liesse sich demnach der folgende Grundsatz aufstellen:
um für die Sicherheit der Bürger Sorge zu tragen, muss der Staat diejenigen, sich unmittelbar allein auf den Handlenden beziehenden Handlungen verbieten, oder einschränken, deren Folgen die Rechte andrer kränken, die ohne oder gegen die Einwilligung derselben ihre Freiheit oder ihren Besitz schmälern, oder von denen dies wahrscheinlich zu besorgen ist, eine Wahrscheinlichkeit, bei welcher allemal auf die Grösse des zu besorgenden Schadens und die Wichtigkeit der durch ein Prohibitivgesetz entstehenden Freiheitseinschränkung zugleich Rücksicht genommen werden muss. Jede weitere, oder aus andren Gesichtspunkten gemachte Beschränkung der Privatfreiheit aber, liegt ausserhalb der Gränzen der Wirksamkeit des Staats.
Da, meinen hier entwickelten Ideen nach, der einzige Grund solcher Einschränkungen die Rechte andrer sind; so müssten dieselben natürlich sogleich wegfallen, als dieser Grund aufhörte, und sobald also z. B. da bei den meisten Polizeiveranstaltungen die Gefahr sich nur auf den Umfang der Gemeinheit, des Dorfs, der Stadt erstreckt, eine solche Gemeinheit ihre Aufhebung ausdrücklich und einstimmig verlangte. Der Staat [114] müsste alsdann zurücktreten, und sich begnügen, die, mit vorsätzlicher, oder schuldbarer Kränkung der Rechte vorgefallenen Beschädigungen zu bestrafen. Denn dies allein, die Hemmung der Uneinigkeiten der Bürger unter einander, ist das wahre und eigentliche Interesse des Staats, an dessen Beförderung ihn nie der Wille einzelner Bürger, wären es auch die Beleidigten selbst, hindern darf. Denkt man sich aufgeklärte, von ihrem wahren Vortheil unterrichtete, und daher gegenseitig wohlwollende Menschen in enger Verbindung mit einander; so werden leicht von selbst freiwillige, auf ihre Sicherheit abzweckende Verträge unter ihnen entstehen, Verträge z. B. dass dies oder jenes gefahrvolle Geschäft nur an bestimmten Orten, oder zu gewissen Zeiten, betrieben werden, oder auch ganz unterbleiben soll. Verträge dieser Art sind Verordnungen des Staats bei weitem vorzuziehen. Denn, da diejenigen selbst sie schliessen, welche den Vortheil und Schaden davon unmittelbar, und eben so, wie das Bedürfniss dazu, selbst fühlen, so entstehen sie erstlich gewiss nicht leicht anders, als wenn sie wirklich nothwendig sind; freiwillig eingegangen werden sie ferner besser und strenger befolgt; als Folgen der Selbstthätigkeit, schaden sie endlich, selbst bei beträchtlicher Einschränkung der Freiheit, dennoch dem Charakter minder, und vielmehr, wie sie nur bei einem gewissen Maasse der Aufklärung und des Wohlwollens entstehen, so tragen sie wiederum dazu bei, beide zu erhöhen. Das wahre Bestreben des Staats muss daher dahin gerichtet sein, die Menschen durch Freiheit dahin zu führen, dass leichter Gemeinheiten entstehen, deren Wirksamkeit in diesen und vielfältigen ähnlichen Fällen an die Stelle des Staats treten könne.
Ich habe hier gar keiner Gesetze erwähnt, welche den Bürgern positive Pflichten, dies, oder jenes für den Staat, oder für einander aufzuopfern, oder zu thun, auflegten, dergleichen es doch bei uns überall giebt. Allein die Anwendung der Kräfte [115] abgerechnet, welche jeder Bürger dem Staate, wo es erfordert wird, schuldig ist, und von der ich in der Folge noch Gelegenheit haben werde zu reden, halte ich es auch nicht für gut, wenn der Staat einen Bürger zwingt, zum Besten des andern irgend etwas gegen seinen Willen zu thun, möchte er auch auf die vollständigste Weise dafür entschädigt werden. Denn da jede Sache, und jedes Geschäft, der unendlichen Verschiedenheit der menschlichen Launen und Neigungen nach, jedem einen so unübersehbar verschiedenen Nutzen gewähren, und da dieser Nutzen auf gleich mannigfaltige Weise interessant, wichtig, und unentbehrlich sein kann; so führt die Entscheidung, welches Gut des einen welchem des andren vorzuziehen sei? — selbst wenn auch nicht die Schwierigkeit gänzlich davon zurückschreckt — immer etwas Hartes, über die Empfindung und Individualität des andren Absprechendes mit sich. Aus eben diesem Grunde ist auch, da eigentlich nur das Gleichartige, eines die Stelle des andren ersetzen kann, wahre Entschädigung oft ganz unmöglich, und fast nie allgemein bestimmbar. Zu diesen Nachtheilen auch der besten Gesetze dieser Art, kommt nun noch die Leichtigkeit des möglichen Missbrauchs. Auf der andren Seite macht die Sicherheit — welche doch allein dem Staat die Gränzen richtig vorschreibt, innerhalb welcher er seine Wirksamkeit halten muss — Veranstaltungen dieser Art überhaupt nicht nothwendig, da freilich jeder Fall, wo dies sich findet, eine Ausnahme sein muss; auch werden die Menschen wohlwollender gegen einander, und zu gegenseitiger Hülfsleistung bereitwilliger, je weniger sich ihre Eigenliebe und ihr Freiheitssinn durch ein eigentliches Zwangsrecht des andern gekränkt fühlt; und selbst, wenn die Laune und der völlig grundlose Eigensinn eines Menschen ein gutes Unternehmen hindert, so ist diese Erscheinung nicht gleich von der Art, dass die Macht des Staats sich ins Mittel schlagen muss. Sprengt sie doch nicht in der physischen Natur jeden Fels, der dem [116] Wanderer in dem Wege steht! Hindernisse beleben die Energie, und schärfen die Klugheit; nur diejenigen, welche die Ungerechtigkeiten der Menschen hervorbringen, hemmen ohne zu nützen; ein solches aber ist jener Eigensinn nicht, der zwar durch Gesetze für den einzelnen Fall gebeugt, aber nur durch Freiheit gebessert werden kann. Diese hier nur kurz zusammengenommenen Gründe sind, dünkt mich, stark genug, um blos der ehernen Nothwendigkeit zu weichen, und der Staat muss sich daher begnügen, die, schon ausser der positiven Verbindung existirenden Rechte der Menschen, ihrem eignen Untergange die Freiheit oder das Eigenthum des andern aufzuopfern, zu schützen.
Endlich entstehen eine nicht unbeträchtliche Menge von Polizeigesetzen aus solchen Handlungen, welche innerhalb der Gränzen des eignen aber nicht alleinigen, sondern gemeinschaftlichen Rechts vorgenommen werden. Bei diesen sind Freiheitsbeschränkungen natürlich bei weitem minder bedenklich, da in dem gemeinschaftlichen Eigenthum jeder Miteigenthümer ein Recht zu widersprechen hat. Solch ein gemeinschaftliches Eigenthum sind z. B. Wege, Flüsse, die mehrere Besitzungen berühren, Plätze und Strassen in Städten u. s. f.
[117]
XI.
Sorgfalt des Staats für die Sicherheit durch Bestimmung solcher Handlungen der Bürger, welche sich unmittelbar und geradezu auf andre beziehen. (Civilgesetze.)↩
Handlungen, welche die Rechte andrer kränken. — Pflicht des Staats, — dem Beleidigten zur Entschädigung zu verhelfen, — und den Beleidiger vor der Rache jenes zu schützen. — Handlungen mit gegenseitiger Einwilligung. — Willenserklärungen. — Doppelte Pflicht des Staats in Rücksicht auf sie, — einmal die gültigen aufrecht zu erhalten, — zweitens den rechtswidrigen den Schutz der Gesetze zu versagen, und zu verhüten, dass die Menschen sich, auch durch gültige, nicht zu drückende Fesseln anlegen. — Gültigkeit der Willenserklärungen. — Erleichterung der Trennung gültig geschlossener Verträge, als eine Folge der zweiten eben erwähnten Pflicht des Staats; — allein bei Verträgen, welche die Person betreffen; — mit verschiedenen Modifikationen, nach der eigenthümlichen Natur der Verträge. — Dispositionen von Todeswegen. — Gültigkeit derselben nach allgemeinen Grundsätzen des Rechts? — Nachtheile derselben. — Gefahren einer blossen Intestaterbfolge, und Vortheile der Privatdispositionen. — Mittelweg, welcher diese Vortheile zu erhalten, und jene Nachtheile zu entfernen versucht. — Intestaterbfolge. — Bestimmung des Pflichttheils. — Inwiefern müssen Verträge unter Lebendigen auf die Erben übergehen? — Nur insofern, als das hinterlassene Vermögen dadurch eine andre Gestalt erhalten hat. — Vorsichtsregeln für den Staat, hier freiheitsbeschränkende Verhältnisse zu verhindern. — Moralische Personen. — Ihre Nachtheile. — Grund derselben. — Werden gehoben, wenn man jede moralische Person blos als eine Vereinigung der jedesmaligen Mitglieder ansieht. — Höchste, aus diesem Abschnitt gezogene Grundsätze.
Verwickelter, allein für die gegenwärtige Untersuchung mit weniger Schwierigkeit verbunden, ist der Fall solcher Handlungen, welche sich unmittelbar und geradezu auf andre beziehen. Denn wo durch dieselben Rechte gekränkt werden, da muss der Staat natürlich sie hemmen, und die Handlenden zum Ersatze des zugefügten Schadens zwingen. Sie kränken aber, nach den im Vorigen gerechtfertigten Bestimmungen, das Recht nur dann, wenn sie dem andren gegen, oder ohne seine Einwilligung etwas von seiner Freiheit, oder seinem Vermögen entziehen. Wenn jemand von dem andern beleidigt worden ist, hat er ein Recht auf Ersatz, allein, da er in der Gesellschaft seine Privatrache dem Staat übertragen hat, auf nichts weiter, als auf [118] diesen. Der Beleidiger ist daher dem Beleidigten auch nur zur Erstattung des Entzognen, oder, wo dies nicht möglich ist, zur Entschädigung verbunden, und muss dafür mit seinem Vermögen, und seinen Kräften, insofern er durch diese zu erwerben vermögend ist, einstehen. Beraubung der Freiheit, die z. B. bei uns bei unvermögenden Schuldnern eintritt, kann nur als ein untergeordnetes Mittel, um nicht Gefahr zu laufen, mit der Person des Verpflichteten, seinen künftigen Erwerb zu verlieren, stattfinden. Nun darf der Staat zwar den Beleidigten kein rechtmässiges Mittel zur Entschädigung versagen, allein er muss auch verhüten, dass nicht Rachsucht sich dieses Vorwands gegen den Beleidiger bediene. Er muss dies um so mehr, als im aussergesellschaftlichen Zustande diese dem Beleidigten, wenn derselbe die Gränzen des Rechts überschritte, Widerstand leisten würde, und hingegen hier die unwiderstehliche Macht des Staats ihn trifft, und als allgemeine Bestimmungen, die immer da nothwendig sind, wo ein Dritter entscheiden soll, dergleichen Vorwände immer eher begünstigen. Die Versicherung der Person der Schuldner z. B. dürfte daher leicht noch mehr Ausnahmen erfordern, als die meisten Gesetze davon verstatten.
Handlungen, die mit gegenseitiger Einwilligung vorgenommen werden, sind völlig denjenigen gleich, welche Ein Mensch für sich, ohne unmittelbare Beziehung auf andre ausübt, und ich könnte daher bei ihnen nur dasjenige wiederholen, was ich im Vorigen von diesen gesagt habe. Indess giebt es dennoch unter ihnen Eine Gattung, welche völlig eigne Bestimmungen nothwendig macht, diejenigen nämlich, die nicht gleich und auf Einmal vollendet werden, sondern sich auf die Folge erstrecken. Von dieser Art sind alle Willenserklärungen, aus welchen vollkommene Pflichten der Erklärenden entspringen, sie mögen einseitig oder gegenseitig geschehen. Sie übertragen einen Theil des Eigenthums von dem einen auf den andren, und die [119] Sicherheit wird gestört, wenn der Uebertragende durch Nichterfüllung des Versprechens das Uebertragene wiederum zurückzunehmen sucht. Es ist daher eine der wichtigsten Pflichten des Staats, Willenserklärungen aufrecht zu erhalten. Allein der Zwang, welchen jede Willenserklärung auflegt, ist nur dann gerecht und heilsam, wenn einmal blos der Erklärende dadurch eingeschränkt wird, und zweitens dieser, wenigstens mit gehöriger Fähigkeit der Ueberlegung — überhaupt und in dem Moment der Erklärung — und mit freier Beschliessung handelte. Ueberall, wo dies nicht der Fall ist, ist der Zwang eben so ungerecht, als schädlich. Auch ist auf der einen Seite die Ueberlegung für die Zukunft nur immer auf eine sehr unvollkommene Weise möglich; und auf der andern sind manche Verbindlichkeiten von der Art, dass sie der Freiheit Fesseln anlegen, welche der ganzen Ausbildung des Menschen hinderlich sind. Es entsteht also die zweite Verbindlichkeit des Staats, rechts widrigen Willenserklärungen den Beistand der Gesetze zu versagen, und auch alle, nur mit der Sicherheit des Eigenthums vereinbare Vorkehrungen zu treffen, um zu verhindern, dass nicht die Unüberlegtheit Eines Moments dem Menschen Fesseln anlege, welche seine ganze Ausbildung hemmen oder zurückhalten. Was zur Gültigkeit eines Vertrags, oder einer Willenserklärung überhaupt erfordert wird, setzen die Theorien des Rechts gehörig auseinander. Nur in Absicht des Gegenstandes derselben, bleibt mir hier zu erinnern übrig, dass der Staat, dem, den vorhin entwickelten Grundsätzen gemäss, schlechterdings blos die Erhaltung der Sicherheit obliegt, keine andern Gegenstände ausnehmen darf, als diejenigen, welche entweder schon die allgemeinen Begriffe des Rechts selbst ausnehmen, oder deren Ausnahme gleichfalls durch die Sorge für die Sicherheit gerechtfertigt wird. Als hieher gehörig aber zeichnen sich vorzüglich nur folgende Fälle aus: 1., wo der Versprechende kein Zwangsrecht übertragen kann, ohne sich selbst blos zu einem Mittel [120] der Absichten des andren herabzuwürdigen, wie z. B. jeder auf Sklavereihinauslaufende Vertrag wäre; 2. wo der Versprechende selbst über die Leistung des Versprochenen, der Natur desselben nach, keine Gewalt hat, wie z. B. bei Gegenständen der Empfindung und des Glaubens der Fall ist; 3. wo das Versprechen, entweder an sich, oder in seinen Folgen den Rechten andrer entweder wirklich entgegen, oder doch gefährlich ist, wobei alle, bei Gelegenheit der Handlungen einzelner Menschen entwickelte Grundsätze eintreten. Der Unterschied zwischen diesen Fällen ist nun der, dass in dem ersten und zweiten der Staat blos das Zwangsrecht der Gesetze versagen muss, übrigens aber weder Willenserklärungen dieser Art, noch auch ihre Ausübung, insofern diese nur mit gegenseitiger Bewilligung geschieht, hindern darf, da er hingegen in dem zuletzt aufgeführten auch die blosse Willenserklärung an sich untersagen kann, und muss.
Wo aber gegen die Rechtmässigkeit eines Vertrags oder einer Willenserklärung kein Einwand zu machen ist; da kann der Staat dennoch, um den Zwang zu erleichtern, welchen selbst der freie Wille der Menschen sich unter einander auflegt, indem er die Trennung der, durch den Vertrag eingegangenen Verbindung minder erschwert, verhindern, dass nicht der zu einer Zeit gefasste Entschluss auf einen zu grossen Theil des Lebens hinaus, die Willkühr beschränke. Wo ein Vertrag blos auf Uebertragung von Sachen, ohne weiteres persönliches Verhältniss, abzweckt, halte ich eine solche Veranstaltung nicht rathsam. Denn einmal sind dieselben weit seltener von der Art, dass sie auf ein dauerndes Verhältniss der Kontrahenten führen; dann stören auch, bei ihnen vorgenommene Einschränkungen die Sicherheit der Geschäfte auf eine bei weitem schädlichere Weise; und endlich ist es von manchen Seiten, und vorzüglich zur Ausbildung der Beurtheilungskraft, und zur Beförderung der Festigkeit des Charakters gut, dass das einmal gegebene [121] Wort unwiderruflich binde, so dass man diesen Zwang nie, ohne eine wahre Nothwendigkeit, erleichtern muss, welche bei der Uebertragung von Sachen, wodurch zwar diese oder jene Ausübung der menschlichen Thätigkeit gehemmt, aber die Energie selbst nicht leicht geschwächt werden kann, nicht eintritt. Bei Verträgen hingegen, welche persönliche Leistungen zur Pflicht machen, oder gar eigentliche persönliche Verhältnisse hervorbringen, ist es bei weitem anders. Der Zwang ist bei ihnen den edelsten Kräften des Menschen nachtheilig, und da das Gelingen der Geschäfte selbst, die durch sie bewirkt werden, obgleich mehr oder minder, von der fortdauernden Einwilligung der Partheien abhängt; so ist auch bei ihnen eine Einschränkung dieser Art minder schädlich. Wo daher durch den Vertrag ein solches persönliches Verhältniss entsteht, das nicht blos einzelne Handlungen fordert, sondern im eigentlichsten Sinn die Person und die ganze Lebensweise betrifft, wo dasjenige, was geleistet, oder dasjenige, dem entsagt wird, in dem genauesten Zusammenhange mit inneren Empfindungen steht, da muss die Trennung zu jeder Zeit, und ohne Anführung aller Gründe erlaubt sein. So bei der Ehe. Wo das Verhältniss zwar weniger eng ist, indess gleichfalls die persönliche Freiheit eng beschränkt, da, glaube ich, müsste der Staat eine Zeit festsetzen, deren Länge auf der einen Seite nach der Wichtigkeit der Beschränkung, auf der andern nach der Natur des Geschäfts zu bestimmen wäre, binnen welcher zwar keiner beider Theile einseitig abgehen dürfte, nach Verlauf welcher aber der Vertrag ohne Erneuerung, kein Zwangsrecht nach sich ziehen könnte, selbst dann nicht, wenn die Partheien, bei Eingehung des Vertrags, diesem Gesetze entsagt hätten. Denn wenn es gleich scheint, als sei eine solche Anordnung eine blosse Wohlthat des Gesetzes, und dürfte sie, ebensowenig als irgend eine andre, jemanden aufgedrungen werden; so wird ja niemanden hierdurch die Befugniss genommen, auch das ganze Leben [122] hindurch dauernde Verhältnisse einzugehen, sondern blos dem einen das Recht, den andern da zu zwingen, wo der Zwang den höchsten Zwecken desselben hinderlich sein würde. Ja es ist um so weniger eine blosse Wohlthat, als die hier genannten Fälle, und vorzüglich der der Ehe (sobald nämlich die freie Willkühr nicht mehr das Verhältniss begleitet) nur dem Grade nach von denjenigen verschieden sind, worin der eine sich zu einem blossen Mittel der Absicht des andern macht, oder vielmehr von dem andern dazu gemacht wird; und die Befugniss hier die Gränzlinie zu bestimmen zwischen dem, ungerechter, und gerechter Weise aus dem Vertrag entstehenden Zwangsrecht, kann dem Staat, d. i. dem gemeinsamen Willen der Gesellschaft, nicht bestritten werden, da ob die, aus einem Vertrage entstehende Beschränkung den, welcher seine Willensmeinung geändert hat, wirklich nur zu einem Mittel des andern macht? völlig genau, und der Wahrheit angemessen zu entscheiden, nur in jeglichem speciellen Fall möglich sein würde. Endlich kann es auch nicht eine Wohlthat aufdringen heissen, wenn man die Befugniss aufhebt, ihr im Voraus zu entsagen.
Die ersten Grundsätze des Rechts lehren von selbst, und es ist auch im Vorigen schon ausdrücklich erwähnt worden, dass niemand gültigerweise über etwas andres einen Vertrag schliessen, oder überhaupt seinen Willen erklären kann, als über das, was wirklich sein Eigenthum ist, seine Handlungen, oder seinen Besitz. Es ist auch gewiss, dass der wichtigste Theil der Sorgfalt des Staats für die Sicherheit der Bürger, insofern Verträge oder Willenserklärungen auf dieselbe Einfluss haben, darin besteht, über die Ausübung dieses Satzes zu wachen. Dennoch finden sich noch ganze Gattungen der Geschäfte, bei welchen man seine Anwendung gänzlich vermisst. So alle Dispositionen von Todeswegen, auf welche Art sie geschehen mögen, ob direkt, oder indirekt, nur bei Gelegenheit eines andern Vertrags, ob in einem Vertrage, Testamente, oder irgend einer andren [123] Disposition, welcher Art sie sei. Alles Recht kann sich unmittelbar nur immer auf die Person beziehn; auf Sachen ist es nicht anders denkbar, als insofern die Sachen durch Handlungen mit der Person verknüpft sind. Mit dem Aufhören der Person fällt daher auch dies Recht weg. Der Mensch darf daher zwar, bei seinem Leben mit seinen Sachen nach Gefallen schalten, sie ganz oder zum Theil, ihre Substanz, oder ihre Benutzung, oder ihren Besitz veräussern, auch seine Handlungen, seine Disposition über sein Vermögen, wie er es gut findet, im Voraus beschränken. Keinesweges aber steht ihm die Befugniss zu, auf eine, für andre verbindliche Weise zu bestimmen, wie es mit seinem Vermögen nach seinem Tode gehalten werden, oder wie der künftige Besitzer desselben handlen oder nicht handlen solle? Ich verweile nicht bei den Einwürfen, welche sich gegen diese Sätze erheben lassen. Die Gründe und Gegengründe sind schon hinlänglich in der bekannten Streitfrage über die Gültigkeit der Testamente nach dem Naturrecht auseinandergesetzt worden, und der Gesichtspunkt des Rechts ist hier überhaupt minder wichtig, da freilich der ganzen Gesellschaft die Befugniss nicht bestritten werden kann, letztwilligen Erklärungen die, ihnen sonst mangelnde Gültigkeit positiv beizulegen. Allein wenigstens in der Ausdehnung, welche ihnen die meisten unsrer Gesetzgebungen beilegen, nach dem System unsres gemeinen Rechts, in welchem sich hier die Spitzfindigkeit Römischer Rechtsgelehrten, mit der, eigentlich auf die Trennung aller Gesellschaft hinauslaufenden Herrschsucht des Lehnwesens vereint, hemmen sie die Freiheit, deren die Ausbildung des Menschen nothwendig bedarf, und streiten gegen alle, in diesem ganzen Aufsatz entwickelte Grundsätze. Denn sie sind das vorzüglichste Mittel, wodurch eine Generation der andern Gesetze vorschreibt, wodurch Missbräuche und Vorurtheile, die sonst nicht leicht die Gründe überleben würden, welche ihr Entstehen unvermeidlich, oder ihr Dasein unentbehrlich machen, [124] von Jahrhunderten zu Jahrhunderten forterben, wodurch endlich, statt dass die Menschen den Dingen die Gestalt geben sollten, diese die Menschen selbst ihrem Joche unterwerfen. Auch lenken sie am meisten den Gesichtspunkt der Menschen von der wahren Kraft und ihrer Ausbildung ab, und auf den äussren Besitz, und das Vermögen hin, da dies nun einmal das Einzige ist, wodurch dem Willen noch nach dem Tode Gehorsam erzwungen werden kann. Endlich dient die Freiheit letztwilliger Verordnungen sehr oft und meistentheils gerade den unedleren Leidenschaften des Menschen, dem Stolze, der Herrschsucht, der Eitelkeit u. s. f. so wie überhaupt viel häufiger nur die minder Weisen und minder Guten davon Gebrauch machen, da der Weisere sich in Acht nimmt, etwas für eine Zeit zu verordnen, deren individuelle Umstände seiner Kurzsichtigkeit verborgen sind, und der Bessere sich freut, auf keine Gelegenheit zu stossen, wo er den Willen andrer einschränken muss, statt dieselben noch begierig hervorzusuchen. Nicht selten mag sogar das Geheimniss und die Sicherheit vor dem Urtheil der Mitwelt Dispositionen begünstigen, die sonst die Schaam unterdrückt hätte. Diese Gründe zeigen, wie es mir scheint hinlänglich die Nothwendigkeit, wenigstens gegen die Gefahr zu sichern, welche die testamentarischen Dispositionen der Freiheit der Bürger drohen.
Was soll aber, wenn der Staat die Befugniss gänzlich aufhebt, Verordnungen zu machen, welche sich auf den Fall des Todes beziehen — wie denn die Strenge der Grundsätze dies allerdings erfordert — an ihre Stelle treten? Da Ruhe und Ordnung allen erlaubte Besitznehmung unmöglich machen, unstreitig nichts anders als eine vom Staat festgesetzte Intestat-Erbfolge. Allein dem Staate einen so mächtigen positiven Einfluss, als er durch diese Erbfolge, bei gänzlicher Abschaffung der eignen Willenserklärungen der Erblasser, erhielte, einzuräumen, verbieten auf der andren Seite manche der [125] im Vorigen entwickelten Grundsätze. Schon mehr als einmal ist der genaue Zusammenhang der Gesetze der Intestatsuccession mit den politischen Verfassungen der Staaten bemerkt worden, und leicht liesse sich dieses Mittel auch zu andern Zwecken gebrauchen. Ueberhaupt ist im Ganzen der mannigfaltige und wechselnde Wille der einzelnen Menschen dem einförmigen und unveränderlichen des Staats vorzuziehen. Auch scheint es, welcher Nachtheile man immer mit Recht die Testamente beschuldigen mag, dennoch hart, dem Menschen die unschuldige Freude des Gedankens zu rauben, diesem oder jenem mit seinem Vermögen noch nach seinem Tode wohlthätig zu werden; und wenn grosse Begünstigung derselben der Sorgfalt für das Vermögen eine zu grosse Wichtigkeit giebt, so führt auch gänzliche Aufhebung vielleicht wiederum zu dem entgegengesetzten Uebel. Dazu entsteht durch die Freiheit der Menschen, ihr Vermögen willkührlich zu hinterlassen, ein neues Band unter ihnen, das zwar oft sehr gemissbraucht, allein auch oft heilsam benutzt werden kann. Und die ganze Absicht der hier vorgetragenen Ideen liesse sich ja vielleicht nicht unrichtig darin setzen, dass sie alle Fesseln in der Gesellschaft zu zerbrechen, aber auch dieselbe mit so viel Banden, als möglich, unter einander zu verschlingen bemüht sind. Der Isolirte vermag sich eben so wenig zu bilden, als der Gefesselte. Endlich ist der Unterschied so klein, ob jemand in dem Moment seines Todes sein Vermögen wirklich verschenkt, oder durch ein Testament hinterlässt, da er doch zu dem Ersteren ein unbezweifeltes und unentreissbares Recht hat.
Der Widerspruch, in welchen die hier aufgeführten Gründe und Gegengründe zu verwickeln schienen, löst sich, dünkt mich, durch die Betrachtung, dass eine letztwillige Verordnung zweierlei Bestimmungen enthalten kann, 1. wer unmittelbar der nächste Besitzer des Nachlasses sein? 2. wie er damit schalten, wem er ihn wiederum hinterlassen, und wie es überhaupt in der [126] Folge damit gehalten werden soll? und dass alle vorhin erwähnte Nachtheile nur von den letztren, alle Vortheile hingegen allein von den ersteren gelten. Denn haben die Gesetze nur, wie sie allerdings müssen, durch gehörige Bestimmung eines Pflichttheils Sorge getragen, dass kein Erblasser eine wahre Unbilligkeit oder Ungerechtigkeit begehen kann, so scheint mir von der blos wohlwollenden Meinung, jemanden noch nach seinem Tode zu beschenken, keine sonderliche Gefahr zu befürchten zu sein. Auch werden die Grundsätze, nach welchen die Menschen hierin verfahren werden, zu Einer Zeit gewiss immer ziemlich dieselben sein, und die grössere Häufigkeit oder Seltenheit der Testamente wird dem Gesetzgeber selbst zugleich zu einem Kennzeichen dienen, ob die von ihm eingeführte Intestaterbfolge noch passend ist, oder nicht? Dürfte es daher vielleicht nicht rathsam sein, nach der zwiefachen Natur dieses Gegenstandes, auch die Maassregeln des Staats in Betreff seiner zu theilen? auf der einen Seite zwar jedem zu gestatten, die Einschränkung in Absicht des Pflichttheils ausgenommen, zu bestimmen, wer sein Vermögen nach seinem Tode besitzen solle? aber ihm auf der andern zu verbieten, gleichfalls auf irgend eine nur denkbare Weise zu verordnen, wie derselbe übrigens damit schalten, oder walten solle? Leicht könnte nun zwar das, was der Staat erlaubte, als ein Mittel gemissbraucht werden, auch das zu thun, was er untersagte. Allein diesem müsste die Gesetzgebung durch einzelne und genaue Bestimmungen zuvorzukommen bemüht sein. Als solche Bestimmungen liessen sich z. B. da die Ausführung dieser Materie nicht hieher gehört, folgende vorschlagen, dass der Erbe durch keine Bedingung bezeichnet werden dürfte, die er, nach dem Tode des Erblassers, vollbringen müsste, um wirklich Erbe zu sein; dass der Erblasser immer nur den nächsten Besitzer seines Vermögens, nie aber einen folgenden ernennen, und dadurch die Freiheit des früheren beschränken dürfte; dass er zwar [127] mehrere Erben ernennen könnte, aber dies geradezu thun müsste; eine Sache zwar dem Umfange, nie aber den Rechten nach z. B. Substanz und Niessbrauch, theilen dürfte u. s. f. Denn hieraus, wie auch aus der hiermit noch verbundnen Idee, dass der Erbe den Erblasser vorstellt — die sich, wenn ich mich nicht sehr irre, wie so vieles andre, in der Folge für uns noch äusserst wichtig Gewordene, auf eine Formalität der Römer, und also auf die mangelhafte Einrichtung der Gerichtsverfassung eines erst sich bildenden Volkes gründet—entspringen mannigfaltige Unbequemlichkeiten, und Freiheitsbeschränkungen. Allen diesen aber wird es möglich sein zu entgehen, wenn man den Satz nicht aus den Augen verliert, dass dem Erblasser nichts weiter verstattet sein darf, als auf’s Höchste seinen Erben zu nennen; dass der Staat, wenn dies gültig geschehen ist, diesem Erben zum Besitze verhelfen, aber jeder weitergehenden Willenserklärung des Erblassers seine Unterstützung versagen muss.
Für den Fall, wo keine Erbesernennung von dem Erblasser geschehen ist, muss der Staat eine Intestaterbfolge anordnen. Allein die Ausführung der Sätze, welche dieser, so wie der Bestimmung des Pflichttheils zum Grunde liegen müssen, gehört nicht zu meiner gegenwärtigen Absicht, und ich kann mich mit der Bemerkung begnügen, dass der Staat auch hier nicht positive Endzwecke, z. B. Aufrechthaltung des Glanzes und des Wohlstandes der Familien, oder in dem entgegengesetzten Extreme Versplitterung des Vermögens durch Vervielfachung der Theilnehmer, oder gar reichlichere Unterstützung des grösseren Bedürfnisses, vor Augen haben darf; sondern allein den Begriffen des Rechts folgen muss, die sich hier vielleicht blos auf den Begriff des ehemaligen Miteigenthums bei dem Leben des Erblassers beschränken, und so das erste Recht der Familie, das fernere der Gemeine u. s. w. einräumen.[39] Sehr nah verwandt [128] mit der Erbschaftsmaterie ist die Frage, inwiefern Verträge unter Lebendigen auf die Erben übergehen müssen? Die Antwort muss sich aus dem festgestellten Grundsatz ergeben. Dieser aber war folgender: der Mensch darf bei seinem Leben seine Handlungen beschränken und sein Vermögen veräussern, wie er will, auf die Zeit seines Todes aber weder die Handlungen dessen bestimmen wollen, der alsdann sein Vermögen besitzt, noch auch hierüber eine Anordnung irgend einer Gattung (man müsste denn die blosse Ernennung eines Erben billigen) treffen. Es müssen daher alle diejenigen Verbindlichkeiten auf den Erben übergehn, und gegen ihn erfüllt werden, welche wirklich die Uebertragung eines Theils des Eigenthums in sich schliessen, folglich das Vermögen des Erblassers entweder verringert oder vergrössert haben; hingegen keine von denjenigen, welche entweder in Handlungen des Erblassers bestanden, oder sich nur auf die Person desselben bezogen. Selbst aber mit diesen Einschränkungen bleibt die Möglichkeit, seine Nachkommenschaft durch Verträge, die zur Zeit des Lebens geschlossen sind, in bindende Verhältnisse zu verwickeln, noch immer zu gross. Denn man kann ebensogut Rechte, als Stücke seines Vermögens veräussern, eine solche Veräusserung muss nothwendig für die Erben, die in keine andre Lage treten können, als in welcher der Erblasser selbst war, verbindlich sein, und nun führt der getheilte Besitz mehrerer Rechte auf Eine und die nämliche Sache allemal zwingende persönliche Verhältnisse mit sich. Es dürfte daher wohl, wenn nicht nothwendig, doch aufs mindeste sehr rathsam sein, wenn der Staat entweder untersagte, Verträge dieser Art anders als auf die Lebenszeit zu machen, oder wenigstens die Mittel erleichterte, eine wirkliche Trennung des Eigenthums da zu bewirken, wo ein solches [129] Verhältniss einmal entstanden wäre. Die genauere Ausführung einer solchen Anordnung gehört wiederum nicht hieher, und das um so weniger, als, wie es mir scheint, dieselbe nicht sowohl durch Feststellung allgemeiner Grundsätze, als durch einzelne, auf bestimmte Verträge gerichtete Gesetze zu machen sein würde.
Je weniger der Mensch anders zu handeln vermocht wird, als sein Wille verlangt, oder seine Kraft ihm erlaubt, desto günstiger ist seine Lage im Staat. Wenn ich in Bezug auf diese Wahrheit — um welche allein sich eigentlich alle in diesem Aufsatze vorgetragene Ideen drehen, das Feld unserer Civiljurisprudenz übersehe; so zeigt sich mir neben andren, minder erheblichen Gegenständen, noch ein äusserst wichtiger, die Gesellschaften nämlich, welche man, im Gegensatze der physischen Menschen, moralische Personen zu nennen pflegt. Da sie immer eine, von der Zahl der Mitglieder, welche sie ausmachen, unabhängige Einheit enthalten, welche sich, mit nur unbeträchtlichen Veränderungen, durch eine lange Reihe von Jahren hindurch erhält; so bringen sie aufs mindeste alle die Nachtheile hervor, welche im Vorigen als Folgen letztwilliger Verordnungen dargestellt worden sind. Denn wenn gleich ein sehr grosser Theil ihrer Schädlichkeit bei uns, aus einer, nicht nothwendig mit ihrer Natur verbundnen Einrichtung — den ausschliesslichen Privilegien nämlich, welche ihnen bald der Staat ausdrücklich, bald die Gewohnheit stillschweigend ertheilt, und durch welche sie oft wahre politische Corps werden — entsteht; so führen sie doch auch an sich noch immer eine beträchtliche Menge von Unbequemlichkeiten mit sich. Diese aber entstehen allemal nur dann, wenn die Verfassung derselben entweder alle Mitglieder, gegen ihren Willen, zu dieser oder jener Anwendung der gemeinschaftlichen Mittel zwingt, oder doch dem Willen der kleineren Zahl, durch Nothwendigkeit der Uebereinstimmung aller, erlaubt, den der grösseren zu fesseln. [130] Uebrigens sind Gesellschaften und Vereinigungen, weit entfernt an sich schädliche Folgen hervorzubringen, gerade eins der sichersten und zweckmässigsten Mittel, die Ausbildung des Menschen zu befördern und zu beschleunigen. Das Vorzüglichste, was man hiebei vom Staat zu erwarten hätte, dürfte daher nur die Anordnung sein, dass jede moralische Person oder Gesellschaft für nichts weiter, als für die Vereinigung der jedesmaligen Mitglieder anzusehen sei, und daher nichts diese hindern könne, über die Verwendung der gemeinschaftlichen Kräfte und Mittel durch Stimmenmehrheit nach Gefallen zu beschliessen. Nur muss man sich wohl in Acht nehmen für diese Mitglieder blos diejenigen anzusehen, auf welchen wirklich die Gesellschaft beruht, nicht aber diejenigen, welcher sich diese nur etwa als Werkzeuge bedienen — eine Verwechslung, welche nicht selten, und vorzüglich, bei Beurtheilung der Rechte der Geistlichkeit, gemacht worden ist.
Aus diesem bisherigen Raisonnement nun rechtfertigen sich, glaube ich, folgende Grundsätze.
Da, wo der Mensch nicht blos innerhalb des Kreises seiner Kräfte und seines Eigenthums bleibt, sondern Handlungen vornimmt, welche sich unmittelbar auf den andren beziehen, legt die Sorgfalt für die Sicherheit dem Staat folgende Pflichten auf.
1. Bei denjenigen Handlungen, welche ohne, oder gegen den Willen des andren vorgenommen werden, muss er verbieten, dass dadurch der andre in dem Genuss seiner Kräfte, oder dem Besitz seines Eigenthums gekränkt werde; im Fall der Uebertretung, den Beleidiger zwingen, den angerichteten Schaden zu ersetzen, aber den Beleidigten verhindern, unter diesem Vorwande, oder ausserdem eine Privatrache an demselben zu üben.
2. Diejenigen Handlungen, welche mit freier Bewilligung des andern geschehen, muss er in eben denjenigen, aber [131] keinen engern Schranken halten, als welche den Handlungen einzelner Menschen im Vorigen vorgeschrieben sind. (S. S. 112. 113).
3. Wenn unter den eben erwähnten Handlungen solche sind, aus welchen Rechte und Verbindlichkeiten für die Folge unter den Partheien entstehen (einseitige und gegenseitige Willenserklärungen, Verträge u. s. f.), so muss der Staat das, aus denselben entspringende Zwangsrecht zwar überall da schützen, wo dasselbe in dem Zustande der Fähigkeit gehöriger Ueberlegung, in Absicht eines, der Disposition des Uebertragenden unterworfenen Gegenstandes, und mit freier Beschliessung übertragen wurde; hingegen niemals da, wo es entweder den Handlenden selbst an einem dieser Stücke fehlt, oder wo ein Dritter, gegen, oder ohne seine Einwilligung widerrechtlich beschränkt werden würde.
4. Selbst bei gültigen Verträgen muss er, wenn aus denselben solche persönliche Verbindlichkeiten, oder vielmehr ein solches persönliches Verhältniss entspringt, welches die Freiheit sehr eng beschränkt, die Trennung, auch gegen den Willen Eines Theils immer in dem Grade der Schädlichkeit der Beschränkung für die innere Ausbildung erleichtern; und daher da, wo die Leistung der, aus dem Verhältniss entspringenden Pflichten mit inneren Empfindungen genau verschwistert ist, dieselbe unbestimmt und immer, da hingegen, wo, bei zwar enger Beschränkung, doch gerade dies nicht der Fall ist, nach einer, zugleich nach der Wichtigkeit der Beschränkung und der Natur des Geschäfts zu bestimmenden Zeit erlauben.
5. Wenn jemand über sein Vermögen auf den Fall seines Todes disponiren will; so dürfte es zwar rathsam sein, die Ernennung des nächsten Erben, ohne Hinzufügung irgend einer, die Fähigkeit desselben, mit dem Vermögen nach [132] Gefallen zu schalten, einschränkenden Bedingung, zu gestatten; hingegen
6. ist es nothwendig alle weitere Disposition dieser Art gänzlich zu untersagen; und zugleich eine Intestaterbfolge und einen bestimmten Pflichttheil festzusetzen.
7. Wenn gleich unter Lebendigen geschlossene Verträge insofern auf die Erben übergehn und gegen die Erben erfüllt werden müssen, als sie dem hinterlassenen Vermögen eine andre Gestalt geben; so darf doch der Staat nicht nur keine weitere Ausdehnung dieses Satzes gestatten, sondern es wäre auch allerdings rathsam, wenn derselbe einzelne Verträge, welche ein enges und beschränkendes Verhältniss unter den Partheien hervorbringen (wie z. B. die Theilung der Rechte auf Eine Sache zwischen Mehreren) entweder nur auf die Lebenszeit zu schliessen erlaubte, oder doch dem Erben des einen oder andren Theils die Trennung erleichterte. Denn wenn gleich hier nicht dieselben Gründe, als im Vorigen bei persönlichen Verhältnissen eintreten; so ist auch die Einwilligung der Erben minder frei, und die Dauer des Verhältnisses sogar unbestimmt lang.
Wäre mir die Aufstellung dieser Grundsätze völlig meiner Absicht nach gelungen; so müssten dieselben allen denjenigen Fällen die höchste Richtschnur vorschreiben, in welchen die Civilgesetzgebung für die Erhaltung der Sicherheit zu sorgen hat. So habe ich auch z. B. die moralischen Personen in denselben nicht erwähnt, da, je nachdem eine solche Gesellschaft durch einen letzten Willen, oder einen Vertrag entsteht, sie nach den, von diesen redenden Grundsätzen zu beurtheilen ist. Freilich aber verbietet mir schon der Reichthum der in der Civilgesetzgebung enthaltenen Fälle, mir mit dem Gelingen dieses Vorsatzes zu schmeicheln.
[133]
XII.
Sorgfalt des Staats für die Sicherheit durch rechtliche Entscheidung der Streitigkeiten der Bürger. ↩
Der Staat tritt hier blos an die Stelle der Partheien. — Erster, hieraus entspringender Grundsatz der Prozessordnung. — Der Staat muss die Rechte beider Partheien gegen einander beschützen. — Daraus entspringender zweiter Grundsatz der Prozessordnung. — Nachtheile der Vernachlässigung dieser Grundsätze. — Nothwendigkeit neuer Gesetze zum Behuf der Möglichkeit der richterlichen Entscheidung. — Güte der Gerichtsverfassung, das Moment, von welchem diese Nothwendigkeit vorzüglich abhängt. — Vortheile und Nachtheile solcher Gesetze. — Aus denselben entspringende Regeln der Gesetzgebung. — Höchste aus diesem Abschnitt gezogene Grundsätze.
Dasjenige, worauf die Sicherheit der Bürger in der Gesellschaft vorzüglich beruht, ist die Uebertragung aller eigenmächtigen Verfolgung des Rechts an den Staat. Aus dieser Uebertragung entspringt aber auch für diesen die Pflicht, den Bürgern nunmehr zu leisten, was sie selbst sich nicht mehr verschaffen dürfen, und folglich das Recht, wenn es unter ihnen streitig ist, zu entscheiden, und den, auf dessen Seite es sich findet, in dem Besitze desselben zu schützen. Hiebei tritt der Staat allein, und ohne alles eigne Interesse in die Stelle der Bürger. Denn die Sicherheit wird hier nur dann wirklich verletzt, wenn derjenige, welcher Unrecht leidet, oder zu leiden vermeint, dies nicht geduldig ertragen will, nicht aber dann, wenn er entweder einwilligt, oder doch Gründe hat, sein Recht nicht verfolgen zu wollen. Ja selbst wenn Unwissenheit oder Trägheit Vernachlässigung des eignen Rechtes veranlasste, dürfte der Staat sich nicht von selbst darin mischen. Er hat seinen Pflichten Genüge geleistet, sobald er nur nicht durch verwickelte, dunkle, oder nicht gehörig bekannt gemachte Gesetze zu dergleichen Irrthümern Gelegenheit giebt. Eben diese Gründe gelten nun auch von allen Mitteln, deren der Staat sich zur Ausmittelung des Rechts da bedient, wo es wirklich verfolgt wird. Er darf darin nämlich niemals auch nur einen Schritt weiter [134] zu gehen wagen, als ihn der Wille der Partheien führt. Der erste Grundsatz jeder Prozessordnung müsste daher nothwendig der sein, niemals die Wahrheit an sich und schlechterdings, sondern nur immer insofern aufzusuchen, als diejenige Parthei es fordert, welche deren Aufsuchung überhaupt zu verlangen berechtigt ist. Allein auch hier treten noch neue Schranken ein. Der Staat darf nämlich nicht jedem Verlangen der Partheien willfahren, sondern nur demjenigen, welches zur Aufklärung des streitigen Rechtes dienen kann, und auf die Anwendung solcher Mittel gerichtet ist, welche, auch ausser der Staatsverbindung, der Mensch gegen den Menschen, und zwar in dem Falle gebrauchen kann, in welchem blos ein Recht zwischen ihnen streitig ist, in welchem aber der andre ihm entweder überhaupt nicht, oder wenigstens nicht erwiesenermaassen etwas entzogen hat. Die hinzukommende Gewalt des Staats darf nicht mehr thun, als nur die Anwendung dieser Mittel sichern, und ihre Wirksamkeit unterstützen. Hieraus entsteht der Unterschied zwischen dem Civil- und Kriminalverfahren, dass in jenem das äusserste Mittel zur Erforschung der Wahrheit der Eid ist, in diesem aber der Staat einer grösseren Freiheit geniesst. Da der Richter bei der Ausmittelung des streitigen Rechts gleichsam zwischen beiden Theilen steht, so ist es seine Pflicht zu verhindern, dass keiner derselben durch die Schuld des andern in der Erreichung seiner Absicht entweder ganz gestört, oder doch hingehalten werde; und so entsteht der zweite gleich nothwendige Grundsatz, das Verfahren der Partheien, während des Prozesses, unter specieller Aufsicht zu haben, und zu verhindern, dass es, statt sich dem gemeinschaftlichen Endzweck zu nähern, sich vielmehr davon entferne. Die höchste und genaueste Befolgung jedes dieser beiden Grundsätze würde, dünkt mich, die beste Prozessordnung hervorbringen. Denn übersieht man den letzteren, so ist der Chikane der Partheien, und der Nachlässigkeit und den eigensüchtigen [135] Absichten der Sachwalter zuviel Spielraum gelassen; so werden die Prozesse verwickelt, langwierig, kostspielig; und die Entscheidungen dennoch schief, und der Sache, wie der Meinung der Partheien, oft unangemessen. Ja diese Nachtheile tragen sogar zur grösseren Häufigkeit rechtlicher Streitigkeiten und zur Nahrung der Prozesssucht bei. Entfernt man sich hingegen von dem ersteren Grundsatz, so wird das Verfahren inquisitorisch, der Richter erhält eine zu grosse Gewalt, und mischt sich in die geringsten Privatangelegenheiten der Bürger. Von beiden Extremen finden sich Beispiele in der Wirklichkeit, und die Erfahrung bestätigt, dass, wenn das zuletzt geschilderte die Freiheit zu eng und widerrechtlich beschränkt, das zuerst aufgestellte der Sicherheit des Eigenthums nachtheilig ist.
Der Richter braucht zur Untersuchung und Erforschung der Wahrheit Kennzeichen derselben, Beweismittel. Daher giebt die Betrachtung, dass das Recht nicht anders wirksame Gültigkeit erhält, als wenn es, im Fall es bestritten würde, eines Beweises vor dem Richter fähig ist, einen neuen Gesichtspunkt für die Gesetzgebung an die Hand. Es entsteht nämlich hieraus die Nothwendigkeit neuer einschränkender Gesetze, nämlich solcher, welche den verhandelten Geschäften solche Kennzeichen beizugeben gebieten, an welchen künftig ihre Wirklichkeit oder Gültigkeit zu erkennen sei. Die Nothwendigkeit von Gesetzen dieser Art fällt allemal in eben dem Grade, in welchem die Vollkommenheit der Gerichtsverfassung steigt; ist aber am grössesten da, wo diese am mangelhaftesten ist, und daher der meisten äusseren Zeichen zum Beweise bedarf. Daher findet man die meisten Formalitäten bei den unkultivirtesten Völkern. Stufenweise erforderte die Vindikation eines Ackers, bei den Römern, erst die Gegenwart der Partheien auf dem Acker selbst, dann das Bringen einer Erdscholle desselben ins Gericht, in der Folge feierliche Worte, und endlich auch diese nicht mehr. Ueberall, vorzüglich aber bei minder [136] kultivirten Nationen hat folglich die Gerichtsverfassung einen sehr wichtigen Einfluss auf die Gesetzgebung gehabt, der sich sehr oft bei weitem nicht auf blosse Formalitäten beschränkt. Ich erinnere hier, statt eines Beispiels, an die Römische Lehre von Pakten und Kontrakten, die wie wenig sie auch bisher noch aufgeklärt ist, schwerlich aus einem andern Gesichtspunkt angesehen werden darf. Diesen Einfluss in verschiedenen Gesetzgebungen verschiedner Zeitalter und Nationen zu erforschen, dürfte nicht blos aus vielen andren Gründen, aber auch vorzüglich in der Hinsicht nützlich sein, um daraus zu beurtheilen, welche solcher Gesetze wohl allgemein nothwendig, welche nur in Lokalverhältnissen gegründet sein möchten? Denn alle Einschränkungen dieser Art aufzuheben, dürfte — auch die Möglichkeit angenommen — schwerlich rathsam sein. Denn einmal wird die Möglichkeit von Betrügereien, z. B. von Unterschiebung falscher Dokumente u. s. f. zu wenig erschwert; dann werden die Prozesse vervielfältigt, oder, da dies vielleicht an sich noch kein Uebel scheint, die Gelegenheiten durch erregte unnütze Streitigkeiten die Ruhe andrer zu stören zu mannigfaltig. Nun aber ist gerade die Streitsucht, welche sich durch Prozesse äussert, diejenige, welche — den Schaden noch abgerechnet, den sie dem Vermögen, der Zeit, und der Gemüthsruhe der Bürger zufügt — auch auf den Charakter den nachtheiligsten Einfluss hat, und gerade durch gar keine nützliche Folgen für diese Nachtheile entschädigt. Der Schade der Förmlichkeiten hingegen ist die Erschwerung der Geschäfte, und die Einschränkung der Freiheit, die in jedem Verhältniss bedenklich ist. Das Gesetz muss daher auch hier einen Mittelweg einschlagen, Förmlichkeiten nie aus einem andern Gesichtspunkte anordnen, als um die Gültigkeit der Geschäfte zu sichern, und Betrügereien zu verhindern, oder den Beweis zu erleichtern; selbst in dieser Absicht dieselben nur da fordern, wo sie den individuellen Umständen nach nothwendig sind, wo ohne sie [137] jene Betrügereien zu leicht zu besorgen, und dieser Beweis zu schwer zu führen sein würde; zu denselben nur solche Regeln vorschreiben, deren Befolgung mit nicht grossen Schwierigkeiten verbunden ist; und dieselben von allen denjenigen Fällen gänzlich entfernen, in welchen die Besorgung der Geschäfte durch sie nicht blos schwieriger, sondern so gut als unmöglich werden würde.
Gehörige Rücksicht auf Sicherheit und Freiheit zugleich, scheint daher auf folgende Grundsätze zu führen:
1. Eine der vorzüglichsten Pflichten des Staats ist die Untersuchung und Entscheidung der rechtlichen Streitigkeiten der Bürger. Derselbe tritt dabei an die Stelle der Partheien, und der eigentliche Zweck seiner Dazwischenkunft besteht allein darin, auf der einen Seite gegen ungerechte Forderungen zu beschützen, auf der andern gerechten denjenigen Nachdruck zu geben, welchen sie von den Bürgern selbst nur auf eine die öffentliche Ruhe störende Weise erhalten könnten. Er muss daher während der Untersuchung des streitigen Rechts dem Willen der Partheien, insofern derselbe nur in dem Rechte gegründet ist, folgen, aber jede, sich widerrechtlicher Mittel gegen die andere zu bedienen, verhindern.
2. Die Entscheidung des streitigen Rechts durch den Richter kann nur durch bestimmte, gesetzlich angeordnete Kennzeichen der Wahrheit geschehen. Hieraus entspringt die Nothwendigkeit einer neuen Gattung der Gesetze, derjenigen nämlich, welche den rechtlichen Geschäften gewisse bestimmte Charaktere beizulegen verordnen. Bei der Abfassung dieser nun muss der Gesetzgeber einmal immer allein von dem Gesichtspunkt geleitet werden, die Authenticität der rechtlichen Geschäfte gehörig zu sichern, und den Beweis im Prozesse nicht zu sehr zu erschweren; ferner aber unaufhörlich die Vermeidung des [138] entgegengesetzten Extrems, der zu grossen Erschwerung der Geschäfte, vor Augen haben, und endlich nie da eine Anordnung treffen wollen, wo dieselbe den Lauf der Geschäfte so gut, als gänzlich hemmen würde.
XIII.
Sorgfalt des Staats für die Sicherheit durch Bestrafung der Uebertretungen der Gesetze des Staats. (Kriminalgesetze.)↩
Handlungen, welche der Staat bestrafen muss. — Strafen. Maas derselben; absolutes: Höchste Gelindigkeit bei der gehörigen Wirksamkeit, — Schädlichkeit der Strafe der Ehrlosigkeit. — Ungerechtigkeit der Strafen, welche sich, über den Verbrecher hinaus, auf andre Personen erstrecken. — Relatives Maas der Strafen. Grad der Nichtachtung des fremden Rechts. — Widerlegung des Grundsatzes, welcher zu diesem Maassstab die Häufigkeit der Verbrechen, und die Menge der, zu ihnen reizenden Antriebe annimmt; — Ungerechtigkeit, — Schädlichkeit desselben. — Allgemeine Stufenfolge der Verbrechen in Absicht der Härte ihrer Strafen. — Anwendung der Strafgesetze auf wirkliche Verbrechen. — Verfahren gegen die Verbrecher, während der Untersuchung. — Prüfung der Frage: inwiefern der Staat Verbrechen verhüten darf? — Unterschied zwischen der Beantwortung dieser Frage, und der Bestimmung, sich nur auf den Handlenden selbst beziehende Handlungen im Vorigen. — Abriss der verschiedenen, möglichen Arten, Verbrechen zu verhüten, nach der allgemeinen Ursache der Verbrechen. — Die erste dieser Arten, welche dem Mangel an Mitteln abhilft, der leicht zu Verbrechen führt, ist schädlich und unnütz. — Noch schädlicher, und daher gleichfalls nicht rathsam ist die zweite, welche auf Entfernung der, im Charakter liegenden Ursachen zu Verbrechen gerichtet ist. — Anwendung dieser Art auf wirkliche Verbrecher. Besserung derselben. — Behandlung der ab instantia absolvirten. — Letzte Art, Verbrechen zu verhüten; Entfernung der Gelegenheiten ihrer Begehung. — Einschränkung derselben auf die blosse Verhütung der Ausführung schon beschlossener Verbrechen. — Was dagegen an die Stelle jener gemissbilligten Mittel treten muss, um Verbrechen zu verhüten? — Die strengste Aufsicht auf begangene Verbrechen, und Seltenheit der Straflosigkeit. — Schädlichkeit des Begnadigungsund Milderungsrechts. — Veranstaltungen zur Entdeckung von Verbrechen. — Nothwendigkeit der Publicität aller Kriminalgesetze, ohne Unterschied. — Höchste, aus diesem Abschnitt gezogene Grundsätze.
Das letzte, und vielleicht wichtigste Mittel, für die Sicherheit der Bürger Sorge zu tragen, ist die Bestrafung der Uebertretung der Gesetze des Staats. Ich muss daher noch auf [139] diesen Gegenstand die im Vorigen entwickelten Grundsätze anwenden. Die erste Frage nun, welche hiebei entsteht, ist die: welche Handlungen der Staat mit Strafen belegen, gleichsam als Verbrechen aufstellen kann? Die Antwort ist nach dem Vorigen leicht. Denn da der Staat keinen andern Endzweck, als die Sicherheit der Bürger, verfolgen darf; so darf er auch keine andre Handlungen einschränken, als welche diesem Endzweck entgegenlaufen. Diese aber verdienen auch insgesammt angemessene Bestrafung. Denn nicht blos, dass ihr Schade, da sie gerade das stören, was dem Menschen zum Genuss, wie zur Ausbildung seiner Kräfte das unentbehrlichste ist, zu wichtig ist, um ihnen nicht durch jedes zweckmässige und erlaubte Mittel entgegenzuarbeiten; so muss auch, schon den ersten Rechtsgrundsätzen nach, jeder sich gefallen lassen, dass die Strafe eben so weit gleichsam in den Kreis seines Rechts eingreife, als sein Verbrechen in den des fremden eingedrungen ist. Hingegen Handlungen, welche sich allein auf den Handlenden beziehen, oder mit Einwilligung dessen geschehen, den sie treffen, zu bestrafen, verbieten eben die Grundsätze, welche dieselben nicht einmal einzuschränken erlauben; und es dürfte daher nicht nur keins der sogenannten fleischlichen Verbrechen (die Nothzucht ausgenommen), sie möchten Aergerniss geben oder nicht, unternommener Selbstmord u. s. f. bestraft werden, sondern sogar die Ermordung eines andern mit Bewilligung desselben müsste ungestraft bleiben, wenn nicht in diesem letzteren Falle die zu leichte Möglichkeit eines gefährlichen Missbrauchs ein Strafgesetz nothwendig machte. Ausser denjenigen Gesetzen, welche unmittelbare Kränkungen der Rechte anderer untersagen, giebt es noch andre verschiedener Gattung, deren theils schon im Vorigen gedacht ist, theils noch erwähnt werden wird. Da jedoch, bei dem, dem Staat allgemein vorgeschriebenen Endzweck, auch diese, nur mittelbar, zur Erreichung jener Absicht hinstreben; so kann auch bei diesen [140] Bestrafung des Staats eintreten, insofern nicht schon ihre Uebertretung allein unmittelbar eine solche mit sich führt, wie z. B. die Uebertretung des Verbots der Fideikommisse die Ungültigkeit der gemachten Verfügung. Es ist dies auch um so nothwendiger, als es sonst hier gänzlich an einem Zwangsmittel fehlen würde, dem Gesetze Gehorsam zu verschaffen.
Von dem Gegenstande der Bestrafung wende ich mich zu der Strafe selbst. Das Maas dieser auch nur in sehr weiten Gränzen vorzuschreiben, nur zu bestimmen, über welchen Grad hinaus dieselbe nie steigen dürfe, halte ich in einem allgemeinen, schlechterdings auf gar keine Lokalverhältnisse bezogenen Raisonnement für unmöglich. Die Strafen müssen Uebel sein, welche die Verbrecher zurückschrecken. Nun aber sind die Grade, wie die Verschiedenheiten des physischen und moralischen Gefühls, nach der Verschiedenheit der Erdstriche und Zeitalter, unendlich verschieden und wechselnd. Was daher in einem gegebenen Falle mit Recht Grausamkeit heisst, das kann in einem andren die Nothwendigkeit selbst erheischen. Nur soviel ist gewiss, dass die Vollkommenheit der Strafen immer — versteht sich jedoch bei gleicher Wirksamkeit — mit dem Grade ihrer Gelindigkeit wächst. Denn nicht blos, dass gelinde Strafen schon an sich geringere Uebel sind; so leiten sie auch den Menschen auf die seiner am meisten würdige Weise von Verbrechen ab. Denn je minder sie physisch schmerzhaft und schrecklich sind, desto mehr sind sie es moralisch; da hingegen grosses körperliches Leiden bei dem Leidenden selbst das Gefühl der Schande, bei dem Zuschauer das der Missbilligung vermindert. Daher kommt es denn auch, dass gelinde Strafen in der That viel öfter angewendet werden können, als der erste Anblick zu erlauben scheint; indem sie auf der andren Seite ein ersetzendes moralisches Gegengewicht erhalten. Ueberhaupt hängt die Wirksamkeit der Strafen ganz und gar von dem Eindruck ab, welchen dieselben auf das [141] Gemüth der Verbrecher machen, und beinahe liesse sich behaupten, dass in einer Reihe gehörig abgestufter Stufen es einerlei sei, bei welcher Stufe man gleichsam, als bei der höchsten, stehen bleibe, da die Wirkung einer Strafe in der That nicht sowohl von ihrer Natur an sich, als von dem Platze abhängt, den sie in der Stufenleiter der Strafen überhaupt einnimmt, und man leicht das für die höchste Strafe erkennt, was der Staat dafür erklärt. Ich sage beinah, denn völlig würde die Behauptung nur freilich dann richtig sein, wenn die Strafen des Staats die einzigen Uebel wären, welche dem Bürger drohten. Da dies hingegen der Fall nicht ist, vielmehr oft sehr reelle Uebel ihn gerade zu Verbrechen veranlassen; so muss freilich das Maas der höchsten Strafe, und so der Strafen überhaupt, welche diesen Uebeln entgegenwirken sollen, auch mit Rücksicht auf sie bestimmt werden. Nun aber wird der Bürger da, wo er einer so grossen Freiheit geniesst, als diese Blätter ihm zu sichern bemüht sind, auch in einem grösseren Wohlstande leben; seine Seele wird heiterer, seine Phantasie lieblicher sein, und die Strafe wird, ohne an Wirksamkeit zu verlieren, an Strenge nachlassen können. So wahr ist es, dass alles Gute und Beglückende in wundervoller Harmonie steht, und dass es nur nothwendig ist, Eins herbeizuführen, um sich des Segens alles Uebrigen zu erfreuen. Was sich daher in dieser Materie allgemein bestimmen lässt, ist, dünkt mich, allein dass die höchste Strafe die, den Lokalverhältnissen nach, möglichst gelinde sein muss.
Nur Eine Gattung der Strafen müsste, glaube ich, gänzlich ausgeschlossen werden, die Ehrlosigkeit, Infamie. Denn die Ehre eines Menschen, die gute Meinung seiner Mitbürger von ihm, ist keinesweges etwas, das der Staat in seiner Gewalt hat. Auf jeden Fall reduzirt sich daher diese Strafe allein darauf, dass der Staat dem Verbrecher die Merkmale seiner Achtung und seines Vertrauens entziehn, und andern gestatten [142] kann dies gleichfalls ungestraft zu thun. So wenig ihm nun auch die Befugniss abgesprochen werden darf, sich dieses Rechts, wo er es für nothwendig hält, zu bedienen, und so sehr sogar seine Pflicht es erfordern kann; so halte ich dennoch eine allgemeine Erklärung, dass er es thun wolle, keinesweges für rathsam. Denn einmal setzt dieselbe eine gewisse Konsequenz im Unrechthandlen bei dem Bestraften voraus, die sich doch in der That in der Erfahrung wenigstens nur selten findet; dann ist sie auch, selbst bei der gelindesten Art der Abfassung, selbst wenn sie blos als eine Erklärung des gerechten Misstrauens des Staats ausgedrückt wird, immer zu unbestimmt, um nicht an sich manchem Missbrauch Raum zu geben, und um nicht wenigstens oft, schon der Konsequenz der Grundsätze wegen, mehr Fälle unter sich zu begreifen, als der Sache selbst wegen nöthig wäre. Denn die Gattungen des Vertrauens, welches man zu einem Menschen fassen kann, sind, der Verschiedenheit der Fälle nach, so unendlich mannigfaltig, dass ich kaum unter allen Verbrechen ein Einziges weiss, welches den Verbrecher zu allen auf Einmal unfähig machte. Dazu führt indess doch immer ein allgemeiner Ausdruck, und der Mensch, bei dem man sich sonst nur, bei dahin passenden Gelegenheiten, erinnern würde, dass er dieses oder jenes Gesetz übertreten habe, trägt nun überall ein Zeichen der Unwürdigkeit mit sich herum. Wie hart aber diese Strafe sei, sagt das, gewiss keinem Menschen fremde Gefühl, dass, ohne das Vertrauen seiner Mitmenschen, das Leben selbst wünschenswerth zu sein aufhört. Mehrere Schwierigkeiten zeigen sich nun noch bei der näheren Anwendung dieser Strafe. Misstrauen gegen die Rechtschaffenheit muss eigentlich überall da die Folge sein, wo sich Mangel derselben gezeigt hat. Auf wie viele Fälle aber alsdann diese Strafe ausgedehnt werde, sieht man von selbst. Nicht minder gross ist die Schwierigkeit bei der Frage: wie lange die Strafe dauern solle? Unstreitig wird jeder [143] Billigdenkende sie nur auf eine gewisse Zeit hin erstrecken wollen. Aber wird der Richter bewirken können, dass der, so lange mit dem Misstrauen seiner Mitbürger Beladene, nach Verlauf eines bestimmten Tages, auf einmal ihr Vertrauen wieder gewinne? Endlich ist es den, in diesem ganzen Aufsatz vorgetragenen Grundsätzen nicht gemäss, dass der Staat der Meinung der Bürger, auch nur auf irgend eine Art, eine gewisse Richtung geben wolle. Meines Erachtens wäre es daher rathsamer, dass der Staat sich allein in den Gränzen der Pflicht hielte, welche ihm allerdings obliegt, die Bürger gegen verdächtige Personen zu sichern, und dass er daher überall, wo dies nothwendig sein kann, z. B. bei Besetzung von Stellen, Gültigkeit der Zeugen, Fähigkeit der Vormünder u. s. f. durch ausdrückliche Gesetze verordnete, dass, wer dies oder jenes Verbrechen begangen, diese oder jene Strafe erlitten hätte, davon ausgeschlossen sein solle; übrigens aber sich aller weiteren, allgemeinen Erklärung des Misstrauens, oder gar des Verlustes der Ehre gänzlich enthielte. Alsdann wäre es auch sehr leicht, eine Zeit zu bestimmen, nach Verlauf welcher ein solcher Einwand nicht mehr gültig sein solle. Dass es übrigens dem Staat immer erlaubt bleibe, durch beschimpfende Strafen auf das Ehrgefühl zu wirken, bedarf von selbst keiner Erinnerung. Ebensowenig brauche ich noch zu wiederholen, dass schlechterdings keine Strafe geduldet werden muss, die sich über die Person des Verbrechers hinaus, auf seine Kinder, oder Verwandte erstreckt. Gerechtigkeit und Billigkeit sprechen mit gleich starken Stimmen gegen sie; und selbst die Vorsichtigkeit, mit welcher sich, bei Gelegenheit einer solchen Strafe, das, übrigens gewiss in jeder Rücksicht vortreffliche Preussische Gesetzbuch ausdrückt, vermag nicht, die, in der Sache selbst allemal liegende Härte zu mindern.[40]
[144]
Wenn das absolute Maas der Strafen keine allgemeine Bestimmung erlaubt; so ist dieselbe hingegen um so nothwendiger bei dem relativen. Es muss nämlich festgesetzt werden, was es eigentlich ist, wonach sich der Grad der, auf verschiedne Verbrechen gesetzten Strafen bestimmen muss? Den im Vorigen entwickelten Grundsätzen nach, kann dies, dünkt mich, nichts andres sein, als der Grad der Nicht-Achtung des fremden Rechts in dem Verbrechen, ein Grad, welcher, da hier nicht von der Anwendung eines Strafgesetzes auf einen einzelnen Verbrecher, sondern von allgemeiner Bestimmung der Strafe überhaupt die Rede ist, nach der Natur des Rechts beurtheilt werden muss, welches das Verbrechen kränkt. Zwar scheint die natürlichste Bestimmung der Grad der Leichtigkeit oder Schwierigkeit zu sein, das Verbrechen zu verhindern, so dass die Grösse der Strafe sich nach der Quantität der Gründe richten müsste, welche zu dem Verbrechen trieben, oder davon zurückhielten. Allein wird dieser Grundsatz richtig verstanden; so ist er mit dem eben aufgestellten einerlei. Denn in einem wohlgeordneten Staate, wo nicht in der Verfassung selbst liegende Umstände zu Verbrechen veranlassen, kann es keinen andern eigentlichen Grund zu Verbrechen geben, als eben jene Nicht-Achtung des fremden Rechts, welcher sich nur die zu Verbrechen reizenden Antriebe, Neigungen, Leidenschaften u. s. f. bedienen. Versteht man aber jenen Satz anders, meint man, es müssten den Verbrechen immer in dem Grade grosse Strafen entgegengesetzt werden, in welchem gerade Lokaloder Zeitverhältnisse sie häufiger machen, oder gar, ihrer Natur nach (wie es bei so manchen Polizeiverbrechen der Fall ist) moralische Gründe sich ihnen weniger eindringend widersetzen; so ist dieser Maasstab ungerecht und schädlich zugleich. Er ist ungerecht. Denn so richtig es wenigstens insofern ist, Verhinderung der Beleidigungen für die Zukunft als den Zweck aller Strafen anzunehmen, als keine Strafe je aus einem andern [145] Zwecke verfügt werden darf; so entspringt doch die Verbindlichkeit des Beleidigten, die Strafe zu dulden, eigentlich daraus, dass jeder sich gefallen lassen muss, seine Rechte von dem Andern in so weit verletzt zu sehen, als er selbst die Rechte desselben gekränkt hat. Darauf beruht nicht blos diese Verbindlichkeit ausser der Staatsverbindung, sondern auch in derselben. Denn die Herleitung derselben aus einem gegenseitigen Vertrag ist nicht nur unnütz, sondern hat auch die Schwierigkeit, dass z. B. die, manchmal und unter gewissen Lokalumständen offenbar nothwendige Todesstrafe bei derselben schwerlich gerechtfertigt werden kann, und dass jeder Verbrecher sich von der Strafe befreien könnte, wenn er, bevor er sie litte, sich von dem gesellschaftlichen Vertrage lossagte, wie z. B. in den alten Freistaaten die freiwillige Verbannung war, die jedoch, wenn mich mein Gedächtniss nicht trügt, nur bei Staats-, nicht bei Privat-Verbrechen geduldet ward. Dem Beleidiger selbst ist daher gar keine Rücksicht auf die Wirksamkeit der Strafe erlaubt; und wäre es auch noch so gewiss, dass der Beleidigte keine zweite Beleidigung von ihm zu fürchten hätte, so müsste er, dessen ungeachtet, die Rechtmässigkeit der Strafe anerkennen. Allein auf der andern Seite folgt auch aus eben diesem Grundsatz, dass er sich auch jeder, die Quantität seines Verbrechens überschreitenden Strafe rechtmässig widersetzen kann, wie gewiss es auch sein möchte, dass nur diese Strafe, und schlechterdings keine gelindere völlig wirksam sein würde. Zwischen dem inneren Gefühle des Rechts, und dem Genuss des äusseren Glücks ist, wenigstens in der Idee des Menschen, ein unläugbarer Zusammenhang, und es vermag nicht bestritten zu werden, dass er sich durch das Erstere zu dem Letzteren berechtigt glaubt. Ob diese seine Erwartung in Absicht des Glücks gegründet ist, welches ihm das Schicksal gewährt, oder versagt? — eine allerdings zweifelhaftere Frage — darf hier nicht erörtert werden. Allein in Absicht desjenigen, [146] welches andre ihm willkürlich geben oder entziehen können, muss seine Befugniss zu derselben nothwendig anerkannt werden; da hingegen jener Grundsatz sie, wenigstens der That nach, abzuläugnen scheint. Es ist aber auch ferner jener Maasstab, sogar für die Sicherheit selbst, nachtheilig. Denn wenn er gleich diesem oder jenem einzelnen Gesetze vielleicht Gehorsam erzwingen kann; so verwirrt er gerade das, was die festeste Stütze der Sicherheit der Bürger in einem Staate ist, das Gefühl der Moralität, indem er einen Streit zwischen der Behandlung, welche der Verbrecher erfährt, und der eignen Empfindung seiner Schuld veranlasst. Dem fremden Rechte Achtung zu verschaffen, ist das einzige sichre und unfehlbare Mittel, Verbrechen zu verhüten; und diese Absicht erreicht man nie, sobald nicht jeder, welcher fremdes Recht angreift, grade in eben dem Maase in der Ausübung des seinigen gehemmt wird, die Ungleichheit möge nun im Mehr oder im Weniger bestehen. Denn nur eine solche Gleichheit bewahrt die Harmonie zwischen der innern moralischen Ausbildung des Menschen, und dem Gedeihen der Veranstaltungen des Staats, ohne welche auch die künstlichste Gesetzgebung allemal ihres Endzwecks verfehlen wird. Wie sehr aber nun die Erreichung aller übrigen Endzwecke des Menschen, bei Befolgung des oben erwähnten Maasstabes, leiden würde, wie sehr dieselbe gegen alle in diesem Aufsatze vorgetragene Grundsätze streitet; bedarf nicht mehr einer weiteren Ausführung. Die Gleichheit zwischen Verbrechen und Strafe, welche die eben entwickelten Ideen fordern, kann wiederum nicht absolut bestimmt, es kann nicht allgemein gesagt werden, dieses oder jenes Verbrechen verdient nur eine solche oder solche Strafe. Nur bei einer Reihe, dem Grade nach verschiedener Verbrechen kann die Beobachtung dieser Gleichheit vorgeschrieben werden, indem nun die, für diese Verbrechen bestimmten Strafen in gleichen Graden abgestuft werden müssen. Wenn daher, nach dem Vorigen, die Bestimmung des [147] absoluten Maases der Strafen, z. B. der höchsten Strafe sich nach derjenigen Quantität des zugefügten Uebels richten muss, welche erfordert wird, um das Verbrechen für die Zukunft zu verhüten; so muss das relative Maas der übrigen, wenn jene, oder überhaupt Eine einmal festgesetzt ist, nach dem Grade bestimmt werden, um welchen die Verbrechen, für die sie bestimmt sind, grösser oder kleiner als dasjenige sind, welches jene zuerst verhängte Strafe verhüten soll. Die härteren Strafen müssten daher diejenigen Verbrechen treffen, welche wirklich in den Kreis des fremden Rechts eingreifen; gelindere die Uebertretung derjenigen Gesetze, welche jenes nur zu verhindern bestimmt sind, wie wichtig und nothwendig diese Gesetze auch an sich sein möchten. Dadurch wird denn zugleich die Idee bei den Bürgern vermieden, dass sie vom Staat eine willkürliche, nicht gehörig motivirte Behandlung erführen — ein Vorurtheil, welches sehr leicht entsteht, wenn harte Strafen auf Handlungen gesetzt sind, die entweder wirklich nur einen entfernten Einfluss auf die Sicherheit haben, oder deren Zusammenhang damit doch weniger leicht einzusehen ist. Unter jenen erstgenannten Verbrechen aber müssten diejenigen am härtesten bestraft werden, welche unmittelbar und geradezu die Rechte des Staats selbst angreifen, da, wer die Rechte des Staats nicht achtet, auch die seiner Mitbürger nicht zu ehren vermag, deren Sicherheit allein von jenen abhängig ist.
Wenn auf diese Weise Verbrechen und Strafe allgemein von dem Gesetze bestimmt sind, so muss nun dies gegebene Strafgesetz auf einzelne Verbrechen angewendet werden. Bei dieser Anwendung sagen schon die Grundsätze des Rechts von selbst, dass die Strafe nur nach dem Grade des Vorsatzes oder der Schuld den Verbrecher treffen kann, mit welchem er die Handlung beging. Wenn aber der oben aufgestellte Grundsatz, dass nämlich immer die Nicht-Achtung des fremden Rechts, und nur diese bestraft werden darf, völlig genau befolgt [148] werden soll, so darf derselbe, auch bei der Bestrafung einzelner Verbrechen, nicht vernachlässigt werden. Bei jedem verübten Verbrechen muss daher der Richter bemüht sein, so viel möglich, die Absicht des Verbrechers genau zu erforschen, und durch das Gesetz in den Stand gesetzt werden, die allgemeine Strafe noch nach dem individuellen Grade, in welchem er das Recht, welches er beleidigte, ausser Augen setzte, zu modificiren.
Das Verfahren gegen den Verbrecher, während der Untersuchung findet gleichfalls sowohl in den allgemeinen Grundsätzen des Rechts, als in dem Vorigen seine bestimmten Vorschriften. Der Richter muss nämlich alle rechtmässige Mittel anwenden, die Wahrheit zu erforschen, darf sich hingegen keines erlauben, das ausserhalb der Schranken des Rechts liegt. Er muss daher vor allen Dingen den blos verdächtigen Bürger von dem überführten Verbrecher sorgfältig unterscheiden, und nie den erstern, wie den letzteren, behandeln; überhaupt aber nie, auch den überwiesenen Verbrecher in dem Genuss seiner Menschen- und Bürgerrechte kränken, da er die ersteren erst mit dem Leben, die letzteren erst durch eine gesetzmässige richterliche Ausschliessung aus der Staatsverbindung verlieren kann. Die Anwendung von Mitteln, welche einen eigentlichen Betrug enthalten, dürfte daher ebenso unerlaubt sein, als die Folter. Denn wenn man dieselbe gleich vielleicht dadurch entschuldigen kann, dass der Verdächtige, oder wenigstens der Verbrecher selbst durch seine eignen Handlungen dazu berechtiget; so sind sie dennoch der Würde des Staats, welchen der Richter vorstellt, allemal unangemessen; und wie heilsame Folgen ein offnes und gerades Betragen, auch gegen Verbrecher, auf den Charakter der Nation haben würde, ist nicht nur an sich, sondern auch aus der Erfahrung derjenigen Staaten klar, welche sich, wie z. B. England, hierin einer edlen Gesetzgebung erfreuen.
[149]
Zuletzt muss ich, bei Gelegenheit des Kriminalrechts, noch eine Frage zu prüfen versuchen, welche vorzüglich durch die Bemühungen der neueren Gesetzgebung wichtig geworden ist, die Frage nämlich, inwiefern der Staat befugt, oder verpflichtet ist, Verbrechen, noch ehe dieselben begangen werden, zuvorzukommen? Schwerlich wird irgend ein anderes Unternehmen von gleich menschenfreundlichen Absichten geleitet, und die Achtung, womit dasselbe jeden empfindenden Menschen nothwendig erfüllt, droht daher der Unpartheilichkeit der Untersuchung Gefahr. Dennoch halte ich, ich läugne es nicht, eine solche Untersuchung für überaus nothwendig, da, wenn man die unendliche Mannigfaltigkeit der Seelenstimmungen erwägt, aus welchen der Vorsatz zu Verbrechen entstehen kann, diesen Vorsatz zu verhindern unmöglich, und nicht allein dies, sondern selbst, nur der Ausübung zuvorzukommen, für die Freiheit bedenklich scheint. Da ich im Vorigen (S. 106—116) das Recht des Staats, die Handlungen der einzelnen Menschen einzuschränken zu bestimmen versucht habe; so könnte es scheinen, als hätte ich dadurch schon zugleich die gegenwärtige Frage beantwortet. Allein wenn ich dort festsetzte, dass der Staat diejenigen Handlungen einschränken müsse, deren Folgen den Rechten andrer leicht gefährlich werden können; so verstand ich darunter — wie auch die Gründe leicht zeigen, womit ich diese Behauptung zu unterstützen bemüht war — solche Folgen, die allein und an sich aus der Handlung fliessen, und nur etwa durch grössere Vorsicht des Handlenden hätten vermieden werden können. Wenn hingegen von Verhütung von Verbrechen die Rede ist; so spricht man natürlich nur von Beschränkung solcher Handlungen, aus welchen leicht eine zweite, nämlich die Begehung des Verbrechens, entspringt. Der wichtige Unterschied liegt daher hier schon darin, dass die Seele des Handlenden hier thätig, durch einen neuen Entschluss, mitwirken muss; da sie hingegen dort entweder gar [150] keinen, oder doch nur, durch Verabsäumung der Thätigkeit, einen negativen Einfluss haben konnte. Dies allein wird, hoffe ich, hinreichen, die Gränzen deutlich zu zeigen. Alle Verhütung von Verbrechen nun muss von den Ursachen der Verbrechen ausgehen. Diese so mannigfaltigen Ursachen aber liessen sich, in einer allgemeinen Formel, vielleicht durch das, nicht durch Gründe der Vernunft gehörig in Schranken gehaltene Gefühl des Missverhältnisses ausdrücken, welches zwischen den Neigungen des Handlenden und der Quantität der rechtmässigen Mittel obwaltet, die in seiner Gewalt stehn. Bei diesem Missverhältniss lassen sich wenigstens im Allgemeinen, obgleich die Bestimmung im Einzelnen viel Schwierigkeit finden würde, zwei Fälle von einander absondern, einmal wenn dasselbe aus einem wahren Uebermaasse der Neigungen, dann wenn es aus dem, auch für ein gewöhnliches Maass, zu geringen Vorrath von Mitteln entspringt. Beide Fälle muss noch ausserdem Mangel an Stärke der Gründe der Vernunft und des moralischen Gefühls, gleichsam als dasjenige begleiten, welches jenes Missverhältniss nicht verhindert, in gesetzwidrige Handlungen auszubrechen. Jedes Bemühen des Staats, Verbrechen durch Unterdrückung ihrer Ursachen in dem Verbrecher verhüten zu wollen, wird daher, nach der Verschiedenheit der beiden erwähnten Fälle, entweder dahin gerichtet sein müssen, solche Lagen der Bürger, welche leicht zu Verbrechen nöthigen können, zu verändern und zu verbessern, oder solche Neigungen, welche zu Uebertretungen der Gesetze zu führen pflegen, zu beschränken, oder endlich den Gründen der Vernunft und dem moralischen Gefühl eine wirksamere Stärke zu verschaffen. Einen andern Weg, Verbrechen zu verhüten giebt es endlich noch ausserdem durch gesetzliche Verminderung der Gelegenheiten, welche die wirkliche Ausübung derselben erleichtern, oder gar den Ausbruch gesetzwidriger Neigungen [151] begünstigen. Keine dieser verschiedenen Arten darf von der gegenwärtigen Prüfung ausgeschlossen werden.
Die erste derselben, welche allein auf Verbesserung zu Verbrechen nöthigender Lagen gerichtet ist, scheint unter allen die wenigsten Nachtheile mit sich zu führen. Es ist an sich so wohlthätig, den Reichthum der Mittel der Kraft, wie des Genusses, zu erhöhen; die freie Wirksamkeit des Menschen wird dadurch nicht unmittelbar beschränkt; und wenn freilich unläugbar auch hier alle Folgen anerkannt werden müssen, die ich, im Anfange dieses Aufsatzes, als Wirkungen der Sorgfalt des Staats für das physische Wohl der Bürger darstellte, so treten sie doch hier, da eine solche Sorgfalt hier nur auf so wenige Personen ausgedehnt wird, nur in sehr geringem Grade ein. Allein immer finden dieselben doch wirklich Statt; gerade der Kampf der inneren Moralität mit der äusseren Lage wird aufgehoben, und mit ihm seine heilsame Wirkung auf die Festigkeit des Charakters des Handlenden, und auf das gegenseitig sich unterstützende Wohlwollen der Bürger überhaupt; und eben, dass diese Sorgfalt nur einzelne Personen treffen muss, macht ein Bekümmern des Staats um die individuelle Lage der Bürger nothwendig — lauter Nachtheile, welche nur die Ueberzeugung vergessen machen könnte, dass die Sicherheit des Staats, ohne eine solche Einrichtung, leiden würde. Aber gerade diese Nothwendigkeit kann, dünkt mich, mit Recht bezweifelt werden. In einem Staate, dessen Verfassung den Bürger nicht selbst in dringende Lagen versetzt, welcher denselben vielmehr eine solche Freiheit sichert, als diese Blätter zu empfehlen versuchen, ist es kaum möglich, dass Lagen der beschriebenen Art überhaupt entstehen, und nicht in der freiwilligen Hülfsleistung der Bürger selbst, ohne Hinzukommen des Staats, Heilmittel finden sollten; der Grund müsste denn in dem Betragen des Menschen selbst liegen. In diesem Falle aber ist [152] es nicht gut, dass der Staat ins Mittel trete, und die Reihe der Begebenheiten störe, welche der natürliche Lauf der Dinge aus den Handlungen desselben entspringen lässt. Immer werden auch wenigstens diese Lagen nur so selten eintreffen, dass es überhaupt einer eignen Dazwischenkunft des Staats nicht bedürfen wird, und dass nicht die Vortheile derselben von den Nachtheilen überwogen werden sollten, die es, nach Allem im Vorigen Gesagten, nicht mehr nothwendig ist, einzeln auseinanderzusetzen.
Gerade entgegengesetzt verhalten sich die Gründe, welche für und wider die zweite Art des Bemühens, Verbrechen zu verhindern streiten, wider diejenige nämlich, welche auf die Neigungen und Leidenschaften der Menschen selbst zu wirken strebt. Denn auf der einen Seite scheint die Nothwendigkeit grösser, da, bei minder gebundner Freiheit der Genuss üppiger ausschweift, und die Begierden sich ein weiteres Ziel stecken, wogegen die freilich, mit der grösseren eignen Freiheit, immer wachsende Achtung auch des fremden Rechts dennoch vielleicht nicht hinlänglich wirkt. Auf der andern aber vermehrt sich auch der Nachtheil in eben dem Grade, in welchem die moralische Natur jede Fessel schwerer empfindet, als die physische. Die Gründe, aus welchen ein, auf die Verbesserung der Sitten der Bürger gerichtetes Bemühen des Staats weder nothwendig, noch rathsam ist, habe ich im Vorigen zu entwickeln versucht. Eben diese nun treten in ihrem ganzen Umfange, und nur mit dem Unterschiede auch hier ein, dass der Staat hier nicht die Sitten überhaupt umformen, sondern nur auf das, der Befolgung der Gesetze Gefahr drohende Betragen Einzelner wirken will. Allein gerade durch diesen Unterschied wächst die Summe der Nachtheile. Denn dieses Bemühen muss schon eben darum, weil es nicht allgemein wirkt, seinen Endzweck minder erreichen, so dass daher nicht einmal das einseitige Gute, das es abzweckt, für den Schaden entschädigt, den es anrichtet; und [153] dann setzt es nicht blos ein Bekümmern des Staats um die Privathandlungen einzelner Individuen, sondern auch eine Macht voraus, darauf zu wirken, welche durch die Personen noch bedenklicher wird, denen dieselbe anvertraut werden muss. Es muss nämlich alsdann entweder eigen dazu bestellten Leuten, oder den schon vorhandenen Dienern des Staats eine Aufsicht über das Betragen, und die daraus entspringende Lage entweder aller Bürger, oder der ihnen untergebenen, übertragen werden. Dadurch aber wird eine neue und drückendere Herrschaft eingeführt, als beinah irgend eine andere sein könnte; indiskreter Neugier, einseitiger Intoleranz, selbst der Heuchelei und Verstellung Raum gegeben. Man beschuldige mich hier nicht, nur Missbräuche geschildert zu haben. Die Missbräuche sind hier mit der Sache unzertrennlich verbunden; und ich wage es zu behaupten, dass selbst, wenn die Gesetze die besten und menschenfreundlichsten wären, wenn sie den Aufsehern blos Erkundigungen auf gesetzmässigen Wegen, und den Gebrauch von allem Zwang entfernter Rathschläge und Ermahnungen erlaubten, und diesen Gesetzen die strengste Folge geleistet würde, dennoch eine solche Einrichtung unnütz und schädlich zugleich wäre. Jeder Bürger muss ungestört handlen können, wie er will, solange er nicht das Gesetz überschreitet; jeder muss die Befugniss haben, gegen jeden andern, und selbst gegen alle Wahrscheinlichkeit, wie ein Dritter dieselbe beurtheilen kann, zu behaupten: wie sehr ich mich der Gefahr, die Gesetze zu übertreten, auch nähere, so werde ich dennoch nicht unterliegen. Wird er in dieser Freiheit gekränkt, so verletzt man sein Recht, und schadet der Ausbildung seiner Fähigkeiten, der Entwickelung seiner Individualität. Denn die Gestalten, deren die Moralität und die Gesetzmässigkeit fähig ist, sind unendlich verschieden und mannigfaltig; und wenn ein Dritter entscheidet, dieses oder jenes Betragen muss auf gesetzwidrige Handlungen führen, so folgt er seiner Ansicht, welche, wie [154] richtig sie auch in ihm sein möge, immer nur Eine ist. Selbst aber angenommen, er irre sich nicht, der Erfolg sogar bestätige sein Urtheil, und der andre, dem Zwange gehorchend, oder dem Rath, ohne innere Ueberzeugung, folgend, übertrete das Gesetz diesmal nicht, das er sonst übertreten haben würde; so ist es doch für den Uebertreter selbst besser, er empfinde einmal den Schaden der Strafe, und erhalte die reine Lehre der Erfahrung, als dass er zwar diesem einen Nachtheil entgehe, aber für seine Ideen keine Berichtigung, für sein moralisches Gefühl keine Uebung empfange; doch besser für die Gesellschaft, Eine Gesetzesübertretung mehr störe die Ruhe, aber die nachfolgende Strafe diene zu Belehrung und Warnung, als dass zwar die Ruhe diesmal nicht leide, aber darum das, worauf alle Ruhe und Sicherheit der Bürger sich gründet, die Achtung des fremden Rechts, weder an sich wirklich grösser sei, noch auch jetzt vermehrt und befördert werde. Ueberhaupt aber wird eine solche Einrichtung nicht leicht einmal die erwähnte Wirkung haben. Wie alle, nicht geradezu auf den innern Quell aller Handlungen gehende Mittel, wird nur durch sie eine andre Richtung der, den Gesetzen entgegenstrebenden Begierden, und gerade doppelt schädliche Verheimlichung entstehen. Ich habe hierbei immer vorausgesetzt, dass die zu dem Geschäft, wovon hier die Rede ist, bestimmten Personen keine Ueberzeugung hervorbringen, sondern allein durch fremdartige Gründe wirken. Es kann scheinen, als wäre ich zu dieser Voraussetzung nicht berechtigt. Allein dass es heilsam ist, durch wirkendes Beispiel und überzeugenden Rath auf seine Mitbürger und ihre Moralität Einfluss zu haben, ist zu sehr in die Augen leuchtend, als dass es erst ausdrücklich wiederholt werden dürfte. Gegen keinen der Fälle also, wo jene Einrichtung dies hervorbringt, kann das vorige Raisonnement gerichtet sein. Nur, scheint es mir, ist eine gesetzliche Vorschrift hiezu nicht blos ein undienliches, sondern sogar entgegenarbeitendes Mittel. Einmal sind schon [155] Gesetze nicht der Ort, Tugenden zu empfehlen, sondern nur erzwingbare Pflichten vorzuschreiben, und nicht selten wird nur die Tugend, die jeder Mensch nur freiwillig auszuüben sich freut, dadurch verlieren. Dann ist jede Bitte eines Gesetzes, und jeder Rath, den ein Vorgesetzter kraft desselben giebt, ein Befehl, dem die Menschen zwar in der Theorie nicht gehorchen müssen, aber in der Wirklichkeit immer gehorchen. Endlich muss man hiezu noch so viele Umstände rechnen, welche die Menschen nöthigen, und so viele Neigungen, welche sie bewegen können, einem solchen Rathe, auch gänzlich gegen ihre Ueberzeugung, zu folgen. Von dieser Art pflegt gewöhnlich der Einfluss zu sein, welchen der Staat auf diejenigen hat, die der Verwaltung seiner Geschäfte vorgesetzt sind, und durch den er zugleich auf die übrigen Bürger zu wirken strebt. Da diese Personen durch besondre Verträge mit ihm verbunden sind; so ist es freilich unläugbar, dass er auch mehrere Rechte gegen sie, als gegen die übrigen Bürger, ausüben kann. Allein wenn er den Grundsätzen der höchsten gesetzmässigen Freiheit getreu bleibt; so wird er nicht mehr von ihnen zu fordern versuchen, als die Erfüllung der Bürgerpflichten im Allgemeinen, und derjenigen besondren, welche ihr besondres Amt nothwendig macht. Denn offenbar übt er einen zu mächtigen positiven Einfluss auf die Bürger überhaupt aus, wenn er von jenen, vermöge ihres besondren Verhältnisses, etwas zu erhalten sucht, was er den Bürgern geradezu nicht aufzulegen berechtigt ist. Ohne dass er wirkliche positive Schritte thut, kommen ihm hierin schon von selbst nur zuviel die Leidenschaften der Menschen zuvor, und das Bemühen, nur diesen, hieraus von selbst entspringenden Nachtheil zu verhüten, wird seinen Eifer und seinen Scharfsinn schon hinlänglich beschäftigen.
Eine nähere Veranlassung Verbrechen durch Unterdrückung der in dem Charakter liegenden Ursachen derselben zu verhüten, hat der Staat bei denjenigen, welche durch wirkliche Ueber [156] tretungen der Gesetze gerechte Besorgniss für die Zukunft erwecken. Daher haben auch die denkendsten neueren Gesetzgeber versucht, die Strafen zugleich zu Besserungsmitteln zu machen. Gewiss ist es nun, dass nicht blos von der Strafe der Verbrecher schlechterdings alles entfernt werden muss, was irgend der Moralität derselben nachtheilig sein könnte; sondern dass ihnen auch jedes Mittel, das nur übrigens nicht dem Endzweck der Strafe zuwider ist, freistehen muss, ihre Ideen zu berichtigen und ihre Gefühle zu verbessern. Allein auch dem Verbrecher darf die Belehrung nicht aufgedrungen werden; und wenn dieselbe schon eben dadurch Nutzen und Wirksamkeit verliert; so läuft ein solches Aufdringen auch den Rechten des Verbrechers entgegen, der nie zu etwas mehr verbunden sein kann, als die gesetzmässige Strafe zu leiden.
Ein völlig specieller Fall ist noch der, wo der Angeschuldigte zwar zu viel Gründe gegen sich hat, um nicht einen starken Verdacht auf sich zu laden, aber nicht genug, um verurtheilt zu werden. (Absolutio ab instantia.) Ihm alsdann die völlige Freiheit unbescholtener Bürger zu verstatten, macht die Sorgfalt für die Sicherheit bedenklich, und eine fortdauernde Aufsicht auf sein künftiges Betragen ist daher allerdings nothwendig. Indess eben die Gründe, welche jedes positive Bemühen des Staats bedenklich machen, und überhaupt anrathen, an die Stelle seiner Thätigkeit lieber, wo es geschehen kann, die Thätigkeit einzelner Bürger zu setzen, geben auch hier der freiwillig übernommenen Aufsicht der Bürger vor einer Aufsicht des Staats den Vorzug; und es dürfte daher besser sein, verdächtige Personen dieser Art sichere Bürgen stellen zu lassen, als sie einer unmittelbaren Aufsicht des Staats zu übergeben, die nur, in Ermanglung der Bürgschaft, eintreten müsste. Beispiele solcher Bürgschaften giebt auch, zwar nicht in diesem, aber in ähnlichen Fällen, die Englische Gesetzgebung.
[157]
Die letzte Art, Verbrechen zu verhüten, ist diejenige, welche, ohne auf ihre Ursachen wirken zu wollen, nur ihre wirkliche Begehung zu verhindern bemüht ist. Diese ist der Freiheit am wenigsten nachtheilig, da sie am wenigsten einen positiven Einfluss auf die Bürger hervorbringt. Indess lässt auch sie mehr oder minder weite Schranken zu. Der Staat kann sich nämlich begnügen, die strengste Wachsamkeit auf jedes gesetzwidrige Vorhaben auszuüben, und dasselbe vor seiner Ausführung zu verhindern; oder er kann weiter gehen, und solche an sich unschädliche Handlungen untersagen, bei welchen leicht Verbrechen entweder nur ausgeführt, oder auch beschlossen zu werden pflegen. Dies Letztere greift abermals in die Freiheit der Bürger ein; zeigt ein Misstrauen des Staats gegen sie, das nicht blos auf ihren Charakter, sondern auch für den Zweck selbst, der beabsichtet wird, nachtheilige Folgen hat; und ist aus eben den Gründen nicht rathsam, welche mir die vorhin erwähnten Arten, Verbrechen zu verhüten, zu missbilligen schienen. Alles, was der Staat thun darf, und mit Erfolg für seinen Endzweck, und ohne Nachtheil für die Freiheit der Bürger, thun kann, beschränkt sich daher auf das Erstere, auf die strengste Aufsicht auf jede, entweder wirklich schon begangene, oder erst beschlossene Uebertretung der Gesetze; und da dies nur uneigentlich den Verbrechen zuvorkommen genannt werden kann; so glaube ich behaupten zu dürfen, dass ein solches Zuvorkommen gänzlich ausserhalb der Schranken der Wirksamkeit des Staats liegt. Desto emsiger aber muss derselbe darauf bedacht sein, kein begangenes Verbrechen unentdeckt, kein entdecktes unbestraft, ja nur gelinder bestraft zu lassen, als das Gesetz es verlangt. Denn die durch eine ununterbrochene Erfahrung bestätigte Ueberzeugung der Bürger, dass es ihnen nicht möglich ist, in fremdes Recht einzugreifen, ohne eine, gerade verhältnissmässige Schmälerung des eignen zu erdulden, scheint mir zugleich die einzige Schutzmauer der Sicherheit der Bürger, und das [158] einzige untrügliche Mittel, unverletzliche Achtung des fremden Rechts zu begründen. Zugleich ist dieses Mittel die einzige Art, auf eine des Menschen würdige Weise auf den Charakter desselben zu wirken, da man den Menschen nicht zu Handlungen unmittelbar zwingen oder leiten, sondern allein durch die Folgen ziehen muss, welche, der Natur der Dinge nach, aus seinem Betragen fliessen müssen. Statt aller zusammengesetzteren und künstlicheren Mittel, Verbrechen zu verhüten, würde ich daher nie etwas anders, als gute und durchdachte Gesetze, in ihrem absoluten Maasse den Lokalumständen, in ihrem relativen dem Grade der Inmoralität der Verbrechen genau angemessene Strafen, möglichst sorgfältige Aufsuchung jeder vorgefallenen Uebertretung der Gesetze, und Hinwegräumung aller Möglichkeit auch nur der Milderung der richterlich bestimmten Strafe vorschlagen. Wirkt dies freilich sehr einfache Mittel, wie ich nicht läugnen will, langsam; so wirkt es dagegen auch unfehlbar, ohne Nachtheil für die Freiheit, und mit heilsamem Einfluss auf den Charakter der Bürger. Ich brauche mich nun nicht länger bei den Folgen der hier aufgestellten Sätze zu verweilen, wie z. B. bei der schon öfter bemerkten Wahrheit, dass das Begnadigungs- selbst das Milderungsrecht des Landesherrn gänzlich aufhören müsste. Sie lassen sich von selbst ohne Mühe daraus herleiten. Die näheren Veranstaltungen, welche der Staat treffen muss, um begangene Verbrechen zu entdecken, oder erst beschlossenen zuvorzukommen, hängen fast ganz von individuellen Umständen specieller Lagen ab. Allgemein kann hier nur bestimmt werden, dass derselbe auch hier seine Rechte nicht überschreiten, und also keine, der Freiheit und der häuslichen Sicherheit der Bürger überhaupt entgegenlaufende Maassregeln ergreifen darf. Hingegen kann er für öffentliche Orte, wo am leichtesten Frevel verübt werden, eigene Aufseher bestellen; Fiskale anordnen, welche, vermöge ihres Amts, gegen verdächtige Personen verfahren; und endlich alle Bürger durch [159] Gesetze verpflichten, ihm in diesem Geschäfte behülflich zu sein, und nicht blos beschlossene, und noch nicht begangene Verbrechen, sondern auch schon verübte, und ihre Thäter anzuzeigen. Nur muss er dies Letztere, um nicht auf den Charakter der Bürger nachtheilig zu wirken, immer nur als Pflicht fordern, nicht durch Belohnungen, oder Vortheile dazu anreizen; und selbst von dieser Pflicht diejenigen entbinden, welche derselben kein Genüge leisten könnten, ohne die engsten Bande dadurch zu zerreissen.
Endlich muss ich noch, ehe ich diese Materie beschliesse, bemerken, dass alle Kriminalgesetze, sowohl diejenigen, welche die Strafen, als diejenigen, welche das Verfahren bestimmen, allen Bürgern, ohne Unterschied, vollständig bekannt gemacht werden müssen. Zwar hat man verschiedentlich das Gegentheil behauptet, und sieh des Grundes bedient, dass dem Bürger nicht die Wahl gelassen werden müsse, mit dem Uebel der Strafe gleichsam den Vortheil der gesetzwidrigen Handlung zu erkaufen. Allein — die Möglichkeit einer fortdauernden Verheimlichung auch einmal angenommen — so unmoralisch auch eine solche Abwägung in dem Menschen selbst wäre, der sie vornähme; so darf der Staat, und überhaupt ein Mensch dem andren, dieselbe doch nicht verwehren. Es ist im Vorigen, wie ich hoffe, hinlänglich gezeigt worden, dass kein Mensch dem andren mehr Uebel, als Strafe, zufügen darf, als er selbst durch das Verbrechen gelitten hat. Ohne gesetzliche Bestimmung müsste also der Verbrecher so viel erwarten, als er ohngefähr seinem Verbrechen gleich achtete; und da nun diese Schätzung bei mehreren Menschen zu verschieden ausfallen würde, so ist sehr natürlich, dass man ein festes Maass durch das Gesetz bestimme, und dass also zwar nicht die Verbindlichkeit, Strafe zu leiden, aber doch die, bei Zufügung der Strafe nicht willkührlich alle Gränzen zu überschreiten, durch einen Vertrag begründet sei. Noch ungerechter aber wird eine solche Verheimlichung bei dem Verfahren [160] zur Aufsuchung der Verbrechen. Da könnte sie unstreitig zu nichts andrem dienen, als Furcht vor solchen Mitteln zu erregen, die der Staat selbst nicht anwenden zu dürfen glaubt, und nie muss der Staat durch eine Furcht wirken wollen, welche nichts anders unterhalten kann, als Unwissenheit der Bürger über ihre Rechte, oder Mistrauen gegen seine Achtung derselben.
Ich ziehe nunmehr aus dem bisher vorgetragenen Raisonnement folgende höchste Grundsätze jedes Kriminalrechts überhaupt:
1. Eins der vorzüglichsten Mittel zur Erhaltung der Sicherheit ist die Bestrafung der Uebertreter der Gesetze des Staats. Der Staat darf jede Handlung mit einer Strafe belegen, welche die Rechte der Bürger kränkt, und insofern er selbst allein aus diesem Gesichtspunkt Gesetze anordnet, jede, wodurch eines seiner Gesetze übertreten wird.
2. Die härteste Strafe darf keine andre, als die nach den individuellen Zeit- und Ortverhältnissen möglichst gelinde sein. Nach dieser müssen alle übrige gerade in dem Verhältniss bestimmt sein, in welchem die Verbrechen, gegen welche sie gerichtet sind, Nichtachtung des fremden Rechts bei dem Verbrecher voraussetzen. So muss daher die härteste Strafe denjenigen treffen, welcher das wichtigste Recht des Staats selbst, eine minder harte denjenigen, welcher nur ein gleich wichtiges Recht eines einzelnen Bürgers gekränkt, eine noch gelindere endlich denjenigen, welcher blos ein Gesetz übertreten hatte, dessen Absicht es war, eine solche, blos mögliche Kränkung zu verhindern.
3. Jedes Strafgesetz kann nur auf denjenigen angewendet werden, welcher dasselbe mit Vorsatz, oder mit Schuld übertrat, und nur in dem Grade, in welchem er dadurch Nichtachtung des fremden Rechts bewies.
4. Bei der Untersuchung begangener Verbrechen darf der Staat zwar jedes dem Endzweck angemessene Mittel [161] anwenden; hingegen keines, das den blos verdächtigen Bürger schon als Verbrecher behandelte, noch ein solches, das die Rechte des Menschen und des Bürgers, welche der Staat, auch in dem Verbrecher, ehren muss, verletzte, oder das den Staat einer unmoralischen Handlung schuldig machen würde.
5. Eigene Veranstaltungen, noch nicht begangene Verbrechen zu verhüten, darf sich der Staat nicht anders erlauben, als insofern dieselben die unmittelbare Begehung derselben verhindern. Alle übrige aber, sie mögen nun den Ursachen zu Verbrechen entgegenarbeiten, oder an sich unschädliche, aber leicht zu Verbrechen führende Handlungen verhüten wollen, liegen ausserhalb der Gränzen seiner Wirksamkeit. Wenn zwischen diesem, und dem, bei Gelegenheit der Handlungen des einzelnen Menschen S. 113 aufgestellten Grundsatz ein Widerspruch zu sein scheint, so muss man nicht vergessen, dass dort von solchen Handlungen die Rede war, deren Folgen an sich fremde Rechte kränken können, hier hingegen von solchen, aus welchen, um diese Wirkung hervorzubringen, erst eine zweite Handlung entstehen muss. Verheimlichung der Schwangerschaft also, um dies an einem Beispiel deutlich zu machen, dürfte nicht aus dem Grunde verboten werden, den Kindermord zu verhüten (man müsste denn dieselbe schon als ein Zeichen des Vorsatzes zu demselben ansehen), wohl aber als eine Handlung, welche an sich, und ohnedies, dem Leben und der Gesundheit des Kindes gefährlich sein kann.
[162]
XIV.
Sorgfalt des Staats für die Sicherheit durch Bestimmung des Verhältnisses derjenigen Personen, welche nicht im Besitz der natürlichen, oder gehörig gereiften menschlichen Kräfte sind. (Unmündige und des Verstandes Beraubte.) Allgemeine Anmerkung zu diesem und den vier vorhergehenden Abschnitten. ↩
Unterschied der hier genannten Personen und der übrigen Bürger. — Nothwendigkeit einer Sorgfalt für ihr positives Wohl. — Unmündige. — Gegenseitige Pflichten der Eltern und Kinder. — Pflichten des Staats. — Bestimmung des Alters der Mündigkeit. — Aufsicht auf die Erfüllung jener Pflichten. — Vormundschaft, nach dem Tode der Eltern. — Pflichten des Staats in Rücksicht auf dieselbe. — Vortheile, die speciellere Ausübung dieser Pflichten, wo möglich, den Gemeinheiten zu übertragen. — Veranstaltungen, die Unmündigen gegen Eingriffe in ihre Rechte zu schützen. — Des Verstandes Beraubte. — Unterschiede zwischen ihnen und den Unmündigen. — Höchste, aus diesem Abschnitt gezogene Grundsätze. — Gesichtspunkt bei diesem und den vier vorhergehenden Abschnitten. — Bestimmung des Verhältnisses der gegenwärtigen Arbeit zur Theorie der Gesetzgebung überhaupt. — Aufzählung der Hauptgesichtspunkte, aus welchen alle Gesetze fliessen müssen. — Hieraus entspringende, zu jeder Gesetzgebung nothwendige Vorarbeiten.
Alle Grundsätze, die ich bis hieher aufzustellen versucht habe, setzen Menschen voraus, die im völligen Gebrauch ihrer gereiften Verstandeskräfte sind. Denn alle gründen sich allein darauf, dass dem selbstdenkenden und selbstthätigen Menschen nie die Fähigkeit geraubt werden darf, sich, nach gehöriger Prüfung aller Momente der Ueberlegung, willkührlich zu bestimmen. Sie können daher auf solche Personen keine Anwendung finden, welche entweder, wie Verrückte, oder gänzlich Blödsinnige, ihrer Vernunft so gut, als gänzlich beraubt sind; oder bei welchen dieselbe noch nicht einmal diejenige Reife erlangt hat, welche von der Reife des Körpers selbst abhängt. Denn so unbestimmt, und, genau gesprochen, unrichtig auch dieser letztere Maassstab sein mag; so ist er doch der einzige, welcher allgemein und bei der Beurtheilung des Dritten gültig sein kann. Alle diese Personen nun bedürfen einer im eigentlichsten Verstande positiven Sorgfalt für ihr physisches und [163] moralisches Wohl, und die blos negative Erhaltung der Sicherheit kann bei denselben nicht hinreichen. Allein diese Sorgfalt ist — um bei den Kindern, als der grössesten und wichtigsten Klasse dieser Personen anzufangen — schon vermöge der Grundsätze des Rechts ein Eigenthum bestimmter Personen, der Eltern. Ihre Pflicht ist es, die Kinder, welche sie erzeugt haben, bis zur vollkommenen Reife zu erziehen, und aus dieser Pflicht allein entspringen alle Rechte derselben, als nothwendige Bedingungen der Ausübung von jener. Die Kinder behalten daher alle ihre ursprünglichen Rechte, auf ihr Leben, ihre Gesundheit, ihr Vermögen, wenn sie schon dergleichen besitzen, und selbst ihre Freiheit darf nicht weiter beschränkt werden, als die Eltern dies theils zu ihrer eignen Bildung, theils zur Erhaltung des nun neu entstehenden Familienverhältnisses für nothwendig erachten, und als sich diese Einschränkung nur auf die Zeit bezieht, welche zu ihrer Ausbildung erfordert wird. Zwang zu Handlungen, welche über diese Zeit hinaus, und vielleicht aufs ganze Leben hin ihre unmittelbaren Folgen erstrecken, dürfen sich daher Kinder niemals gefallen lassen. Daher niemals z. B. Zwang zu Heirathen, oder zu Erwählung einer bestimmten Lebensart. Mit der Zeit der Reife muss die elterliche Gewalt natürlich ganz und gar aufhören. Allgemein bestehen daher die Pflichten der Eltern darin die Kinder, theils durch persönliche Sorgfalt für ihr physisches und moralisches Wohl, theils durch Versorgung mit den nothwendigen Mitteln in den Stand zu setzen, eine eigne Lebensweise, nach ihrer, jedoch durch ihre individuelle Lage beschränkten Wahl anzufangen; und die Pflichten der Kinder dagegen darin, alles dasjenige zu thun, was nothwendig ist, damit die Eltern jener Pflicht ein Genüge zu leisten vermögen. Alles nähere Detail, die Aufzählung dessen, was diese Pflichten nun bestimmt in sich enthalten können und müssen, übergehe ich hier gänzlich. Es gehört in eine eigentliche Theorie der Gesetzgebung, und würde auch nicht [164] einmal ganz in dieser Platz finden können, da es grossentheils von individuellen Umständen specieller Lagen abhängt.
Dem Staat liegt es nun ob, für die Sicherheit der Rechte der Kinder gegen die Eltern Sorge zu tragen, und er muss daher zuerst ein gesetzmässiges Alter der Reife bestimmen. Dies muss nun natürlich nicht nur nach der Verschiedenheit des Klima’s und selbst des Zeitalters verschieden sein, sondern auch individuelle Lagen, je nachdem nämlich mehr oder minder Reife der Beurtheilungskraft in denselben erfordert wird, können mit Recht darauf Einfluss haben. Hiernächst muss er verhindern, dass die väterliche Gewalt nicht über ihre Gränzen hinausschreite, und darf daher dieselbe mit seiner genauesten Aufsicht nicht verlassen. Jedoch muss diese Aufsicht niemals positiv den Eltern eine bestimmte Bildung und Erziehung der Kinder vorschreiben wollen, sondern nur immer negativ dahin gerichtet sein, Eltern und Kinder gegenseitig in den, ihnen vom Gesetz bestimmten Schranken zu erhalten. Daher scheint es auch weder gerecht, noch rathsam, fortdauernde Rechenschaft von den Eltern zu fordern; man muss ihnen zutrauen, dass sie eine Pflicht nicht verabsäumen werden, welche ihrem Herzen so nah liegt; und erst solche Fälle, wo entweder schon wirkliche Verletzungen dieser Pflicht geschehen, oder sehr nah bevorstehen, können den Staat, sich in diese Familienverhältnisse zu mischen berechtigen.
Nach dem Tode der Eltern bestimmen die Grundsätze des natürlichen Rechts minder klar, an wen die Sorgfalt der noch übrigen Erziehung fallen soll. Der Staat muss daher genau festsetzen, wer von den Verwandten die Vormundschaft übernehmen, oder, wenn von diesen keiner dazu im Stande ist, wie einer der übrigen Bürger dazu gewählt werden soll. Ebenso muss er die nothwendigen Eigenschaften der Fähigkeit der Vormünder bestimmen. Da die Vormünder die Pflichten der Eltern übernehmen; so treten sie auch in alle Rechte derselben; [165] da sie aber auf jeden Fall in einem minder engen Verhältniss zu ihren Pflegbefohlenen stehen, so können sie nicht auf ein gleiches Vertrauen Anspruch machen, und der Staat muss daher seine Aufsicht auf sie verdoppeln. Bei ihnen dürfte daher auch ununterbrochene Rechenschaftsablegung eintreten müssen. Je weniger positiven Einfluss der Staat auch nur mittelbar ausübt, desto mehr bleibt er den, im Vorigen entwickelten Grundsätzen getreu. Er muss daher die Wahl eines Vormunds durch die sterbenden Eltern selbst, oder durch die zurückbleibenden Verwandten, oder durch die Gemeine, zu welcher die Pflegbefohlnen gehören, soviel erleichtern, als nur immer die Sorgfalt für die Sicherheit dieser erlaubt. Ueberhaupt scheint es rathsam, alle eigentlich specielle hier eintretende Aufsicht den Gemeinheiten zu übertragen; ihre Maassregeln werden immer nicht nur der individuellen Lage der Pflegbefohlnen angemessener, sondern auch mannigfaltiger, minder einförmig sein, und für die Sicherheit der Pflegbefohlnen ist dennoch hinlänglich gesorgt, sobald die Oberaufsicht in den Händen des Staats selbst bleibt.
Ausser diesen Einrichtungen muss der Staat sich nicht blos begnügen, Unmündige, gleich andren Bürgern, gegen fremde Angriffe zu beschützen, sondern er muss hierin auch noch weiter gehen. Es war nämlich oben festgesetzt worden, dass jeder über seine eignen Handlungen und sein Vermögen nach Gefallen freiwillig beschliessen kann. Eine solche Freiheit könnte Personen, deren Beurtheilungskraft noch nicht das gehörige Alter gereift hat, in mehr als Einer Hinsicht gefährlich werden. Diese Gefahren nun abzuwenden ist zwar das Geschäft der Eltern, oder Vormünder, welche das Recht haben, die Handlungen derselben zu leiten. Allein der Staat muss ihnen, und den Unmündigen selbst hierin zu Hülfe kommen, und diejenigen ihrer Handlungen für ungültig erklären, deren Folgen ihnen [166] schädlich sein würden. Er muss dadurch verhindern, dass nicht eigennützige Absichten andrer sie täuschen, oder ihren Entschluss überraschen. Wo dies geschieht, muss er nicht nur zu Ersetzung des Schadens anhalten, sondern auch die Thäter bestrafen; und so können aus diesem Gesichtspunkt Handlungen strafbar werden, welche sonst ausserhalb des Wirkungskreises des Gesetzes liegen würden. Ich führe hier als ein Beispiel den unehelichen Beischlaf an, den, diesen Grundsätzen zufolge, der Staat an dem Thäter bestrafen müsste, wenn er mit einer unmündigen Person begangen würde. Da aber die menschlichen Handlungen einen sehr mannigfaltig verschiednen Grad der Beurtheilungskraft erfordern, und die Reife der letztern gleichsam nach und nach zunimmt; so ist es gut, zum Behuf der Gültigkeit dieser verschiedenen Handlungen gleichfalls verschiedene Epochen und Stufen der Unmündigkeit zu bestimmen.
Was hier von Unmündigen gesagt worden ist, findet auch auf Verrückte und Blödsinnige Anwendung. Der Unterschied besteht nur darin, dass sie nicht einer Erziehung und Bildung (man müsste denn die Bemühungen, sie zu heilen, mit diesem Namen belegen), sondern nur der Sorgfalt und Aufsicht bedürfen; dass bei ihnen noch vorzüglich der Schaden verhütet werden muss, den sie andren zufügen könnten; und dass sie gewöhnlich in einem Zustande sind, in welchem sie weder ihrer persönlichen Kräfte, noch ihres Vermögens geniessen können, wobei jedoch nicht vergessen werden muss, dass, da eine Rückkehr der Vernunft bei ihnen immer noch möglich ist, ihnen nur die temporelle Ausübung ihrer Rechte, nicht aber diese Rechte selbst genommen werden können. Dies noch weiter auszuführen, erlaubt meine gegenwärtige Absicht nicht, und ich kann daher diese ganze Materie mit folgenden allgemeinen Grundsätzen beschliessen.
1. Diejenigen Personen, welche entweder überhaupt nicht den Gebrauch ihrer Verstandeskräfte besitzen, oder [167] das dazu nothwendige Alter noch nicht erreicht haben, bedürfen einer besondren Sorgfalt für ihr physisches, intellektuelles und moralisches Wohl. Personen dieser Art sind Unmündige und des Verstandes Beraubte. Zuerst von jenen, dann von diesen.
2. In Absicht der Unmündigen muss der Staat die Dauer der Unmündigkeit festsetzen. Er muss dieselbe, da sie ohne sehr wesentlichen Nachtheil weder zu kurz, noch zu lang sein darf, nach den individuellen Umständen der Lage der Nation bestimmen, wobei ihm die vollendete Ausbildung des Körpers zum ohngefähren Kennzeichen dienen kann. Rathsam ist es, mehrere Epochen anzuordnen, und gradweise die Freiheit der Unmündigen zu erweitern, und die Aufsicht auf sie verringern.
3. Der Staat muss darauf wachen, dass die Eltern ihre Pflichten gegen ihre Kinder — nämlich dieselben, so gut es ihre Lage erlaubt, in den Stand zu setzen, nach erreichter Mündigkeit, eine eigne Lebensweise zu wählen und anzufangen — und die Kinder ihre Pflichten gegen ihre Eltern, — nämlich alles dasjenige zu thun, was zur Ausübung jener Pflicht von Seiten der Eltern nothwendig ist — genau erfüllen; keiner aber die Rechte überschreite, welche ihm die Erfüllung jener Pflichten einräumt. Seine Aufsicht muss jedoch allein hierauf beschränkt sein; und jedes Bemühen, hiebei einen positiven Endzweck zu erreichen, z. B. diese oder jene Art der Ausbildung der Kräfte bei den Kindern zu begünstigen, liegt ausserhalb der Schranken seiner Wirksamkeit.
4. Im Fall des Todes der Eltern sind Vormünder nothwendig. Der Staat muss daher die Art bestimmen, wie diese bestellt werden sollen, so wie die Eigenschaften, welche sie nothwendig besitzen müssen. Er wird aber gut thun, soviel als möglich die Wahl derselben durch die Eltern [168] selbst, vor ihrem Tode, oder die übrigbleibenden Verwandten, oder die Gemeine zu befördern. Das Betragen der Vormünder erfordert eine noch genauere und doppelt wachsame Aufsicht.
5. Um die Sicherheit der Unmündigen zu befördern, und zu verhindern, dass man sich nicht ihrer Unerfahrenheit oder Unbesonnenheit zu ihrem Nachtheil bediene, muss der Staat diejenigen ihrer, allein für sich vorgenommenen Handlungen, deren Folgen ihnen schädlich werden könnten, für ungültig erklären, und diejenigen, welche sie zu ihrem Vortheil auf diese Weise benutzen, bestrafen.
6. Alles was hier von Unmündigen gesagt worden, gilt auch von solchen, die ihres Verstandes beraubt sind; nur mit den Unterschieden, welche die Natur der Sache selbst zeigt. Auch darf niemand eher als ein solcher angesehen werden, ehe er nicht, nach einer, unter Aufsicht des Richters, durch Aerzte vorgenommenen Prüfung, förmlich dafür erklärt ist; und das Uebel selbst muss immer, als möglicherweise wieder vorübergehend, betrachtet werden.
Ich bin jetzt alle Gegenstände durchgegangen, auf welche der Staat seine Geschäftigkeit ausdehnen muss; ich habe bei jedem die höchsten Principien aufzustellen versucht. Findet man diesen Versuch zu mangelhaft, sucht man viele, in der Gesetzgebung wichtige Materien vergebens in demselben; so darf man nicht vergessen, dass es nicht meine Absicht war, eine Theorie der Gesetzgebung aufzustellen — ein Werk, dem weder meine Kräfte, noch meine Kenntnisse gewachsen sind — sondern allein den Gesichtspunkt herauszuheben, inwiefern die Gesetzgebung in ihren verschiedenen Zweigen die Wirksamkeit des Staats ausdehnen dürfe, oder einschränken müsse? Denn wie sich die Gesetzgebung nach ihren Gegenständen abtheilen lässt, eben so kann dieselbe auch nach ihren Quellen eingetheilt werden, und vielleicht ist diese Eintheilung, vorzüglich für den [169] Gesetzgeber selbst, noch fruchtbarer. Dergleichen Quellen, oder — um mich zugleich eigentlicher und richtiger auszudrücken — Hauptgesichtspunkte, aus welchen sich die Nothwendigkeit von Gesetzen zeigt, giebt es, wie mich dünkt, nur drei. Die Gesetzgebung im Allgemeinen soll die Handlungen der Bürger, und ihre nothwendigen Folgen bestimmen. Der erste Gesichtspunkt ist daher die Natur dieser Handlungen selbst, und diejenigen ihrer Folgen, welche allein aus den Grundsätzen des Rechts entspringen. Der zweite Gesichtspunkt ist der besondre Zweck des Staats, die Gränzen, in welchen er seine Wirksamkeit zu beschränken, oder der Umfang, auf welchen er dieselbe auszudehnen beschliesst. Der dritte Gesichtspunkt endlich entspringt aus den Mitteln, welcher er nothwendig bedarf, um das ganze Staatsgebäude selbst zu erhalten, um es nur möglich zu machen, seinen Zweck überhaupt zu erreichen. Jedes nur denkbare Gesetz muss einem dieser Gesichtspunkte vorzüglich eigen sein; allein keines dürfte, ohne die Vereinigung aller, gegeben werden, und gerade diese Einseitigkeit der Ansicht macht einen sehr wesentlichen Fehler mancher Gesetze aus. Aus jener dreifachen Ansicht entspringen nun auch drei vorzüglich nothwendige Vorarbeiten zu jeder Gesetzgebung: 1. eine vollständige allgemeine Theorie des Rechts. 2. Eine vollständige Entwicklung des Zwecks, den der Staat sich vorsetzen sollte, oder, welches im Grunde dasselbe ist, eine genaue Bestimmung der Grenzen, in welchen er seine Wirksamkeit halten muss; oder eine Darstellung des besondern Zwecks, welchen diese oder jene Staatsgesellschaft sich wirklich vorsetzt. 3. Eine Theorie der, zur Existenz eines Staats nothwendigen Mittel, und da diese Mittel theils Mittel der innern Festigkeit, theils Mittel der Möglichkeit der Wirksamkeit sind, eine Theorie der Politik und der Finanzwissenschaften; oder wiederum eine Darstellung des einmal gewählten politischen und Finanzsystems. Bei dieser Uebersicht, [170] welche mannigfaltige Unterabtheilungen zulässt, bemerke ich nur noch, dass blos das erste der genannten Stücke ewig und, wie die Natur des Menschen im Ganzen selbst, unveränderlich ist; die andern aber mannigfaltige Modifikationen erlauben. Werden indess diese Modifikationen nicht nach völlig allgemeinen, von allen zugleich hergenommenen Rücksichten, sondern nach andren zufälligeren Umständen gemacht, ist z. B. in einem Staat ein festes politisches System, sind unabänderliche Finanzeinrichtungen; so geräth das zweite der genannten Stücke in ein sehr grosses Gedränge, und sehr oft leidet sogar hierdurch das erste. Den Grund sehr vieler Staatsgebrechen würde man gewiss in diesen und ähnlichen Kollisionen finden.
So, hoffe ich, wird die Absicht hinlänglich bestimmt sein, welche ich mir bei der versuchten Aufstellung der obigen Principien der Gesetzgebung vorsetzte. Allein, auch unter diesen Einschränkungen, bin ich sehr weit entfernt, mir irgend mit dem Gelingen dieser Absicht zu schmeicheln. Vielleicht leidet die Richtigkeit der aufgestellten Grundsätze im Ganzen weniger Einwürfe, aber an der nothwendigen Vollständigkeit, an der genauen Bestimmung mangelt es ihnen gewiss. Auch um die höchsten Principien festzusetzen, und gerade vorzüglich zu diesem Zweck, ist es nothwendig in das genaueste Detail einzugehen. Dies aber war mir hier, meiner Absicht nach, nicht erlaubt, und wenn ich gleich nach allen meinen Kräften strebte, es in mir, gleichsam als Vorarbeit zu dem Wenigen zu thun, das ich hinschrieb; so gelingt doch ein solches Bemühen niemals in gleichem Grade. Ich bescheide mich daher gern, mehr die Fächer, die noch ausgefüllt werden müssten, gezeigt, als das Ganze selbst hinlänglich entwickelt zu haben. Indess wird doch, hoffe ich, das Gesagte immer hinreichend sein, meine eigentliche Absicht bei diesem ganzen Aufsatz noch deutlicher gemacht zu haben, die Absicht nämlich, dass der wichtigste Gesichtspunkt des Staats immer die Entwickelung der Kräfte [171] der einzelnen Bürger in ihrer Individualität sein muss, dass er daher nie etwas andres zu einem Gegenstand seiner Wirksamkeit machen darf, als das, was sie allein nicht selbst sich zu verschaffen vermögen, die Beförderung der Sicherheit, und dass dies das einzige wahre und untrügliche Mittel ist, scheinbar widersprechende Dinge, den Zweck des Staats im Ganzen, und die Summe aller Zwecke der einzelnen Bürger durch ein festes und dauerndes Band freundlich mit einander zu verknüpfen.
XV.
Verhältniss der, zur Erhaltung des Staatsgebäudes überhaupt nothwendigen Mittel zur vorgetragenen Theorie. Schluss der theorethischen Entwicklung.↩
Finanzeinrichtungen. — Innere politische Verfassung. — Betrachtung der vorgetragenen Theorie aus dem Gesichtspunkt des Rechts. — Hauptgesichtspunkt bei dieser ganzen Theorie. — Inwiefern Geschichte und Statistik derselben zu Hülfe kommen könnten? — Trennung des Verhältnisses der Bürger zum Staat, und der Verhältnisse derselben unter einander. Nothwendigkeit dieser Trennung.
Da ich jetzt vollendet habe, was mir, bei der Uebersicht meines ganzen Plans im Vorigen (S. S. 100 — 105) nur allein noch übrig zu bleiben schien; so habe ich nunmehr die vorliegende Frage in aller der Vollständigkeit und Genauigkeit beantwortet, welche mir meine Kräfte erlaubten. Ich könnte daher hier schliessen, wenn ich nicht noch eines Gegenstandes erwähnen müsste, welcher auf das bisher Vorgetragene einen sehr wichtigen Einfluss haben kann, nämlich der Mittel, welche nicht nur die Wirksamkeit des Staats selbst möglich machen, sondern ihm sogar seine Existenz sichern müssen.
Auch um den eingeschränktesten Zweck zu erfüllen, muss der Staat hinlängliche Einkünfte haben. Schon meine Unwissenheit in allem, was Finanzen heisst, verbietet mir hier ein langes Raisonnement. Auch ist dasselbe, dem von mir gewählten Plan nach, nicht nothwendig. Denn ich habe gleich anfangs [172] bemerkt, dass ich hier nicht von dem Falle rede, wo der Zweck des Staats nach der Quantität der Mittel der Wirksamkeit, welche derselbe in Händen hat, sondern wo diese nach jenem bestimmt wird. (S. S. 16—18.) Nur des Zusammenhangs willen muss ich bemerken, dass auch bei Finanzeinrichtungen jene Rücksicht des Zwecks der Menschen im Staate, und der daher entspringenden Beschränkung seines Zwecks nicht aus den Augen gelassen werden darf. Auch der flüchtigste Blick auf die Verwebung so vieler Polizei- und Finanzeinrichtungen lehrt dies hinlänglich. Meines Erachtens giebt es für den Staat nur dreierlei Arten der Einkünfte: 1. die Einkünfte aus vorbehaltenem, oder an sich gebrachtem Eigenthum; 2. aus direkten, und 3. aus indirekten Abgaben. Alles Eigenthum des Staats führt Nachtheile mit sich. Schon oben (S. S. 39 — 40.) habe ich von dem Uebergewichte geredet, welches der Staat, als Staat, allemal hat; und ist er Eigenthümer, so muss er in viele Privatverhältnisse nothwendig eingehen. Da also, wo das Bedürfniss, um welches allein man eine Staatseinrichtung wünscht, gar keinen Einfluss hat, wirkt die Macht mit, welche nur in Hinsicht dieses Bedürfnisses eingeräumt wurde. Gleichfalls mit Nachtheilen verknüpft sind die indirekten Abgaben. Die Erfahrung lehrt, wie vielfache Einrichtungen ihre Anordnung und ihre Hebung voraussetzt, welche das vorige Raisonnement unstreitig nicht billigen kann. Es bleiben also nur die direkten übrig. Unter den möglichen Systemen direkter Abgaben ist das physiokratische unstreitig das einfachste. Allein — ein Einwurf, der auch schon öfter gemacht worden ist — eines der natürlichsten Produkte ist in demselben aufzuzählen vergessen worden, die Kraft des Menschen, welche, da sie in ihren Wirkungen, ihren Arbeiten, bei unsren Einrichtungen mit zur Waare wird, gleichfalls der Abgabe unterworfen sein muss. Wenn man das System direkter Abgaben, auf welches ich hier zurückkomme, nicht mit Unrecht das schlechteste, und [173] unschicklichste aller Finanzsysteme nennt; so muss man indess auch nicht vergessen, dass der Staat, welchem so enge Gränzen der Wirksamkeit gesetzt sind, keiner grossen Einkünfte bedarf, und dass der Staat, der so gar kein eignes, von dem der Bürger getheiltes Interesse hat, der Hülfe einer freien d. i. nach der Erfahrung aller Zeitalter, wohlhabenden Nation gewisser versichert sein kann.
So wie die Einrichtung der Finanzen der Befolgung der im Vorigen aufgestellten Grundsätze Hindernisse in den Weg legen kann; ebenso, und vielleicht noch mehr, ist dies der Fall bei der inneren politischen Verfassung. Es muss nämlich ein Mittel vorhanden sein, welches den beherrschenden und den beherrschten Theil der Nation mit einander verbindet, welches dem ersteren den Besitz der ihm anvertrauten Macht und dem letzteren den Genuss der ihm übriggelassenen Freiheit sichert. Diesen Zweck hat man in verschiedenen Staaten auf verschiedene Weise zu erreichen versucht; bald durch Verstärkung der gleichsam physischen Gewalt der Regierung — welches indess freilich für die Freiheit gefährlich ist — bald durch die Gegeneinanderstellung mehrerer einander entgegengesetzter Mächte, bald durch Verbreitung eines, der Konstitution günstigen, Geistes unter der Nation. Dies letztere Mittel, wie schöne Gestalten es auch, vorzüglich im Alterthum, hervorgebracht hat, wird der Ausbildung der Bürger in ihrer Individualitätleicht nachtheilig, bringt nicht selten Einseitigkeit hervor, und ist daher am wenigsten in dem hier aufgestellten Systeme rathsam. Vielmehr müsste, diesem zufolge, eine politische Verfassung gewählt werden, welche so wenig, als möglich, einen positiven speciellen Einfluss auf den Charakter der Bürger hätte, und nichts andres, als die höchste Achtung des fremden Rechts, verbunden mit der enthusiastischsten Liebe der eigenen Freiheit, in ihnen hervorbrächte. Welche der denkbaren Verfassungen dies nun sein möchte? versuche ich hier nicht zu prüfen. Diese Prüfung gehört [174] offenbar allein in eine Theorie der eigentlichen Politik. Ich begnüge mich nur an folgenden kurzen Bemerkungen, welche wenigstens die Möglichkeit einer solchen Verfassung deutlicher zeigen. Das System, das ich vorgetragen habe, verstärkt und vervielfacht das Privatinteresse der Bürger, und es scheint daher, dass eben dadurch das öffentliche geschwächt werde. Allein es verbindet auch dieses so genau mit jenem, dass dasselbe vielmehr nur auf jenes, und zwar, wie es jeder Bürger — da doch jeder sicher und frei sein will — anerkennt, gegründet ist. So dürfte also doch, gerade bei diesem System, die Liebe der Konstitution am besten erhalten werden, die man sonst oft durch sehr künstliche Mittel vergebens hervorzubringen strebt. Dann trifft auch hier ein, dass der Staat, der weniger wirken soll, auch eine geringere Macht, und die geringere Macht eine geringere Wehr braucht. Endlich versteht sich noch von selbst, dass, so wie überhaupt manchmal Kraft oder Genuss den Resultaten aufgeopfert werden müssen, um beide vor einem grösseren Verlust zu bewahren, eben dies auch hier immer angewendet werden müsste.
So hätte ich denn jetzt die vorgelegte Frage, nach dem Maasse meiner gegenwärtigen Kräfte, vollständig beantwortet, die Wirksamkeit des Staats von allen Seiten her mit den Gränzen umschlossen, welche mir zugleich erspriesslich und nothwendig schienen. Ich habe indess dabei nur den Gesichtspunkt des Besten gewählt; der des Rechts könnte noch neben demselben nicht uninteressant scheinen. Allein wo eine Staatsgesellschaft wirklich einen gewissen Zweck, sichere Gränzen der Wirksamkeit freiwillig bestimmt hat; da sind natürlich dieser Zweck und diese Gränzen — sobald sie nur von der Art sind, dass ihre Bestimmung in der Macht der Bestimmenden lag — rechtmässig. Wo eine solche ausdrückliche Bestimmung nicht geschehen ist, da muss der Staat natürlich seine Wirksamkeit auf diejenigen Gränzen zurückzubringen suchen, welche die reine Theorie vorschreibt, aber sich auch von den Hindernissen [175] leiten lassen, deren Uebersehung nur einen grösseren Nachtheil zur Folge haben würde. Die Nation kann also mit Recht die Befolgung jener Theorie immer so weit, aber nie weiter erfordern, als diese Hindernisse dieselbe nicht unmöglich machen. Diese Hindernisse nun habe ich im Vorigen nicht erwähnt; ich habe mich bis hieher begnügt, die reine Theorie zu entwickeln. Ueberhaupt habe ich versucht, die vortheilhafteste Lage für den Menschen im Staat aufzusuchen. Diese schien mir nun darin zu bestehen, dass die mannigfaltigste Individualität, die originellste Selbstständigkeit mit der gleichfalls mannigfaltigsten und innigsten Vereinigung mehrerer Menschen neben einander aufgestellt würde — ein Problem, welches nur die höchste Freiheit zu lösen vermag. Die Möglichkeit einer Staatseinrichtung, welche diesem Endzweck so wenig, als möglich, Schranken setzte, darzuthun, war eigentlich die Absicht dieser Bogen, und ist schon seit längerer Zeit der Gegenstand alles meines Nachdenkens gewesen. Ich bin zufrieden, wenn ich bewiesen habe, dass dieser Grundsatz wenigstens bei allen Staatseinrichtungen dem Gesetzgeber, als Ideal, vorschreiben sollte.
Eine grosse Erläuterung könnten diese Ideen durch die Geschichte und Statistik — beide auf diesen Endzweck gerichtet — erhalten. Ueberhaupt hat mir oft die Statistik einer Reform zu bedürfen geschienen. Statt blosse Data der Grösse, der Zahl der Einwohner, des Reichthums, der Industrie eines Staats, aus welchen sein eigentlicher Zustand nie ganz und mit Sicherheit zu beurtheilen ist, an die Hand zu geben; sollte sie, von der natürlichen Beschaffenheit des Landes und seiner Bewohner ausgehend, das Maas und die Art ihrer thätigen, leidenden, und geniessenden Kräfte, und nun schrittweise die Modifikationen zu schildern suchen, welche diese Kräfte theils durch die Verbindung der Nation unter sich, theils durch die Einrichtung des Staats erhalten. Denn die Staatsverfassung und [176] der Nationalverein sollten, wie eng sie auch in einander verwebt sein mögen, nie mit einander verwechselt werden. Wenn die Staatsverfassung den Bürgern, seis durch Uebermacht und Gewalt, oder Gewohnheit und Gesetz, ein bestimmtes Verhältniss anweist; so giebt es ausserdem noch ein andres, freiwillig von ihnen gewähltes, unendlich mannigfaltiges, und oft wechselndes. Und dies letztere, das freie Wirken der Nation unter einander, ist es eigentlich, welches alle Güter bewahrt, deren Sehnsucht die Menschen in eine Gesellschaft führt. Die eigentliche Staatsverfassung ist diesem, als ihrem Zwecke, untergeordnet, und wird immer nur, als ein nothwendiges Mittel, und, da sie allemal mit Einschränkungen der Freiheit verbunden ist, als ein nothwendiges Uebel gewählt. Die nachtheiligen Folgen zu zeigen, welche die Verwechslung der freien Wirksamkeit der Nation mit der erzwungenen der Staatsverfassung dem Genuss, den Kräften, und dem Charakter der Menschen bringt, ist daher auch eine Nebenabsicht dieser Blätter gewesen.
[177]
XVI.
Anwendung der vorgetragenen Theorie auf die Wirklichkeit. ↩
Verhältniss theoretischer Wahrheiten überhaupt zur Ausführung. — Dabei nothwendige Vorsicht. — Bei jeder Reform muss der neue Zustand mit dem vorhergehenden verknüpft werden. — Dies gelingt am besten, wenn man die Reform bei den Ideen der Menschen anfängt. — Daraus herfliessende Grundsätze aller Reformen. — Anwendung derselben auf die gegenwärtige Untersuchung. — Vorzüglichste Eigenthümlichkeiten des aufgestellten Systems. Zu besorgende Gefahren bei der Ausführung desselben. — Hieraus entspringende nothwendige successive Schritte bei derselben. — Höchster dabei zu befolgender Grundsatz. — Verbindung dieses Grundsatzes mit den Hauptgrundsätzen der vorgetragenen Theorie. — Aus dieser Verbindung fliessendes Princip der Nothwendigkeit. — Vorzüge dessselben. — Schluss.
Jede Entwicklung von Wahrheiten, welche sich auf den Menschen, und insbesondre auf den handlenden Menschen beziehen, führt auf den Wunsch, dasjenige, was die Theorie als richtig bewährt, auch in der Wirklichkeit ausgeführt zu sehen. Dieser Wunsch ist der Natur des Menschen, dem so selten der still wohlthätige Seegen blosser Ideen genügt, angemessen und seine Lebhaftigkeit wächst mit der wohlwollenden Theilnahme an dem Glück der Gesellschaft. Allein wie natürlich derselbe auch an sich, und wie edel in seinen Quellen er sein mag, so hat er doch nicht selten schädliche Folgen hervorgebracht, und oft sogar schädlichere, als die kältere Gleichgültigkeit oder — da auch gerade aus dem Gegentheil dieselbe Wirkung entstehen kann — die glühende Wärme, welche, minder bekümmert um die Wirklichkeit, sich nur an der reinen Schönheit der Ideen ergötzt. Denn das Wahre, sobald es — wäre es auch nur in Einem Menschen — tief eindringende Wurzeln fasst, verbreitet immer, nur langsamer und geräuschloser, heilsame Folgen auf das wirkliche Leben; da hingegen das, was unmittelbar auf dasselbe übergetragen wird, nicht selten, bei der Uebertragung selbst, seine Gestalt verändert, und nicht einmal auf die Ideen zurückwirkt. Daher giebt es auch Ideen, [178] welche der Weise nie nur auszuführen versuchen würde. Ja für die schönste, gereifteste Frucht des Geistes ist die Wirklichkeit nie, in keinem Zeitalter, reif genug; das Ideal muss der Seele des Bildners jeder Art nur immer, als unerreichbares Muster vorschweben. Diese Gründe empfehlen demnach auch bei der am mindesten bezweifelten, konsequentesten Theorie mehr als gewöhnliche Vorsicht in der Anwendung derselben; und um so mehr bewegen sie mich noch, ehe ich diese ganze Arbeit beschliesse, so vollständig, aber zugleich so kurz, als mir meine Kräfte erlauben, zu prüfen, inwiefern die im Vorigen theoretisch entwickelten Grundsätze in die Wirklichkeit übergetragen werden könnten. Diese Prüfung wird zugleich dazu dienen, mich vor der Beschuldigung zu bewahren, als wollte ich durch das Vorige unmittelbar der Wirklichkeit Regeln vorschreiben, oder auch nur dasjenige missbilligen, was demselben etwa in ihr widerspricht — eine Anmassung, von der ich sogar dann entfernt sein würde, wenn ich auch alles, was ich vorgetragen habe, als völlig richtig und gänzlich zweifellos anerkennte.
Bei jeglicher Umformung der Gegenwart muss auf den bisherigen Zustand ein neuer folgen. Nun aber bringt jede Lage, in welcher sich die Menschen befinden, jeder Gegenstand, der sie umgiebt, eine bestimmte, feste Form in ihrem Innern hervor. Diese Form vermag nicht in jede selbstgewählte überzugehen, und man verfehlt zugleich seines Endzwecks und tödtet die Kraft, wenn man ihr eine unpassende aufdringt. Wenn man die wichtigsten Revolutionen der Geschichte übersieht, so entdeckt man, ohne Mühe, dass die meisten derselben aus den periodischen Revolutionen des menschlichen Geistes entstanden sind. Noch mehr wird man in dieser Ansicht bestätigt, wenn man die Kräfte überschlägt, welche eigentlich alle Veränderungen auf dem Erdkreis bewirken, und unter diesen die menschlichen — da die der physischen Natur wegen ihres [179] gleichmässigen, ewig einförmig wiederkehrenden Ganges in dieser Rücksicht weniger wichtig, und die der vernunftlosen Geschöpfe in eben derselben an sich unbedeutend sind — in dem Besitze des Hauptantheils erblickt. Die menschliche Kraft vermag sich in Einer Periode nur auf Eine Weise zu äussern, aber diese Weise unendlich mannigfaltig zu modificiren; sie zeigt daher in jedem Moment eine Einseitigkeit, die aber in einer Folge von Perioden das Bild einer wunderbaren Vielseitigkeit gewährt. Jeder vorhergehende Zustand derselben ist entweder die volle Ursach des folgenden, oder doch wenigstens die beschränkende, dass die äussern, andringenden Umstände nur gerade diesen hervorbringen können. Eben dieser vorhergehende Zustand und die Modifikation, welche er erhält, bestimmt daher auch, wie die neue Lage der Umstände auf den Menschen wirken soll, und die Macht dieser Bestimmung ist so gross, dass diese Umstände selbst oft eine ganz andre Gestalt dadurch erhalten. Daher rührt es, dass alles, was auf der Erde geschieht, gut und heilsam genannt werden kann, weil die innere Kraft des Menschen es ist, welche sich alles, wie seine Natur auch sein möge, bemeistert, und diese innere Kraft in keiner ihrer Aeusserungen, da doch jede ihr von irgend einer Seite mehr Stärke oder mehr Bildung verschafft, je anders als — nur in verschiedenen Graden — wohlthätig wirken kann. Daher ferner, dass sich vielleicht die ganze Geschichte des menschlichen Geschlechts bloss als eine natürliche Folge der Revolutionen der menschlichen Kraft darstellen liesse; welches nicht nur überhaupt vielleicht die lehrreichste Bearbeitung der Geschichte sein dürfte, sondern auch jeden, auf Menschen zu wirken Bemühten belehren würde, welchen Weg er die menschliche Kraft mit Fortgang zn führen versuchen, und welchen er niemals derselben zumuthen müsste? Wie daher diese innere Kraft des Menschen durch ihre Achtung erregende Würde die vorzüglichste Rücksicht verdient; [180] eben so nöthigt sie auch diese Rücksicht durch die Gewalt ab, mit welcher sie sich alle übrigen Dinge unterwirft.
Wer demnach die schwere Arbeit versuchen will, einen neuen Zustand der Dinge in den bisherigen kunstsoll zu verweben, der wird vor allem sie nie aus den Augen verlieren dürfen. Zuerst muss er daher die volle Wirkung der Gegenwart auf die Gemüther abwarten; wollte er hier zerschneiden, so könnte er zwar vielleicht die äussere Gestalt der Dinge, aber nie die innere Stimmung der Menschen umschaffen, und diese würde wiederum sich in alles Neue übertragen, was man gewaltsam ihr aufgedrungen hätte. Auch glaube man nicht, dass je voller man die Gegenwart wirken lässt, desto abgeneigter der Mensch gegen einen andern folgenden Zustand werde. Gerade in der Geschichte des Menschen sind die Extreme am nächsten mit einander verknüpft; und jeder äussre Zustand, wenn man ihn ungestört fortwirken lässt, arbeitet, statt sich zu befestigen, an seinem Untergange. Dies zeigt nicht nur die Erfahrung aller Zeitalter, sondern es ist auch der Natur des Menschen gemäss, sowohl des thätigen, welcher nie länger bei einem Gegenstand verweilt, als seine Energie Stoff darin findet, und also gerade dann am leichtesten übergeht, wenn er sich am ungestörtesten damit beschäftigt hat, als auch des leidenden, in welchem zwar die Dauer des Drucks die Kraft abstumpft, aber auch den Druck um so härter fühlen lässt. Ohne nun aber die gegenwärtige Gestalt der Dinge anzutasten, ist es möglich, auf den Geist und den Charakter der Menschen zu wirken, möglich diesem eine Richtung zu geben, welche jener Gestalt nicht mehr angemessen ist; und gerade das ist es, was der Weise zu thun versuchen wird. Nur auf diesem Wege ist es möglich, den neuen Plan gerade so in der Wirklichkeit auszuführen, als man ihn sich in der Idee dachte; auf jedem andren wird er, den Schaden noch abgerechnet, den man allemal anrichtet, wenn man den natürlichen [181] Gang der menschlichen Entwicklung stört, durch das, was noch von dem vorhergehenden in der Wirklichkeit, oder in den Köpfen der Menschen übrig ist, modificirt, verändert, entstellt. Ist aber dies Hinderniss aus dem Wege geräumt, kann der nun beschlossene Zustand der Dinge, des vorhergehenden und der, durch denselben bewirkten Lage der Gegenwart ungeachtet, seine volle Wirkung äussern; so darf auch nichts mehr der Ausführung der Reform im Wege stehen. Die allgemeinsten Grundsätze der Theorie aller Reformen dürften daher vielleicht folgende sein:
1. Man trage Grundsätze der reinen Theorie allemal alsdann, aber nie eher in die Wirklichkeit über, als bis diese in ihrem ganzen Umfange dieselben nicht mehr hindert, diejenigen Folgen zu äussern, welche sie, ohne alle fremde Beimischung, immer hervorbringen würden.
2. Um den Uebergang von dem gegenwärtigen Zustande zum neu beschlossenen zu bewirken, lasse man, soviel möglich, jede Reform von den Ideen und den Köpfen der Menschen ausgehen.
Bei den, im Vorigen aufgestellten, blos theoretischen Grundsätzen war ich zwar überall von der Natur des Menschen ausgegangen, auch hatte ich in demselben kein ausserordentliches, sondern nur das gewöhnliche Maas der Kräfte vorausgesetzt; allein immer hatte ich ihn mir doch bloss in der ihm nothwendig eigenthümlichen Gestalt, und noch durch kein bestimmtes Verhältniss auf diese oder jene Weise gebildet, gedacht. Nirgends aber existirt der Mensch so, überall haben ihm schon die Umstände, in welchen er lebt, eine positive, nur mehr oder minder abweichende Form gegeben. Wo also ein Staat die Gränzen seiner Wirksamkeit, nach den Grundsätzen einer richtigen Theorie, auszudehnen oder einzuschränken bemüht ist, da muss er auf diese Form eine vorzügliche Rücksicht nehmen. Das Missverhältniss zwischen der Theorie und der [182] Wirklichkeit in diesem Punkte der Staatsverwaltung wird nun zwar, wie sich leicht voraussehen lässt, überall in einem Mangel an Freiheit bestehen, und so kann es scheinen, als wäre die Befreiung von Fesseln in jeglichem Zeitpunkt möglich, und in jeglichem wohlthätig. Allein wie wahr auch diese Behauptung an sich ist, so darf man nicht vergessen, dass, was als Fessel von der einen Seite die Kraft hemmt, auch von der andern Stoff wird, ihre Thätigkeit zu beschäftigen. Schon in dem Anfange dieses Aufsatzes habe ich bemerkt, dass der Mensch mehr zur Herrschaft, als zur Freiheit geneigt ist, und ein Gebäude der Herrschaft freut nicht blos den Herrscher, der es aufführt und erhält, sondern selbst die dienenden Theile erhebt der Gedanke, Glieder Eines Ganzen zu sein, welches sich über die Kräfte und die Dauer einzelner Generationen hinauserstreckt. Wo daher diese Ansicht noch herrschend ist, da muss die Energie hinschwinden, und Schlaffheit und Unthätigkeit entstehen, wenn man den Menschen zwingen will, nur in sich und für sich, nur in dem Raume, den seine einzelnen Kräfte umspannen, nur für die Dauer, die er durchlebt, zu wirken. Zwar wirkt er allein auf diese Weise auf den unbeschränktesten Raum, für die unvergänglichste Dauer; allein er wirkt auch nicht so unmittelbar, er streut mehr sich selbst entwickelnden Saamen aus, als er Gebäude aufrichtet, welche geradezu Spuren seiner Hand aufweisen, und es ist ein höherer Grad von Kultur nothwendig, sich mehr an der Thätigkeit zu erfreuen, welche nur Kräfte schafft, und ihnen selbst die Erzeugung der Resultate überlässt, als an derjenigen, welche unmittelbar diese selbst aufstellt. Dieser Grad der Kultur ist die wahre Reife der Freiheit. Allein diese Reife findet sich nirgends in ihrer Vollendung, und wird in dieser — meiner Ueberzeugung nach — auch dem sinnlichen, so gern aus sich herausgehenden Menschen ewig fremd bleiben.
Was würde also der Staatsmann zu thun haben, der eine [183] solche Umänderung unternehmen wollte? Einmal in jedem Schritt, den er neu, nicht in Gefolge der einmaligen Lage der Dinge thäte, der reinen Theorie streng folgen, es müsste denn ein Umstand in der Gegenwart liegen, welcher, wenn man sie ihr aufpfropfen wollte, sie verändern, ihre Folgen ganz oder zum Theil vernichten würde. Zweitens alle Freiheitsbeschränkungen, die einmal in der Gegenwart gegründet wären, so lange ruhig bestehen lassen, bis die Menschen durch untrügliche Kennzeichen zu erkennen geben, dass sie dieselben als einengende Fesseln ansehen, dass sie ihren Druck fühlen, und also in diesem Stücke zur Freiheit reif sind; dann aber dieselben ungesäumt entfernen. Endlich die Reife zur Freiheit durch jegliches Mittel befördern. Dies Letztere ist unstreitig das Wichtigste, und zugleich in diesem System das Einfachste. Denn durch nichts wird diese Reife zur Freiheit in gleichem Grade befördert, als durch Freiheit selbst. Diese Behauptung dürften zwar diejenigen nicht anerkennen, welche sich so oft gerade dieses Mangels der Reife, als eines Vorwandes bedient haben, die Unterdrückung fortdauern zu lassen. Allein sie folgt, dünkt mich, unwidersprechlich aus der Natur des Menschen selbst. Mangel an Reife zur Freiheit kann nur aus Mangel intellektueller und moralischer Kräfte entspringen; diesem Mangel wird allein durch Erhöhung derselben entgegengearbeitet; diese Erhöhung aber fordert Uebung, und die Uebung Selbstthätigkeit erweckende Freiheit. Nur freilich heisst es nicht Freiheit geben, wenn man Fesseln löst, welche der noch nicht als solche, fühlt, welcher sie trägt. Von keinem Menschen der Welt aber, wie verwahrlost er auch durch die Natur, wie herabgewürdigt durch seine Lage sei, ist dies mit allen Fesseln der Fall, die ihn drücken. Man löse also nach und nach gerade in eben der Folge, wie das Gefühl der Freiheit erwacht, und mit jedem neuen Schritt wird man den Fortschritt beschleunigen. Grosse Schwierigkeiten können noch die Kennzeichen dieses Erwachens [184] erregen. Allein diese Schwierigkeiten liegen nicht sowohl in der Theorie, als in der Ausführung, die freilich nie specielle Regeln erlaubt, sondern, wie überall, so auch hier, allein das Werk des Genies ist. In der Theorie würde ich mir diese freilich sehr schwierig verwickelte Sache auf folgende Art deutlich zu machen suchen.
Der Gesetzgeber müsste zwei Dinge unausbleiblich vor Augen haben: 1. die reine Theorie, bis in das genauste Detail ausgesponnen. 2. den Zustand der individuellen Wirklichkeit, die er umzuschaffen bestimmt wäre. Die Theorie müsste er nicht nur in allen ihren Theilen auf das genaueste und vollständigste übersehen, sondern er müsste auch die nothwendigen Folgen jedes einzelnen Grundsatzes in ihrem ganzen Umfange, in ihrer mannigfaltigen Verwebung, und in ihrer gegenseitigen Abhängigkeit einer von der andern, wenn nicht alle Grundsätze auf einmal realisirt werden könnten, vor Augen haben. Eben so müsste er — und dies Geschäft wäre freilich unendlich schwieriger — sich von dem Zustande der Wirklichkeit unterrichten, von allen Banden, welche der Staat den Bürgern, und welche sie sich selbst, gegen die reinen Grundsätze der Theorie, unter dem Schutze des Staats, auflegen, und von allen Folgen derselben. Beide Gemälde müsste er nun mit einander vergleichen, und der Zeitpunkt, einen Grundsatz der Theorie in die Wirklichkeit überzutragen, wäre der, wenn in der Vergleichung sich fände, dass, auch nach der Uebertragung, der Grundsatz unverändert bleiben, und noch eben die Folgen hervorbringen würde, welche das erste Gemälde darstellte; oder, wenn dies nicht ganz der Fall wäre, sich doch voraussehen liesse, dass diesem Mangel alsdann, wenn die Wirklichkeit der Theorie noch mehr genähert wäre, abgeholfen werden würde. Denn dies letzte Ziel, diese gänzliche Näherung müsste den Blick des Gesetzgebers unablässig an sich ziehen.
Diese gleichsam bildliche Vorstellung kann sonderbar, und [185] vielleicht noch mehr, als das, scheinen, man kann sagen, dass diese Gemälde nicht einmal treu erhalten, viel weniger noch die Vergleichung genau angestellt werden könne. Alle diese Einwürfe sind gegründet, allein sie verlieren vieles von ihrer Stärke, wenn man bedenkt, dass die Theorie immer nur Freiheit verlangt, die Wirklichkeit, insofern sie von ihr abweicht, immer nur Zwang zeigt, die Ursach, warum man nicht Freiheit gegen Zwang eintauscht, immer nur Unmöglichkeit sein, und diese Unmöglichkeit hier, der Natur der Sache nach, nur in Einem von folgenden beiden Stücken liegen kann, entweder dass die Menschen, oder dass die Lage noch nicht für die Freiheit empfänglich ist, dass also dieselbe — welches aus beiden Gründen entspringen kann — Resultate zerstört, ohne welche nicht nur keine Freiheit, sondern auch nicht einmal Existenz gedacht werden kann, oder dass sie — eine allein der ersteren Ursach eigenthümliche Folge — die heilsamen Wirkungen nicht hervorbringt, welche sie sonst immer begleiten. Beides aber lässt sich doch nicht anders beurtheilen, als wenn man beides, den gegenwärtigen und den veränderten Zustand, in seinem ganzen Umfang, sich vorstellt, und seine Gestalt und Folgen sorgfältig mit einander vergleicht. Die Schwierigkeit sinkt auch noch mehr, wenn man erwägt, dass der Staat selbst nicht eher umzuändern im Stande ist, bis sich ihm gleichsam die Anzeigen dazu in den Bürgern selbst darbieten, Fesseln nicht eher zu entfernen, bis ihre Last drückend wird, dass er daher überhaupt gleichsam nur Zuschauer zu sein, und wenn der Fall, eine Freiheitsbeschränkung aufzuheben, eintritt, nur die Möglichkeit oder Unmöglichheit zu berechnen, und sich daher nur durch die Nothwendigkeit bestimmen zu lassen braucht. Zuletzt brauche ich wohl nicht erst zu bemerken, dass hier nur von dem Falle die Rede war, wo dem Staate eine Umänderung überhaupt nicht nur physisch, sondern auch moralisch möglich ist, wo also die Grundsätze des Rechts nicht [186] entgegenstehen. Nur darf bei dieser letzteren Bestimmung nicht vergessen werden, dass das natürliche und allgemeine Recht die einzige Grundlage alles übrigen positiven ist, und dass daher auf dieses allemal zurückgegangen werden muss, dass folglich, um einen Rechtssatz anzuführen, welcher gleichsam der Quell aller übrigen ist, niemand jemals und auf irgend eine Weise ein Recht erlangen kann, mit den Kräften, oder dem Vermögen eines andern, ohne oder gegen dessen Einwilligung zu schalten.
Unter dieser Voraussetzung also wage ich es, den folgenden Grundsatz aufzustellen:
Der Staat muss, in Absicht der Gränzen seiner Wirksamkeit, den wirklichen Zustand der Dinge der richtigen und wahren Theorie insoweit nähern, als ihm die Möglichkeit dies erlaubt, und ihn nicht Gründe wahrer Nothwendigkeit daran hindern. Die Möglichkeit aber beruht darauf, dass die Menschen empfänglich genug für die Freiheit sind, welche die Theorie allemal lehrt, dass diese die heilsamen Folgen äussern kann, welche sie an sich, ohne entgegenstehende Hindernisse, immer begleiten; die entgegenarbeitende Nothwendigkeit darauf, dass die, auf einmal gewährte Freiheit nicht Resultate zerstöre, ohne welche nicht nur jeder fernere Fortschritt, sondern die Existenz selbst in Gefahr geräth. Beides muss immer aus der sorgfältig angestellten Vergleichung der gegenwärtigen und der veränderten Lage und ihrer beiderseitigen Folgen beurtheilt werden.
Dieser Grundsatz ist ganz und gar aus der Anwendung des oben, in Absicht aller Reformen, aufgestellten (S. 181.) auf diesen speciellen Fall entstanden. Denn sowohl, wenn es noch an Empfänglichkeit für die Freiheit fehlt, als wenn die nothwendigen erwähnten Resultate durch dieselbe leiden würden, hindert die Wirklichkeit die Grundsätze der reinen Theorie, [187] diejenigen Folgen zu äussern, welche sie, ohne alle fremde Beimischung, immer hervorbringen würden. Ich setze auch jetzt nichts mehr zur weiteren Ausführung des aufgestellten Grundsatzes hinzu. Zwar könnte ich mögliche Lagen der Wirklichkeit klassificiren, und an ihnen die Anwendung desselben zeigen. Allein ich würde dadurch meinen eignen Principien zuwiderhandlen. Ich habe nämlich gesagt, dass jede solche Anwendung die Uebersicht des Ganzen und aller seiner Theile im genauesten Zusammenhange erfordert, und ein solches Ganze lässt sich durch blosse Hypothesen nicht aufstellen.
Verbinde ich mit dieser Regel für das praktische Benehmen des Staats die Gesetze, welche die, im Vorigen entwickelte Theorie ihm auflegte; so darf derselbe seine Thätigkeit immer nur durch die Nothwendigkeit bestimmen lassen. Denn die Theorie erlaubt ihm allein Sorgfalt für die Sicherheit, weil die Erreichung dieses Zwecks allein dem einzelnen Menschen unmöglich, und daher diese Sorgfalt allein nothwendig ist; und die Regel des praktischen Benehmens bindet ihn streng an die Theorie, insofern nicht die Gegenwart ihn nöthigt, davon abzugehn. So ist es also das Princip der Nothwendigkeit, zu welchem alle, in diesem ganzen Aufsatz vorgetragene Ideen, wie zu ihrem letzten Ziele, hinstreben. In der reinen Theorie bestimmt allein die Eigenthümlichkeit des natürlichen Menschen die Gränzen dieser Nothwendigkeit; in der Ausführung kommt die Individualität des wirklichen hinzu. Dieses Princip der Nothwendigkeit müsste, wie es mir scheint, jedem praktischen, auf den Menschen gerichteten Bemühen die höchste Regel vorschreiben. Denn es ist das Einzige, welches auf sichre, zweifellose Resultate führt. Das Nützliche, was ihm entgegengesetzt werden kann, erlaubt keine reine und gewisse Beurtheilung. Es erfordert Berechnungen der Wahrscheinlichkeit, welche noch abgerechnet, dass sie, ihrer Natur nach, nicht fehlerfrei sein können, Gefahr laufen, durch die geringsten [188] unvorhergesehenen Umstände vereitelt zu werden; da hingegen das Nothwendige sich selbst dem Gefühl mit Macht aufdringt, und was die Nothwendigkeit befiehlt immer nicht nur nützlich, sondern sogar unentbehrlich ist. Dann macht das Nützliche, da die Grade des Nützlichen gleichsam unendlich sind, immer neue und neue Veranstaltungen erforderlich, da hingegen die Beschränkung auf das, was die Nothwendigkeit erheischt, indem sie der eigenen Kraft einen grösseren Spielraum lässt, selbst das Bedürfniss dieser verringert. Endlich führt Sorgfalt für das Nützliche meistentheils zu positiven, für das Nothwendige meistentheils zu negativen Veranstaltungen, da — bei der Stärke der selbstthätigen Kraft des Menschen — Nothwendigkeit nicht leicht anders, als zur Befreiung von irgend einer einengenden Fessel eintritt. Aus allen diesen Gründen — welchen eine ausführlichere Analyse noch manchen andern beigesellen könnte — ist kein andres Princip mit der Ehrfurcht für die Individualität selbstthätiger Wesen, und der, aus dieser Ehrfurcht entspringenden Sorgfalt für die Freiheit so vereinbar, als eben dieses. Endlich ist es das einzige untrügliche Mittel den Gesetzen Macht und Ansehen zu verschaffen, sie allein aus diesem Princip entstehen zu lassen. Man hat vielerlei Wege vorgeschlagen, zu diesem Endzweck zu gelangen; man hat vorzüglich, als das sicherste Mittel, die Bürger von der Güte und der Nützlichkeit der Gesetze überzeugen wollen. Allein auch diese Güte und Nützlichkeit in einem bestimmten Falle zugegeben; so überzeugt man sich von der Nützlichkeit einer Einrichtung nur immer mit Mühe; verschiedene Ansichten bringen verschiedene Meinungen hierüber hervor; und die Neigung selbst arbeitet der Ueberzeugung entgegen, da jeder, wie gern er auch das selbsterkannte Nützliche ergreift, sich doch immer gegen das ihm aufgedrungene sträubt. Unter das Joch der Nothwendigkeit hingegen beugt jeder willig den Nacken. Wo nun schon einmal eine verwickelte Lage [189] vorhanden ist, da ist die Einsicht selbst des Nothwendigen schwierieger; aber gerade mit der Befolgung dieses Princips wird die Lage immer einfacher und diese Einsicht immer leichter.
Ich bin jetzt das Feld durchlaufen, das ich mir, bei dem Anfange dieses Aufsatzes, absteckte. Ich habe mich dabei von der tiefsten Achtung für die innere Würde des Menschen und die Freiheit beseelt gefühlt, welche allein dieser Würde angemessen ist. Möchten die Ideen, die ich vortrug, und der Ausdruck, den ich ihnen lieh, dieser Empfindung nicht unwerth sein!
Druck von Heinrich Richter.
Fußnoten.
[1.] Für die nachfolgenden Notizen standen mir keine andren Materialien zu Gebote, als die bereits von Schlesier (Erinnerungen an W. v. Humboldt I. p. 151, 152, 155—157) benutzten. Diese Materialien liegen in einer Anzahl gedruckter Humboltscher Briefe, namentlich an Forster; Erfurt, 1. Juni 1792 (Werke I. p. 293 ff.) und an Schiller; Erfurt, 3. Mai 1792, Auleben 12. September 1792, 7. Decbr. 1792, 14. u. 18. Jan. 1793; die ersten fünf der Briefe, welche in dem „Briefwechsel zwischen Schiller und W. v. Humboldt, Stuttgart und Tübingen 1830“ mitgetheilt sind.
[2.] Wieder abgedruckt: Werke I. p. 301 ff
[3.] Diese Aeusserung findet ihre nähere Erklärung weiterhin in demselben Briefe, wo es von dem Abschnitt über Religion heisst: „wobei ich den Aufsatz, „den Sie kennen, umgearbeitet gebraucht habe.“
[4.] Werke I. p. 349 ff.
[5.] Schiller’s treffliche und geistvolle Schwägerin, die nachherige Frau von Wolzogen, die in dieser ganzen Angelegenheit zwischen Schiller und Humboldt die Mittelsperson gebildet zu haben scheint.
[6.] Jahrgang 1792 Heft 5. — Wieder abgedruckt: Werke II. p. 242 ff. — Dies Stück umfasst den 2ten und einen Theil des 3ten Abschnittes der Schrift.
[7.] Stück 10, 11, 12. Wieder abgedruckt in den Werken. I. p. 312 — 342. — Dem 6ten Abschnitt der in No. 12 erschien „über öffentliche Staatserziehung“ fehlen die ersten Seiten.
[8.] Vergl. die Anmerkung des Herausgebers vor dem Abdruck in No. 10 der Berlinischen Monatsschrift.
[9.] In wie grossem Maassstabe diese Aenderungen vorgenommen werden sollten, geht noch aus einer späteren Aeusserung dieses Briefes hervor: „Auch „kann es sein, dass nach der Umarbeitung nicht einmal die Bogenzahl gleich „bleibt.“
[10.] Vergl. Schlesier. Erinnerungen II, 322 u. 561.
[11.] Ueber das bei der Herausgabe selbst befolgte Verfahren ist nach dem Gesagten kaum noch etwas zu erinnern. Es lag ein vollkommen druckfertiges Manuscript vor, welches sich fast durchweg ohne alle Mühe und mit einiger Sorgfalt überall lesen lässt. [Auffallend ist es, dass Schiller, als er einen Verleger gefunden hat, ein deutlicher geschriebenes Manuscript begehrt. Unsre Setzer könnten sich glücklich preisen, wenn sie nirgends grössere Schwierigkeiten zu überwinden hätten, als das vorliegende darbietet.] Nur in Bezug auf die zuerst in der Berlinischen Monatsschrift gedruckten Abschnitte bedarf es noch einer Bemerkung. Eine Vergleichung des Drucks mit der Handschrift ergiebt nämlich hier eine ganze Reihe von Varianten. Von grosser Erheblichkeit sind sie nirgends. Es sind durchweg lediglich stylistische Abweichungen. — Hier und da zeigt sich in den Lesarten des Drucks die Tendenz, kleine Härten der Urschrift auszumerzen. Dass sie überall Verbesserungen enthielten, lässt sich aber durchaus nicht sagen. In vielen Fällen hat mir das Gegentheil geschienen. Oft sind es Modificationen des Ausdrucks, die eben so wenig für sich wie gegen sich haben. Unter diesen Umständen hat es sich als das Gerathenste erwiesen, überall streng der Lesart des Manuscripts zu folgen. Um eine Angabe der Varianten beizufügen, dafür erschien die ganze Differenz von zu geringem Belang. Immerhin bliebe es interessant zu wissen, woher die Abweichungen der Abschrift stammen, aus der der Berliner Druck hervorgegangen ist.
[12.] In den von Pertz herausgegebenen „Denkschriften des Ministers Freiherrn vom Stein über deutsche Verfassungen.“ Berlin 1848; ist auch eine ausführliche Denkschrift Wilh. v. Humboldts über Preussens ständische Verfassung mitgetheilt (p. 97—175) datirt von Frankfurt, den 4. Februar 1819. Es lässt sich rücksichtlich der ganzen Anlage und der schriftstellerischen Intention kaum ein grösserer Gegensatz denken, als zwischen dieser Denkschrift und unseren „Ideen.“ Dort durchweg das engste Anschliessen an die Wirklichkeit, die strengste Beschränkung auf das unter den gegebenen Verhältnissen Ausführbare, — eine durchaus praktische Tendenz; — hier eine ausdrückliche Verleugnung dieser Rücksichten, der kühnste und freieste Schwung zum Idealen hin. Hier bewegt sich Alles um die Bestimmung des Inhalts der Staatsgewalt, dort um die Formen. Um so bemerkenswerther ist die Verwandtschaft in den Grundanschauungen des Staatslebens, die durch alle diese Verschiedenheit hindurch für Jeden, der nur ein Auge für dergleichen hat, wahrnehmbar ist. In beiden Schriften dieselbe Hervorhebung des Bestrebens, die sittliche Kraft der Nation zu steigern, das individuelle Leben zu höherer Geltung zu bringen, das Regieren zu vereinfachen, Thätigkeit und Energie an die Stelle der Passivität und der Trägheit zu setzen. Selbst in gewissen besonders hervortretenden Abneigungen zeigt sich in beiden Schriften eine auffallende Uebereinstimmung, namentlich in dem Misfallen an dem hohlen formalen Wesen einer allmächtigen sich überhebenden Büreaukratie.
[13.] Denkwürdigkeiten und vermischte Schriften. V. p. 118 ff
[14.] Unter den bisher ungedruckten Abschnitten unsrer Schrift ist mir als der merkwürdigste der von der Religion handelnde erschienen. Wie eingehend und mit wie viel innerer Wahrheit sind die verschiedenen religiösen Standpunkte charakterisirt; und wie deutlich tritt es doch hervor, wo Humboldt mit seinem eignen Pathos ist! Wie treffend ist Alles, was über die Stellung des Staates zur Religion gesagt ist! Noch eine besondre Bedeutung gewinnt dieser Abschnitt, wenn man bedenkt, dass nicht lange, ehe er geschrieben wurde, das Wöllner’sche Religionsedict erschienen war (1788). Die Beziehungen auf die durch dasselbe in Preussen herbeigeführten Zustände, die Humboldt während seiner kurzen praktischen Thätigkeit in Berlin zur Genüge hatte kennen lernen, sind ganz unverkennbar. Sollte wohl unter diesen Umständen die Vermuthung zu gewagt sein, dass grade diese Parthie für die Censur der Hauptgrund des Anstosses war?
[15.] Dieses Urtheil kann natürlich nur von der Schrift als einem Ganzen gelten. Der Werth der einzelnen Theile ist ein sehr verschiedener, und wächstziemlich genau nach dem Maasse des inneren Abstandes von dem Grundgedanken. Eine Bemerkung, die ungefähr so auch schon Schlesier gemacht hat in der Würdigung unsres Aufsatzes, die er auf Grund der ihm vorliegenden Stücke desselben giebt, und die durch die vollständige Betrachtung, wie sie jetzt möglich ist, lediglich bestätigt werden kann. Darin aber ist Schlesier ganz und gar irre gegangen, dass er die politischen Elemente der Schrift als ihr innerlich fremde, nur in Folge des äusseren von Dalberg gegebenen Anstosses hineingekommene bezeichnet. Der politische Gedanke bildet die Seele des Ganzen, — und es ist so wenig wahr, dass Humboldts Ideen nur vorübergehend wider ihre Natur durch Dalberg die politische Richtung genommen hätten, — dass vielmehr augenscheinlich diese politische Richtung, seitdem er überhaupt selbständig zu denken angefangen, in ihm die vorherrschende gewesen war. — Und wie hätte es anders sein können? Seine ganze Erziehung war darauf angelegt, ihn für den Staatsdienst vorzubereiten; in demselben Sinne hatte er seine Universitätsstudien gemacht. — Er war in Göttingen mit Forster bekannt geworden, und diese politisch durch und durch aufgeregte Natur hatte ihm mächtig imponirt. Dazu nun noch die Eindrücke der französischen Revolution, die er bei seinem Aufenthalte in Paris während des Sommers 1789 in unmittelbarster Nähe auf sich hatte wirken lassen; — endlich der Beginn seiner juristischen Laufbahn. — Zu dieser Natur seines bisherigen Lebensganges stimmt es nun auch vollkommen, dass Humboldt in einem der oben herangezogenen Briefe an Schiller im Gegensatze zu diesem das Studium der öffentlichen Angelegenheiten ausdrücklich als seinen Beruf bezeichnet, während er Wolf gegenüber im Beginne seiner Correspondenz mit ihm ebenso unverkennbar als ein Laie in philologischen Dingen erscheint. — Der Zeitpunkt, von dem an in Humboldts Gedanken und Studien Kunst, Alterthum, Sprache, Geistesleben diejenige Stelle einnehmen, die vorher Recht, Staat, die äusseren Verhältnisse des Menschen eingenommen haben, lässt sich sehr genau bestimmen. Er fällt unmittelbar nach Vollendung der vorliegenden Schrift. Es fehlt schon in ihr nicht an Stellen, die diese Veränderung ankündigen. Sie sind grossentheils grade die interessantesten und schönsten. Aber man würde nichts desto weniger sehr unrecht thun, in ihnen den Schwerpunkt von Humboldts damaligem Gedankensysteme zu suchen.
[16.] Vergl. besonders: Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre. Königsberg 1797. Dann die schon vorher, 1795 erschienene Abhandlung: Zum ewigen Frieden; endlich: Der Streit der Fakultäten. Königsberg 1798, wo namentlich das über das Verhältniss der Staatsregierung zur Religion Gesagte interessante Vergleichungspunkte darbietet.
[17.] Nie ist dieser Unterschied auffallender, als wenn alte Philosophen von neueren beurtheilt werden. Ich führe als ein Beispiel eine Stelle Tiedemanns über eins der schönsten Stücke aus Platos Republik an: Quanquam autem per se sit iustitia grata nobis: tamen si exercitium eius nullam omnino afferret utilitatem, si iusto ea omnia essent patienda, quae fratres commemorant; iniustitia iustitiae foret praeferenda; quae enim ad felicitatem maxime faciunt nostram, sunt absque dubio aliis praeponenda. Jam corporis cruciatus, omnium rerum inopia, fames, infamia, quaeque alia evenire iusto fratres dixerunt, animi illam e iustitia manantem voluptatem dubio procul longe superant, essetque adeo iniustitia iustitiae antehabenda et in virtutum numero collocanda. Tiedemann in argumentis dialogorum Platonis. Ad 1. 2. de republica.
[18.] Kant über das höchste Gut in den Anfangsgründen der Metaphysik der Sitten [genauer: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Riga 1785], und in der Kritik der praktischen Vernunft.
[19.] Το οικειον ἑκαστῳ τῃ φυσει, κϱατιστον και ἡδιστον εσϑ̕ ἑκαστῳ και τῳ ανϑρωπῳ δη ὁ κατα τον νουν βιος, ειπερ μαλιστα τουτο ανϑρωπος, οὑτος αρα και ευδαιμονεστατος. Aristotelis Ηϑικων Νικομαχ. l. X. c. 7. in fin.
[20.] Blüthe, Reife. Neues deutsches Museum, 1791. Junius, 22, 3.
[21.] Göthe, über die Metamorphose der Pflanzen.
[22.] Eben dies bemerkt einmal Rousseau im Emil
[23.] (†) Göthe’s Torquato Tasso II. 1.
[24.] Was ich hier umschreibe, bezeichnen die Griechen mit dem einzigen Worte πλεονεξια, für das ich aber in keiner andern Sprache ein völlig gleichbedeutendes finde. Indess liesse sich vielleicht im Deutschen: Begierde nach Mehr sagen; obgleich dies nicht zugleich die Idee der Unrechtmässigkeit andeutet, welche in dem griechischen Ausdruck, wenn gleich nicht dem Wortsinne, aber doch (so viel mir wenigstens vorgekommen ist) dem beständigen Gebrauch der Schriftsteller nach, liegt. Passender, obgleich, wenigstens dem Sprachgebrauche nach, wohl auch nicht von völlig gleichem Umfang, möchte noch Uebervortheilung sein.
[25.] La sureté et la liberté personelle sont les seules choses qu’un être isolé ne puisse s’assurer par lui même. Mirabeau s. l’éducat, publique. p. 119.
[26.] Reges (nam in terris nomen imperii id primum fuit) cet. Sallustius in Catilina. c. 2. Κατ̕ αϱχας ἁπασα πολις Ελλας εβασιλευετο. Dion. Halicarn. Antiquit. Rom. 1. 5. (Zuerst wurden alle griechische Städte von Königen beherrscht u. s. f.)
[27.] Ὁντινα τιμησουσι Διος κουϱαι μεγαλοιο, Γεινομενον τ̕ εσιδωσι διοτϱεφεων βασιληων, Τῳ μεν επι γλωσσῃ γλυκεϱην χειουσι εε̃ ϱσην, Του δ̕ επε̕ εκ στοματος ϱει μειλιχα.und Τουνεκα γαϱ βασιληες εχεφϱονες, ὁυνεκα λαοις Βλαπτομενοις αγοϱῃφι μετατϱοπα εϱγα τελευσι Ρηϊδιως, μαλακοις παϱαιφαμενοι επεεσσιν. Hesiodus in Theogonia. [v. 81 sqq. 88 sqq.](Wen der götterentsprossenen Könige Zeus des Erhabnen Töchter ehren, auf wen ihr Auge bei seiner Geburt blickt, Dem beträufeln sie mit holdem Thaue die Zunge, Honigsüss entströmet seinen Lippen die Rede.und Darum herrschen verständige Könige, dass sie die Völker, Wenn ein Zwist sie spaltet, in der Versammlung zur Eintracht Sonder Mühe bewegen, mit sanften Worten sie lenkend.)
[28.] (†) Göthe in dem Gedicht: Grenzen der Menschheit. II. p. 69. (Ausg. v. 1840.)
[29.] (†) Diese sind nämlich so gebildet, dass ihnen der Tod nicht als etwas Schreckliches erscheint, sondern als das Gegentheil. Republ. III. init.
[30.] (†) An essay on the history of civil society. Basel 1789. p. 123—146. Of rude nations prior to the establishment of property.
[31.] Dans une société bien ordonnée, au contraire, tout invite les hommes à cultiver leurs moyens naturels: sans qu’on s’en mêle, l’éducation sera bonne; elle sera même d’autant meilleure, qu’on aura plus laissé à faire à l’industrie des mâitres, et à l’émulation des élèves. Mirabeau s. l’éducat. publ. p. 12.
[32.] Ainsi c’est peut-être un problême de savoir, si les législateurs Français doiveut s’occuper de l’éducation publique autrement que pour en protéger les progrès, et si la constitution la plus favorable au développement du moi humain et les lois les plus propres à mettre chacun à sa place ne sont pas la seule éducation, que le peuple doive attendre d’eux. l. c. p. 11. D’après cela, les principes rigoureux sembleraient exiger que l’Assemblée Nationale ne s’occupât de l’éducation que pour l’enlever à des pouvoirs, ou à des corps qui peuvent en dépraver l’influence. l. c. p. 12.
[33.] (†) Göthe. Prometheus II. p. 63. (Ausg. v. 1840.)
[34.] (†) Kritik der Urtheilskraft. 2te Aufl. (Berlin 1793). p. 220 f.
[35.] (†) Kritik der Urtheilskraft p. 211. ff.
[36.] (†) 2. Aufl. (Berlin 1793) p. 172. Kant nennt die Modificationen des Lichts in der Farbengebung eine Sprache, die die Natur zu uns führt und die einen höheren Sinn zu haben scheint. „So scheint die weisse Farbe der Lilie das Gemüth zu Ideen der Unschuld, und nach der Ordnung der sieben Farben, von der rothen an bis zur violetten, 1) zur Idee der Erhabenheit, 2) der Kühnheit, 3) der Freimüthigkeit, 4) der Freundlichkeit, 5) der Bescheidenheit, 6) der Standhaftigkeit, und 7) der Zärtlichkeit zu stimmen.“
[37.] F. v. Dalberg vom Bilden und Erfinden.
[38.] Es könnte scheinen, als gehörten die hier angeführten Fälle nicht zu dem gegenwärtigen, sondern mehr zu dem folgenden Abschnitt, da sie Handlungen betreffen, welche sich geradezu auf den andern beziehn. Aber ich sprach auch hier nicht von dem Fall, wenn z. B. ein Arzt einen Kranken wirklich behandelt, ein Rechtsgelehrter einen Prozess wirklich übernimmt, sondern von dem, wenn jemand diese Art zu leben und sich zu ernähren wählt. Ich fragte mich ob der Staat eine solche Wahl beschränken darf, und diese blosse Wahl bezieht sich noch geradezu auf niemand.
[39.] Sehr vieles in dem vorigen Raisonnement habe ich aus Mirabeaus Rede über eben diesen Gegenstand entlehnt; und ich würde noch mehr davon haben benutzen können, wenn nicht Mirabeau einen, der gegenwärtigen Absicht völlig fremden, politischen Gesichtspunkt verfolgt hätte. S. Collection complette des travaux de Mr. Mirabeau l’ainé à l’Assemblée nationale. T. V. p 498—524.
[40.] Thl. 2. Tit. 20. §. 95.